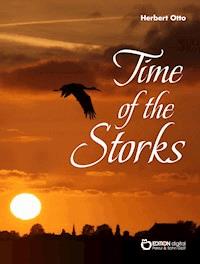8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jetzt ist der junge Soldat Alfred Haferkorn ein Gefangener der Russen und ihnen mit seiner schrecklichen Angst vor Entdeckung ausgeliefert. Er will die Bilder zurückdrängen, denn er hat gar nicht auf die Partisanen geschossen, aber das junge Mädchen, die beiden Männer, sie erscheinen immer wieder vor seinem inneren Auge. In höchster Not lügt er, nennt ein falsches Regiment. Eines Tages taucht Major Krebs im Lager auf, unter anderem Namen. Er hat den Erschießungsbefehl erteilt, und Haferkorn will nicht zulassen, dass Krebs ungeschoren davonkommt. Herbert Otto wendet sich in seinem ebenso spannenden wie wahrhaftigen Buch der Realität des Gefangenenalltags deutscher Soldaten in sowjetischen Lagern zu. Hunger, Typhus, Korruption, Selbstmord und verzweifelte Fluchtversuche sind der Alltag, aus dem heraus allmählich die Ahnung einer künftigen sinnvollen Existenz wächst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum
Herbert Otto
Die Lüge
Roman
ISBN 978-3-95655-315-8 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1956 im Verlag Kultur und Fortschritt, Berlin und wurde in mehrere Sprachen übersetzt.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2015 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Erste Begegnung
Tagsüber blieb der Schlagbaum geöffnet. Er stach schräg in den Himmel, wie ein vom Wind geneigter Fahnenmast, und war mit Lackfarbe schwarz-weiß-rot gestrichen. Der Lack war zu dick aufgetragen und fing an abzublättern. Staub deckte die Farben mit einem schmutzig grauen Schleier.
Alles war staubig: die Sträucher am Straßenrand, das Laub der Bäume und auf dem Felde die Maisstauden, deren Blätter dürr und braun und kraftlos herunterhingen. Seit Anfang August - das waren jetzt mehr als zwei Wochen - hatte es kaum eine Wolke am Himmel gegeben. Selbst die Lehmhäuser des Dorfes schienen von der Sonnenglut entkräftet. Sie duckten sich schief unter ihren Strohdächern, als sei die Last ihnen zu schwer geworden.
Remanowka lag zehn Kilometer westlich des Dnestr, dessen Ufer seit Wochen Fronten dieses Krieges waren. Noch nie hatte das Dorf so viele Menschen beherbergt, nie war es so arm gewesen, mit sich selbst so zerfallen wie in diesem Sommer.
Fremde Soldaten, Angehörige des 28. Infanterieregiments, lagen in den niedrigen Stuben der Häuser und hatten Höfe und Schuppen mit Gerätschaften vollgestellt. Die Einheimischen bewohnten die Ställe. Andere hatten zu nächtlicher Stunde ihre Höfe verlassen und waren in den benachbarten Wald gegangen, um sich den Partisanen anzuschließen.
Die staubgraue Straße, die von Süden kam, schnurgerade, und das Dorf in zwei gleiche Hälften teilte, lief dann kilometerweit durch den Wald bis zum Dnestr. Deutsche Lastkraftwagen holperten über die Straße, in beiden Richtungen. Sie fuhren stets in langer Kolonne, weil es im Wald bei Remanowka auf Leben und Tod ging. Sie fuhren nur tagsüber, denn es lag der Befehl vor, die Straße durch den Wald sei während der Nacht gesperrt.
Am nördlichen Dorfausgang, einen Kilometer von der Stelle entfernt, wo die Straße im Wald verschwand, hatte man darum den Schlagbaum errichtet, der tagsüber geöffnet blieb und wie ein Fahnenmast in den blauen Himmel stach.
Haferkorn stand an diesem Mittag beim Schlagbaum Posten. Er musste in der prallen Sonne stehen, denn bis zum Schatten des nächsten Baumes waren es dreißig Schritt, und dass die Sonne den Schatten um so viel näher rücken würde, brauchte er nicht abzuwarten. Wie weit er sich beim Auf und Ab vom Schlagbaum entfernen durfte, war nicht genau festgelegt, und Haferkorn gehörte nicht zu den Ängstlichen. Doch heute schienen ihm dreißig Schritt ein Wagnis, das er besser nicht unternahm. Er blieb in der Sonne, verfluchte sein Missgeschick, Hitze und Himmel und die Schweißtropfen, die überall am Körper hinunterliefen. Manchmal setzte er für Sekunden den Stahlhelm ab und wischte mit dem Taschentuch über Gesicht und Nacken.
Heute dünkte ihn die Hitze dichter und drückender, das Sonnenlicht, das von unten her, aus dem Straßenstaub, in seine Augen drang, schien heute greller als gewöhnlich. In Abständen blickte er auf seine Uhr: auch die Zeit verging langsamer als sonst. Haferkorn war fast ein Jahr Soldat, aber er hatte sich bis heute nicht daran gewöhnt, ohne Recht und Maß von jedermann, dem es gefiel, bestraft und gedemütigt zu werden. Mit einer unverdienten Kränkung kam er nicht so schnell zurecht wie manch einer. Er hatte die Feldwebelstimme von heute Morgen noch im Ohr: „Eine Woche Nachtwache! Sie! Sie Arschloch, Sie!“ Eine Stimme wie Gänseschnattern.
Das war so gekommen. Er sollte den Morgenkaffee für das Wachkommando holen. „Wenn keiner gehen will, geht eben der Jüngste!“, hatte der Fähnrich gesagt. Der war selber erst zwanzig, aber Alfred ging. Er hatte sechs Kochgeschirre genommen, in jede Hand drei. An der Küche hatte ein Feldwebel gestanden. Haferkorn hatte ihn gegrüßt, aber nicht weiter beachtet. Er ließ die Kochgeschirre füllen und wollte zurück. Da rief der Feldwebel ihn an: „Zeigen Sie mal her!“ Er wies auf die Kochgeschirre, bückte sich und schielte schräg auf den Kaffee. Alfred sah, dass es der Offizier vom Dienst war. „Sehen Sie sich das an!“, sagte er.
Was zum Teufel wollte der Kerl? Alfred musste eine geistlose Miene gemacht haben, denn der Mann brüllte: „Sie sollen sich das ansehen! Was ist das? Wie?“
Alfred blickte flüchtig hinunter auf die Gefäße und sagte: „Kaffee, Herr Feldwebel!“
„Das sehe ich, Sie Idiot!“ Der andere war dicht herangekommen. Alfred bekam Speichelspritzer ins Gesicht.
„Wie heißen Sie?“ Der Feldwebel hatte Notizbuch und Bleistift schon in der Hand.
„Schütze Haferkorn!“
„Und weiter, weiter.“ Er schrieb und sagte: „Ich mach euch Beine! Passt mal auf!“
„Dritte Kompanie, zweiter Zug“, sagte Haferkorn.
„So!“ Der Feldwebel klappte das Buch zu. „Sehen Sie sich den Kaffee an! Was suchen die Fettaugen da? Seit wann hat Kaffee fettig zu sein? Wie? Was ist das für ein Gesöff? Das ist Brühe! Dreckschweine! Ich bring euch Ordnung bei! Verstanden?“
„Jawohl, Herr Feldwebel!“, sagte Haferkorn. „Aber ich ...“
„Maul halten!“ Die Feldwebelstimme kippte über. Der ganze Mann, auf die Zehenspitzen gehoben, drohte vornüberzukippen. „Sie Arschloch, Sie! Eine Woche Nachtwache außer der Reihe! Sie melden sich heute Abend!“
Haferkorn hatte abtreten dürfen. Dann überzeugte er sich: in einem der Kochgeschirre schwammen tatsächlich Fettaugen auf dem Kaffee. Die Kameraden in der Wachstube lachten ihn aus. Es stellte sich heraus, dass das Kochgeschirr mit den Fettaugen dem Fähnrich Weirosta gehörte. Er sagte nebenher: „Mein Putzer ist ein Drecksack. Ich weiß. Ich brauche einen anderen. Wie wär’s, Haferkorn?“
„Ich glaube nicht, dass ich das nötige Geschick habe“, sagte Haferkorn.
„Schade! Aber wegen der Strafwache werde ich zusehen!“
Es war ein schwacher Trost für Haferkorn, dass der Fähnrich zusehen werde. Den ganzen Vormittag über würgte ihn die Wut. Er kam sich erniedrigt und ohnmächtig vor. Der Fähnrich hatte ihm die Putzerstelle angeboten ...! Alfred spuckte aus, obwohl er ohnehin eine trockene Kehle hatte, und sagte: „Scheiße!“ Einen der Steine, die auf der Straße lagen, stieß er kräftig mit dem Fuß. Staub spritzte auf ...
Alfred blickte die Straße hinunter, nach Süden über das Dorf hin, wo schon minutenlang eine dichte graue Wolke stand. Die Wolke wuchs an, ein Brummen füllte die Luft. Er sah einen Lastwagen, den ersten einer Kolonne, der schnell näher kam und schließlich an ihm vorüberdröhnte. Dann den zweiten ... Alles war in Staub gehüllt, die Sonne, der Himmel, er selbst. Er schloss die Augen fest, kniff die Lippen aufeinander und ließ den Staub über sich ergehen. Der Motorenlärm bestand aus einzelnen Wogen, die anschwollen und wieder abebbten. Alfred zählte daran die Wagen ... zwölf ... dreizehn ... Er hatte doch Staub zwischen die Zähne bekommen und biss knirschend darauf herum. Er atmete in kurzen Zügen. Benzingestank. Er stellte sich vor, wie blauschwarze Schwaden ihn umgaben. Es schwirrte und dröhnte unter seinem Stahlhelm. Er stand und zählte immer noch ... achtzehn... neunzehn ... zwanzig ...
Etwa zehn Minuten später - das Brummen der Autokolonne war längst im Wald verschollen, der Staub war verflogen - hörte Alfred die Salve eines Maschinengewehrs. Ferne Schüsse oder dumpfes Grollen hörte man oft. Die Front brachte sich zuweilen in Erinnerung, wie ein Tier, das auf der Lauer lag und knurrte. Doch die Salve eben war deutlicher gewesen. Auch folgten die einzelnen Schüsse nicht so rasch aufeinander. Man sagte, die russischen MGs schössen langsamer, und so elegant wie die deutschen wären sie auch nicht ... Sie funktionierten dafür besser, sagte man ... Jetzt wieder Schüsse ... eine lange Kette, in die eine zweite geflochten wurde, und dann eine Detonation.
Es blieb eine Weile still. Alfred blickte zum Haus hinüber, wo das Wachkommando untergebracht war. Zwischen den Sträuchern hindurch erkannte er einige der Kameraden vor der Tür. Es beruhigte ihn, dass er nicht allein war, er konnte die anderen wenigstens sehen.
Seit drei Wochen befand er sich in Remanowka. Er hatte zu den Besatzungstruppen in Südfrankreich gehört, hatte dann Urlaub gehabt und war hierhergekommen, in die unmittelbare Nachbarschaft des Feindes, den er fürchtete, ohne ihn je gesehen zu haben. Er brannte nicht darauf, diesen Feind zu sehen, ihm bewaffnet gegenüberzutreten mit der Aussicht, getötet zu werden. Mit Neunzehn stirbt man nicht gern. Man setzt nur unter Zwang sein Leben aufs Spiel, wenn man nicht weiß warum ... Von den roten Heckenschützen, den Partisanen, war viel geredet worden: allerlei Schauergeschichten, wonach nichts grausiger sein konnte, als ihnen lebend in die Hände zu fallen.
Kürzlich hatte einer auf der Stube erzählt - Alfred erinnerte sich fast noch an jedes Wort: „... letzten Sommer! So ein Dorf am Dnepr. Wir wissen, die Bande kann bloß im Dorf stecken! Wer ist Herr im Hause, sagt der Hauptmann. Kurzen Prozess machen! Wir umzingeln das Dorf ... Zirkuspatronen her, die weißen ... und sollst mal sehen, wie das geknistert hat! Wer nicht verbrennen wollte, kam rausgelaufen auf die Straße ... Weiber wie die Fackeln oder die Fetzen schon runtergerissen ... und dann: immer gib ihm ... mit MG ... Paar Tage hatten wir Ruhe, dann ging das wieder los!“ Der Mann hatte sich geschüttelt und einen Trinkbecher voll Kognak hinuntergekippt. Mit hastigem Blick hatte Alfred die Gesichter der anderen abgesucht: er hatte den Eindruck gehabt, ein Gefühl sei hier nicht angebracht, nicht männlich genug, nicht kriegerisch ...
Jetzt wurde im Wald wieder geschossen. Alfred sah den langen Fähnrich aus dem Hause laufen. Er hörte ihn rufen: „Wache raustreten!“ Eine neue Detonation übertönte die Schießerei. Am Horizont schraubte sich ein Rauchpilz in den blauen Himmel. Die Wache war rausgetreten. Der Stahlhelm, den der Fähnrich aufhatte, hüllte fast den ganzen Kopf ein und schlenkerte wie ein Paletot. Der Fähnrich ließ die Leute beiderseits der Straße ausschwärmen. Er brüllte Haferkorn an: „Deckung! Mensch!“ Über das Dorf wurden Leuchtraketen abgeschossen. Wenn der Lärm des Gefechts aus dem Walde für Sekunden verstummte, hörte man im Dorf Kommandorufe. Der Fähnrich kam und angelte den Schlagbaum herunter.
Nach wenigen Minuten schien das Feuergefecht abzusterben. Da, wo die Straße im Wald verschwand, tauchte plötzlich ein Lastwagen auf. Er kam in rasender Fahrt heran, hüpfend, auf eine Seite geneigt. Er zog Staubschwaden hinter sich her. Die Reifen eines Hinterrades waren zerschossen, ebenso Kühler und Scheiben. Auf beiden Trittbrettern standen Soldaten; sie winkten und riefen etwas. Der Wagen bremste. Er kam nicht früh genug zum Stehen und fuhr den Schlagbaum nieder. Fünfzehn bis zwanzig Soldaten sprangen vom Wagen, dreckverschmiert, Entsetzen in den Gesichtern. Die meisten ließen sich sofort am Straßenrand nieder, um zu rauchen. Der Unteroffizier, der aus dem Fahrerhäuschen gesprungen war, schrie: „Ist jemand verwundet?“
Niemand gab Antwort. Die Männer schienen taub und stumm zu sein. Oben auf dem Wagen standen noch zwei, das Gewehr in der Hüfte. Es sah aus, als trauten sie sich nicht herunter. „Hier liegt ein Verwundeter!“, sagte einer der beiden zu dem Unteroffizier.
„Der muss runter! Der Wagen ist im Arsch!“
„Und die drei Vögel hier?“, fragte der Mann auf dem Wagen. „Auch runter!“ Der Unteroffizier wandte sich an Weirosta. „Wir haben Gefangene. Drei Stück! Wo kann man sie hintun?“
„Drüben ist ein Schuppen. Ich stell zwei Mann dazu!“ Weirosta neigte den Kopf in Richtung des Waldes. „Was ist mit den anderen?“
„Die Hölle war los! Alles im Arsch!“
Der Rauchpilz über dem Wald war angewachsen. Eine riesige Faust.
Der verwundete Soldat wurde in den Straßengraben gebettet. Er jammerte. Auf dem Wagen, in der dunklen Öffnung des Verdecks, erschien der erste der Gefangenen. Alfred konnte sein Gesicht nur flüchtig sehen. Ein junges Gesicht, dunkelgebrannt und mager. Der Gefangene bekam einen Stoß und fiel vom Wagen. Er stand schneller wieder aufrecht, als man vermutet hätte, denn er konnte nur einen Arm gebrauchen. Der linke baumelte am Körper wie ein Ärmel. Über dem Ellenbogen war er verbunden, offenbar mit Fetzen, die aus dem graubraunen Hemd herausgerissen waren. Der Russe fuhr sich mit der Hand über den Mund, als sei nichts geschehen. Einer der beiden Soldaten sprang herunter und beeilte sich, sein Gewehr wieder auf den Gefangenen zu richten. Der blickte angestrengt in das Innere des Wagens und streckte seinen gesunden Arm aus ... Jetzt erschrak Haferkorn. Er sah die beiden anderen Gefangenen. Einer schien schwer verwundet. Er wurde gestützt, eher geschleppt als gestützt ..., und Alfred sah das Mädchen, das den Verwundeten Schritt für Schritt aus dem Dunkel des Wagens heranschleppte ... es war ein junges Mädchen ... der andere schien bewusstlos zu sein. Alfred starrte das Mädchen an. Blondes, kurz geschnittenes Haar fiel ihr in die Stirn ... warum half ihr denn keiner ... was wollte das Mädchengesicht hier ... in dieser Hölle? ... Außer ihr gab es jetzt nichts für ihn. Er sah, wie sie vom Wagen sprang, das Haar aus der Stirn schob, mit einer halben Bewegung ... wie sie schnell einen Arm des Verwundeten über ihre Schulter zog.
„Hier! Schütze Haferkorn! Los! Abführen die drei! In den Schuppen drüben! Und nicht aus den Augen lassen! Verstanden?“ Das war die Stimme des Fähnrichs. „Ich schicke noch einen Mann!“ Den Gefangenen befahl er mit einer Geste, die Straße entlang zu gehen.
Ohne dem Fähnrich geantwortet zu haben, folgte Alfred der Gruppe.
„Vielleicht nehmen Sie das Gewehr von der Schulter! Sie Träne!“
Alfred nahm das Gewehr in die Hüfte. Er ging unsicher, wie im Traum ... Er hatte die Russen zu bewachen, die vor ihm durch den Straßenstaub schlurften ... Es waren Feinde! Er spürte Mitleid statt Feindseligkeit und konnte dagegen nicht an ..., wollte auch nicht ...
Das Mädchen trug Tuchstiefel und Hosen wie die anderen. Sie war zart und klein. Der Verwundete hing schief zwischen den beiden ... Er versuchte jetzt, selbst zu laufen. Sein Hemd war wie ein Brustwickel um den Leib gebunden. Der Schweiß perlte auf seiner Haut und glänzte staubig.
Sie mussten in Höhe des Hauses von der Straße abbiegen. Haferkorn ging voraus. Er öffnete die Schuppentür und stellte sein Gewehr gegen die Bretter. Er stieß Körbe zur Seite, einen Trog, der da stand, und breitete auf dem Boden Säcke aus. Er wollte helfen, den Verwundeten hinzulegen. Doch die beiden ließen ihn zu keinem Handgriff kommen. Er hatte das Gefühl, seine Mithilfe sei ihnen unerwünscht.
Neben dem Verwundeten kniete das Mädchen, fuhr mit der Hand über seine Stirn und betastete den Verband. Das Blut war bereits durch den Stoff gesickert. Jetzt regte sich der Mann. Eröffnete sogar die Augen einen Spalt breit. Die Kühle schien ihm gut zu tun. Das Mädchen beugte sich über ihn und flüsterte und strich wieder über seine Stirn ... Er wollte ihre Hand fassen und hatte keine Kraft ...
Plötzlich stand sie auf und ging ein paar Schritte weiter in den Schuppen hinein. Sonne fiel in Streifen schräg durch das Schuppendach. Das Mädchen öffnete den Leibriemen. Sie zog ihre Bluse über den Kopf. Ein weißes ärmelloses Hemd hatte sie an ... Alfred sah sie jetzt deutlich vor dem Dunkel des Raumes stehen. Sie streifte auch das Hemd ab ... die schmalen Finger der Sonne berührten ihre Haut an den Armen, am Rücken ... Alfred spürte plötzlich das Gewehr in seiner Hand ... was sollte er damit? ... War überhaupt Krieg? ... Gab es Feinde? ... Das Mädchen war unversehrt geblieben.
Als sie zurückkam, versuchte er ihren Blick zu fangen. Er hatte das schon wiederholt versucht: sie hatte hartnäckig ihren Blick verweigert, so, als trüge sie ihm etwas nach ...
„Ist das hier richtig, wo die Gefangenen sind?“ Der Mann, den Weirosta hatte schicken wollen, war gekommen und stand in der Schuppentür. Alfred sah ihn rasch an, gab aber keine Antwort.
Er verfolgte, wie das Mädchen ihr Hemd in Streifen riss. In einem Zipfel seiner Feldbluse steckte das Verbandzeug. Er griff danach und fühlte das Päckchen. Er wandte den Kopf zur Tür, wo der andere stand, und sagte: „Ich gebe ihnen mein Verbandzeug!“
„Ob das erlaubt ist? Wenn das einer sieht!“
„Erlaubt! Wer sieht’s denn? Und du hältst die Schnauze! Ich sag dir, halt die Schnauze!“
Alfred ging auf das Mädchen zu, reichte ihr das Päckchen und sagte: „Schnell!“
Jetzt traf ihr Blick ihn. Aber so viel Kälte in ihren Augen hatte er nicht erwartet. Ihr Blick drang bis in die Fingerspitzen, und es schien, als wollte er die Hand müde machen, die das Päckchen hielt. Alfred riss die Stoffhülle herunter, und sie nahm schließlich die Binde.
„Gib deins noch her! Los!“, sagte Alfred zu dem Soldaten an der Schuppentür.
„Die buchten uns ein ...“
„Quatsch nicht! Gib her! Schnell!“
Der Gefangene bekam einen ordentlichen Verband. Haferkorn holte noch sein Kochgeschirr aus der Wachstube und brachte Wasser. Der Verwundete trank. Das Wasser schien ihn zu beleben. Doch bald darauf lag er wieder kraftlos, anscheinend ohne Bewusstsein.
„He, Soldat!“, rief die Partisanin. „Doktor nix?“
Alfred hob die Schultern und nickte gleichzeitig mit dem Kopf. Er fand ihren Blick weniger abweisend, versöhnlicher als zuvor. Wenn sie von ihm verlangt hätte, er möchte sie fliehen lassen ... zurück in den Wald ..., aber sie hatte nach einem Doktor verlangt!
Haferkorn lief auf die Straße, um Weirosta zu suchen. Er fand ihn in der Wachstube.
„Herr Fähnrich …“, Alfred musste erst Luft schöpfen, „... die Gefangenen ...“
„Was ist?“
„... Die Gefangenen ... einer ist schwer verwundet ... sie bitten um einen Doktor …“
„Was bitten sie?“
„Um einen Doktor!“
Der Fähnrich stand langsam auf und schwieg und stierte Haferkorn an. „Wer hat Ihnen erlaubt, Ihren Posten zu verlassen? Wie?“ Er brüllte jetzt. „Antwort! Soll ich Sie einsperren lassen? Scheren Sie sich weg!“
Alfred ging zurück in den Hof. Er traute sich nicht in den Schuppen. Er saß auf einer Kiste im Hof, stand auf und setzte sich wieder. Aber schließlich ging er doch hinein zu den Gefangenen, und er sagte zu dem Mädchen: „Doktor kommt!“ Er wollte ihr etwas Tröstliches sagen.
Eine knappe Stunde danach kam ein Wagen vom Regimentsgefechtsstand, der am anderen Ende des Dorfes untergebracht war. Die Gefangenen wurden auf den Wagen genötigt und abgefahren. Vor der ehemaligen Polizeistation, etwa in der Mitte des Dorfes, unweit der Kirche, hielt der Wagen. Man brachte die Gefangenen in ein niedriges, abseits gelegenes Gebäude und sperrte sie in eine Zelle.
Zweite Begegnung
Der Fähnrich hatte wohl nicht mehr daran gedacht, wegen der Strafwache „zuzusehen“, und Haferkorn hatte ihn nicht mehr erinnert.
Gegen neun Uhr abends war Alfred im Wachlokal erschienen. Ein Unteroffizier lümmelte am Tisch in der Ecke, und Alfred meldete sich. Weshalb er sich denn zu melden habe? Haferkorn berichtete das Vorgefallene und wurde eingeteilt: von Mitternacht bis zwei Uhr morgens Wache an der ehemaligen Polizeistation, und zwar an der Vorderfront des Hauses, an der Straßenseite.
Halb angezogen legte er sich auf einen der Strohsäcke und schlief dann auch ein. Es war ein Angsttraum, zäh und schweißfeucht. Er hatte das Mädchen zu bewachen, das hartnäckig den Blick verweigerte. Es drängte ihn, ihr etwas zu sagen, sie zu fragen, zu bitten; aber er merkte, dass er gar nicht reden konnte. Sie lief dann aus der Stube und auf der Straße entlang dem Walde zu. Er wollte schießen, merkte aber, dass er statt des Gewehrs ein Kochgeschirr in der Hand hielt. Soldaten kamen, umringten und packten ihn. Er meinte lauthals zu brüllen, hörte aber nichts ...
Jemand rüttelte ihn an der Schulter, und ein Gesicht sagte: „Aufstehen!“
Es war zwanzig Minuten vor Mitternacht.
Draußen war der warme, dunkle Himmel über den Bäumen. Das Dorf lag blind und stumm. Manchmal jaulte ein Hund, oder Katzen jagten fauchend durch das Gebüsch am Straßenrand. Die Häuser versteckten sich voreinander hinter Bäumen oder mannshohen Mauern. Das Weiß der Tünche an den Mauern, das bei Sonnenlicht die Augen blendete, schwamm jetzt wie Nebel zu beiden Seiten der Straße und löste sich nach wenigen Metern in der Dunkelheit auf.
Die Nacht schien so zu tun, als gäbe es keinen Grund, beunruhigt zu sein. Eine warme lügnerische Verschwiegenheit hatte sich ausgebreitet, hinterhältig, heimtückisch. Haferkorn hörte nur das Schlurfen der eigenen Schritte. Nichts regte sich. Dabei hockte tausend Meter nördlich das Unvorstellbare, das Grausige, bereit, augenblicklich hervorzubrechen. Und knapp zwei Wegstunden entfernt verlief die Grenze aller Dinge und Vorstellungen: die Front.
Das Gewehr, geladen und gesichert, hatte Haferkorn fest unter den Arm geklemmt. An einem Weg, der links von der Straße abbog, blieb er stehen. Er sah den Waldrand: ein schwarzer Streifen zwischen Himmel und Erde. Er dachte daran, dass überall Posten standen, rund um das Dorf und drüben wohl auch, am Wald. Die Nächte hier waren leblos durch die Verschwiegenheit der Posten. Er ging weiter. Er beschleunigte den Schritt, um ans Ziel zu kommen. Dort am Haus, an seinem Standort, würde er einen anderen treffen, der ihn schon erwartete. Sie würden ein paar Worte wechseln. Ganz gleich welche. Wenigstens Worte. Er würde dann den nächsten erwarten, der kommen sollte, ihn abzulösen.
Inzwischen hatte Alfred die Kirche erreicht, ein schwarzer Gebäudeleib, der über die Bäume hinaus in den Himmel wuchs. Jetzt fiel sein Traum ihm ein, und er fragte sich, wo die drei Gefangenen seien ... das Mädchen ... „Doktor nix?“
Von rechts kroch ein Gerüst heran, galgenhaft: ein Ziehbrunnen am Straßenrand. Es ist jetzt nicht mehr weit! Der Straßenstaub ist stellenweise wie ein dicker Teppich ...
Plötzlich bleibt Alfred stehen. Er atmet nicht. Da ist ein Menschenschrei über dem Dorf ... ein langer Schrei ... Es muss nahe sein! Alfred rennt. Der Schreck ist unter die Haut gekrochen. Hat man einen der Posten überfallen? Aber warum schießt niemand? Seine Glieder sind ungehorsam, doch er läuft, geduckt, immer dicht an den Mauern die Straße hinunter. Er möchte umkehren, denn der Schrei ängstigt ihn, und doch läuft er dieser Stimme entgegen, die sich aufbäumt und windet und niederfällt.
Er hat einen Hof erreicht, ein Haus, das sich mit schwachen Umrissen nur widerwillig zu erkennen gibt. Es ist die Polizeistation. Lichtstreifen hängen senkrecht in der Finsternis. Die Fenster sind nachlässig abgedunkelt. Und wieder der Schrei ... ganz nahe, aber nur kurz ... Dann ist es still.
Im Hof, wenige Meter von der Straße entfernt, sieht Alfred den Posten. Er steht da, teilnahmslos, wie ein Pfahl.
Haferkorn läuft auf das Haus zu.
„He! Wohin?“
Alfred hört nicht. Er will an dem Posten vorbei, doch er wird am Arm gepackt und herumgeschleudert.
„Verrückt? He?“ Der andere ist groß und breit. Alfred versucht sich loszureißen. Es gelingt nicht. Er atmet hastig mit halb geöffnetem Mund.
„Was ist da los?“ Das Gesicht des anderen ist nicht mehr als ein grauer Fleck.
„Was soll schon los sein?“
„Da schreit doch einer!“
„Na, und?“
Der Posten hat Haferkorn losgelassen und wendet den Kopf dem Hause zu. Da scheint ihm etwas nicht zu stimmen. Es ist immer noch still hinter den Fenstern. Unbegreiflich still!
„Wer hat da geschrien?“
Jetzt lacht der andere. Es hört sich wie ein Knurren an. „Alles in Ordnung!“, sagt er. „Da wird einer verhört!“
Alfred zieht an seinem Kragen, aber der Würgeschmerz im Hals hat mit dem Kragen wohl nichts zu tun. Einer schreit wie ein Tier ... und alles in Ordnung?
„Wer wird verhört?“
„Von den Roten einer!“
„Von welchen Roten?“
„Herrgott!“ Der andere zieht seinen Dreck in der Nase hoch und spuckt. „Partisanen!“, sagt er.
Alfred starrt auf die Lichtstreifen, die dort im Finstern aufgehängt sind. Sie scheinen zu tänzeln. Er wischt mit der Hand schräg übers Gesicht. Der Arm fällt herab. Er spürt das Verlangen, zum Haus hinüberzugehen ... Die Gedanken torkeln im Kopf ...
„... das Mädchen ...“, sagt er leise.
„Ja! Du Bock!“ Der Posten lacht knurrend.
„Die kommt auch dran! Aber solche wie du werden da nicht rangelassen! Das macht der Herr Major! Ganz persönlich!“ Der Posten lacht wieder, und irgendwo wiehert ein Pferd, im Traum vielleicht.
„Bist du Ablösung?“
„Ja, ja!“, sagt Alfred.
„Gut!“, sagt der andere. „Der OvD schleicht rum! Bloß damit du weißt!“
Alfred hörte noch die Schritte, die eilig davongingen. Er stand allein im Hof, das Gewehr in der Hüfte, und die Hände, die das Gewehr umklammerten, waren feucht. Die Stille summte ihm in den Ohren. Er wollte ausspucken oder fluchen, doch der Mund war trocken. Er hatte das Gefühl, die Zunge sei geschwollen.
Er ging langsam zum Haus hinüber, auf die Lichtstreifen zu. Manchmal blieb er stehen und horchte. Geräusche drangen aus dem Innern des Hauses, plätschernde und klirrende Geräusche. Er fürchtete, jeden Augenblick könnten die Schreie wieder anfangen und es könnte die Stimme des Mädchens sein ... Alfred stand vor den beiden Fenstern und stellte fest, dass man sie von innen mit Decken verhängt hatte. Die Decken waren zu schmal, und von einem der Fenster stand ein Flügel offen. Er hörte Stimmen hinter dem Fenster. Dann brach Gelächter aus, und ein Eimer klirrte, als sei er zu Boden gefallen. Alfred warf das Gewehr über die Schulter und trat an das geöffnete Fenster. Er schob die Decke ein wenig beiseite: Er sah eine Ecke des Zimmers, eine Bank, auf der einer der gefangenen Partisanen lag, bewusstlos, wie es schien. Drei, vier Soldaten umringten ihn. Ihre Stiefel tapsten in Wasserlachen, die überall auf dem Fußboden schwammen. Die Bank war triefend nass.
Alfred merkte, dass die Hand zitterte, mit der er die Decke einen Spaltbreit geöffnet hielt. Die Arme des Mannes auf der Bank hingen schlaff und fremd herunter, als gehörten sie ihm nicht. Sein Oberkörper wurde von einem der Umstehenden hochgezerrt. Man stülpte einen Eimer über seinen Kopf und ließ den Körper dann hintüber auf die Bank fallen. Der Eimer polterte zu Boden.
Alfred zog schnell seine Hand zurück und trat zur Seite. Im Zimmer lachten sie grölend. Ihn ekelte vor dem Gelächter. „Bring Wasser her!“, brüllte einer, und da verstummte das Gelächter.
Wenig später wurde polternd die Haustür geöffnet, und jemand klapperte mit einem Eimer. Für den Fortgang der „Verhandlung“ brauchte man Wasser.
Haferkorn lehnte an der Hauswand, reglos, wie angeheftet. Er bildete sich ein, die Schreie wieder zu hören. Baum und Strauch erschauern. Die Nacht verschließt sich vor dem Schrei. Nun ist der Mann verstummt. Seine Arme baumeln herunter wie Seilenden. Sie haben ihm die Stimme aus dem Leib gequält! Alles in Ordnung! Keine besonderen Vorkommnisse!
Es mochte die Verwandtschaft der Empfindungen sein - zwischen heute und damals -, dass Alfred sich plötzlich jener Mittagsstunde erinnerte, vor Wochen, an einer Straßenecke in Nizza. Eine Reihe Lastwagen auf dem Platz. Soldaten schwärmten aus und sperrten in weitem Viereck die Straßen ab. Er war ganz zufällig dazugekommen. Er hatte in die Stadt fahren müssen, ein Bowlengeschirr einzukaufen für den Unteroffizier, und wo die Hauptstraße in den Platz mündet, unweit der Strandpromenade, wurden zwei Franzosen erhängt, öffentlich und um elf Uhr vormittags. Sie standen auf Kisten, gefesselt an Händen und Füßen. Die Stricke, die von ausgedienten Laternenhaltern herunterhingen, wurden um ihre Hälse geschlungen. Hunderte von Menschen hinter den Absperrketten, Kopf an Kopf. Die Kisten wurden weggestoßen, Gesichter abgewandt, ein tausendkehliger Schrei über dem Platz.
Er hatte die Menge gespürt, die ihn wogend umgab, und den Abscheu der Menge. Hassblicke trafen ihn, weil er kenntlich war durch die Uniform. Er hielt es für gut, sich dagegen zu wehren, bis ihn selbst ein Widerwille ergriff, eine ungenaue, hässliche Empfindung und darin eingebettet die Frage nach Recht oder Unrecht.
Er erinnerte sich genau jener Mittagsstunde. Sie war der jetzigen, der Nachtstunde, verwandt.
Schritte näherten sich dem Haus. Alfred hätte rufen müssen, kam aber nicht darauf. Es war auch nur der Mann, den man vorhin nach Wasser geschickt hatte. Alfred lehnte immer noch an der Wand. Er hatte den Stahlhelm abgesetzt und den Schweiß von Stirn und Nacken gewischt. Was hinter dem Fenster gesprochen wurde, konnte er von hier aus nicht verstehen. Ein sonderbarer Gleichmut hatte ihn plötzlich befallen. Es lag ihm nichts daran, die Reden hinter dem Fenster zu verstehen. Er nahm das Gewehr von der Schulter und stellte es neben sich an die Wand. Er holte Streichhölzer aus der Hosentasche, dann eine Zigarette. Seine Finger zitterten, und das Licht der Streichholzflamme stach in die Augen.
Da wurde die Haustür aufgerissen. Hinter Gepolter und dem Zischeln unterdrückter Stimmen tänzelte der Lichtkreis einer Taschenlampe aus der Tür. Alfred ließ die Zigarette fallen, nahm sein Gewehr und ging eilig vom Hause weg in den Hof. Der Lichtfleck huschte über Gesichter und schräg an der Wand des Hauses hinauf und auch über zwei Soldaten, die einen Körper schleppten.
Die Taschenlampe und die Soldaten mit dem leblosen Manne bewegten sich schweigend auf ein schuppenähnliches Gebäude zu, das seitlich, einige Meter zurückgesetzt, neben dem Hause stand. Der Mann mit der Lampe schloss die Tür auf und betrat die Zelle. Die Soldaten mit ihrer Last folgten.
Haferkorn war über den Hof gegangen. Er sah nur die Türöffnung und das Gitterviereck, und als die Soldaten das Mädchen aus der Zelle führten, konnte er plötzlich nicht weitergehen. Die Dunkelheit verbarg sie ihm. Nur einmal hüpfte der Lichtkreis flüchtig über ihre Gestalt und in ihr Haar, das davon aufzuflammen schien. Dann verlosch das Licht, und wenig später wurde die Haustür zugeworfen.
Minutenlang stand Alfred auf dem gleichen Fleck. Er suchte sich zu beschwichtigen. Er hoffte, sie würden es nicht über sich bringen, das Mädchen zu quälen. Und was wäre, wenn sie es täten? Durften sie das überhaupt? Gab es keine Mittel, sie zu hindern? Er fürchtete, das Mädchen könnte jeden Augenblick zu schreien anfangen.
Oder war alles wirklich viel einfacher: Schulterzucken und sagen: „Das ist der Krieg!“
Es war ihm jetzt, als ob die Lichtstreifen dort drüben wieder angefangen hätten zu hüpfen. Hinter seinem Rücken, von der Straße her, kamen Schritte heran. Er wandte sich schnell um. „Halt! Wer da?“, rief er.
„Leipzig!“, sagte eine Stimme. Das war die Parole dieser Nacht. Alfred erkannte einen Offizier und meldete: „Schütze Haferkorn ... dritte Kompanie ... auf Posten!“ Er stieß die Worte heraus. Seine Stimme war so brüchig, dass sie ihm seihst fremd erschien.
„Na, und?“, fragte der andere.
Die Meldung war unvollständig. Alfred wusste das. Er brachte nur den Satz nicht heraus, der noch fehlte; denn der Satz traf nicht zu.
„Vielleicht melden Sie anständig!“, sagte schroff der Mann. „Keine besonderen Vorkommnisse!“, sagte Haferkorn schließlich.
„Das war auch Zeit, Kerl! Merken Sie sich gefälligst, wie eine Meldung auszusehen hat.“
Der Mann ging auf das Haus zu, blieb eine Zeit lang stehen und kam dann zurück. „Gut beobachten!“, sagte er noch und war schon auf der Straße, wo seine Schritte sich rasch entfernten.
„Jawohl!“, sagte Alfred. Er dachte: Keine besonderen Vorkommnisse? Er hatte nur gesagt, was verlangt worden war; aber es kam ihm vor, von nun an sei er mitbeteiligt. Dein Feind ist auch als Gefangener noch dein Feind, und wer den Russen in die Hände fällt als lebendiger Mann ... Da musst du eine Kugel aufgespart haben. Es kommt darauf an, dass du noch Zeit findest, und feige darfst du nicht sein, und am sichersten ist, den Gewehrlauf in den Mund zu stecken ...
Wenn darüber gesprochen worden war, dann immer so, als handelte es sich um eine alltägliche Verrichtung, so belanglos und so notwendig wie der Punkt hinter dem Satz.
Alfred ging zum Fenster hinüber, immer langsamer, je näher er kam. Er blickte sich fortwährend in der Dunkelheit um. Er hörte eine Stimme hinter dem Fenster.
„Sie wollen nicht antworten?“, fragte die Stimme, und eine zweite sprach russisch. Es war dann eine Weile still. „Antworten Sie!“, brüllte die Stimme.
Alfred drehte sich um. Wo die Straße war, schwamm das Weiß einer getünchten Mauer wie Nebel. Es war viel zu warm, und die Nacht umgab ihn wie eine feindliche Menge. Hinter dem Fenster herrschte immer noch Stille. Dann polterten Stiefel auf dem Fußboden. Alfred blickte sich abermals um, bevor er näher trat und die Decke vorsichtig beiseiteschob.
Soldaten waren über das Mädchen hergefallen und zogen ihr die Bluse über den Kopf. Einer hielt sie von hinten mit den Armen umklammert. Er krallte die Finger in ihre Brüste und verbiss die Lippen wie bei äußerster Anstrengung, obwohl das Mädchen sich nicht wehrte. Sie schien niemand im Zimmer anzublicken. Man warf ihre Sachen auf den Boden, in die Wasserlachen. „Los! Weg!“, befahl die Stimme.
Das Mädchen stand da, nackt und aufrecht, die Arme hinter dem Rücken. Sie blickte geradeaus, unverwandt auf irgendeinen Punkt. Jetzt flutete grelles Licht über ihren Körper. Von der Zimmerdecke hing ein Strick herunter und baumelte sacht. Er war oben durch einen Ring gezogen.
„Das letzte Mal! Wo sind geheime Treffpunkte, Waffenlager ... Sie haben noch Zeit!“
Alfred zitterte am ganzen Leib. Das Mädchen schwieg. Er starrte sie an, und ihre Gestalt verschwamm. Sekundenlang schloss er die Augen. Weil er das Gewehr ganz oben am Lauf umklammerte, drang die Kimme in den Handballen. Vielleicht bewirkte der Schmerz, dass er nicht losbrüllte; denn man packte jetzt das Mädchen und zerrte sie zur Bank. Sie wurde festgeschnallt, an Armen und Beinen. Der Mann, dem wohl die Stimme gehörte, trat neben die Bank und wippte auf den Zehen. Unter halb gesenkten Lidern hervor, gelangweilt, wie es schien, blickte er auf das Mädchen hinab, hob dann eine Hand und betrachtete flüchtig seine Fingernägel.
„Sie haben noch Zeit!“, sagte er. Es war ein Major. Seine Lippen waren so schmal, dass man glauben konnte, er hätte statt des Mundes eine Narbe über dem Kinn. Er hatte die Daumen ins Koppel gehängt und wippte. Und das Ritterkreuz am Kragen wippte.
„Los! Anfangen!“, brüllte er plötzlich und winkte mit dem Kopf. Alfred sah noch die beiden Soldaten, die mit Koppelriemen in der Hand herankamen. Er trat vom Fenster weg in die Nacht. Er schlurfte schräg über den Hof und zog das Gewehr hinter sich her.
Er blieb stehen und horchte, ging auf die Straße und stand wieder. Das Mädchen würde wohl anfangen zu schreien. Er hatte Angst. Warum kam ihn keiner ablösen?
Die Mauer drüben schwamm wie ein Nebelstreifen. Es war viel zu warm und viel zu still, und er wünschte, das Mädchen würde schreien. Alfred erschrak. Der Stahlhelm, den er in der Hand hielt, war ihm entglitten und zu Boden gefallen.
Endlich kam die Ablösung, und Alfred ging eilig die Dorfstraße hinunter, dem Wachlokal zu. Das Mädchen hatte nicht geschrien. Alfred beeilte sich, als fürchtete er, sie könnte doch noch anfangen zu schreien und ihre Schreie könnten ihn einholen. Dann kam ein merkwürdiges Geräusch vom Wald herüber. So klingt es, wenn man einen Korken aus der Flasche zieht. Es pfiff leise in der Luft und knallte über dem Dorf ...
Alfred presste sich an die Mauer. Er lauschte ... Die Stille hatte sich schon wieder geglättet.
Er ging weiter. Im Nordosten mischte sich ein milchiger Schleier in den grauschwarzen Horizont. Die ersten Sterne ertranken in der jungen Morgendämmerung. Alfred sah plötzlich helle Tupfen auf der Straße, hier und da. Er wischte mit dem Fuß. Da lag Papier ... graue Vierecke im Straßenstaub ...
Flugblätter!
Er bückte sich. Flüchtig kniffte er das Blatt und schob es in die Tasche. Er beeilte sich, weiterzukommen. Überall die Tupfen auf der Straße, als hätte ein Wind sie hergeweht. Er lief schnell, um die Blätter hinter sich zu bringen.
Unweit des Wachlokals am Dorfausgang fasste er in die Tasche und fühlte das gefaltete Papier. Er wollte es in die Brusttasche stecken, traute sich aber nicht mehr. Und wenn einer fragen sollte ... Flugblätter hatte er nirgends gesehen.
Auf dem Strohsack in der Wachstube lag er schlaflos, wälzte sich und starrte zur verräucherten Zimmerdecke hinauf, wo mitunter eine Fliege wach wurde und vorwurfsvoll zu summen anfing.
Major Wolfram Krebs
Niemand wusste genau, wo der Mann Gottes geblieben war. In seinem Hause jedenfalls - einem stattlichen Hause, das zu den schönsten des Dorfes zählte, mit Obergeschoss, gelblich getünchten Mauern und einem Dach aus roten Ziegeln – in diesem Hause hatte das achtundzwanzigste Regiment seinen Gefechtsstand.
Ein Teil der alten Möbel stand seitdem in einer Ecke des geräumigen Hofes, der, von zwei dickleibigen Linden überdacht, an Garten, Haus und Dorfstraße grenzte. Zwischen Stühlen, Vasen und Wandbrettern spielten junge Katzen. An den Türen eines Schrankes krümmte sich das Holz wie Birkenrinde im Feuer. Nur in zwei Räumen des Obergeschosses war fast alles so geblieben, wie es der Vater des Popen eingerichtet hatte.
Dort wohnte Major Krebs. Er war jetzt einunddreißig Jahre alt, vielleicht einer der jüngsten Regimentskommandeure der Armee, ausgezeichnet mit dem Ritterkreuz und namhaft gemacht in einem der täglichen Berichte des Oberkommandos. Das sollte erst einer nachmachen! Mit großer Schnauze allein war das nicht zu schaffen! Das hieß: Tapferkeit angesichts des Feindes, soldatische Bewährung, Durchgreifen! ...
Wenn er seinen Weg zurückschauend überblickte, tat er es mit Stolz. War das kein Weg? Mit zwanzig, im Jahre der Machtergreifung, bereits Stammführer der Hitlerjugend! Bannführer und schließlich, im Jahre siebenunddreißig, Stellvertreter des Gebietsführers ... Militärdienst ... Offiziersschüler ... Leutnant ...
Der Vater, Arthur Krebs, ehemals Fuhrunternehmer und Schweinehändler, später Häusermakler, hatte oft zu seinem Sohne sagen müssen: „Aus dir wird nie ein brauchbarer Mensch werden!“ Es hatte auch so ausgesehen, als sollte der Vater recht behalten. In der Schule war Wolfram unvergleichlich faul und dumm gewesen. Mit weit mehr Leidenschaft wusste er die Horde der gleichaltrigen und jüngeren Kinder der Umgebung anzuführen: befehlssüchtig, draufgängerisch und brutal zuweilen. Die Privatschule am Stadtgraben schluckte indessen beträchtliche Summen. Was den Sohn betraf, geizte der Alte nicht. Auch mit Verwünschungen, Prügel und anderen Strafen geizte er nicht. Sechzehnjährig, brannte der Junge durch. Zwei Wochen suchte die Polizei und griff ihn schließlich in einem der fragwürdigen Gässchen der Innenstadt auf. Bei käuflichen Weibsbildern hatte er Unterschlupf und Erlebnisse gefunden. Als der Junge siebzehn war, nahm der Vater die dritte Frau. Wolfram durfte Mary sagen und gewann eine wohlwollende Freundin an ihr. Sie war fünfundzwanzig Jahre; der Mann, dessen Frau sie geworden, war doppelt so alt. Ihren mädchenhaft schönen Körper pflegte sie eifersüchtig. Sie betete ihn an wie ein geheiligtes Kleinod. Ihr Bedürfnis nach moralischen Grundsätzen stand in umgekehrtem Verhältnis zu ihrer Lebensgier, und da der junge Wolfram kräftig und wohlgestaltet, entdeckte sie ihr Herz für ihn. Sie wusste ihre Sache mit Klugheit ins Werk zu setzen.
Noch heute, wenn er sich jenes Abends erinnerte, überlief es ihn ... Er war nach Hause gekommen, später als gewöhnlich, denn er wusste den Vater außerhalb, auf einer Geschäftsreise. Die Tür zum elterlichen Schlafzimmer war nur angelehnt. Er öffnete sie, schaute hinein: Mary saß vor dem dreiteiligen Frisierspiegel und lächelte, und ihr Blick lockte aus dem Spiegelglas. Am nächsten Morgen schrieb sie einen Entschuldigungsbrief für den Jungen, den das Hausmädchen in die Schule zu bringen hatte ... Wolfram erwachte erst gegen Mittag. Er fühlte sich schwach und elend und doch kräftiger als jemals früher. Er fühlte sich als Sieger.
So über den Alten zu triumphieren, hatte er nie zu träumen gewagt ... Er belächelte den Vater und alle seine zweifelhaften Prophezeiungen. In jener Nacht in Marys Armen - so schien es ihm noch heute - hatte das Leben begonnen, die väterliche Weisheit Lügen zu strafen ...
Und war er etwa kein brauchbarer Mensch geworden? ... Das Kreuz am Kragenausschnitt! ... Zierte ihn nicht der Dank der ganzen Nation?
Der Herr Major hatte bis Mittag geschlafen. Er saß beim verspäteten Frühstück. Sein Langhaardackel - er hatte sich das Tier kürzlich aus Deutschland mitbringen lassen, denn er liebte diese Rasse -, der Dackel also lag neben ihm auf dem Sofa und schien zu schlafen. Krebs stocherte unmutig in einem viel zu weich gekochten Ei. Er setzte den Eierbecher wütend auf den Tisch. Das Ei sprang heraus, drehte sich auf dem Tuch ... Krebs blickte zur Tür hin und auf das Ei, das da langsam auseinanderlief, er blickte auf seinen Hund und wieder zur Tür und schrie: „Wacholder!“ Er stemmte die Arme gegen die Tischkante und brüllte wieder, jetzt schon aufs Äußerste gereizt: „Wacholder!“
Der Gefreite Wacholder stand im Hof, zwischen allerlei Kisten, in der prallen Mittagssonne und putzte Stiefel. Er war seit zehn Tagen Regimentsputzer, und die Stiefel, weich wie ein Damenhandschuh, gehörten dem Kommandeur. Er putzte gewissenhaft und mit Feingefühl: er spuckte vorsichtig auf das schwarze Leder, bürstete, neigte den Kopf, um den Glanz am ausgestreckten Arm zu prüfen, spuckte wieder und bürstete ...
Die Stimme, die seinen Namen rief und plötzlich aus den Fenstern des ersten Stockwerks auf ihn herunterfiel, erschreckte ihn. Er legte Stiefel und Bürste sorgfältig auf eine der Kisten und ging. Dann stand der hagere Tischlermeister aus Dresden vor seinem Kommandeur und meldete, wie die Vorschrift es verlangte, seine Ankunft.
„Wie oft muss ich das noch sagen? Wie? Das Gelbe hat wie Öl zu sein! Verstanden?“
„Jawohl, Herr Major!“ Wacholder legte den Kopf in den Nacken und presste die Arme an den Körper. Krebs stand auf und knöpfte an seinem Rock.
„Pure Angst ist das! Mangel an Mut! Verstanden? Machen Sie drei weiche Eier! Und das da wegwischen!“
Wacholder verschwand, und Krebs trat ans Fenster. Der Blick ging von hier nach Süden, über Strohdächer und zwischen Bäumen hindurch zum Horizont, wo die Straße einen kahlen Hügel erklomm. Unten im Hof saßen Soldaten, fünfzehn bis zwanzig. Sie lümmelten im Schatten der Linden auf ihrem Gepäck.
Der Major beugte sich aus dem Fenster und rief: „He! Was macht ihr da? Wer seid ihr?“
Ein Unteroffizier sprang auf. „Gestern angekommen! Vom Ersatztruppenteil!“
Krebs rief seinen Putzer und befahl, sofort jemanden aus der Schreibstube zu schicken. Bald danach klopfte es, und an der Tür stand ein untersetzter Mann. Er hatte ein fast kreisrundes Gesicht.
„Feldwebel Schubert meldet sich zur Stelle!“
„Was ist das für ein Sauladen bei euch? Da kommen neue Leute, und ich weiß das nicht! Sofort die Begleitpapiere! Bisschen schnell!“
Dann brachte Feldwebel Schubert die Papiere, und man konnte ihm ansehen, dass der Ton des Majors ihm nicht behagte. Dann kamen auch die Eier. Wacholder schob sie auf einem Teller vor sich her, stellte sie behutsam auf den Tisch und sagte: „Wünsche Herrn Major guten Appetit!“ Dabei federte sein Kopf wie der einer Henne, wenn sie gackert.
Krebs frühstückte. Den Kaffee hatte er „extra stark“ bestellt; denn er spürte die Nacht noch in den Knochen sitzen. Da steht man wie ein dummer Lümmel, und keiner macht sein Maul auf! Stur sind die Roten wie Stabsgefreite ... Und dieses Weib! Hübsches Kind eigentlich ... die Haut weiß wie ein Laken! Er hatte sogar einen schwachen Augenblick gehabt. Da lag sie auf der Bank, angeschnallt ... die Koppelriemen schlugen auf ihren Leib - die Kerls machten ganze Arbeit -, und plötzlich, obwohl sie nackt war, schien sie ein Hemd anzuhaben! ... Lauter rote Streifen auf dem Bauch! Er war nahe daran gewesen, das Verhör abzubrechen. Primanerschwäche!
Krebs leckte den Löffel ab, grinste in das ausgehöhlte Ei und zerdrückte die Schale in seiner Hand. Er wird sie rufen lassen ... hierher! Vielleicht wird sie gesprächig bei einer Tasse Tee ... oder im Bett ...
Aus den Papieren der Neuankömmlinge war ersichtlich, dass die Mehrzahl von ihnen zum Jahrgang sechsundzwanzig gehörte. Brauchbare Leute alles ... hier ein Älterer, null vier ... ging auch noch ... aber was war das? Da stand: Schutzhaft von März bis Juli dreiunddreißig! Er überflog die Angaben ... Weiß, Wilhelm ... Bootsbauer ... Berlin-Schöneweide ... Mitglied der KPD ... Er erhob sich und blickte aus dem Fenster. Dort unten saß er irgendwo, sah aus wie jeder andere, trug die feldgraue Uniform.
Krebs rief den Feldwebel. „Den Schützen Weiß zu mir! Die anderen Leute einweisen!“, sagte er, ohne die Gruppe der Soldaten im Hof aus den Augen zu lassen. Dann sah er diesen Weiß herüberkommen: klein, breite Schultern ... Er hatte ihn herausgefunden!
Es klopfte, und Krebs stand am Fenster und hörte die Stimme des anderen, der hereingekommen war und sich meldete ... eine heisere Stimme, mit einem spöttischen Unterton! Sicherlich hockte jetzt Bosheit in diesem Gesicht ...
Irgendetwas bewog den Major, weiter aus dem Fenster zu sehen.
„Sie sind Kommunist?“, fragte er.
Weiß zögerte mit der Antwort. Er hatte mit der Frage gerechnet. Auch jetzt verfügte er über jenen Ausdruck ahnungsloser Gelassenheit, den er sich in langen Jahren der Gefahr dienstbar gemacht hatte. Doch er schwieg, um diesen Menschen da am Fenster zu zwingen, sich umzuwenden ... Aus dem Nebenzimmer drang das behäbige Ticktack einer Uhr.
Krebs fuhr herum und brüllte: „Ohrenkrank, wie? Ich habe Sie etwas gefragt!“ Die Stimme des Majors war so schrill, dass der Hund auf dem Sofa davon erwachte.
Wilhelm Weiß sah den anderen aus seinen kleinen eiligen Augen an und sagte, als beantworte er eine alltägliche Frage: „Ich war Mitglied der Kommunistischen Partei bis zu ihrem Verbot!“
Krebs ging zum Sofa. Die Antwort missfiel ihm. Das stand im Fragebogen! Er wollte mehr wissen, als im Fragebogen stand. Er setzte sich und merkte plötzlich, dass er nicht genau wusste, weshalb er den Mann hatte rufen lassen. Der Hund war vom Sofa gesprungen und schlich misstrauisch um den Fremden herum, beschnupperte dessen Schuhe, die Wickelgamaschen ... „Rühren Sie!“, sagte Krebs und nahm eine Zigarette. „Was sagen Sie zur Lage und überhaupt zu allem? Mich interessiert das mal!“
„Die Lage ist ernst, Herr Major!“
„Sehr richtig! Sehr ernst. Und weiter?“
„Wir werden weiterkämpfen, Herr Major!“
„Na, und?“
„Wir werden siegen!“, sagte Wilhelm Weiß, und für den Bruchteil einer Sekunde wich der vorgetäuschte Gleichmut aus seinen Zügen. Nur für den Teil einer Sekunde.
„Wer wird siegen?“
„Wir werden siegen!“
„Wer ist ,wir‘?“ Der Major war aufgesprungen. „Wollen Sie Versteck spielen ? Wer ist wir? Ihr rotes Gesindel? Oder wer?“
„Wir, die Deutschen!“, sagte Weiß.
Der Major lief zum Schreibtisch. Er warf das Zigarettenetui, mit dem er gespielt hatte, zwischen die Papiere. Da lag auch das Flugblatt, das in der Nacht gefunden worden war. Man hatte ihn abgebildet. Man schrieb über ihn. Und der Mann ihm gegenüber fuhr gleichgültig mit der Hand durch seinen Schopf. Er hatte ergrautes Haar. Ein merkwürdiger Kontrast zu seinem Gesicht. Krebs spürte das Verlangen, den Mann zu demütigen. „Hier! Lesen Sie!“ Er nahm das Flugblatt und warf es durch die Luft. Es flatterte auf den Fußboden. „Lesen Sie!“
Weiß bückte sich und las. „An die Offiziere und Soldaten des 28. Regiments der 62. Inf.-Div.! Liebe Kameraden! Vor zwei Monaten sind wir übergelaufen ...“ Links ein Bild mit der Unterschrift: „Das ist Major Krebs!“ ...
Weiter kam er nicht; denn der andere riss ihm das Blatt aus den Fingern. „Man schreibt über mich! Man nennt mich einen Schlächter! Wie finden Sie das?“
„Es wird eine Verleumdung sein!“, sagte Weiß gelassen.
Krebs musste plötzlich einen befreienden Gedanken gefasst haben. Sein Gesicht entspannte sich, und er sagte ruhig: „Wir haben Gefangene gemacht. Ich werde sie morgen erschießen lassen! Ich gebe Ihnen den Befehl, an dem Kommando teilzunehmen!“
Er hatte seinen Trumpf gespielt. Doch die erwartete Wirkung blieb aus. Nichts im Gesicht des anderen verriet, dass er bezwungen worden war.
„Wie gefällt Ihnen das, Schütze Weiß? Eine Ehre ganz besonderer Art! Und ich erwarte, dass Sie pünktlich sind! Morgen früh um fünf! Hier unten!“
„Jawohl, Herr Major!“, sagte Weiß ruhig.
Nachdem er den Schützen Weiß weggeschickt hatte, ließ Krebs die zuverlässigsten Zugführer an seinem geistigen Auge vorüberziehen. Man muss diesen Kerl in gute Hände geben. Wie wäre das mit Weirosta! Ein junger Fähnrich! Ein Draufgänger ... unerschrocken! Er darf diesen Burschen nicht aus den Augen lassen! Jedenfalls bis morgen früh nicht! Dann wird man weitersehen!
Krebs befahl, den Schützen Weiß dem zweiten Zug der dritten Kompanie zuzuteilen und den Fähnrich Weirosta entsprechend zu unterrichten.
Das verbotene Papier
Vom fünften Lebensjahre an war Alfred mit der Mutter allein gewesen. Das Ehepaar Haferkorn hatte sich getrennt, und Alfred hatte den Vater seitdem nur selten gesehen. Das Bild, das der Junge später von ihm gewann, war zum größeren Teil durch Erzählungen der Mutter geformt als durch eigenes Erlebnis. Nicht, dass sie bemüht gewesen wäre, im Herzen des Kindes Abscheu gegen den Vater auszusäen. Sie wollte, dass der Junge, der ihr das Liebste war, hellhörig werde für die einfachste menschliche Anständigkeit, dass er besser werde, gerechter und gütiger, als der Vater hatte werden können.
Deshalb erzählte sie dem Jungen von ihren Tränen. Deshalb sorgte sie dafür, dass er vom Gram jener Jahre, die sie freudlos und erniedrigt neben ihrem Manne gelebt hatte, erfuhr. Es schien ein verdienter Ausgleich zu sein, dass sie den Jungen Gefühl und Verstand entdecken sah für Gut und Böse.
Ihr Mann war ein gescheiter und begabter Taugenichts gewesen, haltlos und eigensüchtig. Er hatte während des Weltkrieges vier Jahre seiner Jugend in englischer Zivilinternierung zugebracht, in Gesellschaft von Seeleuten und Zirkusartisten, von Zuhältern und Taschendieben. Vier Jahre ohne sinnvolle Beschäftigung, gefangen auf einer unwirtlichen Insel in der Irischen See. Er war später vielerlei gewesen: Kaffeehausmusiker, Angestellter; er hatte gemalt und gelegentlich ein Ölbild oder eine Radierung verkaufen können; er hatte Waren über die deutsch-tschechische Grenze geschmuggelt und hatte die Frau manchmal mit hinübergenommen. Er hatte nie für das Nötigste sorgen können, weder für Vertrauen noch für Liebe, noch für die Mittel zum Unterhalt.
Seit sie mit dem Jungen allein war, saß sie Tage und halbe Nächte an der Nähmaschine. Sie machte Heimarbeit für ein Konfektionsgeschäft in der Innenstadt, sie schneiderte für Bekannte. Sie sorgte für das Allernötigste.
Alfred lernte frühzeitig, schon als Neunjähriger, der Mutter behilflich sein. Wenn er nachmittags auf der Straße spielte, und er sah die Mutter mit einem Bündel aus dem Hause gehen, lief er hinauf in die kleine Stube im fünften Stock, aus der zwei ganz kleine Stübchen gemacht waren durch einen bunt gestreiften Vorhang. Mutter pflegte wenigstens eine Stunde wegzubleiben, wenn sie Arbeit ins Geschäft brachte. Alfred fegte die Stube aus, wischte Staub, stellte alles an seinen Platz und wusch zuweilen das Geschirr ab, so gut er konnte. Überhaupt versuchte er, der Mutter unerwartet Freude zu bereiten. Wie der Vater war auch er zeichnerisch begabt, und manchmal malte er für die Mutter eine Windmühle oder eine Landschaft von einer Postkarte ab. Während der letzten Volksschuljahre war er mit Richard befreundet, dem Sohn eines Druckereiarbeiters. Häufig spielten sie am Museumsplatz oder am Denkmal Kaiser Wilhelms, und es kam häufig vor, dass sie, in Schlägereien verwickelt, sich zu verteidigen hatten. Richard lehrte seinen Freund, die Fäuste zu gebrauchen. „Richtig zuschlagen!“, sagte er. „Und immer in die Fresse! Das kühlt ab!“ Alfred fand das sehr in der Ordnung, und wenn Mutter meinte, es sei roh, anderen ins Gesicht zu schlagen, dann sagte der Junge: „Sollen sie uns in Ruhe lassen!“ Es mache schließlich einen wichtigen Unterschied aus, ob man angreife oder sich verteidigen müsse. Aber Mutter mochte das nicht so beurteilen können, denn sie brauchte sich nicht zu prügeln.
Alfred war ein begabter Schüler. Dreizehnjährig, wurde er auf eine sogenannte Aufbauschule geschickt, die er nach drei Jahren mit dem Zeugnis der Mittleren Reife verließ. Was sollte nun werden? Um sein zeichnerisches Talent auszubilden, fehlte das Geld. Vielleicht hätte er Elektriker gelernt; denn er bastelte gern mit Schaltanlagen und einem Detektorempfänger, der nicht angemeldet war (zwei Mark monatlich konnten sie nicht erübrigen). Doch Mutter hatte ihm eingeschärft: „Nimm dir vor, Beamter zu werden! Sei fleißig, Junge! Oder willst du bloß einfacher Arbeiter werden? Du sollst es doch mal leichter haben!“ Er wurde Lehrling in einer Sparkasse. Und zwei Jahre später Soldat.
Die Rekrutenzeit verbrachte er in den Kasernen einer kleinen südfranzösischen Stadt. Man konnte bis zu den Gipfeln der Pyrenäen blicken. Manchmal führten sie abends heimlich Gespräche. Sie waren zu dritt und wollten desertieren. Sie hüteten sich vor diesem Wort, sie hatten sogar Furcht, es im Kopf zu haben, aber sie träumten von Abenteuern und Gefahren, von Spanien oder einem anderen Land, von einer entlegenen Insel oder einer Plantage am Rande der tropischen Wälder, wo es keinen Krieg gäbe und keinen Unteroffizier. Damals bohrten sich die ersten Zweifel an der Gerechtigkeit und dem guten Ende dieses Krieges in seine Gedanken, wurden abgetötet und wieder belebt. Er sah und hörte von Partisanen ... Wer greift an, und wer verteidigt sich? Wer ist im Recht? Was früher einfach zu entscheiden gewesen, schien heute unlösbar ... Er vermied es, darüber nachzugrübeln ...
Und jetzt steckte in der Brusttasche seines Uniformrocks das Flugblatt der russischen Partisanen ...!
Vormittags war am Wäldchen, das westwärts hinter dem Dorf lag, Granatwerferübung gewesen. Alfred hatte die Mittagspause herbeigesehnt. Er hatte die Eisenplatte zu schleppen gehabt. Die Hitze ... die Furcht und die Ungeduld! Nun saß er endlich hier im Garten, an einen Baum gelehnt. Kochgeschirre klapperten am Brunnen und Löffel. Alfred sah durch den Lattenzaun zum Waldrand hinüber. Er blickte sich um ... Er nahm die Briefe aus der Brusttasche und das gefaltete Blatt, das dazwischen steckte. Er sah das Bild. Das Gesicht von heute Nacht, den lippenlosen Mund, das Ritterkreuz. Er begann zu lesen.
An die Soldaten und Offiziere des 28. Regiments ...
Liebe Kameraden!
Vor zwei Monaten sind wir übergelaufen! Erinnert Ihr Euch? Wir sprachen vorher mit einigen! Wir sagten: es gibt Gefangene in Russland! Das heißt, so hundertprozentig sicher waren wir auch nicht! Aber wir sind gegangen, weil wir das Blutvergießen nicht länger mitmachen wollten. Wir sind jetzt in einem Lager für deutsche Kriegsgefangene weit hinter der Front. Es gibt sechshundert Gramm Brot und dreimal warmes Essen täglich. Für uns ist der Krieg beendet, und wir wissen, dass wir gesund nach Hause zurückkehren werden! Ihr aber wisst das nicht! Wenn die russische Offensive weitergeht, kann Euer Graben Euer Grab werden! Macht Schluss mit dem Hitlerkrieg! Gebt Euch gefangen! Wir gingen freiwillig in die Gefangenschaft - und gingen doch in die Freiheit und in das Leben!
Leutnant Ernst Petrollat
Soldat Fritz Ludwig Huch.
Alfred hatte gute Augen, doch nun begann die Schrift auf dem Blatt zu verschwimmen. Er ließ das Papier sinken und steckte es zwischen die Briefe zurück. War es nicht Lüge, was da stand? Hatte man zwei Namen missbraucht, erfunden vielleicht ... und waren die beiden nicht längst erschossen, wenn sie wirklich gelebt haben sollten? Wollte dieses Blatt ihn zwingen, blindlings zu glauben? Gab es Beweise? War nicht alles einleuchtend? War es nicht geheuchelt, auf heimtückisch-bedrohliche Weise? Wie oft hatte er Worten geglaubt! Jetzt wollte er nicht! Es hätte eines Zeugen bedurft, ehe er bereit gewesen wäre zu glauben.
Er fürchtete sich, weiterzulesen. Es waren Augenblicke nie gekannter Bedrängnis. Er blickte zum Haus hinüber. Er nahm wieder das Blatt und las.
Major Wolfram Krebs ist ein Mörder! Kennt Ihr Euren Kommandeur? Er wurde für besondere Tapferkeit mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet! Er hat im Dorfe Jurjewo bei Odessa über zweihundert Frauen, Greise und Kinder in eine Scheune treiben und lebendigen Leibes verbrennen lassen. Er hat den deutschen Gefreiten Rudolf Zilinski erschossen, als der sich weigerte, ein Dorf in Brand zu stecken. Er hat während des Rückzugs in einem Bergwerk bei Kertsch fünfzig russische Kriegsgefangene in einen Schacht stürzen lassen. Das sind einige der Heldentaten Eures Kommandeurs! Der Tod Hunderter Menschen lastet auf seinem Gewissen! Auch Euch wird er bedenkenlos in den Tod treiben, um sich zu retten und aufzuspielen! Gebt ihm keine Gelegenheit dazu! Lasst Euch von diesem Schlächter nicht länger Befehle erteilen! Macht Schluss mit dem Hitlerkrieg, der ein Verbrechen ist! Gebt Euch gefangen! Das Kommando der Roten Armee garantiert allen deutschen Soldaten und Offizieren, die sich freiwillig gefangen geben, das Leben, gute Behandlung und die Heimkehr nach Kriegsende!
Unten auf dem Blatt befand sich ein Stern mit Hammer und Sichel. Links daneben, eingerahmt, folgender Text:
Passierschein!
Ich, deutscher Soldat, weigere mich, gegen die russischen Arbeiter und Bauern zu kämpfen. Ich gebe mich freiwillig der Roten Armee gefangen.
Haferkorn hatte immer schneller gelesen, immer häufiger vom Blatt aufgesehen. Sein Atem war kürzer geworden von Zeile zu Zeile.
Er stopfte eilig das Flugblatt in die Hosentasche. Er nahm es wieder heraus, in der Absicht, es zu vernichten. Eine erlösende Flamme ... Sekundensache ...
Doch er glättete das Papier und schob es mit den Briefen in die Brusttasche zurück. Er stand auf und ging zum Zaun hinüber. Hier und da im Garten, im Schatten der Bäume, lagen Soldaten ausgestreckt, die Feldmütze auf dem Gesicht, und schliefen. Alfred beneidete sie um ihren Schlaf. Er hätte jetzt keinem gegenübertreten wollen. Es war besser, jede Gesellschaft zu meiden. Vielleicht stand alles auf seinem Gesicht geschrieben: Ich, deutscher Soldat, weigere mich ...!
Der Waldrand flimmerte in der Mittagsglut. Er schien weiter von dem Dorf weggerückt zu sein ... Alfred erwog, eine Meldung zu machen. Das Flugblatt verlangte, dass er etwas tat. Irgendetwas musste geschehen. Was aber sollte er tun? Er hatte ein Gefühl hilfloser Verlassenheit. Er wünschte, mit keinem ein Wort zu wechseln, aber dass er niemand wusste, dem er sich hätte anvertrauen können, vermehrte seine Bedrängnis.
Er ging ins Haus, in eine der niedrigen Stuben, wo zwölf Strohsäcke auf dem Boden lagen. Er warf sich auf sein Lager und fiel bald danach in einen traumlosen Schlaf.
Der Nachmittag war dienstfrei bis auf eine Stunde Waffenreinigen. Fast die ganze Zeit über wischte Haferkorn gedankenlos an seinem Gewehrschloss herum. Er beteiligte sich an keinem der Gespräche. Jemand fragte ihn: „Hast du eine Kette?“ (Nur etwa jeder dritte der Soldaten besaß eine Kette zum Reinigen des Gewehrlaufs.) Haferkorn erschrak. Er starrte den anderen verständnislos an und schüttelte den Kopf. Nichts in seiner Umgebung schien Bedeutung zu haben, nur manchmal blickte er verstohlen in eines der benachbarten Gesichter, wobei er bemüht war, fremden Blicken auszuweichen. Er litt unter der Nähe der Kameraden und wünschte doch einen herauszufinden, dem er sich freimütig offenbaren könnte. Und der Major, dieser Krebs, hatte gebrüllt: „Los! Anfangen!“ Und sie hatten mit Koppelriemen auf das Mädchen eingeschlagen ...
Der Putzer
Die Soldaten vom Ersatzhaufen waren nacheinander geholt worden. Man hatte sie verschiedenen Kompanien des Regiments zugeteilt, sorgfältig in alle Winde verstreut. Wilhelm Weiß war der letzte. Er hockte auf seinem Tornister, an den Gartenzaun gelehnt, und versuchte, mit sich und dem neuen Auftrag fertig zu werden.
Während der letzten halben Stunde war ihm viel durch den Kopf gegangen, es hatte kleinlich zaghafte Augenblicke gegeben. Ein Gefühl, dem er seit Jahren getrotzt hatte, war wütend über ihn hergefallen: das Gefühl der Hilflosigkeit, allein und mit leeren Händen dem Feind gegenüberzustehen ... Er hatte sich Menschen hergewünscht, die unerreichbar waren. Obwohl er sie brauchte! Die Genossen der Zelle, seine Frau - untergetaucht in Deutschland, in Dachkammern oder Sommerlauben, unter Deckadressen oder eingesperrt. Er hatte immer auf sie rechnen können, auf einen oder einige bestimmt. Jetzt saß er hier, allein!
Er werde die russischen Genossen zu retten haben! Das wusste er. Er wusste nur nicht, wie! Irgendwo im Dorf saßen sie, vielleicht in einem Keller und womöglich ganz in der Nähe. Ihr Leben sollte in wenigen Stunden aufhören. Seine Sache war, dass es nicht dazu kam! Das war jetzt der neue Auftrag! Er hatte ihn erwogen und bestätigt und sich den Auftrag dann erteilt. Drüben, hinter dem Wald, musste die Front sein! Woher kam ihm das Gefühl, allein zu sein?
Weiß stand auf, straffte sich, so, als habe er den Kleinmut abzuwerfen, der ihm den Auftrag streitig machen wollte. Bis morgen früh um fünf. Das waren sechzehn Stunden.
Im Hof, neben dem Haus, stand ein Mann über eine Kiste gebeugt. Weiß ging hinüber. Der andere putzte ein Koppel mit einem wollenen Lappen. Schweiß perlte ihm an den Schläfen. Es war ein breites braunes Koppel, mit dem er sich mühte. „Verschnauf dich mal!“, sagte Weiß. „Dir bricht ja der Schweiß aus!“
Wacholder blickte ihn flüchtig an. Er nahm das Koppel an beiden Enden und hielt es gegen das Sonnenlicht. „Beim Chef muss alles glänzen!“, sagte er, legte das Koppel wieder auf die Kiste, stemmte die Fäuste ins Kreuz und streckte sich.
„Was ich dich fragen wollte: Wie weit sind wir ab von der Front?“
„Zehn Kilometer!“ Wacholder wies mit einer Kopfbewegung schräg hinter sich. „Durch den Wald in zwei Stunden. Zu Fuß! Du kommst vom Ersatzhaufen?“
„Ja. Gestern Abend.“ Weiß nahm Zigaretten aus der Tasche. Wacholder griff nach dem Feuerzeug, behutsam, als angle er ein Hühnerei aus der Hose. „Und die Partisanen sind munter?“
„Ich kann dir sagen!“ Wacholder riss die Augen auf. „Lieber gleich eine Kugel als durch den Wald müssen! Gestern ...“ Er blickte um sich, scheu und eilig, und dämpfte seine Stimme. „Gestern erst ein ganzer Transport hops gegangen ... Aber du redest nicht darüber! Ich glaube, man soll nicht darüber reden! Zwanzig Wagen! Munition und Verpflegung für vorne! Alles im Eimer!“
„Zwanzig Wagen?“
„Ja, bis auf einen. Aber halt die Schnauze!“
„Natürlich!“, sagte Weiß. Er blinzelte zum Waldrand hinüber. „Und die sind gut verschanzt da drüben?“
„Ich kann dir sagen! Mal werden welche geschnappt. Gestern auch. Aber was ist das schon? Da sitzt bestimmt ein ganzes Regiment. Bewaffnet bis an die Zähne!“
„Habt ihr viele erwischt gestern?“
„Drei Stück! Sogar ein Weibsbild dabei! Und verstockt, sag ich dir! Die ganze Nacht Verhör! Früh um zwei ist der Chef erst gekommen. Und heute hat er schlechte Laune, und was meinst du, wer das auszubaden hat? Eine Putzerstelle, ich kann dir sagen, ist eine einzige Nervensache!“
Weiß nickte beifällig und lachte, und Wacholder zeigte beim Lachen eine Reihe gelber schief gewachsener Zähne.
„Aber wenn die drei euch abhauen?“
„Wo die sind, ist noch keiner abgehauen! Red nicht drüber. Ich glaube, man soll nicht darüber reden! Wo die Rumänen ihre Polizeistation hatten, da sind sie! Wir haben den Bunker gleich übernommen!“
„Bunker, gut!“, sagte Weiß. „Wenn er nicht anständig bewacht ist, hat der beste Bunker keinen Wert!“
„Verlass dich drauf!“ Wacholder dämpfte wieder seine Stimme. „Der Chef denkt an so was! Drei Posten, Tag und Nacht! Vorne an der Straße einer und hinten an der Hecke Doppelposten!“ Wacholder warf die Zigarette in den Sand und trat sie aus. Er nahm den wollenen Lappen und fuhr fort, das Koppel zu polieren. „Ich muss jetzt dem Chef die Sachen bringen. Und denk dran, was ich dir gesagt habe - du weißt von nichts!“
„Nichts weiß ich, ganz klar!“
Irgendwo schwamm ein Grollen wie ein fernes Gewitter. Es kam aus der Richtung, wo die Front lag. Die Hitze summte in den Ohren, der Himmel war blank und gläsern.
Weiß saß wieder auf seinem Gepäck, und es quälte ihn, untätig warten zu müssen ... Einen gescheiten Putzer hat der Herr Major ... Mit der Geheimhaltung ist es bei denen wie mit Wasser in der hohlen Hand ...
Der Fremde
Fähnrich Weirosta trat aus dem Hause und nahm die Meldung des Unteroffiziers mit betonter Würde hin. Er musterte die Soldaten, dann den Tisch, der inmitten des Hofes aufgestellt war. Er fing an herumzugehen, als ob er etwas suchte. „Zeigen Sie den Lauf!“, sagte er zu einem der Soldaten. Er blickte durch den Gewehrlauf, ging weiter und blieb dann neben Haferkorn stehen.
„Sie beenden das Waffenreinigen! Sie gehen sofort zum Regimentsgefechtsstand und melden sich in der Schreibstube! Verstanden?“
Haferkorn erinnerte sich rechtzeitig, dass er kein Recht habe, eine Begründung zu verlangen. Er sagte: „Jawohl, Herr Fähnrich“, packte seine Sachen zusammen und ging.
Unterwegs war er nahe daran, das Flugblatt herauszunehmen und zu vernichten. Wenn ihn heute Nacht jemand beobachtet hatte, wäre er dann nicht längst geholt worden? ... Und der Fähnrich ... Hatte er nicht unschlüssig die Gesichter der Leute gemustert, bevor er auf ihn verfallen war? Es gehörte wohl einfach zur Buße für seine Sünden, dass er diesen Weg während der Freizeit zu machen hatte ... Man fällt einmal auf, hebt sich ungewollt aus der Masse heraus und hat es schwer, wieder unterzutauchen. Die Rache der Vorgesetzten kann lang und ausführlich sein. Er behielt das Blatt in der Tasche. „Ich, deutscher Soldat, weigere mich …“
An der ehemaligen Polizeistation stand der Posten unter einem Baum. Alfred betrachtete im Vorübergehen das Haus und den niedrigen Seitenflügel, eine Art Anbau, der grellweiß getüncht war. Das Gitterviereck ... Dahinter saßen sie und blickten manchmal in das Stück Himmel, das man ihnen gelassen hatte, abgemessen und vergittert.
Alfred wollte stehen bleiben. Der Posten müsste Bescheid wissen. Sind die Gefangenen noch hier, noch alle zusammen ... und der Verwundete? Das Mädchen?
Als Alfred das Haus des Regimentsstabes betreten hatte, fasste er noch im Flur an die Rocktasche. Plötzlich kam sein Mut ihm zweifelhaft vor. Er hatte die Folgen nicht bedacht ... Es blieb noch Zeit, umzukehren und das Blatt loszuwerden!
Eine der Türen wurde aufgestoßen. Haferkorn starrte den Feldwebel an, der, Papiere unter dem Arm, aus dem Zimmer trat. Er hatte ein tellerrundes Gesicht.
„Wohin?“, fragte er barsch.
„Schütze Haferkorn, dritte Kompanie, zweiter Zug, meldet sich zur Stelle!“
Der Blick des Feldwebels schien zurückzutreten. Der Mann dachte nach. „Ja, ja. Ich weiß. Warten Sie im Zimmer!“
Ein Gefreiter übte auf der Schreibmaschine. Alfred fächelte sich mit seiner Mütze Luft zu. Die Maschine klirrte wie ein Schlüsselbund. Konnte er noch umkehren?