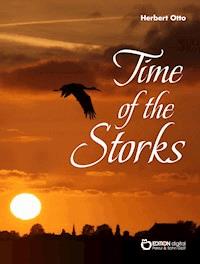7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Herbert Otto hat Fidel Castro und einige der Helden „der ersten Stunde“ kennengelernt, als er die „Republik der Leidenschaft“, den ersten sozialistischen Staat Amerikas, besuchte. Ein Vierteljahr lang ist er im regierungseigenen Cadillac, im Jeep, im Hubschrauber, auf Mauleseln und dem Pferd kreuz und quer durch Kuba gereist. Er war auf Baracoa, wo Columbus gelandet ist; er hat im Fort Moncada gestanden, wo am 26. Juli 1953 die ersten Kämpfe der Revolution begannen; er war in den Bergen der Escambray, und er hat in Playa Giron mit den Arbeitern gesprochen, die dort Wohnungen und Sanatorien bauten und später, im April 1961, als erste die Angriffe der amerikanischen Invasoren abwehrten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impressum
Herbert Otto
Republik der Leidenschaft
Mit 97 Fotos des Autors
ISBN 978-3-95655-323-3 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1961 im Verlag Volk und Welt Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2020 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected]
Den companeros, die im April 1961 die kubanische Revolution mit ihrem Leben verteidigt haben.
I Grüßen Sie Herrn Castro!
WAS WOLLEN SIE AUF KUBA?
Im Flughafengebäude von Amsterdam wird mein Reisepass einbehalten. „Setzen Sie sich!“, sagt der Polizist. Er trägt weiße Lackriemen um Brust und Bauch und verschwindet hinter irgendeiner Tür. Reisende, Gepäckwagen, Leuchtröhren. Was der Herr im Lautsprecher sagt, das sagt er viermal hintereinander, in vier verschiedenen Sprachen. Draußen dröhnen die Motoren der Flugzeuge; hier drinnen werden Koffer gewogen und Papiere abgestempelt. Ich warte eine Stunde. Dann kommt ein anderer Polizist, ebenfalls mit weißen Lackriemen verschnürt. Er hat gesättigte Langeweile im Gesicht und einen Kaugummi im Mund.
„Wohin wollen Sie?“, fragt er mich.
„Nach Kuba“, antworte ich wahrheitsgemäß.
„Was wollen Sie in Amsterdam?“
Ich gebe ihm den Brief der hiesigen Kubanischen Botschaft, in dem steht, dass mein Visum für Kuba genehmigt ist und abgeholt werden kann. Ich sehe, dass der Brief ihm nicht gefällt. Der Mann kaut müde und mustert mich. Er grinst dabei, und es sieht aus, als kaute er an diesem Grinsen. „Was wollen Sie auf Kuba?“, fragt er dann.
Das ist eine Frage, die ihm nicht zusteht. Trotzdem sage ich, dass die kubanische Revolution mich interessiert und ich die Absicht habe, darüber zu schreiben.
„Aha!“ Er nickt verhalten und gleicht einem Ganoven im Film, der einen anderen Ganoven durchschaut hat. Er nickt noch einmal und geht.
Ich warte wieder. Mir bleibt genügend Zeit, dieses Stückchen „freie“ Welt zu bewundern: die kühne Architektur des Raumes, die Eleganz der Ausstattung und die Höflichkeit des Flugpersonals. Über einer Flügeltür steht „Wachtkamer“; das heißt wohl zu deutsch Warteraum. Der Mann im Lautsprecher redet in vier Sprachen. Eine Maschine aus Bagdad sei soeben gelandet. Ich darf zwar aufstehen und mir ein bisschen die Beine vertreten, aber ich darf nirgendwohin gehen; höchstens zur Toilette, und das wahrscheinlich auch nur in Begleitung. Ich bin ein zweifelhaftes Element für die Behörden; denn ich komme aus einem Staat, der für sie nicht existiert. Die Damen und Herren der Königlich-Niederländischen Fluggesellschaft sind zurückhaltend. Im Berliner Büro der Gesellschaft ist mir versichert worden, dass meine Zwischenlandung in Amsterdam keinerlei Schwierigkeiten machen werde. Hier enthält man sich der Stimme. Man zuckt mit der Schulter und kann nichts tun.
Ich warte länger als zweieinhalb Stunden.
Endlich bringt der Königlich-Niederländische Polizist meinen Pass und dazu einen Zettel, der mir gestattet, mich bis zum Abflug der nächsten Maschine nach Südamerika in Amsterdam aufzuhalten. Bis übermorgen Vormittag elf Uhr fünfzig. Am Schalter der Fluggesellschaft erhalte ich nun Gutscheine für ein Hotelzimmer, für Mahlzeiten, Taxis und Omnibusse. Die Damen und Herren sind von ausgesuchter Höflichkeit. Willkommen in Amsterdam! Ich bin plötzlich wieder ein Herr. Die Gesellschaft verdient sehr viele Dollar an meinem Flug. Ich habe Anspruch auf Höflichkeit und erhalte sie vertragsgemäß.
EIN GESTUTZTER REMBRANDT
Was ich von Amsterdam sehe, sind nur Streiflichter. Es scheint, als hätte die Stadt mehr Radfahrer als Einwohner. Nicht Autos beherrschen das Straßenbild, sondern Radfahrer. An Bäumen und Häuserwänden, entlang der Kanäle, die die Stadt wie Straßen durchziehen – überall, wo sich Platz dafür bietet, – „parken“ Fahrräder. Es gibt besondere Schilder, die da oder dort das Abstellen von Fahrrädern untersagen. Eine Straßenbahnfahrt in Amsterdam kostet etwa vierzig Pfennig.
Man hat soeben einen berühmten Fälscher gefasst und abgeurteilt, und ich lese, dass in Holland die Höchststrafe für Urkundenvergehen und Falschmünzerei neun Jahre Gefängnis beträgt. Überall amerikanische Zigaretten und Filme und Schallplatten. Im Apollosaal tritt allabendlich der Evangelist Morris Cerullo auf. Man verteilt Handzettel in den Straßen, man hat Plakate geklebt. ,,… Im Februar 1959 verkündigte der Evangelist Cerullo Gottes Wort auf den Philippinen. Während der Predigt ging die heilende Kraft Gottes durch die Reihen … Taube erhielten ihr Gehör zurück, Blinde konnten wieder sehen, Lahme wieder laufen …“ Hier ist ein Wunder, glaubet nur! Die Spezialität der Hotelgaststätte, in der ich esse, sind Kalbsschnitzel. Es gibt siebzehn verschiedene Sorten Kalbsschnitzel. Und zu jedem Schnitzel wird ein buntbedrucktes Kärtchen serviert. Darauf steht: „Seit 1870 verkaufen wir Schnitzel. Dieses hat die Nummer 4675098.“ Das Restaurant ist auch sehr laut; denn was immer ein Gast bestellt, wird von den Kellnern quer durch den Raum zum Büfett hinübergebrüllt, wo ein Mann sitzt, den man das „Echo“ nennt. Er fängt die Bestellungen auf und brüllt sie weiter in die hinteren Küchenräume. Er hat ein geübtes Organ.
Ein normales Essen mit Suppe und Nachtisch kostet hier zwischen elf und vierzehn Mark. Überhaupt sind die Preise hoch in Amsterdam. Billig ist ein Besuch bei Rembrandt. In dem Hause, das er als Fünfzigjähriger verlassen musste, bettelarm und verspottet, werden für einen halben Gulden zweihundert seiner Radierungen gezeigt, und im Rijksmuseum kann man für einen weiteren halben Gulden berühmte Gemälde des Meisters sehen.
Eins hängt gesondert von den übrigen: der Auszug der Amsterdamer Schützengilde, die „Nachtwache“. Es hat einen ganzen Saal für sich allein. Bequeme Bänke sind im Halbkreis aufgestellt. Da sitzen Besucher aus aller Welt, Laien und Kunstverständige, und betrachten oft stundenlang die kostbare Leinwand mit den Gesichtern jener Amsterdamer Herren, die gemalt sein wollten aus Eitelkeit und die Rembrandt dann auch abgebildet hat, wie sie wirklich waren: habgierig und eitel. Das Bild ist eines der größten Kunstwerke der Erde. Aber es ist nicht mehr vollständig. Als das Gemälde vor rund zweihundert Jahren in einem Sitzungssaal aufgehängt werden sollte, war es zu breit für die Wand. Der verantwortliche Mann tat das Nächstliegende: Er ließ etliche Quadratmeter von der Leinwand herunterschneiden. Und siehe, das Bild passte.
„GRÜSSEN SIE HERRN CASTRO!“
Während der drei Flugstunden nach Zürich kam ich mit meinem Nachbarn zur Rechten ins Gespräch, einem gebürtigen Hamburger. Zwischen uns liegt der Mittelgang. Kinder laufen hin und her und das Bordpersonal. Aber der Mann zu meiner Rechten ist redselig. Er stellt mich auch seiner Frau vor. Seit nunmehr vierzig Jahren lebt das Ehepaar in Chile. Sie haben zwei erwachsene Söhne und betreiben das Hotelrestaurant „Silbergrotte“, eine knappe Autostunde von Santiago entfernt. Sechzig Tische im Winter, zweihundert im Sommer; dazu einige Betten für besondere Fälle. Die Gegend sei paradiesisch. Der Herr hat einen Stoß bunter Ansichtskarten zur Hand und schildert Wachsen und Werden der „Silbergrotte“. Manchmal muss er aufstoßen; denn sein Magen ist nicht in Ordnung.
„Das Geschäft zerfällt in drei Hauptteile: das Nachmittagsgeschäft mit Kaffee und Kuchen, das Abendgeschäft, große Küche, gepflegte Weine, und schließlich das Nachtgeschäft, Barbetrieb und so weiter. In diesem Jahr soll ein weiterer Flügel angebaut werden, denn die Fremdenzimmer reichen nicht aus. Das Publikum stammt aus allerersten Kreisen. Hier sehen Sie den Parkplatz, und das da drüben ist ein modernes Schwimmbecken. Da kann ich Wellen erzeugen.“
Die Landung in Zürich wird angekündigt. Sie unterbricht unser Gespräch. Die Stewardess verteilt Kaugummis. Der Hotelier nimmt zwei. Wir schnallen uns an und schauen aus den Fenstern. Felder, Hügel, Häuser. Die Maschine setzt auf.
Wir werden in einem Bus zum Flughafengebäude gefahren. Jeder Fluggast hat einen Gutschein für ein Getränk erhalten, denn es wird eine Stunde dauern, bis die Maschine wieder startet. Der große Transitraum ist sehr geschmackvoll ausgestattet. Verkaufsstände, bequeme Sessel, Wechselkassen. Man kann Genussmittel kaufen, Kekse und Kuckucksuhren. Hunderte Menschen warten hier, kommen und gehen, trinken Fruchtsaft oder Schokolade. Zürich ist ein Luftknotenpunkt.
An einem Andenkenstand das Ehepaar aus Chile. Der Herr handelt mit der Verkäuferin. Es geht um einen Vogelbauer. Die Frau sagt erläuternd: „Sie haben hier so schöne Vogelhäuser, und die Vögel zwitschern wie echte Vögel!“ Ein kleiner Käfig und ein Federwerk, das man aufziehen muss, wenn der nachgemachte Vogel zwitschern soll. Aber es fehlen dem Hotel- und Gaststättenbesitzer zwei Schweizer Franken, und er versucht zu handeln. Das ist sein Beruf. Er beteuert, nicht mehr Geld flüssig zu haben. Die Verkäuferin lässt nicht mit sich handeln. Wo käme sie denn hin, wenn jeder Käufer zwei Franken zu wenig zahlte? Das Ehepaar tritt beiseite und tuschelt. Die Frau besteht auf dem „Vogelhaus“, bis der Mann schließlich eine Dollarnote aus der Brieftasche nimmt. Aber wie peinlich, nun wieder an den Stand zu gehen. Was soll die Verkäuferin von ihm denken! So bittet er mich, den künstlichen Vogel zu kaufen, und ich bewundere das Feingefühl des Herrn.
Auf dem Wege nach Lissabon erfahre ich mehr über die „Silbergrotte“. Der Ärger mit dem Personal nehme kein Ende, und auf niemand sei Verlass, außer auf sich selbst.
In einer Bordmitteilung, die durchgereicht wird, steht, dass wir uns über den Pyrenäen befinden, fünftausend Meter hoch, und dass die Geschwindigkeit der Maschine 420 Kilometer in der Stunde beträgt. Der Mann aus Chile fragt nach meinem Reiseziel. Ich sage, wohin ich fliege, und das erschreckt ihn sehr. Er beginnt, mir seine Ansichten über Castro auseinanderzusetzen und über Revolution im Allgemeinen. Ob ich keine Angst hätte, in dieses wilde Land zu reisen? Man höre immer wieder von Terrorurteilen und von Toten auf offener Straße.
„Davon habe ich nichts gehört“, antworte ich.
„Und den Leuten wird alles weggenommen!“, sagt der Mann entrüstet. „Wem?“, frage ich.
„Na, den Besitzern! Der Boden wird ihnen weggenommen, die Fabriken …“ „Das wird wohl stimmen“, sage ich. „Sonst wäre es ja keine Revolution.“ Der gebürtige Hamburger wird stutzig. Ob ich am Ende aus Ostberlin komme, will er wissen. Aha! Und es folgt eine lange Debatte über Recht und Unrecht, über Freiheit und Diktatur und für wen das alles oder gegen wen.
„Jedenfalls ruiniert dieser Castro das ganze Land!“, behauptet der Mann hartnäckig. Dabei habe es anfangs gar nicht so ausgesehen. Wie schade! Er kenne Kuba. Es sei ein Paradies gewesen.
Die Stewardess kommt mit einem Tablett voller Schokolade, jeder Fluggast nimmt eine Tafel. Danke schön. Der Herr aus Chile nimmt zwei Tafeln und stammelt einen plumpen Scherz dazu. Dann beeilt er sich, die Schokolade zu essen, und muss manchmal aufstoßen, denn sein Magen ist nicht in Ordnung.
„Sie können ja Herrn Raul Castro, dem Bruder, mal Grüße von mir bestellen!“, sagt der Mann plötzlich. Er beginnt, angestrengt in seiner zerschlissenen Brieftasche zu suchen. „Ich muss da irgendwo seine Karte noch haben … Er soll ja noch radikaler sein als dieser Fidel, sagt man. Er war mal Gast bei mir in der ,Silbergrotte‘. Das liegt schon Jahre zurück, aber er wird sich erinnern. Grüßen Sie ihn von mir, und er soll unser Haus besuchen, wenn er mal wieder nach Chile kommt … Wo ist denn nur die Karte? …“
Der Mann hat sie nicht gefunden. Dafür gab er mir seine eigene, die ich bei Gelegenheit Raul Castro überreichen sollte, mit einer artigen Empfehlung des Hauses „Silbergrotte“, das der Gäste bedarf, auch der Radikalen, die ganze Länder ruinieren … Sechzig Tische im Winter, zweihundert im Sommer. Und was Sie dort sehen, ist das Schwimmbad. Da kann ich auch Wellen erzeugen …
DIE REISENDEN DER OBERKLASSE
Wegen schlechten Wetters über dem Atlantik muss ab Lissabon der Kurs geändert werden. Wir fliegen über die Kapverdischen Inseln, die in Höhe von Dakar dem afrikanischen Kontinent vorgelagert sind. Es ist Zeit, sich der Schwimmwesten zu erinnern, die jeder Fluggast unter seinem Sitz vorfindet.
Durch den Lautsprecher wird den Reisenden der Touristenklasse, bitte schön, das Studium der Gebrauchsanweisung empfohlen. Und während die sechzig Passagiere dieser Klasse sich mit den Geheimnissen und Vorzügen der „Lebenswesten“, wie sie im Englischen heißen, vertraut machen, findet im Abteil der ersten Klasse der Anschauungsunterricht statt. Das Bordpersonal erklärt jedem der zwanzig „teuren“ Fluggäste das Öffnen und Anlegen der Apparate, das Verschnüren und Aufpumpen. Durch einen schmalen Spalt im Vorhang, der beide Abteile streng voneinander trennt, kann ich die Sorgfalt beobachten, mit der dieser Unterricht erteil wird. Alles soll begriffen werden. Das Leben kann davon abhängen, ob ein Handgriff sitzt oder nicht. Und die Leute haben Anspruch auf Sicherheit; ihre Flugkarten sind sehr teuer, um die Hälfte teurer als die der Touristen. Nach einer reichlichen halben Stunde ist die Lektion hinterm Vorhang beendet. Die first-class-passengers sind für den Ernstfall vorbereitet. Das Bordpersonal begibt sich in die Küche, denn es ist Zeit, das Abendessen aufzutragen. Und die sechzig Passagiere der Touristenklasse? Werden sie nicht unterrichtet im Anlegen der Schwimmwesten? Nein, wozu? Sie sollen, bitte schön, die Gebrauchsanweisung durchlesen. Die ist anschaulich abgefasst, und lesen kann auch jeder. Das eigenmächtige Aussteigen im Katastrophenfall ist nicht gestattet. Nehmen Sie bitte alle spitzen Gegenstände aus den Taschen und die falschen Zähne aus dem Mund. Wegen der Schwimmweste, siehe die Zeichnungen eins bis zwölf. Alles ist anschaulich, jede Riemenschnalle, jede Zugschnur hat ihre ganz spezielle Funktion. Verwechseln Sie da nichts! Ihr Leben kann davon abhängen! Wenn Sie alles beachten, kann es Ihnen sogar gelingen, trocken in eines der Rettungsboote zu gelangen. Außerdem wird der Ernstfall, wie wir hoffen, gar nicht eintreten. Sollten Sie aber Wert darauf legen, im Gebrauch einer Schwimmweste genau unterrichtet zu werden, so haben Sie die Freiheit, für die nächste Luftreise ein Ticket der ersten Klasse zu lösen. Wir beraten Sie gern.
Das Abendessen kommt und der Kaffee. Mein Nachbar zur Rechten ist wieder nicht satt geworden. Er beklagt das, und man bringt ihm eine zweite Portion, die er nicht schafft. Zuweilen muss er aufstoßen; denn sein Magen ist nicht in Ordnung.
Mein Nachbar zur Linken, der in Lissabon zugestiegen ist, ist ein Schneidermeister aus Peru, nachlässig gekleidet und wortkarg. Er spricht nur Spanisch, und ich beneide ihn. Vor meiner Abreise habe ich versucht, Spanisch zu lernen. Ich kann bis dreißig zählen und auch schon einfache Sätze bilden. Zum Beispiel: „Albert fährt nach Paris.“ Aber für meine Arbeit auf Kuba wird das nicht ausreichen. Man sagte mir: Zwinge dich bei jeder Gelegenheit, Spanisch zu reden, zermartere dein Gehirn, quäle dich, bis der Schweiß ausbricht – nur so lernt man eine Sprache. Ich bin fest entschlossen, jetzt damit zu beginnen. Das gute Geschick selbst hat den Schneider aus Peru neben mich gesetzt.
Ich frage ihn, ob das Essen geschmeckt habe. Er kann nur nicken, denn er stochert zwischen den Zähnen. Ich sage, mein Spanisch sei noch sehr mangelhaft; ein durch und durch unsinniger Hinweis, denn er hat das natürlich längst bemerkt. Aber der Mann erwidert höflich: Wieso, mein Spanisch sei sehr gut. Aus dem Kabinenfenster deutend, sage ich dann: „La Iuna!“, zu deutsch: der Mond.
Der Schneider aus Peru schaut hinaus und sagt: „Si, la luna!“
Mehr sagt er nicht. Das Essen hat den Mann ermüdet. Er rekelt sich im Sessel zurecht und schiebt ein Kissen unter den Kopf. Noch bevor ich die Wörter „Schlafen Sie gut“ zusammengestellt habe, ist der Mann eingeschlafen.
ZWÖLF STUNDEN ÜBER DEM ATLANTIK
Allmählich wird es dunkel. Die Leselampen, die über den Sitzen angebracht sind, verlöschen nach und nach. Draußen funkelt der Sternenhimmel, und einige Tausend Meter unter uns blinkt wie eine Silberplatte der nächtliche Atlantik. Auf den Tragflächen der Maschine vibriert das Mondlicht. Es ist sehr warm in der Kabine, und die Motoren sind laut. Der Nachbar zu meiner Rechten, der Gaststättenbesitzer, ist auch eingeschlafen. Er schmatzt manchmal. Er scheint von einer Mahlzeit zu träumen …
Dann steht plötzlich die Stewardess vor dir, das Tablett voller Kaugummis in den Händen. Du hast drei Stunden geschlafen. Das gewaltige Getöse der vier Motoren ist wieder da. Der Lautsprecher sagt: „Schnallen Sie sich bitte an. Wir landen auf Ilha do Sal, Kapverdische Inseln.“
Afrika. Man sieht nur einige Baracken, farbige Positionslichter und in der Ferne eine Hügelkette. Der Mond steht fast senkrecht über dem Flugplatz. Die Luft ist heiß und schwer, und man spürt nach wenigen Sekunden die Feuchtigkeit auf der Haut.
Die Männer, die mit dem Tankwagen an die Maschine heranfahren, um Treibstoff nachzufüllen, sind Neger. Die Kellner im ärmlichen Restaurant, die Verkäuferinnen für Postkarten und Andenken – alle sind Neger. Nur die Polizisten nicht sowie die Herren vom Zoll und von der Flugleitung. Sie sind Portugiesen; denn die Kapverdischen Inseln gehören noch zum portugiesischen Kolonialgebiet. Feigenbäume wachsen wild im Gelände, herrenlose Hunde schlafen in den Ecken. Am Stand liegen Zeitungen aus Lissabon und Segelschiffe, große und mittlere, aus vergoldetem Silber.
Um drei Uhr morgens Ortszeit startet die Maschine wieder. Zu Hause ist es schon sechs. Wir schreiben den 7. Oktober, die Republik macht sich bereit, ihren Geburtstag zu feiern. Ich bestelle einen Kognak. Zum Wohl, und herzliche Wünsche von hier oben, von irgendeinem Punkt über dem Meer.
Wir fliegen nun genau in westlicher Richtung, zwölf Stunden lang über den Atlantischen Ozean. Wenn die Maschine das nächste Mal landet, sind wir in Amerika. Die Nacht wird ungewöhnlich lang für uns werden, denn wir fliegen entgegen der Erddrehung. Die Sonne hat gleichsam Mühe, uns einzuholen. Aber sie schafft es, denn wir sind nicht schnell genug. Und während hier der neue Morgen dämmert, ist es in Berlin bereits zehn Uhr. Der Schneidermeister aus Peru schläft nach dem Frühstück sofort wieder ein. Ich konnte nur flüchtig einige Vokabeln mit ihm wechseln: Brot, Gabel, Motorenlärm. Ich lasse mir Zeitungen bringen und Zeitschriften. Sie sind alle amerikanisch, auch wenn sie nicht in New York, sondern in Madrid oder Hamburg oder Caracas geschrieben und gedruckt sind. Da wird Castro als „Roter Heiland“ beschimpft, und eine westdeutsche Illustrierte vergleicht ihn mit Hitler. Überhaupt sei die kubanische Revolution – diesem Blatt zufolge – der reine Faschismus.
Auch mein Nachbar, der Gastwirt aus Chile, hat einen solchen Bericht in die Finger bekommen. Er reicht ihn mir strahlend. „Hier, lesen Sie mal! Da sind doch die Beweise!“
Daraufhin hatten wir nur noch einen sehr kurzen Wortwechsel. Dann brach der Herr die Beziehungen zu mir ab.
CURACAO
Endlich taucht Land aus der Wüste des Ozeans auf, Inselgruppen, Küstenstriche und schließlich Curacao, die nächste Station der Reise. Die Insel liegt vor der Nordküste Venezuelas und gehört zu den Kleinen Antillen, deren westliche Ausläufer auch „Inseln unter dem Wind“ genannt werden.
Je mehr die Maschine an Höhe verliert, desto kräftiger treten die Farben des Ozeans hervor, vom dunkelsten Blau bis zum hellsten Grün, der Meerestiefe entsprechend.
Wir landen zwar in Südamerika, aber wir landen auf niederländischem Territorium. Beim Verlassen der Maschine glaubt man, einen Backofen zu betreten. Curacao liegt auf dem 12. Breitengrad, und die Hitze hat tropischen Charakter. Aber was schlimmer ist: Wir sind mit Verspätung angekommen, und das Flugzeug nach Havanna hat nicht gewartet. Erregte Debatten, Seufzer und Flüche. Auch Beschimpfungen. Alles ändert nichts. Wir haben heute Freitag, und der nächste Flug nach Miami, mit Zwischenlandungen auf Jamaika und in Havanna findet am Montag statt. Weshalb die Aufregung, meine Herrschaften? Die Gesellschaft wird Sie im ersten Hotel am Platz unterbringen und auf das Beste verpflegen lassen. Sie werden die Sonne genießen und das freundliche Meer. Sie haben ganz unerwartet drei herrliche Urlaubstage erhalten. Das wird die Gesellschaft Tausende kosten. Aber die Gesellschaft wird sich nichts anmerken lassen.
Der holländische Polizist nimmt meinen Pass. Er stellt keine dummen Fragen wie seine Kollegen in Amsterdam. Im Gegenteil. Er stempelt einfach ein Visum in meinen Pass. Ist das nicht leichtsinnig? Gleich ein Visum? Wenn der Mann nur keine Schwierigkeiten mit seiner Regierung bekommt! Und was werden die NATO-Partner dazu sagen?
Das Hotel „Curacao“ gehört zu den Luxushotels dieser Welt. Malerisch liegt es neben der Hafeneinfahrt von Willemstad, dem Hauptstädtchen der Insel. Es hat ein Schwimmbecken mit Meerwasser zu bieten und eine Klimaanlage für alle Räume, die die Temperatur bei etwa zweiundzwanzig Grad hält. Mein Zimmer, aus dem man, wie in allen Zimmern hier, durch ein riesiges Fenster aufs Meer hinausschaut, kostet die Winzigkeit von sechsunddreißig Dollar die Nacht, das heißt 453,60 DM für drei Tage! Dazu die nicht billige Verpflegung – eine Mahlzeit rund zwanzig Mark. Zum Essen hat man mit Schlips und Kragen zu erscheinen. Eine gute Kapelle spielt, ohne aufdringlich zu sein, und auf jedem Tisch brennt eine Kerze.
Wer bevölkert das Hotel, die Liegestühle, das Spielkasino? Amerikaner. Täglich besteht eine direkte Flugverbindung von und nach New York. Das liegt zwar viertausend Kilometer von hier entfernt, und es war viel bequemer, nach Havanna zu fliegen. Aber da der Urlaub auf Kuba nicht mehr verlebt werden kann, sucht man Ersatz für das verlorene Paradies. Geld spielt keine Rolle.
Willemstad gibt sich holländisch: die Giebelfronten der Häuser, die Straßennamen. Auch hier wird mit Gulden bezahlt, nur dass der hiesige anders aussieht und doppelt so viel wert ist wie der Gulden im „Mutterland“. Die Holländer raubten die Insel Anfang des siebzehnten Jahrhunderts den Spaniern; die Sprache der Bewohner, die zum großen Teil Neger sind, trägt noch deutlich spanische Züge. Weit dehnen sich die Elendsviertel der Stadt. In Bretterbuden und Hütten aus Blech vegetieren vielköpfige Familien. Zwischen den Resten verfallener und verlassener Behausungen spielen die Kinder, und die Romantik dieser Spiele wird in ihrer Erinnerung bewahrt bleiben. Romantik der Elenden. Die meisten der Kinder sind nackt. Schuhe kennen sie kaum. Viele von ihnen werden sterben, ehe sie erwachsen sind; denn es gibt hier Parasiten, die sich durch die Fußsohlen in den Körper fressen und innerhalb weniger Jahre den menschlichen Organismus zerstören.
Besuchen Sie Curacao, die Perle der Kleinen Antillen! Glückliche Inseln unter dem Wind! Man trinkt den berühmten Curacaolikör, der dieses Eiland in aller Welt bekannt gemacht hat. Für die Zubereitung des Getränks verwendet man unreife Pomeranzenfrüchte, die hart sind und kirschgroß. Man kann die Äpfelchen aber auch trocknen lassen; sie dienen dann nicht dem Genuss, sondern der Frömmigkeit: Sachgemäß bearbeitet und gedrechselt, werden Rosenkränze daraus gefertigt. Auf je zehn kleine Kügelchen, deren jedes ein Ave Maria bedeutet, folgt immer ein größeres für das Paternoster. Und so fünfzehnmal hintereinander. Da kann man gar nichts falsch machen.
„WAS SIE DA SEHEN, IST KUBA!“
Die Maschine nach Miami startet Montagvormittag. Curacao bleibt unter uns zurück, dann auch Aruba und Jamaika, wo in der Flugplatzbaracke unentgeltlich so viel Rum angeboten wurde, wie jeder Reisende bei vierzig Grad Hitze zu trinken sich entschließen konnte.
Jetzt kann es nur noch Minuten dauern, und aus der blauen Meeresebene werden die Küsten Kubas auftauchen, ein grauer Streifen zunächst, der dann rasch Gestalt annehmen wird. Es sind erregende Minuten, obwohl der Landstrich ebenso aussehen wird wie alle Landstriche, die dir am Horizont entgegenkamen. Du wirst gar keine Einzelheiten erkennen, nicht die Berge und Flüsse und nicht die Felder mit Zuckerrohr. Du wirst nur Land sehen, aber es wird Kuba sein, dessen jüngste Geschichte seit Jahren die Gemüter und Journale in aller Welt bewegt und dessen Städte und Dörfer du während der nächsten Monate durchforschen wirst.
Wohl jedes Schulkind der Erde hat irgendwann den Namen Christoph Kolumbus oder Cristóbal Colón, wie sein spanischer Name lautet, an die Tafel oder in sein Heft geschrieben. Dann war stets von der „Santa Maria", dem Segelschiff des Entdeckers, die Rede und auch von Kuba. Der 28. Oktober 1492, da Kolumbus mit seinen knapp hundert Leuten die Insel betrat, soll ein Sonntag gewesen sein. Was er danach geäußert haben soll, dass nämlich Kuba das schönste Land sei, das Menschenaugen je gesehen haben, ist seither millionenfach gedruckt worden. Ebenso oft sind die Fahrten des ehrgeizigen Kolumbus, mit dem Schein romantischer Bewunderung umgeben, dargestellt worden. Eine Druckschrift über Nordamerika und den karibischen Raum, die im Flugzeug verteilt wurde, behauptet, dass die Entdeckung der Neuen Welt nur ganze siebentausend Dollar gekostet und Kolumbus selbst nur dreihundert Dollar erhalten habe. Wie groß und wie bescheiden in seiner Größe war doch dieser Mann, der in Wahrheit unverschämte Forderungen erhob, ehe er bereit war, die Fahrt anzutreten: die Titel eines Admirals und eines Vizekönigs, ein Zehntel aller Einkünfte aus den neu zu unterwerfenden Gebieten und die Partnerschaft an dortigen Monopolgeschäften der Spanischen Krone.
Wie märchenhaft billig war es doch, Amerika zu entdecken, wenn man bedenkt, wie reich die Früchte, wie unbegrenzt die Möglichkeiten, die dieser Tat zu danken sind! Ganze siebentausend Dollar hat es gekostet! Wie preiswert!
Und was hat es wirklich gekostet?
Die Geschichte Kubas wird mit dem Tage der Entdeckung der Insel eine Leidensgeschichte. Die Spanier besetzen das Land, gründen Siedlungen und befestigte Städte. Sie nennen die Insel „Juana“ und metzeln die einheimischen Indios grausam nieder. Schon wenige Jahrzehnte nach der Ankunft der neuen Herren ist die Urbevölkerung Kubas fast vollständig ausgerottet. Sklaven aus Afrika werden ins Land gebracht, und Jahrhunderte hindurch ist Havanna ein Zentrum des Sklavenhandels in Amerika. Man beginnt Tabak zu kultivieren und dann vor allem Zuckerrohr, das Reichtum und zugleich Geißel Kubas wird. Mit dem Wohlstand der Besitzenden wächst das Elend der Unterdrückten. Doch auch ihre Kraft nimmt zu. Sie bewaffnen sich und beginnen den Kampf gegen die Unterdrücker. Das neunzehnte Jahrhundert ist ein blutiges und heroisches Jahrhundert für die Zuckerinsel. Die Spanier werden niedergerungen. Nach vierhundertjähriger Herrschaft müssen sie Kuba verlassen. Aber die Ablösung steht schon bereit. Die „Perle der Antillen“ wird eine Kolonie der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Regime der neuen Herren hat andere Formen, ist aber darum nicht weniger grausam als das der vertriebenen Herren. Das letzte Kapitel der Leidensgeschichte Kubas hat begonnen. Es dauerte sechzig Jahre und endete erst in unseren Tagen.
Am Horizont sind nun Inselchen und Landstriche sichtbar geworden. Je näher wir der Küste kommen, desto stärker wechselt die Farbe des Meeres vom Blau ins Grün. Manchmal scheint es, als bewegten sich Boote auf dem Wasser; aber es sind nur Schaumkronen.
Auf die Frage eines Reisenden antwortet der Steward im Vorbeigehen: „Ja, was Sie da sehen, ist Kuba!“
Die beiden Herren schräg vor mir bemühen sich angestrengt, keinerlei Notiz davon zu nehmen. Wie ich ihrem Gespräch entnehmen kann, sind sie Geschäftsleute aus dem US-Staat Florida. Es muss peinlich für sie sein, an ihr verlorenes Paradies erinnert zu werden und mit quälenden Gedanken auf eine Insel hinabzuschauen, wo jetzt Straßen zu erkennen sind und Siedlungen, eingestreut zwischen Flüsse und Felder in ein sattes, fruchtbares Grün.
Dann die weite Bucht von Havanna und das Häusermeer der Millionenstadt. Die Erde eilt rasch auf uns zu; Weiden, Rinder und Palmen rasen wie auf einem Laufband dahin. Die Maschine setzt auf.
Havanna empfängt seine Gäste mit heißer Musik. Drei Männer stehen unten an der fahrbaren Treppe und singen. Zwei Gitarren und zwei Rumbakugeln. Die Geschäftsleute aus Florida bemühen sich angestrengt, keine Notiz davon zu nehmen. Sie hören nicht hin. Es wäre ihnen wohl angenehmer, während des Zwischenaufenthaltes im Flugzeug bleiben zu können. Aber auch Transitpassagiere müssen aussteigen. Das ist überall in der Welt so.
Über dem Empfangsgebäude des Flughafens von Havanna steht in großen grellroten Buchstaben: CUBA – TERRITORIO LIBRE DE AMERICA … freies Territorium von Amerika.
II Havanna
PARADIES DER SÜßEN LASTER
Der Spanier Diego Yclázquez gründete La Habana an der Südküste Kubas, etwa dort, wo sich heute das Städtchen Batabanó befindet. Das war 1515. Aber schon fünf Jahre später „verlegte“ man Havanna an die Nordküste der Insel, wo die Natur längst ein musterhaftes Hafenbecken vorbereitet hatte.
Dort wuchs die Stadt und wurde gut befestigt, weil sie mehrmals von Seeräubern heimgesucht und von den Engländern sogar für ein Jahr erobert worden war. Der Hafen wurde Sammelplatz jener berühmten Gallionen der spanischen Kriegsflotte, die die geraubten Gold- und Silberschätze Amerikas nach Spanien transportierten. Havanna, der Ort, wo Kolumbus begraben lag, zählte bald zu den bedeutendsten Tabak- und Kaffeehäfen der Welt und war ein blühender Sklavenmarkt.
Während der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts wächst es zur modernen Millionenstadt heran und wird ein Tummelplatz der Dollarkönige. Seeleute und schlechte Filme sprechen von Havanna als dem Paradies der süßen Laster. Hotelgiganten und Spielkasinos, Mädchenhandel und Korruption. Kinder gehen barfuß und betteln. Was im dreißigstöckigen Habana-Hilton-Hotel ein Appartement die Nacht kostet, davon muss die Familie des Landarbeiters am Rande der Stadt drei Monate existieren. Mit acht oder zehn Personen.
Und doch geht Havanna durch Millionen naiver Träume, geträumt überall im Lande in engen Hütten aus Palmblättern, auf hartem Lager, nach einer Mahlzeit, die den Hunger nicht gestillt hat. Havanna ist ein Meer von Licht; man hat es auf Bildern gesehen. Dort gibt es große Häuser voller Schuhe und Kleider, und Leute essen sich satt. Und auch Hoffnung ist in den Träumen, denn man hört, dass aus dem Verborgenen gegen die Tyrannei gekämpft wird. Lange bleibt Havanna die märchenferne Hauptstadt, ein Traum.
Die Fremden und die Reichen des eigenen Landes haben sie eingerichtet nach ihrem Geschmack, und sie fühlen sich dort wohl. Sie haben ihre Paläste ans Meer setzen lassen. Alle Reichtümer, die sie dem Lande und seinen Menschen abjagen, sind hier in Havanna zusammengetragen. Sogar den Strand haben die Herrschaften zu ihrem Eigentum erklärt; sie haben Zäune aufgestellt:. Überall steht Militär bereit. Sie wollen die Stadt nicht hergeben. Ihr letzter Mann hieß Batista. Er hatte sich zum General ernannt und zum Staatsoberhaupt. Sein Blutregime kostete zwanzigtausend Kubanern das Leben. Er floh in den Morgenstunden des 1. Januar 1959 vor der siegreichen Armee der Bauern und Arbeiter Kubas, als das Volk der Zuckerinsel auch seine Hauptstadt in Besitz zu nehmen begann.
Seitdem sind erst zwei Jahre vergangen. Tür an Tür mit dem Heute wohnt noch das Gestrige. Man ist schon dabei, die Sümpfe trockenzulegen, aber die Sumpfblumen wuchern noch.
Die Laster der Jahrzehnte sterben nicht über Nacht.
RAFAEL MIT DEM HUT
Er hatte mich auf dem Prado angesprochen, jener breiten Prachtallee in der Altstadt von Havanna, wo noch zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts, da Alexander von Humboldt durch Kuba reiste, die Baracken des Sklavenmarktes gestanden haben.
Zunächst hatte ich nicht auf das Reden des Mannes reagiert, aber er blieb hartnäckig. Er sprach notdürftig Englisch und hatte Ware anzubieten. Menschenware. Er trug einen Strohhut. Keines der Mädchen sei älter als zwanzig Jahre, versicherte der Mann. Die Jüngste sei fünfzehn.
„Aber das interessiert mich nicht“, sage ich.
„Es ist nicht weit“, versetzt der Mann. „Zwei Blocks von hier!“
Er folgt mir und schwatzt unaufhörlich. Jede Stadt habe ihre Sehenswürdigkeiten. Wer in Havanna sei, ohne die Girls kennenzulernen, der lerne überhaupt nichts kennen von dieser Stadt.
Es sind enge Straßen, durch die ich gehe. Kaffeestände und Restaurants, Bars und Filmtheater. An den Ecken kann man Schmalzgebäck kaufen und geröstete Erdnusskerne. Männer mit großen fünfstelligen Zahlen am Hut bieten Lose an. Ein Gequirl von Menschen, und über allem liegt der Lärm wie ein Nebel: Autohupen, Schreie, Musikautomaten.
„Hier sind wir schon!“, sagt plötzlich der Mann. „Dort oben.“
Es ist ein normales einstöckiges Haus; unten ein Schuhgeschäft. „Sie brauchen ja nur mal zu sehen. Das verpflichtet nicht.“
Er spekuliert auf meine Schwäche. Wenn ich ihn nur erst oben habe, denkt er.
„Wie viel bekommen Sie, wenn Sie einen Gast bringen?“, frage ich.
„Nicht viel“, antwortet der Mann.
„Haben Sie keine Arbeit?“
„Das ist meine Arbeit. Ich bin Fremdenführer. Früher verdiente man gut, jetzt sind schlechte Zeiten. Haben Sie eine Zigarette?“
Ich biete ihm eine meiner kubanischen Zigaretten an. Er hatte amerikanische erwartet und ist enttäuscht.
„Gehen wir hinauf?“, fragt der Mann.
„Was soll ich dort?“
„Eine gute Zeit haben“, antwortet er wörtlich. „Die Mädchen sind jung, alles Küken. Sie können sie sich aussuchen.“ Er schiebt seinen Strohhut aus der Stirn.
„Ist das ein Lokal dort oben?“
„Nein. Es ist eine Wohnung. Die Mädchen wohnen bei der Frau. Sie kochen da und sind wie eine Familie.“
„Was ist das für eine Frau?“
„Eine Ältere. Sie hat die Küken bei sich aufgenommen. Es ist eine saubere Wohnung. Sie werden sehen. Gehen wir!“
Der Mann wird ungeduldig. Er nimmt den Strohhut ab, dreht ihn zwischen den Fingern, schaut hinein und setzt ihn wieder auf. Ich schätze den Mann auf Mitte Zwanzig. Er ist kräftig. Ob er an diesem Geschäft beteiligt sei, frage ich.
„Zehn Prozent waren ausgemacht. Aber ich weiß, dass die Alte mich betrügt. Manchmal gibt sie mir eine Mahlzeit. Kommen Sie, wir gehen!“
„Nein, ich mag nicht!“
„Wollen Sie lieber in eine Bar mit Tanz und einer Show?“
„Auch nicht“, sage ich.
Der Mann rückt wieder an seinem Hut. „Haben Sie einen Kaugummi? Oder Dollars? Ich tausche Dollars gegen Pesos. Drei Pesos für einen Dollar.“ Das sagt er leiser und blickt sich dabei um.
„Aber Dollar und Peso stehen eins zu eins“, entgegne ich.
„Standen!“, erwidert der Mann rasch. „Unser Geld ist jetzt nichts mehr wert.“
„Wer sagt das?“
„Man sieht es“, meint er.
„Bekommt man für einen Peso jetzt weniger zu kaufen als vor der Revolution?“, frage ich. Ich habe nämlich inzwischen erfahren, dass es sich genau umgekehrt verhält.
„Das nicht“, sagt der Mann. „Aber die Amerikaner verlangen manchmal sogar vier Pesos für einen Dollar. Unser Geld ist nichts mehr wert.“
„Es ist mehr wert als vor der Revolution“, antworte ich. „Und die Amerikaner betreiben den Schwindel, weil die kubanische Revolution ihnen nicht gefällt.“