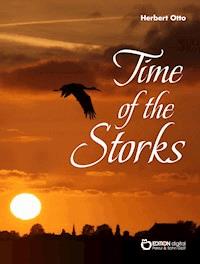7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Zwei DDR-Schriftsteller und ein Fotograf reisen 1958 und 1960 von Berlin mit einem mit Gepäck vollgestopften, klapprigen Auto über Griechenland in den Norden Afrikas und zurück über Sizilien, insgesamt 50 000 Kilometer. Sie besuchen einige Sehenswürdigkeiten, aber ihr großes Interesse gilt den Menschen dieser Länder. Sie schließen Freundschaften, erfahren große Hilfsbereitschaft, wenn das Auto mal wieder repariert werden muss, und begegnen vielen neugierigen, wissbegierigen Menschen. Ihr Budget ist klein, doch mit ihrer einfachen Campingausrüstung findet sich oft ein kostenloser Schlafplatz. Nach über 60 Jahren liest sich das Buch wie ein Eintauchen in eine relativ friedliche Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impressum
Herbert Otto
Stundenholz, Minarett und Mangobaum
Eine Entdeckungsfahrt ins Morgenland von 1960
ISBN 978-3-95655-319-6 (E-Book)
Die beiden Bücher „Stundenholz und Minarett“ und „Minarett und Mangobaum“ erschienen erstmals 1960 im Verlag Volk und Welt Berlin. Da der zweite Autor, Konrad Schmidt, nicht gefunden wurde, sind in dem E-Book beide Bücher zusammengefasst, allerdings nur die Texte von Herbert Otto. Auch auf die Fotos von Jochen Moll musste verzichtet werden.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2020 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected]
HEISSES HELLAS
ERSTE BEKANNTSCHAFTEN
Königliche Gesichter
Manchmal findet der Grenzübertritt gar nicht statt. Du verlässt die Grenzstation des einen Landes und erreichst nach einigen Kilometern die des anderen. Dazwischen ist Landschaft; Straße, Himmel und Feld. Alle Sträucher sind grün.
Du kannst keinen neuen Abschnitt entdecken, obwohl du weißt: Hier irgendwo muss jene Linie verlaufen, die zwei Völker trennt, die dich im Augenblick des Übertritts anderen Gesetzen unterwerfen und das Geld in deiner Tasche, das eben noch gültig war, entwerten wird. Vielleicht hast du sie eben überschritten? Doch die Natur hat die Grenze nicht markiert. Und wo es die Menschen nicht getan haben, wartest du vergebens auf jenen Moment, dem du mit heimlicher Erregung entgegengefahren warst. Darum bist du ein bisschen enttäuscht. Das Stück Pedanterie in dir ist unbefriedigt. Die Zöllner des anderen Landes wühlen bereits in deinem Koffer, und dir scheint immer noch, der Grenzübertritt habe gar nicht stattgefunden.
Auf dem Wege von Jugoslawien nach Griechenland ist das anders. Es sind zwar weder Steine noch bunt gestrichene Pfähle zwischen den beiden Stationen aufgestellt. Trotzdem ist die Grenze markiert. Die unbefestigte Sand- und Schotterstraße, an die wir seit Tagen gewöhnt waren, die uns Nerven und Zeit gekostet und unseren Wagen um seinen Auspuff gebracht hatte – diese Straße endet plötzlich. Eine freundlich-glatte Asphaltstraße beginnt. Der Wartburg hat aufgehört zu zittern. Er rollt wie ein Auto dahin, vernünftig und ohne Lärm.
Leider sind gute Straßen kein Beweis für die Güte des Staates, der sie bauen ließ.
Am Horizont tauchen die ersten Häuser auf, königlich-griechische Häuser. Die Bäume sehen hier genauso aus wie die jugoslawischen. Aber man nennt sie anders und schreibt ihre Namen mit anderen Buchstaben. Die Erde ist hier die gleiche wie zuvor. Nur sind ihre Reichtümer anders verteilt. Für ein Kilo Brot werden wir heute das Doppelte von dem zu zahlen haben, was wir gestern dafür bezahlten …
Vor dem modernen Gebäude der Zoll- und Grenzstation warten Wagen aus aller Herren Ländern: aus Italien, Syrien, der Türkei und dem Iran. Elegante Damen und Herren, eigensinnige Kinder, Geschäftsleute, Touristen. Grenzbeamte gehen eilig, Papiere unter dem Arm.
Wir sind noch nicht dran. Wir beobachten, wie andere ihre Koffer schleppen, vom Auto ins Haus oder umgekehrt. Eine schreckliche Ahnung befällt uns. Es wäre das harte Werk einer guten Stunde, unser Auto aus- und wieder einzuräumen.
Da steht ein türkischer Omnibus. Junge Mädchen und Burschen, mit denen wir ins Gespräch kommen. Es sind Musikstudenten, die zu Konzerten nach Österreich fahren. Sie bestaunen unser Vorhaben und – unsere Schuhe. Eigentlich sind es keine Schuhe. Es sind Sandalen: eine Sohle und schmale graue Lederriemchen. Wir haben sie am Straußberger Platz gekauft. Sie kosteten um 9 DM und stammen aus der CSR. Gibt es keine Schuhe in der Türkei? Doch, aber nicht so geschmackvolle. So?
Andere Leute gesellen sich zu unserem Kreis. Man buchstabiert über der Reiseroute, die kühn und bunt auf der Kühlerhaube steht. Ein Herr aus dem Iran verschluckt sich, als er Moskau liest. Mit verdunkeltem Blick sieht er uns der Reihe nach an und schätzt flüchtig den Wagen ab. „So, aus Ostberlin!“
Er tritt einen Schritt zurück, er hat uns durchschaut. Er steckt eine Miene auf, als wollte er jeden Augenblick die Diskussion über Ungarn beginnen. Aber dann besinnt er sich, geht ohne ein weiteres Wort und schießt noch einen Strafblick ab auf jene, die sich mit uns eingelassen haben.
Endlich sitzen wir im Dienstraum der Station vor einem der Tische. Die Einrichtung ist gediegen und modern. Es gibt auch eine Bar in der Nähe. An der Wand hängt das griechische Königspaar, und die feine Würde ihrer Gesichter hat ausgestrahlt; viele der Beamten hier geben sich gleichermaßen königlich.
Papiere werden uns zugeteilt, Fragebogen verschiedener Art und Größe. Wir sind vorerst beschäftigt.
Name des Vaters … Konfession … Welche optischen Geräte führen Sie mit sich?
Dann will man an unser Gepäck. Ein Uniformierter kommt mit zum Wagen. Er wählt fünf Koffer aus, die wir jetzt, bitte sehr, hineinzubringen haben auf den Tisch des Hauses. Wir hatten es geahnt! Zwei der auserwählten Koffer liegen ganz zuunterst. Aber noch ehe wir recht Hand an unser Gepäck gelegt haben, naht die Rettung in Gestalt eines anderen königlich-griechischen Grenzbeamten. Er fragt, ob wir nach Saloniki wollten und ob wir zu dritt wären. Er überzeugt sich noch einmal, dass vier Plätze im Wagen sind, und beginnt mit dem Manne zu tuscheln, der es auf unsere Koffer abgesehen hat. Und siehe: Die Pflichtvergessenheit ist groß! Dem Uniformierten genügt plötzlich ein sehr flüchtiger Blick in einen unserer Koffer. Er händigt uns die Papiere aus. Der andere schickt sich an einzusteigen. Aber leider müssen wir ihm nun eröffnen, dass wir ihn im Interesse unseres Fahrzeuges nicht befördern können. Der Wagen habe auf den Straßen durch Jugoslawien empfindlich gelitten, und noch mehr Belastung könne ihm nicht zugemutet werden. Die abgerissene Auspuffanlage, die zwischen den Sitzen liegt, ist Beweis genug. Nicht böse sein, und noch einmal vielen Dank!
Türkenpfunde
Wir fahren in Richtung Saloniki. Es ist inzwischen Abend geworden. Wir haben keine einzige Drachme in der Tasche, nur die Reiseschecks in englischer Währung und ein paar türkische Pfunde. Die Wechselstube der königlich-griechischen Grenzstation hatte schon geschlossen.
Die Dörfer, die wir durchfahren, haben Ausgang. Manchmal scheint es, als wären alle Einwohner mit Kind und Kasten auf die Straße gekommen. Sie schlendern unbekümmert. Wozu haben sie die gute glatte Straße mitten durch den Ort? So ungefähr müsste es sein, wenn man versuchen wollte, am Abend des 1. Mai Unter den Linden in Berlin oder gar in der Moskauer Gorkistraße mit dem Auto zu fahren. Schrittgeschwindigkeit, und wenn man hupt, schimpfen die Leute.
Wir kommen an Dutzenden kleinen Lokalen vorüber, die an der Straße liegen. Stühle und Tische stehen unter freiem Himmel. Bunte Lichtergirlanden. Dann und wann flutet eine Woge greller Musik heran.
Ganz plötzlich taucht ein Flimmerberg aus der Dunkelheit auf. Ein riesiges Kissen scheint da zu liegen, mit glitzernden Steinen bestickt, über und über. Saloniki, nach Athen die größte Stadt des Landes.
Wir hatten beschlossen, kurz vor Saloniki einen geeigneten Schlafplatz zu suchen. Am nächsten Morgen wollten wir in die Stadt, um Geld zu tauschen und in der Wartburg-Vertragswerkstatt den Auspuff zu reparieren.
Es sollte ganz anders kommen.
Noch ehe die Außenbezirke der Stadt erreicht sind, bemerken wir links der Straße ein hell erleuchtetes Restaurant. Alle Tische sind leer. Es ist ein frei stehendes Haus, von unbebautem Gelände umgeben. Hier müsste sich ein Zeltplatz finden lassen. Wir halten an.
Der Motor ist noch nicht abgestellt, da erscheint der Gastwirt bereits, reißt die Wagentüren auf und gibt zu erkennen, dass wir ihm über alle Maßen willkommen sind. Ein Lautsprecher krakeelt. Er muss irgendwo an der Außenwand des Hauses befestigt sein. Wir machen dem Manne behutsam verständlich, dass die Musik uns ein wenig laut erscheint. Schon ist er auf und davon, verschwindet im Innern der Gaststube, und die Musik bricht plötzlich ab.
Wir stehen unschlüssig da. Jeder behauptet vom anderen, er sähe sehr mitgenommen und verhungert aus. Wann hatte das Mittagsschnitzel stattgefunden? Vor zehn Stunden. Seitdem sind wir gefahren. Und ein Glas Wein vor dem Schlafengehen?
Aber wir haben keine Drachme in der Tasche. Reiseschecks nimmt nur die Bank. Was bleibt, sind die Türkenpfunde. Wir beschließen, eine Zehnpfundnote anzulegen.
Der Mann ist zurückgekommen, betrachtet die fremde Banknote flüchtig und steckt sie rasch ein. Er nötigt uns, Platz zu nehmen. Sofort verschwindet er hinter seinem Verschlag und erscheint gleich darauf mit mehreren Flaschen. Aber erst muss der Gegenwert für die türkische Note ausgehandelt werden. Es ist ein eigen Ding mit diesen Noten. Ihr Preis pendelt sehr erheblich über den eigentlichen Wert der Note hinaus. Sowohl nach unten wie nach oben. Wir hatten sie in einer Münchner Bank billig gekauft. Zahlte der Mann zwanzig Drachmen für die Zehnpfundnote, hätten wir weder Gewinn noch Verlust.
„Also, was bieten Sie?“
Er neigt den Kopf, lächelt, als hätte er um Nachsicht zu bitten, und zieht den Schein aus der Tasche. Die Banknote hat sich schon ziemlich verändert. Sie ist nur noch ein zerknülltes Stück Papier. Ein Fahrschein oder so. Das scheint hier üblich zu sein. Man steckt Geldscheine so in die Tasche, wie wir manchmal Zeitungspapier in nass gewordene Schuhe stopfen.
„Vierzig!“, sagt der Mann. Er sagt es englisch. Sieh mal an! Wie hoch hier die Türkenpfunde stehen. Doch da man uns zu Hause eingeschärft hat, nie und nirgends ein Geschäft abzuschließen, einen Einkauf zu tätigen, ohne vorher mit dem Partner tüchtig gehandelt zu haben, erwidern wir: fünfzig!
Jetzt bietet der Mann fünfundvierzig, und die Sache ist erledigt. Molli behauptet, es sei ein Fehler gewesen, in München nicht ein paar Türkenpfunde mehr gekauft zu haben. Wir widersprechen nicht.
Mit Hilfe des Sprachführers bestellen wir Eier mit Schinken, Brot, Tomatensalat und Käse. Die Preise werden vorher ausgehandelt. Eier erscheinen uns teuer. In Jugoslawien hätten wir weniger bezahlt, sagen wir dem Wirt. Er glaubt es nicht und versichert, sie seien in Saloniki, in der Stadt selbst, noch teurer.
Nach dem Essen eine Flasche Wein. Sie soll dreizehn Drachmen kosten, zwei Mark etwa. Das ist billig genug. Doch um zu sehen, wie der Wirt sich verhalten wird, bieten wir neun. Der Mann fängt an, eine wehleidig-gestenreiche Geschichte zu erzählen. Er weiß genau, wir verstehen kein Wort. Aber das tut nichts. Er sagt schließlich zwölf. Und wir zehn. Da geht er auf elf, und die Flasche wird geöffnet.
Der Mann ist ein kleines Erlebnis für uns. Er sieht nicht aus, wie gemeinhin ein Gastwirt aussieht. Er könnte Gemüsehändler sein oder Zeitungsverkäufer.
Er ist beredt wie ihrer zehn. Er holt Zigaretten aus der Nachbarschaft und rennt wie ein Zwölfjähriger. Auf die Frage nach dem Preis der Schachtel erwidert er mit lammfrommer Miene: sieben. Sie kostet in Wirklichkeit nur fünf.
Es kommen andere Gäste. Sie setzen sich an unseren Tisch. Es sind Schlosser und Kraftfahrer, die ganz in der Nähe wohnen. Der Wirt schmeißt eine Runde Bier. Die Unterhaltung mit Hilfe von Bleistift, Papier und Sprachführer ist zwar umständlich, belustigt aber alle Teilnehmer. Es dauert lange, bis wir erfahren haben, dass die Schlosser nicht mehr als zweihundert Mark monatlich verdienen.
Wir sind eine laute, freundschaftliche Runde. Eine weitere Zehnpfundnote wird angelegt. Noch eine Flasche Wein für alle, und dann ins Zelt. Selbstverständlich dürfen wir hier neben dem Haus unser Zelt aufschlagen. Es ist, als wollte der Wirt sagen: Ich bitte sogar darum! Und das Frühstück morgen wird königlich sein!
„Liebe“' wird organisiert
Bald nach zweiundzwanzig Uhr haben sich die anderen Gäste verabschiedet. Wir sitzen bei der letzten Zigarette. Der Wirt scheint noch etwas auf dem Herzen zu haben. Er prüft verstohlen unsere Gesichter, als gälte es, noch einen letzten Zweifel bei sich auszuräumen. Er hüstelt verlegen, lächelt mal ein bisschen, ganz ohne Grund. Endlich gibt er sich einen innerlichen Ruck.
„Schon schlafen?“, fragt er vorsichtig, halb englisch, halb französisch.
Wir sagen ihm, dass wir müde sind. Den ganzen Tag im Auto. Schlechte Straßen. Er nickt, aber er gibt nicht auf. Das sieht man deutlich. Es arbeitet in ihm. Er kratzt sich den Kopf und schießt unablässig seine listig-forschenden Blicke auf uns ab. Anscheinend krempelt er sein Gedächtnis nach ausländischen Brocken um. Plötzlich sagt er: „Nix gut alleine schlafen!“
Er sagt es abwartend. Er grinst und zeigt auf das Stückchen Mond und auf den übrigen Himmel drum herum. Er meint die liebliche Sommernacht, und es soll ein Argument sein.
Da wir uns unbeeindruckt zeigen, wird er lebhaft.
„Scheenes Girl!“, sagt er hingeschmolzen. Er schmatzt, als ob es sich um Cremespeise handelt.
„Zwei Minut!“, sagt er dann und deutet dringlich irgendwohin.
Es sind wirklich nur ein paar Hundert Meter. Der Mann führt uns in eine Kneipe, die seiner eigenen ähnlich sieht: Tische unter freiem Himmel, drin die Theke und Hunderte von Flaschen dazu. Nur, dass hier noch eine Wirtin tätig ist, beleibt und mit Augen, die längst Bescheid wissen über dieses Leben. Wirt und Wirtin taxieren uns ab. Elegant sind wir nicht. Sandalen, Hemd und Hose. Aber wir sind Ausländer. Meistens haben die Geld. Ein Tisch wird eilig abgewischt, die Stühle werden zurechtgerückt. Bitte sehr, die Herren!
Auch hier sind wir die einzigen Gäste. Auf einem der Stühle liegen zwei Katzen. Von irgendwo klingt Gitarrenmusik herüber, zaghaft. Die Nacht ist sehr warm, und drüben flimmert der Lichthügel Saloniki. Etwas Lockendes ist in diesem Flimmern. Man müsste mit seinem Mädchen diese schmale Straße hier entlanggehen. Weiter unten sind ein paar Häuser im Mondlicht. Manchmal kläfft ein Hund.
Wir schlürfen das Bier und beobachten, wie man die „Liebe“ organisiert. Der Mann, der uns herbrachte, hat mit dem Wirt getuschelt und sich dann zu uns gesetzt. Er nickt immer mal herüber und kneift verschwörerisch ein Auge ein. Die Wirtin erhält ein Kopfzeichen ihres Mannes und verschwindet um das Haus herum.
Es dauert eine Weile. Der Mann am Tisch ist bemüht, uns bei guter Laune zu halten. Er schmatzt wieder: So schön werde das Mädchen sein! Dann kehrt die Frau zurück und flüstert mit dem Wirt.
Das Bett
Zehn Minuten später erscheint das Mädchcn. Die Wirtin führt sie an unseren Tisch. Wir begrüßen uns. Georgia heißt sie und wird Anfang Zwanzig sein.
Sie ist eine zierliche Person, hat dunkles Haar und kleine scheue Vogelaugen.
Sie sitzt auf der Stuhlkante und spielt mit einem Schlüssel. Es ist wohl der Zimmerschlüssel. Ihr Englisch hat ganz unverkennbar amerikanische Färbung, und die Frage danach ist ihr peinlich. Saloniki ist ein Stützpunkt der Amerikaner.
Sie kann sich denken, dass wir das wissen. Sie fragt, ob wir das erste Mal in Griechenland seien. Der Wirt bringt ihr ein Bier, und sie fragt, ob das griechische Bier uns zusage. Nachdem auch über das Wetter gesprochen ist, steuert sie auf den Kern der Dinge. Sie ist des trocknen Tons gewissermaßen satt. Sie will jetzt wissen, wer den Anfang macht.
Keiner wird den Anfang machen. Wenn überhaupt, werden wir zu dritt mit ihr gehen. Zunächst weiß sie nicht, was sie von dem Angebot halten soll. Und ihr Zimmer sei sehr klein.
Das macht ja nichts, erwidern wir.
Also wird eine Flasche Wein gekauft, Gläser werden bei der Wirtin ausgeliehen, und das Mädchen geht voraus, um die Kneipe herum und schräg über ein Feld.
Sie lässt uns in ein kleines Haus ein. Rechts im Flur ist die Tür zu ihrem Zimmer. Wir sollten leise sein, sagt sie. Ein winziger Lichtschein kommt uns entgegen. Es ist eine elende Behausung, in die wir eintreten. Der Raum ist niedrig, zwei mal drei Meter, und hat ein einziges Fensterchen, nicht größer als ein Briefbogen. Ein Stück Blumenstoff ist über Eck gezogen, um eine Kleidernische abzuteilen. Ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch. Das ist alles.
Man sieht deutlich, dass das Mädchen sich schämt. Wegen dieser elenden Szenerie? Oder wegen des schweren Geruchs aus Moder und Schweiß? Oder weil wir das Bett sehen, auf dem sie sich verkauft, an jeden, der bezahlen kann?
Wir sitzen um das Tischchen und trinken. Der Docht der Petroleumfunzel ist weit heruntergeschraubt und blakt manchmal. Das Mädchen ist still geworden. Sie hält das Glas mit beiden Händen. Sic spricht nur, wenn wir etwas fragen. Ihre Mutter lebt in Volos, einer Hafenstadt. Sie selbst wohnt noch nicht lange hier. Ihrer Mutter schickt sie jeden Monat etwas. Vorher hat sie in Saloniki gearbeitet, in einem Restaurant.
„Haben Sie dort Ihr Englisch gelernt?“
Sie nickt leise. Sie hat ihr Glas schon ausgetrunken.
„Und warum sind Sie weggegangen?“
Sie zuckt mit der Schulter.
„Mussten Sie gehen?“
,,]a, ich musste!“, sagt sie unwirsch. „Es sind genug andere da, die es besser verstehen. Noch halbe Kinder. Aber das wollen doch die Herren!“
Sie hat einen bösen Ausdruck im Gesicht, eine Bitternis, die jedoch rasch wieder schwindet. Sie sieht uns der Reihe nach herausfordernd an. Sie hat ihr Glas schon das zweite Mal ausgetrunken. Sie öffnet die Knöpfe ihrer Bluse, unter der sie nichts weiter trägt. Sie sagt, es sei heiß. Das stimmt. Der Raunt ist zu klein für vier Personen. Er ist für zwei gedacht.
„Und haben Sie etwas gelernt?“
Sie schüttelt gelangweilt den Kopf, ein wenig traurig auch, wie es scheint. Sie fächelt sich Luft zu mit der geöffneten Bluse. Wir sollen sehen, wie nackt sie ist. Sie füllt wieder ihr Glas und stößt mit uns an.
„Und können Sie nicht noch etwas lernen?“ Ich stelle diese Frage, weil ich mich eines oft gebrauchten Arguments erinnere: Die Frauen in diesen Ländern, die vom Verkauf ihres Körpers lebten, wollten es gar nicht anders. Sie hätten keine Lust zu arbeiten.
„Was lernen?“, fragt sie.
„Vielleicht irgendetwas in der Tabakindustrie oder …“
Sie lacht auf, laut und bitter. Ob ich wüsste, wie viel Leute im Lande eine Arbeit suchten? Und sie lacht wieder. Ich weiß es und sehe, dass die Frage nichts getaugt hat. Sie trinkt jetzt hemmungsloser als zu Beginn. Der Wein war sehr billig und schmeckt überhaupt nicht.
Einmal, als draußen vor dem Hause Schritte vorübergehen, lauscht sie gespannt und bedeutet uns, zu schweigen. Die Polizei darf nichts entdecken. Das Gewerbe scheint nicht angemeldet.
Endlich will sie wissen, ob wir nur gekommen seien, ihr unnötige Fragen zu stellen?
„Wir wollten uns unterhalten!“
Schweigen tritt ein. Das Mädchen trinkt ihr Glas in einem Zuge leer. Sie lässt sich hintenüber auf das Bett fallen. Die Bluse ist weit geöffnet. Das Mädchen ist sehr mager. Vielleicht zu mager für ihren Beruf, muss ich unwillkürlich denken.
Sie weint leise vor sich hin. Sie gibt keine Antwort mehr.
Wir haben sie enttäuscht. Das Leben ist gehässig und teuer. Vom Reden wird sie nicht satt. Sie hatte schon mit der Einnahme gerechnet. Und dann sind das solche Gäste.
Sie steht langsam auf, knöpft die Bluse zu und steckt sie im Rock zurecht. Sie holt ein Taschentuch unterm Kopfkissen hervor und wischt die Tränen ab. Wenn wir nichts von ihr wollten, sagt sie, müsste sie jetzt schlafen gehen. Und vierzig Drachmen bekäme sie. Nicht für sich selbst. Das sollten wir nicht denken. Es wären nur die Unkosten, die sie mit uns hätte. Wir seien fast eine Stunde mit ihr im Zimmer gewesen. Und der Kerl da vorne verlange von ihr zwanzig Drachmen je halbe Stunde … sobald jemand bei ihr sei.
So teuer und erbärmlich kann das Leben sein.
Wir geben ihr das Geld. Zahlen nicht die Maler auch, wenn sie für knappe Zeit ein Stück Natur belauschen wollen?
Vorne in der Kneipe sitzen der Herr Geschäftsführer und sein Zubringer noch am Tisch. Wir gehen, ohne uns zu verabschieden. Wir sind nicht elegant, und wir sind auch nicht höflich. So, wie uns zumute ist, würden wir ihnen ganz gern ein paar derbe Bemerkungen hinwerfen. Doch der Sprachführer ist für solche Fälle nicht eingerichtet. Und ob die Männer uns ernst nehmen würden?
Ein solches Geschäft ist hierzulande nicht ehrenrührig. Im Gegenteil. Man nimmt ein junges Mädchen zu sich, man liest es von der Straße auf, wo das Schlimmste geschehen kann. Man gibt ihm Unterkunft und sorgt für Arbeitsmöglichkeiten.
Kann man mehr tun?
Ziegen am Olymp
Wir sind zu müde, um schlafen zu gehen; denn Schlafengehen heißt Zeltaufbauen. Wir steigen ins Auto und fahren. Knapp zwei Stunden lang ist nichts weiter vor uns als hundert Meter Straße, die das dahineilende Scheinwerferlicht aus der Dunkelheit herausschneidet, Bäume am Straßenrand, getünchte Steine mit Kilometerzahlen. Manchmal eine schlafende Ortschaft. Zum Glück sind fast alle Ortsschilder in lateinischen Buchstaben geschrieben.
Die Morgendämmerung beginnt. Allmählich steigt die Landschaft aus der Nacht, erfrischt. Wir fahren schon geraume Zeit bergan. Die Straße verläuft so steil und kurvenreich, dass wir fast nur im zweiten Gang vorwärtskommen. Das Kühlerwasser wird gleich zu kochen anfangen, und noch ist kein Ende der Steigung abzusehen. Wilde Bergwelt umschließt uns jetzt. Auf lange Strecken hin ist der Fahrweg aus den felsigen Steinhängen geschlagen. Hunderte Meter tief fallen die Schluchten ab.
Manchmal stehen die Reste ehemaliger Gebäude auf einer Kuppe oder an Abhängen. Von dort leuchten dann meist blaurote Buchstaben herüber, die groß und griechisch an das verfallene Mauerwerk gepinselt sind: „Telefunken“ oder „Philips“ oder „General Motors“. Man könnte denken, diese Ruinen seien eigens für Reklamezwecke aufgebaut worden. Es wird nichts kosten, an ihnen Reklame zu machen. Die früheren Bewohner der Häuser, Bergbauern, sind vielleicht vor mehr als hundert Jahren von den Türken erschlagen worden. Wer also sollte Gebühren fordern für die großen blauroten Buchstaben? Tote tun das nicht, und die Reklamechefs der großen Konzerne gelten als findige Leute. Ganz unerwartet taucht ein Dorf auf, an einem Abhang gelegen. Eine geöffnete Gastwirtschaft an der Straße, Raststätte für Kraftfahrer. Es ist gegen fünf Uhr morgens, Zeit, einen heißen Kaffee zu trinken.
Der Kaffee ist süß und auf türkische Art bereitet. Wir bestellen auch ein Brot mit Käse. Über der Theke hängt das Königspaar.
Gleich gegenüber ist eine Bet- und Wasserstelle. Aus einem Rohr fließt Quellwasser in ein Zementbecken. Daneben, aus dem gleichen Zement gefertigt, eine Art Häuschen, ein unvollendeter Kiosk, der einem Bildnis der heiligen Maria Unterkunft bietet. Blumen stehen vor dem Bild, ein Öllämpchen und noch eine Kanne mit Ersatzbrennstoff. An alles ist gedacht.
Wir geben dem Auto Wasser, füllen alle Behälter auf und starten wieder. Häufiger kommen uns jetzt Lastzüge entgegen. Man fährt hier zu so früher Stunde, um der drückenden Mittagsglut zu entgehen. Die Straße steigt immer noch an. Uns wird nichts geschenkt; denn sie führt über den höchsten Punkt dieses Gebirgsmassivs, fällt in unzähligen Windungen wieder ab in die Ebene, um dann abermals anzusteigen.
Je näher wir Larissa kommen, desto öfter unterbrechen heimtückische Risse das glatte Asphaltband der Straße. Manchmal fehlt auf einer Strecke von fünfzig oder hundert Metern die Asphaltdecke ganz und gar. Dann fahren wir über Geröll.
Dieses Gebiet wurde vor wenigen Monaten von schweren Erdbeben heimgesucht. In Volos und anderen Städten wurden Tausende obdachlos. In aller Welt fanden Hilfsaktionen zugunsten der Geschädigten statt. Auch die schöne Königin des Landes hat sich damals die Katastrophe angesehen.
Wir haben uns einem gewaltigen Gebirge genähert, das sich jetzt schneebedeckt zu unserer Linken erhebt: der Olympos, ein Ensemble von Bergriesen, unter denen der Olymp selbst nicht eindeutig zu erkennen ist. Wir fragen Einheimische, die vorüberkommen, aber auch sie können den höchsten der Berge nicht genau bestimmen.
Auf einem dieser Gipfel jedenfalls wohnen nach dem Glauben der Alten die Götter und versammeln sich im Tempel des Zeus regelmäßig zu Sitzung und Geselligkeit. Zeus selbst jedoch ist, einer Variante der Mythologie zufolge, nicht mehr unter ihnen. Denn als er sein Eheweib gefressen hatte, spaltete ihm Hephaistos den Schädel, und Athene, die ewig jungfräuliche Tochter des Zeus, sprang lieblich und in voller Rüstung hervor.
Ob durch die heftigen Erschütterungen, die auf der schlechten Wegstrecke das Fahrzeug unablässig heimsuchen, oder durch die Erwähnung der lieblichen Göttertochter – Molli ist aufgewacht. Er hatte ein paar Stunden geschlafen und soll nun plötzlich den Olymp fotografieren. Das kommt ihm viel zu überraschend. Er behauptet, das Licht sei völlig ungeeignet und überhaupt der Berg nicht erhaben genug. Fast wären wir ohne ein Bild des Göttersitzes geblieben, wenn die Ziegen nicht gewesen wären – richtiger gesagt: das Hütemädchen.
In einem der Täler neben der Straße weiden ein paar Dutzend schwarzer Ziegen, und das Hütemädchen trägt ein rotes Gewand, jetzt muss ganz dringend angehalten werden. Molli rafft seine Kameras zusammen, stürzt wortlos aus dem Wagen und den Abhang hinunter. Während der nächsten halben Stunde jagt er die aufgebrachte Herde und das ahnungslose Mädchen durch die Täler und über die Hügel zu Füßen des heiligen Olymp, der als Hintergrund anscheinend sehr geeignet ist. Molii „schießt“ aus allen Objektiven und kehrt atemlos zum Auto zurück.
Das versteht nur, wer die Farbfotografie ein wenig kennt und weiß, was da ein roter Tupfen bedeutet.
Topfgucker
In Larissa wird endlich Geld getauscht.
Es ist inzwischen unerträglich heiß geworden. Man hat das Gefühl, in einer Bratröhre zu stecken. Die Gassen sind eng, ohne einen Luftzug; die Fliegen aufdringlich. Nach Möglichkeit bewegen wir uns nur im Schatten.
Wie ein Komet seinen Schweif, ziehen wir eine Horde lärmender Kinder hinter uns her. Sie halten uns für Amerikaner, und wir lassen sie gern in ihrem Glauben. Sie rufen uns englische Brocken nach. Sie schneiden Grimassen und hänseln uns nach Lausbubenart. Wir haben Spaß daran; denn wir sind nicht gemeint. Es gilt den Vertretern der unpopulären Besatzungsmacht, die sie in uns sehen. Sollen sie sich Luft machen. Wir hätten sogar Lust, sie zu ermuntern. Aber das ginge schlecht. Wir sind die einzigen „Amerikaner“ hier.
Wir versuchen, uns an den Gedanken zu gewöhnen, dass das Städtchen, in dem wir sorglos spazieren gehen, mindestens zweitausend Jahre alt ist. Molli hat unterdessen Balkons und Dächer erstiegen. Er behauptet fortwährend, solche Bilder bekämen wir nicht wieder.
Endlich haben wir ein Speiselokal gefunden. Hier, wie auch in den zahlreichen anderen Gaststätten und Kaffeestuben, sitzen Männer, die in ein seltsames Brettspiel vertieft sind. Es scheint eine Art „Dame“ zu sein, nur dass da mit zwei winzigen Würfeln nach unergründlichen Regeln um die Steine gespielt wird.
Der Kellner ist ein leichtgläubiger Mann. Er bringt eine Speisekarte in griechisch. Was sollen wir damit. Wir können nur die Preise lesen und machen ihm das verständlich. Eine Weile steht er ratlos und verfällt dann auf die einfachste Idee der Welt: Wir sollen in die Küche kommen.
Ein kleiner Raum, verräucherte Wände. Es riecht fettig, und der Atem stockt vor Hitze. Auf dem Herd stehen Pfannen und große dampfende Töpfe: Schmortomaten, Bohnen, Reis, Gulasch und gefüllte Paprikaschoten. Man braucht nur mit dem Finger zu zeigen; einmal von diesem und einmal von diesem. Fertig.
Das Lokal ist ziemlich besetzt. Der Lautsprecher funktioniert. Die Tischdecken sind weder sauber noch neu. Dafür steht auf jedem Tisch eine Karaffe mit Wasser. Das gehört hier zum Essen wie Teller und Besteck. Sobald die Karaffe leer getrunken ist, bringt der Kellner eine andere. Und die ist beschlagen, wie ein kühles Bierglas im Sommer. Das frische Wasser in der Karaffe kokettiert gewissermaßen. Es bietet sich an. Alle Mahnungen, die man uns auf die Reise mitgab, sind vergessen. Warum sollten wir nicht trinken? Die Leute an den Nachbartischen trinken auch – und leben noch.
„Cigarette, please!“
Es sind noch vierhundert Kilometer bis nach Athen. Wir werden es heute nicht mehr schaffen. Zwar haben wir jetzt ebenes Land vor uns und können streckenweise mit mehr als neunzig Stundenkilometern fahren. Aber bald werden wir wieder klettern müssen und in der Nähe der Thermopylen sogar auf dreizehnhundert Meter.
Wagenfenster und Schiebedach sind geöffnet, so weit es geht, doch selbst der Fahrtwind ist heiß wie die Luft aus einem Föhnapparat. Manchmal, wenn irgendwo ein Bach aus einer Felsenschlucht heraufblinkt, halten wir an, um ein Quellwasserbad zu nehmen. Noch ehe wir recht zum Auto zurückgekehrt und gestartet sind, ist die Erfrischung nicht mehr zu spüren.
Wir treffen Militäreinheiten, die mit Straßenreparaturen beschäftigt sind. Die Soldaten treten zur Seite, wenn wir uns nähern: willkommener Anlass, auf den Schaufelstiel gestützt, die Arbeit zu unterbrechen. Und die Soldaten rufen etwas. Sie deuten mit den Händen zu uns herüber. Vielleicht sollen wir langsamer fahren. Steht eine Tür offen, oder haben wir ein Rad verloren? Wir können nichts entdecken. Auch das Blinklicht ist ausgeschaltet.
Da, schon die nächste Kolonne. Die Soldaten verhalten sich nicht anders. Auch sie rufen und strecken ihre Hände aus. Wir fahren langsamer und hören, dass sie betteln.
„Cigarette, please!“, schreien sie. „Cigarette!“
Ein Land, das zu den großen Tabakproduzenten der Welt gehört. Und seine Soldaten fechten am Straßenrand Zigaretten.
DREIGETEILTE HAUPTSTADT
Sonntagshose für Athen
Da liegt Athen. Es ist Vormittag. Wir sind noch einige Kilometer außerhalb, und die Sommerglut hat einen Dunstschleier vor die Stadt gezogen. Athen ist wie eine Erscheinung, ungenau und so, als ob es augenblicklich wieder verschwinden könnte. So sehen Städte manchmal auf der Kinoleinwand aus. Man ist nicht sicher; war es Modell oder Wirklichkeit?
Überhaupt hat dieser Moment etwas Fragwürdiges. Ein halbes Leben hast du von dieser Stadt reden hören, hast dir deine Bilder von ihr gemacht. Du hast mit innerer Verneigung ihren Namen gesagt, weil so viel Ehrwürdiges hier seinen Anfang hat. Was dort auf der Hügelkuppe über der Stadtmitte flimmert, ist die Akropolis, der Parthenon. Wohl jedes Schulkind auf der Welt hat diese Säulen betrachtet.
Jetzt bist du hier, und Athen liegt vor dir. Aber du willst es noch nicht glauben.
Autos jagen vorbei. Wir stehen am Straßenrand. In einem der Häuser haben wir um einen Eimer Wasser gebeten. Wir müssen uns waschen und umziehen: weißes Hemd und Sonntagshose für Athen.
Wir überlassen uns dem Fahrzeugstrom und werden in die Stadt gespült. Der Verkehrsbrei wird zäher, je weiter wir kommen. Fußgänger, Lastträger, Straßenkreuzer, Handwagen. Jeder hat ein Recht auf die Straße. Jeder macht es geltend. Es scheint kein Reglement zu geben. Niemand hat Vorfahrt. Überholt wird da, wo Platz ist. Alles schreitet und schiebt und rollt durcheinander. Hupen ist verboten.
Im eigentlichen Stadtzentrum fahren wir ganze Strecken zentimeterweise. Rechts Autos und links und vor uns und hinter uns. An Kreuzungen bilden sich Autoknoten. Meistens sind auch Straßenbahnen verwickelt. Dann dauert es etwas länger. Man kann Gespräche mit dem Nachbarn führen.
„Verzeihen Sie bitte, wir wollen in die Valaouritu …“
Der freundliche Mann im Nachbarauto beschreibt es ganz in Ruhe. Wir haben Zeit. Polizisten sind auch da. Sie winken ein bisschen, aber sie haben kein Amt. Sie scheinen nur der Abwechslung halber hier zu sein: immer mal eine Uniform zwischen den Zivilen.
Der Mann im Nachbarauto ist jetzt einige Zentimeter zurückgefallen. „Und noch eine Frage: Wie lange fährt man zur Valaouritu?“
„Es sind fünfhundert Meter.“ Er lächelt schwach. „Sie müssen zwanzig Minuten rechnen.“
Der Mann hatte recht.
Der Durst der Nation
Im ersten Stock des Hauses Nummer fünfzehn befindet sich die Handelsvertretung der Republik, wo uns ein Freund erwartet. Eine heimatliche Insel inmitten der Fremdheit. Deutsche Dialekte und deutsche Zeitungen, Zeiss-Geräte in Glasvitrinen und Perlonwäsche und Wurzener Schokoladenkekse. Jemand, der aus Sachsen stammt, spricht englisch in ein Telefon.
Die Begrüßung ist herzlich.
„Wie war die Reise, wie lange soll sie dauern?“
„Und was wollt ihr trinken? Portokolade?“
Eine barmherzige Frage bei vierzig Grad im Schatten. Aber was ist das für ein merkwürdiger Name?
Damals wussten wir noch nicht, dass dieses Wort überall im Land, an den Straßenecken, in den Kinos und am Badestrand aus Tausenden Kehlen gebrüllt wird. Tag für Tag. Überall, wo es heiß ist und wo Leute sind, von denen man erwarten kann, dass sie Geld für eine Erfrischung übrig haben.
Ein Fruchtgetränk mit Kohlensäurezusatz. Der Name kommt vom griechischen Wort „portokali“, was Apfelsine bedeutet. Die Griechen verdanken das Getränk ihrer fruchtbaren Sonne und dem größten Getränkefabrikanten des Landes, der in Athen eine riesige Fabrikanlage und unweit Saloniki eine märchenhafte Villa unterhält. Der Mann heißt Fix und ist ein Wohltäter großen Stils. „Portokolades!“
Dass die griechische Regierung die Einfuhr von Coca-Cola verbietet, ist sein Verdienst. Er sorgt für den Aufkauf der kleinen Orangen, der unausgereiften wie der überreifen. Aber das ist noch das Geringste. Er hat die gewaltige Aufgabe übernommen, den Durst der Nation zu löschen. So ist er gewissermaßen das erfrischende Gegengewicht zur sengenden Sonne Griechenlands. Die drei Buchstaben seines Namens sind Millionen Mal gedruckt, gepinselt und auf Blech gespritzt. Fix lässt auch Bier produzieren und ist Millionär. Ein Fläschchen Portokolade kostet drei Drachmen. Dafür bekommt man fast ein Kilo Apfelsinen.
Wir trinken also Portokolade und finden, dass sie gut schmeckt. Bei eisgekühlten Getränken und in der Nähe eines geräuscharmen Ventilators ist Athen eine freundliche Stadt.
„Wie kann ich euch helfen?“, fragt unser Freund.
Wir hatten gedacht, wenn irgendwo ein Stück Garten wäre, als Zeltplatz geeignet und als eine Art Standquartier unseres Athener Aufenthaltes …
Ein solcher Garten sei nicht da.
„Oder ein Abstellraum? Wir könnten unser schweres Gepäck dort lassen.
Wir wären beweglicher …“
Es gibt auch keinen Abstellraum.
Dann sagt unser Freund plötzlich: „Wir haben ein Haus, eine Villa in Psychiko.
Sie ist augenblicklich unbewohnt.“
Vor einigen Tagen sei der bisherige Handelsrat abberufen worden, und bis sein Nachfolger einziehen werde, sei das Haus frei.
„Ihr habt einen Eisschrank dort, und baden könnt ihr, wann ihr wollt …“
Wir erheben die Portokolades.
Wir werden außerdem eine Dolmetscherin zur Seite haben, und der Wagen kann gleich morgen in die Wartburg-Werkstatt.
Noch am Abend beziehen wir das Haus. Psychiko ist ein moderner Villenvorort. Ein Haus kostet durchschnittlich tausend Mark Monatsmiete. Man kann sich denken, wer hier wohnt: Großkaufleute, hohe Staatsbeamte und andere Würdenträger.
Wir sehen uns gezwungen, das Auto zu waschen.
Es beginnen die unvergesslichen Tage in Athen. Wir werden von hier aus die Stadt durchforschen, so gut wir können. Wenn um Mittag die Sonne steil über dem Häusermeer steht und die Schatten schmal sind, werden wir hier draußen in der Zimmerkühle sitzen und schreiben, fürs Tagebuch oder für die Zeitung in Berlin. Wir werden dann und wann ein Abendessen bruzzeln: feine Julischkasuppe und Setzei und eisgekühlten Kaffee danach.
Manchmal ein Glas Whisky.
Wir werden Abend für Abend Wäsche abhalten; denn im Mittelpunkt steht das Hemd. Aber das wird ein Kinderspiel sein. Wir verfügen über ein schaumgewaltiges Pulver: „Tide – the Washday Miracle“, das „Waschtagwunder“ aus Amerika!
Fürstliche Kuppelei
Athen ist in gewisser Hinsicht eine dreigeteilte Stadt: das alte ehrwürdige Athen mit den Zeugen der Jahrtausende, das neue ehrwürdige, das Athen der Armen und Arbeitsamen, und schließlich das der Reichen, das mondäne, wohlsituierte. Dieses letzte hat fast keine Originalität. Es ist verwechselbar. Die Glanzstraßen der Athener Innenstadt könnten in Rom ebenso gut sein wie in München. Hotelpaläste, elegante Salons, Filme aus Hollywood, Straßenkreuzer, geräuschlos und massenhaft, und was dazu gehört: amerikanisches Militär, Fahrzeuge und Offiziere. Hier wie dort.
Aber da sind Unterschiede. Nicht nur, dass in der Münchner Marienstraße keine Schuhputzer auf dem Bürgersteig sitzen oder dass die Buchstaben der Neonreklame dort lateinisch sind. Der große Unterschied liegt darin, dass die Gegensätze zwischen reich und arm in Athen weit krasser sind als anderswo.
Das griechische Nationaleinkommen ist das niedrigste in Europa. Die Reichen des Landes aber streben nach dem gleichen Luxus, den ihre Kumpane in Rom oder München genießen. Sie mussten entsprechend verfahren und tun es bis heute erfolgreich. Das übrige ist die einfache Rechenaufgabe von der Verteilung des ohnehin geringen Nationaleinkommens.
Unweit der Elendsbehausungen in der westlichen Stadt und am Fuße der Akropolis, weiter im Nordosten, baut man große Wohnblocks, luftig, komfortabel. Wir haben solche Wohnungen angesehen. Sie unterscheiden sich nicht wesentlich von denen am Straußberger Platz in Berlin. Aber man hat hier für drei Zimmer eine monatliche Miete von sechshundert Mark zu zahlen! Ein Bauarbeiter müsste den Verdienst eines ganzen Jahres anlegen, um mit seiner Familie ein halbes Jahr lang in einer solchen Wohnung zu leben. Sie könnten duschen und den Lift benutzen und abends vom Schlafzimmerfenster die Akropolis sehen. Aber sie könnten weder essen noch trinken, noch Kleidung kaufen.
Einige Kilometer südlich der Stadt, am Meere, liegt das Villenbad Glyphada. Strand und Pinienwald und eine malerische Bucht. Man hat den Strand kultiviert: geschmackvolle Kabinen gebaut, Blumenbeete und Süßwasserduschen angelegt. Liegestühle und Sonnenschirme, helle, kräftige Farben und Spielplätze für Erwachsene und Kinder. Eine vorbildliche Anlage. Hier einen freien Tag verbracht, und man sammelt Energie für die ganze Woche.
Wer sammelt Energie?
Es kostet natürlich Eintritt, und der Preis ist so, dass die Wohlhabenden unter sich bleiben. Es kostet zwanzig Drachmen pro Person. Eintritt!
Hier sind Sie also ungestört! Hier haben Sie nichts Lästiges zu befürchten: nicht die Waschfrau und nicht den Betonmischer und nicht die ärmlichen Kinder der beiden. Ruhen Sie hier von Ihren Geschäften aus, und sammeln Sie Energie für neue größere Geschäfte!
Und gleich in der Nachbarschaft das eleganteste Restaurant Attikas. Hier geben Onassis oder Niarchos, Milliardäre und Manager in Öl, gelegentlich ein Jubelfest. Herren erscheinen im Frack. Da wird an einem einzigen Abend verzecht, wovon die hunderttausend Arbeitslosen der Stadt eine ganze Woche leben müssen.
Während unseres Athener Aufenthaltes – eines Nachmittags in Voulagmeni, wo die Badelustigen der Hauptstadt sich ohne Eintrittskarte am Meer vergnügen – lernten wir einen Mann kennen, der vor Jahresfrist an einer bemerkenswerten Schiffsreise teilgenommen hatte. Er war als Küchengehilfe auf dem 5000-Tonnen-Turbinenschiff „Achilleus“ beschäftigt gewesen, das der Reeder Petros M. Nomikos der griechischen Königsfamilie für eine Ferienfahrt geliehen hatte.
Es wurde eine wahrhaft königliche Reise, Friederike, schöne „Landesmutter der Hellenen“, hatte an die hundert erlauchte Gäste zusammengetrommelt. Alles liebe Verwandte. Könige und Fürsten und verjagte Könige aus ganz Europa, verschwistert und verschwägert.
Zwei Wochen lang kreuzte die „Achilleus“ mit der hochwohlgeborenen Sippe durch das Mittelmeer: Italien, griechische Inseln und sogar Portugal. Die Gesellschaft bewies natürlich hochwohlgeborenen Appetit.
„Mit den Vorräten hätte man eine ganze Stadt versorgen können“, sagt der Mann. „Auch mit dem Wein. Allein zwei Kisten Sekt pro Kopf!“
Und dann zählt er auf, so schnell, dass niemand mitschreiben kann. Spezialitäten der kalten und der warmen Küche: Cremespeisen, Fruchtsalate, Lammbraten, zehn verschiedene königliche Arten Lammbraten. Er macht das gestenreich und amüsant. Wir gewinnen allerdings den Eindruck, dass der Mann ein wenig übertreibt.
Später haben wir uns genauer nach dieser Reise erkundigt. Es fiel nicht schwer, Material zu bekommen, denn die Sache war damals Gegenstand von Anfragen und Debatten im Parlament gewesen. Die Spazierfahrt der Friederike und des Hochadels hatte runde dreieinhalb Millionen Drachmen gekostet. Niemand wollte wissen, aus welchem Fach der Staatskasse das Geld genommen war. Jeder aber wusste – denn die Regierung hatte kurz zuvor statistische Angaben veröffentlicht –, dass ein Drittel der Bewohner im Durchschnitt mit etwa 25 Drachmen im Monat auskommen müssen. Das sind vier Mark!