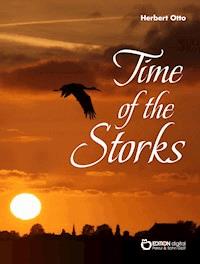6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Katherina fährt nach jahrelanger Abwesenheit zurück auf die heimatliche Insel zur Hochzeit ihrer Schwester Sofia. Sie freut sich über das Meer und das Wiedersehen mit den Verwandten. Aber auch die Erinnerung an die Ermordung ihres kommunistischen Vaters vor der Mutter und den Kindern in ihrem Elternhaus taucht vor ihrem Auge auf. In ein leer stehendes Haus war ein Kriegsinvalide gezogen. Der Fremde erweckte wegen seiner Verkrüppelung Mitleid, bis das Versteck eines Fischers verraten wurde. Nun begegnen die Einheimischen ihm mit Vorsicht, lauschen aber gebannt, wenn er sich mit seinen „Taten“ brüstet, wie viele Menschen er mit bloßen Händen ohne Blutvergießen getötet hat. Da erkennt Katherina ihn trotz seiner Verunstaltung als den Mörder ihres Vaters. Ein dramatisches Buch über Griechenland in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg, über den Weißen Terror in den vierziger Jahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum
Herbert Otto
Griechische Hochzeit
ISBN 978-3-95655-307-3 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1964 im Aufbau-Verlag Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2015 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Sie konnte schon manchmal das Meer sehen. Es war immer nur ein dünner Silberstrich am Horizont, und es dauerte immer nur Augenblicke. Dann schaukelte der Autobus wieder laut und langsam zu Tal. Felsen und Sonne und nur selten der flüchtige Schatten einer Pinie.
Durch die offenen Fenster quollen der Staub. Hitze und der Lärm des Motors. Katherina hielt die Augen geschlossen. Auch diese Fahrt wird zu Ende gehen, und an den Rückweg dachte sie noch nicht. Der Kopf schmerzte und der Leib.
Es wird ihm gewiss schaden, dachte sie. Gut kann es nicht sein für ihn. Aber sie hoffte zugleich, dass ihm vielleicht doch kein Schaden erwachsen werde, da es noch so sehr früh sei, so ganz am Anfang seines Lebens.
Hinter S., wo sie aus dem Zug in den Bus gestiegen war, hatte die feste Straße plötzlich aufgehört und dieser Weg begonnen: Geröll, grober Schotter oder einfach Lehmerde, vom Frühlingsregen durchweicht, dann zerfurcht und so schließlich versteinert in der Sonnenglut des Jahres. Der alte Autobus kroch darüber hin, litt und krachte. Mitunter schüttelte er sich und sprang, als wollte er die Leute abwerfen, die Last endlich hinschütten in die Schluchten oder auf die Hänge zu den Oliven.
Dieser Weg schien ein Irrtum zu sein. Aber der Fahrer machte den Eindruck vollkommener Gelassenheit. Er wird es wissen. Es geht schon zwei Stunden so. Auf See musste es so ähnlich sein, wenn Unwetter die Fischer überrascht.
Sie krallte sich am Sitz fest und an den Griffen. Sie stand mehr, als dass sie saß, um die harten Stöße in den Knien abzufangen. Übelkeit kam und verging wieder. Sie wurde in die: Ecke geworfen, wo das Fenster war, und tat sich weh und konnte nicht aufhören, um ihn besorgt zu sein, der noch gar nicht da war, der eben in ihr zu wachsen begonnen hatte. Vor Kurzem erst, in einer Nacht um die Mitte des letzten Monats. Sie weiß genau den Augenblick. Sie erinnert sich dieser Nacht so deutlich wie keiner anderen mit Andreas.
Immer, wenn sie seitdem an ihr Kind dachte, nannte sie es er. obwohl sie doch wusste, dass es nicht vorauszusehen war, ob sie oder er. Sie tat es, weil Andreas kein Mädchen haben wollte. Sie tat es ihm zu Gefallen und auch mit der versteckten Hoffnung, der Natur keine andere Wahl zu lassen. Sie hatte den Vater oft sagen hören, dass der Mensch fast alles fertigbringe, jedenfalls immer mehr, als er sich zutraue. Er müsse es nur wollen. Und sie wollte einen Jungen. Sie wollte Andreas nicht erzürnen.
Es wird auch Zeit, dass ich’s ihm sage, dachte sie. Wenn ich zurück bin, muss ich’s ihm sagen.
Auf den letzten Kilometern wurde der Weg etwas besser. Nun war der Gebirgszug überwunden, und das Meer lag da, ausgespannt bis zum Rand des Himmels.
Der Fahrer hielt an, um eine Pause zu machen; die meisten der Fahrgäste stiegen aus. Katherina blieb sitzen. Sie spürte, wie die Stille langsam und angenehm in den Körper kam. Sie sah durch das Fenster. Der Pope aß abseits auf einem Stein und schnitt sparsam von der Melone ab. Er aß andächtig. Die Frau, die Trauerkleidung trug, konnte so demütig nicht sein, wie sie aussah; denn sie beschimpfte und ohrfeigte ihre beiden Söhne sehr entschlossen. Der dicke schwitzende Mann hatte seinen Hühnerkäfig mit hinausgenommen, und die Tiere saßen ruhig da und putzten ihr Gefieder. Sie wussten schon nichts mehr von der Todesangst, gegen die sie während der letzten Stunden laut und erbittert angekämpft hatten.
Dort unten stieß eine Landzunge ins Meer; in die Bucht gebettet lag ein kleiner Hafen, wo Onkel Anastas wohl schon wartetete mit seinem Boot.
Es war damals blau und weiß angestrichen und hatte nach Treibstoff und Farbe und Fisch und Salz gerochen. Sie werden wieder übers Meer fahren, der Insel entgegen, die Katherina nun in der Ferne treiben sah, in der flimmernden Unendlichkeit hinziehend wie ein altes Schiff und der Gipfel des Gebirges schien das Segel zu sein.
Als Fünfzehnjährige war Katherina dort gewesen, mit Sofia, der jüngeren Schwester, Ende Oktober nach der Tabakernte. Der Ertrag war kärglich gewesen, sodass der Vater seinen Bruder gebeten hatte, die Töchter eine Weile aufzunehmen. Katherina hatte den Onkel und dessen Familie in guter Erinnerung behalten. Auch das Inselstädtchen, das lebendiger war und sorgloser schien als ihr Dorf in der Ebene hinter Salloniki.
Aber das tiefste Erlebnis war das Meer gewesen, seine Farben und seine Weite. Die Begegnung hatte Sehnsucht hinterlassen und den Wunsch, zurückzukehren.
Nun sah sie es wieder, nach sieben Jahren, und es schien ihr fast, als müsste das Meer ;sie erwartet haben. Bald, heute noch oder morgen, wird sie allein ans Ufer gehen: Siehst du, ich bin gekommen. Wir können das Fest feiern. Und Katherina wird das Meer grüßen, mit dem Blick, mit den Armen, ganz eintauchen in die Kühle und getragen werden. Sie musste das für sich behalten.
Andreas würde das wohl nicht verstehen: zu Gast beim Meer und Salzküsse, blau und silbern, sie musste das für sich behalten. Sie musste Andreas damit betrügen; sie fürchtete seinen Spott.
Die Hühner gackerten wieder laut und aufgebracht und plusterten das Gefieder; denn der Dicke schaffte den Käfig ungeschickt in den Bus zurück. Die Fahrt ging weiter. Nun war die Straße eben und lief in dauernden Windungen talwärts. Sichtbar mit jedem Augenblick rückte der Hafen näher und so auch die Insel mit dem Städtchen und dem Platz vor der Taverne, wo der Brunnen steht, und mit den alten Häusern, die immer aufs Meer sehen.
2. Kapitel
Auf einem schmalen Pfad, der in südwestlicher Richtung an der Küste der Insel entlangläuft, steinig und schon vor Jahrhunderten aus dem Steilufer herausgeschlagen, erreicht man, eine knappe Stunde Fußweg vom Städtchen entfernt, das Haus auf dem Felsen. Es steht dort, geduckt zwar und alt, aber noch immer unerschrocken. An dieser Stelle treten die Klippen aus der geraden Uferlinie hinaus ins Meer. Hier, weit außerhalb der Bucht, herrscht niemals Frieden zwischen See und Stein. Auch bei geringer Brandung schlagen die Wellen laut gegen den Felsen.
Und das Haus oben steht unerschrocken.
Es schien unbewohnt. Meist waren die Fensterläden geschlossen. Alte Tische und Stühle, verwittert und zerbrochen, lagen verstreut oder lehnten an den Mauern. Aus dem niedrigen Stall am Haus drang mitunter das Gemecker von Ziegen. Bis vor reichlich vier Jahren war hier eine Gaststätte gewesen. Doch das Geschäft war schlecht und schlechter gegangen. Wer verläuft sich schon hierher außer Sonntagsbesuchern aus dem Dorfe N., die zu Verwandten ins Städtchen gehen, oder gelegentlich einem Bauern, der auf dem Esel Gemüse zum Markt schafft oder zwei Hammel ins Schlachthaus treibt. So hatte sich der Besitzer entschlossen, das Leben neu zu versuchen. Er war eines Tages, wie Tausende Griechen vor ihm, mit der Frau und den beiden Kindern nach Australien gegangen. ohne einen Käufer für das Haus gefunden zu haben.
Die örtliche Behörde legte ihre Hand auf das Gebäude. Über ein Jahr lang wohnte niemand hier außer den Ziegen, die der frühere Besitzer zurückgelassen und einer entfernten Verwandten im Städtchen geschenkt hatte. Die alte Frau kam seitdem täglich heraus, trieb die Tiere zur Weide, melkte sie und ging gegen Abend heim, die Kanne mit der Milch vorsichtig tragend. Auch als der neue Besitzer das Haus bezog, änderte sich daran nichts.
Er tauchte eines Tages auf - der Himmel allein mochte wissen woher -, struppig und laut und riesenhaft. Er hatte nur ein Auge und statt des anderen eine runde schwarze Scheibe, von einem Gummiband gehalten. In den ersten Monaten nach seiner Ankunft genoss er manche Bewunderung, sogar Ansehen auf der Insel. Er war zu scherzen bereit, wusste wilde Geschichten zu erzählen vom Kampf gegen die Türken, von Abenteuern auf See, und schien über gewaltige Körperkräfte zu verfügen. Denn gelegentlich, in der Taverne am Hafenplatz sitzend, forderte er diesen oder jenen zum Wettkampf im Armdrücken heraus - er hatte dieses Spiel und auch die Kräfte und auch die wilden Geschichten vom Vater geerbt, der lange zur See gefahren war - und er besiegte auf Anhieb jeden. Er wählte unter den vielen jungen Leuten, die ohne feste Arbeit herumgingen, einen Gehilfen aus, beschaffte Werkzeuge und Holz und zimmerte zwei Glücksräder: runde Holzplatten mit Zahlen und Nägeln um den äußeren Rand und mit einem in der Mitte befestigten Arm, dessen Federzunge in die Nägel griff und der sich schnarrend wie ein Zeiger drehen ließ. Das Gerät war transportabel, und Menelaos - so hieß der Fremde - begann, mit den Glücksrädern durch die Dörfer der Insel zu ziehen.
Damals, wie gesagt, erschien er den Leuten noch harmlos, niemand kannte ihn auf der Insel, und man ahnte nichts Böses. Menelaos liebte den Ouzo, scharfen Anisschnaps, trank ihn mäßig, war aber nicht geizig und bestellte häufig eine Lage für die Männer.
An einem dieser Abende, zu später Stunde, die Zunge locker vom Schnaps, erzählte ein junger Fischer von seinem Bruder. Der war verhaftet worden, verbannt auf Makronissos und kürzlich von dort geflohen. Er lebte nun illegal, irgendwo auf dem Festland, aber manchmal trieb ihn die Sehnsucht her, nachts mit einem Boot für wenige Stunden. Alles Lebendige, so meinte der junge Fischer, müsse sich verkriechen in die Nacht. Das sei geworden aus dem stolzen Land. Seine Stimme war brüchig vor verhaltener Wut. Menelaos zeigte sich beeindruckt, ermunterte den Fischer und schien dessen Empörung zu teilen.
Etwa eine Woche danach, in einer dunklen Nacht, stellte man den Flüchtling. Polizisten, die auf der Lauer gelegen hatten, folgten ihm von der abgelegenen Bucht, wo er an Land gestiegen war, zum Hause der Eltern. Sie verhafteten ihn und den Bruder, ihre beiden jungen Frauen und auch die alte Mutter.
Mit dieser Stunde begann die Insel, sich vor dem Einäugigen zu verschließen. Kein anderer als er konnte den Fischer denunziert haben, und in der Folgezeit wuchs der Verdacht zur Gewissheit heran, denn Menelaos gab Vorsicht und Verstellung mehr und mehr auf.
Ursprünglich war er auf dieses vergessene Eiland gekommen, um unerkannt hier zu leben, fern von den .Schauplätzen seiner früheren Tätigkeit. Aus der Armee des Königs hatte er schwer verwundet ausscheiden müssen, in allen Ehren, war aufs Altenteil gesetzt oder, wie er es lieber nannte, in Wartestellung, erst Anfang Vierzig, also viel zu früh, und er hatte gehofft, in aller Stille und bei passender Gelegenheit dem König doch noch dienstbar zu sein. Er wollte beweisen, wie durchaus verwendbar er noch war. Und nun musste er scheitern, noch ehe er begonnen. Nur weil man sich keine Zeit gelassen, nicht noch gewartet hatte mit dem Zupacken. Gleichviel. Er sah die Mauern der stillen Verachtung aufwachsen, wo immer er hinkam. Sie saßen an seinem Tisch, tranken mit, redeten auch, aber sie hatten einander vor ihm gewarnt, hielten Abstand. Er kam nicht heran, und sie taten, als sei nichts.
Der Polizeihauptmann der Insel, den Menelaos von früher her kannte und durch dessen Vermittlung er hergekommen war, hatte nur ein Schulterzucken, als Menelaos darüber klagte. „Nimm es, wie es ist. Gib dich zufrieden. Danke Gott, dass du davongekommen bist. Deine Verdienste stiehlt dir keiner.“
„Aber bin ich zu nichts mehr nütze?“, wandte Menelaos ein.
„Hab Geduld“, sagte der Hauptmann. „Du bist krank. Also schon dich. Vielleicht ruft man dich eines Tages.“
Ja, das hoffte Menelaos. Und es geschah vielleicht bald. Aber die Geringschätzung der Leute musste er nicht schweigend ertragen. Das konnte niemand verlangen. Wenn sie ihn schon verachteten, so sollten sie doch vor ihm zittern.
Er trug Papiere bei sich, die er nie hervorgeholt hatte. Nun aber nutzte er jede Gelegenheit, mit den Schriftstücken zu prahlen und sie jedermann zu zeigen. Besonders dann, wenn er getrunken hatte, denn der Ouzo ging wie Trauer in ihm um und entblößte ihn innerlich. Gerade in solchen Augenblicken, gering und elend, bedurfte er dringend der Schriftstücke. Und so war es nicht bloße Prahlerei, dass er sie immer wieder vorwies - es war auch eine Art von Selbsthilfe, sonderbare Notwehr.
Die Papiere waren: ein Brief der Behörde von S., in dem gewünscht wurde, dass dem Obengenannten ein Haus übereignet werde, dann eine gestempelte Urkunde, die ihm den Betrieb eines Spielunternehmens, einer ambulanten Glücksbude, erlaubte. und schließlich - das stellte den Mann Menelaos hoch über alle Gewöhnlichen - ein Schreiben, das der König selbst unterzeichnet hatte. Es war ein Dankschreiben, die Anerkennung ganz besonderer Verdienste während des Bürgerkrieges und bei der Rettung des Landes, des Glaubens, der Freiheit und so fort.
Menelaos war ein Held.
Die Art seiner Verdienste wurde in jenem Brief nicht näher erläutert, doch aus den Reden, die Menelaos gelegentlich führte, ging hervor, dass er ungezählte Male, sein eigenes Leben mutig missachtend, das Leben anderer ausgelöscht hatte, feindliche Leben jedes Mal, und es war - wie er beim heiligen Nikolaus versicherte - stets ohne Blutvergießen geschehen.
Immer wenn er davon sprach, streckte er die Hände vor, krampfte sie zu Fäusten, sodass die Haut über den Knöcheln dünn und blass wurde und die Adern hervortraten, als habe er alle Kraft seines gewaltigen Körpers in die Fäuste gezwungen. Er begann heftig zu zittern. Er sah sie wohl vor sich - junge Männer und ältere und auch Frauen - wehrlos unter seinem Griff, ringend nach Luft und Leben. Der Kampf dauerte nur kurz. Menelaos löste die Klammer. Er zitterte noch immer. Er blickte um sich und schien nicht zu wissen, wo er war. Er schlug die Hände ineinander zu einer stummen Klage. Sein Gesicht war grau geworden, und er starrte zu Boden, als lägen da die Opfer noch. Wie viele es waren, wusste er nicht. Er wusste nur: es waren viele, und sie würden ihm folgen, wohin er auch ging.
Die Leute in der Runde - Kumpane oder auch nur Neugierige - saßen schweigend und betroffen. Irgendeiner, meist der Polizeihauptmann, schlug ihm dann hart auf die Schulter. Menelaos kehrte zurück und grinste verstört.
Die Bewohner der Insel lernten ihn ertragen, wie man eine Wunde oder ein Gebrechen ertragen lernt, und allmählich auch wurde das Missbehagen von einer Genugtuung sonderbar gemildert: denn Menelaos war gezeichnet und gestraft und ausgesondert.
Im Herbst 1949, während der letzten Kämpfe des Bürgerkrieges, waren er und seine Bande in ein heftiges Feuergefecht mit; Soldaten der Befreiungsfront geraten. Eine Granate hatte Menelaos den Leib zerrissen, und Splitter waren in die Herzgegend gedrungen.
Die Waffen schwiegen längst im Lande, der Kampf war entschieden, die Volksfront niedergerungen, ihre Verbände zerstreut, vernichtet oder gefangen gesetzt, der König und die Kaufleute. Priester und Generale, die Reichen des Landes und auch Arme hatten Gott ausführlich für diesen Sieg gedankt, aber der Mann Menelaos lag immer noch auf Leben und Tod.
Als er dann endlich zusammengeflickt und wieder, wie es schien, bei Kräften war, entließ man ihn aus dem Hospital. Der Arzt rief ihn. Menelaos musste sich setzen, und was er hörte, war ein Urteilsspruch, obwohl der Doktor, auf Schonung bedacht, nur einen Teil der Wahrheit sagte. Er verschwieg, dass ein Splitter der Granate die Herzwand gestreift und beschädigt und dass an dieser Stelle - locus minoris resistentiae (Ort des geringsten Widerstandes) - mit jedem Herzschlag, unterm Druck des Bluts, die Herzwand sich erweitern und verdünnen, eine Art Aneurysma (Schlagadererweiterung) entstehen würde, bis eines Tages, in absehbarer Zeit schon, die Ruptur (Zerreißung, Durchbruch) der Herzwand den Mann löten musste. Das war unabänderlich; da gab es keine Rettung. Alles, was der Mann noch hoffen konnte, war, den Prozess zu verlangsamen; drei Jahre Leben oder vielleicht fünf konnte er noch gewinnen durch Mäßigung.
Er, der immer laut und heftig gelebt hatte, immer in Gefahr, immer eilig, gehetzt, strauchelnd auf der abschüssigen Bahn, immer verwickelt und verstrickt gewesen: schon als Kind, nach dem frühen Tod des Vaters, in den täglichen Aufstand gegen den Hunger, als Schauermann im Hafen von Saloniki in Messerkämpfe und Intrigen um etwas Arbeit und etwas Schmuggelei, als kleiner Händler später und zeitweise als Zuhälter in verbotene Geschäfte, die ihn für drei Jahre ins Gefängnis brachten, dann als heimlicher Helfer der deutschen Okkupanten in Verrat und Spitzelei und schließlich Polizist des Regenten Damaskinos (Griechisch-orthodoxer Erzbischof von Athen, 1944-46 stellvertretender Regent von Griechenland), seit 1947 Soldat des Königs Paul, in den Krieg gegen das eigene Volk - er sollte nun mit halber Kraft weitergehen auf ebenem Wege, das Blut ruhig halten, still und vorsichtig leben. Das war, was ihm noch zu tun blieb, und nur darüber hatte der Arzt im Hospital mit ihm gesprochen. Er gab das später, in der Taverne am Hafen sitzend, mit folgenden Worten wieder: „Menelaos, König von Sparta, sagte er, denn so nannte er mich, sei tapfer. Was ich dir sagen werde, wird dich vernichten. aber es ist wahr. Du kannst Helena nicht wiedersehen. Verstehst du mich? Er wusste, ich hatte nie ein Weib namens Helena gehabt, kein angetrautes jedenfalls. Aber so sagte er, und weil er sah, ich verstand ihn nicht, so sagte er: Du darfst nicht leben wie bisher. Du musst bedächtig leben, langsam gehen, nicht raufen, nicht tanzen, nicht trinken. Und vor allem: Du musst ohne Frauen leben. Hörst du das? Ohne Frauen ...“
Hier hielt Menelaos inne, blickte mit seinem Auge in die Runde, die Wirkung der Worte überprüfend, und fuhr fort: „Wir haben um dein Leben gerungen, deiner eigenen Tapferkeit würdig, aber diesen Fluch konnten wir nicht abwenden. Und so sag ich dir, Menelaos: Paris hat dir Helena geraubt. Und du sollst es dabei lassen! Du bist ein Held, aber kein Mann mehr. Dein Herz schlägt noch, aber der Faden, an dem es hängt, ist gefährlich dünn. Wir haben dir aus dem Herzen einen Splitter entfernt, aus dem Beutel, in dem dein Herz liegt. Und jetzt hast du dort eine Narbe, zerbrechlich, wie feines Glas. Also rühr sie nicht an. Du bist stark und. wie ich glaube, gezwungen zu wilder Leidenschaft. Aber gerade sie kann dich töten. Ein Weib kann dein Tod sein, Menelaos. Hörst du? Kann! Die Granate und die Feinde haben es nicht vermocht - also töte dich nicht selbst durch Begierde. Verzichte auf Helena, verfluch sie, wenn dir das helfen sollte. Nun geh und lebe, hat er gesagt, und lass den Tod nicht auf dein Lager. Er kommt wie das süße Vergessen: das lange Haar, die hellen Brüste, die Haut frisch und lieblich wie der Schatten der Pistazie am Mittag. so sagte er, aber wisse - es ist dein Tod!"
Menelaos war während der letzten Worte in sich zusammengesunken. Den Blick hielt er auf die Tischplatte gerichtet. Die Zuschauer sahen sich an, und jedes Mal, auch später, als sie die Geschichte längst kannten, dauerte ihr Schweigen eine angemessene Weile.
Es konnte geschehen, dass der Einäugige sich plötzlich reckte, aufstand, das Hemd hochriss und den Gürtel hinunterstieß und seinen Leib zeigte, er von wulstigen, bläulich-roten Narben entstellt war. „Hier!“, schrie er. „Das haben sie gemacht!“ Er drehte sich mit ruckweis wütender Bewegung, damit jeder den verwüsteten Leih gut sah.
Der Hauptmann versuchte schwach und auch vergeblich ihn zurückzuziehen auf den Stuhl. „Setz dich. Was regst du dich auf? Das schadet“, sagte er, ohne wirklich besorgt zu sein.
„Aber ganz habt ihr mich nicht getötet!“, schrie Menelaos weiter. Sein Blick sprang in die Augen der Männer und krallte sich sekundenlang in jedem der Gesichter fest. Er ließ das Hemd herunter und streckte die: Hände vor. „Sie sind noch gut! Sie sind noch wie früher. Ich kann sie noch gebrauchen!“