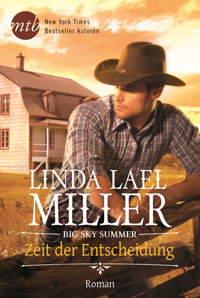4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die McKettrick Cowboys Trilogie
- Sprache: Deutsch
Er will sie als Mittel zum Zweck - doch sie erobert sein Herz ...
Arizona, 1884. Der freiheitsliebende Rafe McKettrick hat sich per Anzeige eine Braut "bestellt" - so will er sich das Erbe der väterlichen Ranch sichern. Die Gefühle, die Emmeline Harding in ihm hervorruft, hat er nicht erwartet. Doch Emmeline hat ein Geheimnis, und als ein Mann aus der Vergangenheit auftaucht, erfasst Rafe eine brennende Eifersucht ...
Band 1 der erfolgreichen McKettrick-Saga und zugleich der Auftakt der historischen Western-Romance-Trilogie um die drei Cowboys von der Triple M Ranch.
Dieser Liebesroman ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Zärtlichkeit, die du mir schenkst" erschienen.
Über die Reihe: Eine Ranch. Drei Söhne. Nur einer kann sie weiterführen - unter einer Bedingung ...
Arizona, 1884. Rancher Angus McKettrick will seine Nachfolge regeln und ruft daher einen Wettbewerb aus: Der erste seiner drei Söhne, der heiratet und ihm einen Enkel schenkt, wird seine Triple M Ranch erben. Die drei jungen Cowboys könnten unterschiedlicher, aber auch entschlossener nicht sein, und so beginnt die Suche nach Bräuten im Wilden Westen ...
Weitere historische Romance-Reihen von Bestsellerautorin Linda Lael Miller bei beHEARTBEAT: "Die Springwater-Serie", "Die Corbin-Saga", "Die McKenna-Brüder" und die Orphan-Train-Trilogie um die Chalmers-Schwestern.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Epilog
Über dieses Buch
Er will sie als Mittel zum Zweck – doch sie erobert sein Herz …
Arizona, 1884. Der freiheitsliebende Rafe McKettrick hat sich per Anzeige eine Braut »bestellt« – so will er sich das Erbe der väterlichen Ranch sichern. Die Gefühle, die Emmeline Harding in ihm hervorruft, hat er nicht erwartet. Doch Emmeline hat ein Geheimnis, und als ein Mann aus der Vergangenheit auftaucht, erfasst Rafe eine brennende Eifersucht …
Über die Autorin
Linda Lael Miller wurde in Spokane, Washington geboren und begann im Alter von zehn Jahren zu schreiben. Seit Erscheinen ihres ersten Romans 1983 hat die New York Times- und USA Today-Bestsellerautorin über 100 zeitgenössische und historische Liebesromane veröffentlicht und dafür mehrere internationale Auszeichnungen wie den Romantic Times Award erhalten. Linda Lael Miller lebt nach Stationen in Italien, England und Arizona wieder in ihrer Heimat im Westen der USA, dem bevorzugten Schauplatz ihrer Romane. Neben ihrem Engagement für den Wilden Westen und Tierschutz betreibt sie eine Stiftung zur Förderung von Frauenbildung.
Mehr Informationen über die Autorin und ihre Bücher unter http://www.lindalaelmiller.com/
Linda Lael Miller
DIEMCKETTRICKSAGA
Frei wie der Wind
Aus dem amerikanischen Englischvon Joachim Honnef
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2002 by Linda Lael Miller
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »High Country Bride«
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2004/2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: »Zärtlichkeit, die du mir schenkst«
Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven © Aleta Rafton; © shutterstock: Pinkcandy | Lamar Sellers
eBook-Erstellung: Olders DTP.company, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5042-5
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für meine NichtenKelly Lael,Angela Lang,Samantha Lang,Jenni Readman
und meine GroßnichteCourtney Lael.
Prolog
Früher Winter 1884Arizona Territorium
Angus McKettrick hasste jeden Dornbusch und Kaktus, jeden Zweig Salbei, jeden Wacholderstrauch, Hasen und Felsen im Umkreis von fünfzig Meilen, und wenn er das Land hätte abflämmen können wie eine Schweinehaut zur Schlachtzeit, hätte er es getan, jawohl. Er hätte gelacht, während die Flammen von einem Ende der Ranch bis zum anderen wüteten und alles verschlangen.
Angus stand hoch auf einer Hügelkuppe und sah auf Georgias Grabmal hinab, einen schneeweißen Engel, gemeißelt aus feinstem italienischen Marmor und so groß wie eine erwachsene Frau. Er hatte das Grabmal eine Woche nach dem Tod seiner Frau bestellt, und es war den weiten Weg von New Orleans, Louisiana, geschickt worden. Georgias Familie stammte aus diesem gottverlassenen Land mit seinen Sümpfen und Alligatoren und der feuchten Hitze. Die Menschen dort bevorzugten anscheinend feine Steinmetzarbeit, nicht nur auf ihren Gräbern, sondern auch in ihren Gärten. Angus führte das darauf zurück, dass sie den französischen Lebensstil im Blut hatten und folglich zu Tand und Getue neigten.
»Georgia«, sagte er ziemlich laut, denn sie waren allein an diesem hoch gelegenen, vom Wind gepeitschten Ort. »Ich bin heute fünfundsiebzig geworden.« Das wusste sie natürlich; sie hielt sich gewiss über ihn auf dem Laufenden, auch von der anderen Seite aus. Hätte sie unter den Lebenden geweilt, hätte sie ihm zur Feier des Tages einen ihrer Kuchen mit braunem Zucker und Melasse gebacken. »Was mich betrifft, so ist das alt genug, aber der Herr sieht das wohl anders.« Der liebe Gott war nach Angus’ Erfahrung von widersprüchlicher Art. Er handelte bedächtig und war wahrscheinlich zu gütig, um schnell zu entscheiden, doch er tat es trotzdem.
Angus streckte einen Finger aus und strich über ihren Namen und die sorgfältig gewählten Worte, die in den weißen Sockel gemeißelt waren, auf dem der Engel auf einem nackten und zarten Fuß stand, die Trompete erhoben, den Blick in den Himmel gerichtet, bereit emporzufliegen.
GEORGIA BEAUDREAUX MCKETTRICKGELIEBTE FRAU UND MUTTERZU FRÜH VON UNS GEGANGEN
Darunter standen die Daten, die ihr Leben wie Klammern einschlossen: GEBOREN 13. SEPTEMBER 1824, GESTORBEN 17. JUNI 1870. Angus fand es lächerlich zu versuchen, solch eine Schönheit, so viel Liebe, Gelächter und Vitalität – all die vielen Charakterzüge seiner Georgia – auf eine Hand voll verschwundener Jahre zu beschränken.
Wenn er doch nur an ihrer Stelle hätte sterben können! Es war der Wunsch eines Feiglings, das war ihm klar, doch er hatte ihn seit ihrem Tode oft gehegt. Es hätte nichts geholfen, wenn er zuerst gestorben wäre, denn so stark und schlau Georgia auch gewesen war, sie hätte allein und als Frau die Ranch nicht all die Jahre halten können. Die Jungen, der Älteste war bei ihrem Tod gerade fünfzehn Jahre alt gewesen, wären mehr Belastung als Hilfe gewesen.
Hölle, sie waren immer noch eher hinderlich als hilfreich, alle drei.
Angus legte eine Hand auf den Fuß des Engels und grübelte. »Es wird höchste Zeit, dass unsere Jungs mit dem Poussieren aufhören und einen Hausstand gründen«, bemerkte er, als er all seine streunenden Gedanken wie eine Herde versprengter Rinder gesammelt und in dieselbe Richtung getrieben hatte. »Unser Rafe wird im Juni dreißig, und er ist nichts als ein Hallodri, der sich in Saloons prügelt und hinter Weiberröcken her ist. Er meint, es zählt nur eine Meinung in der Welt, und zwar seine eigene. Den halben Winter hat er mal im Gefängnis und mal auf freiem Fuß verbracht. Und Kade ist nicht besser, er spielt nur geschickter Karten, das ist alles. Und was Jeb betrifft …« Er verstummte kurz und schüttelte den Kopf. »Dieser Junge sieht so gut wie der Teufel vor dem Sündenfall aus, ist wild wie ein Mustang und stur wie ein dreibeiniges Maultier. Wir haben es ihnen zu leicht gemacht, Georgia. Ich habe auf dich gehört und nie Hand an einen von ihnen gelegt, aber jetzt weiß ich, dass ich ihnen dann und wann eins hinter die Ohren hätte geben sollen. Ja, sie wären heute vielleicht etwas wert, wenn ich sie hin und wieder zum Holzschuppen geschleppt hätte wie mein Pa mich früher.«
Er wandte den Kopf und blickte über das Land, das so viel von seinem Blut und Schweiß und seiner Spucke aufgesaugt hatte, seit er achtzehnhundertdreiundfünfzig aus Texas gekommen war. Er war ein junger Mann gewesen, seelisch zerrissen vom Verlust seiner ersten Frau Ellie, die bei der Geburt ihres Sohnes gestorben war. Er hatte den Säugling zurückgelassen, und er war von Ellies Verwandten aufgezogen worden; vielleicht bereute er das am meisten in seinem Leben, die geheime Sünde, die an seinem Gewissen nagte, auch nach all diesen Jahren.
Die ungeschminkte Wahrheit war, dass er dem Baby die Schuld an Ellies Tod gab. Deshalb hatte er sich gegen sein eigenes Fleisch und Blut gewandt. Es war hirnverbrannt, und das wusste er auch, aber er hatte seinen unvernünftigen Zorn niemals überwinden können. Er hatte Florence und Ellies Lieblingsbruder Dill verlassen, hatte nicht gewagt zurückzublicken und geholfen, eine Herde Longhorns nach Kansas City zu treiben.
Im Laufe der Jahre hatte Angus ein paar Briefe von Florence erhalten, in dem sie ihm mitgeteilt hatte, dass Holt ein gesunder, kräftiger Junge war, und wann immer es ihm möglich gewesen war, hatte er ein paar Dollars geschickt und einen knappen Antwortbrief geschrieben. Flo hatte ihn nie um etwas gebeten. Dill und sie betrieben eine ärmliche Farm, und es kostete so einiges, einen Jungen aufzuziehen.
Allmählich ließ der Schriftverkehr nach. Eines Tages wurde Holt einundzwanzig. Angus arrangierte, dass eine Bank in Denver dem Jungen sein Erbe überwies, tausend Dollar für jedes Jahr seines jungen Lebens. Holt, halsstarrig wie alle McKettricks vor ihm, überwies das Geld zurück, jeden Cent.
Angus, selbst stur, legte es auf ein Konto auf Holts Namen an, und seither bekamen sie Zinsen gutgeschrieben.
Jetzt besaß Angus fast dreißigtausend Acres, genug Grasland für eine ziemlich große Rinderherde und viele Pferde. Doch er hatte mit nur einer halben Parzelle, einem Klepper und einem alten Ochsen begonnen. Er lächelte in der Erinnerung an jene frühen Tage. Es hatte viele Sorgen und Mühen gegeben, und dennoch war dies in vielerlei Hinsicht der beste Teil seines Lebens gewesen, weil seine Jahre mit Georgia, die Jahre der Liebe und der Heilung von seinem seelischen Schmerz, noch vor ihm gelegen und darauf gewartet hatten, gelebt zu werden.
Er lachte rau und schüttelte den Kopf. Georgia war ein Schuljahr lang Lehrerin in Indian Rock gewesen, und dann hatte sie, seines sturen Werbens müde, schließlich kapituliert und lachend seinen Heiratsantrag angenommen.
Als er seinen Blick über das Land schweifen ließ, wurde er wieder ernst. Er straffte die Schultern und reckte sein energisches schottisch-irisches Kinn vor. »Georgie«, sagte er im Tonfall eines Mannes, der Widerspruch erwartet, »es wird höchste Zeit, das unsere Söhne etwas Verantwortlichkeit lernen, anständig heiraten und uns einige Enkelkinder schenken. Ich spiele mich jetzt als Autorität auf. Sie haben sich lange genug gehen lassen. Bei Gott, von nun an werden sie wie Männer handeln!«
Die einzige Antwort war das Säuseln des Windes, der sein weißes Haar zerzauste.
Angus atmete die Luft tief ein, als enthielte sie eine stumme Botschaft von Georgia. Er setzte seinen Hut wieder auf, pfiff seinen betagten gescheckten Wallach namens Navajo herbei und schwang sich in den Sattel, nur ein bisschen weniger geschmeidig als früher. Angus hatte zwar Rheumatismus in allen Gliedern, doch er war fast jeden Tag seines Lebens geritten, und das Auf- und Absitzen bereitete ihm nicht mehr Mühe, als auszuspucken oder sich am Kopf zu kratzen. Er hielt die Zügel locker in der linken Hand, tippte mit der rechten an seine Hutkrempe, eine Geste des Abschieds, und ritt den steilen Hügelhang hinab nach Hause.
Als er nach einer Viertelstunde harten Ritts den Stall erreichte, übergab er Navajo Finn Williams, einem der Arbeiter, und ging zum Haus, wobei seine Sporen trügerisch fröhlich klingelten. Über die hintere Veranda und durch die Hintertür gelangte er in die Küche und vergaß fast, seinen Hut abzunehmen.
»Du betrittst nicht mit Sporen an den Stiefeln meinen Boden, Mr. McKettrick«, sagte Concepcion, die ihm den Haushalt führte, seit ihr Ehemann Manuel, ein Schäfer, vor zwanzig Jahren von einer Horde gesetzloser Cowboys aufgehängt worden war. Sie stand an dem großen Plankentisch beim Kamin und knetete Brotteig. Ihr Gesicht und das Oberteil ihres Kattunkleides waren mit Mehl bestäubt. »Wie oft muss ich dir das noch sagen?«
Er blickte sie aus zusammengekniffenen Augen an, wich jedoch zur Türschwelle zurück, schnallte die Sporen ab und warf sie auf die Veranda. Dann hängte er seinen Hut und die Jacke auf die Haken neben der Tür.
»Wo«, begann er unheilvoll, »sind meine Söhne?«
Concepcion hob die Augenbrauen und zuckte die Schultern. »Woher soll ich das wissen?«, fragte sie, die alles über jeden wusste, nicht nur im Haushalt der McKettricks, sondern auch im Umkreis von Meilen.
Angus nahm an, dass sie die Nase immer noch ein wenig hoch trug, weil er ihr an diesem Morgen beim Frühstück offen gesagt hatte, dass sie etwas sehr rundlich geworden war und abspecken sollte. Jetzt bedachte er sie mit einem finsteren Blick, und sie zeigte sich kein bisschen eingeschüchtert. Sie konnte fast so grimmig wie der alte Geronimo persönlich sein und wahrscheinlich – ebenso wie er – einen Mann auf einem Ameisenhügel anpfählen, wenn er ihr zu oft in die Quere kam.
»Also gut«, brummte sie. »Rafe ist vorgestern in die Stadt geritten, was du bereits wüsstest, wenn du mir jemals zuhören würdest, und Kade hat das Haus heute Morgen gleich nach dir verlassen, um etwas zu erledigen – etwas wegen eines Pferdes. Jeb liegt noch im Bett.«
Angus blickte zur Decke. »Ist der Junge krank?«
Concepcion lächelte liebevoll. Seit Georgias Tod bemutterte sie diese drei Halunken wie eine alte Henne, ergriff Partei gegen ihn, ihren eigenen Vater, und trennte sie, wenn sie sich gegenseitig an die Kehle gehen wollten. O ja, sie liebte sie, als wären sie ihre eigenen Söhne, und sie machte auch kein Geheimnis daraus. »Er ist nur müde, glaube ich«, antwortete sie.
Angus ging zum Fuß der Treppe und umklammerte so hart den Endpfosten, dass die Spindel heraussprang. »Jeb!«, brüllte er, und seine donnernde Stimme hallte durch das Haus. »Wälz deinen Allerwertesten aus dem Bett und komm her, aber schnell!«
Als Angus drauf und dran war, hinaufzugehen und den Jungen an den Haaren aus dem Bett zu ziehen, tauchte er auf dem oberen Treppenabsatz auf. Jeb blinzelte. Er trug nur eine falsch zugeknöpfte Hose, sonst nichts, und er wirkte beleidigt, weil er gestört worden war.
Er war zwanzig Jahre alt, verdammt. In Jebs Alter hatte sich Angus bereits fast fünf Jahre lang seinen Lebensunterhalt verdient.
»Was ist los, Pa?«, fragte er.
»Es ist zehn Uhr morgens«, bellte Angus und schlug mit der Faust die Spindel wieder in den Pfosten. »Was denkst du dir dabei, im Bett herumzugammeln wie eine alte Hure nach einer arbeitsreichen Nacht? Wir haben hier eine Ranch zu betreiben!«
Jeb wurde rot, und seine Augen – McKettrick-blau hatte Georgia sie bezeichnet – blitzten. »Das weiß ich, Pa«, erwiderte er. »Ich habe soeben eine Woche damit verbracht, Zaunpfosten auszubessern, erinnerst du dich?«
Das stimmte. Die Erinnerung daran milderte ein wenig Angus’ Zorn, aber nicht viel. »Zieh dich an«, befahl er. »Ich will, dass du deine Brüder suchst, alle beide, und dafür sorgst, dass sie zum Dinner hier sind.« Dinner auf der Triple M Ranch war das Mittagsessen, nicht nur ein anderes Wort für Abendessen wie anderswo, wo die Leute das nicht voneinander unterscheiden konnten. »Ich habe euch allen etwas mitzuteilen.«
Jeb murmelte eine Verwünschung, die ihm vermutlich eine gehörige Standpauke eingebracht hätte, wenn Angus sie deutlich gehört hätte, doch er taumelte zurück in sein Zimmer, zog sich an und ritt binnen zwanzig Minuten los, um Rafe und Kade zu suchen.
Die Uhr auf dem Kaminsims schlug zwei, als die Familie um den langen Tisch in der Küche saß und alle Jungen dort waren. Sie sahen auch sauber aus, obwohl Rafe ziemlich mitgenommen wirkte und sein rechtes Auge praktisch hinter einer großen, grünlich-purpurnen Schwellung verborgen war. Er hatte anscheinend wieder über Politik geredet; Wenn dieser Junge nicht eines Tages ganz allein einen Weidekrieg anzettelte, würde das wie ein Wunder sein.
Kade wünschte sich offensichtlich weit weg, und Jeb war noch ärgerlich, weil er vor dem Mittag aus dem Bett geworfen worden war.
»Ich bin zu einer Entscheidung gelangt«, begann Angus.
Sie warteten.
Angus räusperte sich. »Ich bin ein alter Mann. Fünfundsiebzig, genau gesagt. Es wird Zeit, dass ich es eine Weile ruhig angehen lasse, vielleicht sogar für immer die Füße hochlege.« Er legte eine Pause ein und atmete tief durch. »Aber bevor ich das tue, verdammt, will ich ein Enkelkind. Einen Erben.«
Die Jungen tauschten Blicke und sahen dann ihn, ihren Vater, an, aber keiner erwiderte etwas.
Angus fuhr fort: »Folgendes habe ich entschieden: Der Erste von euch, der heiratet und ein Kind zeugt – ob Sohn oder Tochter, das ist mir egal –, wird dieses Haus, einen Haufen meines Geldes, drei Viertel der Herde und all die Mineralien- und Wasserrechte bekommen.«
Das brachte sie auf die Palme, wie er es vorausgesehen hatte.
Rafe warf fast die Bank um, auf der er saß. Kade blickte wütend drein, und Jeb wirkte, als wäre er bereit, die Öllampe, die über dem Tisch hing, herunterzureißen und hineinzubeißen.
»Moment mal, Pa«, entgegnete Rafe gereizt. »Du hast immer gesagt, wir werden alles gleich zwischen uns dreien aufteilen. Und jetzt soll einer alles bekommen? Wo bleiben denn bei diesem feinen Plan die beiden anderen?«
Angus lächelte. »Nun, die gehen natürlich leer aus«, meinte er. »Die erhalten ihre Befehle von demjenigen, der vernünftig genug ist, mich ernst zu nehmen und sich eine Frau und ein Baby anzuschaffen. Gebt mir jetzt den Kartoffelbrei.«
Kade schob die große Steingutschüssel zu seinem Vater hinüber. Seine Miene war grimmig. Er hatte das dunkelbraune Haar mit den rötlichen Strähnen ebenso von Georgia wie ihre grünen Augen und auch ein gehöriges Maß an Sturheit. »Du willst, dass wir losziehen und uns verheiraten. Einfach so.«
»Du hast es erfasst«, brummte Angus. »Schieb die Platte mit dem gebratenen Hähnchen her, anstatt herumzusitzen und sie anzustarren.« Er legte eine Pause ein und schenkte jedem seiner Söhne einen freundlichen Blick. »Aber heiraten reicht nicht. Es muss auch ein Baby dabei herauskommen. Wisst ihr wenigstens, wie das gemacht wird?«
Jebs Hals und Gesicht waren gerötet. Eine Ader zuckte an seiner rechten Schläfe. »Und wo sollen wir diese Frauen finden?«, fragte er.
Angus spießte das beste Stück Hähnchen auf – schließlich hatte er Geburtstag – und schob die geplünderte Platte zurück in die Mitte des langen Tisches. »Ich nehme an, das ist euer Problem, nicht meines.«
Es folgte Stille.
Angus aß mit gutem Appetit. Am Ende der Mahlzeit holte Concepcion aus der Vorratskammer einen Kuchen mit Glasur und einer brennenden Kerze in der Mitte, und dann begann sie, das Geburtstagslied zu singen.
Niemand sonst stimmte ein.
1. Kapitel
Rafe McKettrick las die kleine geschmackvolle Anzeige auf der Rückseite des Cattleman’s Journal, kennzeichnete die Seite mit einem Eselsohr und schlug mit dem Magazin gegen die Kante des Schreibtischs im Arbeitszimmer seines Vaters. Es war eine verzweifelte Maßnahme, auf die Anzeige zu antworten und eine Braut zu bestellen, wie man ein Buch oder eine speziell angefertigte Gürtelschnalle bestellte, aber Rafe war schließlich ein verzweifelter Mann.
Er hatte nicht den geringsten Zweifel, dass sein Vater seine Worte heute beim Dinner ernst gemeint hatte. Angus war nicht der Typ, der leere Drohungen ausstieß. Rafe kannte weder ein anderes Leben noch wünschte er ein anderes als sein derzeitiges auf der Triple M, und er wollte verdammt sein, wenn er den Rest seiner Tage nach Kades oder Jebs Pfeife tanzen musste. Was bedeutete, dass er schnell eine Frau brauchte, und wenn er sie auf dem Heimweg von der Kirche schwängern konnte, umso besser.
Er schob den großen Polstersessel zurück, zog eine Schreibtischlade auf und nahm ein Blatt des Briefpapiers heraus, das sein Vater für Geschäftskorrespondenz benutzte. Er wählte sorgfältig eine Feder, öffnete ein Tintenfässchen und ordnete seine Gedanken. Nach einer Weile begann er zu schreiben.
An alle, die es angeht.Bitte schicken Sie mir eine Frau. Gesund, mit guten Zähnen. Des Lesens und Schreibens kundig. Und des Kochens. Muss Kinder wünschen. Bald.
Rafe McKettrick
Triple M Ranch
bei Indian Rock, Arizona Territorium
Rafe las den Text mehrmals, sagte sich, dass er nicht wesentlich verbessert werden konnte, faltete das Blatt und steckte es in ein Kuvert, zusammen mit einem Scheck, ausgestellt auf die Bank in der Stadt. Jetzt brauchte er nur noch eine Briefmarke aufzukleben und den Brief mit der nächsten Postkutsche in den Osten abzuschicken.
Er runzelte die Stirn, als er die Adresse schrieb. Die wenigen Male, die er Gelegenheit gehabt hatte, einen Brief abzuschicken, hatte er ihn einfach jemandem von der Ranch anvertraut, der zufällig als Nächster zur Stadt ritt, aber diesmal war das etwas anderes. Zum einen konnte jeder auf dem Umschlag lesen, dass der Brief an das »Heiratsinstitut Happy Home« adressiert war, und das allein war Futter genug für gnadenlose Frotzelei von jedem anderen Mann auf der Ranch. Zum anderen wollte er nicht, dass seine Brüder seine Absicht spitzkriegten, indem sie seinen Brief stahlen oder seine Idee klauten oder beides. Nein, nein, sagte sich Rafe, lehnte sich in dem Sessel zurück und steckte das Kuvert in seine Westentasche, ich werde den Brief persönlich aufgeben, den ganzen Weg nach Indian Rock reiten und auf die Postkutsche warten.
Er seufzte, schloss die Augen und legte die Füße auf den Schreibtisch.
Vielleicht würde es gar nicht so schlecht sein, eine Frau zu haben. In einer kalten Nacht würde er sie gleich greifbar haben, und das war auf einer so abgelegenen und einsamen Ranch wie der Triple M ein Segen. Er würde sie schwängern, bevor die Tinte in der Familienbibel getrocknet war, und das wäre es dann. Die Ranch würde ihm gehören, wenn es so weit sein würde, und Kade und Jeb würden entweder nach seiner Pfeife tanzen oder ihr Pferd satteln und fortreiten müssen.
Er wusste, dass sie niemals die Ranch verlassen würden – dieses Leben lag ihnen im Blut wie ihm selbst –, und er lächelte bei dem Gedanken, sie arbeiten zu lassen wie Ackergäule. Als Erstes würde er sie ein neues Loch für den Abort graben und dann das alte mit Kalk zuschaufeln lassen. Das Dach des Arbeiterquartiers musste im kommenden Frühjahr repariert werden – sie brauchten verdammt viel Glück, damit es den kommenden Winter über noch hielt –, und natürlich würden er und die Frau einen Anbau ans Haupthaus brauchen, damit sie ein wenig Privatsphäre hatten. Jeb hatte zwar daran gearbeitet, die Grenzzäune zu reparieren, doch viele Pfosten mussten ersetzt und oben an der Nordgrenze mussten Bäume gefällt werden. Während seine Brüder unter den Aufgaben schwitzen würden, die er sich für sie ausdachte, würde er ausreiten und nach dem prächtigen Hengst suchen, den er wie einen Geist in den Canyons gesehen hatte. Er war nie nahe genug herangekommen, doch wenn es ihm gelingen würde, dieses Pferd einzufangen, würde das der Beginn seiner eigenen Herde sein.
Jemand schlug ihm auf die Füße, die auf der Schreibtischplatte lagen, und er erschrak fast zu Tode und setzte sich mit einem Fluch aufrecht hin, bereit zu kämpfen.
Kade, mit siebenundzwanzig zwei Jahre jünger als Rafe, starrte auf ihn herab. »Was hast du soeben gedacht, großer Bruder?«, fragte er in seiner gedehnten Sprechweise. Er hockte sich auf die Schreibtischkante, verschränkte die Arme und sah seinen Bruder aus zusammengekniffenen Augen an. »Nach deiner Miene zu schließen, hattest du nichts Gutes im Sinn.«
Rafe war froh darüber, dass er den Brief in seine Westentasche gesteckt hatte, wo er nicht zu sehen war. Er legte die verschränkten Hände auf den Bauch und setzte eine beleidigte Miene auf. »Was ist denn das? Du traust mir nicht, kleiner Bruder?«
»Er müsste schön blöd sein, wenn er dir traut!«, rief Jeb von der Türschwelle her. Sein Mund war zu einem sarkastischen Grinsen verzogen. »Ich würde eher einem Stinktier vertrauen.« Er betrat das Arbeitszimmer und schloss die Tür hinter sich. Der große Raum schien zu schrumpfen, als sich alle drei darin aufhielten. Rafe spielte mit dem Gedanken, aufzustehen und ein Fenster zu öffnen, doch er wollte nicht den Platz in dem Sessel aufgeben, den er bereits als seinen eigenen betrachtete.
Er setzte sich gerade hin und stellte die Füße auf den Boden.
Kade drehte den Kopf, beobachtete das Nahen ihres jüngsten Bruders, der sich einen Stuhl heranzog und sich setzte. Jeb bewegte sich lässig und geschmeidig. Er war der beste Zureiter auf der Ranch – Rafe hatte noch keinen gesehen, der wie sein kleiner Bruder von vielen wilden Pferden abgeworfen worden und meistens auf seinen Füßen gelandet war.
»Was sollen wir tun?«, hakte Jeb jetzt ernst nach und schlug die Beine übereinander. »Dies ist keine seiner Schrullen, wisst ihr? Pa meint seine Worte ernst.«
Kade nickte grimmig, die Arme immer noch verschränkt. Er war der Ruhige, Gesittete, Nachdenkliche der Brüder. Er las und zitierte ständig Poesie, und man musste bei ihm aufpassen wie bei einer Klapperschlange. »Ich glaube, dass er es ernst gemeint hat«, stimmte er zu. »Es hat mit seinem Geburtstag zu tun. Er fühlt sich alt.«
»Hölle, er ist alt«, murmelte Rafe.
Jeb lachte und schüttelte den Kopf. »Sag das dem Arbeiter, den er vorige Woche dabei erwischt hat, als er eine der Stuten schlug«, entgegnete er. »Der Typ liegt immer noch in Daisys Pension. Der Doc sagt, es könnte bis zum Frühjahr dauern, bis der arme Kerl wieder reiten kann.«
Kade grinste. »Daisy«, murmelte er. »Na, das ist doch eine zukünftige Braut! Warum machst du ihr nicht den Hof, Rafe?«
»Eher würde ich mich mit einer alten Bärin einlassen«, antwortete Rafe entschieden. Daisy Pert war über einsachtzig, wog fast so viel wie ein beladener Heuwagen und hatte noch zwei Zähne im Mund, beide schadhaft. Sie schnupfte Tabak und war in Lemuel, den schielenden Sohn des Reisepredigers, verliebt, der sie mehr fürchtete als den Teufel persönlich.
»Ich nehme an, Rafe hat einen Trumpf im Ärmel«, spekulierte Kade. Sein Tonfall war leicht, doch seine Stimme enthielt einen drohenden Unterton; man musste schon genau hinhören, um ihn wahrzunehmen. Er neigte sich ein wenig vor. »Nicht wahr, Rafe?«
Rafe tat sein Bestes, um unschuldig zu wirken. Diese Fähigkeit hatte er im Laufe der Jahre entwickelt, und sie war ihm nicht so leicht zugefallen wie das Kämpfen, Schießen und Reiten. »Wie kommst du auf so was?«, fragte er.
»Nur so ein Gefühl«, meinte Kade leichthin und blickte zu den Flecken frischer Tinte, die auf dem Löschblatt trockneten. »Und siebenundzwanzig Jahre Erfahrung.«
In diesem Augenblick flog die Tür des Arbeitszimmers auf, und Concepcion tauchte auf wie eine Gewitterwolke über der Anhöhe, beladen mit schlechtem Wetter und Blitzschlägen. Rafe, der mit dem Vater gerechnet hatte, war nur ein wenig erleichtert; dies sah für ihn nicht nach einer Gnadenfrist aus.
Concepcion drehte sich mit unermesslicher Würde um, verriegelte die Tür und wandte sich dann wieder den Brüdern zu. In ihren dunklen Augen blitzte es. »Wie konntet ihr?«, zürnte sie. »Wie konntet ihr solch einen wichtigen Tag vergessen?«
Jeb stand auf, wenn auch verspätet. Seine blauen Augen funkelten mutwillig, und mit einer Geste forderte er Concepcion auf, sich auf seinen Stuhl zu setzen. »Ich kann nicht für meine Brüder sprechen«, erwiderte er, »aber zufällig habe ich daran gedacht.«
Kade und Rafe starrten ihn wütend an.
»Den Teufel hast du!«, fuhr Rafe auf.
»Ich habe oben ein Buch, hübsch eingewickelt und mit einer Schleife zusammengebunden, nur für Pa«, beharrte Jeb.
»Das hast du für dieses neue Flittchen gekauft, das soeben im Saloon angefangen hat«, beschuldigte Kade ihn.
Concepcion ließ sich auf den Stuhl fallen und bedachte Kade und Rafe mit einem einzigen vernichtenden Blick. Der Blick, den sie Jeb zuwarf, war nur geringfügig milder. Offensichtlich zweifelte sie an seiner Geschichte, war jedoch bereit, zu seinen Gunsten zu urteilen. Frauen waren immer geneigt, im Zweifelsfall für diesen Schurken zu entscheiden, fand Rafe.
Jebs Lächeln wurde zu einem Grinsen, und er zuckte die Schultern. »Denkt, was ihr wollt.«
»Setz dich«, befahl Concepcion, »und halt die Klappe.«
Jeb schnitt eine Grimasse, setzte sich auf die Umrandung des Kamins, verschränkte die Hände und ließ sie zwischen seinen Knien baumeln. Kade schaute nicht mehr zur Decke, sondern zum Boden, und Rafe richtete den Blick auf eine Stelle oberhalb Concepcions linker Schulter.
»Wisst ihr, was ich denke«, fuhr Concepcion fort und drohte ihnen allen mit dem Finger. Rafe sagte sich, dass sie ihre Gedanken gleich darlegen würde, ob sie sie bereits kannten oder nicht. »Euer Vater hat Recht. Es ist höchste Zeit, dass ihr vernünftig werdet, ihr drei, und ein eigenes Heim und eine Familie gründet.«
Kade äußerte sich als Erster dazu. Er seufzte tief. »Ich habe vergessen, dass Pa Geburtstag hat«, gab er zu. »Trotzdem verstehe ich nicht, was das damit zu tun hat, dass …«
Concepcion wurde wütend. »Wenn du über etwas anderes als Bücher, lockere Weibsbilder und Pferde nachdenken würdest, dann würde dir klar werden, dass du dein Leben vergeudest.« Als Jeb und Rafe grinsten und sich über Kades Unbehagen freuten, fuhr Concepcion sie an wie eine Wölfin. »Meint ihr, ihr seid besser?«, schnaubte sie. »Du, Rafe, mit deinem Jähzorn und deiner Rauflust? Du, Jeb, mit deinem Kartenspielen?«
Kade hob in einer Geste der Kapitulation beide Hände.
Rafe reckte das Kinn vor und versuchte, Concepcion mit Blicken einzuschüchtern, doch er wusste, dass ihm das nie gelingen würde.
»Ich nehme an«, brach Jeb das unheilvolle Schweigen, »ich sollte das Geburtstagsgeschenk holen, das ich oben habe, und es Pa geben.«
»Wenn du einen Fuß aus diesem Zimmer setzt«, warnte Kade ihn wütend, »ziehe ich dir die Haut ab, gleich hier und jetzt.«
Jeb wurde rot. Er sprang auf, ballte die Hände zu Fäusten, stets bereit zu einem Kampf. Concepcion war jedoch dank langer Praxis schnell, und sie trat zwischen Kade und ihn, bevor einer von beiden zuschlagen konnte. Da Jeb der Jüngste war, wurde er für gewöhnlich bei diesen kleinen Schlägereien verprügelt, doch er versuchte es trotzdem immer wieder.
»Das reicht«, entschied Concepcion in einem Tonfall, der keinen Widerspruch duldete.
Jeb legte die Hände auf ihre Schultern, drehte sie zu sich um und machte ihr schöne Augen. »Concepcion«, säuselte er, »willst du mich heiraten und die Mutter meiner Kinder sein?«
Einen Moment herrschte Totenstille, ähnlich der Sekunden des Schocks kurz nach einem Wespenstich, bevor sich das Gift auszubreiten beginnt. Dann folgte ein Klatschen, und Jebs Gesicht färbte sich dort, wo Concepcions Hand es getroffen hatte, rot.
»Es reicht«, zürnte sie.
Rafe und Kade sahen sich an, unterdrückten ihr Gelächter und schauten schnell wieder fort.
»Ihr habt diesem feinen Mann das Herz gebrochen«, fuhr Concepcion fort, nachdem sie sich gesammelt hatte. »Ihr seid eine Enttäuschung, eine Schande. Ihr alle.«
Sie starrten sie an. Keiner von ihnen hatte sie jemals so aufgeregt erlebt, was angesichts einiger der Streiche, die sie im Laufe der Jahre allein und vereint ausgeheckt hatten, etwas heißen sollte.
»Bis ihr euren Vater mit dem Respekt behandelt, den er verdient«, bemerkte sie, straffte ihre Haltung und strich sich das mit Mehl befleckte Kleid glatt, »werde ich keinen Bissen Essen mehr für einen von euch kochen. Ich werde weder Knöpfe annähen noch Betten machen noch Kleidung waschen. Einmal in eurem Leben könnt ihr für euch selbst sorgen.« Damit machte sie kehrt, das Kinn königlich erhoben, und rauschte zur Tür. Sie entriegelte sie, riss sie auf und trat hinaus, ohne zurückzublicken.
»Meint ihr, das hat sie alles ernst gemeint?«, fragte Jeb, jetzt nicht mehr so selbstsicher.
Kade verdrehte die Augen. »O ja«, entgegnete er resigniert, »völlig ernst.«
Rafe starrte zur Decke und überlegte, wie lange es dauern würde, bis seine Braut eintraf. Der Gedanke, sich seine Mahlzeiten selbst zu kochen, gefiel ihm gar nicht, und er hatte im ganzen Leben noch keine Wäsche gewaschen. Am besten ritt er schnell nach Indian Rock und schickte diesen Brief ab.
»Pa wird das nie zulassen«, mutmaßte Jeb und klammerte sich an einen Strohhalm. »Er bezahlt sie dafür, dass sie kocht und sauber macht.«
»Für ihn«, gab Kade zu bedenken. »Nicht für uns.«
Jeb dachte darüber nach und blickte gequält drein. »Oh.«
»Wir sollten uns was einfallen lassen, wie wir sie besänftigen können«, meinte Kade. »Entweder das, oder wir müssen im Arbeiterquartier essen, und ihr wisst, wie Red kocht – angebrannte Bohnen zum Frühstück, Dinner, Abendessen und zum Dessert.«
»Was schlägst du vor?«, hakte Rafe nach, ohne die Augen zu öffnen. Er tat sein Bestes, um guten Mutes zu bleiben, indem er sich eine Frau an seiner Seite vorstellte. Bis dahin würde er einfach in der Stadt essen müssen. Dieser chinesische Knabe, Kwan Sowieso, konnte einmal im Monat seine Wäsche waschen. Man musste nur findig sein, das war alles.
»Ich schlage vor, wir gehen auf Pas Forderungen ein«, seufzte Kade. »Dann werden all unsere Probleme gelöst sein.«
»Das gilt für einen von uns«, erinnerte Jeb, und etwas an seinem Tonfall ließ darauf schließen, dass er annahm, dieser eine zu sein. »Die anderen beiden sind ziemlich übel dran.«
Rafe äußerte sich nicht dazu.
»Ich habe vor, die erste anständige Frau zu heiraten, die ich finden kann«, vertraute Kade seinen Brüdern an. »Doch ihr beide braucht euch keine zu großen Sorgen zu machen. Ich werde von euch nicht verlangen, dass ihr salutiert oder Uniformen tragt. Ihr könnt einen Zehn-Stunden-Tag abreißen wie all die anderen Arbeiter und einen Sonntag im Monat freinehmen.«
Rafe öffnete die Augen. »Wen willst du denn heiraten?«, fragte er, neugierig und ziemlich alarmiert. Kade war der Listigste von ihnen. Man wusste nie, was in seinem wie ein Uhrwerk arbeitenden Kopf vorging.
Kade lächelte; Butter wäre in seinem Mund geschmolzen. »Meint ihr wirklich, ich wäre so blöd, euch das auf die Nase zu binden?« Dann schlenderte er ohne ein weiteres Wort aus dem Arbeitszimmer. Man hätte meinen können, er hätte in diesem Moment oben im Haus eine Frau in den Wehen liegen, so verdammt selbstsicher gab er sich.
Rafe sprang auf, um ihm zu folgen, und Jeb war gleich hinter ihm.
In der großen Halle schnallte Kade seinen Revolvergurt um. Er nahm seinen Hut vom Haken an der Wand, setzte ihn auf und griff nach seiner langen Jacke. Concepcion hatte geschimpft, dass er damit wie ein Herumtreiber und Gesetzloser wirke.
»Du willst in die Stadt?«, fragte Rafe mit erhobenen Augenbrauen.
Kade zog die Jacke an, richtete den Kragen und überprüfte den Sitz des Hutes im Spiegel an der Wand neben der Standuhr. Er gab keine Antwort.
Jeb lief unterdessen die Treppe hinauf und nahm immer zwei Stufen auf einmal. Vermutlich wollte er das Geschenk holen, das er für dieses Saloon-Mädchen gekauft hatte, und damit beim Vater Speichel lecken und so tun, als hätte er die ganze Zeit gewusst, dass heute sein Geburtstag war.
Rafe wandte sich angewidert ab. Seine Brüder waren hinterlistige Kerle, alle beide.
Er nahm seinen eigenen Hut, seine Jacke und den Gurt mit dem Revolver, den er in der obersten Schublade im Schrank in der Halle aufbewahrte. Ja, er würde nach Indian Rock reiten und seinen Brief mit der Postkutsche abschicken. Und bald würde seine Braut eintreffen, bereit, einen Haushalt zu gründen und ein Baby zu bekommen.
Hölle, mit etwas Glück würde sie sogar halbwegs präsentabel sein.
Kansas City, Missouri
Emmeline Harding schloss das Fenster des Zimmers im ersten Stock von Miss Beckys Pension mit einem Knall, konnte jedoch kaum das Brüllen der Rinder und die Rufe der Cowboys auf der Straße dämpfen. Eine weitere Herde, vermutlich von Texas hergetrieben, war auf dem Weg zum Viehhof. Binnen einer Stunde würden die Treiber hereinströmen und ein Bad, Whisky und Frauen haben wollen – nicht zwangsläufig in dieser Reihenfolge. Mithilfe ihrer »Mädchen« würde Becky, Emmelines Tante, dafür sorgen, dass alle zufrieden gestellt wurden. Gegen gutes Geld, versteht sich.
Emmeline seufzte. Vom gesellschaftlichen Standpunkt aus betrachtet – im Wesentlichen der einzige Standpunkt, der zurzeit für sie zählte, denn sie wurde in nur einer Woche neunzehn –, war sie weder Fisch noch Fleisch. Becky hatte sie auf das beste Mädchenpensionat in der Stadt geschickt und von den Gästen fern gehalten – und wofür? Trotz all der hervorragenden Manieren, der hübschen Kleidung und des Bücherwissens war sie immer noch eine gesellschaftlich Ausgestoßene, unwillkommen in den respektablen Häusern ihrer ehemaligen Klassenkameradinnen.
Das Leben, so schien es Emmeline, war eine große Party, und sie war nicht eingeladen.
Auf der anderen Seite des oberen Wohnzimmers mit seinen perlenbesetzen Wandschirmen und Samtvorhängen rollte Becky einen schwarzen Netzstrumpf über ein schlankes Bein. Becky war eine Schönheit mit Geschäftssinn, und sie war stets freundlich zu Emmeline gewesen, hatte sie seit der Kindheit beschützt und für sie gesorgt, als sie zur Waise geworden war. Jetzt betrachtete Becky ihre Nichte nachdenklich.
»Spinnst du wieder Tagträume?«, fragte sie.
»Nein«, flunkerte Emmeline. Oft gelangweilt und stets einsam, liebte sie es, Zuflucht in den breiten Grenzen ihrer Fantasie zu suchen. Dort baute sie eine gemütliche kleine Hütte für sich und einen moralisch rechtschaffenen Ehemann, obwohl er ihr noch unbekannt war, für mehrere Kinder mit rosigen Wangen und goldenen Haaren und zwei fette Katzen. Die Hütte hatte Läden vor den Fenstern, Blumen blühten im Vorgarten, und die weiße Pforte knarrte ein bisschen, wenn das Wetter trocken war. Es gab auch andere Szenarien, die zu ihrer jeweiligen Stimmung passten. Bei einem wurde sie von Indianern gefangen gehalten, war die Frau eines leidenschaftlichen Kriegers namens Schneewolf, der sie in einer Art und Weise berührte, dass ihr Blut in Wallung geriet.
Becky betrachtete sich im verzierten Spiegel neben der Tür. Sie war groß, mit einer dunklen Haarfülle, makelloser heller Haut, grünen Augen, und trotz ihres Rufs hätte die Hälfte der Rancher und Geschäftsleute in Missouri sie vermutlich geheiratet und ihr ein feines Zuhause geboten, wenn sie nur einen Finger gekrümmt hätte. Offensichtlich zufrieden mit ihrer üppigen Erscheinung, wandte sie sich ihrer Nichte zu.
»Ich brauche dir wohl nicht zu sagen, dass du unten im Salon bleiben und warten sollst, bis sich die Dinge ein wenig beruhigt haben. Du weißt, wie Cowboys sind, wenn sie eine Weile unterwegs waren.«
Emmeline verzog das Gesicht. »Ich weiß.« Sie verspürte nicht den Wunsch, Männer zu »unterhalten«, wie ihre Tante es tat, doch sie war in jüngster Zeit ruhelos. Sie hatte jedes interessante Buch aus der öffentlichen Bücherei gelesen, jedes Theaterstück gesehen, das in der Stadt aufgeführt worden war, und genug Tücher gestickt, um damit den Weg zur Hölle zu bedecken. Sie war es leid, die Zeit totzuschlagen, den Schein zu wahren und darauf zu warten, dass ihr Leben endlich anfing. Wenn nicht bald etwas geschah, nun, dann wusste sie nicht, was sie tun würde.
Nach und nach trudelten die anderen Frauen ein, die in der Pension wohnten. Die meisten gähnten und trugen ein Negligee oder einen Morgenrock. Einige begrüßten Emmeline mit mahnend erhobenem Zeigefinger, andere lächelten schläfrig. Nach der Uhr auf dem Kaminsims war es dreizehn Uhr – von ihrem Standpunkt aus gerade Morgengrauen.
Becky gab sofort Anweisungen, ein General in Seide und Tüll. Sie schickte ihre »Soldaten« in ihre Zimmer, um sich dort reizvoll zurechtzumachen, bevor sie ihre Gefechtsstationen im unteren Salon einnahmen. Dieser prächtige Raum hatte Emmeline schon immer fasziniert, obwohl sie ihn selten betreten durfte. An den Wänden hingen Gemälde von splitternackten Frauen, auf dem Boden lagen orientalische Teppiche, und die schweren Vorhänge waren mit goldenen Fransen besetzt. Das Zigarrenrauchen war erlaubt, und Whisky wurde serviert, diskret, denn Becky hatte keine Lizenz zum Verkauf von alkoholischen Getränken. Aber sie fürchtete das Gesetz nicht. Der Marshal und seine Deputys waren Stammgäste, und weil sie vom Stadtrat nur ein jämmerliches Gehalt erhielten, bekamen sie bei Becky stets einen Sonderpreis.
Heute war für Emmeline dieser geheimnisvolle Raum einfach unwiderstehlich.
Emmeline bemühte sich, ihre abenteuerliche Natur zu zügeln – es war die gleiche ruhelose Ader, wegen der sie fast verhaftet worden wäre, weil sie in einer mondhellen Nacht mit zwei »wilden« Mädchen nackt im Mühlenteich gebadet hatte –, doch die kommenden Stunden waren zu lang und zu langweilig, und sie erlag der Versuchung.
Becky war eine Stunde fort, als Emmeline wie ein Geist nach langem, langem Schlaf aus der Flasche schlüpfte, heimlich in das luxuriöse Schlafzimmer ihrer Tante schlich und den massiven Kleiderschrank gegenüber des Kamins öffnete. Das Innere barst fast vor farbiger Seide, Satin, Samt und Spitze – solch ein köstlicher Kontrast zu ihrem praktischen braunen Leinenkleid – und einer Fülle von Federn, Armreifen und Perlenketten. Nach einiger Überlegung wählte sie ein gewagtes rotes Kleid aus glänzendem Stoff mit einem Besatz aus schwarzer Spitze, zog ihr eigenes Kleid aus und Tante Beckys Kleid an. Sie stand wie gebannt vor Beckys Spiegel und betrachtete sich.
Emmeline erkannte sich kaum. Sie löste ihr fast blondes Haar, das im Nacken in einem strengen Knoten zusammengefasst war, und kniff sich in die Wangen. Ihre graugrünen Augen, die sonst ruhig blickten, funkelten feurig, und sie nahm eine provokative Pose ein, stemmte die Hände in die Hüften und reckte den Busen vor. Sie lächelte frivol, wie sie es unzählige Male bei den anderen Mädchen gesehen hatte, drehte sich einmal um die eigene Achse und bewunderte sich.
Sie liebte es, so zu tun, als wäre sie jemand ganz anderes, jemand völlig Neues, kühn und sogar ein wenig schamlos, und es widerstrebte ihr, zu ihrer normalen langweiligen Persönlichkeit zurückzukehren.
Was kann es denn schaden, wenn ich nach unten schleiche, nur für ein paar Minuten, und mich unter die anderen mische?, sagte sie sich. Dort war es bereits rappelvoll; der Lärm von unten verriet ihr das. Wenn sie sich am Rande der Versammelten hielt, würde sie von Becky nicht gesehen werden, und sie konnte ein bisschen harmlos schauspielern, mit einem Cowboy flirten, vorgeben, eine Dame der Nacht zu sein, und sich dann wieder nach oben stehlen, ohne jemals entdeckt zu werden.
Es lief fast alles wie geplant ab.
Fast.
Emmeline schwang mit den Hüften, als sie die Treppe hinabstieg und die ganze Zeit nach ihrer Tante Ausschau hielt. Wie sie gehofft hatte, hielt Becky in einer Ecke des Salons Hof, umgeben von Cowboys, die sich fein gemacht hatten und Schnaps tranken. Die anderen Frauen waren ebenfalls beschäftigt, plauderten, gaben vor, wahrsagen zu können, oder servierten Getränke.
Ihr Blick glitt unfehlbar zu dem größten und beeindruckendsten Mann im Salon. Nach der Aura der Autorität zu schließen, war er der Trailboss oder sogar der Besitzer einer großen Ranch unten an der mexikanischen Grenze. Er hatte welliges braunes Haar und haselnussbraune Augen, und er trug immer noch seinen langen Staubmantel, obwohl es warm war. Sie erhaschte einen Blick auf einen Revolver, den er in einem tief geschnallten Halter an der linken Hüfte trug. Er drehte sich zu ihr wie eine Kompassnadel, die den Norden findet, und einer seiner Mundwinkel verzog sich zu einem kaum wahrnehmbaren Lächeln. Es war eine Spur von Spott darin, als argwöhnte er, dass sie ein Spiel spielte und vorgab, jemand anderes zu sein.
Er ging auf sie zu, seine Schritte waren lang, langsam und würdevoll.
Emmeline, die immer noch auf der Treppe verharrte, wich unbeholfen einen Schritt zurück und wäre fast auf ihren Po geplumpst.
Er umfasste den Treppenpfosten mit einer behandschuhten Hand und betrachtete sie. Seinen Hut hatte er an der Tür abgesetzt – das war eine Vorschrift bei Becky, und sie erlaubte auch nicht das Tragen von Waffen in ihrem Etablissement. Jedenfalls normalerweise nicht. Wer auch immer dieser Mann war, er lebte nach seinen eigenen Regeln.
»Hallo«, begann er. Die Art, wie er dieses eine Wort aussprach, reichte, um ihn als Texaner zu stempeln; honigsüß, schmeichelnd rollte es über seine Zunge.
»Hallo«, brachte Emmeline heraus und spürte, dass sie von den Füßen bis zum Haaransatz errötete. Sie wollte sich wegdrehen und davonstürzen, doch sie war zu keiner Bewegung fähig.
»Sie müssen hier neu sein«, bemerkte er gedehnt. »Ich erinnere mich nicht vom letzten Mal an Sie.«
Emmeline presste kurz die Lippen aufeinander. »Ja«, stimmte sie verlegen zu. »Das stimmt. Ich bin … ich bin neu.«
Er hob leicht eine Augenbraue. »Wie heißen Sie?«
Sie zögerte, blickte in Richtung ihrer Tante und sah, dass Becky zum Glück immer noch beschäftigt war und sie deshalb nicht bemerkt hatte. »Lola«, flunkerte sie, weil sie den Namen in einem Roman gelesen hatte. »Lola McGoneagle.«
Er lächelte wieder, lehnte sich gegen das Treppengeländer und betrachtete sie. »Nun, Miss Lola«, meinte er. »Ich bin mächtig froh, Ihre Bekanntschaft zu machen. Es war ein langer Weg von Texas rauf.«
Emmeline schluckte hart. »Oh«, murmelte sie benommen.
Er grinste. »Darf ich Ihnen einen Drink spendieren?«
Emmeline zögerte und entschied sich dann, gefährlich zu leben. Ich werde später über diese schöne, gefährliche Begegnung in mein Tagebuch schreiben, dachte sie und empfand Vorfreude darauf. »Ja, antwortete sie. »Das wäre nett.«
»Was möchten Sie?«
Diesmal schluckte Emmeline nicht nur, sondern hustete fast. Grundgütiger! Er wollte wissen, welche Art Schnaps sie bevorzugte, und sie hatte das Zeug kaum probiert, höchstens mal ein wenig Brandy in ihren Eierflip am vergangenen Heiligabend gegeben. »Was immer Sie trinken«, wich sie aus. Als er sich abwandte, um zu dem eleganten Tisch zu gehen, der als Bar diente, riet eine innere Stimme Emmeline wegzulaufen. Auf dem Absatz kehrtzumachen, nach oben zu laufen und sich in dem anderen Salon einzuschließen. Stattdessen setzte sie sich auf eine Treppenstufe, fühlte sich ein wenig schwindelig und faltete die Hände.
Sie würde einfach warten, bis sie zu Atem gekommen war, und dann fliehen.
Doch der Texaner kehrte zurück und setzte sich auf die Treppe neben sie, bevor sie genug Mut gefunden hatte, aufzustehen und die Flucht zu ergreifen.
»Sind Sie lange im Geschäft?«, fragte der Fremde und überreichte ihr ein Glas, das mit mindestens einem doppelten Whisky gefüllt war.
Emmeline war nie auch nur geküsst worden, geschweige denn hatte sie die Dinge getan, die in ihrer Fantasie Becky und die anderen Frauen mit Männern taten, doch es war ihr peinlich, das zuzugeben. Eine weitere Lüge kam ihr so leicht über die Lippen, dass sie überrascht und beschämt war. »O ja«, behauptete sie und kramte in dem Repertoire von eingebildeten Emmelines, die sie im Laufe der Jahre entwickelt hatte. »Ich kam ursprünglich von Chicago. Dort bin ich auf der Bühne aufgetreten.« Es war immer ihr Traum gewesen – jedenfalls einer ihrer Träume –, Schauspielerin zu sein, eine berühmte und reiche Schönheit mit zahllosen lustigen Kumpanen. Sie sagte sich, dass Lola regelmäßig durch Europa und zu all den anderen Orten reiste, von denen Emmeline ebenso gelesen hatte, und die Huldigung von Königen, Prinzen und Potentaten genoss.
Er lächelte auf eine Art, die anscheinend … nun, nachsichtig war, wie Emmeline fand, und sie war ein wenig gekränkt. »Ich verstehe«, meinte er. »Und jetzt machen Sie … dies.«
Sie biss sich auf die Unterlippe. Nein, antwortete sie im Stillen, »Ja«, sagte sie laut.
Er dachte eine Weile darüber nach, sehr ernst, während er an seinem Whisky nippte. Emmeline musste noch trinken; sie hielt ihr Glas mit beiden Händen fest, und zwang sich, das Zeug nicht auf den Teppich zu schütten. »Anscheinend ein harter Weg, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen«, bemerkte er nach einer Weile.
Emmeline kippte den Whisky in einem Zug hinunter. »Gibt es einen leichten Weg?«, entgegnete sie, und ihr schauderte, als die feurige Flüssigkeit ihre Kehle herabrann und in ihrem Magen brannte. Ihr wurde sofort schwindelig, und sie hielt sich am Treppenpfosten fest, um sich zu stützen.
»Ich glaube nicht, dass es einen gibt«, erklärte der Mann und lächelte leicht, obwohl sein Blick traurig war. »Noch Whisky?«
»Wenn es Ihnen nichts ausmacht«, erwiderte Emmeline. Sie war von irgendeinem boshaften Geist besessen – das war die einzige Erklärung für ihr gegenwärtiges Verhalten. Wenn Becky sie bei diesem Spiel erwischte, würde die Hölle los sein.
Und so unterhielten sie sich, Emmeline und der Texaner, und tranken mehr Whisky. Er stellte sich als Holt vor, obwohl sie sich später nicht mehr erinnern konnte, ob das sein Vor- oder Nachname war. Er war in der Nähe von San Antonio bei Tante und Onkel aufgewachsen und besaß einen Anteil an der Rinderherde, die Emmeline zuvor auf der Straße gesehen hatte. Irgendwann – sie hätte nicht sagen können, wie lange es gedauert hatte – nahm er sie an die Hand, half ihr auf die Füße und führte sie die Treppe hinauf in den stillen Schatten des Flurs.
Dort küsste er sie. Es war tatsächlich angenehm, doch Emmeline fühlte sich ein wenig enttäuscht. Ihre Lektüre und ihre Fantasien hatten dazu geführt, etwas mehr zu erwarten, obwohl sie nicht genau hätte erklären können, was dieses Etwas war. Als es vorüber war, sank sie gegen die Wand und seufzte, was ihn zu einem leisen Lachen veranlasste.
»Das habe ich mir gedacht«, murmelte er sarkastisch.
»Hm?«, fragte sie und musste gegen einen leichten Schluckauf ankämpfen. Ihre Knie waren ein wenig weich, und sie begann an der Wand hinabzurutschen, doch er fing sie auf und hob sie leicht auf seine Arme.
»Ihr Zimmer«, meinte er, »wo ist es?«
Das vage Prickeln, das sie empfand, war weder alarmierend noch erwartungsvoll, sondern etwas anderes, etwas, das sie nicht kannte. Sie rieb sich über eine Schläfe und versuchte, so etwas wie Ordnung in ihre Gedanken zu bringen. »Ich finde, Sie sollten mich absetzen«, protestierte sie. »Dies ist sicherlich ziemlich unschicklich.«
Darüber lachte er glucksend. »Das mag wahr sein«, stimmte er zu, »aber Sie sind nicht in der Verfassung, um allein in einem Bordell herumzuwandern.«
Sie seufzte wieder. »Ich wohne hier«, entgegnete sie.
»Das haben Sie gesagt«, erwiderte er.
Emmeline dachte schnell, und es war nicht leicht angesichts ihres benebelten Verstandes. Dann wies sie auf die Tür eines Zimmers, das leer stand, wie sie wusste. Vor ein paar Tagen hatte Chloe Barker Becky und Kansas City für immer verlassen und den Zug nach Westen genommen. Emmeline empfand deshalb plötzlich einen scharfen Stich von Neid, ein hartherziges Gefühl, das sie hatte unterdrücken können, als sie nüchtern gewesen war.
»Da ist mein Zimmer«, behauptete sie. Wenn sie sich nur einen Moment hinlegen, die Augen schließen und ihr Gleichgewicht zurückgewinnen konnte, würde es ihr wieder prima gehen.
Der Texaner öffnete mit seinem Fuß die Tür. Der schwache Duft von Lavendelwasser und Puder hing in der Luft, und Staubkörnchen schwebten wie Fragmente von Sternen im fahlen Gaslicht, das vom Flur hereinfiel. Das Bettgestell war aus Eisen, weiß angestrichen, und die Tagesdecke aus Satin war abgenutzt, jedoch immer noch hübsch.
Emmeline gähnte herzhaft, und der Mann namens Holt legte sie auf die Matratze, woraufhin die Bettfedern quietschten. Sie versuchte, sich aufzusetzen, weil sie sich daran erinnerte, dass sie noch ihre Schuhe trug, und erkannte, dass es andere, wichtigere Gründe zur Sorge gab. Doch er legte eine Hand auf ihre Schulter, und sie drückte sich tiefer in die Kissen. Sie empfand ein gnädig befreiendes Gefühl um ihre Füße, als er ihr die Schuhe auszog.
Das war leider das Letzte, an das sie sich erinnerte, denn sie geriet in einen Wirbel von Schatten und glaubte, an einen Ort zu stürzen, der zu finster und tief für Träume war. Als sie erwachte, war die Sonne aufgegangen, und ihr Kopf schmerzte, als hätte sie ihn kurz vor der Ankunft des Zehnuhrzuges auf die Eisenbahnschienen gelegt. Als Erstes wurde ihr bewusst, dass sie allein in dem fremden Bett lag und nur ihre Unterwäsche trug.
Ihre Augen wurden groß, als die Erinnerung zurückkehrte; Gallenflüssigkeit stieg in ihrer Kehle hoch. Zusammenhanglose Erinnerungen wirbelten nach und nach durch ihren Kopf – das rote Kleid, der Mann aus Texas – wie war sein Name? –, der Whisky. Sie taumelte zum Waschständer neben dem Fenster, blinzelte im grellen Tageslicht, beugte sich über das Waschbecken aus Porzellan und erbrach sich. Als es ihr wieder etwas besser ging, tastete sie hektisch ihre Brüste, ihren Leib und ihre Schenkel ab. Sie fühlten sich nicht anders an. Sie war nirgendwo wund, und als sie mit angehaltenem Atem die Bettdecke zurückschlug, sah sie kein Blut.
Vielleicht – bitte, lieber Gott – war nichts passiert.
Sie setzte sich auf die Bettkante, atmete langsam und tief und hielt beide Hände auf den Bauch gepresst, damit der Magen nicht wieder rebellierte. Und dann sah sie die Goldstücke, die ordentlich gestapelt auf dem Nachttisch neben der Öllampe lagen.
Emmeline schnappte nach Luft, sank zurück in die Kissen, riss die Decke über ihren Kopf und weinte, denn sicherlich war ihr die Unschuld geraubt worden.
Wie konnte sie ihre Dummheit Becky erklären? Ihre Tante hatte sich alle Mühe gegeben sicherzustellen, dass das Leben ihrer Nichte anders verlief als ihr eigenes. Emmeline wäre sogar vor langer Zeit auf eine Klosterschule fortgeschickt worden, wenn sie nicht gebettelt hätte, in Kansas City bleiben zu dürfen. Becky, stets gutherzig, hatte schließlich widerwillig nachgegeben. Diese Entscheidung würde sie jetzt bereuen.
In diesem Moment wurde die Tür geöffnet, und Becky tauchte auf der Schwelle auf. Das Haar, zu tiefschwarzem Glanz gebürstet, fiel ihr offen über den Rücken, und sie trug einen lindgrünen seidenen Morgenrock. »Ich dachte, ich hätte gehört …«, begann sie, doch dann schnappte sie nach Luft, und ihr Blick glitt von Emmeline zu dem schimmernden Stapel Münzen. »Guter Gott, Emmeline«, fragte sie krächzend, »was hast du getan?«
Emmeline biss sich auf die Unterlippe. Sie war zu stolz und schämte sich zu sehr, um vor ihrer Tante zu weinen, und sie hatte keine Erklärung oder gar eine Entschuldigung parat. Sie saß nur dort, wünschte, sie wäre tot, und starrte auf das entsetzte Gesicht ihrer Tante.
»Wer war es?«, flüsterte Becky. Ihr Gesicht war weiß geworden, und sie zitterte. »Ich werde den Bastard persönlich erschießen …«
Emmeline schüttelte nur den Kopf. Nachdem sie zu Boden geblickt hatte, fiel es ihr zu schwer, den Kopf wieder zu heben.
Becky zögerte einen Moment, dann stürmte sie in das Zimmer und gab Emmeline eine Ohrfeige. »Du dummes, undankbares kleines Ding!«, schrie sie und erstickte fast an ihrem Zorn.
Emmeline hielt eine Hand an ihre Wange. Nur Trotz hielt sie aufrecht; ohne ihn wäre sie zusammengebrochen wie ein Gebäude, das aus seinem Fundament gerissen war. »Du hast mich in einem Hurenhaus aufgezogen«, entgegnete sie. »Hast du wirklich gedacht, ich würde jemals eine Dame werden?«
Becky holte aus, als wollte sie Emmeline erneut schlagen, hielt dann jedoch mit der Hand in der Luft inne. »Geh mir aus den Augen«, flüsterte sie. »Ich kann deinen Anblick nicht mehr ertragen.«
2. Kapitel
Emmeline spähte aus tränenfeuchten, geschwollenen Augen auf die Anzeige auf der dritten Seite des Kansas City Star. Sie war die ganze Nacht wach gewesen, hatte abwechselnd geweint und gezürnt, und man konnte sagen, dass sie an diesem sonnigen Morgen alles andere als gut gelaunt war.
BRÄUTE GESUCHT, lautete die fett gedruckte Überschrift. Dann folgte der Anzeigentext mit vielen Ausrufezeichen.
Ladys! Warten Sie nicht auf einen Antrag, denn er wird vielleicht niemals kommen! Beginnen Sie ein neues und aufregendes Leben im amerikanischen Westen! Keine Gebühr für qualifizierte Bewerberinnen, alle Ausgaben sind bezahlt! Unsere Agentur vertritt nur Männer, die gut situiert sind und moralische Substanz haben! Ferntrauung durch einen Bevollmächtigten vor der Abreise! Besuchen Sie das Heiratsinstitut Happy Home, Freemont Street 67, Kansas City.
Emmeline schniefte, und ihre Fantasie regte sich. In ihrem Kopf summte es wie in einem Bienenstock voller aufgeregter Bienen. Fünf Minuten später drückte sie ein kaltes, feuchtes Tuch auf ihr Gesicht, zog ihr schickstes Kleid an – es war taubengrau mit schwarzen Paspeln am Kragen, an den Manschetten und am Saum –, setzte ihren besten Hut auf und verließ das Haus. Sie ging um die Ecke, stieg in einen Straßenbahnwagen, bezahlte einen Cent für den Fahrschein und setzte sich resolut.
Sie hatte diesen schicksalhaften Morgen in stolzer Schande begonnen. Als sie in die Pension zurückkehrte, nachdem sie zwei Stunden im Heiratsinstitut Happy Home verbracht hatte, fuhr sie in einer zweirädrigen Kutsche und hatte Gutscheine für Eisenbahn- und Postkutschenfahrscheine in ihrer Handtasche, zusammen mit einer Heiratsurkunde, unterzeichnet von einem Richter und im Gericht ordentlich registriert.
Vor den Augen Gottes und der Menschen war sie nun Mrs. Rafe McKettrick.
Sie stand mit gestrafften Schultern auf der Schwelle von Beckys Büro und verkündete, dass sie jetzt eine verheiratete Frau war und die Stadt verließ, um im Arizona Territorium ein neues Leben zu beginnen.
Becky wurde bleich. »Guter Gott!«, stieß sie hervor. Sie wollte von ihrem Schreibtischstuhl aufstehen, schaffte es jedoch nicht. »Das kann nicht dein Ernst sein!«
Emmeline hob ihr Kinn. »Meine Koffer sind gepackt und warten auf der Veranda. Ich muss den Zug bekommen«, erklärte sie.
»Das ist völliger Blödsinn«, begehrte Becky auf. »Du kannst dich nicht mit irgendeinem Fremden verheiraten lassen und in die Wildnis reisen!«
»Ich kann«, beharrte Emmeline steif und hielt ihr die Heiratsurkunde hin. »Es ist ganz legal.«
»Ich lasse das annullieren!« Becky war jetzt auf den Füßen und tastete sich um die Kante des Schreibtischs herum zu ihrer Nichte. »Emmeline, ich weiß, dass ich ärgerlich war – ich habe dich geohrfeigt und Dinge gesagt …«
Emmeline schüttelte langsam den Kopf. »Nichts davon spielt eine Rolle«, erwiderte sie. Sie hatte ein sonderbares, traumhaftes Gefühl, als wäre sie in einen unsichtbaren Fluss gefallen und von der Strömung fortgetrieben worden. Es gab kein Zurück. »Ich kann nicht mehr hier bleiben. Nicht, nachdem …« Sie schluckte hart. »Ich kann einfach nicht bleiben, das ist alles.«
Becky fasste sie verzweifelt, fast schmerzhaft an den Schultern. »Sei nicht dumm, Emmeline! Der Westen ist grausam und unzivilisiert, und du kannst nicht wissen, wie dieser Mann ist. Angenommen, er misshandelt dich?«
»Das wird er nicht«, widersprach Emmeline. Sie war sich nicht so sicher, wie es klang, doch sie glaubte, Becky täuschen zu können. »Und wenn doch, werde ich ihn verlassen.«
»Und was wirst du dann anfangen? Wie wirst du für deinen Lebensunterhalt sorgen, wenn dieser ›Ehemann‹ sich als etwas Geringeres als ein Prinz erweist?« Tränen schimmerten in Beckys Augen.
»Ich kann in einer Schule unterrichten«, erwiderte Emmeline. »Oder vielleicht in einem Saloon tanzen.«
Beckys Miene nahm einen härteren Zug an und spiegelte Kummer wider. »Das war nicht lustig«, meinte sie.
»So war es auch nicht gemeint«, antworte Emmeline. Dann küsste sie Becky auf die Wange, wenn auch steif. »Lebe wohl«, flüsterte sie. »Und danke – für alles.«
»Emmeline!«, rief Becky ihr nach.
Emmeline ging jedoch weiter.
»Glaube nicht, du kannst jemals hierher zurückkommen«, fügte Becky hinzu. »Wenn du gehst, dann sollst du für immer fortbleiben!«
Tränen traten in Emmelines Augen, doch sie erwiderte nichts und schaute nicht zurück.
Der Droschkenfahrer lud bereits ihre Koffer ein, als sie die Veranda erreichte. Sie blieb dort einen Augenblick stehen, um ihre Fassung wiederzugewinnen, und beobachtete, wie die Schatten des Blätterwerks, durch das Sonnenstrahlen fielen, über den Rasen und den Bürgersteig tanzten.
»Ich werde schreiben«, murmelte Emmeline, ohne sich umzuwenden, denn sie wusste, dass sie den Mut verlieren und bleiben würde, wenn sie jetzt ihrer Tante gegenüberstehen würde. Wenn das geschah, konnte sie ebenso gut in ihr Geschäft eintreten.
Becky erwiderte nichts.
Emmeline stieg die Verandatreppe hinunter, ging über den Weg und durch die Pforte. Der Fahrer half ihr in die Kutsche, wo sie auf der gepolsterten Sitzbank ihre Röcke ordnete und starr geradeaus blickte.
Es blies ein rauer Wind, als Emmeline Harding McKettrick endlich in Indian Rock, Arizona Territorium, aus der Postkutsche stieg, eine Reisetasche in einer Hand und all ihre tapferen, dummen Träume in der anderen. Sie zog sich den Umhang fester um die Schultern und hielt Ausschau nach einem Gesicht inmitten der rau aussehenden Fremden, das sie willkommen heißen würde, doch bald wurde offenkundig, dass niemand gekommen war, um sie abzuholen.
Sie kämpfte gegen die Tränen an, die sie in den über zwei Wochen zermürbender Reise hatte zurückhalten können, straffte die Schultern und blickte zu dem grob geschnitzten Schild über der Tür der Postkutschenstation hinauf. Vielleicht war sie an der falschen Station ausgestiegen.
Leider war das nicht der Fall.
»Miss?« Ein junger, blonder Mann kam über die schlammige Straße. Seine blauen Augen leuchteten freundlich und mit einer Art gutmütigem Übermut, und sie spürte, dass dies in seiner Natur lag wie sein Herzschlag und seine Atmung.
Er war schlank, behände und strahlte Selbstvertrauen aus, was Emmeline sehr beruhigend fand. »Werden Sie von niemandem abgeholt?«
All die Erschöpfung, all die Sorgen, das Rütteln und Schütteln über scheinbar endlose raue Meilen holten sie fast ein, als er diese einfache Frage stellte, trotz ihres eisernen Bemühens, nicht den Mut zu verlieren. Sie schwankte ein wenig und blinzelte heftig. »Mein … mein Mann«, antwortete sie. »Die Agentur sollte ein Telegramm schicken …«
Als der Cowboy sah, dass sie schwankte, stützte er sie schnell am Ellenbogen. »Na, na. Setzen Sie sich auf die Kante dieses Wassertrogs. Ruhen Sie sich ein bisschen aus.«
Bevor Emmeline einwenden konnte, dass sie lange genug in den Zügen, Postkutschen und sogar Frachtwagen gesessen hatte, mit denen sie gefahren war, um diesen Außenposten in der Wildnis zu erreichen, und jetzt lieber stehen wollte, ertönte ausgelassenes Johlen aus dem Saloon neben der Postkutschenstation. Das staubige Gespann vor der Postkutsche wieherte und tänzelte nervös im Geschirr, und der Fahrer, beschäftigt mit dem Ausladen von Emmelines Koffern, tadelte die armen Tiere mit einem lästerlichen Fluch.
In diesem Augenblick flog die Schwingtür des Saloons auf und ein Mann segelte heraus. Er sauste rücklings durch die Luft und landete in einer Rolle im Schmutz. Einen Moment blieb er lang hingestreckt auf dem Rücken liegen, anstatt sich aufzurappeln. Er schüttelte benommen den Kopf. Dann fluchte er und stemmte sich auf die Ellenbogen.
Emmelines Augen weiteten sich, als eine schreckliche Ahnung in ihr aufstieg. »Wer ist das?«, wollte sie wissen.
»Das«, sagte der Cowboy, »ist mein Bruder Rafe McKettrick.«
Emmelines Knie gaben nach; fast wäre sie in den Wassertrog gefallen. »Nein«, flüsterte sie.
»Doch«, erklärte der Cowboy bedauernd.
Sie stand auf, trat einen Schritt auf den Mann zu, der auf der Straße lag, dann noch einen, bis sie vor ihm stand.
»Mr. McKettrick?«, fragte sie verzweifelt.
Er blinzelte gegen den Sonnenschein des Nachmittags an, schüttelte erneut den Kopf, rappelte sich dann auf und katapultierte sich durch die Schwingtür zurück in den Saloon, wo er mit Gejohle empfangen wurde.
»O nein!«, stieß Emmeline hervor.
Der blonde Mann, ihr selbst ernannter Ritter in glänzender Rüstung, kam an ihre Seite und führte sie von der Straße. »Leider doch«, meinte er. »Haben Sie etwas mit meinem Bruder zu tun?«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: