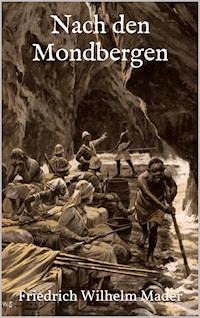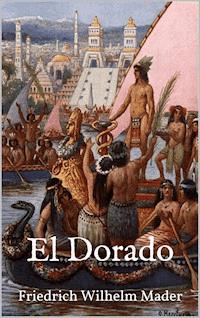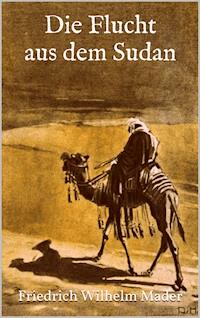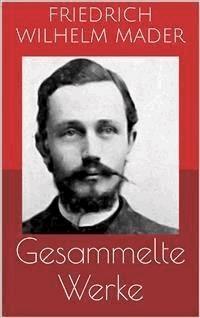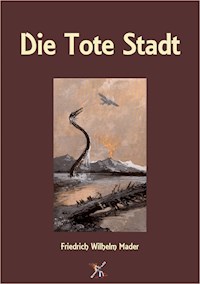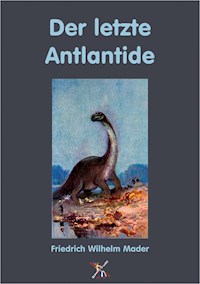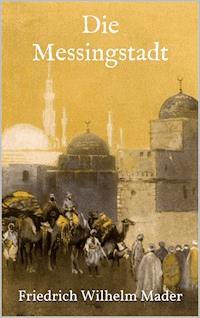
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ernst Friedrich Wilhelm Mader (* 1. September 1866 in Nizza; † 30. März 1945 in Bönnigheim) war ein deutscher evangelischer Pfarrer und Schriftsteller von Zukunfts- und Abenteuerromanen, Theaterstücken, Märchen, Gedichten und Liedern. Er wird der "schwäbische Karl May" genannt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1. Die Verschwörer
2. Hussein Pascha und sein Stab
3. Die Hauptperson
4. Die Harmonika und die Zitrone
5. In der Oase Dachel
6. Nach Westen
7. Der Wüstenmarsch
8. Der Wüstensturm
9. Im Rachen des Todes
10. Die Geisterburg
11. Weihnacht in der Wüste
12. Abu Haschischs Abenteuer
13. Die Zitrone und die Harmonika auf der Jagd
14. Des Professors Wunderkuren
15. Haschisch
16. Wieder im Sandmeer
17. Ein Überfall
18. In der Gefangenschaft der Beduinen
19. Zitronenlist
20. Auf Schleichwegen
21. Die Befreiung der Halunken
22. Münchhausens wunderbare Erlebnisse
23. Abu Haschischs Verschwinden
24. Franzls Entdeckung
25. Die Heldentaten der Harmonika
26. Straußenjagd
27. Die Geschichte der Messingnen Stadt
28. Die Schakale
29. Fortsetzung der Geschichte der Messingnen Stadt
30. Franzls Jagdabenteuer
31. Die Elefanten
32. Das Rätsel der Sahara
33. Die Messingstadt
34. Der verschwundene Pascha
35. Wieder in Feindesgewalt
36. Sieg!
Quellen und Nachweise.
Verzeichnis der Hauptquellen
Einzelnachweise
Impressum
1. Die Verschwörer
Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne tauchten die Kuppeln Kairos und die hochragenden Minarette seiner Moscheen in blutiges Rot, als drei Männer in hellen Bernussen1 und mit turbanumwundenen Häuptern durch das Bab-el-Attabeg oder Tor des Atta-Bei die Stadt verließen und sich den Kalifengräbern zuwandten.
Der eine dieser Männer war bartlos; er war ein Schergi, das heißt ein Schirg-Araber aus dem Lande östlich des Nils, und ein geborener Ägypter. Er nannte sich Hamed, und mit seinem vollen Titel: Sidi Hamed Ben Abd er Rahman esch Scherif, was nichts weiter bedeutet, als: Herr Hamed, Sohn des Abd er Rahman, der Scherif. Der Titel »Scherif«, der sein besonderer Stolz war, kommt den Nachkommen des Propheten Mohammed zu. Diese finden sich sehr zahlreich unter den Mohammedanern, da auch die weibliche Abstammung giltig ist, und überdies der angemaßte Stammbaum nicht nachgeprüft wird, was auch seine Schwierigkeiten hätte.
Hameds einer Gefährte trug einen langen rötlichen Bart, auf den er nicht wenig eitel zu sein schien; denn häufig strich seine Hand, wie liebkosend, an dieser Zierde hinab. Die rote Haarfarbe ist bei den Kindern des Ostens eine Seltenheit und gilt als der Ausbund aller Schönheit. Aus diesem Grunde begnügt sich manche orientalische Schöne nicht damit, bloß ihre Backen, Nägel, Hände und Füße mit dem Orangerot der Henna zu färben, sondern sie benutzt diese kostbare Pflanze, die der Botaniker Lawsonia inermis benennt, auch heimlich als Haarfärbemittel. Ja, so verliebt ist sie in die rote Farbe, daß sie wohl gar das Fell ihrer Lieblingskatze damit verschönert.
Auch unser Rotbart war vom Verdachte nicht frei, seinem Bart mittels Henna den erwünschten Glanz zu verleihen; denn einmal stand dieser merkwürdige Gesichtsschmuck in gar zu auffälligem Gegensatz zu seinem kohlschwarzen Haupthaar, und dann besaß der Bart die seltsame Eigenschaft, mit der Zeit immer dunkler zu werden, bis er dann eines Morgens wieder in frischestem Rot erstrahlte.
Hadschi Mohamed et Talib, nannte sich der würdige Bartbesitzer. Der Titel »Hadschi« verriet, daß er die Wallfahrt, die sogenannte »Hadsch«, nach Mekka ausgeführt hatte; denn jeder Mekkapilger hat Anspruch auf diesen Ehrennamen. Den Beinamen »et Talib«, das heißt »der Fuchs« hatte er sich selber beigelegt, mit Beziehung auf seinen fuchsroten Bart. Überhaupt lieben es die Orientalen, sich möglichst lange Namen beizulegen, zur Erhöhung ihrer Bedeutung in den Augen ihrer Mitmenschen. Sie gleichen hierin den Portugiesen und Spaniern. Fällt ihnen nichts besseres ein, so fügen sie ihrem eigenen Namen außer demjenigen ihres Vaters, wie es jeder tut, auch noch den des Großvaters und wohl gar Urgroßvaters hinzu.
Mohamed et Talib war ein Gharb-Araber, das heißt ein Araber des Westens, und stammte aus Algerien.
Der dritte im Bunde unterschied sich durch seine tiefdunkle, beinahe schwarze Gesichtsfarbe von seinen Begleitern. Er trug einen lang herabhängenden Schnurrbart bei sonst glattem Antlitz. Diese Glätte bezieht sich jedoch lediglich auf die Unbehaartheit: im übrigen war die lederne Haut derart gerunzelt und verschrumpft, daß der Mann ungleich älter aussah, als er wohl eigentlich war, und auffallend einer gedörrten Zwetschge glich, die man im Schwabenlande »Hutzel« nennt.
Dieser hagere hochgewachsene Greis war ein indischer Fakir, bekannte sich jedoch auch, vielleicht nur hierzulande und aus Zweckmäßigkeitsgründen, zu der Religion des Propheten. Er machte einen abstoßenden Eindruck, und geradezu unheimlich leuchtete das glänzende Schwarz seiner übergroßen Pupillen aus den blendend weißen Augäpfeln unter den struppigen Brauen hervor.
Sein Name war nicht so weitläufig, denn er lautete kurz: Abd ul Hagg. Das heißt zu Deutsch: Diener der Wahrheit. Vermutlich hätte er sich mit mehr Recht »Diener der Lüge« nennen dürfen, wenigstens machte er einen höchst verschlagenen und unehrlichen Eindruck.
Dieser Fakir war auf einer weiten, gefahrvollen Reise begriffen, um die Schätze der geheimnisvollen Messingstadt zu heben, von denen er im fernen Indien aus alten Schriften und den Berichten gelehrter Brahminen Kunde erhalten hatte.
Da ihm von Ägypten aus ein monatelanger Ritt durch die Wüste bevorstand, mußte er sich nach geeigneter Begleitung umsehen. Zu seiner unliebsamen Überraschung hatte er in Erfahrung gebracht, daß ein deutscher Kapitän in ägyptischen Diensten, hierzulande Hussein Pascha genannt, soeben im Begriffe war, eine Expedition in die Sahara zu unternehmen, deren Endziel ebenfalls die rätselhafte Messingstadt war.
Wie der Deutsche zur Kenntnis des Vorhandenseins dieser Fundgrube unermeßlicher Reichtümer gekommen war, die bisher für ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht galt, hinter dem nichts Tatsächliches zu finden sei, konnte der Inder nicht wissen; doch hatte er beschlossen, sich eben diesem Unternehmen anzuschließen, einmal, weil er so am bequemsten an sein Ziel gelangen konnte, sodann, weil er mit allen Mitteln verhindern wollte, daß der Pascha in den Besitz der erträumten Schätze gelange.
Die Wanderer verfolgten ihren Weg zwischen den Kalifengräbern hindurch bis zum Mausoleum oder Grabmal des Sultans Barkuk. Vor diesem hochragenden, kuppelgekrönten, und trotz seines Zerfalles immer noch prächtigen Bau hielten sie an und ließen sich am Fuße der Felsen nieder, die den Sockel dieses Wunders der Baukunst bilden.
Weithin schweift hier der Blick durch die Wüste nach Süden, bis zu den Pyramiden von Sakkara, wo früher die Ramseskolosse sich erhoben, nun aber langgestreckt auf dem Erdboden ruhen.
Die Moslem waren jedoch nicht gekommen, die schöne Aussicht zu bewundern: sie hatten nur einen Ort aufsuchen wollen, wo sie unbelauscht wichtige Angelegenheiten besprechen konnten.
Hier lag zu dieser Abendstunde alles einsam, wie ausgestorben, war es doch auch eine Stätte der Toten vergangener Jahrhunderte.
»Du mußt es ausführen, Abd ul Hagg!« begann der finsterblickende Hamed: »Wir haben dem Pascha einen heiligen Eid schwören müssen, sein Leben nicht anzutasten; denn er ist vorsichtig, dieser Rumih, und wenn wir auch sein Vertrauen besitzen, so hat er sich doch von allen, die ihn auf der Wüstenreise begleiten, schwören lassen, daß sie ihm und seinen weißen Begleitern keinen Schaden an Leib und Leben zufügen werden. Wer wollte es wagen, den Eid zu brechen?«
»Habe ich nicht ebenso schwören müssen, wie ihr, keine Hand an ihn zu legen?« erwiderte der Inder mit einem bösen Lächeln.
»Gewiß! Allein du sagtest doch, du habest Mittel, ihn zu verderben, ohne den Schwur zu verletzen,« wandte nun Mohamed et Talib ein.
»Das habe ich wohl,« bestätigte Abd ul Hagg; »aber warum soll er sterben?«
»Erstens ist er ein Kafir, ja noch schlimmer, er ist ein Rumih,« grollte Hamed.
Mit Kafir, Kafer, oder Giaur bezeichnet der Muselman die Ungläubigen, die der Prophet auszurotten geboten hat. Rumih bedeutet eigentlich »Römer« und ist daher ursprünglich der Ausdruck für römische, das heißt katholische Christen. Der Mohammedaner bezeichnet jedoch mit diesem Worte heutzutage alle Europäer, insbesondere alle Christen, auch die evangelischen: Europäer und Christ gilt ihm für ein und dasselbe, und für die Christen empfindet er noch mehr Haß und Verachtung als für die anderen Ungläubigen, die Juden und die Heiden.
»Sollen wir jeden ums Leben bringen, der ein Rumih ist?« fragte der Indier spöttisch.
»Wallahi! Bei Gott!« rief Mohamed: »Ja alle, – wenn wir könnten.«
»Da wir es nun aber nicht können, warum gerade diesen Nemza, diesen Deutschen?«
»Weil wir ihn hassen auf den Tod!« riefen nun beide Araber gleichzeitig.
»Ist er nicht euer Wohltäter? Hat er euch nicht lauter Gutes erwiesen und euch zu seinen vertrauten Begleitern erhoben?«
»Siehe!« ließ sich hierauf Hamed vernehmen: »Ist nicht der Kuhmist etwas Gemeines? Und doch wendet uns Allah durch ihn Wohltaten zu, da er ihn trocknen läßt, so daß wir daraus Feuerung gewinnen, uns zu wärmen und unser Mahl darüber zu kochen. So läßt uns der Allmächtige durch die Christen, die gemeiner sind als der Kuhmist, zuweilen Wohltaten zukommen. Wie unerforschlich sind seine Ratschläge!«
»Wohlgesprochen, Scherif!« sagte der Fakir, beifällig lächelnd: »auch ich hasse diese gemeinen Christenhunde, die mein Volk zugrunde richten. Allein ihr müßt doch ganz besondere Gründe haben, Hussein Pascha vor allen anderen aus der Welt schaffen zu wollen.«
»Die haben wir auch!« rief Mohamed et Talib zähneknirschend: »Ja, ganz besondere und äußerst triftige Gründe besitzen wir, ihn tödlich zu hassen. Siehe, dieser Nemza, dieser Deutsche, ist von Hause aus ein gewöhnlicher Schiffskapitän. Weiß Allah, wie er sich bei dem Herrn einzuschmeicheln wußte, bis er ihm geradezu unentbehrlich wurde! Der Khedive hat ihn beauftragt, eine Dampferlinie auf dem Nil einzurichten; das hat er getan und das ist gut. Nun hat ihn der Herrscher zum Pascha ernannt, ihn, einen Christenhund, und das ist nicht gut! Das Schlimme aber ist, er besitzt das Ohr des Khediven und gibt ihm allerlei verderbliche Ratschläge, die der Vizekönig befolgt. Gegen das Verbot des Propheten läßt Seine Hoheit sogar Standbilder und Denkmäler herstellen und auf öffentlichen Plätzen ausrichten, zum großen Ärgernis aller Gläubigen.«
»Daran tut Taufik sehr unrecht, und ich sehe, der Einfluß des Rumih auf den Herrn ist in der Tat schädlich. Ihr müßt mir jedoch gestatten, einige Zweifel daran zu hegen, daß es nur der Eifer um den wahren Glauben ist, der euch zu seinen Todfeinden macht.«
»O, Abd ul!« seufzte Hamed. »Hussein Pascha richtet das Land und uns zugrunde! Merke auf: wenn der Khedive uns bisher einen Auftrag erteilte und in seiner Großmut eine reiche Summe zu dessen Ausführung aushändigte, wie wir sie ihm als notwendig angaben, so fragte er nie, wo das viele Geld blieb. Aber dieser niederträchtige Hund von einem Christen redet ihm ein, er werde betrogen, da wir doch nur unser Bakschisch, unser wohlverdientes Trinkgeld, zurückbehalten. Und nun ist es schon mehrfach vorgekommen, daß Seine Hoheit genaue Rechnungsablage forderte, – wer hat vordem je so etwas erhört! – und dadurch ist mancher in Ungnade und schwere Strafe verfallen. Jetzt müssen wir in beständiger Angst leben und sehen uns in unserm Verdienst gehindert: und daran ist nur dieser verwünschte, gottlose Pascha schuld. Was mischt er sich in die inneren Angelegenheiten unseres Landes, statt daß er sich begnügt hätte, seinen Auftrag auszuführen und die Dampfschiffahrt einzurichten? Möge Allah ihn verderben, und kein Erbarmen haben mit seiner Seele!«
»So!« sagte der Indier befriedigt: »Nun sehe ich, daß ihr eure guten Gründe habt, den deutschen Pascha ins Jenseits zu wünschen, und ihm womöglich dazu zu verhelfen: ihr seht euch gehindert in euren Betrügereien.«
»Bakschisch!« verbesserte Mohamed: »Nur im Erwerb unsres rechtmäßigen Bakschischs.«
»Wie du meinst: kein Spitzbube wird seine Taten unehrlich nennen. Aber ihr werdet einsehen, daß mich die Sorge um euer redliches oder unredliches Trinkgeld nicht dazu bestimmen kann, den Pascha zu ermorden.«
»Aber der Eifer für unsere Religion!« warf Hamed ein. »Und dann der reiche Lohn, den wir und viele andere dir spenden werden, wenn wir von dem lästigen Aufpasser befreit sind, und wieder in die Lage kommen, die Mittel zu erwerben, uns unsern Freunden erkenntlich zu zeigen.«
»Das alles würde mir nicht genügen: aber seid zufrieden, ich selber habe meinen besonderen Grund, dem Pascha feind zu sein. Er will die fernen Oasen erforschen, freilich im Interesse des Khediven und des Landes. Aber seine Reise hat, wie ich von ihm selber erfuhr, noch ein anderes Ziel. Mitten in wasserlosen Wüsteneien, fern von allen Karawanenstraßen, liegt eine prächtige Stadt, aus Marmor und Kupfer erbaut. Schon die Märchen von Tausendundeiner Nacht erzählen von ihr, und damals schon war sie verlassen und ausgestorben. Seither hat keines Menschen Fuß sie mehr betreten. Unermeßliche Schätze von Gold, Silber und Edelsteinen bergen noch heute ihre Paläste. Ich habe sichere Kunde davon aus uralten Büchern. Ja, eine genaue Karte sogar habe ich entdeckt, die ihr letzter Besucher, Musa, vor Jahrhunderten aufnahm, und führe sie bei mir. Auf dieser Karte sind auch unbekannte Oasen verzeichnet, die von keinem Menschen bewohnt sind, sowie geheime Brunnen, die es dem Besitzer des unschätzbaren Pergaments ermöglichen, die verödete Stadt zu erreichen, ohne Gefahr zu laufen, unterwegs zu verdursten.
»Ich zog von Indien aus, um diese Messingstadt aufzusuchen, und hier in Kairo wollte ich noch einige zuverlässige Begleiter anwerben, mit denen ich mich in die fabelhaften Reichtümer teilen will, die ich dort zu holen gedenke. Euch habe ich dazu ausersehen.«
»Als ich erfuhr, daß der Pascha dem gleichen Ziele zustrebt, beschloß ich, mich seiner Karawane anzuschließen; denn der Gefahren in der Wüste sind so viele, wenn ich nur an räuberische Beduinenüberfälle denke, daß es nicht ratsam ist, ihnen ohne den Schutz einer zahlreichen Begleitung entgegenzugehen. Wäre der Pascha so vernünftig, sich mit uns in die aufzufindenden Schätze zu teilen, so könnten wir uns mit ihm verbünden ...«
Die beiden Araber hatten den Bericht des Fakirs mit zahlreichen Ausrufen des Erstaunens und gieriger Freude begleitet, nun rief Hamed entrüstet aus: »Verbünden, mit dem verhaßten Rumih, und ihm womöglich den Löwenanteil an den Reichtümern überlassen? Niemals, bei Allah und dem Propheten!«
»Nach den zuverlässigen Berichten, die ich besitze,« fuhr Abd ul Hagg unbeirrt fort, »ist die Fülle an edlen Metallen und Juwelen in der Riesenstadt so groß, daß sie mehr als ausreichend wären, jedes einzelne Mitglied der großen Karawane Hussein Paschas zum reichen Manne zu machen, ja, wir müßten wohl doppelt so viel Kamele mitführen, um nur die wertvollsten Kostbarkeiten alle mitnehmen zu können. Ich war daher nicht ohne weiteres abgeneigt, mit dem Deutschen gemeinsame Sache zu machen, und habe mit aller Vorsicht seine Gesinnung erforscht. Ich fand jedoch, daß er von einer solch dummen Ehrlichkeit und plumpen Gewissenhaftigkeit ist, daß er alles für den Khediven in Beschlag nehmen und gar nichts für sich und seine Begleiter beiseite schaffen würde: man findet ja oft bei den Christen und namentlich bei den Deutschen eine solch einfältige Redlichkeit. Nun muß ich alles daran setzen, dies zu verhindern, und er darf auch keine Nachricht von der rätselhaften Stadt und ihren märchenhaften Reichtümern dem Herrscher zurückbringen. Ich habe daher beschlossen, ihn und womöglich die ganze Karawane in der Wüste ins Verderben zu führen, damit wir drei allein die Herren der Schätze seien und uns das Wertvollste zueignen könnten, so viel wir immer auf den Kamelen fortzubringen vermögen. Darum seid ohne Sorge und vertrauet mir: Hussein Pascha wird von dieser Reise nicht wieder zurückkehren! Dafür werde ich sorgen. Ihr aber müßt mir schwören, daß ihr mir in allem unbedingten Gehorsam leisten werdet, was ich für nötig befinde, im Interesse unseres Planes anzuordnen.«
Willig leisteten die beiden Araber den geforderten Schwur, und so war Kapitän Münchhausens Tod in heimlicher Verschwörung zu einer beschlossenen Sache geworden.
Die Gier nach dem alleinigen Besitz der erhofften fabelhaften Schätze verblendete Hamed und Mohamed genau so, wie den Fakir, so daß sie so wenig wie er bedachten, welche kaum überwindliche Schwierigkeiten sich ihnen entgegensetzen müßten, wenn sie nach Vernichtung der ganzen Reisegesellschaft den beschwerlichen und gefahrvollen Rückweg zu dritt mit einer Menge beutebeladener Kamele unternehmen wollten. Bis dahin hatte es aber noch gute Zeit!
Gewöhnlich wird dieses orientalische Kleidungsstück fälschlich »Burnuß« geschrieben.
2. Hussein Pascha und sein Stab
Ein kleines, zierliches Landhaus, umgeben von einem üppigen Garten, diente Kapitän Hugo von Münchhausen als Paschawohnung.
Der Park, der sich bis an die Ufer des Nils erstreckte, wies eine Mannigfaltigkeit der Pflanzen und Gewächse auf, wie sie nur selten beieinander zu finden sind. Vor allem wuchsen darin die herrlichen Früchte des Südens: sind doch im Orient gerade die Obstbäume zugleich die schönsten Zierbäume.
Die schlanken Dattelpalmen ließen ihre üppigen Trauben zwischen den gefiederten Zweigen niederhängen; Orangen, Limonen und Zitronen, wie eigentlich die wilden Orangen benannt werden, während die Limone das ist, was der Deutsche irrtümlich als Zitrone bezeichnet, leuchteten rot und gelb aus dem glänzenden Grün der kugeligen Kronen, und gleichzeitig ließen ihre lieblichen Blüten einen durchdringenden Wohlgeruch ausströmen. Häufig konnte man an ein und demselben Zweige Knospen, Blüten, reife und unreife Früchte zugleich beobachten. Aprikosen, Pfirsiche, Mandeln, Granatäpfel, Maulbeeren, Pistazien, die goldgelbe, saftige und zuckersüße japanische Mispel, Nessel genannt, Feigen und Ölbäume, die duftenden Karuben oder Johannisbrotbäume und noch vieles andere war hier zu finden; aber auch an nordischem Obst, Äpfeln, Birnen, Pflaumen, Kirschen und dergleichen mangelte es nicht.
Dazwischen grünten die Gesträuche und Büsche der Quitte, des Wacholders, des Rizinus. An den Mauern standen oder rankten empor die Opuntie oder Kaktusfeige, von den Arabern auch »Christenfeige« benannt, die prächtige Aloe, der süßriechende Oleander, traubenschwere Reben und die entzückenden Pfefferbäume mit ihren starren hellroten Fruchttrauben und den würzigen, feingefiederten Blättern, die trauerweidenartig in lachendem Hellgrün herniederhängen: das alles strömte seine berauschenden Düfte aus und bezauberte den schönheitstrunkenen Blick.
Natürlich fehlte es auch nicht an Blumen aller Art, namentlich an Rosen, die überall emporrankten und ihren reichen Flor in allen Farbenschattierungen von Weiß, Gelb und Rot prangen ließen. In der Nähe des Landhauses spendeten süße Kastanien und Nußbäume kühlenden Schatten, während reizende Fächerpalmen ihre gefransten Kronen in der Luft wiegten. Kurzum, es war ein kleines Paradies!
In der offenen, luftigen Säulenhalle, die einen freien Ausblick in den Garten gewährte und seinen frischen Wohlgerüchen ungehinderten Zutritt ließ, saß Kapitän Hugo von Münchhausen oder Hussein Pascha nach Türkenart mit untergeschlagenen Beinen auf einer kostbaren Matte. Dem Schlauche seiner edelsteinbesetzten Nargileh oder Wasserpfeife entlockte er bläuliche Rauchwolken.
Der Pascha war ein noch jugendlicher Mann, doch von stattlicher Leibesfülle. Er zählte neununddreißig Jahre, und das rundliche Gesicht in seiner frischen Röte strahlte Wohlwollen aus, verbunden mit einem heiteren, schalkhaften Gemüt. Seine Kleidung war durchaus arabisch: ein roter Fes bedeckte das Haupt, und den Leib umhüllte ein weiter Bernuß.
Ihm gegenüber hockte in gleicher Stellung, etwas unbeholfen, ein blondbärtiger Mann von etwa fünfunddreißig Jahren, Professor Gerhard Rommel, ein deutscher Archäologe, das heißt Altertumsforscher. Auch er rauchte den duftigen blonden Türkentabak; doch zog er der Wasserpfeife den Tschibuk vor, das lange Pfeifenrohr mit dem Bernsteinmundstück und dem kelchartig sich öffnenden roten Tonkopf. Kunstvolle Ringe blies er bedächtig in die Luft; dann setzte er die Pfeife ab und wandte sich an den Pascha mit den Worten: »Daß ich mit Leib und Seele bei Ihrem Unternehmen bin, wissen Sie, Kapitän. Doch ein Bedenken treibt mich immer noch um: wir sind zu wenig Europäer! Nur drei Mann, Sie und ich und mein Diener Franz Billinger, allerdings eine treue Seele und ein anstelliger Mensch. Aber ist es nicht bedenklich, eine so weite Reise ins Ungewisse und Unbekannte zu unternehmen, ganz umgeben von Mohammedanern, die uns Christen doch tödlich hassen? In der Wüste befinden wir uns völlig in ihrer Gewalt.«
»Beruhigen Sie sich!« sagte der Kapitän oder Pascha lachend. »Wir reisen im gefürchteten und geachteten Schutz des Khediven; sodann sind unsere Leute in mancher Beziehung auf uns angewiesen und haben ein Interesse an unserm Wohlergehen. Was aber noch mehr besagen will, ich habe fast lauter erprobte und zuverlässige Leute, vor allem die beiden Araber Hamed Ben Abd er Rahman und Mohamed et Talib, die mir sehr viel verdanken und die ich zu Scheichs unserer eingeborenen Diener ernannt habe.«
»Ich weiß nicht,« entgegnete der Professor kopfschüttelnd, »gerade diese beiden gefallen mir wenig, sie haben etwas Ungutes in ihrem Blick.«
»Na, Sie kennen die Araber noch ungenügend; die dunkeln Augen dieser Orientalen erscheinen uns anfangs wenig vertrauenerweckend, und doch kann hinter dem klaren, unschuldigen Blau eines europäischen Auges ebensogut List und Verrat lauern. Ich kenne meine Leute nun seit zwei Jahren; ich sage Ihnen, sie sind harmlos und mir durch und durch ergeben.«
»Mag sein! Aber ganz und gar nicht traue ich jenem indischen Fakir, der sich neuerdings zur Teilnahme an unserm Zuge gemeldet hat.«
»Ach was, Professor! Der kann uns nichts anhaben. Was sollte er auch für Gründe dazu besitzen? Er ist ein einzelner und ganz in unserer Gewalt. Übrigens ist mir seine Begleitung äußerst wertvoll. Sie wissen ja, wenn wir auch in erster Linie die Oasen des Westens neuentdecken und erforschen wollen, um ihre Einverleibung durch Ägypten vorzubereiten, so habe ich es mir doch in den Kopf gesetzt, womöglich die sagenhafte kupferne Stadt aufzufinden, die ›Messingstadt‹, wie sie in den Märchen aus ›Tausendundeiner Nacht‹ genannt wird.«
»Nehmen Sie mir's nicht übel, Pascha,« unterbrach ihn Rommel mit einem etwas spöttischen Lächeln, »aber an die Märchenstadt kann ich nicht glauben. Tausendundeine Nacht ist doch wahrhaftig keine ernste Quelle, auf die man ein wissenschaftliches Unternehmen gründen kann. Da können wir gerade so gut ausziehen, den Magnetberg und Sindbads Diamantental zu suchen.«
»Verzeihen Sie, mein Lieber,« entgegnete der Pascha ebenfalls etwas sarkastisch, »auch Märchen sind selten freie Erfindung der Phantasie und ganz aus der Luft gegriffen; sie können einem wirklich schätzbare Winke geben. Ich bin ein vielgereister Mann und kenne das Vorhandensein von wirklichen Magnetbergen, nicht bloß von einem, aus persönlicher Erfahrung, und daß es Diamantentäler in Südafrika gibt, die an Reichtum demjenigen kaum nachstehen, das in Tausendundeiner Nacht geschildert wird, dürste Ihnen selber bekannt sein. Nun habe ich über die Messingstadt auch unter den Eingeborenen manches gehört, das den Eindruck uralter und durchaus nicht ganz märchenhafter Überlieferung macht.
»Plötzlich taucht nun dieser Indier Abd ul Hagg auf, behauptet, ziemlich genaue Kenntnis über die Lage der merkwürdigen Stadt zu besitzen und eigens die Reise hierher gemacht zu haben, um dorthin zu gelangen. Folglich muß mir dieser Mann als Führer willkommen sein. Übrigens habe ich zu aller Vorsicht sämtliche Eingeborenen meiner Karawane und auch den Fakir einen furchtbaren Eid der Treue ablegen lassen, den keiner zu brechen wagen wird.«
So wenig der Professor überzeugt war, wußte er doch im Augenblick keine weiteren schlagenden Einwendungen zu machen; darum trat vorerst wieder Schweigen ein, und nur die Rauchwölkchen und Rauchringe trieben ihr Spiel in der Halle.
Da trat nach gebührendem Anklopfen, auf des Paschas Hereinruf ein schwarzer Diener ein und überbrachte seinem Herren eine goldgeränderte Besuchskarte mit einem zierlichen Krönlein über dem Namen.
»Baron Erich von Steinberg,« las der Kapitän. »Er möge eintreten!« fügte er, zu dem Neger gewendet, auf Arabisch hinzu.
3. Die Hauptperson
Der Eintretende war ein blutjunger Mensch von etwa zwanzig Jahren. Ein spärlicher, blonder Flaum umrahmte seine Lippen und sein Kinn, während aus den halbgeschlossenen Lidern ein paar wasserblaue, nicht besonders geistreiche Augen blickten. In das linke Auge hielt er ein Einglas geklemmt, dieses lächerliche Prunkstück des Gecken und Stutzers, das der gebildete Deutsche mit dem französischen Namen »Monocle« zu bezeichnen pflegt, weil er Französisch stets für gebildeter hält, als Deutsch.
Der Jüngling trat mit einer überlegenen Sicherheit auf, die beinahe als Anmaßung bezeichnet werden konnte, und ein nicht geringes Selbstbewußtsein sprach aus der Haltung des hochgetragenen, etwas nach hinten zurückgeworfenen Hauptes, das schon den Ansatz zu einer frühzeitigen Glatze zeigte.
Übrigens war diese Haltung des Kopfes schon durch den hohen Stutzerkragen bedingt, den der junge Baron trug.
Ein vornehmer Jagdanzug umschloß die hagere, hochaufgeschossene Gestalt, zu dem die durchaus nicht jägermäßigen feinen Lackstiefelchen an den Füßen einen sonderbaren Gegensatz bildeten. Edelsteinbesetzte Ringe blitzten an den wohlgepflegten Händen. Alles in allem erschien das feine Herrchen eher ein Salonlöwe und Kaffeehausheld zu sein, als ein kühner Nimrod. Münchhausen wußte nicht recht, was er aus ihm machen sollte, jedenfalls machte der erste Augenschein keinerlei günstigen Eindruck auf ihn.
»Was ist Ihr Begehr?« fragte er zunächst auf Arabisch, obwohl er wußte, daß er einen Deutschen vor sich hatte.
Der junge Mann erwiderte in einer Sprache, die Arabisch sein sollte, in Wirklichkeit aber ein schauderhaftes Gemisch von französischen und stark verunstalteten arabischen Brocken aufwies. Immerhin konnten sowohl der Kapitän, wie der Professor, etwa Folgendes daraus entnehmen:
»Ich habe gehört, daß Euer Durchlaucht eine Forschungsreise nach Westen zu unternehmen gedenken. Auch ich beabsichtige eine solche und mache Ihnen das Anerbieten, sich meiner Expedition anzuschließen, was Ihnen zweifellos angenehm sein dürfte.«
Der Pascha konnte sich bei diesem naiven Angebot eines Lächelns nicht enthalten. Doch gewann er rasch seine ernste Würde zurück, wie sie einem hohen königlichen Beamten geziemend war, und erwiderte:
»Reden wir vor allem einmal Deutsch, mein werter Herr Baron: ich vermute, es wird so besser gehen.«
»Wie?« rief der Geck erstaunt: »Sie sprechen Deutsch, Exzellenz?«
»Gewiß! Ich bin sogar ein Deutscher: Kapitän Hugo Münchhausen ist mein ehrlicher Christenname.« Geflissentlich ließ er sein adliges »von« weg, auf das er wenig Wert legte.
»Was? Ein simpler Kapitän?« rief der andere sichtlich enttäuscht. »Na! Das tut nichts. Sie dürfen sich mir trotzdem anschließen.«
Jetzt lachte Münchhausen hellauf, und auch der Professor stimmte in die Heiterkeit ein. – Dieser junge Fant zeigte sich ja äußerst gnädig!
»Ja, simpler Kapitän und Pascha seiner Hoheit des Khediven, wie Sie wissen,« lautete die Antwort.
»Na, so ein Pascha hat ja wohl nicht viel zu bedeuten,« meinte von Steinberg absprechend. »Ich bin Baron, geborener Baron.«
»Na, das tut nichts, junger Mann,« spöttelte nun seinerseits der Kapitän. »Wenn Sie Baron von Geburt sind, so können Sie ja nichts dafür, und wenn ich Pascha durch Verdienst wurde, so bin ich nicht so töricht, mir viel darauf einzubilden. Das ist ja alles Nebensache. Aber von einem Anschluß an Ihr Unternehmen kann natürlich bei mir keine Rede sein. Ich reise im Auftrag Seiner Hoheit des Khediven, der die Karawane selbst ausgerüstet hat. Sie haben also ebenfalls eine Expedition unternommen und sind wohl deren Leiter?«
»Selbstverständlich!« entgegnete der Baron hochmütig.
»Und wer sind Ihre Begleiter, wenn man fragen darf?«
»Begleiter? Bis jetzt habe ich mich noch nach keinen solchen umgesehen; deshalb eben machte ich Ihnen meinen Vorschlag.«
»Sie haben keine europäischen Begleiter? Ich muß sagen, Ihr Unternehmen ist kühn für einen Neuling in Afrika! Haben Sie wenigstens erprobte, zuverlässige Leute in Ihrer Karawane?«
»Karawane? Nein! Eine Karawane habe ich überhaupt nicht. Ich bin erst seit vierzehn Tagen in Kairo und habe mir alle Sehenswürdigkeiten angesehen, so viele im Reisehandbuch stehen.«
»Aha! jetzt verstehe ich,« rief Münchhausen lachend. »Sie haben sich offenbar verkehrt ausgedrückt, als Sie mich zum Anschluß an Ihre nicht vorhandene Expedition einluden. Sie wollten mich wohl um die Erlaubnis bitten, sich uns anschließen zu dürfen?«
»Bitten ...? Erlaubnis ...?« stotterte Erich von Steinberg. »Aber ich bitte Sie, ich bin Baron, und Sie sind ein Kapitän!«
»Was soll uns das? Ich habe die Erfahrung, und ich habe die Leitung einer großen Karawane. Wir brauchen Sie nicht, wohl aber könnten Sie uns brauchen, falls es Ihnen mit Ihren kühnen Forschungsplänen wirklich Ernst ist.«
Jetzt wurde der junge Mann doch etwas unsicher. Es dämmerte ihm, daß sein Titel bei solch einem Unternehmen keine Rolle spielte; darum schlug er einen anderen Weg ein und fragte: »Haben Sie einen Botaniker?«
»Nein! Nur einen Archäologen: hier, Herrn Professor Gerhard Rommel.«
»Angenehm!« schnarrte der junge Mann mit seiner näselnden Stimme und verbeugte sich gegen den Vorgestellten. Dann wandte er sich wieder dem Pascha zu: »Nun also! Einen Botaniker brauchen Sie doch notwendig, sonst fehlt Ihrer Expedition der wissenschaftliche Charakter.«
»Sie sind also Botaniker? Das wäre doch immerhin etwas!«
»Ja, Herr Kapitän, ich habe mich ziemlich mit Botanik beschäftigt. Man muß doch irgend ein Steckenpferd haben, um die viele Zeit totzuschlagen! Ich bin aber auch Jäger.«
»Ausgezeichnet! Doch fürchte ich nur, in der Wüste wird sich wenig Ausbeute für einen Botaniker finden und auch geringe Gelegenheit, dem Jagdsport zu frönen.«
»Wieso? Reisen Sie in die Wüste?« fragte der Baron, die Augen weit aufreißend.
Wieder lachte Münchhausen herzlich. »Na, junger Mann, was vermuten Sie denn sonst im Westen von Ägypten? Es dürfte Ihnen doch nicht unbekannt sein, daß die Sahara eine Wüste ist.«
»Die Sahara, selbstverständlich! Aber ich denke, die Sahara ist in Algerien, und hier befinden wir uns doch ein ganzes Ende davon entfernt.«
»Nein, so etwas!« rief jetzt Professor Rommel entsetzt. »Die Sahara umfaßt den Süden von Marokko, Algerien, Tunis, Tripolis und grenzt an Ägypten, wo sie allerdings auch ›Libysche Wüste‹ genannt wird. Hören Sie einmal, junger Herr: Sie wollen Afrika erforschen? Haben Sie nicht wenigstens zuvor einen Blick aus die Karte dieses Erdteils geworfen? Sie haben wohl gar am Ende nicht einmal eine Karte bei sich?«
Nun wurde der Baron denn doch kleinlaut. »O, ich habe Baedekers ›Ägypten‹ bei mir,« entgegnete er; »das ist ja doch wohl das bekannteste Reisehandbuch. Ich meinte, das genüge vollkommen.«
»Für den Vergnügungsreisenden; aber nicht für den Forscher. Ich sehe, mit Ihnen ist nicht viel los!« rief der Professor, ganz entrüstet über solche naive Keckheit.
»Na! Trösten Sie sich,« sagte nun Münchhausen gutmütig, da er sah, daß der arme Baron wirklich zerknirscht und beschämt dastand. »In den unbekannten Gegenden, die unser Ziel sind, nützen Landkarten wenig, vielmehr müssen wir erst selber solche entwerfen. Im übrigen habe ich nichts dagegen, wenn Sie sich uns anschließen wollen; nur müssen Sie sich selbstverständlich allen meinen Anordnungen fügen, denn ich bin der Herr der Expedition, somit auch der Ihrige, falls Sie mitziehen.«
Nun loderte wieder die Eitelkeit des Barons hoch empor. »Was?« rief er. »Ich bitte Sie, ich, ein Baron, sollte mich Ihnen, einem Kapitän, unterordnen?«
Damit fiel ihm vor Erstaunen und Entrüstung sein Einglas aus dem weitaufgerissenen Auge. Rasch zog er es an der Schnur empor und klemmte es wieder ein, da es ihm unentbehrlich schien, um einen recht vornehmen, überlegenen Eindruck zu erwecken.
Münchhausen aber erwiderte mit edler Ruhe: »Scheint Ihnen ein Kapitän zu gering, um sich ihm unterzuordnen, so betrachten Sie mich eben in meiner Eigenschaft als Pascha: so fällt es Ihnen vielleicht leichter. Falls Sie jedoch meine Oberhoheit nicht anerkennen wollen, wie jedes andere Mitglied meiner Karawane, so müßten wir bedauern, auf die hohe Ehre, den großen Vorteil und die außerordentliche Annehmlichkeit Ihrer geschätzten Begleitung verzichten zu müssen.«
Diese ironischen Worte, die der Baron für ernst nahm, klangen so schmeichelhaft, daß sich sein im Grunde gutmütiges Herz versöhnt fühlte. Er lenkte daher ein, indem er sprach:
»Nun ja denn! Der Form wegen will ich mich in diese Bedingungen fügen. Übrigens möchte ich noch erwähnen, daß ich natürlich meinen Diener mitnehme, den Peter Grill.«
»Auch dies sei Ihnen gestattet,« erwiderte Münchhausen: »Seine Begleitung wird uns sogar angenehm sein, da wir nur wenige Europäer sind, und unseres verehrten Professors Diener, Franz Billinger, ein biederer Bayer, wird sich besonders freuen, einen hoffentlich angenehmen Kameraden und Reisegefährten in Ihrem Peter zu finden.«
»Daß ich es nicht vergesse,« schnarrte Steinberg wieder: »Ich habe nämlich auch meine Schwester bei mir, Baronesse Hulda von Steinberg, die sich selbstverständlich der Entdeckungsreise anschließt.«
»Oho!« rief der Pascha: »Selbstverständlich, sagen Sie? Das ist im Gegenteil nichts weniger als selbstverständlich, das ist vielmehr völlig ausgeschlossen. Eine zarte Dame auf diese beschwerliche und nicht gefahrlose Wüstenfahrt mitzunehmen, wäre eine Verantwortung, die ich nicht übernehmen möchte. Professor Rommel hier nimmt zwar auch seine Schwester mit, das ist aber ein bewährtes, mutiges Frauenzimmer, und die Verantwortung für sie übernimmt er selber.«
»Nun wohl! So übernehme ich ebenfalls die Verantwortung für meine Schwester: so zart, wie Sie sich vorstellen, ist sie durchaus nicht. Sie ist zwei Jahre älter als ich und hat einen scharf ausgeprägten Willen. Unter keinen Umständen würde sie es dulden, daß sie von der Reise ausgeschlossen werden sollte: eher würde sie mir die Erlaubnis verweigern, mitzugehen.«
»Aha!« lachte Münchhausen. »Das scheint ja eine ganz entschlossene und selbständige Frauensperson zu sein, und Sie stehen sozusagen unter dem schwesterlichen Pantoffel. Da wird es sich am Ende noch fragen, ob Fräulein Hulda uns gütigst gestattet, sie zu begleiten?«
»O, was das betrifft, so wird sie keinerlei Schwierigkeiten machen: sie brennt auf Abenteuer und ist viel zu vernünftig, sie ohne sachkundige Führung aufsuchen zu wollen.«
»Also vernünftiger als Sie!« meinte der Kapitän beifällig: »Das wäre ja immerhin eine Empfehlung.«
»Gestatten Sie doch, daß sich die Baronesse uns anschließt,« bat jetzt Professor Rommel den Pascha: »So tüchtig und furchtlos meine Schwester auch ist, war es mir doch immer eine geheime Sorge, sie als einzige weibliche Person auf diese gefährliche Wüstenfahrt mitzunehmen. Auch für Monika selber wäre es äußerst angenehm, nicht die einzige Dame der Gesellschaft zu sein, und mir wäre es, wie gesagt, eine Beruhigung, wenn sie bei ihrem Wagnis eine ebenso kühne Gefährtin fände.«
»Gut also! Ich genehmige den Anschluß der Baronesse Hulda: der Baron übernimmt ja die Verantwortung für sie.«
»Es versteht sich wohl von selbst,« hub dieser wieder an, »daß meine Schwester auch ihre Zofe Isolde mitnimmt.«
Jetzt brach Rommel in ein schallendes Gelächter aus und Münchhausen lachte, daß es dröhnte: »Na, na! Herr Baron,« rief er, als er wieder einigermaßen zu Atem kam: »Das wird ja nett! Zuerst erklären Sie, überhaupt keine Begleiter zu haben, dann taucht Ihr Diener auf, hernach besinnen Sie sich auf Ihr Fräulein Schwester, hinterher fällt Ihnen noch deren Zofe ein: wenn das so fortgeht, so führen Sie uns zuletzt doch noch eine ganze Karawane zu, Männlein und Weiblein!«
»Nee, nee! Nu ist es fertig!« beeilte sich Steinberg zu versichern. Er mußte nun selber lachen, wodurch sein Einglas wieder den Halt verlor. Er ließ es jetzt baumeln: es mochte ihm die Einsicht gekommen sein, daß er hier Männern gegenüberstand, denen man mit solch läppischen Äußerlichkeiten nicht zu imponieren vermag.
»So, so! Nun ist es also zu Ende?« fragte der Kapitän: »Wirklich und wahrhaftig?«
»Wirklich und wahrhaftig!«
»Nun also, Herr Baron, auch die Zofe sei zugelassen. Und jetzt gehen Sie hin und treffen Sie Ihre Vorbereitungen zur Reise und zwar etwas rasch, denn übermorgen geht es unweigerlich ab, und auf Nachzügler wird nicht gewartet. Die Kamele für Sie und Ihre Begleitung will ich selber bereitstellen, denn Sie könnten uns bei Ihrer Unerfahrenheit unbrauchbare Tiere zuführen. Für Ihre übrige Ausrüstung müssen jedoch Sie selber Sorge tragen wie es sich von selbst versteht. Hoffentlich ist Ihr Fräulein Schwester so praktisch, daß sie Ihnen hierin gute Ratschläge geben kann.«
Etwas bescheidener und höflicher, als bei seinem Kommen, empfahl sich der Wichtigtuer beiden Herren, die noch lange über seine Unverfrorenheit lachten.
»Ich fürchte,« bemerkte Münchhausen zu Rommel, »wir haben uns mit dieser ungebetenen Verstärkung eine Last aufgeladen, die uns manche Unannehmlichkeit bringen dürfte. Oder versprechen Sie sich viele Vorteile für unsere Expedition von den botanischen Kenntnissen des jungen Mannes?«
»Das nun gerade nicht,« erwiderte der Professor: »Er scheint ein rechter Windhund, dessen wissenschaftliche Bildung nicht weit her sein dürfte. Dagegen vermute ich, daß er, wenn auch unfreiwillig, viel zur Erheiterung der Gesellschaft beitragen wird, und das ist bei einer Reise durch die sandigen Einöden von unschätzbarem Wert.«
»Ich weiß nicht,« meinte der Kapitän kopfschüttelnd: »Solche monokulierte Jünglinge sind mir von jeher zuwider gewesen. Hoffen wir, daß seine Schwester sich als gediegener erweist, obgleich mir das sehr unwahrscheinlich scheint.«
Diesmal zeigte sich der sonst mehr zu Zweifeln geneigte Professor als der hoffnungsvollere und milder urteilende. »Der junge Mann,« sagte er, »scheint zwar an maßloser Selbstgefälligkeit und Selbstüberschätzung zu leiden, im Grunde jedoch ein gutes Herz zu haben. Jedenfalls läßt er sich etwas sagen und nimmt es nicht gleich übel, selbst wenn es wie eine scharfe Zurechtweisung klingt. Am besten hat mir an ihm gefallen, daß er sich von uns auslachen ließ, ohne die Spur einer beleidigten Miene aufzusetzen.«
»Darin haben Sie allerdings nicht so unrecht,« gab der Pascha zu: »Da sich der adelsstolze Jüngling doch etwas sagen läßt, ist er zum mindesten nicht unbelehrbar, noch unverbesserlich. Vielleicht verdanken wir dies seiner Schwester, die offenbar ein recht energisches Frauenzimmer ist, und vor der er allen Respekt zu haben scheint. Ich will daher gutes Muts der Begleitung unserer ungebetenen Gäste entgegensetzen und mich bemühen, aus unserm neuen Botaniker ein brauchbares Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu machen.«
»Darin werde ich Sie lebhaft unterstützen,« sagte Rommel, »und wenn ich mich in Baronesse Hulda nicht täusche, so werden wir eine tüchtige Bundesgenossin an ihr haben. Schiller sagt: ›Der Mensch hofft immer aus Besserung‹. So wollen denn auch wir auf Besserung des Barons hoffen, der sie so nötig hat, und das Unserige dazu beitragen.«
Nach dieser Aussprache begaben sich die beiden an die Arbeit; denn sie hatten noch alle Hände voll zu tun mit den letzten Vorbereitungen und Anordnungen, die der bevorstehende Aufbruch erheischte.
4. Die Harmonika und die Zitrone
Schon qualmten die Schlote des fürstlich eingerichteten Dampfers, der Hussein Pascha und seinen Begleitern zur Fahrt nilaufwärts durch den Khediven zur Verfügung gestellt worden war.
Der deutsche Pascha stand mit Professor Rommel am Ufer und leitete die Arbeiten, die sich noch in den letzten Augenblicken vor der Abfahrt zusammendrängten. Es galt noch vieles auf das Schiff zu verfrachten, und Münchhausen gab an, wo es zu verstauen sei.
Da erschien Monika Rommel, des Professors Schwester, in Begleitung von dessen Diener, des Bayern Franz Billinger, dessen gutmütiges Gesicht ein flotter schwarzer Schnurrbart zierte.
Fräulein Rommel machte für ihre zwanzig Jahre einen äußerst gesetzten Eindruck; doch spielte um ihre Mundwinkel ein Schalk, der verriet, daß sie bei allem Ernste im Grunde doch heiteren Gemütes und einem harmlosen Scherz durchaus nicht abgeneigt war. Sie hatte ein angenehmes Gesicht, vollwangig und rotbackig, so recht gesund und frisch; vor allem aber nahm es sofort ein durch die gewinnende Freundlichkeit, die daraus strahlte. Blondes Haar und blaue Augen verrieten die Deutsche.
»Ah! Da kommt ja unsere Harmonika!« rief Münchhausen erfreut, als er sie erblickte.
»Har–mo–ni–ka?!« fragte der Professor verwundert, und dehnte in feinem Erstaunen den Namen aus, gleich einer Ziehharmonika.
»Ach so!« sagte der Kapitän lachend: »Da habe ich mich verschnappt! Sie wissen ja wohl noch gar nicht, welch schönen, ungemein passenden Namen ich Ihrem Fräulein Schwester beilegte. Sie heißt ja freilich nur Monika: aber sagen Sie selber, paßt eigentlich dieser Name für ein so anmutiges Geschöpf?«
»Ich wüßte nicht, warum er nicht für mein Schwesterlein passen sollte,« meinte der Gelehrte.
»Natürlich, Sie, der trockene Mann der Wissenschaft, dem nichtssagende lateinische Namen geläufiger sind als ehrliches Deutsch, – Sie fragen nichts danach, ob der Klang eines Namens auch des Wesens würdig ist, das er bezeichnen soll! Ich bitte Sie, was ist ›Monika‹? Mich erinnert dieser Name immer an ›Monismus‹, die Religion der Unvernunft und Halbbildung. Und so sollte ich eine Dame nennen, die wie Ihr Fräulein Schwester hohen Verstand und tiefgründige Bildung besitzt? Nimmermehr! Sie hat ein so geklärtes, harmonisches Wesen, daß der Name ›Harmonika‹ wie für sie geschaffen erscheint. Wer diesen Namen vernimmt, weiß gleich, mit wem er es zu tun hat: Die Harmonie der Sphären klingt ihm daraus entgegen, wie aus der melodischen Stimme und den harmonischen Reden seiner Trägerin. Sie werden mir also gewiß gestatten, Professor, Ihre Schwester so zu nennen. Sollten Sie mir aber törichterweise die Erlaubnis hiezu verweigern, so mögen Sie wissen, daß ich mich den Kuckuck darum schere: denn ich bin Pascha und der Herr des Unternehmens!«
Während dieser Rede war Fräulein Monika hinzugetreten. Mit vergnügtem Lächeln begrüßte sie den schalkhaften Kapitän und sagte: »Ich erteile Ihnen hiemit in höchsteigener Person die Ermächtigung, mir diesen schmeichelhaften Namen beizulegen, und es soll mir eine Ehre sein, ihn zu tragen, wie ich mich auch stets bemühen will, seiner würdig zu sein.«
»Also ich und meine Meinung sind wieder einmal ausgeschaltet? Das ist das Los der Professoren!« Also brummte Rommel, eine Entrüstung heuchelnd, die ihm ferne lag; denn er besaß Sinn für Humor, und im Grunde gefiel ihm der Name »Harmonika« für seine Schwester gar nicht so übel.
Franz Billinger, Rommels bayrischer Diener, der meist kurz weg »Franzl« genannt wurde, nahm nun das Wort.
Doch ehe wir seine treffenden Bemerkungen wiedergeben, müssen wir einer besonderen Schwierigkeit gedenken, die uns diese Wiedergabe bereitet. Billinger redete meist in seiner bayrischen Mundart, obgleich er in langjährigem Dienste des Professors gelernt hatte, zuweilen auch einiges Schriftdeutsch darunter zu mengen, so daß seine Reden nicht durchweg als unverfälschtes Bayrisch erschienen. Wir möchten nun zu keinen Übersetzungskünsten greifen, sondern alles, was er jetzt und späterhin äußerte, möglichst genau so wiedergeben, wie es »dem Gehege seiner Zähne« entfloh. Aber eben darin liegt die Schwierigkeit, da einzelne bezeichnende Laute sich durchaus nicht völlig lautgetreu niederschreiben lassen. Das kommt vor allem für sein »a« in Betracht, das für gewöhnlich wie ein getrübtes »o« lautete, gleich dem englischen »aw« oder unserm deutschen »o« in »Sonne«, wenigstens wie es in Süddeutschland ausgesprochen wird. Zuweilen klang es mehr wie »a«, zuweilen mehr wie »o«. In letzterem Falle schreiben wir einfach »o«, wobei der Leser sich bewußt bleiben muß, daß es als getrübtes »o« mit einem Anklang an »a« auszusprechen ist und für das schriftdeutsche »a« steht. Im übrigen hoffen wir, das Verständnis der Reden unseres Franzls wird weiter keine besonderen Schwierigkeiten bieten. Immerhin müssen wir um Nachsicht bitten, wenn die Wiedergabe einem kundigen bayrischen Ohr nicht immer die zutreffendste erscheint.
Nach dieser notgedrungenen Erörterung wollen wir es wagen, des guten Dieners schlagende Bemerkung zu Gehör zu bringen, so gut es eben gelingt. Er sagte also, da er vernahm, daß seiner Herrin der schöne Spitzname beigelegt werden sollte: »Wos a Monika is, dös hob i moaner Lebtog nit g'wißt. Aba a Harmonika, dös loß i ma g'folln! Dös gibt a Musi, ganz oans, ob's a Mundharmonika is oda a Ziechharmonika. Dös hoamelt mi on, und i möcht glei an Schuhplotterl tonzen vur Vagnügen, wann i bloß an Nomen vun dösen Instrumenterl hör. Wann Sö's mir erlaaben, Fräulein Monika, nachher hoaß i Sö aa ›Fräulein Harmonika‹ oda moanen S', daß sö dös nit schicken tut vur an Diena?«
»Getrost darfst du mich so nennen,« lachte die wohlgestimmte Harmonika.
Nun sah man auch die Steinbergs daherkommen.
Des Barons Diener, Peter Grill, war ein etwas rötlich angehauchter, blonder Jüngling, schlank und beweglich. Die Zofe Isolde zeigte die Würde, die der Kammerjungfer einer Baronesse zukommt. Ihr rosiges Gesicht hatte sie weiß gepudert, weil die blasse Gesichtsfarbe ihrer Herrin sie viel vornehmer dünkte. Das Stumpfnäschen, das zuvor schon keck genug in die Luft ragte, trug sie so hoch, daß man glauben konnte, unmittelbar durch die Nasenlöcher in den Schädel blicken zu können, in dessen dunklem Hohlraum sich wohl nur ein bescheidenes Gehirn finden mochte. Kurzum, sie machte den Eindruck eines recht hochnäsigen Gänschens, was nicht verhinderte, daß man ihr von glänzend braunem, schön gewelltem Haar umrahmtes Gesichtchen recht hübsch finden mußte.
Baronesse Hulda hatte eine marmorweiße Haut, besser gesagt, eine lilienweiße: denn sie zeigte nichts von krankhafter Blässe, sondern einen blühenden Glanz, obgleich ihr das frische Rot der Wangen völlig fehlte. Umso frischer leuchteten die roten Lippen des feingeschnittenen Mundes hervor. Ihr Gesicht war schmal, ohne mager zu sein, die dunklen Augen waren von seltener Größe, die langen Wimpern und Brauen kohlschwarz, und ebenso das üppige, seidenschimmernde Haar, ganz im Gegensatz zu ihrem blonden Bruder. Alles in allem konnte das schlanke Mädchen wohl für eine eigenartige Schönheit gelten.
Stark beeinträchtigt wurde diese Schönheit freilich durch die zitronengelbe Färbung ihres Gewandes. Es bestand aus widerstandsfähiger, glatter Leinwand, luftig und kühl, und für eine Wüstenreise außerordentlich gut geeignet. Auch die Farbe war für diesen Zweck eigentlich die denkbar günstigste: der ganze Anzug machte daher dem Verstand und praktischen Sinn der Trägerin alle Ehre, verriet jedoch zugleich, daß sie, auch hierin ihrem Bruder unähnlich, von aller Eitelkeit auf ihre körperlichen Reize frei war, sonst hätte sie zweifellos Stoff, Schnitt und Farbe ganz anders gewählt.
»Die reinste Zitrone!« rief Münchhausen, als er sie von ferne erblickte; und mit diesem, auf ihr Äußeres so zutreffenden Namen bezeichnete er sie auch in der Folge, freilich nur, wenn weder sie noch ihr Bruder es hören konnten.
Die Arbeiten waren beendet, die Ladung verstaut, und die Teilnehmer an der Forschungsreise gingen an Bord, nachdem die Steinbergs herangekommen und begrüßt worden waren.
Der Anker wurde gelichtet, und der prächtige Dampfer trat alsbald seine Fahrt nilaufwärts nach Süden an.
In wahrhaft fürstlicher Weise hatte der Khedive für die Bequemlichkeit der Reisenden gesorgt, und vor allem eine großartige Reiseküche auf dem Fahrzeug einrichten lassen: Silberbestecke, Glas, Porzellan, Kristall, Nahrungsmittel, Getränke und Leckereien in üppigster Fülle sollten anscheinend die kühnen Forscher im voraus entschädigen für die Entbehrungen, die auf dem langwierigen Zug durch die Wüsten vorauszusehen waren. Große Käfige mit Hühnern, Tauben, Puten und Fasanen, eine Menge Schafe, Hunderte von Büchsen mit eingemachten Pasteten, Gemüsen, Fleisch- und Fischkonserven, auserlesene Genüsse aller Art, feine Weine, Sekt, Liköre, Bier, Tee, Schokolade, Zigarren und Zigaretten, – nichts mangelte! Und dazu der Befehl an die Behörden, alles sofort zu erneuern, wenn es verbraucht sein sollte, und jeden Wunsch der Reisenden zu befriedigen.
»Was meinen Sie wohl, was unsere Verpflegung den Vizekönig kostet?« fragte Münchhausen den Professor, mit dem er die Vorräte in Augenschein nahm.
»Mindestens fünfzig Mark täglich für den Mann,« erwiderte Rommel.
»Stimmt!« sagte der Kapitän: »Dafür aber zahlt er zweihundert Mark täglich für jeden von uns, und achtzig Mark für die Diener und Leute. Sie können sich ausrechnen, was da in die Taschen der Beamten fließt! Aber ich arbeite redlich daran, Taufik über die Betrügereien seiner Untergebenen die Augen zu öffnen, es geht jedoch nur langsam: die Unterschlagungen sind der ganzen Beamtenschaft so zur Gewohnheit geworden, daß sie dieselben geradezu als ihr Recht betrachten und sich eifrig darum wehren. Allein die Unsummen, die da verschleudert werden, kann man besser anlegen, zum Wohl und Emporblühen des Landes und zur Linderung der himmelschreienden Not unzähliger Armer. Das ist mein Bestreben, das mir aber, außer beim einsichtigen Vizekönig, wenig Dank und viel Feindschaft einträgt.«
Peter Grill und Franz Billinger machten es sich an Bord bequem und schlossen bald Freundschaft.
Franz machte sich auch an die feine Zofe mit dem kuriosen heidnischen Namen heran, und bemühte sich, ihre Gunst zu erwerben.
Er wurde jedoch schnippisch abgewiesen. Peter sah lachend zu, wie der Kamerad abblitzte und bemerkte:
»Du, da is nichs zu wollen: det is eene janz Vornehme, oder eine vornehme Jans, wenn dich det lieber is, – der sin wir viel zu jeringe. Nu is se ja von zu Hause ooch man bloß eene Schäferstochter vom Lande, un heeßt eejentlich Liese, woraus sie in ihren Hochmut Liselotte und hernach Isolde jemacht hat, dat et feiner klingt. Det allens habe ik schonst in Berlin herausjebracht. Sie leujnet et aber ab und wird spinnejiftig, wenn eener sie ihre standesamtliche Herkunft vorhält. Nu is jedoch jerade dieset Leujnen der jewisse Beweis von die Richtigkeet meener Entdeckunk: denn Leujnen is dich immer verdächtig. So erinnere ik mir aus meener Vaterstadt eenes bezeechnenden Beispiels. Da is nämlich eenes Nachts een blutiger Raubmord jeschehen, und die Polizei hat wie jewöhnlich den Täter nich entdecken können. Nu kommt eenes Tajes der Schutzmann vor den Bürjermeester mit eenen schäbigen Jesellen, un sacht: ›Herr Bürjermeester, hier habe ik endlick den Raubmörder!‹ Der Bürjermeester sieht sich det Individuum an, un det war een Pennbruder, der nich jerade wie een jroßer Verbrecher ausjesehen hat, weshalb er den Polizeidiener jefragt hat: ›Woher wissen Sie denn, det det der Raubmörder is? Hat er jestanden?‹ – ›Nee, nee!‹ sacht der Schutzmann: ›Int Jejenteel: er leujnet, un det is sehr verdächtig!‹ Und jenau so is et mit di Isolde: sie leujnet, det se eene Schäferstochter vom Lande is, un det is sehr verdächtig! Ik habe ja so in Anbejinn von unsere Bekanntschaft ooch den Versuch jemacht, mit sie anzubändeln; alleene sie behandelt mir so hochmütig, det ik et vorziehe, ihr loofen zu lassen. Sie bildet sik nämlichst in, sie is die Allerschönste auf die janze Herrjottswelt, un deswejen wartet sie jewiß uf eenen Prinzen von Jeblüt: da kann nu unsereener nich ankommen, un ik rate dich, laß ihr loofen, wie ik et mache.«
Billinger war vernünftig und selbstbewußt genug, diesen Rat zu befolgen und die stolze Isolde fortan als Luft zu behandeln. Dies brachte sie dann mit der Zeit doch auf andere Gedanken. Namentlich machte sie auch die endlose Reise durch die sandige Einöde späterhin zugänglicher, und sie war dann oft froh, sich mit den biederen Dienern unterhalten und belustigen zu können.
Auch die Zitrone und die Harmonika befreundeten sich rasch; denn Baronesse Hulda, wie sie nicht eitel war, zeigte sich auch nicht so hochmütig, wie ihre Zofe. Adelsstolz kannte sie schon gar nicht, dazu hatte sie viel zu viel gesunde Vernunft. Bei aller Energie war sie doch gutmütig und umgänglich, und schon ihr Verstand sagte ihr in diesem Fall, daß sie und Monika sehr aufeinander angewiesen seien, so daß es auch für sie selber von größtem Vorteil sein müsse, in herzlichem Einvernehmen mit der Gefährtin zu leben. Monika ihrerseits war ja so liebenswürdiger und offenherziger Natur, daß es leicht fiel, ihr Zutrauen und ihre Freundschaft zu gewinnen.
Als am zweiten Tage der Fahrt, nachdem sich alle nach ihren Neigungen eingerichtet hatten, Peter und Franzl plaudernd auf dem Verdeck saßen, fand es der Araber Mohamed, der auf seinen Hadschi-Titel so stolz war, geboten, sich den ungläubigen Sklaven vorzustellen, um ihnen klar zu machen, welch hohe, unverdiente Ehre sie genössen, in Gesellschaft einer solch hervorragenden Persönlichkeit reisen zu dürfen, und ihnen mit seiner hohen Würde die gebührende Ehrfurcht einzuflößen. Er trat daher in selbstbewußter Haltung auf die beiden Diener zu, und sprach, auf Arabisch natürlich:
»Wisset ihr wohl, mit wem Allahs Güte gegen euch Unwürdige euch begnadigt, die Reise nach dem Untergange der Sonne zu machen? Vor euch steht kein Geringerer, als Mohamed et Talib, – Hadschi!«
»Zur Genesung!« rief Franz Billinger alsbald höflich, auf Deutsch.
»Was is dich in die Knochen jefahren?« fragte Peter Grill verwundert: »Der Mann stellt sich uns mit seener werten Persönlichkeet vor, und du rufst: ›Zur Jenesunk!‹«
»Na!« meinte Franz: »Bei uns in Boaern samma fein höflich, und wann oana nießen tut, nachher sogen wir: ›Zur Genesung!‹ oder: ›Zur Gesundheit!‹ Und wann oaner ganz fein gebüldet soan will, hernach sogt er: ›Prosit!‹«
»Aber, Menschenskind! Der Araber hat doch nich jenossen? Is ihn nich eenjefallen.«
»Hast denn du nit g'hört, wie er ›Hatschi!‹ g'macht hot? Is doch deutlich g'nug g'wesen.«
Da brach Peter in ein helles Gelächter aus: er war über ein halbes Jahr lang mit Steinbergs im Orient umher gereist, und sprach schon ziemlich geläufig Arabisch; noch besser verstand er es. So gedachte er, den unwissenden Gefährten zu belehren, indem er ihm vorhielt:
»Nee, so wat! Weeßt du denn nich, det Hadschi een Mokkapiljer is, nämlich eener, der die Hadsch, wie die Muselmänner ihre Piljerfahrt nennen, nach die heiligen Stätten von Mokka jemacht hat?«
Das wußte Franz gar wohl, denn er befand sich noch viel länger in Professor Rommels Diensten in Ägypten, und Sprache und Sitten der Araber waren ihm noch bekannter, als dem neuen Freund. Er entgegnete daher:
»Moanst, dös taat i nit wissen? Is ma aba ganz oans: der Monn hot ›Hatschi‹ g'mocht, und an höflicha Bursch bin i moaner Lebtog g'west, hernach sog i: ›Zur G'sundheit!‹ und dös kann ma koan onständiga Kerl nit vaübeln. Und übahaapt, wann d's moanst, du konnst da Franzl belehren, nachher will i da sogen, dö hoalig Stodt vun dö Mahomedianer hoaßt Mekka und nit Mokka.«
»Nee! Det weeß ik nu bestimmt, det se Mokka heeßt, indem det der berühmte Mokkakaffee aus dieser Stadt kommt, det herrliche Jetränke.«
»Is ollweil nix mit doaner Wissenschaft: Mekka hoaßt's, dös is sicha! Und wann's durten an guten Kaffee gibt, hob i nix dogegen, nachher is dös eben a Mekkakaffee. Wann d's dös nit glaaben tust, alsdann konnst moanetholben selba nach Mekka pilgern und durten an Mekkakaffee saufen: hernach derfst aa ›Hatschi!‹ machen, wann d's di vurschtellst, und i wünsch da, als gebüldeter Boar ›Zur Genesung!‹«
Mit Erstaunen lauschte Mohamed den fremdartigen Lauten dieses deutsch geführten Gesprächs, von dem er natürlich kein Wort verstand. Er glaubte jedoch, nicht recht begriffen worden zu sein, und wiederholte daher mit Nachdruck und Würde:
»Habt ihr's gehört, ihr Ungläubigen? Euch wurde eine Ehre zuteil, deren ihr nicht wert seid; denn vor euch steht Mohamed et Talib, Hadschi!«
»Zur Gesundheit!« rief der höfliche Franzl abermals, diesmal jedoch auf Arabisch.
Der Araber war verblüfft.
»Allah erleuchte das Dunkel deines Verstandes!« rief er aus: »Die Gesundheit ist ein hohes Gut und eine köstliche Gabe des Allmächtigen. Aber ich erfreue mich ihrer und bedarf deines Wunsches nicht. Hat die Dürftigkeit deines Gehirnes nicht verstanden, daß ich mich herabließ, euch zu offenbaren, welchen hohen Vorzug euch die Gnade des Allgütigen gewährte, da sie euch würdigte, in der Gesellschaft eines frommen Mekkapilgers zu reisen, da ihr doch nichts weiter seid, als ungläubige Christenhunde?«
Das ging dem biedern Bayern doch über die Gemütlichkeit, und er grollte, wieder auf Arabisch:
»Bildest du dir ein, meinem Verstand Erleuchtung wünschen zu müssen? So sage ich dir, der Franzl Billinger aus Bayern: Allah und sein sauberer Prophet täten wohl daran, zuvor deinen stockfinstern Gehirnkasten zu erhellen. Weißt du nicht, daß man ›Hatschi!‹ macht, wenn die Dämpfe des abgekühlten Gehirns gewaltsam der Nase entfahren? Das nennt man ›nießen‹. Wir höflichen und gebildeten Söhne Germanistans wünschen Gesundheit jedem, den wir nießen hören, und wenn es ein schmutziger Araber wäre. So habe auch ich getan, und wenn du einen Funken von Anstand besäßest, hättest du dich geziemend bedankt. Aber du grober Flegel und eingebildeter Tropf nennst uns Hunde, während ein anständiger Hund sich schämen würde, dich als seinesgleichen anzuerkennen. Wisse, daß der Franzl Billinger sich deine Beleidigungen nicht gefallen läßt, und wenn du noch ein einziges Mal uns so beschimpfst, so kriegst du von dieser seiner Hand eine Watschen, daß du übers ganze Deck hinweg und über Bord fliegst, wie eine taumelige Fledermaus. Und da wird dir dein Allah und sein Prophet nicht helfen; aber der Scheitan, wie ihr den Teufel nennt, wird lachen und dich bei deinem Fuchsbart in die Dschehennah schleppen, eure Hölle; denn dorthin gehörst du und Deinesgleichen.«
Mohamed stand bei dieser langen donnernden Rede da, wie ein begossener Pudel. Was eine Watschen sei, die ihm der grimmige Bayer androhte, wußte er zwar nicht; Billinger machte jedoch eine so unmißverständliche Bewegung mit seiner kräftigen Hand, daß dem eingeschüchterten Hadschi auch hierüber das Verständnis aufging, und er es vorzog, sich stillschweigend und eiligst zu entfernen, wohl merkend, daß er hier vergeblich zu imponieren suchte.
Lachend rief ihm Franzl noch nach, diesmal wieder auf gut Bayrisch: »Nit wohr, do sponnst, und a Watschen vum Franzl soana Pratzen magst nit riskiern. Aba, ols doan guta Freund, will i di aufmirksam machen auf doan Fuchsbort, doan on'g'strichenen, auf den du Lackel a so stolz bist: vun gestan aus heut is a schun vül schwarza worrn. Is da wohl doan Henna ausgongen, womit an färben tust? Nachher derfst froh san, wann di da Scheitan in dö Dschehennah eini schmeißen tut, denn in da Dschehennah gibt's g'wiß Henna in Hüllen und Füllen, is jo durten olles glühig rot.«
»Den unverschämten Mokkapiljer hast du die Meenung jründlich jesacht!« bemerkte Peter anerkennend, und benutzte dabei die Gelegenheit, zu betonen, daß er auf seiner Ansicht beharrte, daß es Mokka heiße und nicht Mekka. Diese Meinungsverschiedenheit blieb zwischen den beiden Freunden dauernd bestehen, ohne im übrigen ihr Verhältnis zu stören. Nur redete der Preuße fortan bei jeder Gelegenheit mit herausfordernder Betonung von der heiligen Stadt Mokka und den Mokkapilgern, während der Bayer sich dadurch rächte, daß er mit ebensolcher Nachdrücklichkeit den vorzüglichen Mekkakaffee lobte, der zum Frühstück gereicht wurde.
5. In der Oase Dachel
Der Dampfer landete in El-Hamra, dem Hafenort von Siut. Diese Stadt von etwa dreißigtausend Seelen bot mit ihrem üppigen Grün, das sich von den zerklüfteten Felswänden im Hintergrund leuchtend abhob, einen prächtigen Anblick.
Hier wurden die notwendigsten Vorräte eingehandelt, soweit sie sich nicht an Bord befanden, namentlich das Futter für die Kamele zu der fünfzehntägigen Reise nach der Oase Dachel, nämlich fünfzig Zentner Bohnen, die allein fünfzehn Kamellasten bildeten.
Dann setzte sich die Karawane mit mehr als hundert Kamelen in Bewegung, nach Südwesten zu.
Professor Rommel ritt auf einem Esel, da er den schwankenden Sitz auf dem Kamelrücken fürchtete.
So ging es zwischen Orangen- und Zitronenhainen, Dattelpalmen, Feigen-, Maulbeer- und Granatbäumen, zwischen Gemüsegärten mit Bohnen, Tomaten, Zwiebeln, Pfeffer, Auberginen, Durra-, Gerste- und Mohnfeldern hindurch in die Wüste, wo nur noch vereinzelte Dumpalmen die Öde belebten. Baron Erich von Steinberg ritt hoch zu Kamel neben des Professors Esel einher.
»Wann kommen wir denn in die berühmte Wüste?« fragte er.
»Wieso? Wir sind ja bereits mitten darin!« lautete die Antwort.
»Sie scherzen! Ich meine, die Wüste ist Sand, nichts als Sand, ein endloses Sandmeer. Hier aber sind Felsen, der Boden ist meist steinig, überall wuchern Kräuter und Büsche; das ist doch keine richtige Sandwüste?«
»Na, denn eine Steinwüste! Hören Sie, Herr Baron, die Wüste ist nicht überall gleich; sie hat ihre Berge und Täler, ihre Pflanzen und Gesträuche und trägt oft einen steppenähnlichen Charakter; doch werden Sie bald genug auch die sandige Öde kennen lernen und wahrscheinlich rasch satt bekommen.«
Der Baron wurde von seinem Wüstenschiff tüchtig hin und her geworfen und hatte Mühe, sich im Sattel zu halten. Bald überfiel ihn denn auch die Kamelkrankheit, die der Seekrankheit nichts nachgibt, und er wurde ganz still. Einige Tage hatte er dieses abscheuliche Leiden, und ganz genesen fühlte er sich erst, als die Oase Dachel erreicht wurde.
Obgleich die Reise durch die teilweise noch wenig wüstenartige Wüste erst vierzehn Tage gewährt hatte, war es doch für alle eine unbeschreibliche Freude, als von ferne das fruchtbare Land erschaut wurde, und als man ihm näher und näher kam. Auch die Reit- und Lasttiere schritten munterer aus.
Getreidefelder und grüne Palmengärten grüßten hier die freudig aufatmende Karawane. Stachelige Opuntienhecken oder Feigenkaktus hegten die Gärten ein; Sykomoren und andere Feigenbäume, Tamarinden und Tamarisken, Ssantakazien, Ulmen, Eschen, Kastanien, Korkeichen, andalusische Eichen, Pfefferbäume, Karuben oder Johannisbrotbäume, Ölbäume, Mandeln, Orangen, Zitronen, das heißt wilde, bittere Orangen, Limonen, die wir, wie schon erwähnt, fälschlich als Zitronen zu bezeichnen pflegen, während wir doch ihren mit Zucker und Wasser gemischten Saft ganz richtig Limonade und nicht etwa Zitronade heißen, Granatäpfel, Pfirsiche, Aprikosen, Pistazien, Äpfel, Maulbeeren und andere herrliche Bäume und Sträucher kündeten von der Fruchtbarkeit des gesegneten Landstrichs.
In den Gärten wurde eine Menge Küchengewächse, Heil- und Genußpflanzen gezogen, als da sind: Malven, Kürbisse, Gurken, Wassermelonen, Tabak, Tomaten, Zwiebel, Knoblauch, Rizinus, Bohnen und Saubohnen, Lubiabohnen, Erbsen, Linsen und Gulgasknollen oder Colocasia antiquorum. An den Felsen wucherten Aloe, Wacholder, Oleanderbüsche und andere duftreiche Pflanzen; auch Reben waren in üppiger Fülle zu schauen.
Der Mudir oder Statthalter von Dachel, der Scheich-el-Beled oder Oberbürgermeister, der Hakim oder Obermedizinalrat, einfacher als Doktor und noch besser als Kurpfuscher zu bezeichnen, sowie die andern hohen Beamten des Städtchens kamen in glänzendem Aufzug, meist auf Eseln reitend, der Karawane entgegen.
Nach feierlicher Begrüßung mit wortreichen Reden hin und her, geleiteten sie den Pascha und sein Gefolge in die Stadt und wiesen ihnen ihre Herbergen an.
In dieser prächtigen Oase hielt sich die Reisegesellschaft vierzehn Tage auf, um ihre Ausrüstung zu ergänzen und sich vollends mit Lebensmitteln und anderem Bedarf für die lange Wüstenreise zu versehen. Dies ging nur langsam von statten, da die gesamte Obrigkeit des Orts es für ihre Ehrenpflicht hielt, dem Pascha des Vizekönigs mindestens zwei Besuche täglich abzustatten, was natürlich wieder Gegenbesuche notwendig machte. Nichts geht über arabische Höflichkeit, außer der noch viel umständlicheren chinesischen; aber viel Zeit geht mit solchen Förmlichkeiten verloren.
Selbstverständlich war es das erste, was der Mudir tat, daß er die Geschenke der Gastfreundschaft sandte, nämlich zwei Hammel, Truthähne, Eier, Butter, Honig und einen großen Korb voll schmackhafter Brote. Auch der Scheich-el-Beled ließ sich nicht schlecht finden und schickte Töpfe voll Datteln und andre Lebensmittel, wofür ihm Hussein Pascha Silberdraht und silberne Uhren als Gegengeschenk übersandte.
In Erwiderung eines üppigen Gastmahls, lud der Pascha die Beamten auch zu einem Abendessen ein.
Hatten die Europäer sich bei den arabischen Mahlzeiten dazu bequemen müssen, mit den Fingern zuzulangen, so war es für sie nun eine heimlich erheiternde Genugtuung und ein köstliches Schauspiel, zuzusehen, wie ihre würdigen Gäste sich abmühten, mit Messer und Gabel umzugehen. Wenn sich aber einer unbeobachtet glaubte, fuhr er mit einem raschen Griff in die Schüssel und schob sich eine gute Handvoll in den Mund, denn mit den schwierig zu handhabenden Eßbestecken war es eine gar zu langwierige Arbeit, sich in allzudürftigen Mengen nach und nach so viel Nahrung einzuverleiben, um den Hunger einigermaßen zu stillen.
Der strenggläubige Mudir hütete sich gewissenhaft, den Wein und Kognak zu kosten; er begnügte sich mit Limonade. Anders der Hakim, der Arzt, der den Gastgebern höflich und mit sichtlichem Behagen Bescheid tat, während der Scheich-el-Beled sich um die Vorschriften seiner Religion ganz und gar nicht kümmerte, vielmehr ein Glas um das andere leerte. Der Dattelschnaps, der zuletzt aufgetischt wurde, gab ihm den Rest.
Als nun das Aufblitzen von Magnesiumlichtern und einige Revolverschüsse das Fest beendigten, taumelte das würdige Stadtoberhaupt, lustige Lieder singend, nach Hause, rechts und links gestützt von zwei arabischen Polizeisoldaten, die der vorsorgliche Mann wohlweislich mitgenommen hatte.
Die Beamten aus Kairo, die im Auftrag des Khediven die Karawane begleitet hatten, verabschiedeten sich am nächsten Tage, forderten jedoch ein solch unverschämtes Bakschisch oder Trinkgeld vom Pascha, daß dieser ein Telegramm an den Vizekönig aufsetzte, mit der Anfrage, ob die Herren zu so maßlosen Forderungen berechtigt seien.
Die Antwort konnte nicht zweifelhaft sein und wäre den unverfrorenen Erpressern höchst unangenehm geworden.
Der Telegraphenbeamte erklärte jedoch rundweg, das Telegramm nicht befördern zu können: er wisse nämlich bestimmt, daß den Beamten die Annahme eines Trinkgeldes überhaupt verboten sei, da sie mehr als genügend bezahlt würden. Die Anfrage würde daher dem Khedive ihren Ungehorsam verraten und ihnen eine schwere Bestrafung zuziehen, und zu solch einer Ungerechtigkeit könne er als ehrlicher und gewissenhafter Beamter die Hand nicht bieten, zumal er sich dadurch den Haß der Hereingefallenen zuzöge.
Immerhin konnte Münchhausen nun auf dem Verbot fußen und die Gauner mußten froh sein, daß er erklärte, er werde eine Anzeige an den Beherrscher, seinen Freund, unterlassen und ihnen aus Gnaden ein kleines Bakschisch gewähren.
Baron Steinberg hatte infolge seiner Unkenntnis arabischer Sitten und seiner selbstherrlichen Unvorsichtigkeit ein höchst unangenehmes Erlebnis in der gastlichen Oase.
Er spazierte viel in der Umgegend umher, aus Neugier. Er gab freilich vor, er tue es, um zu botanisieren, doch brachte er niemals eine Pflanze mit heim, die irgend welches wissenschaftliche Interesse hätte beanspruchen dürfen.
Eines Tages betrat sein rücksichtsloser Fuß mit den feinen Lackstiefelchen ein junges Saatfeld von Durragetreide oder Sorghum vulgare.
Da rief ihm ein Araber wütend und drohend zu: »Ziehe deine Schuhe aus! Es ist haram, anders als barfuß durch die Saat zu gehen.«
Des Barons arabische Kenntnisse reichten zwar nicht aus, um zu verstehen, daß haram so viel bedeute, als daß es religiös verboten sei, doch begriff er die Forderung des Mannes wohl und der wütende Ton und die drohende Haltung des Mohammedaners schüchterten ihn derart ein, daß er sich raschestens der Fußbekleidung entledigte und in seinem Schrecken ganz vergaß, daß er sie nach Verlassen des Ackers unbesorgt wieder anlegen durfte. So kam er barfuß zurück, Schuhe und Strümpfe in der Hand, und noch ganz bleich und zitternd vor Angst.
Große Heiterkeit der Genossen begrüßte ihn, als er in diesem Aufzuge erschien, und sie nahm noch zu, als er ganz kleinlaut die Ursache erzählte und schloß: »Das sind ja entsetzliche Fanatiker, diese Eingeborenen! Der Mann sah wahrhaftig so aus, als wolle er mich mit Haut und Haar verschlingen, wegen des Frevels, den ich unschuldigerweise begangen.«
»Oho! Unschuldigerweise?« wies ihn Münchhausen zurecht: »Auch in Deutschland würde Ihre Rücksichtslosigkeit mit Recht als Frevel angesehen werden; da dürften Sie nicht einmal barfuß ein Saatfeld betreten. Das ist ja überhaupt zwecklos und verderbt nur die mühsam gezogene Pflanzung, die uns zur Nahrung dienen soll. Was fiel Ihnen überhaupt ein, in junge Getreidesaat zu stapfen?«
»Konnte ich denn wissen, daß das Getreide war? Ich glaubte hier seltene Pflanzen zu entdecken.«
»O weh!« seufzte Professor Rommel bei diesem naiven Geständnis: »Und das ist nun ausgerechnet der Botaniker unserer Expedition! Ein Glück nur, daß es in der Wüste keine Pflanzen gibt, sonst würden wir mit unserer botanischen Ausbeute vor der ganzen europäischen Wissenschaft unsterblich blamiert!«
6. Nach Westen
Endlich war alles bereit und die Kamele konnten bepackt werden zum Antritt der Reise nach dem Westen.
Die Saharin und die Rhafir, das sind die arabischen Kameltreiber und Wächter, erhoben den lebhaftesten Einspruch dagegen, daß der Pascha die Kamele mit Fellachensätteln versah, an Stelle der höchst unpraktischen, ja, tierquälerischen Sättel arabischer Art, die seit Jahrtausenden unverändert beibehalten werden. Der arabische Sattel wird nur unter dem Schwanz der Tiere festgebunden, und durch eine hölzerne Gabel vor dem Höcker zusammengehalten. Das ist eine sehr zweifelhafte Befestigungsweise, daher es nur zu oft vorkommt, zumal auf schwierigen Wegstrecken, daß die ganze Last nach hinten rutscht oder zur Seite herabfällt, was viel unnützen und ärgerlichen Aufenthalt verursacht.
Der weit zweckmäßigere Sattel der Fellahin dagegen berührt das Tier nur mit seinen vier Polstern und wird mit einem Leibgurt festgeschnallt. Er ist viel leichter, und da er festsitzt, statt hin und her zu rutschen wie sein arabischer Kamerad, reibt er die Tiere nicht wund. Die Araber zeigen aber für diesen vorzüglichen Fellachensattel die hochmütigste Verachtung, weil sie sich so unendlich hoch über die Fellachen erhaben fühlen und daher glauben, auch alles Arabische für ungleich besser und vollkommener halten zu müssen, als irgend etwas, das von den Fellachen stammt. Das gilt ihnen als so zweifellos, daß sie nicht daran denken, zu prüfen, oder auch nur ernstlich darüber nachzudenken, ob nicht doch vielleicht ein fellachisches Erzeugnis seine Vorzüge vor den ihrigen habe.
»Genau so,« bemerkte Münchhausen, als die Rede auf dieses schädliche Vorurteil kam, »verachten bei uns die Sachverständigen in ihrem Hochmut jedes Werk und jeden Vorschlag, die von einem Laien stammen, und lassen nur das gelten, was einer ihrer Zunft ausheckte, wenn es auch tausendmal minderwertiger und unpraktischer ist. Und weil in Deutschland das Urteil der Sachverständigen – leider – in allen Dingen ausschlaggebend ist, wird so mancher wertvolle Fortschritt und so manche hervorragende Erfindung gehindert und unmöglich gemacht, weil das maßgebende Gutachten dieser Alleswisser sie verurteilt. Und wenn ein Laie sich anmaßt, Kranke wirklich zu heilen, denen keine ärztliche Kunst zu helfen vermochte, so wird er von dem Fachmediziner verachtet und verhöhnt, wenn nicht gar als »Kurpfuscher« verschrien und verfolgt. Ja, so geht es sogar hervorragenden Fachmännern, wie Professor Schweninger, sobald sie vernünftigere und erfolgreichere Bahnen betreten, als diejenigen, die von der Wissenschaft zur Zeit als allein wissenschaftlich anerkannt vertreten werden. Hüten wir uns daher, die Araber ihres beschränkten Hochmuts wegen zu verurteilen.«
Unbeschadet dieses milden Urteils kümmerte sich der vernünftige Hussein Pascha wenig um die Einwände blinder Fanatiker, und er tat wohl daran, wie der Erfolg lehrte.