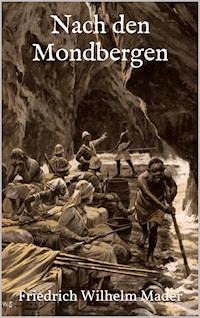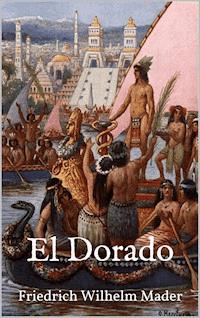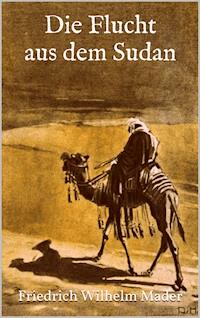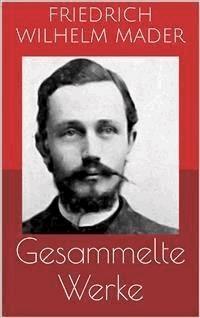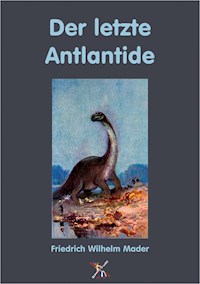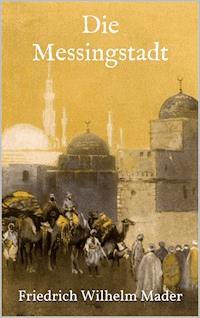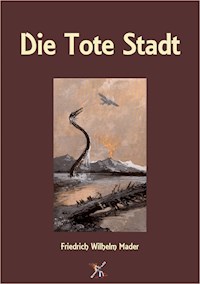
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Tote Stadt in ihren zwei Teilen, deren zweiter die Überschrift "Der letzte Atlantide" führt, ist mein erster Versuch auf dem Gebiete der Jugenderzählung, der infolge verschiedener Umstände erst jetzt zur Buchausgabe gelangt. "Die Tote Stadt" entstand zu einer Zeit, da die Südpolarforschung völlig vernachlässigt wurde. Ich vertrat damals die Ansicht, dass der Südpol auf einer größeren, zusammenhängenden Festlandmasse liegt, dass seine Erreichung am leichtesten von Viktorialand oder vom Weddellmeere aus möglich wäre und viel weniger Schwierigkeiten biete, als die Erreichung des Nordpols. Diese schon 1899 veröffentlichte Überzeugung wurde inzwischen, nachdem die Südpolforschung einen erneuten Aufschwung nahm, durch die Erfolge von Scott, Shakleton, Amundsen und Filchner bestätigt. Bei einer gründlichen Neubearbeitung der Erzählung berücksichtigte ich die neuesten Forschungsergebnisse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die tote Stadt
Friedrich Wilhelm Mader
Mit acht Farbbildern
von
Karl Mühlmeister
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Impressum
Vorbemerkung
Personen
1.– Ein Notschrei aus der Eiswüste
2.– Eine seltsame Persönlichkeit
3.– Ein fauler Zauber
4.– Das Paläoskop
5.– Neue Gäste
6.– Evas Geheimnis
7.– Die Wunder des Lichts
8.– Orpheus?
9.– Mäusles Heldentat
10.– Die Enteisung der Pole
11.– Das Luftschiff der Zukunft
12.– Evas Abschied
13.– Die Erforschung des Südpols
14.– Die Philosophie der Geografie
15.– Das Antarktische Eis
16.– Auf hoher See
17.– Von Ligurien bis Indien
18.– Mann über Bord!
I9.– Ein unfreiwilliger Ritt
20.– Das Südkreuz
21.– Münchhausens wunderbare Berichte
22.– Im Packeis
23.– An der Eisküste
24.– Auf der Eisterrasse
25.– Das Verderben vor Augen
26.– Wie der Kapitän sich zu helfen wusste
27.– Gerettet!
28.– Holmheim
29.– Ein Trugschluss
30.– Südburg
31.– Unfälle
32.– Aus dem Winterleben
33.– Die Siegfriedsage
34.– Antarktische Jagden
35.– Überraschende Kunde
36.– Die Puppe
37.– Ein Rezept für Schriftsteller
38.– Auf zum Südpol
39.– Ein Stück Urwelt
40.– Fabeltiere
41.– Die Seeschlange
42.– Die Tote Stadt
43.– Verloren!
44.– Ein schwerer Unfall
45.– Heimkehr
Quellen und Nachweise
Impressum
Verlag Heliakon
2022 © Verlag Heliakon, München
Umschlaggestaltung: Verlag Heliakon
Bild Cover: Karl Mühlmeister.
Herstellung: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
www.verlag-heliakon.de
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Vorbemerkung
Die Tote Stadt in ihren zwei Teilen, deren zweiter die Überschrift „Der letzte Atlantide“ führt, ist mein erster Versuch auf dem Gebiete der Jugenderzählung, der infolge verschiedener Umstände erst jetzt zur Buchausgabe gelangt. „Die Tote Stadt“ entstand zu einer Zeit, da die Südpolarforschung völlig vernachlässigt wurde. Ich vertrat damals die Ansicht, dass der Südpol auf einer größeren, zusammenhängenden Festlandmasse liegt, dass seine Erreichung am leichtesten von Viktorialand oder vom Weddellmeere aus möglich wäre und viel weniger Schwierigkeiten biete, als die Erreichung des Nordpols. Diese schon 1899 veröffentlichte Überzeugung wurde inzwischen, nachdem die Südpolforschung einen erneuten Aufschwung nahm, durch die Erfolge von Scott, Shakleton, Amundsen und Filchner bestätigt. Bei einer gründlichen Neubearbeitung der Erzählung berücksichtigte ich die neuesten Forschungsergebnisse.
Die vielfach von ernsten wissenschaftlichen Forschern erörterte Möglichkeit eines warmen, ja tropischen Klimas am Südpol mit Urweltlandschaft und Urwelttieren, schien mir wert, der Schilderung zugrunde gelegt zu werden, obgleich ich ihre Bestätigung nicht erwartete. In der Tat hat sie sich auch nicht bestätigt, was mich durchaus nicht überraschte. Ich hatte daher von Anfang an im zweiten Teile dafür gesorgt, dass der plötzliche Untergang dieser Urwelt und die rasche völlige Vergletscherung der Südpolargegenden vorausgesehen werden müssten, so dass bei der Entdeckung des Poles nur noch die Eiswüste vorgefunden würde, wie sie sich tatsächlich dort fand.
Im übrigen will die Erzählung unterhalten, gediegene Kenntnisse vermitteln, die Fantasie in gesunder Weise anregen und die Jugend für tüchtige und edle Vorbilder erwärmen. Gelingt ihr dies, so ist ihr Zweck erfüllt.
Stuttgart 1928
Friedrich Wilhelm Mader
Personen
Professor Frank
Ernst Frank, sein Sohn
Georg Werner, Ernsts Freund
Baron von Münkhuysen
Eva, seine Tochter
Kapitän Hugo von Münchhausen, sein Vetter
Professor Heinrich Schulze aus Berlin
Professor Michael Mäusle
Neeltje, geb. Von Rijn, seine Frau
Raimund, Professor der Physik aus Württemberg
Holm, schwedischer Ingenieur
Dr. Maibold, Arzt
Italienischer Steuermänner
Cavini
Seloso
Italienische Matrosen
Luigi
Carlo
Pietro
Antonio
Enrico
1.– Ein Notschrei aus der Eiswüste
Ich hab’s!«, rief Professor Frank befriedigt aus und überlas noch einmal die Zeilen, die er niedergeschrieben hatte.
Welche Mühe hatte es ihn gekostet, das rätselhafte Schriftstück zu entziffern und hernach die fremdartigen Worte einer völlig unbekannten Sprache zu deuten! Es waren nur wenige Zeilen, und doch hatte ihre Enträtselung mehrere Wochen in Anspruch genommen. Ja, eben die Kürze der Botschaft hatte die Schwierigkeit ihrer Übersetzung gesteigert, weil sie umso weniger Vergleichspunkte bot.
Dass es sich um eine Buchstabenschrift handelte, hatte Professor Frank bald erkannt, und da er in den ältesten Sprachen wohlbewandert war, fiel ihm auch sofort auf, dass die Zeichen einige Ähnlichkeit mit dem Sanskritalphabet aufwiesen. Je älter die Sprache, desto vollkommener ist sie, sowohl in der Reichhaltigkeit der Formen, als in der Fülle der schriftlichen Unterscheidung verschiedener Laute. Das Sanskritalphabet enthält nicht weniger als neunundvierzig Buchstaben, also mehr als das Doppelte unserer heutigen Alphabete. Ja dem vorliegenden Schriftsatz waren fünfzig verschiedene Zeichen erkennbar und da er keinesfalls alle Buchstaben der unbekannten Sprache enthielt, war auf eine noch größere Fülle zu schließen. Der Professor schloss daraus, dass es sich um eine Sprache handeln müsse, die noch älter sei als die heilige Sprache Indiens, und höchst wahrscheinlich deren Urform darstellte. Diese Erkenntnis half ihm nach und nach, die Bedeutung der einzelnen Zeichen mit ziemlicher Sicherheit festzustellen.
Es ergaben sich hieraus Worte, die vielfach in Form und Laut an Wortstämme des Sanskrit, zum Teil auch an ägyptische und chaldäische erinnerten. Durch angestrengtes Nachsinnen und scharfsinnige Schlussfolgerungen brachte Frank allmählich die Bedeutung einzelner Worte mit großer Wahrscheinlichkeit heraus. Dabei kam es ihm zustatten, dass er die meisten toten Sprachen beherrschte und zum Vergleich heranziehen konnte. Die Bedeutung völlig fremdartiger Wörter erriet er schließlich nach vielem Tasten aus dem Zusammenhang. So kam allmählich Sinn in die geheimnisvollen Sätze und es blieben nur noch wenige Unklarheiten übrig, die jedoch die Deutung des Ganzen nicht mehr wesentlich beeinträchtigen konnten.
Jetzt war er endlich so weit und besah sich noch einmal kopfschüttelnd die Urschrift: was für eine seltsame Urkunde war das! Schon das Blatt, auf dem die Schrift stand, war etwas völlig Fremdartiges — kein Papier, kein Pergament, kein Papyrus oder sonst ein pflanzlicher Stoff! — Glatt und hart war es, wie Stein oder Metall, und doch so biegsam, dass es sich rollen und falzen ließ und beim Entfalten keine Spur eines Knicks zeigte. Dabei war es zäh, geradezu unzerreißbar und unzerbrechlich.
Ebenso merkwürdig war die Art und Weise, wie der Professor zu diesem Schriftstück gelangt war: ein Freund in Kapstadt hatte es ihm zugesandt und dazu geschrieben, er habe es in den Schwanzfedern einer Kaptaube entdeckt, die er in Südgeorgien erlegt habe.
Aber woher und von wem stammte dieses rätselhafte Blatt? Nun, darüber schien der Inhalt des Schreibens alle wünschenswerte Auskunft zu geben, doch eben diese erschien noch das Allerseltsamste von allem.
»Es sind Verse«, sprach Professor Frank vor sich hin: »Ich will versuchen, meine Übersetzung in deutsche Verse zu bringen, um der Vorlage völlig gerecht zu werden.«
Damit machte er sich wieder an die Arbeit, wenn man das Dichten, das er oft übte, eine Arbeit nennen darf.
Er kam rasch damit zustande und hatte soeben die letzte Zeile niedergeschrieben, als sein Sohn eintrat.
Dieser war ein schlanker Jüngling von zweiundzwanzig Jahren. Er hatte vor Kurzem seine naturwissenschaftlichen Studien auf der Hochschule beendet und schickte sich nach glänzend bestandener Prüfung an, sich an einer Forschungsreise zu beteiligen.
»Ich bin am Ziel, Ernst!«, rief ihm der Vater zu: »Endlich, endlich ist Licht in die Sache gebracht: das heißt, das Schriftstück konnte ich entziffern, der Inhalt jedoch bleibt mir völlig unerklärlich.«
»Wie lautet er denn?«, fragte Ernst in höchster Spannung.
Der Professor nahm seine Übersetzung zur Hand und las:
»Im Lande umgürtet vom ewigen Eis,
Wo die Sonne sechs Monden den goldenen Kreis
Am Himmel hinführt, — welch ein trauriges Los
Erduldet Atlanta im Erdenschoss!
Sind Menschen noch sonst auf der Erde Rund,
O Taube, so tue doch du ihnen kund,
Dass hier im Gefängnis von ewigen Eis
Nach Menschen sich sehnt eine Seele so heiß!
Wohl blühen die Fluren dort oben im Licht,
Doch trösten die Blüten die Einsame nicht;
Wohl wimmeln die Wälder von grausem Getier,
Doch grüßet kein Mensch, keine Jugend mich hier.
Rings starret von ragenden Gletschern die Wand:
Wagt Keiner die Fahrt ins verschlossene Land?
O! Leben noch Menschen auf Erden so weit,
Ich rufe euch, dass ihr Atlanta befreit!
Atlanta, im fünften Jahre vor der Rückkehr des fünfundsiebzigjährigen Schweifsterns.«
»Ein Notschrei aus dem ewigen Eis!«, rief Ernst, aufs höchste erstaunt: »Vom Südpol natürlich, da die Kaptaube in dessen Nähe erlegt wurde. Sollte es eine Schiffbrüchige sein?«
»Das ist undenkbar«, entgegnete der Professor: »Es handelt sich, wie wir hören, um ein weibliches Wesen, das sich ganz vereinsamt fühlt. Es scheint ein junges Mädchen zu sein, dem es völlig unbekannt ist, ob überhaupt noch sonst wo Menschen auf Erden leben. Der Südpol muss also wohl ihre Heimat sein, wo sie aufgewachsen ist und die Bewohner am Aussterben oder eher schon ausgestorben sind bis auf diese Eine.«
»Nein! Wie schrecklich!«, sagte der Jüngling teilnahmsvoll. Sein Vater aber fuhr, fort: »Auch die bisher völlig unbekannte Schrift und Sprache beweisen, dass es sich um ein noch nicht entdecktes, in unzugänglichen Gegenden abgeschieden lebendes Volk handeln muss. Daran weist auch der Stoff hin, auf den die Schriftzüge mit unverwüstlicher Farbe gemalt sind, und der von allen uns bekannten Stoffen wesentlich verschieden ist.«
»Höre, Papa!«, rief nun Ernst lebhaft: »Ist das nicht eine ganz merkwürdige Fügung, dass uns diese Botschaft in die Hände gelangt gerade in dem Augenblick, da ich im Begriff bin, die Südpolargegenden aufzusuchen? Vielleicht entdecken wir die Schreiberin und können sie aus ihren Nöten befreien. Ist wohl die Handschrift schon alt?«
»Durchaus nicht! Sie stammt aus diesem Jahre, wie die Zeitbestimmung beweist. Denn mit dem fünfundsiebzigjährigen Schweifstern, der in fünf Jahren wiederkehren soll, kann nur der Halley Komet gemeint sein, der im Jahre 1910 der Erde wieder erscheinen muss. Wir ersehen daraus, dass die Schreiberin einem Volk angehört, das auf einer hohen Bildungsstufe steht, denn seine astronomischen Kenntnisse befähigen es, die Kometenbahnen genau zu berechnen. So weit sind wir selber erst seit zweihundert Jahren gekommen. Zugleich erkennen wir, dass die Schreiberin scharfen Verstand und klare Überlegung besitzt: sie bestimmt nämlich das Jahr nicht nach einer Zeitrechnung, die vielleicht ihrem Volk eigen ist, von der sie jedoch denken muss, sie könne anderen Völkern unbekannt sein, sie wählt vielmehr eine Zeitrechnung, die allgemein gültig ist, und von der sie vermuten durfte, sie müsse von gebildeten Menschen auf der ganzen Erde verstanden werden.«
»Hurra!«, jubelte Ernst: »Diesem klugen Geschöpfe müssen wir Hilfe bringen! Du gibst mir doch das Schreiben mit, Papa?«
»Unter keinen Umständen! Es ist eine so ungewöhnliche und ganz einzigartige Urkunde, dass ihr Verlust unersetzlich wäre. Doch habe ich sie bereits fotografiert, um sie anderen Gelehrten zugänglich zu machen, und du kannst Abzüge von meiner Aufnahme haben, soviel du willst. Auch die Übersetzung kannst du hektografisch vervielfältigen.«
Der Jüngling ließ sich das nicht zweimal sagen: er bat sich drei Abzüge aus und ging dann an die Vervielfältigung der deutschen Verse.
Sowie er mit dieser Arbeit fertig war, begab er sich zu seinem besten Freunde, Georg Werner, der sich lebhaft für die geheimnisvolle Schrift interessierte, und teilte ihm mit, dass die Entzifferung geglückt sei.
Georg war um vier Jahre jünger als Ernst; er zählte achtzehn Jahre und hatte soeben die Reifeprüfung des Gymnasiums bestanden. Er war eine elternlose Waise und lebte im Haus eines Onkels, wo er sich gar nicht wohlfühlte und eine trübe Jugendzeit verbracht hatte. Sein Oheim selber war zwar ein edler, gutherziger Mann, der ihn stets väterlich behandelt hatte; allein die übrigen Hausgenossen ließen es ihn jederzeit empfinden, dass er ein Fremdling in der Familie sei.
Da hatte ihm Ernsts Freundschaft ganz besonders wohlgetan. Die beiden waren trotz des Altersunterschieds ein Herz und eine Seele. Georg war, vielleicht eben wegen seiner Heimatlosigkeit und seinen bitteren Erfahrungen, frühe gereift, und Ernst Frank konnte mit ihm verkehren wie mit einem Altersgenossen.
Nun vernahm der Freund die Deutung des rätselhaften Schriftstücks mit großer Freude und höchstem Staunen.
Die Freunde malten sich die Lage der Schreiberin aus: eine Prinzessin musste es sein; tief unter der Erde in einem mittelalterlichen Burgverlies schmachtend, in einem einsamen Turm mitten im Gletschereis des Südpols. Um den Turm her blühten Gärten und grünten Wälder, durch geheimnisvolle Künste eines weit fortgeschrittenen Volks in den Eiswüsten hervorgezaubert. Vom Gitterfenster ihres Gefängnisses konnte die Königstochter die Pracht schauen und empfand es doppelt schwer, dass ihr das freie Streifen durch Wald und Flur versagt blieb.
Georg ließ sich einen Abzug des Originals und der Übersetzung geben und sagte: »So! Nun will ich die Sprache der verzauberten Prinzessin lernen: ich habe alles, was ich dazu brauche.«
Ernst lachte: »Du bist kühn! Das Alphabet wirst du dir ja so ziemlich einprägen können, da die meisten Buchstaben in dem Schriftstück vorkommen werden, sodass du die fremde Sprache lesen und schreiben lernen magst. Auch eine Reihe von Wörtern und Formen kannst du dir aneignen. Aber weiter in das Verständnis der geheimnisvollen Sprache eindringen zu wollen, wäre ein aussichtsloses Unternehmen: dazu ist der Wortschatz des Zettels denn doch zu gering.«
»Gewiss! Aber einen guten Anfang werde ich gemacht haben, eine ganze Reihe von Ausdrücken innehaben und vieles vom Satzbau und der Formenlehre kennen. Vielleicht finde ich dann späterhin Gelegenheit, meine Kenntnisse zu erweitern und werde dann nur noch auf geringe Schwierigkeiten stoßen. Aber wie beneide ich dich! Du darfst nach dem Südpol reisen und wirst hundert merkwürdige Abenteuer bestehen, vielleicht gar unsere Prinzessin erlösen. Und ich muss daheimbleiben! Nun, ich gönne dir dein Glück von Herzen; aber wenn ich mit könnte! Nicht rasten und ruhen wollte ich, bis ich das Rätsel des Südpols und seiner Bewohner gelöst hätte, Und müsste ich tausend Gefahren und Schrecknisse überwinden!«
Allein für Georg Werner bestand keine Aussicht, dass seine Sehnsucht Befriedigung fände.
2.– Eine seltsame Persönlichkeit
Bald kam der Tag, da Ernst von seinem Vater Abschied nehmen sollte.
Der Professor war kein Mann vieler Worte; dennoch glaubte er, seinem Sohn auf eine so weite und gefahrvolle Reise einige Ratschläge mitgeben zu müssen und schärfte ihm noch besonders ein: »Die größten Gefahren des Aufenthaltes in völliger Abgeschiedenheit, wie sie eine Fahrt in die Polargegenden mit sich bringt, sind die üble Laune und die Langeweile. Letztere ist oft ein Anlass zu ersterer, und dann leiden alle schwer unter den meist kleinlichen Zwistigkeiten, die doppelt verhängnisvoll wirken, wenn sie Menschen entzweien, die so ganz und gar aufeinander angewiesen sind. Man ist in seiner, vielleicht grundlosen Verstimmung gar zu leicht versucht, sich über die anderen zu ärgern, ihnen alles zu missdeuten und übel zu nehmen und wegen der geringfügigsten Ursachen Streit anzufangen.
»Darum sei immer tätig, freundlich, entgegenkommend und dienstbereit, auch wenn es dich Selbstüberwindung kostet. Gibt es nichts zu tun, vielleicht während wochenlang andauernder Schneestürme in der Polarnacht, die den Aufenthalt im Freien verbieten, so schaffe dir eine Arbeit, und auch der geringste Dienst sei dir nie zu schlecht; müssen doch auch alle Knechts- und Magdarbeiten von den Mitgliedern der Expedition verrichtet werden.«
»Vor allem benutze fleißig die guten Bücher, die ich dir mitgab, teils zur Belehrung, teils zur Unterhaltung. Und wenn du bemerkst, dass andere an Langerweile oder gar mürrischem Wesen leiden, so suche sie aufzuheitern, statt dich anstecken zu lassen. Lies dann etwas Anregendes vor oder bitte die Gelehrten der verschiedenen Fächer um Belehrung über dieses und jenes aus ihrer Wissenschaft, selbst wenn dir solche Belehrung nicht nötig erscheint: das stimmt sie immer gut und kann dir von Nutzen sein. Sei recht bescheiden und bilde dir ja nie ein, alles zu wissen: kein Mensch ist widerwärtiger als derjenige, der auf allen Gebieten mitreden und dabei gar alles besser wissen will. Man kann immer und von jedermann etwas Brauchbares lernen, wenn man zu fragen und zu hören versteht, statt immer das große Wort zu führen.
»Vor allem zeige dich gegen den Leiter des Unternehmens, meinen edlen Freund, Baron von Münkhuysen, stets ehrerbietig und vertrauensvoll. Er verdient vollkommenes Vertrauen, und das merke dir, denn er ist ein so außergewöhnlich genialer Mann, dass man von ihm Dinge zu sehen und zu hören bekommt, die einem oft unglaublich erscheinen, sodass man leicht versucht ist, seine Aussagen für zum Mindesten stark übertrieben zu halten. Ich kenne ihn aber, und lege dir ans Herz, ihm stets unbedingt Glauben zu schenken.
»Deine Reise wird, wie ich zuversichtlich hoffe, für dich von größtem Nutzen sein; du wirst viel Neues sehen, zum Teil noch gänzlich Unbekanntes; du wirst lernen, dich auch in den ungewohntesten Lagen zurechtzufinden. Aber auch großen Gefahren gehst du entgegen. Du weißt, ich bin kein Gespensterseher und verstehe es, den Wert eines auch gefährlichen Unternehmens, wenn es nur wertvollen Zwecken dient, vollauf zu schätzen, als ein Mittel zur Stählung des Leibes und des Charakters. Dennoch ließe ich dich nicht ohne Sorge ziehen, wenn ich nicht in Münkhuysens Fähigkeiten, Geistesgegenwart und Findigkeit das größte Vertrauen setzte.«
Mit diesen Worten entließ Professor Frank seinen Sohn.
In Amsterdam angelangt, begab sich Ernst sofort zu Münkhuysen, der einen jener alten, herrlichen Paläste bewohnte, welche an die vergangene Größe der Stadt erinnern.
Ein einfach gekleidetes junges Mädchen von etwa vierzehn Jahren öffnete ihm das Tor. Das Gesichtchen war von einer weit vorstehenden holländischen Haube umrahmt, eine äußerst anmutige und reizvolle Tracht. Von den Ohren und Haaren sah man nichts, bis auf ein paar krause blonde Löckchen, die über die Stirn hervorquollen.
Der Jüngling hielt das Kind für ein kleines Dienstmädchen. Er raffte seine spärlichen Kenntnisse der holländischen Sprache zusammen und redete sie nur so von oben herab an: »Ist Baron von Münkhuysen zu sprechen, Kleine?«
Das Mädchen lachte ihm hell ins Gesicht: »Nein! Wie sonderbar Sie das Holländische sprechen!« erwiderte sie, ebenfalls in ihrer Muttersprache: »Sie sind wohl ein Deutscher?«
Ernsts zweiundzwanzigjähriger Stolz fühlte sich nicht wenig beleidigt: eine freche Kröte das! Wie darf eine einfache Hausmagd sich es herausnehmen, einen jungen Herrn auszulachen? Er zog die Brauen zusammen und entgegnete: »Jawohl, ich bin ein Deutscher, und es kann niemand erwarten, seine Muttersprache von einem Fremden tadellos sprechen zu hören!«
Jetzt überzog eine dunkle Röte das liebliche Gesicht, und die Kleine sagte kleinlaut, diesmal auf Deutsch: »Ach! Es war wohl recht unverschämt von mir, so über Sie zu lachen: Sie sprechen zu komisch und ich lache über jede Kleinigkeit. Wissen Sie, wir Mädchen in Holland lachen gar zu gerne und meinen es gewiss nicht böse. Sie dürfen mir’s nicht übel nehmen und Papa nichts sagen, sonst zankt er. Er meint immer, ich sollte schon viel ernster sein, und ich bin doch noch so jung. Aber sprechen Sie nur Deutsch: mein Papa stammt ja aus Deutschland, und wir sprechen fast immer Deutsch, besonders jetzt, wo so viele fremde Herren im Haus sind, die alle Deutsch reden.«
»O, entschuldigen Sie, Baronesse, Sie sind die Tochter des Hauses?«, fragte Ernst, nun seinerseits beschämt, sie mit „Du“ und als „Kleine“ angeredet zu haben.
Sie kicherte, das Lachen unterdrückend: »Nein! Wie nennen Sie mich jetzt! Baronesse? So heißt mich doch niemand! Ich heiße Eva und Du. Bei uns sagt man zu einem Kind immer „Du“, und ich bin ja noch ein Kind. Wenn Sie nicht ein Fremder wären, würde ich auch so zu Ihnen sagen. Mich dürfen Sie aber nicht „Sie“ nennen, das klingt gar zu sonderbar, da Sie doch soviel größer sind als ich.«
»Nun, meinetwegen! Aber dann musst du eben auch „Ernst“ und „Du“ zu mir sagen. Ich bin dann eben dein Vetter und du bist meine Cousine.«
»Desto besser! Dann bist du wie ein Holländer. Aber was schwatze ich da, anstatt dich hinaufzuführen? Komm nur schnell, Papa schilt sonst.«
Unser Freund folgte der kleinen Eva in das erste Stockwerk. Sie führte ihn in ein großes Zimmer und bat ihn, Platz zu nehmen; sie werde den Papa gleich holen.
Ernst glaubte sich in einem Museum, so viele Merkwürdigkeiten aus aller Herren Ländern waren hier zu sehen, meist ihm ganz unbekannte Dinge. Doch fand er wenig Zeit, sie zu betrachten, denn bald trat ein hochgewachsener Mann von etwa fünfzig Jahren ein. Der edle Ausdruck seiner fein geschnittenen Züge machte sofort den gewinnendsten Eindruck. Zugleich fiel aber auch ein gewisser heiterer Zug auf, der in unaufhörlichem Wechsel um die Mundwinkel spielte.
Ernst brauchte nur seinen Namen zu nennen, um von Münkhuysen auf das herzlichste willkommen geheißen zu werden. Der Baron erkundigte sich lebhaft nach seinem Vater und bedauerte, dass er den Jüngling nicht einladen könne, längere Zeit sein Gast zu sein, da er in den nächsten Tagen schon abreise, um eine Entdeckungsreise nach dem Südpol zu unternehmen.
Ernst sprach nun seine Bitte aus, an der Fahrt teilnehmen zu dürfen, und erzählte, dass sein Vater ihn eben aus diesem Grund hierher geschickt habe. Er war ganz beschämt über die aufrichtige Freude, die Münkhuysen bei dieser Mitteilung bezeugte: wahrhaftig! Er tat, als ob er an dem jungen, unerfahrenen Mann eine wertvolle Errungenschaft mache, und lud ihn ein, im Speisesaal sofort die Bekanntschaft einiger seiner Reisebegleiter zu machen.
Hier fand der junge Gast mehrere Herren verschiedenen Alters und offenbar auch verschiedenen Berufs, zugleich aber auch eine reiche Auswahl auserlesener Speisen, denen er, nach erfolgter Vorstellung seiner unbedeutenden Person, vom Baron freundlich gedrängt, zusprechen musste.
Unter den Anwesenden fiel ihm besonders ein wohlbeleibter Herr auf, dessen rundes Gesicht stets von Heiterkeit strahlte; es zeigte eine unverkennbare Familienähnlichkeit mit Münkhuysen. Der einnehmende Mann wurde als „Kapitän Münchhausen“ angeredet und war ein Vetter des Barons aus Deutschland.
Inzwischen nahm das Gespräch der Anwesenden seinen Fortgang. Man sprach soeben von musikalischen Dingen und zwar von den Klangfarben verschiedener Instrumente, wobei erörtert wurde, welches wohl den Preis als das angenehmste klingende verdiene. Natürlich waren die Meinungen hierüber geteilt, da es sich hierbei nur um persönliche Geschmacksurteile handeln konnte.
Kapitän Münchhausen nahm nun das Wort und erklärte, ihn habe nie eine Musik so sehr angesprochen, wie ein Glockenspiel, das er einst auf einer Schweizeralm im Freien gehört habe.
»Sie scherzen, Kapitän!«, sagte ein junger Professor der Physik, namens Raimund. »Ein Glockenspiel auf einer Schweizeralm! Nein, verzeihen Sie, das klingt doch etwas unglaublich, es sei denn, dass Sie das regellose Durcheinanderklingen der Kuhschellen, das ja für den Naturfreund etwas poetisch Anmutendes hat, für Musik erklären wollten.«
»Kuhschellen waren es in der Tat«, erwiderte der Kapitän lachend; »und dennoch ein vollkommenes Glockenspiel! Lassen Sie sich das Erlebnis erzählen, meine Herren!
»Es war im Sommer 1895, als ich eine Wanderung durch das Berner Oberland unternahm. In ziemlicher Höhe auf einer weltverlorenen Matte traf ich einen Hirten an, der eine Herde von etwa zwei Dutzend Kühen beaufsichtigte. Ich ließ mich mit dem Mann in ein Gespräch ein; denn ich habe immer meine Freude an dem naturwüchsigen Humor und an dem gesunden Urteil, die beide für gewöhnlich bei diesen unverdorbenen Menschenkindern sich Vereinigt finden. Da ich den Mann weder mit Schnitzen noch mit sonst etwas beschäftigt fand, fragte ich ihn unter anderem, mit was er sich eigentlich unterhalte: die Zeit müsse ihm doch oft lang werden.
»Wenn mir’s langweilig werden will, so lasse ich meine Kühe ein Konzert aufführen«, erwiderte er.
»Ha, ha!«, lachte ich, das muss ein schönes Konzert geben! Aber Ihr tut ja ganz, als ob die Kühe es auf Euern Befehl hin erschallen ließen.
»Gewiss tun sie das, und es hat mich weiter gar keine Mühe gekostet, es ihnen beizubringen, denn sie waren schon vorher „gewohnt, auf ihren Namen zu hören. Geben Sie einmal acht!“
»Und nun rief er: „Bläst“! Sofort hob eine der Kühe den Kopf und ihre Schelle erklang dabei klar und laut. Rasch hintereinander rief der Hirte nun teils verschiedene, teils die gleichen Kühe wieder auf, und jedes Mal erklang eine Schelle. Zu meiner größten Verwunderung vernahm ich auf diese Weise den Choral: „Geh aus mein Herz und suche Freud“ in tadellosem Takt und vollkommener Reinheit. Der Hirte hatte die Kuhschellen derart ausgewählt, dass er zwei Oktaven mit sämtlichen Zwischentönen besaß, und nun war es ihm ein leichtes, alle möglichen Weisen durch Ausrufen der Kühe in der richtigen Reihenfolge hervorzuzaubern. Dieses lebendige Glockenspiel gefiel mir so ausnehmend, dass ich mir noch mehrere Stücke vorspielen ließ, und ich kann sagen, nie hat eine Musik einen solchen Zauber auf mich ausgeübt, wie dieses einfache Kuhschellenkonzert; dazu mag freilich zum Teil das Originelle dieser Vorführung beigetragen haben, denn, Sie wissen, ich bin ein ausgesprochener Freund alles Originellen, so wenig ich selber Originalität besitze.«
Was nun das Letztere betraf, so sollte Ernst in der Folge erfahren, dass Kapitän Münchhausen womöglich noch weniger an Originalitätsmangel litt, als der Baron. Für diesmal war er im Zweifel, ob das eigentümliche Glockenspiel wirklich auf einer Tatsache beruhte oder nicht.
Erst später erkannte unser Freund, dass Münchhausen seinem Namen alle Ehre machte und ein Schalk war, der mit ernstester Miene die fabelhaftesten Erlebnisse zu erzählen wusste, nicht um die anderen zu täuschen, sondern um sie mit seiner humorvollen Fantasie zu erheitern.
Man war auf die Musikinstrumente des Altertums zu sprechen gekommen, auf Davids Harfe und noch ältere verschollene Instrumente. Münkhuysen erwähnte, die Hebräer hätten die Musik aus Ägypten mitgebracht und Joseph sei der erste ihres Volkes gewesen, der in Ägypten sich zu einem tüchtigen Musiker herangebildet habe.
Ernst war bei dieser Behauptung anfangs ganz sprachlos; denn er hatte auf der Universität aus Liebhaberei Vorlesungen der verschiedensten Fakultäten belegt, und so auch die alttestamentliche Geschichte nach den neuesten Forschungen gehört und studiert; als er die Sprache wiederfand, sagte er: »Sie können unmöglich im Ernste sprechen, Herr Baron; hat doch die moderne Wissenschaft unwiderleglich nachgewiesen, dass Joseph und die Patriarchen überhaupt nur sagenhafte Gestalten und Versinnbildlichungen von Stammesgruppen und Stammeseigenschaften sind.«
»Sie vergessen, junger Freund«, erwiderte Münkhuysen, »dass die Wissenschaft uns nur Wahrscheinlichkeiten auftischt, niemals aber unumstößliche Wahrheiten. Die Wahrheit deckt sich aber äußerst selten mit der Wahrscheinlichkeit; ja sehr häufig ist gerade das Unwahrscheinlichste das Wahre. Der sogenannte wissenschaftliche Beweis ist im Grunde nichts mehr, als der Versuch, durch scharfsinnige Schlussfolgerungen eine Vermutung einleuchtend zu begründen; die Tatsächlichkeit derselben wirklich sicher zu stellen, ist ihm nicht möglich. Deshalb wechselt die Wissenschaft gleich einem Chamäleon die Farbe, und was heute als erwiesen galt, wird vielleicht schon morgen wieder durch neue Entdeckungen widerlegt. Eigentliche Gewissheit gibt nur die sinnliche Wahrnehmung, die freilich auch noch groben Täuschungen unterworfen sein kann. Meine Behauptung von vorhin gründet sich einfach darauf, dass ich mit eigenen Augen öfters gesehen habe, wie sich Joseph in Ägypten in der Musik übte.«
Nun dachte unser Freund wohl daran, dass ihm sein Vater unbedingtes Vertrauen zu Münkhuysen eingeschärft hatte; allein das war denn doch zu viel! Das neunzehnte Jahrhundert hat ja gewiss Wunder gezeitigt, die unseren Vorfahren märchenhaft erscheinen müssten; wenn es aber einer wagt, einem gebildeten jungen Menschen gegenüber zu behaupten, er habe selber gesehen, wie Joseph in Ägypten Musik trieb, wer wird es diesem jungen Menschen verargen, wenn er sich ernstlich darüber ärgert, dass man sich gestattet, ihm so etwas zu bieten?
Sah ihn denn dieser Münkhuysen für ein Kind oder einen Einfaltspinsel an, der sich jeden Bären aufbinden lässt? Ernst vergaß in seinem Ärger alle Rücksichten und fragte den Baron, ob er etwa mit dem bekannten Freiherrn von Münchhausen blutsverwandt sei?
Münkhuysen erwiderte mit feierlichem Ernst: »Junger Mann, obgleich ich die Meinung Ihrer Frage verstehen must, nehme ich sie Ihnen doch nicht übel. Sie sind im Glauben an unsere moderne Wissenschaft erzogen, die wie die Wissenschaft aller Zeiten, sich für gewissermaßen abgeschlossen hält und alles für unmöglich erklärt, was über ihre gegenwärtigen Erkenntnisse der Möglichkeiten hinausgeht. Zunächst aber die Antwort aus Ihre Frage: mein Großvater hieß Münchhausen; er war ein Deutscher und ließ sich in Amsterdam nieder. Mein Vater nahm, als geborener Niederländer, auf Wunsch der Verwandten meiner Mutter, den Namen Münkhuysen an. Kapitän Münchhausen hier ist der Sohn des deutschen Vetters meines Vaters. Der bekannte Freiherr von Münchhausen ist mein Urgroßvater; er war ein durchaus wahrheitsliebender Mann, hatte aber so außerordentliche Erlebnisse, dass er mit seinen Berichten immer wieder das ungläubige Lächeln, ja die spöttischen Bemerkungen der Übergescheiten herausforderte, die nie über ihre Grenzpfähle hinausgesehen hatten.
»Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass viel gereiste Männer in der Heimat von Leuten mit engem Horizont und geringen Kenntnissen für Schwindler und Aufschneider gehalten werden.
»Ganz die gleiche Erfahrung machte mein Ahnherr, der Freiherr von Münchhausen: seinen wahrheitsgetreuen Erlebnissen wurde kein Glaube geschenkt; dies brachte den humorvollen Mann darauf, seine fantastischen Märchen zu erfinden und, siehe da!, zu seinem Ergötzen machte er die Wahrnehmung, dass eben die Übergescheiten, die seinen tatsächlichen Erlebnissen so misstrauisch begegnet waren, sich des öfteren die größten Bären aufbinden ließen und geneigt waren, die unglaublichsten Geschichten für wahr zu halten.
»Was übrigens die Stammesmythen betrifft, so stellt diese Hypothese die bekannten Tatsachen geradezu auf den Kopf, wie es ja bei wissenschaftlichen Ausheckungen nicht selten ist. Die Geschichte lehrt uns auf Schritt und Tritt, dass hervorragende Persönlichkeiten als Stammväter ihren Namen einem Stamme gaben. Es ist ein geradezu unsinniger Gedanke, der auch durch keine einzige Tatsache gestützt wird, dass umgekehrt aus dem Namen eines Stammes eine Persönlichkeit erdichtet worden sein soll und dieser fabelhaften Persönlichkeit die Schicksale des Stammes angedichtet worden seien. Solch weltfremdes Denken lag den Völkern des Altertums womöglich noch ferner als uns. Eine Völker- oder Stammesgeschichte kannten sie nicht, sondern die Geschichtsschreibung und Überlieferung knüpfte sich immer an hervorragende, führende Persönlichkeiten an. Gerade so gut könnte man fabeln, Karl der Große sei nichts weiter als eine Versinnbildlichung des Stammes der Franken und seine Taten seien eben nur die Taten dieses Stammes, die dem erfundenen Helden angedichtet worden seien!
»Übrigens, Tatsachen beweisen und der Augenschein überzeugt. Was meine Ihnen so unglaublich klingende Bemerkung von vorhin betrifft, so sollen Sie morgen früh mit eigenen Augen sehen, wie Joseph in Ägypten Musik übte.«
Offen gestanden, so einleuchtend Münkhuysens Ausführungen waren, was den letzteren Punkt betraf, glaubte Ernst immer noch, er wolle seinen Scherz mit ihm treiben.
3.– Ein fauler Zauber
Am Nachmittag wurde ein kleiner Ausflug unternommen nach einem Hügel, den Baron von Münkhuysen angekauft hatte, und aus dessen Gipfel er sich ein Landhäuschen hatte erbauen lassen. Zwar erhob sich die Anhöhe kaum dreißig Meter über das Flachland, immerhin aber war sie in dieser ebenen Gegend eine Merkwürdigkeit.
Unterwegs beklagte sich die Gesellschaft, dass in diesem Land von einer richtigen Aussicht keine Rede sein könne; auch von solch einem Maulwurfshügel aus könne man eben höchstens einige Dörfer in nächster Nähe erblicken. Dahinter sei der weitere Ausblick durch Dämme behindert, über die im besten Fall eine Windmühle rage.
»Dennoch sollen sie heute eine richtige Fernsicht genießen«, erklärte Münkhuysen mit geheimnisvollem Lächeln.
Alles war infolgedessen in gespannter Erwartung; denn man war gewohnt, dem Baron unbedingt Glauben zu schenken, und doch konnte sich niemand erklären, woher die versprochene Fernsicht plötzlich kommen solle.
Im Landhaus angelangt, führte der Hauswirt die Gesellschaft sofort in ein rundes, fensterloses Türmchen hinauf, das sein Licht von oben durch eine Glaskuppel empfing, und in dessen Wände ein Kranz von Doppelgläsern, gleich Feldstechern, eingelassen war.
»Schauen Sie einmal durch diese Operngläser«, forderte Münkhuysen seine Gäste auf. Und wahrhaftig! Was erblickten sie? Eine Aussicht, die sich in unabsehbare Fernen dehnte: da sah man entlegene Dörfer und Windmühlen, endlos sich hinziehende Kanäle und erst ganz fern am Horizont die Dämme als kaum sichtbare Streifen.
»Da hört sich doch alle Wissenschaft auf!«, eiferte Professor Schulze, ein Naturforscher aus Berlin: »Wie war es Ihnen nur möglich, Baron, eine solch großartige Fernsicht hierher zu zaubern? Denn dass es sich nicht um ein täuschendes Panorama handeln kann, beweisen die Fuhrwerke, Schiffe und Menschen, die wir in voller Bewegung ihres Weges dahinziehen sehen.«
Während noch alle schauten und staunten, sagte Münkhuysen lachend: »Die Sache ist kindlich einfach: sehen Sie, ich ließ diese Operngläser einfach verkehrt in die zu diesem Zwecke ausgesparten Maueröffnungen einfügen, die großen Gläser vorn, nach innen, und die kleinen nach außen. Das ist der ganze Zauber, der Sie entzückt. Ist es nicht eine merkwürdige Sonderbarkeit von uns Menschenkindern, dass wir auf eine weite Fernsicht so viel Wert legen und uns, um sie genießen zu können, mit dem Erklettern hoher Berge abplagen, oft unter Lebensgefahr? Was ist denn das im Grunde für ein so erstrebenswerter Vorzug, wenn wir von einem himmelhohen Berg so weit in die Welt hinaus sehen, dass wir Wälder und Hügel, Dörfer und Städte kaum mehr zu erkennen vermögen und oft im Zweifel sind, ob ein Kirchturm oder eine Tanne am Horizont emporragt. Wem das ein solcher Genuss ist, der kann ihn sich überall dadurch verschaffen, dass er einfach seinen Feldstecher verkehrt an die Augen hält.
Das Gelächter über diesen verblüffenden Scherz war allgemein; doch musste man, wie immer, dem Baron recht geben; denn die Fernsicht machte tatsächlich einen ebenso großartigen Eindruck, als wenn sie Tatsache gewesen wäre.
Vergnügt kehrten alle wieder in die Stadt zurück, vollbefriedigt, ohne erhebliche Anstrengung einen so erhabenen Aussichtspunkt erklommen zu haben.
So stolz der junge Frank bisher auf seine vielseitigen Kenntnisse gewesen war, musste er sich doch immer mehr eingestehen, dass er bei Münkhuysen so viel Neues lernte, dass der Wahn, als habe er seine Lehrjahre schon hinter sich, rasch verflog. Er fing an, zu merken, dass sie erst jetzt so recht begannen. Das Leben und der lebendige Verkehr mit bedeutenden Männern fügte seiner Hochschulbildung noch vieles Wertvolle hinzu und gab ihr erst den rechten Wert.
Es fanden sich aber auch hier in des Barons Umgebung tüchtige und bewährte Männer der verschiedensten Berufe, Männer der Wissenschaft und der Technik. Es gab kaum einen Gegenstand, der im Laufe der Zeit nicht irgendwie berührt und von allen Seiten beleuchtet worden wäre. Als man einmal von neuen Erfindungen auf dem Gebiete des Kriegswesens redete, bedauerte Münkhuysen, dass der Dowepanzer so kurzerhand abgetan worden sei.
»Mochte er auch für den Soldaten zu schwer sein«, meinte er, »so hätte er doch für Verschanzungen gute Dienste leisten können; ja die Wiedereinführung der Kriegselefanten hätte er ermöglicht: ein mit dem Dowepanzer geschützter Elefant, mit einem Dowepanzerturm, in welchem nur wenige Krieger sich aufhielten, gliche einer unverletzbaren wandelnden Festung, die dem feindlichen Heere unabsehbaren Schaden zufügen könnte. Auch Automobile ließen sich mit dem leichten Panzerstoff überkleiden und so in der Schlacht wirksam verwenden.«
4.– Das Paläoskop
Am meisten beschäftigten sich Ernsts Gedanken mit dem merkwürdigen Versprechen seines Gastherrn, ihm Joseph in Ägypten leibhaftig zu zeigen. Noch am Abend versicherte ihn der Baron, er solle zu sehen bekommen, was sich vor Tausenden von Jahren auf der Erde begeben habe.
Der Jüngling sprach die Vermutung aus, Münkhuysen befinde sich vielleicht im Besitz von Wiedergaben uralten neu entdeckter Steinreliefs, auf denen sich Darstellungen zeigten, die solche Vorkommnisse zum Vorwurf hätten und mit Bestimmtheit zu deuten seien, etwa durch beigefügte Hieroglyphen. Als ihm jedoch der Baron erklärte, er werde ihm die Vorgänge selber zu Gesicht führen, sodass sich alles lebendig vor seinen Augen abspielen werde, konnte Ernst doch wieder nur noch an einen Scherz denken, wie mit den berühmten Ferngläsern, vielleicht bewegliche Lichtspiele mit altertümlich gekleideten Darstellern.
Erwog er anderseits den feierlichen Ernst der Versicherungen Münkhuysens, so konnte er sich sogar des Gedankens nicht erwehren, ob nicht vielleicht des Barons zweifellos geniale Anlagen teilweise schon die Grenzen des gesunden Verstandes überschritten hätten? Nun, das würde er ja bald beurteilen können!
Als Ernst am anderen Morgen das fürstliche Schlafzimmer verließ, das ihm der Hausherr zur Verfügung gestellt hatte, begegnete ihm Professor Raimund, der Physiker, der sich anscheinend auch erst erhoben hatte, denn er sah noch ganz verschlafen aus. Als der junge Mann ihn jedoch fragte, was es wohl mit Münkhuysens Versprechen vom vorhergehenden Tage auf sich habe, da kam Leben und Feuer in den Gelehrten.
»Herr Frank«, sagte er eifrig, »Sie halten ihn natürlich für verrückt? Haben wir alle getan! Denken Sie sich, wir wären den Weisen des achtzehnten Jahrhunderts mit Berichten und Beschreibungen gekommen von Telegrafen, Telefon, Phonografen, Kinematografen; wir hätten ihnen von der Fotografie, den Eisenbahnen, den Röntgenstrahlen und dergleichen vorgeplaudert, — was meinen Sie, hätten die für ein Urteil über den Zustand unseres Gehirns gefällt? Wir natürlich lächeln über den beschränkten Horizont unserer Vorfahren, und dabei zeigen wir die gleiche Beschränktheit wie jene, indem wir noch Tausende von Dingen für unmöglich erklären.
»Nachdem wir gesehen, wie viel geworden ist, das noch vor kurzer Zeit als verrückte Fantasie und reine Unmöglichkeit erklärt worden wäre, sollten wir uns hüten, noch irgendetwas für unmöglich zu halten, da wir nie wissen können, welche ganz neuen Bahnen die Entdeckungen und Erfindungen der Zukunft eröffnen können.
»Was nun Münkhuysen betrifft, so ist sein Geist unserer Zeit weit voran und er hat in der Tat Erfindungen gemacht, an die niemand glauben wird, bis sie allgemein bekannt geworden sind.«
Da sie inzwischen im Speisesaal angekommen waren, wo die anderen Herren schon um den Frühstückstisch versammelt saßen, und ihnen Münkhuysen guten Morgen wünschend, entgegenkam, konnte Ernst nicht weiter fragen.
Er sollte aber bald aus allen Zweifeln in das größte Erstaunen versetzt werden; denn gleich nach dem Morgenimbiss lud ihn sein liebenswürdiger Wirt ein, ihn zu seiner Tagessternwarte zu begleiten. Sie stiegen in den Keller des Hauses hinab und von dort auf einer Wendeltreppe in eine tiefe Grube unter freiem Himmel. Hier sah man die Sterne am hellen Tages.
Münkhuysen zog ein achteckiges Rohr aus der Tasche, ziemlich kurz und dick, und schraubte es auf ein in den Erdboden eingelassenes Gestell fest. Nun begann er durch dieses ganz unbekannte Instrument nach den Sternen zu sehen. Mittels einer kleinen Kurbel stellte er sein Fernrohr ein, das er Paläoskop nannte, weil es, wie er sagte, gestatte, Blicke in uralte, vergangene Zeiten zu tun. Nach wenigen Minuten sagte er: »Jetzt habe ich ihn!«, und ersuchte Ernst, durch das Okular zu schauen.
Ein unwillkürliches »Ah!«, staunender Bewunderung entschlüpfte des Jünglings Lippen: er sah, wie aus der Vogelschau, mitten hinein in eine altägyptische Stadt. Die Sonne neigte sich zum Untergang und beleuchtete die mit bunten Figuren bemalten westlichen Wände der Häuser, alles in rosigen Schimmer tauchend. Überall ragten aus dem Häusermeer die zierlichen Wipfel hoch aufgeschossener Palmen hervor und gaben dem Stadtbild einen besonders malerischen Reiz. Dort erhoben sich majestätische Tempelhallen, deren Dächer von Riesensäulen getragen wurden. Ihre Eingänge waren bewacht von ernsten, gewaltigen Bildnissen sitzender Menschen, deren ungeschlachte Hände auf den Knien ruhten. Hier ragten Paläste von fremdartigen fantastischer und doch märchenschöner Bauart empor.
Die Straßen waren äußerst belebt. Sie wimmelten von Fußgängern und Wagen, die gleich lebendig gewordenen Hieroglyphen durcheinanderwogten. Die bunten Farben der Gewänder und der reich verzierten Brüstungen und Räder der Fuhrwerke verliehen dem Bilde eine Pracht, wie sie unserer Zeit völlig unbekannt ist.
Weiter schweiften Ernsts Augen zum Nilstrom, der langsam an der Stadt dahinglitt, von Handelsschiffen und zierlichen Vergnügungsgondeln belebt. Silbern glänzte das Wasser und die Rosen des Abendhimmels mischten sich darein.
Weiter oben, wo das Ufer still und einsam lag, sah er grünschillernde Krokodile ans Ufer steigen oder gähnend daliegen und das schreckliche Gebiss des ungeheuren Rachens zeigen.
Der junge Mann konnte sich an dem Bilde nicht sattsehen und Münkhuysen störte ihn lange Zeit nicht in seiner Betrachtung; dann aber sagte er: »Nun bitte ich Sie, schauen Sie nach dem Palast in der Mitte der Stadt; er ragt bedeutend über die anderen Gebäude empor.«
»Ich sehe ihn!«
»Dann blicken Sie auf das Dach des etwas niedrigeren, palastähnlichen Hauses, das danebensteht: was sehen Sie da?«
»Ich sehe einen jungen Mann von einnehmenden Gesichtszügen; er ist sehr reich gekleidet und scheint auf einem eigentümlichen Saiteninstrumente zu musizieren. Ein alter ehrwürdiger Priester steht ihm zur Seite und zeigt ihm von Zeit zu Zeit die Handgriffe; zuweilen nickt er zufrieden, zuweilen schüttelt er den Kopf und spricht einige Worte, wobei der andere sein Spiel unterbricht, um hernach wieder fortzufahren. Offenbar gibt der Priester dem vornehmen Jüngling Musikunterricht.«
»Sie haben recht gesehen!«, sagte Münkhuysen feierlich. »Der Jüngling aber heißt Joseph, Sohn Jakobs, des Sohnes Isaaks, des Sohnes Abrahams, zum Trotz aller erhabenen Mythenweisheit!«
»Wie wollen Sie das wissen?«, rief Ernst aus.
»Ich habe seine Lebensgeschichte mit dem Paläoskop verfolgt, sowie die seiner Vorfahren, und fand die Berichte des Alten Testamentes bestätigt; natürlich sah ich noch ungleich mehr, als uns schriftlich überliefert wurde.«
Unser Freund befand sich in einem Sturme der Aufregung; sein Verstand drohte stille zu stehen; er konnte nicht glauben, dass er nicht träume.
Münkhuysen bemerkte das wohl und sagte daher: »Kommen Sie heraus; Sie haben für das erste Mal genug gesehen, ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig.«
Er führte Ernst in den Garten, der in herrlichen Anlagen sich an seinen Palast anschloss. Sie setzten sich in eine schattige Laube, von Blumen umduftet. Der Baron ließ eine Flasche Rheinwein bringen und bot dem Jüngling eine Havanna an, sich gleichzeitig eine solche ansteckend.
»Es ist bekannt«, begann er, »dass das Licht rund dreihunderttausend Kilometer in der Sekunde zurücklegt. Nun gibt es Sterne, die so weit von unserer Erde entfernt sind, dass ihr Licht tausend und noch mehr Jahre gebraucht hat, um bis zu uns zu dringen. Nehmen Sie an, Sie besäßen ein so scharfes Fernrohr, dass es Ihnen möglich wäre, zu beobachten, was auf einem solchen Sterne vorgeht. Dann würden Sie nicht etwa sehen, was heute auf ihm geschieht, sondern was vor etwa tausend Jahren dortselbst geschehen ist. Das Licht trägt die Bilder von allem, was da ist und geschieht, unaufhörlich durch den Raum; die Strahlen werden immer schwächer, weil sie sich auf immer größere Kreise verteilen, aber völlig verschwinden können sie nie oder doch erst in der Unendlichkeit, was etwa auf das gleiche herauskommt.
»Diese Erwägungen machten mich neugierig, die Vorgänge vergangener Jahrtausende auf den entferntesten Welten zu studieren; dazu benötigte ich aber ein Teleskop, gegen welches die größten Fernrohre unserer Zeit, das Lickfernrohr und das der Nizzaer Sternwarte, Zwerge sind. Ich sagte mir, dass in der Herstellung von Teleskopen nach dem bisherigen System ein bedeutender Fortschritt nicht mehr möglich sei. Die Linsen, die gegenwärtig für solche Instrumente geschliffen werden, sind so ungeheuer groß und ihre Herstellung erfordert so viel Zeit, Mühe und ängstliche Sorgfalt, dass man sich denken kann, es möchte noch die doppelte, die vierfache, vielleicht gar die zehnfache Größe mit der Zeit erreicht werden — aber dann muss es ein Ende haben: hundertfach oder gar tausendfach so große Linsen sind einfach undenkbar.
»Ich erkannte daher, dass es nötig sei, einen ganz neuen Weg einzuschlagen, das System der Zusammensetzung der Teleskope aus Linsen aufzugeben und eine völlig neue Methode zu entdecken. Es ist mir denn auch gelungen, dieses so einfache Instrument herzustellen, durch das Sie einen Blick getan haben, und von dessen Wesen ich Ihnen nur so viel verraten will, dass es unter anderem eine Reihe im Kreise angeordneter Prismen enthält. Ich kann sagen, ich habe die Multiplikation der Vergrößerung durch ganz einfache Mittel erfunden, und wo bisher die Entfernung auf ein Fünfhunderttausendstel verringert wurde, wird sie durch mein Instrument noch viele Millionen Mal geringer. Dabei lässt sich mein Instrument so einstellen, dass sowohl nähergelegene als auch weit entferntere Sterne bis auf die Entfernung von etwa hundert Metern nahe gerückt erscheinen; auch lässt das Paläoskop die schwächsten Strahlen in hellem Glanz leuchten. Sie werden begreifen, dass weder der Mars noch ein anderer Planet mehr ein Geheimnis für mich hat; nur die Fülle der Beobachtungen, die ich in der kurzen Zeit gemacht habe, seit ich das Paläoskop erfand, hat mich bisher verhindert, etwas darüber zu veröffentlichen; doch führe ich stets sorgfältig Buch über meine Entdeckungen.«
»Ich begreife nun«, sagte Ernst, »wie Sie, Herr Baron, mittels Ihrer wunderbaren Erfindung die Vorgänge auf den Sternen beobachten können, die sich ins grauer Zeit abgespielt haben; aber das erklärt mir durchaus nicht, wie es auch möglich sein soll, in die Vergangenheit unserer Erde und ihrer Bewohner einen Einblick zu gewinnen.«
»Ja so«, erwiderte Münkhuysen, »das ist freilich wieder etwas anderes. Mittels meines Paläoskops entdeckte ich bald Tausende von Welten, die den Astronomen bisher unsichtbar waren, weil sie kein eigenes Licht besitzen. Auf jeden Fixstern kommt durchschnittlich mindestens ein Dutzend Planeten und Monde, die ihn als ihre Sonne umkreisen. Zum Teil sind das ausgestorbene Welten gleich unserem Monde. Solche Planeten, besonders aber ihre Trabanten, zeigen häufig große spiegelnde Flächen, seien es bewegungslose Wassermassen, seien es Meere von geschmolzenem Metall und dergleichen. Diese Flächen werfen das Bild unserer Erde deutlich zurück.«
»Fasse ich nun einen solchen Spiegel ins Auge, der tausend Lichtjahre von uns entfernt ist (damit will ich sagen, dass das Licht von ihm zu uns und umgekehrt tausend Jahre zu wandern hat), so brauchen die zurückgeworfenen Lichtstrahlen wiederum tausend Jahre, um zu uns zurück zu gelangen. Das Spiegelbild der Erde wird uns also dort den Anblick bieten, den die Erde vor zweitausend Jahren bot. Will ich nun irgendein Begebnis der Vergangenheit sehen, so muss ich ausrechnen, in welcher Entfernung von der Erde das Bild desselben am heutigen Tage sichtbar sein muss, und dann einen spiegelnden Weltkörper aufsuchen, der sich in eben dieser Entfernung befindet, das heißt in der Hälfte der Entfernung, die das Bild in ununterbrochenem Laufe zurückgelegt haben würde. Ein solcher Weltkörper ist unschwer zu finden, da dieselben in unzähligen Mengen in jeder denkbaren Entfernung den Raum erfüllen. Eine wesentliche Erleichterung gewährt der Umstand, dass mein Paläoskop sich genau auf jede Entfernung einstellen lässt, sodass ich nur im Raum einen Planeten zu suchen habe, der deutlich sichtbar erscheint, wenn mein Instrument auf die fragliche Entfernung eingestellt ist. Dennoch geht es selten ohne Suchen und Ausprobieren ab, da die Daten sehr entlegener Ereignisse meist sehr unsicher sind. Habe ich aber gefunden, was ich suche, so kann ich sofort den Zeitpunkt des betreffenden Vorgangs aufs genaueste feststellen. Ich habe mir daher auch eine Zeittafel angelegt, in der ich eine große Anzahl wichtiger Ereignisse vergangener Zeiten nach Jahr, Tag und Stunde eingetragen habe.
»Leider stoße ich öfters auf Hindernisse; es bleibt mir nämlich verborgen, was sich hinter den Mauern der Häuser, unter dem Laubdach der Bäume und an anderen verborgenen Plätzen oder bei mondscheinloser Nacht abspielte. Wenn der Himmel zurzeit des Ereignisses, das ich zu beobachten wünsche, bewölkt war, so ist überhaupt nichts zu sehen. Selbstverständlich ist für mich auch nur die Erdhalbkugel sichtbar, die zur Zeit des Vorgangs dem spiegelnden Sterne zugekehrt war, und wenn mir infolge der Umdrehung der Erde das beobachtete Bild am Horizont des Gesichtskreises entschwindet, so muss ich eben sehen, ob ich es auf einem anderen Sterne wieder auffinde. Glücklicherweise spielte sich das Leben in der Urzeit meistens im Freien und unter einem vorwiegend klaren Himmel ab.
»Übrigens kennen wir ja schon in den Röntgenstrahlen solche Lichtwellen, die das Hindernis von Mauern und Wolken zu durchbrechen vermögen, weshalb ich hoffe, dass ein vervollkommneste Paläoskop seinerzeit gestatten wird, auch durch Mauern und Wolken hindurchzusehen.«
»Herr Baron!«, rief Ernst begeistert aus, »ich bin bekehrt und werde fortan nichts mehr für unmöglich halten.«
5.– Neue Gäste
Die derzeitigen Bewohner des Münkhuysenschen Schlosses waren im Speisesaal versammelt. Es waren dies, außer Ernst Frank, der dicke Kapitän Münchhausen, Professor Heinrich Schulze aus Berlin, Naturwissenschaftler und Forschungsreisender, der namentlich Südamerika und Innerafrika erkundet hatte und sich auch für einen gewaltigen Jäger hielt, der sich auf seine „niefehlende Büchse“ viel zugute tat. Ferner: Professor Raimund, Physiker aus Württemberg, der Arzt Doktor Maibold und der schwedische Ingenieur Holm.
Ernst berichtete soeben dem letzteren begeistert über das, was er durch das Paläoskop geschaut hatte, als der Baron mit zwei neu angekommenen Gästen eintrat, die sich ebenfalls seinem Unternehmen anschließen wollten.
Es war ein junges Ehepaar. Er trug einen blonden, kurz geschnittenen Bart und lange Künstlerlocken. Sein Gesicht hatte einen äußerst freundlichen und dabei bescheidenen, fast schüchternen Ausdruck. Die blühende junge Frau mit dem üppigem hochgetürmten rotgoldenen Haar war eine wirkliche Schönheit, doch nicht von kalter, hoheitsvoller Art, sondern von herzgewinnender Lieblichkeit und Anmut. Vor allem fielen ihre großen, geistvollen, sonnigen Augen auf, die wohl das Anziehendste an ihrer bezaubernden Erscheinung waren.
»Ich habe die Freude, Ihnen hier, zwei liebe Freunde vorstellen zu dürfen«, sagte Münkhuysen beim Eintreten: »Professor Michael Mäusle mit seiner Gattin. Er ist ein hervorragender, vielgereister Philologe und Dichter aus Württemberg.«
»Aus Gschlachtenbretzingen«, ergänzte der Schwabe bescheiden: »Und von hervorragend ist keine Rede.«
Kapitän Münchhausen und Professor Schulze schnellten von ihren Sitzen empor und eilten auf die Ankömmlinge zu, sie mit erstaunten und neugierigen Augen musternd. Dann bestürmten sie den jungen Gelehrten abwechselnd mit ihren Fragen, ohne ihn in ihrem Eifer zum Wort kommen zu lassen.
Schulze begann: »Sind Sie der Mann, der die Löwen mit dem Flintenkolben angreift und mit dem Donner seiner schwäbischen Anrede in feige Flucht jagt?«
Der Kapitän fiel ein: »Sind Sie der Held, der trockenen Fußes die breitesten Ströme überschreitet, indem er lebendige Krokodile als Sprungbrett benutzt?«
Schulze rief wiederum: »Sind Sie es, dem das unbändige Kudu als gefügiges Reittier dienen muss, und der den Löwen, unter dessen Pranken er liegt, mit dem Dolchmesser besiegt?«
Worauf Münchhausen fortfuhr: »Sieht vor unseren staunenden Augen der Herkules, der den stärksten Büffel lebendig bei den Hörnern fängt und den Vogel Strauß bei den starken Beinen packt, sodass der Riesenvogel zu Boden stürzt und seine hilflose Beute wird?«
Gleich kam Schulze wieder an die Reihe: »Erblicken meine begnadeten Augen den gewaltigen Geist, der Mittel ersinnt, die Strauße in ganzen Herden zu fangen, und der noch todwund den Weg aus den Wirrnissen des Urwaldes findet, in dem er sich verirrte, und wo jeder andere Sterbliche zugrunde gegangen wäre?«
Und der Kapitän: »Haben wir vor uns den König aller Schützen, der das Gnu auf kilometerweite Entfernung ins Herz trifft und den unbesiegbaren Hünen, der den Rüssel des Elefanten durchschneidet, von dem er gepackt war?«
Worauf der Professor noch hinzufügte: »Sind Sie es, der im Burenkriege all die Wunder der Tapferkeit verrichtete, die der englischen Übermacht den Sieg aus den Händen zu winden drohten?«
»Aber ich bitte Sie, meine Herren!«, sagte nun Mäusle, als er endlich zu Worte kam: »Ich bin nichts weiter als der Michael Mäusle aus Gschlachtenbretzingen, der allerdings in Afrika einige ungewöhnliche Erlebnisse hatte, ohne jedoch selber irgendwie Hervorragendes geleistet zu haben. Ich kann wirklich nichts dafür, dass meine harmlosen Taten so aufgebauscht wurden.«
»Es ist wirklich der sagenhafte Held, den mit leiblichen Augen zu erblicken ich mir so lange gewünscht habe!«, frohlockte der Dicke. »Gestatten Sie, dass Kapitän Münchhausen Ihnen die wackere Rechte schüttelt.«
»Und auch ich bitte um diese Ehre: ich nenne mich Heinrich Schulze, Professor der Naturwissenschaften.« Und beide schüttelten nacheinander aus Leibeskräften die dargebotene Hand.
Der Schwabe aber fragte: »Sagen Sie mir doch nur, meine verehrten Herren, wie Sie dazu gekommen sind, so viel von meinen bescheidenen Abenteuern zu erfahren.«
»An den Lagerfeuern Afrikas vernahm ich Ihren Ruhm«, erwiderte Münchhausen feierlich: »Hendrik Rijn, Sannah, Mietje und Frans plauderten am liebsten von ihrem heldenmütigen Lehrer.«
Mäusles Gattin stieß einen Schrei der Überraschung aus, während Schulze seinerseits Antwort gab: »Und ich habe schon zuvor in Oranjehos von Ihnen gehört: der alte biedere Piet van Rijn hat mir so manches von Ihren Wunderwerken mitgeteilt.«
»In Oranjehof waren Sie?«, rief nun die junge Frau erregt. »Zog mein Vater zurück nach Transvaal und hat unser altes Heim wieder bezogen?«
»Nein! Piet Rijn lebt mit den Seinigen in Ostafrika, zu Füßen des Runsoro auf seiner neuen Pflanzung, die er, wie die alte, Oranjehof taufte. Aber Ihr Vater kann er unmöglich sein.«
»Wieso?«, entgegnete die Angeredete auf diese Bemerkung des Professors: »Ich bin doch Neeltje, geborene Van Rijn.«
»Da irren Sie sich«, widersprach Schulze hartnäckig: »Neeltje, von der wir freilich auch viel Gutes vernahmen, war allerdings die Braut des berühmten Michael Mäusle, dieses echten deutschen Michels. Allein sie ist mit ihrer Mutter und ihren Schwestern im Hungerlager gestorben. Noch heute wird sie in Oranjehof betrauert.«
»Ich bin’s, ich bin’s! O welche Freude! Nun haben wir doch gewisse Kunde vom Aufenthalt unserer Lieben, nach dem wir so lange vergeblich forschten!«
Der Professor schüttelte den Kopf: »Ich wiederhole es, Sie befinden sich im Irrtum, denn Neeltje starb leider, daran ist gar kein Zweifel, ich habe es aus sicherster Quelle, von ihrem Vater und ihren Geschwistern selber.«
»Mann der Wissenschaft!«, mahnte der Kapitän: »Blamiere dich doch nicht schon wieder. Die junge Dame muss doch schließlich am besten wissen, wer sie ist!«
»In der Tat«, ergriff Mäusle nun wieder das Wort: »Meine liebe Gattin wäre wohl auch im Konzentrationslager zugrunde gegangen, doch gelang es mir noch rechtzeitig, sie heimlich daraus zu befreien und vor dem grässlichen Schicksal zu bewahren.«
»Dann seien Sie mir aufs Herzlichste willkommen!«, rief Schulze, endlich überzeugt, und ergriff die zarte Hand, die er lebhaft schüttelte.
»Und mir desgleichen!«, sagte Münchhausen und folgte des Freundes Beispiel.
»Und Frans lebt?«, fragte Neeltje: »Wir hörten, er sei einer Verwundung erlegen. Und auch Mietje ist noch am Leben?«
»Sie leben beide«, bestätigte der Professor: »Wir waren so glücklich, sie aus schlimmen Lagen zu befreien und sie zu den Ihrigen zurückzuführen, mithilfe des edlen Lords Flitmore, dessen Gattin Mietje jetzt ist.«
»Lord Flitmore!«, rief Frau Mäusle: »O welche Freudenbotschaften wir Ihnen verdanken! Nun können wir die Unsrigen gleich aufsuchen, sobald wir von dieser Reise zurückkehren!«
Alle Anwesenden hatten mit größtem Erstaunen und lebhafter Teilnahme diesem seltsamen Gespräche gelauscht und begrüßten nun ihrerseits die neuen Gäste herzlichst.
Münchhausen und Schulze mussten nun vor allem ihre Erlebnisse auf Oranjehof berichten und erzählen, wie sie Lord Flitmore im Lande der Zwerge getroffen hatten, wobei Hendrik und Sannah, Neeltjes Geschwister, eine so hervorragende Rolle gespielt hatten. Ferner, wie sie mit diesen beiden und dem Lord, Doktor Leusohn und seiner Schwester Helene sowie der kühnen Zwergprinzessin Tipekitanga, Mietje van Rijn in den Mondbergen fanden und schließlich Frans in Ophir befreiten.
Diesen merkwürdigen Abenteuern lauschten alle mit gespanntestem Interesse, vor allem natürlich Mäusle und seine Gattin, die dadurch so vieles Neue und Gute von ihren nächsten Angehörigen erfuhren, und dass sie in Doktor Leusohu, Sannahs Gatten, einen so trefflichen Schwager, in Helene eine so liebe Schwägerin gewonnen hatten, nach deren Hochzeit mit Hendrik.
Noch während des Mittagsmahls und lange darüber hinaus wurden die Berichte fortgesetzt. Zuletzt musste Mäusle erzählen, wie ihm Neeltjes Befreiung gelang, und wie sich der beiden fernere Schicksale gestaltet hatten.
6.– Evas Geheimnis
Der Baron hatte mit den Vorbereitungen zu seiner Reise noch alle Hände voll zu tun. Als daher das Wesentliche zwischen Münchhausen und Schulze einerseits, Mäusle und Neeltje anderseits ausgetauscht war, entschuldigte er sich, dass er seine werten Gäste einige Zeit sich selbst überlassen müsse.
Ernst bat um die Erlaubnis, die herrlichen Parkanlagen näher in Augenschein nehmen zu dürfen.
«Bitte!«, sagte Münkhuysem »Mein Besitztum steht selbstverständlich meinen lieben Gästen zur freien Verfügung; machen Sie nur Entdeckungsreisen nach Ihrem Belieben, und ich hoffe, dass Sie an meinen bescheidenen Anlagen einiges Vergnügen finden.«
Die bescheidenen Anlagen waren eine Redensart. War das Wohngebäude bei aller Einfachheit doch ein Palast, so war der ausgedehnte Park einfach fürstlich. Er dehnte sich eine halbe Stunde weit mit seinen gewundenen Fahrstraßen und lauschigen Fußwegen. Künstliche Hügel, enge Felsschluchten mit schäumenden Bächen, ebenfalls künstlich angelegt machten den Eindruck einer natürlichen Gebirgslandschaft im Kleinen. Prächtige Baumgruppen, schattige Wäldchen wechselten ab mit reich blühenden Blumenbeeten, in denen frische Springbrunnen plätscherten. Geheimnisvolle Tropfsteingrotten führten tief in das Innere der Hügel und ließen sich mittels buntfarbiger elektrischer Glühbirnen nach Belieben feenhaft erleuchten.
Bald hatte der Jüngling einen reizenden See entdeckt, an dessen stillen Ufern sich’s im weichen Rasen unter himmelhohen Bäumen herrlich ruhen und träumen ließ. Hier lagerte sich Ernst und genoss den duftigen Frieden der schweigenden Natur. Zuweilen unterbrach ein leises Säuseln der Wipfel die Stille, auch wohl eine liebliche Vogelstimme. Weit draußen im See lockte eine üppig bewachsene Insel, aus deren Gebüsch ein altersgrauer Turm ragte, zu einer Entdeckungsfahrt, und da der Jüngling einen halb im Schilfe versteckten Kahn am Ufer gewahrte, gedachte er schon, ihn zu lösen und auf den klaren Spiegel hinauszurudern, als er einen leichten Elfenschritt über die Kieswege nahen hörte.
»So, so! Da steckst du?«, rief Evas helle Stimme: »Ich habe alles nach dir ausgesucht. Papa schickt mich, um dir in deiner Verlassenheit Gesellschaft zu leisten, falls dir das nicht lästig ist. Aber pass nur einmal auf! Ich habe etwas ganz Besonderes im Sinn. Ich will dich nämlich in ein Geheimnis einweihen, das ich allein weiß. Nicht einmal der Papa ahnt etwas davon, denn ich bin ganz von selber darauf gekommen. Ja, ja, so dumm bin ich nicht, wie ich aussehe!«
»Und ich soll in dieses tiefe Geheimnis eingeweiht werden?«
»Jawohl, du, — du ganz allein!«
»Das ist ja eine ungeheure Ehre! So viel Vertrauen flöße ich dir also ein?«
»Halt! Zuerst musst du mir feierlich versprechen, dass du keiner Seele ein Sterbenswörtchen davon verrätst. Wenn die Zeit gekommen ist, will ich selber mit meiner Weisheit glänzen können. Und wenn du ein Tagebuch führst, darfst du ja nichts davon hineinschreiben, sonst könnte es jemand zu lesen bekommen, wenn du es einmal herumliegen lässt. Ich habe mich auch gehütet, das Geheimnis meinem Tagebuch anzuvertrauen, denn ich vergesse manchmal, es einzuschließen.«
»Also! Ich gelobe dir heiligstes Schweigen!«
»Gut! So komm nur gleich mit mir.«
Dabei fasste sie ihn bei der Hand und führte ihn dem Haus zu. Unterwegs plauderte sie weiter: »Weißt du, mein Papa geht an den Südpol.«
»Jawohl, und ich gehe mit!«
»Ach! Das ist nett«, sagte sie und klatschte in die Hände: »Ich gehe auch mit.«
»Was?! Du, Kind, willst in die schrecklichen Eiswüsten, und dein Vater gestattet es?«
»Ach, was! Schrecklich? Wo Papa ist, ist es nirgends schrecklich; und meinst du, ich wolle hier sitzen bleiben, wenn andere viele Abenteuer erleben und merkwürdige Dinge sehen? — Und dann bin ich dem Papa sein einziges Kind und sein Liebling, jawohl! Da wird er mich doch nicht allein zu Hause lassen, wenn er so weit fortreift! Nein! Da ist ja überhaupt keine Rede davon!
»Aber jetzt merke einmal auf, Vetter Ernst: Papa ist furchtbar gescheit und auch wohlüberlegt und er denkt beinahe an alles, wo sonst andere nicht dran denken.«
»Das habe ich gemerkt, und ich habe allen Respekt vor ihm.«
»Und siehst du«, triumphierte sie: »An das Allnächstliegende, was ganz selbstverständlich wäre, hat er eben doch nicht gedacht; da habe ich ganz allein dran gedacht und sonst gar niemand!«