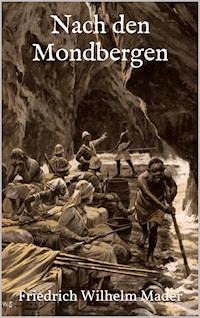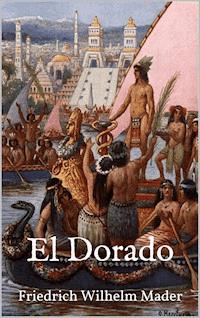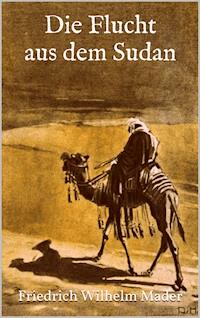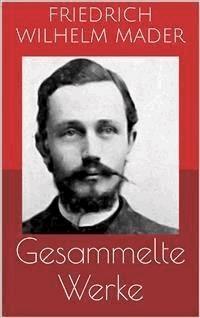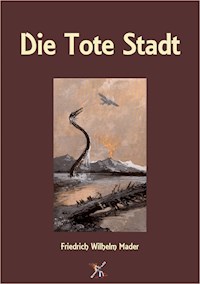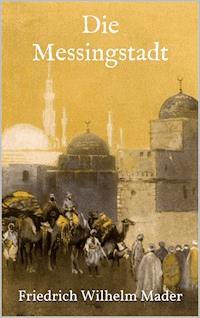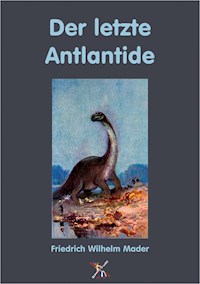
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf dem Festlande des Südpolgebiets, dem sechsten Weltteil unserer Erdkugel, an der Südküste des Weddellmeeres stand ein junger Mann einsam und verlassen vor einer Steinhütte. Der südliche Winter, der in unsere Sommermonate fällt, hüllte die in Eis und Schnee schimmernde Landschaft in Nacht; doch war es kein tiefes Dunkel, das sie umgab, denn der Himmel strahlte in rötlichem Glanz und ergoss einen rosigen Schein über die starren Gefilde. Die seltsame Beleuchtung mochte etwas Unheimliches an sich haben, dem Jüngling aber erschien sie ungemein lieblich, nachdem die letzten Tage ein Schneesturm von besonderer Heftigkeit gewütet und die Finsternis der Polarnacht völlig undurchdringlich gemacht hatte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der letzte Atlantide
Erzählung
Friedrich Wilhelm Mader
Mit farbigen Bildern
von
Karl Mühlmeister
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Impressum
Vorbemerkung
Personen
1.– Im Südlicht
2.– Ein junger Durchbrenner
3.– Das Gespensterschiff
4.– An Bord des Seelöwen
5.– Süd-Georgien
6.– Im Eismeer
7.– Die Pelzrobben
8.– Eine Robbenjagd
9.– Die Sandelholzhändler
10.– John Paton
11.– Die Pinguine
12.– Die See-Elefanten
13.– Ein teuflischer Plan
14.– Ausgesetzt!
15.– Durch die Eiswüste
16.– Eine merkwürdige Überraschung
17.– Sonnenburg
18.– Wunderbare Entdeckungen
19.– Das Paradies
20.– Die Schrecken der Urwelt
21.– Die Tote Stadt
22.– Häusliche Niederlassung
23.– Vor Einbruch der Nacht
24.– Entdeckungsreisen in Polstadt
25.– Jagdabenteuer
26.– Ein nächtlicher Spuk
27.– Licht und Wasser!
28.– Ein seltsames Erlebnis
29.– Die große Landkarte
30.– Das Schauspielhaus
31.– Rätsel über Rätsel
32.– Der verschwundene Kamerad
33.– Die gute Fee
34.– Unheimliche Ereignisse
35.– Im Schoß der Erde
36.– Der geheimnisvolle Greis
37.– Die Atlantiden
38.– Gelöste Rätsel
39.– Atlanta
40.– Ernst Franks Wanderfahrt
41.– Wiederfinden
42.– Evas Rettung
43.– Eine neue Überraschung
44.– Der letzte Atlantide
45.– Der Untergang der Toten Stadt
Quellen und Nachweise
Impressum
Verlag Heliakon
2022 © Verlag Heliakon, München
Umschlaggestaltung: Verlag Heliakon
Bild Cover: Karl Mühlmeister
Herstellung: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
www.verlag-heliakon.de
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Vorbemerkung
Der letzte Atlantide, bildet die Fortsetzung und den Schluß der Erzählung „Die Tote Stadt“. Doch ist darin in aller Kürze alles wiedererzählt, was aus dem ersten Teil zu wissen nötig ist, so dass die Erzählung auch selbständig für sich gelesen werden kann.
Es würde mich freuen, wenn auch dieses Buch sich viele Freunde erwürbe.
Stuttgart 1923
Friedrich Wilhelm Mader
Personen
Georg Werner
Der Schiffszimmermann
Bill Robber, Kapitän des Seelöwen
Richard O’Karney, genannt Dick, ein junger Irländer
Englische Matrosen auf dem Seelöwen
Ernst Frank, ein junger Chemiker
Max Sonnewald, ein junger Hesse
Der letzte König der Atlantiden
Atlanta, seine Urenkelin
Zwerge
Eva von Münkhuysen
Baron von Münkhuysen, ihr Vater
Michael Mäusle, Dichter und Professor aus Württemberg
Neeltje, seine Frau
Professor Raimund
1.– Im Südlicht
Auf dem Festlande des Südpolgebiets, dem sechsten Weltteil unserer Erdkugel, an der Südküste des Weddellmeeres stand ein junger Mann einsam und verlassen vor einer Steinhütte. Der südliche Winter, der in unsere Sommermonate fällt, hüllte die in Eis und Schnee schimmernde Landschaft in Nacht; doch war es kein tiefes Dunkel, das sie umgab, denn der Himmel strahlte in rötlichem Glanz und ergoss einen rosigen Schein über die starren Gefilde. Die seltsame Beleuchtung mochte etwas Unheimliches an sich haben, dem Jüngling aber erschien sie ungemein lieblich, nachdem die letzten Tage ein Schneesturm von besonderer Heftigkeit gewütet und die Finsternis der Polarnacht völlig undurchdringlich gemacht hatte.
Bei dem schneidenden Orkan, der auch die dichte Polarkleidung mit eisiger Schärfe durchdrang, hatte der junge Mann seine Steinhütte nur aus Minuten verlassen, um den nötigen Schnee hereinzuholen, den er zum Kochen und zur Verwandlung in Trinkwasser brauchte. Dann hatte er sich rasch wieder in den Steinbau geflüchtet, der ihm Schutz vor Wind und Kälte gewährte.
Nun war es ihm eine willkommene Erholung, sich wieder ein wenig im Freien ergehen zu können und dabei das entzückende Schauspiel des Südlichts genießen zu dürfen, das ihm längst vertraut war und ihn jedes Mal von Neuem erfreute.
Monatelange Einsamkeit ist nicht leicht zu ertragen, am schwersten in jungen Jahren, und wenn dann noch die lange Polarnacht dazu kommt, kein Sonnenstrahl, keine Tageshelle mehr Abwechslung in die Eintönigkeit des Lebens bringt, da könnte einen wohl Schwermut und Verzagtheit befallen. Glücklicherweise neigte Ernst Frank nicht zu Tiefsinn und Mutlosigkeit. Seine Verbannung war eine freiwillige, und er hatte ein Ziel vor Augen, das ihn immer wieder aufrechterhielt. Freilich galt es, Geduld zu beweisen, solange das nächtliche Dunkel jede Unternehmung zur Erreichung des Zieles hinderte, und da war eine Abwechslung, wie sie das Südlicht in die Einförmigkeit der langsam dahinschleichenden Tage brachte, eine willkommene Erquickung.
Während Ernst sich dem Zauber der märchenhaften Beleuchtung hingab, lenkte plötzlich eine ganz fremdartige Erscheinung seine Blicke empor: drei leuchtende Kugeln schwebten in ungleichem Abstand nebeneinander von Norden daher, langsam und majestätisch, als glitten dort oben drei Luftboote durch die Lüfte, jedes mit einer Papierlaterne versehen. Und doch stimmte der Vergleich mit den kugeligen Leuchten nicht, denn jede der rätselhaften Leuchtkugeln zog einen langen strahlenden Schweif nach sich, gleich einem Kometen. Die mittlere erschien blutrot, die beiden äußeren goldgelb.
Jetzt standen die so herrlichen und doch unheimlichen Lichtgebilde über Ernsts Haupt. Da erfolgte ein dumpfer Knall, wie von einem Sprengschuss und dann ein donnerähnliches Rollen. Die mittlere Kugel zerbarst, während die beiden anderen weiterzogen. Kurz darauf ging ein Steinhagel los: mehrere Brocken klatschten in die Bucht, das Meerwasser schäumend und zischend in gewaltigen Springbrunnen emporschleudernd; die meisten schlugen am Strande ein, wo sie sich in die Erde wühlten, die, mit Schneestaub und Eissplittern vermengt, ebenfalls aufspritzte, als ob sie flüssig wäre.
Ein besonders großer rot glühender Meteoreisenblock fiel ganz in der Nähe des erschrockenen Beobachters nieder und überschüttete ihn mit Schnee, Erde und Eisstücken, so dass er sich rasch in die Hütte zurückzog.
»Da wäre ich ja beinahe von einem himmlischen Steinregen erschlagen worden!«, sprach Ernst vor sich hin, während er die Türe hinter sich schloss und einen Vorhang von Robbenfellen zurückschob, der unmittelbar hinter dem Eingang herabhing, um das Eindringen von Schneewehen zu verhindern.
Dabei fiel ihm eine köstliche Weisheit ein, die er einmal im Briefkasten einer angesehenen wissenschaftlichen Zeitschrift gelesen hatte. Da war einem Anfragenden folgender hochernste Bescheid erteilt worden: »Es ist statistisch festgestellt, dass in jedem Jahrhundert nur ein einziger Mensch durch einen Meteorfall ums Leben kommt. Da im laufenden Jahrhundert dieser eine schon erschlagen wurde, können Sie beruhigt sein, denn in den nächsten neunzig Jahren wird niemand mehr von einem Meteor getroffen werden können.«
Diese Erinnerung weckte ein Lächeln auf Ernsts Lippen: »Welches Glück für mich«, sagte er, »dass der einzige Mensch, der jedes Jahrhundert nach den unumstößlichen Ergebnissen unserer erhabenen Wissenschaft von einem Meteorstein erschlagen werden darf, diesmal schon gleich zu Anfang des Zwanzigsten Jahrhunderts von seinem Schicksal ereilt wurde. Sonst wäre jedenfalls ich es gewesen, der heute daran hätte glauben müssen!«
Das Innere der Hütte war ganz angefüllt mit Kisten, Ballen und aufgestapelten Blechbüchsen. Zwischen diesen Vorräten führte ein schmäler Gang nach hinten, bog dann nach rechts ab, um kurz darauf wieder links weiter zu führen und zuletzt, nochmals nach links sich wendend, auf eine freie Stelle zu münden, die etwa vier Meter im Geviert maß. Die Anordnung des Ganges bewirkte, dass hier in diesem behaglichen Mittelraum auch beim heftigsten Orkan kein Luftzug zu spüren war, zumal hier Kisten und Ballen bis zur Decke aufgebaut waren. In der Mitte des Raums stand ein Ofen, dessen Rohr durch das Dach ins Freie ging.
Auf dem Ofen, der die Kammer, wenn man sie so nennen darf, gemütlich erwärmte, konnte auch gekocht werden. Vor ihm stand ein Tisch, auf dem eine Erdöllampe brannte. Eine leere Kiste diente als Sitzbank und im Hintergrund war, ebenfalls auf leeren Kisten, eine einfache Lagerstatt mit einem Schlafsack bereitet.
Kriechend war der Jüngling aus dem Gang in diesen Mittelraum gelangt; denn auch gegen den Flur zu waren Kisten bis zur Decke aufgebaut, und nur die untersten standen so weit auseinander, dass sie einen niederen Durchgang freiließen, der durch eine eingeschobene genau eingepasste schmale Kiste verschlossen werden konnte. So vermochte die Wärme nicht zu entweichen und kein Luftzug einzudringen, während der Ofen doch für genügende Erneuerung der Luft sorgte.
Nicht immer hatte Ernst Frank so wohlgeborgen hier gelebt. Die Steinhütte war eigentlich nicht als Wohnstätte, sondern lediglich als Vorratshaus erbaut worden, ein sogenanntes Depot. Der Ofen und seine Röhre waren wohl darin vorhanden gewesen, hatten aber erst aufgestellt werden müssen, wobei die Führung des Rohrs durch das Dach einige Schwierigkeiten bot.
Der junge Deutsche hatte an einer Entdeckungsfahrt des Barons von Münkhuysen teilgenommen, die ihr Ziel, die Entdeckung des Südpols, erreichte. Auf der Heimreise war das Vorratshaus am Ufer des Weddellmeers errichtet worden, zum Nutzen späterer Südpolarfahrer, die etwa in Not geraten würden. Während die Reisegesellschaft heimfuhr, war Ernst heimlich zurückgeblieben. Nur notdürftig von einer schweren Verwundung genesen, hatte er vom abfahrenden Schiffe aus die Küste schwimmend gewonnen und sich in seinen nassen Kleidern in der Depothütte versteckt, sodass er, wie er beabsichtigt hatte, nicht aufgefunden werden konnte, als die Kameraden nach ihm suchten. Infolgedessen musste angenommen werden, er sei ertrunken.
Eine weitere Folge jedoch, die der Jüngling durchaus nicht beabsichtigt hatte, trat ein: der längere Aufenthalt in dem frostigen Raum bei völlig durchnässter Kleidung, verursachte einen schweren Fieberrückfall. Wochenlang schwebte der freiwillig Verlassene zwischen Tod und Leben. Kam er zu klarem Bewusstsein, so konnte er nur mühsam aus seinem Schlafsack kriechen, um sich an dem glücklicherweise reichlich vorhandenen Wein und etwas Schiffszwieback zu stärken. Dann zog er sich alsbald wieder fröstelnd in den Schlafsack zurück. Als seine kräftige Natur schließlich das Fieber überwand, machte er eine schlimme Zeit durch: Schneestürme und heftiger Frost traten ein, und manchmal wäre er beinahe in seinem Schlafsack erfroren. Er war noch zu schwach zu irgendwelcher Tätigkeit, konnte sich kaum Bewegung verschaffen, und nur selten fand er die nötige Kraft, sich einen warmen Tee oder Kakao zu bereiten. Auch diese schlimmste Zeit überstand seine gesunde Jugend.
Inzwischen stand jedoch der Polarwinter vor der Tür. Ernsts Kräfte kehrten so langsam zurück, dass er einsah, sein geplantes Unternehmen vor Einbruch der langen Nacht nicht mehr ausführen zu können. Er musste daher zusehen, sich in der Vorratshütte so bequem wie möglich einzurichten, um darin gefahrlos überwintern zu können. Vor allem machte er in der Mitte des Baus einen Raum frei und stellte den Ofen dort auf. Mittels aufgetürmter Kisten konnte er das Dach erreichen und eine Platte abheben, um das Rohr hinauszuleiten. Dann kletterte er von außen auf das Dach und verschloss die Lücke rings um die Röhre mit Steinen. Hernach baute er die Ballen und Kisten im Innern derart auf, dass sie den gewundenen Gang vor der Eingangstür bis zum Mittelraum freiließen.
Eine große Erleichterung für ihn bildete Münkhuysens weise Fürsorglichkeit. Der Baron hatte nämlich Bedacht darauf genommen, dass die Waren nicht etwa nach Arten zusammengepackt worden waren, sodass eine ganze Anzahl Kisten und Ballen hätten geöffnet werden müssen, um das Notwendigste zusammenzubekommen, sondern jeder Behälter enthielt eine Auswahl des Nötigsten. Überdies erleichterten Aufschriften das Auffinden des Gewünschten.
Ernst brauchte nur zwei Ballen und vier Kisten zu öffnen, um alles beieinander zu haben, dessen er bedurfte, und zwar in genügender Menge, um als einzelner monatelang damit auszukommen.
Die erste Kiste mit der Aufschrift „Getränke und Lebensmittel“ hatte er gleich zu Anfang bei beginnendem Fieber aufgemacht. Hammer, Stemmeisen und Beißzange lagen unverpackt bei der Tür. Diese besonders große Kiste enthielt außer einer Menge Schiffszwieback, zwanzig Flaschen Südwein, zehn Flaschen Kognak, mehrere Pfund Tee, Kakao, Kaffee, kondensierte oder eingedickte Milch, Zucker, Salz, Mehl, Eipulver, Backpulver, Schmalz, Büchsenfleisch, Sardinen, Heringe, Sprotten, Schokolade und einiges andere.
Später erbrach der Jüngling noch eine Kiste mit Teigwaren: Nudeln, Makkaroni, Reis, Grieß, Suppentafeln und so weiter; eine zweite mit allerlei eingedünsteten Gemüsen und Früchten und endlich eine dritte, die Erdöl, Weingeist, Spiritus- und Erdölkocher, Erdöllampen, Zündhölzer und Gewehrpatronen enthielt. Es folgte ein Ballen mit Decken, Kissen und Wäsche und einer, der Kämme, Bürsten, Schwämme und Seife in sich vereinigte.
Man sieht, Ernst Frank konnte sich recht üppige und abwechslungsreiche Mahlzeiten herstellen, sobald seine Genesung im Gange war, und das hatte er auch recht nötig, um wieder zu Kräften zu kommen.
Hie und da erlegte er auch einen Seehund oder einen Pinguin und hatte dann frisches Fleisch und Pinguinsuppe für lange Zeit. Da sich dieses Fleisch in gefrorenem Zustand monatelang hält, stapelte er auch einige erbeutete Robben und Vögel für den Winter im Freien auf.
Bei Einbruch der Nacht fühlte er sich wieder ganz gesund. Umso mehr empfand er nun schmerzlich den Mangel an genügender Tätigkeit. Mit der Jagd war es nichts mehr, Spaziergänge im Freien verboten sich meist von selbst. Das tägliche Kochen und die wöchentliche Wäsche boten zwar immer Beschäftigung, aber doch keine, die ganze Tage ausfüllte. Zu flicken gab es selten etwas. Eine Stunde täglich oder auch mehr füllte Ernst, der Gesundheit wegen, mit Dauerläufen durch seinen Gang, Kletterübungen über Kisten und Ballen und anderen turnerischen Kunststücken aus, so oft Finsternis oder Schneestürme die Bewegung im Freien ausschlossen. Trotzdem gab es lange Stunden der Langenweile, die als besonders schädlich für die Gemütsverfassung vermieden werden mussten.
Da kam ihm die Entdeckung einer Bücherkiste sehr zustatten. Hier fand er vortreffliche Werke zur Unterhaltung und Belehrung und konnte nun den letzten Rest von Langerweile endgültig bannen, zumal er auch darauf verfiel, allmählich seine Erlebnisse der letzten Monate niederzuschreiben; denn Tinte, Federn und Papier fand er bei den Büchern verpackt.
Aber warum war der Jüngling hier in freiwilliger Verbannung von aller menschlichen Gesellschaft, warum hatte er seine Gefährten heimlich verlassen, um allein in diesen Eiswüsten zurückzubleiben, wobei er in seiner anfänglichen leidenden Verfassung sein Leben aufs Spiel setzte? Verbitterung und Menschenhass lagen ihm fern, verfeindet hatte er sich mit niemand, ebenso wenig besaß er einen krankhaften Hang zur Einsamkeit, der in so jugendlichem Alter auch kaum denkbar wäre.
Die Gründe seines außergewöhnlichen Entschlusses gingen aus seinen Aufzeichnungen deutlich hervor. Mit Eva, der nunmehr fünfzehnjährigen Tochter des Barons von Münkhuysen war er ganz besonders befreundet. Und dieses sonnige Wesen war am Südpol spurlos verschwunden. Wie dies geschah und was aus der Unglücklichen geworden, blieb rätselhaft und unerklärlich. Man hatte alles nach ihr durchsucht, ohne die geringste Spur zu entdecken, die einen Anhaltspunkt über ihren Verbleib oder ihr Schicksal gewährt hätte. Ernst selber war damals schwer verletzt im Fieber gelegen, und als die Nachforschungen als aussichtslos aufgegeben wurden und man zu der Überzeugung kam, Eva müsse von einem der grässlichen Ungeheuer verschlungen worden sein, die am Südpol hausten, wurde der Jüngling, immer noch fiebernd, zur Küste mitgenommen.
Da er inzwischen wieder einigermaßen genas und fest überzeugt war, seine kleine Freundin müsse noch unter den Lebenden weilen, war er heimlich zurückgeblieben, um die Suche nach ihr wieder aufzunehmen.
Seine Hoffnung gründete sich auf ein ebenfalls noch ungelöstes Rätsel: seinem Vater war auf seltsame Weise ein Schriftstück zugekommen, dessen Entzifferung dem gelehrten Professor gelang. Es war eine Botschaft in Versen, die nach Hilfe und Erlösung aus öder Einsamkeit rief. Die Schreiberin nannte sich Atlanta und bezeichnete den Südpol als ihren Aufenthaltsort.
Nun war am Südpol keine Spur irgendeines lebenden menschlichen Wesens entdeckt worden, und Ernst sagte sich: »Wenn wir Atlanta nicht fanden, die doch zweifellos am Südpol zu finden sein muss, so ist es so gut wie sicher, dass sie sich an einem verborgenen Ort befindet, den wir nicht entdeckten. Und was ist dann wahrscheinlicher, als dass auch Eva in dieses geheimnisvolle Versteck geriet, da so gar keine Spur mehr von ihr zu entdecken war?«
Und so schloss Ernst Frank diese Schilderung seines Tagebuchs mit den Worten: »Meine teure Eva lebt, dessen bin ich gewiss, und zwar lebt sie bei Atlanta, der gefangenen Prinzessin. Beide müssen zu finden sein, und ich will und muss sie beide finden, Atlanta und Eva! Glückauf! Gott wird mir helfen! O Sonne, Sonne, wo weilst du so lang? Komme bald, komme bald, mir zu leuchten auf dem Weg zur Verlorenen!«
2.– Ein junger Durchbrenner
Wir müssen um mehrere Monate zurückgreifen, um die Schicksale eines Freundes von Ernst Frank, des jungen Georg Werner, kennenzulernen.
Wir finden ihn an Bord eines holländischen Seglers auf der Fahrt nach Südafrika.
Es war ein schwüler Sommerabend, wobei nicht zu vergessen ist, dass auf der südlichen Halbkugel der Sommer in unsere nördlichen Wintermonate fällt. Schon war die Dunkelheit eingebrochen und die Schiffslaternen brannten. Das Schiff war der Südspitze des schwarzen Erdteils nahe und hoffte, am kommenden Tage Kapstadt zu erreichen, das Ziel Georg Werners.
Dieser saß an einen Mast gelehnt auf einer Taurolle, neben ihm der Schiffszimmermann, der ein geborener Deutscher war und sich besonders mit ihm angefreundet hatte.
»Morgen sollen wir uns trennen«, sagte der Zimmermann soeben: »Das tut mir leid, denn wir haben uns gut miteinander verstanden. Nun möchte ich aber etwas Näheres über Ihre Schicksale erfahren, und was Sie eigentlich in Kapstadt wollen. Sie mussten doch schwerwiegende Gründe haben, um in Ihrer Jugend die Heimat zu verlassen und in die weite Ferne zu ziehen?«
»Es ist wahr«, erwiderte der Jüngling: »Ich bin Ihnen Mitteilungen schuldig. Bisher ließ ich mich von Ihnen unterhalten, so oft Sie Zeit dazu fanden, und wie viel Wunderbares wussten Sie von Ihren abenteuerlichen Fahrten zu berichten, wie manche schöne Stunde verdanke ich Ihnen, da ich begierig Ihren Schilderungen aus dem Seeleben lauschte. Ich glaube, auf einem Segler erlebt man viel mehr des Merkwürdigen als auf einem Dampfer: schade, dass die Segelfahrten nach und nach ganz aus der Mode kommen und kaum mehr ein Segelschiff gebaut wird. Leider kann ich nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, denn mein Leben verlief bisher ziemlich einförmig und das Erleben spannender Abenteuer soll für mich jetzt erst beginnen, wie ich hoffe. Doch sollen Sie erfahren, wie es mir bis heute ergangen ist.
»Eltern und Geschwister habe ich nicht. Drei Jahre zählte ich, als mein Vater starb, meine Mutter hatte ich schon früher verloren. Mein Onkel hat sich zwar meiner väterlich angenommen, aber seine Frau ist mir nie eine Mutter geworden. Ich habe eine traurige Jugendzeit verlebt. Außer meinem Onkel, einem durchaus edlen Manne, mochte mich niemand im Haus leiden; er aber war durch seine Lehrtätigkeit als Professor und durch seine wissenschaftlichen Arbeiten so viel in Anspruch genommen, dass er sich wenig um mich bekümmern konnte.
»Ich hatte ein stilles verschlossenes Wesen von Kindheit auf: das kam wohl daher, dass ich keine teilnehmende Seele fand, der ich mich anvertrauen konnte. Diese Verschlossenheit, die für heimtückisch galt, machte mich den Hausgenossen noch mehr verhasst. Meine Pflegeschwestern neckten und verspotteten mich unaufhörlich; auch unter ihrem Zorn hatte ich viel zu leiden. War ich ihnen nicht in allen Stücken zu Willen, so lockte ihr Schreien und Heulen sofort meine Tante herbei, und ich wurde bestraft, ohne dass der Fall auch nur untersucht worden wäre. Ich hatte auch meinen Stolz und mein kindliches Rechtsgefühl: solche Strafen empörten mich und machten mich nicht geneigter, den gehorsamen Diener meiner Cousinen abzugeben. Allein ich war ihnen gegenüber vollständig macht- und rechtlos: wo etwas im Haus verübt wurde, musste ich der Täter sein und meine Unschuldsbeteuerungen wurden stets für Lügen gehalten, da man den boshaften Fräulein blinden Glauben schenkte; so gewöhnte ich mir allen Inquisitionsfragen gegenüber ein verbissenes Schweigen an, das erst recht als Schuldbewusstsein ausgelegt wurde.
»Es kam in der Tat so weit, dass ich mich oft selbst für den Übeltäter hielt, der alles angestellt haben musste; dann aber bäumte sich das Gefühl meiner Unschuld mit umso größerer Bitterkeit in mir auf. Ich war zu stolz um vor meinen Verwandten Tränen zu vergießen, die mir nur Spott eingetragen hätten; aber wie oft habe ich mich nach der Nacht gesehnt, da ich mich ungesehen in Schlaf weinen konnte!«
»Armer Kamerad!«, bemerkte mitleidig der Zimmermann als der jugendliche Erzähler erregt innehielt: »Sie haben schon frühe Schweres durchgemacht: ich weiß es, leichter erträgt ein Mann gewaltige Schicksalsschläge, als ein gemütvolles Kind Lieblosigkeit und ungerechte Kränkungen. Ich habe einen Räuber eine schwere Zuchthauskette schleppen sehen, weil er einem reichen Kaufmann eine Geldkatze gewaltsam abgenommen hatte, und ein andermal sah ich einen rohen Burschen einem armen Kind sein Butterbrot entreißen: die Umstehenden lachten über das herzzerreißende Schreien des hungrigen Kindes, es war für sie ein spaßhaftes Schauspiel, und sie fanden es komisch, dass das Kind sich diese Kleinigkeit so zu Herzen nahm. Noch mehr spotteten sie über mich, weil ich das Kind tröstete und ihm etwas schenkte. Ich aber musste denken, der Kerl, der das Kind so herzlos betrübte, ist zehnmal schlechter, als jener Räuber, wenngleich die irdische Gerechtigkeit das hilflose Kind nicht in Schutz nimmt, wie den reichen Kaufmann.«
»Sie sprechen wahr, und haben recht gehandelt: auch ich kann an einem weinenden Kind nicht vorübergehen, ohne mich nach der Ursache seines Schmerzes zu erkundigen. Ich weiß, sein kleiner Schmerz tut seinem weichen Herzen viel weher, als den selbstsüchtigen Erwachsenen ihre großen Schmerzen, und meist kann man so leicht die Tränen eines Kindes trocknen — aber wer denkt daran, wer beachtet sie? Ich habe mir geschworen, und wenn ich hundert Jahre alt werden sollte, — niemals will ich meine Wünsche und Hoffnungen, meine Pläne und Unternehmungen, meine Sorgen und Schmerzen so sehr überschätzen, dass ich darüber versucht würde, die Angelegenheiten eines Kindes zu verachten.
»Doch um in meiner eigenen einfachen Geschichte fortzufahren: als ich in die Schule kam, wurde mein Los etwas erträglicher; die Zeit, die ich außerhalb des Hauses zubrachte, zum Teil auch diejenige, die ich meinen Hausaufgaben widmen musste, entzog mich den tausenderlei Quälereien; auch hatte ich Lust zum Lernen und einige Gaben, sodass mein Onkel sich meiner Fortschritte und guten Zeugnisse freute, und mich mehr als bisher in Schutz nahm. Immerhin fand sich noch Gelegenheit genug für die Tante und die Cousinen, mir das Leben zu verbittern, sodass ich im Gegensatz zu meinen Schulkameraden nichts mehr fürchtete, als die Ferien, und mich auf die Schulzeit stets herzlich freute.
»Sie werden nun begreifen, dass schon seit meinen Kinderjahren die größte Sehnsucht meines Herzens war, nur fort zu kommen, weit fort aus den Verhältnissen und der ganzen Umgebung, wo ich so Qualvolles erduldete. Gewiss! Unser herrliches deutsches Vaterland hat von den Alpen bis zum Meer landschaftliche Reize, die ihresgleichen suchen. Meine engere Heimat freilich ist eine öde Heide, die spottweise des Römischen Reiches Streusandbüchse genannt wird. Dennoch hat sie ihre eigentümlichen Schönheiten und geheimnisvollen Wunder, die ein Herz wohl fesseln können, das eine goldene Jugendzeit darin genossen. — Aber ich? Ich sehnte mich hinaus mit allen Fibern meiner Seele; und ob die Gegend ein Paradies gewesen wäre, ich hätte nur hinweggestrebt von der Stätte einer verbitterten Kindheit. Doch langsam schlichen die Jahre dahin: eine heimliche Flucht? Ich dachte auch daran, doch so etwas führt sich schwer aus und ist auch in unserer Zeit für einen unreifen Knaben beinahe aussichtslos. Ich hoffte daher hauptsächlich auf die Zeit, da ich nach beendigter Schulzeit die Hochschule beziehen könnte. Freilich zog meine Sehnsucht mich auch in weite Fernen: ich kannte kein lieberes Studium als Geschichte und Geografie, keine reizendere Lektüre als Reisebeschreibungen und Erzählungen abenteuerlicher Fahrten in fremde Länder. Ich wollte sie schauen, die Stätten, wo stolze Ruinen an die Größe der alten Römer und Griechen erinnern, wo Denkmäler von märchenhaften Größenverhältnissen von der Macht der Ägypter und Assyrer zeugen; das geheimnisvolle Indien, das wunderliche China, das Schneehaupt des Fujiyama, das auf ein so merkwürdiges Land und Volk herabblickt; die Wunder Amerikas und Australiens und nicht zuletzt auch die afrikanische Tropenwelt, sie reizten meine Fantasie und waren das eigentliche Ziel meiner Träume.
»Doch von Träumen zum Schauen — das merkte ich immer mehr — war ein gewaltiger Schritt! Allein, was denkt die Jugend an Hindernisse, wenn ihr Geist auf den Flügeln der Hoffnung der Zukunft ungemessene Räume durchfliegt!
»Mein Vater hatte mir nur ein kleines Vermögen hinterlassen, das nicht ausreichen konnte, die Kosten meines Studiums zu bestreiten; der gute Onkel war nun zwar entschlossen gewesen, mich auf seine Kosten studieren zu lassen; allein meine Tante wusste es in heftigem Kampf durchzusehen, dass ich den Kaufmannsberuf ergreifen sollte. Diesen Sommer bestand ich mit Glanz meine Reifeprüfung. Und nun, ich bitte Sie! Mit siebzehn Jahren und Gymnasialbildung sollte ich noch als Lehrling in ein Geschäft treten, Kunden bedienen und mich schlecht behandeln lassen? Was mir aber der unerträglichste Gedanke war, ich wäre in absehbarer Zeit nicht aus dem Haus und den Verhältnissen herausgekommen, aus denen ich mich so heiß hinaussehnte.
»Vielleicht hätte ich doch noch studieren dürfen, wenn ich meinen Onkel dringend darum gebeten hätte. Aber betteln mochte ich nicht, da ich doch zum Studium fremden Geldes bedurft hätte. Dagegen schlug mir mein Onkel selber vor, nach den Anstrengungen der Vorbereitung der letzten Monate und der Prüfung selber, eine vierwöchige Erholungsreise nach Paris zu machen, wo er Bekannte besaß. Er meinte, das würde mich für den kaufmännischen Beruf gut vorbereiten und namentlich meine Kenntnisse im Französischen vervollkommnen. Das Reisegeld bemaß er mir reichlich aus meinem väterlichen Erbe.
»Nun war mein Plan gefasst: ich habe einen Vetter in Kapstadt; zu dem wollte ich mich begeben. Hier reichte meine Barschaft, wenn auch knapp. Ich fuhr also nach Vlissingen, statt nach Paris und war froh, dass mich Euer Kapitän als Passagier aufnahm, da die Reise auf dem Segelschiff bedeutend billiger kam, als auf einem Dampfschiff.«
»Wird sich aber Ihr Vetter auch Ihrer annehmen?«, fragte der Zimmermann.
»Gewiss! Er hat mich sogar eingeladen, zu ihm zu kommen: er wolle für meine Ausbildung und mein Fortkommen sorgen. Davon wollte jedoch mein Onkel vorerst nichts wissen. Er meinte, in Deutschland sei die Ausbildung gründlicher, und in zwei Jahren sei es noch Zeit genug, an die Reise nach Afrika zu denken. Darum entschloss ich mich, durchzubrennen. Wenn ich schon einmal Kaufmann werden soll, so will ich wenigstens dabei fremde, interessante Länder kennenzulernen. Übrigens würde ich lieber gleich weiter zum Südpol reisen, statt an das Kap.«
»An den Südpol?«, rief der Zimmermann erstaunt: »Das ist doch nicht Ihr Ernst!«
»Doch, doch!«, beteuerte Georg: »Sehen Sie, der Vater meines Freundes Ernst Frank, ein berühmter Professor, erhielt vor etwa einem Jahr ein rätselhaftes Schriftstück. Es war in den Schwanzfedern einer Kaptaube gefunden worden, die ein Bekannter von ihm in Süd-Georgien schoss. Es gelang ihm, die fremdartige Schrift zu entziffern und zu übersetzen. Ich habe eine fotografische Wiedergabe und eine Abschrift der Übersetzung bei mir.«
Georg holte beides aus seiner Brieftasche hervor, zeigte es dem Freunde und las ihm dann die Übertragung vor:
Im Land umgürtet vom ewigen Eis,
Wo die Sonne sechs Monden den goldenen Kreis
Am Himmel hinführt, — welch ein trauriges Los
Erduldet Atlanta im Erdenschoß!
Sind Menschen noch sonst auf der Erde Rund,
O Taube, so tue doch du ihnen kund,
Dass hier im Gefängnis von ewigem Eis
Nach Menschen sich sehnt eine Seele so heiß!
Wohl blühen die Fluren dort oben im Licht,
Doch trösten die Blüten die Einsame nicht;
Wohl wimmeln die Wälder von grausem Getier,
Doch grüßet kein Mensch, keine Jugend mich hier.
Rings starret von ragenden Gletschern die Wand:
Wagt keiner die Fahrt ins verschlossene Land?
O! Leben noch Menschen auf Erden so weit —
Ich rufe euch, dass ihr Atlanta befreit!
Atlanta, im fünften Jahre vor der Wiederkehr des fünfundsiebzigjährigen Schweifsterns.«
»Das bedeutet so viel wie 1905«, erläuterte Georg, nachdem er zu Ende gelesen hatte.
Der Seemann lachte, dass sein Schnurrbart wackelte: »Da haben Sie sich aber einen schönen Bären aufbinden lassen, junger Freund! Und Sie glauben wirklich an diese märchenhafte Taubenpost vom Südpol?«
»Die Sache ist ernst und erleidet keinen Zweifel«, erwiderte Werner etwas gekränkt über solch unangebrachte Heiterkeit: »Wie gesagt, ist die Nachricht in einer bisher völlig unbekannten Sprache und Schrift geschrieben, wie sie in keinem bisher bekannten Land der Erde vorkommen, also sicher nur am Südpol üblich sein können. Die Entzifferung bot natürlich die größten Schwierigkeiten, die jedoch von Professor Frank überwunden wurden. Es steht hienach fest, dass eine gefangene Prinzessin, namens Atlanta, am Südpol schmachtet und nach Hilfe ruft. Die möchte ich gerne erlösen. Inzwischen hat mein Freund, Ernst Frank, eine Entdeckungsreise nach dem Südpol mitmachen dürfen, auf der er sich zurzeit noch befindet. Vielleicht weilt er gerade jetzt am Pol und hat Atlanta aufgefunden und befreit.«
Der Zimmermann schüttelte den Kopf: er glaubte an den fliegenden Holländer, an den Klabautermann und an alles mögliche, an eine Prinzessin am eisigen Südpol zu glauben, überstieg jedoch seine Leichtgläubigkeit. Für ihn war diese Sache der Scherz irgendeines Witzbolds, dem nur ein junger Träumer Glauben schenken konnte. Und das waren nun die Leute, die auf ihre Gymnasialbildung stolz waren, und sich doch die vernunftwidrigsten Fabeln aufschwatzen ließen, auf die ein einfacher aber hellköpfiger und welterfahrener Seemann niemals hereinfallen konnte!
3.– Das Gespensterschiff
Die beiden verharrten eine Zeit lang schweigend. Georg hatte sich wieder auf die Taurolle niedergelassen; denn, um die Verse vorlesen zu können, hatte er sich erhoben und das Blatt der am Mast hängenden Schiffslaterne näher gebracht.
Plötzlich schreckte ganz unvermittelt ein außergewöhnlich heftiger Windstoß die Sinnenden aus ihrer Ruhe.
»Das bedeutet nichts Gutes!«, rief der Zimmermann aufspringend: »Ein Sturm, der so ohne alle Vorzeichen einsetzt, ist in diesen Breiten etwas äußerst Bedenkliches. Und wir stehen noch dazu unter vollen Segeln. Leider haben wir einen blutjungen, unerfahrenen Kapitän, der seiner Aufgabe gar nicht gewachsen ist. Ohne Begünstigung hätte er seine Prüfung unmöglich bestanden und wäre ihm ein so verantwortungsvoller Posten nicht anvertraut worden. Vor allem fehlt es ihm an der nötigen Umsicht: die einfachsten Vorsichtsmaßregeln lässt er außer acht. Und wie der Herr, so der Diener: ist der Kapitän leichtsinnig, so wird die Mannschaft nachlässig. Sehen Sie! Die Bordwache schläft und selbst der Steuermann scheint zu träumen. Nein! Solche Sorglosigkeit und Pflichtvergessenheit! Das kann ja recht werden!«
Indessen hatte der Orkan schon mit voller Kraft eingesetzt. Es donnerte und fahle Blitze erhellten die Nacht. Zugleich stiegen die schaumgekrönten Wellen immer höher.
Georg entsann sich, einmal gelesen zu haben, haushohe Wellen gebe es gar nicht: dieser Ausdruck bedeute eine Übertreibung. Man habe über zwölf Meter hohe Wellen gemessen, noch nie aber haushohe. Der weltfremde Gelehrte, der sich so ausließ, ahnte ja gewiss nicht, dass er einen baren Unsinn behauptete, da Bauwerke von zwölf Meter Höhe nicht einmal zu den kleinsten Häusern gehören, sondern schon ganz stattliche genannt werden dürfen. Somit ist es durchaus keine Übertreibung, wenn man solche Wellen haushoch nennt. Aber die zufällig gemessenen Wogen gehörten gewiss nicht zu den höchsten, und der Jüngling schätzte diejenigen, die er jetzt zu sehen bekam, auf wohl zwanzig Meter.
Der Aufruhr der Elemente hatte den jungen, leichtfertigen Kapitän an Deck getrieben, zugleich auch die ganze Mannschaft. Der Befehl Alle Mann an Deck, der überdies das Heulen des Sturmes kaum übertönte, kam also zu spät. Leider aber kam auch die zweite Weisung, die Segel zu reffen, viel zu spät, wenn sie überhaupt noch auszuführen gewesen wäre. Die Bö knickte den Fockmast und das Schiff legte sich unter seiner Last zur Seite, sodass die Wellen einen Teil des Decks fegten.
Schleunigst wurden die Taue durchschnitten und der Mast gekappt und über Bord befördert, sodass sich das Schiff wieder aufrichtete. Aber es standen noch Segel genug, wenn auch einige schon in Fetzen flatterten. Das Schiff flog wie ein Pfeil über die aufgewühlte See.
Die Blitze folgten einander so rasch, oft mehrere gleichzeitig, dass es fast andauernd hell war: eine unheimliche Beleuchtung.
»Das Gespensterschiff!«, schrie ein Matrose, und wies schreckensbleich nach Südosten.
»Wahrhaftig! Das Gespensterschiff!« wiederholte ein anderer: »Nun sind wir unrettbar verloren!«
Georg sah nicht ferne ein weiß leuchtendes Schiff mit zwei kurzen, sonderbar gestalteten Masten hoch aus der Flut ragen. Segel besaß es keine und schien unbeweglich in den rasenden Wassern zu stehen. Die Wogen schäumten hoch an seinen Flanken empor, ohne es auch nur zum Schwanken zu bringen. An Deck erblickte man einige dunkle Gestalten von verschiedener Größe: einige schienen wahre Riesen zu sein.
Unter den Matrosen aller Länder war die Kunde von diesem Geisterschiff verbreitet, dessen Anblick sicheren Untergang bedeute, und niemand wusste, wieso man Nachrichten darüber haben könne, wenn doch keiner, der es erblickt hatte, mit dem Leben davongekommen sein sollte.
Während noch alles nach der grausigen Erscheinung hinstarrte, auf welche das Schiff zuschoss, ging der Hauptmast über Bord. Rasch wurde auch er gekappt mit allem, was drum und dran hing. In diesem Augenblick überflutete eine Sturzsee das tief geneigte Deck und spülte Georg hinab in die kochenden Fluten.
Der übliche Ruf Mann über Bord erscholl nicht. Wer konnte auch in der Verwirrung, dem Wasserschwall und der unsicheren Beleuchtung durch die Blitze das Unglück bemerkt haben? Vielleicht war der junge Werner nicht der einzige, den die Woge mit fortgerissen hatte.
Prustend tauchte er auf. Er war ein guter Schwimmer, doch im Kampf mit den sich überstürzenden Brechseen hatte er keine Hoffnung, sich längere Zeit über Wasser halten zu können: er machte sich auf den Untergang gefasst.
Da griff seine Hand in ein Gewirr von Tauwerk, Spieren und Segelfetzen. Bei festem Zupacken merkte er, dass dies alles irgendwo fest hing, und das konnte nirgends anders sein, als an dem zuletzt gekappten Hauptmast. Die Blitze zeigten ihm auch den dicken treibenden Baum, den er mit Hilfe der Taue bald erreichte. So gut es ging, band er sich in den Rahen fest und schaute dann nach dem Schiff aus. Er sah gerade, wie es auf das Gespensterschiff auffuhr und daran zerschellte. Die Trümmer sanken zurück in die Fluten, das Geisterschiff ragte starr und unerschüttert empor, wie bisher.
Georg erkannte hieraus, dass es sich um eine eigentümliche Felsbildung handeln müsse, deren Gestaltung ein Schiff vortäuschte.
Ob wohl von der gescheiterten Mannschaft einer oder der andere mit dem Leben davonkam? Der Anprall war so fürchterlich, dass dies kaum zu hoffen schien. Vielleicht war es Georgs Rettung gewesen, dass er schon zuvor von Deck gerissen wurde. Aber war er denn gerettet? Er trieb ja noch in den wütenden Gewässern. Wie lange er aushalten könne und ob ein Schiff ihn auffinden und aufnehmen werde, das waren Fragen, die er nicht hätte beantworten können, wenn er sie sich überhaupt zurzeit vorgelegt hätte.
Nach einigen Stunden ließ der Sturm nach. Die See beruhigte sich. Der Schiffbrüchige jedoch merkte nichts mehr davon: Infolge der Erschöpfung und des vielen Salzwassers, das er hatte schlucken müssen, war ihm die Besinnung geschwunden.
4.– An Bord des Seelöwen
Hallo! Dick, wirf den Kerl wieder ins Wasser; du kriegst ihn doch nicht mehr lebendig — und wenn auch! Was fangen wir mit solch einem seinen Passagier an?« Es war ein struppiger, stämmiger Mann von etwa fünfzig Jahren, mit brandrotem Haar und Vollbart, der in dieser rohen Weise einen jungen Matrosen anrief, welcher, auf dem Verdeck kniend, eifrige Wiederbelebungsversuche an einem Jüngling anstellte, der offenbar erst vor Kurzem aus den Wellen gezogen worden war.
»Kapitän«, erwiderte der Angeredete, »der Schiffbrüchige lebt: ich spüre schon den wiederkehrenden Hauch des Lebens; auch fängt der Puls wieder an zu schlagen.«
»Nun, meinetwegen! Sieh zu, ob du ihn wieder munter kriegst; aber du musst an Bord für ihn sorgen und ihn pflegen; ich habe keine Lust, auf meine alten Tage die barmherzige Schwester zu spielen«, sagte der Kapitän mit höhnischem Lachen, indem er sich entfernte.
Dick fuhr, ohne ein Wort zu erwidern, in seinem Samariterwerk fort, und hatte die Freude, nach kurzer Zeit seine Bemühungen von Erfolg gekrönt zu sehen: Der Ohnmächtige kam langsam zu sich und schlug die Augen auf.
»Wo bin ich?«, lispelte er.
»An Bord des Seelöwen«, sagte Dick freundlich: »aber nur still! Du brauchst Ruhe und Pflege: ich will dich in meine Koje bringen und dir einen Grog bereiten.« Mit diesen Worten hob der kräftige Jüngling den Wiedererwachten auf und trug ihn in die Kajüte hinab, wo selbst er ihn in seine Hängematte bettete. Dann eilte er, den warmen Trank zu bereiten.
Sein Schützling erholte sich inzwischen wesentlich, und nachdem er sich durch den Grog erwärmt und gestärkt hatte, konnte er das Nähere über seine Rettung von Dick erfahren und diesem seinerseits mitteilen, dass er ein Deutscher Namens Georg Werner sei, und dass ihn auf der Reise nach Kapstadt bei dem heftigen Sturm, der vor Kurzem noch gewütet hatte, eine Sturzsee über Deck gespült habe.
Dick erlaubte ihm jedoch nicht, viel zu sprechen, und bald umfing ein erquickender Schlaf den Ermatteten.
Anderen Tag konnte Georg bereits, in warme Decken gehüllt, aus dem Verdeck sich sonnen; der Sturm hatte sich völlig gelegt und das Wetter war klar und mild; dennoch war die Temperatur ziemlich niedrig, da das Schiff sich in rascher Fahrt nach Südwesten der Polarregion näherte.
Ungestört konnte der junge Deutsche seinen Gedanken nachhängen und seine Beobachtungen anstellen; letztere waren für ihn wenig erfreulich. Er bemerkte, dass die Matrosen und besonders der Kapitän ein selbst für raue Seeleute ungewöhnlich rohes Wesen zeigten: nie hatte er solch wildes Fluchen gehört, noch eine solche Anzahl durchweg finsterer, fast unheimlicher Gestalten auf so engem Raum beieinander gesehen. Dick allein, mit seinem ehrlichen, gutmütigen Gesicht, machte eine Ausnahme.
Eben kam er daher, setzte sich neben Georg auf ein zusammengerolltes Tau und erkundigte sich nach des Freundes Befinden. »Ein Stündchen werde ich mich nun dir widmen können«, fuhr er fort, nachdem ihm Georg eine befriedigende Antwort gegeben; »es gibt gerade wenig zu tun.«
»Höre einmal, Dick«, nahm nun Georg das Wort, »was betreibt eigentlich dein Kapitän für ein Gewerbe? Seiner Art und seinem Aussehen nach könnte man ihn für einen Seeräuber halten; dazu passen auch die übrigen Matrosen: nur du bist von anderem Schlag — wie kommst du denn in solch eine Umgebung?«
»Du hast recht! Die Gesellschaft ist durchaus nicht nach meinem Herzen: wir gehen auf den Robbenschlag aus, und das ist ein grausames Geschäft, das die Herzen verhärtet. Gefühlsmenschen sind wir Seeleute ja alle nicht, und ich bin eine echte Seeratte. Schon als Knaben nahm mich mein Vater auf den Walfischfang mit. Aber so rau die Außenseite ist, so gut und bieder ist meistens der Kern beim echten Matrosen; die Robbenschläger aber scheinen durch ihre blutige Arbeit nach und nach jedes menschliche Gefühl zu verlieren. Vor zwei Jahren, nach meines Vaters Tod, begleitete ich Kapitän Bill auf die Seehundsjagd; nach meiner ersten Reise aber hatte ich von dem widerlichen Geschäft schon so übergenug, dass ich gewiss nicht mehr mitmachen würde, wenn ich mein freier Herr wäre. Ich fühle mich ganz vereinsamt hier an Bord, sie verspotten und hassen mich, weil ich ihnen manchmal ein wahres Wort gesagt habe. Glaube mir, so hartherzig sind die Kerle, dass keiner eine Hand geregt hätte, dich zu retten, wenn ich nicht gewesen wäre … »Aber, ich bitte! lass den Dank bleiben! Ich kann es nicht hören: ich habe doch nur getan, was ein ehrlicher Seemann seinem unglücklichen Mitmenschen schuldig ist! — Nun aber sage du mir einmal, wie du in diese Breiten kommst.«
Georg erzählte kurz von seinen Plänen und Schicksalen, die wir bereits kennen, und schloss mit den Worten: »Nun ist alles vereitelt, und ich werde meinen guten Vetter in Kapstadt sobald nicht sehen. Stattdessen muss ich nun unfreiwillig an einer Robbenjagd im antarktischen Eis teilnehmen.«
»Lass dich es nur nicht gereuen! Du wirst des Neuen und Schönen genug sehen — freilich auch des Grausigen! Jedenfalls aber bin ich froh, einen solch liebenswürdigen Kameraden gefunden zu haben, obgleich ich geringe Seeratte es nicht verdiene, so einen vornehmen Herrn Freund nennen zu dürfen.«
»Schweig doch, Dick, mein Lebensretter!«, sagte Georg, indem er den bescheidenen Freund umarmte: »Ich habe wenig Freunde auf der Welt, gewiss aber keinen, den ich in kurzer Zeit gleich aufrichtig in mein Herz geschlossen hätte, wie dich. Ich glaube, wir beide taugen zusammen: wollte Gott, wir blieben auch beisammen — allerdings nicht immer an Bord des Seelöwen!«
5.– Süd-Georgien
Der Seelöwe war ein vorzügliches Schiff, dem der letzte Sturm nur wenig Schaden zugefügt hatte, nur dass er ihn weit ostwärts von seinem Kurse abgetrieben hatte, ein Umstand, dem Georg seine Rettung verdankte.
Nun aber richtete der Kapitän die Fahrt wieder südwestwärts, Süd-Georgien zu.
Als die Insel in Sicht kam, glaubte sich Georg schon ins Polargebiet versetzt: eine herrliche Alpenlandschaft ragte vor seinen Augen hoch empor; schroffe Felsen, schneeige Gipfel und wild gezackte, kahle Zinnen umgaben tief eingeschnittene, eiserfüllte Täler.
Als der Seelöwe näherkam, öffneten sich vor ihm breite Buchten, in deren Hintergrund mächtige Gletscher bis ins Meer vorsprangen. Dazwischen sah man frische, grüne Streifen: hier wuchs in riesigen Büscheln das saftige Tussockgras.
Der Kapitän lenkte in die Cumberlandbucht ein, die mit zwei tiefen Fjordarmen weit in die Küste hineingreift.
Süd-Georgien liegt auf dem 54. Grad südlicher Breite; dennoch hat es ebenso mächtige Gletscher und Eisströme wie Spitzbergen aus dem 80. Grad nördlicher Breite.
Da sich aus der Insel gewöhnlich viele Robben aufhalten, Seeleoparden und namentlich See-Elefanten, wurde in der Bucht gelandet. Zahllose Bäche plätscherten von den Bergen herab und rannen murmelnd durch das Moos. Hie und da krochen Käfer und kleine Spinnen unter Steinen hervor und die kleinen Süßwasserteiche wimmelten von Krebsen und Wasserkäfern.
Das Tussockgras wuchs hoch an den Bergen hinauf; ein schäumender Gießbach stürzte sich von einer steilen Felswand herab. Einige wenige Pinguine ließen sich blicken und Georg hatte seine Freude an den drolligen Gestalten. Auch einige Krick-Enten waren zu sehen.
Als Georg mit Dick und einigen Matrosen etwas höher am Ufer hinausstieg, entdeckte er Farnkraut und üppig blühende Pflanzen, Rosazeen und Ranunkulus. In den Lüften trillerten kleine gelbbraune Vögel, deren fröhliches Gezwitscher das Herz erfreute.
Von den See-Elefanten, an denen die Insel so reich sein soll, wurde kein einziges Exemplar gesichtet.
Man begab sich wieder an Bord und steuerte aus dem Westfjord der Cumberlandbucht, in deren Hintergrund drei Gletscher ins Wasser vorspringen, nach dem Südfjord. Unterwegs erblickte Georg die erste Robbe, die er je in Freiheit gesehen. Es war ein schlanker, gefleckter Seehund, dessen langer, schmaler Kopf einer Eidechse glich; sein tückischer, lauernder Blick hatte etwas Raubtierartiges; und ein Raubtier war dieses Geschöpf offenbar, das mit großer Gewandtheit die Fische aus dem Wasser holte, um sie zu verschlingen.
»Das ist ein Seeleopard«, sagte Dick, der das Interesse beobachtete, mit dem Georg die Robbe betrachtete.
Der Südfjord teilt sich in zwei Buchten, deren westliche durch einen Wall dunkler Steinblöcke gesperrt ist, der nur an einzelnen Stellen mit einem Boote überfahren werden kann.
Zwei Gletscher münden in diese westliche Bucht, die den Namen Moränenfjord trägt. Das heißt, nur der östliche der beiden, der De-Geers-Gletscher mündet eigentlich ins Wasser; der andere, der Hamberg-Gletscher, hat seine Abbruchstelle an einer Felswand im Inneren der Küste.
»Das ist ein kalbender Gletscher«, sagte Dick, auf den De-Geers-Gletscher weisend.
»Kalbender Gletscher?«, fragte Georg verwundert.
»Jawohl, so nennt man sie: schau, der Eisstrom stürzt in hoher Wölbung weit ins Wasser hinaus; von Zeit zu Zeit trennt sich ein Stück der vorgeschobenen Eismasse los und treibt weg. Dann sagt man: der Gletscher kalbt. All die Eisstücke und Miniatureisberge, die hier in der Bucht treiben, sind von diesem Gletscher ausgekalbt. Kalbt er aber einmal richtig, so gibt es einen großen Eisberg, der einem den Eingang zur Bucht versperren kann.
»Dort rechts dagegen, der Hamberg-Gletscher, ist ein Hängegletscher. Siehst du, wie die dunkle, senkrechte Felswand ihn in einen oberen und unteren Gletscher teilt und wie die langsam strömenden Eismassen des oberen Gletschers als Eiswächten weit über die Zinne der Felswand vorstehen? Gib acht! Wir erleben eine Luftkalbung!«
Wirklich barst in diesem Augenblick die überhängende Eismasse und stürzte aufgelöst in größere und kleinere Blöcke, Eissplitter und Eisstaub hinab auf das untere Gletschereis, auf dem sie mit donnerndem Getöse vollends zerschellte.
Die östliche Bucht des Südfjords wurde von einem großen kalbenden Gletscher, dem Nordenskjöld-Gletscher, gespeist.
Der Kapitän sandte wieder ein Boot aus, das am westlichen Strande, in der Kochtopfbucht landen sollte, um nachzusehen, ob keine Spuren von Robben zu finden seien. Solche fanden sich nicht, dagegen ein großes, grün gestrichenes Boot, neben dem immer noch der gusseiserne Kochtopf stand, nach dem die Bucht benannt wurde. Was mochte aus der Bemannung dieses Bootes geworden sein, das allen Anzeichen nach schon viele Jahre hier ruhte?«
Der Seelöwe fuhr in den Westfjord zurück und ankerte in der Maibucht. Hier wurde ein Lager am Strande aufgeschlagen in der Nähe einer Höhle, die sich in einer senkrechten Felswand öffnete, und die offenbar von Menschen bewohnt worden war; denn ihr Eingang war durch einen künstlichen Erdwall verschlossen. Auch die Reste einer einfachen Wohnhütte mit Feuerstelle wurden entdeckt, und nicht fern davon — ein Kirchhof!
Es waren Gräber von Seehundsfängern, einzelne durch eingerammte Pfähle, andere durch Namentafeln mit deutlich lesbaren Inschriften bezeichnet.
»Das ist kein gutes Vorzeichen!«, murmelte der Kapitän mit einem seiner schrecklichen Fläche: »Hier halte ich mich nicht länger auf!«
Als am anderen Morgen die höchsten Schneegipfel unter den ersten Strahlen der Morgensonne rosig erglühten, verließ das Schiff die Cumberlandbucht. Der Kapitän bog noch in die südlicher gelegene Royalbucht ein, die der gewaltige Roß-Gletscher abschließt.
Am nördlichen Strande der Moltkebucht ragte noch die vor mehr als fünfundzwanzig Jahren errichtete deutsche Beobachtungsstation auf. Seehunde waren aber auch hier keine zu sehen.
Bald verfolgte der Seelöwe wieder seinen südwestlichen Kurs, bis allmählich völlige Windstille eintrat und seine Weiterfahrt hinderte.
Seltsam, ja lächerlich kamen Georg die echt seemännischen Versuche des Kapitäns vor, den Wind auffrischen zu lassen. Zuerst befahl er den Matrosen, Wind herzupfeifen. Sie pfiffen denn auch alle aus Leibeskräften, jedoch ohne den gewünschten Erfolg.
Hieran gebot Bill Robber dem Schiffsjungen, den Mast zu kratzen. Auch das wollte nichts helfen. Nun musste der Schiffsjunge mit einem Besen den obersten Top erklettern, um den Himmel zu kehren. Als auch dies keine Wirkung hatte, entschloss sich der Kapitän, ein Paar alte Stiefel zu opfern und ins Meer zu werfen. Aber auch dadurch ließ sich der Windgott nicht erweichen, und erst als Bill noch ein Paar alte Hosen zum Opfer brachte, erhob sich ein sanftes Wehen, das allmählich in einen segelblähenden Wind überging.
Diesen Abend genoss der junge Werner zum ersten Mal das wunderbare Schauspiel eines Meerleuchtens: in weitem Umkreise blitzte und flimmerte die Wasserfläche, Feuer schien die gekräuselten Wellchen zu durchglühen, ein strahlender Glutstreifen zog sich im Kielwasser hinter dem Schiffe her; am bezauberndsten aber war der phosphoreszierende Schein der Wellen, die gegen die Bordwände schlugen.
6.– Im Eismeer
Bald darauf fuhr der Seelöwe östlich an den Süd-Orkney-Inseln vorbei, die schroff aus dem Meere emporsteigen und, mit Ausnahme der Küsten, völlig vereist sind.
Eine Landung verschmähte der Kapitän: er wollte keine Zeit mit vielleicht vergeblichem Suchen nach kleinen Robbenherden verlieren, da er wusste, dass weiter südlich sich die Aussichten aus einen reichen Fang ständig vermehrten.
Immer noch ging der Kurs bei günstigstem Wetter nach Südwesten; die Fahrt war eine langweilige für Georg, denn es war nichts zu sehen als Himmel und Meer, und Dick fand nur wenig Zeit, seinen Freund zu unterhalten. Interessanter wurde die Reise erst, als das Gebiet des Treibeises erreicht wurde; immer häufiger zeigten sich Eisberge, von welchen einzelne die Mastspitzen des Schiffes um das Doppelte und Dreifache überragten. Dennoch war Georg von ihrem Anblick enttäuscht; denn er hatte die abwechslungsreichen, wild zerklüfteten und seltsamen Formen erwartet, die man so vielfach auf Abbildungen aus den nördlichen Polargegenden sieht, und die dem entzückten Auge ein beständig wechselndes Schauspiel von märchenhafter Pracht bieten. Nun musste er entdecken, dass die antarktischen Eisberge ganz anders aussahen als die Fantasiebilder, die er sich von ihnen gemacht hatte. Sie glichen teils ungeheuren Felsplatten, teils mächtigen Würfeln von nahezu viereckiger Form und hatten etwas Gleichmäßiges und Einförmiges, das nicht imstande war, auf die Dauer das Interesse zu fesseln. Immerhin gab es doch etwas zu sehen, und manche dieser schwimmenden Riesen imponierten durch ihre überwältigende Größe.
Die Eisberge wurden immer zahlreicher, die Temperatur sank rasch und es herrschte beinahe beständiger Tag. Die Schiffsmannschaft wurde nun in Robbenpelze gekleidet, die echte Polarausrüstung, welche am wirksamsten gegen die Kälte schützt. Auch Georg erhielt einen solchen Anzug und fühlte sich darin so behaglich, dass er sich gegen Dick äußerte, nun getraue er sich, den Südpol zu entdecken.
»Halt«, lachte Dick: »Da haben wir noch weit hin, und Kapitän Robber schwimmt nicht durchs Packeis.«