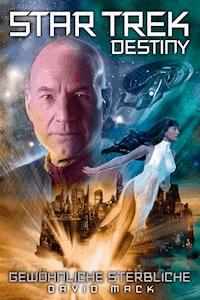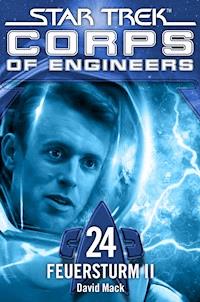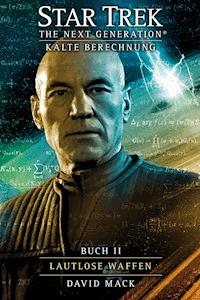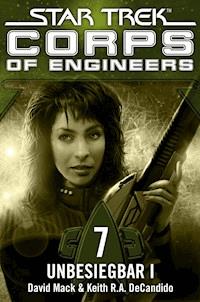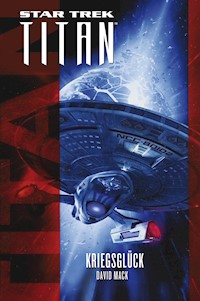Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Dunklen Künste
- Sprache: Deutsch
Der epische erste Roman in der "Dunkle Künste"-Trilogie. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs töten Nazi-Magier die Familie von Cade Martin. Auf der Suche nach Vergeltung tritt er der Mitternachtsfront als Zauberlehrling bei – dem streng geheimen Programm der Alliierten für magische Kriegsführung. Cade kämpft sich durch das besetzte Europa hinter die feindlichen Linien, wobei er sich ständig fragt, was ihn wohl zuerst umbringen wird – seine Verbündeten, seine Feinde oder die Dämonen, die er braucht, um Magie zu wirken. Und bald muss er erkennen, dass es keine schwierigere Aufgabe gibt, als Gutes zu tun mit einer Macht, die dem ultimativen Bösen entsprungen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 841
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DUNKLE KÜNSTE 1
DIE MITTERNACHTSFRONT
DAVID MACK
Ins Deutsche übersetzt von
CLAUDIA KERN& HELGA PARMITER
Die deutsche Ausgabe von DUNKLE KÜNSTE: DIE MITTERNACHSTFRONT wird herausgegeben von Cross Cult, Teinacher Straße 72, 71634 Ludwigsburg.
Herausgeber: Andreas Mergenthaler, Übersetzung: Claudia Kern und Helga Parmiter; verantwortlicher Redakteur und Lektorat: Markus Rohde; Lektorat: Jana Karsch; Korrektorat: Peter Schild; Satz: Rowan Rüster; Cover-Illustration: Larry Rostant; Printausgabe gedruckt von CPI Moravia Books s.r.o., CZ-69123 Pohořelice.
Printed in the EU.
Titel der Originalausgabe:
DARK ARTS 1: MIDNIGHT FRONT
Copyright © 2018 by David Mack
Published by arrangement with Tom Doherty Associates. All rights reserved
Dieses Werk wurde im Auftrag von Tom Doherty Associates durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover, vermittelt.
German translation copyright © 2021, by Cross Cult.
Print ISBN 978-3-96658-611-5 (Oktober 2021)
E-Book ISBN 978-3-96658-612-2 (Oktober 2021)
WWW.CROSS-CULT.DE
Für diejenigen,die zum Schweigen gebracht wurden,und diejenigen,die immer noch darum kämpfen,gehört zu werden.
Inhalt
1939
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
1940
Kapitel 4
1941
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
1942
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
1943
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
1944
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
6. JUNI 1944 D-DAY
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
1945
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
GLOSSAR
DIE HIERARCHIE DER HÖLLE
DANKSAGUNGEN
Es gibt Helden im Bösen wie im Guten.
– François de La Rochefoucauld, Maximen
1939
AUGUST
Die Nacht stank nach Dämonen.
Ihr übler Geruch zog in alle Richtungen, als Nando Cabral durch die bewaldeten Hügel südlich von Lemberg, Deutschland, floh, weniger als drei Kilometer von der französischen Grenze entfernt.
Er taumelte wie ein Betrunkener, eine Hand auf die Schusswunde in seiner linken Seite gedrückt. Strahlen aus Mondlicht drangen durch das Blätterdach der Bäume. Das Blut pulsierte bei jedem Schritt gegen seine Handfläche.
Er warf einen Blick auf seine Verfolger. Verschwommene Bewegungen, die zwanzig Meter entfernt waren und immer näher kamen.
Es war zu dunkel, um ihre Gesichter zu erkennen, aber der junge Spanier wusste, wer sie waren. Er wusste nicht, wie sie ihn gefunden hatten, aber das war jetzt auch egal. Nur eine Handvoll Geister waren noch an sein Gebot gebunden, gerade genug, um ihn mit ständigen Kopfschmerzen zu plagen. Er hatte nicht die kleine Legion, die er gebraucht hätte, um gegen einen anderen Karcisten zu kämpfen, geschweige denn gegen zwei. Ihm blieb jetzt nur noch die Flucht.
Eine geisterhafte Peitsche knallte und spie grünes Feuer, als sie die Rinde von den Bäumen zu seiner Linken riss. Der Feind hatte ihn eingeholt. Nando gab die Hoffnung auf, Frankreich zu erreichen, drehte sich um und wappnete sich für den Kampf. Seine Feinde bewegten sich wie Gespenster, mehr als ein Dutzend Meter voneinander entfernt.
Sie wollen meine Aufmerksamkeit teilen, folgerte Nando. Mit einem Gedanken schickte er zwei Dämonen, die normalerweise mit Wahrsagerei beauftragt waren, als seine Wachen los. Dann nutzte er die Gaben eines anderen Geistes, um sich unsichtbar zu machen – bestenfalls eine Verzögerungstaktik, aber bei der magischen Kriegsführung zählte jede Sekunde.
Seine Feinde waren nirgends zu entdecken – nichts als ein Wispern, das in der Dunkelheit lauerte.
Er dämpfte seine Schritte mit dem Talent von ARIS, einem der Schutzpatrone der Diebe in der Absteigenden Hierarchie. Obwohl der Boden mit trockenen Zweigen und Trümmern übersät war, schlich er darüber hinweg, ohne eine Spur zu hinterlassen oder ein Geräusch zu verursachen.
Sie müssen gesehen haben, wie ich ihren Kurier verfolgt hab. Abgesehen von einem Moment auf den Straßen Stuttgarts hatte er darauf geachtet, stets außer Sicht zu bleiben und sich mit Schutzglyphen zu verbergen. Die Deckung zu verlassen, um den Boten der Thule-Gesellschaft zu seinem endgültigen Ziel zu verfolgen, war ein kalkuliertes Risiko gewesen – eines, das Nando eine Kugel in den Bauch und die Aufmerksamkeit der beiden Feinde eingebracht hatte, die er laut einer Warnung seines Meisters Adair um jeden Preis meiden sollte.
Er durchsuchte die Nacht mit Blicken, während er weiterschlich, um seinen Feinden in die Flanke zu fallen. Sie hatten ihn nicht gerade kampfbereit erwischt, aber er war auch nicht wehrlos. Der stärkste Geist unter seinem Joch war BELETH, ein König der Hölle, bekannt für seine Liebe zur Zerstörung. Nando spürte die Flügel des gefallenen Engels, als wären es seine eigenen. Er schlug zweimal mit ihnen und entfesselte dabei Donnerschläge, die Baumstämme in Splitter verwandelten. Schockwellen durchliefen den zerstörten Wald, wirbelten Staub auf …
Zwei Blitze aus violettem Licht schossen durch den Dunst und trafen Nandos Brust. Sie prallten gegen ihn wie ein angreifender Stier und schleuderten ihn nach hinten. Er stolperte über Wurzeln und spitze Steine.
Ein scharfer, eisiger Schmerz in seiner Brust beraubte ihn seiner Unsichtbarkeit, als er seinen mentalen Einfluss über GLASYA verlor, die in die Unterwelt zurückkehrte, nachdem sie ihre Pflichten erfüllt hatte. Nando betastete die mit Maden übersäte Wunde in seinem Oberkörper und erkannte, dass er vom Speer SAVNOKS niedergestreckt worden war, einem Fürsten der Hölle, der sich daran erfreute, Pestilenz zu verbreiten.
Bewegung, zu seiner Rechten. Er schlug mit einer dämonischen Klinge zu, der keine Rüstung standhalten konnte, aber sie wurde abgewehrt.
Eine flüchtige Gestalt zu seiner Linken. Nando machte die Bäume zu seinen Soldaten. Ihre Gliedmaßen streckten sich aus und ergriffen eine rothaarige junge Frau. In Sekundenschnelle war sie gefangen, ein Eichenast schlängelte sich um ihre Kehle und legte sich über ihren Mund.
Nando befahl den Bäumen: Reißt sie …
Ein Feuerball verschluckte ihn.
Es war ein Angriff mit einer Dämonenfackel. Nandos Schreie erfüllten die Luft, aber er konnte sie durch das Tosen des Höllenfeuers nicht hören.
Als die letzte Flammenzunge erloschen war, lag er auf dem Rücken vor seinen Feinden. Die Frau, jetzt frei von den Bäumen, ragte vor ihm auf. Sie strahlte Verachtung aus, ihre kupferfarbene Mähne war so zerzaust, dass sie beinahe wild aussah. Wären ihre blauen Augen nicht von absoluter Boshaftigkeit erfüllt gewesen, hätte Nando sie unvergleichlich schön gefunden.
Ebenso auffallend war ihr Begleiter, ein blonder Mann mit gemeißelten Gesichtszügen. Selbst nach einem Duell im Wald sah er tadellos aus. Seine Schuhe hatten nicht eine Schramme, sein maßgeschneiderter Anzug hatte keine einzige Falte davongetragen. Wenn die Warnungen, die Nando von seinem Meister Adair gehört hatte, wahr waren, musste der Mann vor ihm der oberste Hexer der Nazis sein, Kain Engel.
Kain betrachtete Nando mit überdrüssiger Miene und bedauerndem Blick. »So viel Potenzial. Was für eine Verschwendung.«
Die Frau ballte ihre rechte Hand zur Faust. »Lass mich ihn fertig machen.«
»Nein, Briet. Ich muss das tun.« Unter seinem schwarzen Trenchcoat, auf dessen Revers ein Hakenkreuz prangte, zog Kain ein Athame hervor, ein Messer mit schwarzem Griff, das in der zeremoniellen Magick verwendet wurde. Er kniete sich hin und beugte sich über Nando, dessen geschundener Körper von Zittern geplagt wurde. Er senkte seine Stimme auf eine vertrauliche Lautstärke und sprach in perfektem Spanisch. »Dich und die anderen Nikraim als Karcisten auszubilden war schlau. Bisher hat dein Meister Adair nie eine derartige Weitsicht an den Tag gelegt.«
Nando wollte dem dunklen Magicker ins Gesicht spucken, aber sein Mund war so trocken wie Asche und es kostete ihn all seine Kraft zu sprechen. »Ihr werdet uns nicht alle besiegen.«
»Ich habe bereits die anderen fünf getötet, die Adair wie dich ausgebildet hat. Und wenn ich den letzten von deiner Sorte finde, den, der versteckt war, wird dieser Krieg vorbei sein« – er rammte die Klinge mit einer brutalen Drehung in Nandos Herz – »und eine bessere Zukunft kann beginnen.«
SEPTEMBER
Der silberne Austin Ten kam langsam vor dem Rekrutierungsbüro der Royal Army zum Stehen. Draußen peitschte der Regen die St. Giles’ Street entlang und prasselte auf die Fassaden der Oxforder Stadthäuser ein. Donner ließ die Fenster des chauffierten Autos klappern, als Cade Martin den Griff der hinteren Tür packte.
Sein Vater, Blake Martin, legte Cade die Hand auf den Arm. »Wir sind spät dran, Sohn. Beeil dich.«
»Ich bin zurück, bevor du sagen kannst: ›Chamberlain ist ein Idiot.‹«
Cades Mutter Valerie beugte sich vor, um an ihrem Mann vorbei zu sprechen. »Cade, wir meinen es ernst. Der Sturm überflutet die Straßen. Wir können es uns nicht leisten, das Schiff zu verpassen, es ist …«
»… das letzte, das nach Amerika zurückkehrt. Ich weiß, Mom.« Er öffnete die Tür. Regen durchnässte ihn, als er innehielt, um dem englischen Fahrer seines Vaters zu sagen: »Sorgen Sie dafür, dass sie mich nicht hier zurücklassen.«
»Ich verspreche nichts, Master Cade.«
»Sie sind ein Schatz, Sutton. Ändern Sie sich nie.« Cade flitzte durch die Böen. Nach all den Jahren, die er in England gelebt hatte – zuerst auf einem Internat in London, seit er vierzehn war, und dann die letzten zwei Jahre am Exeter College in Oxford – hatte er angefangen, den trockenen britischen Humor zu bewundern, und er machte sich einen Spaß daraus, anmaßende Spitzen zu verteilen, wann immer es möglich war.
Die Stunden vor der Morgendämmerung in Oxford waren immer dunkel, aber der Sturm machte diesen Morgen doppelt so finster. Trotz Regen, Wind und Düsternis zog sich eine Schlange von Männern die Straße entlang bis zum Rekrutierungsbüro, die alle darauf warteten, sich für den Krieg zu melden, den Deutschland zwei Tage zuvor mit dem Überfall auf Polen ausgelöst hatte. Die meisten der Männer sahen wie Einheimische aus, aber Cade erkannte ein paar von ihnen von verschiedenen Colleges in Oxford. Er ging zu dem einzigen, dessen Namen er kannte. »Claydon! Hast du Miles gesehen?«
Der schlaksige Student zuckte zusammen, als der Wind sich drehte und ihm der Regen ins Gesicht stach.
»Er ist drinnen. Der verrückte Kerl stand an der Spitze der Warteschlange.«
»Scheiße.« Cade schüttelte den Kopf, verärgert über sich selbst. Wie ich Miles kenne, stand er die ganze Nacht hier draußen, um auf jeden Fall als Erstes reinzukommen. »Danke, Claydon.« Er eilte die Treppe hinauf und schob sich an der Warteschlange vorbei. Sein Weg wurde von Stirnrunzeln verfolgt, aber er beachtete es nicht. Die sind doch alle dem Tod geweiht.
Er stieß die Tür am oberen Ende der Treppe auf und marschierte hinein. Das Foyer war karg eingerichtet, ohne Stühle, Sofas oder andere Annehmlichkeiten. Auf kleinen Tischen lagen Handzettel, auf denen die Tugenden und Belohnungen des Wehrdienstes angepriesen wurden. Ein pausbäckiger Corporal beaufsichtigte alles und hätte um ein Haar sein Klemmbrett fallen gelassen, als er sich beeilte, Cade den Weg zu versperren. »Sir, Sie müssen warten, bis …«
»Entspannen Sie sich, ich bin nicht so dumm, mich zu melden. Ich bin nur auf der Suche nach jemandem, der es ist.« Der Corporal brachte nur unzusammenhängendes Gestammel heraus, als Cade an ihm vorbei- und einen Korridor hinuntereilte.
Von Miles’ sattem Bariton angezogen, ging Cade an Porträts von Militäroffizieren vorbei, deren Schnurrbärte wahrscheinlich älter waren als er selbst. An der letzten offenen Tür der Halle blieb er stehen und steckte den Kopf hindurch.
Miles Franklin, sein bester Freund und Kommilitone aus Oxford, saß vor einem Schreibtisch, auf dem jeder Stift, jede Büroklammer und jedes Blatt Papier parallel oder in einem perfekten rechten Winkel zueinander angeordnet war, als hätten die Schreibwaren und Büromaterialien Paradeformation angenommen. Ein Sergeant thronte hinter der Zurschaustellung exakter Ordnung.
Missbilligend runzelte der Mann mit dem sorgfältig gestutzten Schnurrbart die Stirn, als er Cade sah. »Und Sie sind …?«
Bei dieser Frage drehte Miles sich zu Cade um und strahlte bei seinem Anblick.
»Cade! Bist du zur Vernunft gekommen, alter Junge?«
»Nein, ich bin gekommen, um mit anzusehen, wie du dich von deiner verabschiedest.« An den Sergeant gewandt, fügte Cade mit gespielter Erregung hinzu: »Ich habe noch nie dabei zusehen dürfen, wie ein Mann sein ganzes Leben wegwirft.«
Miles stand auf. »Verzeihen Sie, Sergeant, aber würden Sie meinen Freund und mich für einen Moment allein lassen?«
Der Sergeant stand auf und nahm seine Mütze von einem Ständer in der Ecke. »Also schön, Mr. Franklin. Eine Minute.« Er verließ den Raum und hielt nur inne, um Cade mit zusammengezogenen Augenbrauen einen Blick zuzuwerfen, der der Verachtung des Sergeants mit respektlosem Lächeln begegnete.
Miles baute sich vor Cade auf. »Was wird das hier?«
Cade überlegte, dass sie auf andere wie ein Paar ungleicher Socken wirken mussten.
Cade trug die Art von Anzug und Krawatte, wie es von Oxford-Studenten erwartet wurde, doch an ihm sahen die Sachen wie eine schlechte Verkleidung aus, während Miles ein Händchen für Mode hatte. Außerdem war Cade blass und sah durchschnittlich aus, während Miles eine ebenholzfarbene Haut und königliche Gesichtszüge besaß. Sogar ihre Stimmen waren ein Sinnbild für Kontrast.
Cade war überzeugt, dass sein amerikanischer Akzent neben Miles’ englischem Bariton tölpelhaft klang. »Verdammt, Miles. Ich kann nicht glauben, dass du Oxford mit einem halben Abschluss verlassen willst, nur um der Armee beizutreten.«
»Glaube es.« Schalk funkelte in Miles’ Augen. »Du kannst das auch.«
»Es ist nicht mein Krieg.«
»Da spricht dein Vater aus dir.« Er legte Cade die Hand auf die Schulter. »Komm mit mir! Die Armee sieht es gerne, wenn Yanks sich melden.«
»Ja, aber sie nehmen keine Gentlemen wie dich.«
»Wie mich?« Er hielt eine braune Hand hoch. »Söhne Afrikas?«
»Du weißt, was ich meine.« Er warf einen Blick über die Schulter, um sicherzugehen, dass der Sergeant nicht zurückgekommen war. »Schwuchteln.«
Miles lachte. »Die Armee missbilligt Verhaltensweisen, aber keine Persönlichkeitsmerkmale. Ich werde schon klarkommen.«
»Willst du für die Dauer des Krieges nur eine Lüge leben?«
»Das werde ich nicht müssen.« Er stieß Cade freundschaftlich an. »Im Gegensatz zu dir weiß ich, wie ich meinen Appetit zügeln kann.«
Seine Neckereien weckten Erinnerungen in Cade an die vielen Nächte, in denen sie die Kneipen von Oxford unsicher gemacht hatten. Sie hatten Geschichten erzählt und Lieder gesungen und jeden, der es wagte, sie beim Dart herauszufordern, dumm dastehen lassen. Es machte Cade traurig, sich vorzustellen, wie sein wunderbarer Gefährte in den Krieg zog – und er fühlte mehr als einen Stich der Scham, dass ihm der Mut fehlte, sich mit ihm zu melden, obwohl er tief in seinem Herzen wusste, dass es das Richtige gewesen wäre. Er maskierte seine Selbstvorwürfe mit Draufgängertum und sagte: »Sag mir, dass du das nicht nur tust, um zu beweisen, dass Oxford-Männer Patrioten sind.«
Miles verbarg seine Enttäuschung nicht. »Ich hatte wirklich gehofft, dass du deine Meinung ändern würdest.«
»Das könnte ich auch von dir sagen.«
Der Sergeant marschierte auf dem Weg zu seinem Schreibtisch zwischen ihnen hindurch. »Wenn Sie beide dann fertig sind?«
Bevor Cade antworten konnte, steckte Sutton, der Chauffeur seines Vaters, den Kopf zur Tür herein und unterbrach ihn. »Verzeihung, junger Herr, aber die Zeit wird knapp.«
»Ich komme.« Traurig darüber, sich von dem Mann zu trennen, den er in den letzten zwei Jahren wie einen Bruder geliebt hatte, konnte Cade nur den Kopf schütteln. »Pass auf dich auf. Und versuch, nicht umgebracht zu werden.«
Miles grinste. »Machst du dir schon Sorgen um mich?«
»So’n Quatsch. Du schuldest mir zehn Pfund.«
Miles stülpte seine leeren Taschen von innen nach außen. »Tut mir leid, Kumpel, ich bin ein bisschen knapp bei Kasse.« Ein einfaches Achselzucken überspielte den Kummer des Augenblicks. »Regeln wir das nächstes Mal?«
Cade umarmte seinen Freund. »Verlass dich drauf.« Sie klopften sich gegenseitig auf den Rücken und trennten sich mit einem Handschlag zum Abschied. Miles kehrte zu seinem Stuhl vor dem Schreibtisch des Sergeants zurück, um seine Einberufungsunterlagen zu vervollständigen, während Sutton Cade aus dem Rekrutierungsbüro führte.
Draußen peitschte der Regen über die Straße und Blitze zuckten über den Himmel. Der Austin Ten stand im Leerlauf auf der Straße, seine Scheinwerferstrahlen bohrten sich durch den Sturm, der alles in schwere Vorhänge aus Regen hüllte.
Während Sutton voraushuschte, um Cade die hintere Tür des Austin Ten zu öffnen, hörte Cade Dampfpfeifen – die klagenden Schreie von Zügen, die an der Oxford Station vorbeifuhren, fast einen Kilometer entfernt.
Selbst vom abgeschiedenen Fellows’ Garden in Exeter aus hatte Cade die Züge rumpeln hören. Auf Anordnung der Regierung Seiner Majestät waren in den vergangenen zwei Tagen Zehntausende von Kindern und Jugendlichen aus allen Schichten der Gesellschaft aus den städtischen und industriellen Regionen Süd- und Mittelenglands in die trügerische Sicherheit des ländlichen Nordens evakuiert worden.
Cades düstere Gedanken wurden durch eine Hand auf seinem Arm unterbrochen. Ein älterer Mann mit einem aschfahlen drahtigen Bart und schottischem Akzent hielt ihn auf halbem Weg an.
»Cade Martin?«
Er beäugte den Fremden misstrauisch. »Kenne ich Sie?«
»Ich bin hier, um Sie zu rekrutieren für …«
»Nein, danke.« Cade hielt weiter auf den Bürgersteig zu.
Er kam nur einen Schritt weit, bevor der Fremde mit dem irren Blick ihn am Kragen packte. »Ich bin noch nicht fertig, Mr. Martin. Der Krieg braucht Sie.«
»Fassen Sie mich nicht an!« Cade wand sich aus dem Griff des Schotten. »Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber was auch immer Sie verkaufen, ich will nichts damit zu tun haben. Dies ist nicht mein Krieg. Begreifen Sie das?«
Wieder ging Cade weiter. Er schaffte es bis zum Bürgersteig, bevor der Fremde ihn einholte. »Wenn Sie weglaufen, bringen Sie jeden in Ihrer Nähe in Gefahr.« Das ließ Cade stehen bleiben und er drehte sich um, als der Mann hinzufügte: »Einschließlich Ihrer Eltern.«
Bevor Cade eine Erklärung verlangen konnte, stürzte sein Vater Blake aus dem Austin Ten und stellte sich zwischen Cade und den Fremden. »Steig in den Wagen, mein Sohn.«
»Dad, was ist …?
»Steig ins Auto!«
Cade wich vor der Konfrontation zwischen seinem Vater und dem älteren Mann zurück. Er ging in Richtung des Austin Ten und hörte gerade noch, wie sein Vater den Fremden warnte: »Sprechen Sie nie wieder mit meinem Sohn.«
Der Schotte klang verzweifelt. »Es ist zu spät, Blake. Er kann sich nicht ewig verstecken.«
»Möglich. Aber er geht nicht mit dir mit.« Cades Vater schubste den älteren Mann, der nach hinten stolperte und auf dem Bürgersteig zusammensackte. Cade war von dessen Misere wie hypnotisiert, bis sein Vater sich in Bewegung setzte, Cades Arm nahm und ihn zum Auto schleppte.
Trotz des Regens stieg Cade ein seltsamer Hauch von Schwefel in die Nase, als er und sein Vater zum Austin Ten eilten. Cade verzog bei dem Geruch das Gesicht und warf einen Blick zur anderen Seite der Straße. Dort sah er einen weiteren Fremden, der ihn anstarrte: ein blasser, braunhaariger Mann von ungefähr dreißig Jahren, der einen sorgfältig gestutzten Knebelbart – eine Kombination aus Schnurrund Ziegenbart –, einen dunklen Anzug und einen Filzhut trug. Der Mann folgte jedem einzelnen von Cades Schritten, machte aber keinen Versuch, sich ihm zu nähern; er stand nur mit den Händen in den Taschen da und strahlte reine Bosheit aus.
Cades Vater drängte ihn auf den Rücksitz des Autos, nahm ihn in die Mitte zwischen sich und Cades Mutter und schnauzte dann Sutton an: »Los!«
Entweder vom Instinkt oder von der Angst getrieben, warf Cade einen Blick aus dem Heckfenster des Autos. Der ältere Mann lag immer noch auf dem Bürgersteig, aber der Fremde mit dem Filzhut war verschwunden.
Der Austin Ten setzte sich in Bewegung und raste davon. Sein Fahrgestell rumpelte und klapperte auf dem Weg über die mit Steinen gepflasterten Straßen Oxfords, während der Regen auf die Windschutzscheibe prasselte.
Cade saß eingeklemmt zwischen seinen Eltern da und spürte eine Welle der Beunruhigung wegen der Auseinandersetzung auf der Straße. »Dad … wer war das?«
»Niemand, um den du dir Sorgen machen müsstest.«
»Was meinte er damit, als er sagte, ich könne mich nicht ewig verstecken?«
»Vergiss ihn einfach, Cade.«
Cades Eltern wechselten geheimnisvolle Blicke. Seine Mutter versuchte, ihre Sorge mit einem nervösen Lächeln zu überspielen. »Versuch zu schlafen, mein Schatz. Wir werden dich in Liverpool wecken.«
Die sturmgepeitschte Landschaft huschte verschwommen vorbei. Oxfords Vorstädte wichen nach weniger als dreißig Minuten Fahrt einer ländlichen Gegend. Beim Blick aus dem Heckfenster sah Cade nur noch Abgaswolken, als wäre seine Vergangenheit ausgelöscht worden.
Er fühlte sich wie hypnotisiert von dem Dröhnen der Straße. Das Prasseln der Regentropfen auf dem Dach, das Geräusch der Reifen auf dem nassen Asphalt und das Schnurren des Motors lullten Cade ein. Sein Verstand protestierte gegen den Gedanken an Schlaf, aber seine Augen schlossen sich wie von selbst.
Na gut, einen Moment. Nur ein paar Minuten ausruhen …
Cade schreckte aus dem Schlaf auf und blinzelte ins trübe Morgenlicht.
Das Auto hatte angehalten und er war allein auf dem Rücksitz. Seine Augen gewöhnten sich an die Helligkeit, während er sich umsah. Der Austin Ten war neben einem überfüllten Dock geparkt worden, wo ein riesiger Dampfer vor Anker lag. Der Kofferraum war offen. Stämmige Hafenarbeiter zogen das Gepäck der Martins aus dem Auto und trugen es zur Landungsbrücke des Schiffs.
Seine Eltern standen vor dem Auto und sprachen mit Sutton.
Cade stieg aus dem Auto. Die schwüle Hitze, gemischt mit dem Gestank der Ebbe, ließ ihn die Luft im Auto vermissen, in dem es nach sauberem Leder und süßem Pfeifentabak roch.
Sein Vater schüttelte Suttons Hand. »Es tut mir leid, dass ich nicht mehr als eine Wochenabfindung anbieten kann, nach all den Jahren, die Sie uns gedient haben.«
Sutton winkte ab. »Nicht der Rede wert, Mr. Martin.«
»Da bin ich anderer Meinung.« Cades Vater reichte dem Fahrer ein gefaltetes Stück Papier. »Das ist die Besitzurkunde des Autos. Ich habe es auf Ihren Namen überschrieben. Nennen Sie es ein Abschiedsgeschenk.«
»Sehr großzügig, Sir«, sagte Sutton sichtlich bewegt. »Ich werde es in bester Ordnung halten, bis Sie zurückkehren.« Er warf Cade einen Blick zu und tippte sich an die Kappe. »Gute Reise, junger Herr.«
Cade winkte Sutton zum Abschied zu, dann wurde er von seinen Eltern über das Dock und die Landungsbrücke des Dampfers Athenia geführt.
Ein Steward mit schwieligen Händen und Edinburgh-Akzent kam ihnen auf dem Hauptdeck entgegen. »Hier entlang, Herrschaften!« Mit dem wankenden Gang eines Mannes, dessen seefeste Beine nicht wussten, was sie an Land tun sollten, führte er sie unter Deck zu ihrer Kabine. Drei Hafenarbeiter, beladen mit ihrem Gepäck, stapften hinter ihnen her.
Ihre Kabine war ein ordentlicher Raum, der durch das Gepäck beengt wurde, das die Träger wahllos stapelten. Der Steward bemerkte die Bestürzung der Familie, lächelte und tippte sich an seine Mütze. »Es ist klein, aber sehr privat. Es gibt sogar ein Bullauge irgendwo da drin!«
Cades Mutter tat ihr Bestes, um höflich zu sein. »Wie luxuriös. Ich danke Ihnen.«
Ein peinliches Schweigen machte deutlich, dass der Steward ein Trinkgeld erwartete. Cades Vater drückte dem Mann ein paar Schillinge in die Hand, dann schloss er die Tür. »Ich brauche einen Drink. Valerie, wo ist mein Flachmann?«
»In deinem Schrankkoffer, wo du ihn hingetan hast.«
Das Schiffshorn dröhnte und ließ das Deck mit seinem Klang erzittern. Cade drückte sich mit dem Rücken an eine Wand, während seine Eltern mit ihrem Gepäck und miteinander rangen, um den Flachmann seines Vaters zu finden. An einem anderen Tag hätte Cade ihre Marotten vielleicht amüsant gefunden, aber die Kabine war zu eng, als dass er sich darin wohlfühlen konnte. Er öffnete die Tür. »Ich gehe nach oben und sehe mir das Ablegemanöver an.«
Seine Ankündigung trug ihm einen besorgten Blick seines Vaters ein, aber seine Mutter antwortete zuerst. »In Ordnung, mein Lieber. Wenn wir hinausgehen, lassen wir ein Licht für dich an.«
»Danke, Mom.«
Cade machte sich auf den Weg nach oben aufs Hauptdeck. Von dort aus blickte er auf die dunstverhangenen Dächer von Liverpool hinaus. Hunderte von Passagieren drängten sich an der Reling des Schiffs. Die meisten von ihnen winkten und warfen den wimmelnden Massen auf dem Dock unter ihnen Küsse zu. Andere starrten in die Ferne, als fürchteten sie, sie könnten England nie wiedersehen – zumindest nicht das England, das sie kannten.
Die Mannschaft machte die armdicken Taue des Schiffs los. Klirrende Ketten und brummende Motoren kündigten an, dass der Anker gelichtet wurde, und das Horn der Athenia war so laut, dass Cade zusammenzuckte. Ein tiefes Grollen pflanzte sich durch den Rumpf fort und das Schiff wälzte sich träge hinaus aufs Meer.
Eine Brise bot flüchtige Erleichterung von der Schwüle. Cade erwog, zum Bug zu gehen, um Ausblick auf den offenen Ozean zu haben – bis er jemanden auf dem Dock entdeckte, der ihn anstarrte.
Der stumme Fremde, der vor dem Rekrutierungsbüro gestanden hatte.
Als wäre er immun gegen die Hitze, trug der blasse Mann immer noch seinen Anzug und seinen Filzhut. Selbst aus mehreren Dutzend Metern Entfernung spürte Cade seinen bohrenden Blick. Wer auch immer der Mann war, was auch immer er wollte, es war kein Zufall, dass er hier war.
Vielleicht sollte ich Dad auf ihn hinweisen. Cade wandte sich um, um zur Kabine zu eilen, aber dann fragte er sich, ob er seiner eigenen Fantasie zum Opfer gefallen war. Er schaute zurück; der Fremde war verschwunden. Ob er in der Menge abgetaucht war oder sich in Luft aufgelöst hatte, konnte Cade nicht sagen.
Ich schätze, es spielt keine Rolle. Solange er bloß weg ist.
Cade ging nach achtern. Einsame Stunden vergingen, während er vom Heck der Athenia aus die schwindende Küste anstarrte.
Er verdrängte alle Gedanken an Miles, der geradewegs in die Gefahr hineinmarschierte, und an den merkwürdigen Fremden auf dem Dock, während er zusah, wie England allmählich hinter dem Horizont verschwand.
Leb wohl, Britannia, dachte er düster. Ich schätze, wir sehen uns wieder, wenn der Krieg vorbei ist.
Mit einer Handbewegung warf er ein Streichholz in das leere Treibstofffass. Die Flammen schossen fauchend nach oben und die Hitze stach Siegmar Tuomainen ins Gesicht.
Er trat zurück, um zu verhindern, dass das Feuer seinen Bart versengte, aber er achtete darauf, den Doppelkreis nicht zu berühren, den er mit Kreide um das Fass gezeichnet hatte. Er hatte es hinter dem Fuhrpark der Docks gefunden, wo es vor neugierigen Blicken sicher war. Zwischen die konzentrischen Ringe hatte er Glyphen gezeichnet, damit seine Feinde nicht auf diese kleine Magick aufmerksam werden konnten. Außerhalb des größeren Kreises hatte er die astrologischen Zeichen in ihrer Reihenfolge im Tierkreis geschrieben. Die Zwillinge befanden sich im Norden.
Aus seiner Tasche nahm er ein verknotetes Baumwolltuch, das mit Steinsalz gefüllt war, und exorzierte Merkur-Weihrauch aus schwarzem Nelkenpulver. Er warf es ins Feuer. Goldene Funken sprühten aus der Glut und die Hitze des Tages wurde von einer unirdischen Kälte vertrieben.
Siegmar streckte seine Hand in den Strahl aus Feuer und Phosphor und murmelte die Beschwörungsformel für die Fernkommunikation: »Exaudi. Exaudi. Exaudi.«
Flammenzungen wanden sich, verschmolzen dann und enthüllten das Gesicht von Kain, seinem Meister in der Kunst. Siegmar senkte den Kopf. »Ave, Meister.«
Kain sprach in Silben aus Asche und Schatten. »Ave. Was gibt es Neues?«
»Ich konnte ihn nicht mehr rechtzeitig erreichen. Er war gegen Angriffe geschützt.«
Ein ernstes Nicken. »Wie wir befürchtet hatten. Wo ist er jetzt?«
»Auf einem Schiff mit seinen Eltern. Die Athenia. Sie hat Liverpool um 3 Minuten nach 1 Uhr mit Kurs Richtung Nordamerika verlassen.«
»Das haben Sie gut gemacht. Kehren Sie zur Wewelsburg zurück. Wir haben viel zu tun.«
»Was ist mit dem Jungen?«
Durch die Flammen hindurch war ein mattes Lächeln zu sehen. »Er ist auf See. Es gibt kein Entkommen mehr.«
Sechsunddreißig Stunden Übelkeit und eine unruhige Nacht hatten Cade daran erinnert, wie sehr er Seereisen hasste. Besatzungsmitglieder der Athenia hatten ihm versichert, dass der Ozean ruhig und das Wetter schön sei, aber sein Magen bestand darauf, dass sie logen. Die Seekrankheit hatte ihm innerhalb weniger Stunden nach dem Auslaufen des Schiffes den Appetit geraubt – ein Umstand, der ihm wie ein Segen vorkam, als er die Mahlzeiten sah, die im Speisesaal serviert wurden.
Ich liebe die Engländer, aber ich hasse ihre Küche.
Er stand auf dem Promenadendeck, umklammerte mit weißen Knöcheln die Backbordreling und kämpfte gegen den Drang an, sich zu übergeben. Die Seeluft half ihm, den Kopf frei zu bekommen. Im Süden färbte sich der Himmel dämmrig rosa und die Sonne sank vor der westwärts fahrenden Athenia dem Horizont entgegen.
Schritte überquerten das Deck hinter ihm und kamen näher. Cade war nicht in der Stimmung, es seinem Vater leicht zu machen, deshalb tat er so, als würde er ihn nicht bemerken.
Sein Vater trat rechts neben Cade an die Reling. »Du hast das Abendessen eilig verlassen. Fühlst du dich gut?« Er sah, wie Cade den Kopf schüttelte. »Hm. Du bist ein bisschen grün im Gesicht. Vielleicht kann dir der Schiffsarzt etwas Natron geben. Das beruhigt deinen Magen.«
»Du willst meinen Magen beruhigen? Dann wirf den Koch über Bord.«
Einen Moment lang bewunderten sie den Sonnenuntergang. Sein Vater stopfte seine Bruyèrepfeife mit süßem Cavendish-Tabak und schaute dann zum Horizont. »Es gibt da etwas, worüber wir reden sollten, mein Sohn.« Seine Heiterkeit verwandelte sich in Scham. »Eine Wahrheit, die ich dir schon viel zu lange vorenthalten habe.«
Cade hatte seinen Vater noch nie so reden hören. »Die Wahrheit über was?«
Er riss ein Streichholz an der Reling an, zündete seine Pfeife an und füllte die Luft mit Aromen von Kirsche und Bourbon. »Entscheidungen, die ich getroffen habe, bevor du geboren wurdest. Bürden, die du tragen musst, weil ich dich dazu verdammt habe.«
»Dad, ich weiß, ich hab mich über das Internat beschwert, aber so schlimm war es wirklich nicht.«
»Du tust immer gerne so, als sei alles ein Witz, aber das hier ist ernst, Cade. All die Jahre … Ich hätte dich ausbilden sollen.«
»Du unterrichtest Geschichte und Mom ist Chemikerin. In was willst du mich ausbilden? Alchemie?«
»Verdammt, Cade! Hör nur ein einziges Mal in deinem Leben zu! Ich muss dich auf das vorbereiten, was auf dich zukommt, bevor es zu spät ist. Ich hätte dir schon vor Jahren die Wahrheit sagen sollen, aber deine Mutter und ich hatten Angst.« Er starrte auf seine Schuhe. »Du bist alles, was wir haben. Wir wollen dich nicht verlieren.«
Plötzlich war Cade hellwach und begann, die Angst seines Vaters zu teilen. »Dad … wovon redest du? Was genau, glaubst du, wird kommen? Und was hat das mit mir zu tun?«
Gerade als sein Vater den Mut aufbrachte, etwas zu erwidern, hörten sie Flügelschlag über ihren Köpfen. Sie schreckten vor einem großen schwarzen Vogel zurück. Er landete auf dem Geländer und drehte sich zu ihnen um. Cade bestaunte die Kreatur, deren Augen eine hypnotische Kraft ausstrahlten. »Ist das eine Krähe?«
Sein Vater starrte den Vogel entsetzt an. »Ein Rabe.« Er schlug nach dem Vogel. »Husch! Verschwinde!«
Der Rabe flatterte mit den Flügeln, hackte mit dem Schnabel nach seiner Hand und stieß ein durchdringendes Krächzen aus. Dann sagte er mit schnarrender Stimme: »Rettungsboot!«
Entsetztes Schweigen. Cade wich vor dem Raben zurück. »Dad … der Vogel hat gesprochen.«
»Geh unter Deck, mein Sohn.«
»Raben sprechen nicht. Papageien sprechen. Mainavögel sprechen. Sogar Stare. Aber nicht …«
»Rettungsboot!«, krächzte der Rabe.
Schiere Panik schien Cades Vater ergriffen zu haben. Er zeigte nach vorne, in Richtung der Luke. »Geh zum Speisesaal! Finde deine Mutter, bring sie …«
»Warum sagt er immer ›Rettungsboot‹?«
»Finde einfach deine …« Seine Stimme erstarb, als sein Blick an dem Vogel vorbei auf das Meer fiel. Cade trat an die Reling und sah, was seinen Vater in den Bann gezogen hatte: eine gerade Linie, die weißen Schaum unter den Wellen aufsprudeln ließ – und direkt auf die Athenia zusteuerte.
Ein Torpedo.
Sein Herz hämmerte und er packte den Mantel seines Vaters. »Dad, komm schon!«
Es blieb keine Zeit zum Weglaufen. Die Explosion war lauter als ein Donnerschlag. Ein Schwall eisiger Gischt ergoss sich über sie, als sich die Athenia abrupt nach Steuerbord neigte, weg von der Explosion, und sie nach hinten taumeln ließ, bis sie gegen die Deckaufbauten prallten. Ein Feuerball stieg aus dem hinteren Teil des Schiffs gen Himmel, das mit Wucht nach Backbord zurückkippte, sodass sie gegen die Reling geschleudert wurden.
Cade verlor den Halt und wäre beinahe über die Reling gestürzt. Sein Vater ließ seine Pfeife fallen und erwischte Cades Arm. »Halt dich fest, mein Sohn!«
Das Schiff landete mit Schlagseite nach Backbord wieder auf seinem Kiel. Ein durchdringender Alarm ertönte und die Besatzung eilte auf ihre Gefechtsposten. Der Rabe war nirgends zu sehen, als Cades Vater ihn von der Reling wegzog und ihm den Weg nach vorne wies.
»Geh zu einem Rettungsboot!«
»Was ist mit Mom?«
»Ich werde sie finden! Geh!«
Er folgte seinem Vater. »Ich bleibe bei dir!«
Die Stimme des Kapitäns dröhnte aus den Lautsprechern auf dem Schiffsaufbau: »An alle Passagiere, hier spricht der Kapitän: Verlassen Sie das Schiff. Begeben Sie sich auf das Hauptdeck und steigen Sie in die Rettungsboote.«
Cades Vater spannte sich an und wollte widersprechen, dann änderte er seine Meinung. »Bleib dicht bei mir.«
Sie stolperten über das schräge Deck und kämpften um ihr Gleichgewicht. An der Luke stießen sie mit einer Flut von Körpern zusammen – die erste Welle flüchtender Besatzungsmitglieder und Passagiere auf dem Weg nach oben. Panische Schreie erfüllten die Luft, als eine weitere Explosion das Schiff von innen erschütterte und die Lichter erlöschen ließ. Angst wallte in Cade auf und verursachte eine Übelkeit, die schlimmer war als alles, was das Meer bewirken konnte.
Sein Vater bahnte sich mit dem Ellbogen den Weg durch den Korridor. Cade folgte ihm und schlängelte sich durch die Menge, um sicherzustellen, dass er und sein Vater nicht getrennt wurden. Sie stürmten die vordere Treppe hinunter, nur um von einer Wand aus schwarzem Rauch aufgehalten zu werden, der nach Motoröl und Dieselkraftstoff stank.
Ein jüngerer Offizier drückte ihnen seine Handflächen gegen die Brust und hielt sie auf. »Gehen Sie zurück!«
Cade betäubte den Mann mit einem Schlag ins Gesicht, dann folgte er seinem Vater an ihm vorbei.
Der Rauch stach Cade in die Augen und brannte in seiner Kehle. Er hustete und spuckte die Treibstoffrückstände in seinem Mund aus, während er sich abmühte, mit seinem Vater Schritt zu halten. Fliehende Passagiere strömten auf beiden Seiten an ihnen vorbei. Dann rannte jemand direkt in sie hinein.
Anstatt sie wegzustoßen, umarmte Cades Vater die Gestalt in der Dunkelheit.
Cade blinzelte und erkannte das Profil seiner Mutter. »Mom!«
Sie ließ Blake los, um Cade zu umarmen, gab ihm einen Kuss auf die Wange und setzte sich dann in Bewegung. »Mir geht’s gut! Los!« Sie folgten der Evakuierung bis zum Promenadendeck und reihten sich in die Schlange für die Rettungsboote ein, die über zwei Treppen zu einer Einstiegsplattform über dem Hauptdeck hinaufreichte.
Die Schiffsbesatzung an der Spitze der Reihe tat ihr Bestes, um die Dinge unter Kontrolle zu halten, aber Cade konnte die Anweisungen der Offiziere wegen der schreienden Passagiere, die darum wetteiferten, den sinkenden Cunard-Liner als Erste zu verlassen, kaum hören.
»Haben Sie Geduld, meine Damen und Herren!«, rief ein Lieutenant. »Wir haben Rettungsboote für alle und es bleibt genug Zeit, sie zu Wasser zu lassen! Bleiben Sie ruhig!« Seine Worte beruhigten die Menge, bis das Schiff nach hinten kippte und die Wellen des Nordatlantiks über das Achterdeck schwappten.
Die Schlange drängte vorwärts, nur um gleich wieder zurückzuweichen, als der ranghöchste Offizier seine Waffe zog. »Ruhe!« Der Lieutenant schwang seine Pistole. »Sie gehen an Bord, wenn wir es Ihnen verdammt noch mal sagen!« Er warf einen Blick auf seine Mannschaft, die mit den verhedderten Tauen des ersten Bootes und einem rostigen Kranarm herumfuchtelte. »Schneller!« Er richtete seinen Revolver auf die heranstürmenden Massen. »Sie gehen nach Kabinenzuteilung an Bord! Passagiere der ersten Klasse nach vorne!«
Buhrufe und Proteste erfüllten die Luft.
Eine alte Dame schrie: »Frauen und Kinder zuerst!«
Der Tumult verstummte mit dem Knall eines Schusses. Der Lieutenant stand mit der Pistole in den Himmel gerichtet, Rauch stieg aus der Mündung auf. »Passagiere der ersten Klasse! Sofort einsteigen!«
Cades Vater zog ihn und seine Mutter nach vorne. »Wir sind dran.«
Die Bewohner der Touristen- und Zwischendeckklasse verfolgten Cade, seine Eltern und die anderen Passagiere der ersten Klasse mit bösen Blicken, während sie sich von Verwünschungen verfolgt einen Weg zum Anfang der Schlange bahnten. Eine junge Frau drückte einen Säugling an ihre Brust und betrachtete Cade mit vor Entsetzen geweiteten Augen, als er und seine Eltern die Stufen zu den Rettungsbooten hinaufstiegen.
Vor ihnen wurde das Beladen des ersten Rettungsboots beendet, eine Gruppe nervöser Passagiere saß zwischen zwei jungen Besatzungsmitgliedern der Athenia, je einem am Bug und am Heck des Boots. Cade und seine Eltern beobachteten, wie das Boot ausgesetzt wurde, und Cade wurde klar, dass es eher ein Fluch als ein Segen sein könnte, zu den Ersten zu gehören, die das Schiff verließen.
Verhedderte Seile und schlechtes Timing beim Ausschwenken des Kranarms ließen das Boot kippen.
Die vornehme Gesellschaft klammerte sich aufheulend an Sitze und Reling, um nicht über Bord geworfen zu werden. Ihre weniger wohlhabenden Mitreisenden, die sich noch auf der Athenia befanden, kicherten über die missliche Lage der feinen Pinkel.
Das Gelächter verstummte, als die Seile sich lösten und das Rettungsboot außer Kontrolle geriet. Es richtete sich gerade noch rechtzeitig auf, bevor es auf den Wellen aufschlug, aber es landete hart, und das aufspritzende Wasser des Aufpralls ergoss sich über die Menge an Deck.
Über ihnen bellten Offiziere Befehle im Seemannsjargon an die Mannschaften, die für das Aussetzen zuständig waren. Die meisten der Begriffe ergaben für Cade keinen Sinn, aber die Zusammenfassung des Lieutenants war leicht zu verstehen: »Baut keinen Mist mehr, ihr Bastarde! Lasst noch ein Boot fallen und ich erschieße jeden einzelnen von euch!« Er richtete seinen Zorn wieder auf die Passagiere auf der Treppe.
»Weiter geht’s!« Die Schlange hastete vorwärts. Er zeigte auf die Martins, als sie sich dem oberen Ende der Treppe näherten. »Sie drei! In den Bug!«
Cade stand eingezwängt zwischen seinen Eltern, als ihnen die letzten Plätze am Bug des zweiten Rettungsbootes zugewiesen wurden. Seine Mutter ging zuerst an Bord. Cade fragte sich, ob sein Vater versuchen würde, seinen Platz jemand anderem zu überlassen, aber seine Illusionen über väterliche Ritterlichkeit zerschlugen sich, als sein Vater sich links von ihm auf die schmale Sitzbank setzte. »Halt dich fest, mein Sohn«, sagte sein Vater.
Die beiden dem Rettungsboot zugeteilten Besatzungsmitglieder bereiteten sich auf das Aussetzen vor. Cades Mutter schlang ihre Arme um ihn, als könnte sie ihn vor der Inkompetenz der Mannschaft schützen. Die Seile wurden gespannt und das Boot schwankte, als es vom Oberdeck gehoben wurde. Die Mannschaft schwenkte den Kranarm über die Backbordseite, um es über das Wasser zu bringen. Cades Mutter küsste ihn auf die Wange. »Schließ deine Augen, mein Schatz.« Als er in ihre tränenverschmierten Augen blickte, merkte er, dass sie eher nach Mut suchte, als ihm welchen anzubieten.
Flaschenzugräder quietschten, als die Schiffsbesatzung sich abmühte, das Boot zu Wasser zu lassen. Das Rettungsboot war auf halbem Weg nach unten, da rutschte jemandem das Seil aus der Hand und sie gerieten in freien Fall. Cades Magen sprang ihm in die Kehle und allein die Tatsache, dass er leer war, hielt ihn davon ab, mehr als nur Säure zu spucken. Der Sturz endete mit einem Ruck. Eiskaltes Wasser explodierte über die Reling und durchnässte ihn und alle anderen an Bord. Das Donnern des Ozeans dämpfte die Geräusche der Panik an Bord der Athenia, bis Cade und der Rest der wenigen Glücklichen im Rettungsboot auftauchten und nach Luft schnappten.
»Jemand muss mit dem Ausschöpfen beginnen«, rief das Besatzungsmitglied im hinteren Teil des Rettungsbootes.
Das Besatzungsmitglied am Bug sagte: »Ruder ausbringen! Fangt an zu rudern, bevor das nächste Boot ausgesetzt wird!«
Die Passagiere des Rettungsboots gerieten sich gegenseitig in die Quere, während sie versuchten, die Ruder in den Halterungen zu befestigen, damit sie sich aus dem Landebereich entfernen konnten. Einige Männer in der Mitte des Bootes ruderten, während der Mann am hinteren Ende das Boot in Richtung des halb versunkenen Hecks der Athenia steuerte.
Cade starrte entsetzt auf die Wunde, die der Torpedo in den Schiffsrumpf gerissen hatte. Der klaffende Riss im hinteren Teil des Schiffes schluckte Seewasser und stieß Rauch aus. Auf den unteren Decks breiteten sich Brände aus, die in der zunehmenden Dämmerung aufglühten, bevor sie nach und nach überflutet wurden.
Hinter ihnen startete ein weiteres Rettungsboot. Es fiel mit dem Bug voran und durchbohrte die Oberfläche wie ein Pfeil. Schreckensschreie durchdrangen die Luft, um dann vom Meer erstickt zu werden.
Die Athenia rollte noch weiter nach Backbord und schleuderte ein Dutzend Leute über die Reling in die schäumenden Wellen. Ihr Heck sank mit einem Stöhnen tiefer, das Cade einen Schauer über den Rücken jagte.
Nachdem sie das sinkende Schiff hinter sich gelassen hatten, ruderten die Männer noch angestrengter. Sie folgten dem ersten Boot, das einige Dutzend Meter vor ihnen war und umrundeten das Heck in Richtung Norden, um hinaus aufs offene Meer zu gelangen. Cades Vater fragte den Mann am Bug: »Sollten wir nicht in der Nähe des Schiffs bleiben?«
»Wir müssen vermeiden, dass wir mitgerissen werden, wenn sie sinkt«, erklärte das Besatzungsmitglied über das dumpfe Knarren der Ruder hinweg. »Vertrauen Sie mir, wir wissen, was wir …«
Das Boot schwankte.
Der Mund von Cades Mutter bebte und klappte auf, aber es kamen keine Worte heraus. Sie deutete am Bug vorbei aufs offene Meer und sein Vater verkrampfte sich. Cade versuchte angestrengt zu erkennen, was sie derart in Panik versetzt hatte.
Vor dem Boot gähnte ein Strudel.
Das war keine gewöhnliche Wirbelbildung; Cade spürte, dass etwas Unnatürliches an der Geschwindigkeit war, mit der sich sein Schlund ausdehnte und in der Tiefe versank.
Innerhalb von Sekunden kippte das erste Rettungsboot über seinen Rand und verschwand. Geisterhaftes Licht waberte in dem Wirbel und ein kalter Gifthauch strömte aus seinen Eingeweiden. Cades Vater schreckte vor dem Gestank zurück. Dann schoss ein Tentakel aus dem Strudel, riss das Mannschaftsmitglied vom Bug und zerrte es schreiend in die Tiefe.
»LEVIATHAN!«, zischte Cades Vater, als sei der Name ein Fluch – und dann war er nicht länger der gelehrte Cambridge-Professor, den Cade immer gekannt hatte.
Jetzt hatte er die Augen eines Mörders. Er stand auf, stützte sich mit einem Fuß auf den Bug, griff unter seine Jacke und zog einen verdrehten Stab aus geschnitztem weißem Holz hervor.
»Valerie! Bleib unten!«
Cade starrte ungläubig den Zauberstab an. Was zum Teufel macht er da?
Sieben riesige Tentakel brachen aus dem Strudel hervor und schlugen nach dem Rettungsboot.
Sie wurden nur durch Feuerdolche in Schach gehalten, die der Zauberstab ausspie, während Cades Vater in heiserem, verstümmeltem Latein brüllte: »Vindicta! Morietur, et draconi!«
Die anderen Passagiere ruderten mit hektischen Schlägen, verzweifelt darum bemüht, so viel Abstand wie möglich zwischen sich und die um sich schlagenden Tentakel zu bringen. Aus dem Zauberstab von Cades Vater schossen Blitze, die die schwarzen Glieder der Tiefe eines nach dem anderen einschüchterten, und Blake rief: »Transferam vos!«
Magie? Monster? Cades rationales Weltbild implodierte: Das kann nicht real sein …
Ein riesiger Arm schlug neben dem Rettungsboot ein und verursachte eine Welle, die das Gefährt mit dem breiten Boden wie ein Spielzeug durch die Luft schleuderte. Es landete schräg und das Besatzungsmitglied am Heck wurde über Bord geschleudert. Wasser schwappte über die Passagiere und stieß Cades Mutter in seine Arme. Sie schüttelte den Kopf und spuckte einen Mundvoll Salzwasser aus.
»Mom! Geht es dir gut?« Er wartete, bis seine Mutter nickte, dann wandte er sich nach hinten.
Der Rest der Passagiere stolperte übereinander, um das Heck des Rettungsbootes zu erreichen. Er packte eines der Ruder und riss es aus seiner Halterung. Er hielt es wie einen Kampfstab, wirbelte herum und stellte sich neben seinen Vater.
Seine Mutter sprang auf und griff nach seinem Mantel. »Was hast du vor?«
»Ich helfe Dad!« Er schwang sein Ruder wild gegen die Tentakel, die über ihm wogten.
Sie versuchte, ihn hinunterzuziehen. »Nein, Cade! Tu’s nicht!«
»Mom, er braucht mich!« Er schlug nach einem Tentakel, der nach seinem Vater peitschte, doch das Blatt seines Ruders zerbrach daran.
Sie umklammerte Cades Mantel mit der Faust. »Du weißt nicht, was du …«
Ein weiterer Tentakel schoss aus dem Wasser, wickelte sich um ihren Oberkörper und riss sie fort, bevor Cade zuschlagen konnte. »Mom!«
Sein Schrei ließ den Kopf des Vaters herumfahren. Der ältere Martin drehte sich schwungvoll um und schleuderte Feuerstacheln auf den Tentakelarm, der seine Frau hielt. »Occidere monstrum!«
Eine erdrückende Kraft legte sich um Cades Taille und Brust. Das zerbrochene Ruder fiel ihm aus der Hand und er schrie. Sein Verstand leerte sich vor Angst, als ein Tentakel ihn in die Luft hob, hoch über das Rettungsboot, außerhalb der Reichweite seines Vaters. Der gewaltige Arm rollte sich fester zusammen, während er ihn umherschleuderte. Ein weiterer Schrei kam über seinen Lippen, als einige seiner Rippen brachen.
Unfähig zu atmen, geriet er in Panik. Er trat, schlug um sich und stemmte sich gegen die ledrige Haut und die eisernen Sehnen, die ihn festhielten. Er sah, wie seine Mutter fast ein Dutzend Meter über dem Wasser in dem anderen Tentakel hing. Sie versuchte zu schreien, konnte aber keinen Laut von sich geben, weil sie genauso wie er selbst erstickte.
Sie schwangen aufeinander zu. Er streckte die Hand aus und versuchte, ihre Hand zu ergreifen. Ihre Finger berührten sich, konnten sich aber nicht festhalten. Die Tentakel, von denen sie gehalten wurden, schwangen wieder auseinander, aber der Blick seiner Mutter blieb auf ihn gerichtet. Seine Tränen vermischten sich mit dem Meerwasser, das aus seinem Haar lief.
Unten schmetterte ein dritter Tentakel seinen Vater über Bord. Er verschwand in einer sich brechenden Welle und tauchte einen Moment später wieder auf, den Zauberstab auf Cade gerichtet. »Iustitia et libertas!« Pfeile aus geisterhaftem Licht schossen aus dem Zauberstab und spießten den Tentakel auf, der daraufhin erschlaffte und Cade fallen ließ. Er stürzte auf die Wellen zu und kämpfte darum, seinen Brustkorb auszudehnen, damit er Luft holen konnte.
Sekunden bevor er aufs Meer traf, hielt Cade sich die Nase zu. Er stürzte mit den Füßen voran ins Wasser. Unter der Oberfläche wurde er von Trauergeheul umfangen, als würden alle Toten, die das Meer je gefordert hatte, dem Ozean mit klagender Stimme ein Ständchen bringen. Anstelle von unergründlicher Dunkelheit glühten in der Tiefe höllische Flammen, die Cade mit Grauen erfüllten.
Cade kämpfte gegen den stechenden Schmerz seiner Rippen und trat mit den Beinen, um sich vom Feuer wegzubewegen. Ein paar Meter vor dem Boot durchbrach er die Oberfläche und hustete Salzwasser aus. Sein Vater hatte es in das Rettungsboot geschafft; er lehnte sich über die Bordwand und streckte Cade den Arm entgegen. »Nimm meine Hand!«
Schmerz und Kälte hatten Cade die Kraft geraubt. Ein primitiver Überlebensinstinkt ließ ihn auf das Boot zuschwimmen, obwohl es immer näher an den Strudel herantrieb. Sobald er nahe genug war, hievte sein Vater ihn auf das Dollbord. Cade beugte sich über den Rand des Rettungsbootes, suchte nach seiner Mutter und hoffte, dass auch sie sich aus dem Griff der Kreatur befreit hatte.
Sie war nicht im Wasser. Er sah nach oben. Sie befand sich immer noch im Griff des Tentakels, der sie aus dem Boot geholt hatte. Er rief mit brennender Kehle und rauer Stimme: »Mom!«
Ein widerliches Knacken von brechenden Knochen war zu hören. Ihr Körper wurde schlaff.
»Nein!« Blind vor Wut und Trauer stieß Cade einen heiseren Schmerzensschrei aus. Es war zu spät, ihr zu helfen, trotzdem ging er zornig auf seinen Vater los: »Tu doch was!«
Sein Vater winkelte seinen Arm an, um der Kreatur einen weiteren Schlag zu versetzen. Einer ihrer Tentakel schoss aus dem Wasser, schlang sich um das Rettungsboot und zerquetschte es. Holz splitterte und Wasser strömte herein. Zwei weitere Gliedmaßen peitschten zu beiden Seiten des Wracks aus dem Meer. Eine dritte packte die Beine seines Vaters und begann, ihn von den zerbrochenen Überresten des Bugs in den Strudel zu ziehen.
»Dad!« Die Bestie hatte bereits seine Mutter getötet; Cade wollte nicht zulassen, dass sie ihm auch seinen Vater nahm. Er packte die Hand seines Vaters, dann umklammerte er ein großes Trümmerstück. »Halt dich fest, Dad!«
Die Angst wich aus den Augen seines Vaters und zurück blieb nur von Trauer durchdrungene Liebe.
»Lass ein Licht für mich brennen, mein Sohn.« Er richtete seinen Zauberstab auf Cade: »Fuge!«
Ein Lichtimpuls traf Cade und schleuderte ihn durch die Luft, weit weg von dem Wirbel.
Er überschlug sich unkontrolliert und platschte dann halb betäubt ins Wasser. Er tauchte auf und suchte verzweifelt nach seinen Eltern – nur um mit ansehen zu müssen, wie die Tentakel sie in ihr wirbelndes Chaos hinabzogen. Der Körper seiner Mutter sackte mit einem grotesken Knick in der Wirbelsäule nach hinten, aber sein Vater wehrte sich mit einem Schwall von Schimpfwörtern auf den Lippen und einem feuerspeienden Zauberstab gegen sein Schicksal.
Farbige Strahlen schossen über Cades Kopf hinweg und trafen das Biest. Er wirbelte wassertretend herum und wunderte sich dann über den Anblick von drei Fremden, die sich dem Kampf anschlossen. Ein graubärtiger Mann schwebte in der Luft, sein langer Mantel flatterte, während er Feuerkugeln auf die Meereskreatur schleuderte. Ein junger Mann im Anzug sprintete über die Wellen und beschwor dabei schimmernde Pfeile. Ein dritter Mann, der zu weit entfernt war, als dass Cade ihn deutlich hätte erkennen können, stand auf dem schiefen Deck der Athenia; mit balletthaften Gesten ließ er bewusstlose Überlebende aus dem Wasser schweben und setzte sie in ein schwankendes Rettungsboot, dessen Passagiere alle ohnmächtig waren.
Cade hörte ein furchterregendes Zischen und ein Schrei ließ seinen Kopf in Richtung des Strudels herumzucken.
Blitze schossen aus dem Zauberstab seines Vaters und stachen in den Wirbel, der ihn, das Monster und Cades Mutter verschlang.
Der Schlund schrumpfte zusammen und die Nordsee rauschte heran, um seinen Platz einzunehmen.
»Nein!« Cade paddelte mit müden Armen auf die letzten Überreste des Strudels zu, getrieben von der irrationalen Hoffnung, er könne seine Eltern noch retten.
Der Wirbel schloss sich mit einem Donnerschlag und setzte einen Puls eisiger Schwärze frei, der Cade traf und ihn benommen zurückließ. Seine Arme schlossen sich um ein großes Stück Treibgut, das der Aufgabe, ihn über Wasser zu halten, nicht gewachsen zu sein schien. Verwundet und erschöpft spürte er, wie seine Kräfte schwanden. Seine Glieder wurden träge und steif, bis er sich überhaupt nicht mehr bewegen konnte.
Ich habe sie im Stich gelassen. Sie sind fort. Mom und Dad sind fort.
Er zitterte. Der Ozean rief und lockte ihn, seinen Eltern in seine eisige Umarmung zu folgen. Sein Kummer war unerträglich, eine Last, die er nicht abschütteln konnte. Er war bereit, die Einladung des Meeres anzunehmen, loszulassen und in der Tiefe zu verschwinden.
So kalt … so müde …
Er ließ das Treibgut los und überließ sich dem Meer. Es zog ihn nach unten – bis eine schlanke Hand sein Handgelenk packte und ihn zurück an die Oberfläche zerrte.
Alles, was er von seiner Retterin sah, war die Silhouette einer langhaarigen jungen Frau.
»Halte durch«, sagte sie mit slawischem Akzent.
Der Rabe landete auf dem Treibholz neben Cades Gesicht.
Sein verärgertes Krächzen war das Letzte, was er hörte, bevor er sich in der Dunkelheit verlor.
In den steinernen Hallen der Wewelsburg waren jegliche Geräusche weithin zu hören. Schritte konnten scheinbar stundenlang widerhallen und selbst Geflüster schien in der Renaissance-Festung ein Eigenleben zu entwickeln. So war es für Briet Segfrunsdóttir keine Überraschung, als sie aus zwei Stockwerken Entfernung hörte, wie die Standuhr im Arbeitszimmer des Ostturms Mitternacht schlug und das Schloss mit ihrer Melodie erfüllte.
Während sie die Treppe hinaufstieg, waren ihre Schritte nicht zu hören. Sie erfreute sich an ihrer magischen Verstohlenheit. So bewegte sie sich am liebsten durch die Welt: mit der Anmut eines Geistes.
Die Tür des Arbeitszimmers war angelehnt. Sie klopfte zweimal an den Türpfosten. »Meister Kain?«
Seine Antwort ließ auf sich warten. »Herein.«
Sie öffnete die Tür und trat ein. Kain saß in einem mit bordeauxfarbenem Leder gepolsterten Lehnsessel. Seine Füße waren zum schwarzen Marmorkamin hin ausgestreckt und lagen auf dem zum Sessel passenden Polsterhocker. Der Raum war, wie der Rest des Schlosses, erst kürzlich mit großem Aufwand umgestaltet und eingerichtet worden. Getrübt wurde der luxuriöse Anblick durch eine Fülle von Nazi-Symbolen: in den Kaminsims geschnitzte Hakenkreuze, Himmlers »Schwarze Sonne« zierte einen Wandteppich hinter dem Schreibtisch und die Fahne des Dritten Reichs hing über dem Kamin.
Kain hingegen verkörperte Schlichtheit. Er war groß und von schlanker Gestalt mit einem attraktiven, glatt rasierten Gesicht. Sein goldblondes Haar war kurz geschoren und mit Pomade geglättet. Er trug einen dunklen Anzug aus maßgeschneiderter Seide und ein elfenbeinfarbenes Hemd, das seinem sehnigen Körperbau schmeichelte. Die Krawattennadel in seinem burgunderroten Schlips und seine Manschettenknöpfe waren aus Stahl mit Onyx-Pentagrammen. Seine maßgefertigten schwarzen Lederschuhe waren bis hin zu ihren Sohlen so makellos wie der Rest von ihm.
Er schlug das Buch zu, in dem er las. »Was gibt es Neues, Briet?«
»Ein Telegramm von Oberleutnant Lemp auf der U-30, weitergeleitet von der Kriegsmarine. Wie von Ihnen gewünscht, hat er die Athenia vor etwa zweieinhalb Stunden torpediert und versenkt.«
Ein wissendes Grinsen. »Ja, ich habe die Neuigkeiten schon von Unten gehört.« Er legte sein Buch auf einen Beistelltisch und stand auf. »Die Familie Martin ist nicht unter den Überlebenden.«
Sie trat vor und reichte ihm das Telegramm, das sie aus dem Funkraum des Schlosses hochgebracht hatte. »Lemp schwört, dass er den Vorfall aus seinem Logbuch gelöscht hat.«
»Gut. Jetzt kann Admiral Dönitz das Ganze einen Unfall nennen.«
»Wenn er das tut, werden die Briten und Amerikaner Zeter und Mordio schreien.«
Er nahm die Konsequenzen achselzuckend hin. »Ein kleiner Preis, den man zahlen muss.«
Briet war darauf trainiert worden, keine neugierigen Fragen zu stellen, aber sie konnte nicht anders. »Heißt das, wir waren erfolgreich?«
»Jetzt, wo Cade Martin tot ist, ist das letzte Hindernis für unsere Arbeit beseitigt.«
Er zerknüllte das Telegramm und warf es in den Kamin. »Sagen Sie dem Führer, es steht ihm frei, so zu verfahren, wie wir es besprochen haben.« Das Licht des Feuers tanzte in seinen Augen. »›Lang ist der Weg und hart, der aus der Hölle zum Lichte führt.‹ … Wenn Siegmar heimkehrt, beginnt unser großes Werk.«
1940
DEZEMBER
Die innere Stille wich der äußeren Stille. Das Vergessen wurde durch das Gewicht des bloßen Seins verdrängt und der Trost der Dunkelheit glitt davon. Formlose Gedanken gewannen ihre Gestalt zurück. Atome der Identität kehrten wieder, zuerst einzelne Spione, dann ganze Bataillone. Die vertrauten Gezeiten der Atmung setzten sich durch. Das Bewusstsein dämmerte, träge und neblig.
Dann kam eine Flut von Angst und untröstlichem Kummer.
Cade erwachte keuchend. Sein Geist war immer noch auf dem Meer, gefangen im kalten Wasser, seine Seele am Boden zerstört und wund davon, seine Eltern in den Tiefen versinken zu sehen. Er schlug die Hände vors Gesicht und würgte seine Trauer mit kehligem Schluchzen heraus, bis sich sein Körper so leer anfühlte wie sein Herz. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich ihnen das letzte Mal gesagt habe, dass ich sie liebe; jetzt werde ich es nie wieder tun können. Sie sind fort. Für immer.
Seine Tränen waren noch warm auf seinem Gesicht, als Stille ihn überkam.
Bin ich tot? Cade atmete langsamer und gab seinen Augen Zeit, sich anzupassen. Er befand sich in einem dunklen Raum, den er noch nie gesehen hatte. Er war nicht tot, aber er war allein an einem fremden Ort, ohne Gesellschaft oder Erklärung. Das verhieß nichts Gutes.
Wo bin ich?
Schummriges, violettes Licht fiel durch ein Fenster hinter ihm zu seiner Linken. Im Kamin zu seiner Rechten glühte ein Haufen Holzscheite. Er lag auf einem schmalen Bett in einem Raum mit Holzfußboden und schlichten Wänden. Die Eichentür gegenüber dem Fenster war geschlossen.
Rechts vom Kamin, in der Ecke, die am weitesten von der Tür entfernt war, führte ein kleiner Torbogen zu einem weiteren Raum mit mindestens einem Fenster.
Das ist kein Krankenhaus. Bin ich ein Gefangener?
Er schlug die Bettdecke zurück und setzte sich auf. Seine Füße waren nackt und der Flanellschlafanzug, den er trug, wirkte sackartig und saß schlecht. Er schaute sich kurz um und konnte keine Spur seiner Kleidung entdecken. Er zog die Taillenschnürung der Pyjamahose so fest zu, wie es ging. Das sollte reichen.
Er stand auf. Es fühlte sich merkwürdig an zu stehen. Der Boden war kalt und seine Beine zitterten unter seinem Gewicht. Sein Magen knurrte und er fragte sich, wie lange es her war, dass er etwas gegessen hatte.
Unsichere Schritte brachten ihn zum Fenster. Vor der Scheibe war ein mit Schnee und Eis bedeckter Wehrgang mit Zinnen zu sehen. Dahinter erstreckte sich ein Panorama aus Seen und Hügeln, die unter winterlichen Leichentüchern schlummerten. Es war eine Landschaft, die Cade bisher nur auf Fotos gesehen hatte: die schottischen Highlands. Wie zum Teufel bin ich hierhergekommen? Und warum?
Ein Krächzen außerhalb des Fensters ließ ihn zusammenzucken. Auf einer Zinne hockte ein Rabe. Der Vogel starrte ihn an, als ob er Streit suchte. Er legte den Kopf schief, dann reckte er den Kopf vor und krächzte, als wolle er ihn ausschimpfen. Cade wich vom Fenster zurück.
Das kann nicht derselbe Vogel sein, den ich auf der Athenia gesehen habe, oder? Was ist hier los?
Die Neugierde lockte ihn in den angrenzenden kleinen Raum. Auf der niedrigen Kommode fand er einen Rundfunkempfänger – oder, wie er es früher genannt hatte, bevor er mit vierzehn Jahren nach England gezogen war, ein Radio. Er schaltete es mit einem Drehknopf ein und fummelte am Senderregler herum. Statisches Rauschen drang aus dem Kasten, bis er einen Kanal fand, auf dem gesendet wurde. Eine ferne Stimme mit trockenem englischem Akzent durchbrach das Rauschen.
»… während Feuerwehrleute darum kämpfen, das einzudämmen, was viele inzwischen als ›das zweite große Feuer von London‹ bezeichnen. Berichte des Informationsministeriums deuten darauf hin, dass der nächtliche Angriff der tödlichste seit Beginn der Bombenangriffe war. Er hat mehr als einhundertsechzig Personen im Großraum London das Leben gekostet, womit die geschätzte Gesamtzahl der zivilen Opfer seit September ungefähr einundvierzigtausend beträgt. Innenminister Herbert Morrison beeilte sich jedoch zu bestätigen, dass die St. Paul’s Cathedral diese neuste Blitzkriegsnacht überstanden hat. Im Namen von Premierminister Churchill gelobte er: ›Sie wird nicht fallen, solange freie Briten noch Atem schöpfen.‹« Eine düstere Pause. »Nur noch wenige Stunden verbleiben im Jahr 1940, liebe Zuhörer, und das neue Jahr bringt …«
Cade schaltete das Radio aus. Er fühlte sich hohl und wie betäubt.
Silvester 1940? Ich habe sechzehn Monate lang geschlafen? Er betrachtete sich im Spiegel über der Kommode. Sein Haar war zerzaust und ihm war ein Bart gewachsen – dennoch erinnerte er sich nicht an irgendwelche Träume und seine Muskeln waren nicht verkümmert. Wenn ich eineinhalb Jahre weggetreten war, sollte ich nicht mehr stehen, geschweige denn gehen können. Und hier gibt es keine medizinische Ausrüstung, also kann ich nicht im Koma gelegen haben. Je länger er über seine Situation nachdachte, desto weniger Sinn ergab sie. Was zur Hölle ist hier los?
Ein anderer Gedanke kam ihm in den Sinn: Jemand musste ihm den übergroßen Pyjama gegeben haben, den er trug. Vielleicht hatte man noch andere Kleidung hiergelassen, die er nehmen konnte.
Ausleihen, korrigierte er sich.
Er öffnete die Schubladen der Kommode und fand, was er brauchte – Unterwäsche, eine braune Hose mit dunkelgrauen Hosenträgern, ein zerknittertes Leinenhemd. Sie waren alt, fühlten sich aber angenehm an. Das reicht fürs Erste.
Als er seinen Schlafanzug gegen normale Kleidung tauschte, sah er im Spiegel eine Reflexion seines Rückens in der Fensterscheibe hinter ihm. Da war etwas zwischen seinen Schultern.
Er wandte sich vom Spiegel ab, dann verrenkte er den Kopf, um über seine Schulter einen Blick auf das mit Sepiatinte gezeichnete Symbol zwischen seinen Schulterblättern zu werfen:
Was zur …? Er hatte keine Ahnung, was es war oder wer es dort hingemalt hatte. Das wird von Minute zu Minute seltsamer. Er zog sich fertig an, dann entdeckte er ein Paar bereits getragener schwarzer Lederstiefel vor der Fensterbank. Na also. Er hob sie auf und hielt einen an seine linke Fußsohle. Sie hatten seine Größe.
Er setzte sich auf die Fensterbank und zog die Stiefel an. Als er den zweiten fertig geschnürt hatte, entdeckte er in der Ecke neben der Kommode einen Stapel alter Zeitungen.
Sie waren nur schlampig gefaltet und der Stapel war unordentlich; sie waren offensichtlich von jemandem gelesen worden.
Er nahm die oberste Zeitung vom Stapel.
Es war die Londoner Daily Mail