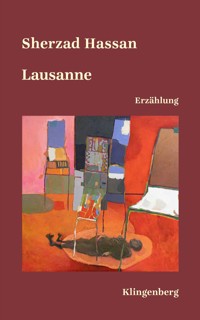9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Klingenberg
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Finnland zur Neujahrsnacht. Während alles auf den Beinen ist, um zu feiern, sitzt ein Flüchtling alleine in seiner Unterkunft. Gesellschaft leistet ihm zunächst nur der Wein, aber dann auch Jesus Christus, der über eine Leiter vom Himmel herabsteigt und an seinem Tisch Platz nimmt. Er sei gekommen, um zu vollbringen, was beim ersten Mal nicht gelungen war: die Menschheit zu erretten. Sein einziges und letztes Wunder sei es, die Botschaft der Liebe zu verkünden. Sein Gegenüber, ein fürsorglicher advocatus diaboli, zweifelt an diesem Vorhaben und will Jesus davon abbringen, denn die Menschen seien seit Golgatha nicht besser geworden. »Sie werden dich wieder ermorden! Wer Liebe sät, erntet Blutvergießen.« Der vor Gewalt und Verfolgung Geflohene versucht also, den Retter zu retten. Und das, obwohl Jesus ihm die Liebe seines Lebens abspenstig gemacht hatte. Diese letzte Nacht, in der Jesus herabsteigt, erzählt von den großen Fragen einer Menschheit, die nicht in Frieden leben kann. Dabei kommt es zu einer berührenden Begegnung mit einem Erlöser, der erstaunlich menschlich ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Ähnliche
Inhalt
I
II
III
IV
Vier Fragen an Sherzad Hassan
Über den Autor
Über die Übersetzer
Impressum
I
Ich hatte immer schon, eigentlich seit ich denken kann, diese seltsame Eigenheit: Im Gegensatz zu all meinen Freunden, Verwandten und Altersgenossen mochte ich weder Trauerfeiern noch fröhliche Feste. Um es kurz zu machen: Seit jeher graute mir vor Menschenmassen. Ich war schon als Kind das Spielen schnell leid. Gleich, ob man mir Murmeln vorsetzte, Guli Danda, Fußball, oder welches verflixte Spiel es auch immer sein mochte. Ein Kind denkt ja normalerweise nicht darüber nach, wofür solche Spiele gut sein sollen. Aber ich Unglückseliger tat das. Nach jedem Spiel und jedem sinnlosen Wirbel stellte ich mir die Frage: Und, wozu war das jetzt wieder gut? In den Augen der anderen war ich ein Griesgram, eigenartig und mürrisch. Ein Einzelgänger, den Leuten und der Welt fern.
Wenn ich heute darüber nachdenke, warum ich so eigentümlich war, gibt es nur eine Erklärung dafür: Es war meine übermäßige Angst, diese unüberwindbare Scheu vor allen anderen. Sie mussten mich immer zum Spielen zerren. Dabei war ich in keinem dieser Spiele weder talentiert noch als lausiger Statist brauchbar. Das Einzige, was mir gefiel, war zu rennen. Es war ein Galoppieren, mit dem ich mich mit Windhunden, Katzen und entlaufenen Eselhengsten maß. Vielleicht tat ich das aus der Befürchtung heraus, meine Altersgenossen könnten mir auflauern, um mich, wie so oft, zu schikanieren und zu verprügeln. Für einen solchen Fall hielt ich mir stets einen anderen Weg offen, auch wenn dieser viele Stunden länger war. Wenn ich in der Klemme steckte, musste ich wie ein Pfeil, der den Bogen verlässt, die Luft durchschneiden, um ihnen zu entwischen. Ich rannte los und traute mich nicht zurückzublicken, um nicht eines der Kinder zu sehen, die mir möglicherweise noch im Nacken saßen und mich zermalmen wollten.
Beim jährlichen Laufwettbewerb in unserer Stadt belegte ich meist den ersten Platz, oder wenigstens den zweiten. Darauf war ich sehr stolz: Es war auch das Einzige, womit ich in der Schule angeben konnte. Für alles andere war ich nicht zu gebrauchen. Aber das Rennen wurde gewissermaßen zu meiner Gewohnheit. Ich rannte, ob es nun einen Grund dafür gab oder nicht. Vor allem rannte ich, weil alle Bewohner in unserem Viertel, Väter, Mütter und enge Verwandte, uns Kinder, ob begründet oder unbegründet, verprügeln durften. Diese Gewalt. Sie war schlimmer, härter, als das, was wir Kinder ertragen konnten. Ich war ein Duckmäuser und meine Angst entfachte in den Erwachsenen noch mehr das Feuer, uns zu peinigen. Sie hatten mir erzählt, dass Schlangen, Hunde, Wölfe und Löwen nur auf diejenigen losgingen, die ihre Angst zeigten. Aber nicht nur Tiere können diese Angst wittern, sondern auch Menschen. Und genau diese Angst in unseren, vor allem in meinen Augen befeuerte ihre Lust, auf uns loszugehen, ob wir nun etwas angestellt hatten oder nicht. Mich haben die Erwachsenen immer besonders hart bestraft. Die Angst vor ihren Hieben, ihrer Wut, trieb mich dazu, mich aus dem Staub zu machen. Wie ein Windhund. So ging es das ganze Jahr, vom Frühjahr bis zum Winter, vier Jahreszeiten der Angst.
Meine Schulkameraden glaubten, dass ich diese Wettrennen nur deshalb gewann, weil ich wegen meiner Feigheit so schnell laufen konnte. Darum brachte sie die Freude über meinen Sieg weder zum Applaudieren noch machte sie meine Niederlage traurig. Doch in Wahrheit kannte niemand das Geheimnis hinter den Gold- und Silbermedaillen, die ich einheimste: In dem großen Stadion unserer Stadt war für mich nur eines wichtig. Ich wollte die leuchtenden Augen meiner gleichaltrigen Nachbarin Meryam auf mich gerichtet wissen, ohne dass ihr Blick auch nur durch einen einzigen Wimpernschlag unterbrochen würde. Unter den hunderten, die da applaudierten, konnte ich den Klang des Lufthauchs heraushören, den ihre zarten Handflächen beim Klatschen erzeugten, wenn sie voller Freude sah, wie ich den anderen Jungen davonflog. Ich rannte wie in einem Rausch, um dann vom Podest aus, beim Empfang der Medaille, den Ausdruck vollkommener Glückseligkeit auf ihrem zarten Gesicht sehen zu können.
Oh, meine Meryam! Oh, diese meine Meryam, die mir gemeinsam mit Jesus in der Christnacht so kummervolle, so sehnsüchtige Gedanken bereitet hat. Immer, jedes Jahr zur Weihnachtszeit, werde ich traurig und unruhig. Jesus und meine Herzens-Meryam, beide werden sie zu Gästen meines Herzens, meiner Seele, meiner Fantasie, ob ich es will oder nicht. So wie auch in dieser Nacht.
Schon in meiner Kindheit und bis heute konnte ich nicht verstehen, warum bei den Trauerfeiern das Rudel junger Männer unseres Viertels betrübt und still dasaß, sie mit ihren Rosenkränzen spielten, Zigarillos rauchten oder ihre Schnurrbärte zwirbelten. Nur ältere Männer, die das Sagen hatten, konnten vielleicht diese öde, geistlose Stille brechen. Sie taten das aber nur mit den üblichen leeren Floskeln, die ich bis heute für geschmack- und geruchlos halte, denn es waren nichts als moralistische Ermahnungen, die an uns Unmündige gerichtet waren. Bei Festen und Feierlichkeiten beachtete niemand uns Jungen und Mädchen, und es befiel mich regelmäßig eine tiefe Traurigkeit bei diesen Anlässen. Dutzende Male schlich ich mich davon und fand Zuflucht neben einer Mauer, wo ich erstickt und schluchzend weinte. Meine Mutter geriet außer sich, als ich sie fragte: »Was soll ich nur tun, wird das denn immer so weitergehen?« Diese Frage konnte ich vor meinem Vater nicht aussprechen, denn zur Antwort kassierte ich betäubende Ohrfeigen und Tritte.
Die Nachbarn und die mir Nahestehenden fragten immerzu, warum sich ein Junge wie ich so sehr zurückziehen würde. Warum ich mich bei den bedrückenden Trauerfeiern, wo sich Frauen und Männer wehklagend selbst geißelten, aber auch bei fröhlichen Festen, in ein Loch auf einem verlassenen Grundstück, neben der Mauer eines Metzgerladens oder unter einem Baum des verwilderten Waldes dieser Stadt verkroch und mir die Seele aus dem Leib heulte. Vielleicht fragten sie sich, woher dieses in jungen Jahren ungewöhnliche Gefühl des Fremdseins rührte.
Noch seltsamer war für meine Mutter, dass ich heimlich an ihren Kleidern, denen meines Vaters und meiner Geschwister schnupperte. Ohne erklärbaren Grund vergaß ich mich dabei und wurde wie berauscht. Jedes Kleidungsstück hatte seinen eigenen Geruch. Besonders der Duft der Kleider meiner Mutter versetzte mich in eine Art Trunkenheit. Der modrige Geruch, der der Kleidung meines Vaters entströmte, tat mir dagegen in der Seele weh. Die Kleider meiner Schwestern rochen angenehmer als die meiner Brüder. Einmal, als ich vollkommen abwesend war, fragte mich meine Mutter: »Mein Sohn, wann hörst du mit dieser schlechten Angewohnheit auf? Mein Junge, hör auf mit diesem abartigen Benehmen! Wir sind doch gar nicht weg! Du tust so, als würdest du uns vermissen müssen!«
** *
Viele Jahre später wurde mir klar, dass ich an mir selbst das Fremdsein roch und nicht an meinen Verwandten. Dieses Fremdsein trug ich in meiner Seele. Je älter ich wurde, umso tiefer wurde diese Empfindung. Warum es mich bis heute begleitet, weiß ich nicht. Die Jahre vergehen und die Wurzeln dieses Gefühls dringen tiefer und tiefer in meine Existenz ein. Warum war meine Seele zu Ramadan und dem Opferfest immer so betrübt? Dass ich keine neuen Schuhe, keine neue Kleidung und kein Geld bekam, wie all die anderen Kinder, verstärkte mein Gefühl, nicht dazuzugehören. Zugleich wuchs mein Groll gegen die Welt. Auch nun, bei dem zur Mode gewordenen Wirbel um Weihnachten und um den Jahreswechsel, kann ich die Freude meiner Mitmenschen nicht teilen und es verkrampft sich alles in mir, wenn ich auch nur daran denke. Was mich jedoch von den anderen unterscheidet, ist wohl ein wenig speziell: Es ist mein ganz persönliches Fest der Melancholie und der Traurigkeit, das ich für mich – und nur für mich allein! – ausrichte. Ich brauche nicht viel: eine gute Flasche Wein, aber ein Fusel tut’s auch, und ein paar Musikkassetten. Dann lasse ich mich weit wegtragen vom Treiben der Welt mit ihren alltäglichen Freuden und ihrer scheinbar so selbstverständlichen, aber für mich unerträglichen Oberflächlichkeit.
Auch heute Nacht, irgendwo dort, wo der nördliche Wendekreis verläuft, begehe ich mein kaltes, bescheidenes Fest. Ich sitze hier, nur in Gesellschaft all meiner Gedanken, meinen Sorgen und meinen Träumen. Ein neues Jahr ist im Anmarsch. Vor mir ein paar brennende Kerzen, die dahinschmelzen wie meine Lebensjahre. Das Knistern der herunterbrennenden Dochte ist wie das Knistern der brennenden Adern meines Herzens. Das tropfende Wachs bildet Tränen. Sie fließen ununterbrochen, wie meine eigenen. Ich bin derart am Boden zerstört, dass ich es nicht wage, die Fotos meiner Frau und meiner Kinder hervorzuholen.
In den ersten drei Monaten hier an diesem Ort hatte ich mit großer Sehnsucht die im Nebel liegenden Gesichter auf dem Fotopapier betrachtet und der Schmerz in meiner Brust ließ mich kaum atmen. Seit kurzem aber suchen mich Sorgen und Traurigkeit noch häufiger heim und die Tränen brechen wie eine Sturzflut aus mir heraus. Die Fotos erinnerten mich an meine Einsamkeit, und an ihre. Darum habe ich aufgehört, ihre Fotos nebeneinander aufzulegen und sie zu betrachten.
Ich hebe meinen Kopf und sehe meinen Schatten. Er tanzt und wandert auf den Wänden hin und her, lebendiger und sorgloser als ich selbst. Vom Alkohol berauscht denke ich mit einem Mal an Jesus Christus, an die kräftezehrenden Tage um seine Geburt, seine Heimatlosigkeit und an die Weisheit in seinen Botschaften bis hin zu seinem Tod am Kreuz. In der Zeit zwischen den Jahren herrscht in mir kein Seelenfriede. Mir ist nicht nach Feiern, Singen und Tanzen. Ich frage mich, ob es heute Nacht jemanden gibt, der über all die Schmerzen von Jesus nachdenkt, die er am Kreuz über sich ergehen lassen musste, oder über all das Blut, das seinen schmalen Körper hinabrann. Ähnlich geht es mir, wenn ich an das Opferfest denke und an jenen Moment, als Vater Abraham das Messer an Isaaks Kehle legte. Warum wurden Isaak und Jesus überhaupt zu Opfern gemacht? Warum ließen es die Väter zu, dass ihre Söhne in jungen Jahren ihr helles Blut einem Wunsch opferten, den nur der Himmel kennt? Wie im Fall von Jesus, dessen Blut angeblich vergossen wurde, um eine Botschaft zu überbringen und um irgendwelche religiösen Wunschträume zu erfüllen. Was könnte es wohl bedeutet haben, als Jesus beim letzten Abendmahl zu seinen Jüngern sagte: »Nehmet und esset alle davon: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Nehmet und trinket alle daraus: Dies ist mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird«? Mir stellt sich wieder die Frage: Was passiert nach diesem Abend? Solange ich denken kann, bin ich nervös und zerrissen in den Tagen, Nächten und Wochen vor der Christnacht, versunken in meine Einsamkeit und mein Grübeln, und ich lasse noch einmal all die Kälte und Wärme des vergangenen Jahres an mir vorüberziehen, blättere durch die schwarzen und weißen Seiten meiner Lebensjahre, die wie vom Wind verweht wurden. Die meisten dieser Blätter sind schwarz wie Pech, wie mein Pech.
Keine der Einladungen zu den Feierlichkeiten in dieser Neujahrsnacht können mich locken. Mich kümmern auch nicht all die Werbeeinschaltungen für die Feiern in Kneipen, in Clubs und in den großen Hotels, Konzerte und dergleichen. Überall dasselbe Versprechen: Kommt, hier erlebt ihr die schönste Nacht des Jahres! Wo europäische und orientalische Musikgruppen die schönste Musik spielen, das beste Essen und die köstlichsten Getränke serviert werden!
Solche Menschenaufläufe und Versammlungen sind bei uns im Orient noch abstoßender: Alle sind so sehr darauf bedacht, andere Leute zu beobachten und zu zerpflücken, dass sich kaum jemand an dem Geschehen selbst erfreut. Anscheinend liegt es an mir, dass ich keinen Sinn in diesen mich anwidernden Anlässen und Feierlichkeiten finde. Wahrscheinlich bin ich einfach von Grund auf abnormal und deswegen ständig so nachdenklich und von Trauer erfüllt. Wie kann es sonst sein, dass sich die anderen alle solchen Festen hingeben, aber ich kann das nicht? Offenbar bin ich ein lustloser Miesepeter. Kurz und kurdisch gesagt: Ich bin mon, ein Kotzbrocken. Da ich nun schon dabei bin, mich selbst herunterzumachen, sollte ich vielleicht noch ergänzen, dass mich sowohl die Trauerfeiern als auch die Feste in meiner Heimat deshalb anekeln, weil sie nicht jenen der anderen Kulturen der Welt ähneln. Bei uns besteht kaum ein Unterschied zwischen Trauerfeiern und fröhlichen Festen. Beide bestehen aus Gedränge, Geschrei, Hysterie und sonst nichts.
Das Schlimme an der Sache und warum ich mich von diesen Anlässen fernhalte, ist, dass mir die zusammengeschmiegte Gesichtermasse auf beiden Festen ein befremdliches Rätsel ist. Dieser Zustand macht mir klar, dass es sich bei diesen sogenannten Festen, bei denen man sich Masken vors Gesicht hält, um nichts anderes handelt als um einen großangelegten Selbstbetrug. Sie gehen so gerne ins Kollektiv, um sich dort selbst zu beweisen, dass sie existieren und lebendig sind. Vielleicht liegt es an meiner grundsätzlichen Skepsis gegenüber einem verlogenen Zugehörigkeitsbedürfnis.
Vielleicht erkennt ihr ja auch, was ich sehe, wollt es aber nicht aussprechen. Oder ihr seid zu stark beherrscht von den Regeln der Gesellschaft, die es euch nicht erlauben, sie zu hinterfragen. Oder meine Abneigung kommt einfach daher, dass ich ein Angsthase bin. Vielleicht renne ich, wie früher schon als Kind, aus Angst und Scheu vor der Zivilisation und überhaupt vor allem weg.
** *
Genau deshalb sitze ich heute Nacht wohl allein in dieser Flüchtlingsunterkunft. Nur eine Flasche Wein, Bachs Matthäuspassion und ein paar Kerzen leisten mir Gesellschaft. Diese Dinge stehen mir so nahe, dass sie mir viel mehr Verständnis schenken als meine Mitmenschen. Außer mir sind alle bereit und schon seit den frühen Abendstunden herausgeputzt. Sie meinen: »Vergnügen, Tanz, Trunkenheit und Lust, nehmt euch in Acht, wir kommen!« Ich denke, heute Nacht bin ich wirklich und wahrhaftig die einzige Seele in diesem Haus, das sonst bewohnt ist von Menschen unterschiedlichster Herkunft: Somalier, Afghanen, Araber, Iraner, Afrikaner, Serben, Inder, Lateinamerikaner und Menschen dutzender anderer Nationalitäten aus der ganzen Welt, die mir im Augenblick entfallen sind. Wir alle warten auf einen Fetzen Papier, um zu beweisen, dass auch wir das Recht auf Leben haben. Auf dem Papier steht geschrieben, warum, wie und wann wir geflüchtet sind – ein Haufen Geschichten, zusammengesetzt aus Wahrheiten und auch Lügen.
In der Stadt sind überall noch die Relikte der Feiertage. Ein grüner Baum, übriggeblieben von Weihnachten, beladen mit Lichterketten, farbigen Glaskugeln, geflügelten Engeln, einer Weihnachtsmannfigur und anderem Kitsch, taucht vor deiner Nase auf. Der sogenannte immergrüne Baum als Symbol für den Tag von Christi Geburt. Es war dies die Nacht der Aussöhnung zwischen Geliebten und auch die Nacht der Verlassenen, in deren Herzen kein Platz für Hass ist. Es war die Nacht des Austauschens von Millionen von Geschenken und auch die Nacht, in der eine Versöhnung sogar unter den dickköpfigsten Widersachern möglich ist, die Nacht der Zusammenkunft von Vätern, Müttern, Kindern und Verwandten, die über die ganze Welt verstreut sind.
Heute aber ist die Nacht des Tanzes und der Heiterkeit, wenn man ein Herz hat, die Nacht des Betrinkens und sich Vergessens, wenn man einen Kopf hat, die Nacht des Umarmens und Einanderhochhebens, wenn man Hände und Arme hat, die Nacht des Genießens der Schönheit, wenn man Augen hat, die Nacht des Küssens und Schmusens, wenn man Mund und Lippen hat, die Nacht des Singens, wenn man gute Stimmbänder hat. Es ist die Nacht, in der man das Schlafen vergisst und in der es sogar die Alten hinauszieht. Diese Stadt und hunderte andere Städte dieser Welt atmen unbekümmert wie ein riesiges Lebewesen. Ihr Atem ist so warm, dass ich seine Wärme spüren kann. Die Stadt schwitzt mitten im Winter und zeigt gemeinsam mit tausenden anderen Städten ihren unbedeckten Hals. Alle torkeln in ihrer Trunkenheit und pfeifen auf die Kälte und den eisigen Wind. Es gibt Mädchen und Frauen in leichten Kleidern, aus Stoff so dünn wie Brautschleier. Sie sind nicht wie ich. In ihren Herzen und Seelen glüht ein Ofen. Die jungen Männer ohne Mantel und Fellmütze setzen sich mit offenen Hemden dem Schneewind aus. Ständig stimmen sie ein grundloses Gelächter an, fallen sich kichernd in die Arme. Es ist, als wäre heute die letzte glückliche Nacht des Lebens. Alle wollen sie ein großes Spektakel veranstalten, um auf den Gipfel des ersehnten Glücks zu steigen. Aber ich steige ihnen nicht nach und ich beneide sie auch nicht darum. Ich werde meine alte Gewohnheit nicht ablegen, egal, ob aus Verrücktheit, Dummheit, Geisteskrankheit oder weiser Voraussicht. Denn ich bin vertraut mit dem Kummer solcher Nächte, ihrer düsteren Stimmung und meiner Einsamkeit.
** *
Seit ich in diesem Flüchtlingsquartier untergebracht wurde, träume ich von einer ruhigen, stillen Nacht, in der ich nicht das Geschrei und Kreischen der Kinder der anderen Flüchtlinge höre. So eine Nacht wird es nicht mehr geben. Ich habe mir zwei Flaschen Wein gekauft. Zum Knabbern gibt es Apfelschnitze, Pistazien und Joghurt mit Gurken. Bedächtig trinke ich und wünsche mir, dass ich in einen betäubten, friedlichen Schwips hinübergleite, damit die Last auf meinen Schultern leichter werde. Durch das Fenster beobachte ich die vorbeifahrenden Autos und die vorüberziehenden Menschen, die unter den Schneeflocken der beleuchteten Nacht mehr einem Trugbild gleichen als der Realität. Ich bin gänzlich in meine Betrübtheit versunken. Zuweilen weht ein leiser Hauch von Fröhlichkeit durch mein Herz, aber diese stirbt sehr schnell wieder ab, ganz so, als würde ich sie mir selbst nicht gönnen. Tieftraurig betrachte ich einen einsamen Baum vor meinem Fenster, dessen Äste und Zweige ich schon über Monate hinweg anstarre. Immerzu saß ich da und beobachtete seinen Wandel mit den Jahreszeiten. Wie er sich mit Blättern und Blüten verkleidete und wie er sich später wieder entblößte. Seit neun Monaten habe ich mir vorgenommen, jemanden zu fragen, was für ein Baum das eigentlich ist.
Der Baum ist so einsam wie ich. Er aber ist im Boden fest verankert und unerschütterlich. Es geht ihm besser als mir, da er seine Wurzeln tief in die Erde geschlagen hat, während ich nun völlig entwurzelt bin. Nein, ich hatte eigentlich niemals Wurzeln. Ich kann mich nicht erinnern, jemals Wurzeln gehabt zu haben, die in die Erde hineinreichen. Wenn ein Mensch auf Reisen ist, entsteht ein inneres Kribbeln, das ihn nicht sesshaft werden lässt – ob er nun in sein Inneres reist oder in der Welt unterwegs ist, es bleibt doch immer eine Reise. Ein Gefühl der Ohnmacht lässt ihn zwischen Himmel und Erde baumeln. Mir ging es schon immer so.
In dem Baum scheint mehr Leben zu sein als in mir. Trotzdem habe ich irgendwie Mitleid mit ihm. Ich habe das Gefühl, der Schnee auf seinen Ästen belaste seine Schultern und seinen Hals, Kälte und Frost ließen ihn erstarren und er sei nicht in der Lage, sie abzuschütteln. Mich drängt der Wunsch, auf ihn zuzugehen und ihn von Schnee und Eiszapfen zu befreien, ihn in mein Zimmer zu tragen und ihn zu bitten, mit mir ein Glas Wein zu trinken. Die anderen Bäume am Rande des Platzes stehen in Reih und Glied nebeneinander, aber dieser einsame Baum da hat sich in den letzten Winkel vor meinem Fenster zurückgezogen. Ich frage mich, ob dies das Werk der Natur oder der Menschen ist? Ständig erinnert er mich an meine Einsamkeit. Wenn der Baum einen Monat lang statt Wasser nur Rotwein tränke, würden seine Blätter dann rot glänzen? Meine Mutter goss ständig die fruchtlosen Bäume im Hof mit dem Blut der Hühner, Truthähne und Lämmer, die wir zum Opferfest geschlachtet hatten, in der Hoffnung, sie würden Früchte tragen. Aber das passierte nie.
In diesem Baum sehe ich nicht das Emporstreben und den Glanz und auch nicht jene Kraft, wie sie seine Artgenossen haben. Wenn der Schnee sein Gesicht bedeckt, fehlt ihm die Lust, sich von ihm zu befreien. Jeden Tag, zu jeder Jahreszeit sitze ich da und betrachte ihn. Ich beobachte die alten, einsamen Frauen, die schönen Mädchen und die gutgekleideten Männer mit ihren Hunden, beobachte, wie sie sie liebevoll und geduldig alles beschnuppern lassen und warten, bis sie ihr Geschäft verrichtet haben und sinnlos herumbellen. Die Hundehalter sitzen gelassen auf den Parkbänken unter dem Baum vor meinem Fenster, ohne mich, obwohl ich sie anstarre, zu beachten. Die Hunde aber erschrecken sich vor mir, wenn ich das Fenster öffne, und laufen davon. Es ist seltsam, es gibt hier niemanden, der mich auch nur eines Blickes würdigt. Keiner sieht hier den anderen an. Es ist, als wäre ich ein Schatten oder gar körperlos. Bei uns zu Hause durchpflügen wir einander mit Blicken. Beides ist eine Unart. Die meisten Köter heben ihr Bein an diesem Baum. An denselben Ort kommen manchmal junge Paare, die sich auf der Bank dort umschlungen halten. Wenn die Nacht anbricht, verschmelzen ihre Schatten zu einem und ich kann sie zum Beweis ihrer heißen Lust stöhnen und seufzen hören, was mich im übrigen, wie andere männliche Flüchtlinge auch, in den Wahnsinn treibt. Mich erinnert diese Umarmung an meine eigene Einsamkeit und an meinen Hunger nach Liebe. Ich beneide den Baum darum, dass er ungerührt bleibt. Bis zu dem Moment, in dem der junge Mann seine Gefährtin an den Baumstamm presst, sie küsst und sich an ihr reibt, bleibt mein armer, verwurzelter Freund unbeteiligt und fühlt sich nicht gestört – oder vielleicht hat er sogar Glücksgefühle durch die Berührung? Ich hingegen, wenn ich all das Stöhnen höre, sehe mich gezwungen, das Fenster zu schließen und mit glühendem Kummer wie ein verletzter Tiger in meinem kleinen Zimmer umherzuwandern, in meine Faust zu beißen, um mein schäumendes Blut und mein rasendes Herz zu ertragen. Ich zweifle aber daran, dass die anderen Flüchtlinge, die von allen Seiten in dieses Land gestürmt sind, sich mit dem Beißen in ihre Fingerknöchel zufriedengeben. Vielleicht werden sie gehen und versuchen, die weiblichen Wesen zu beißen, die in den Augen der meisten nur leichte Mädchen sind. Die alten Märchen und Mythen, auch die Geschichte des Sündenfalls, all dies trug bei uns dazu bei, dem weiblichen Geschlecht mit Geringschätzung und Abscheu zu begegnen. Und die Männer? Ihnen wurde die Rolle des Jägers zuteil, mit der Frau als Beute, als Freiwild.
Die Teilnahmslosigkeit des Baumes bringt mich um. Ich wünschte, ich könnte, wie er, nichts davon mitbekommen, was in der Welt um mich herum geschieht. In Wahrheit schwanke ich zwischen zwei merkwürdigen Zuständen: Einerseits bin ich glücklich darüber, dass die verliebten Paare frei sind wie die Vögel auf den Bäumen und dass niemand daran denkt, sich mit vorwurfsvollem Blick nach ihnen umzuwenden. Genau darum schließe ich immer schnell das Fenster, damit nicht der Blick des Voyeurs in meinen Augen aufflackert, denn ich will mich zivilisiert verhalten. Andererseits habe ich das Gefühl, dass mir diese offen zur Schau gestellte Leidenschaft, die ich tagtäglich beobachten muss, die mir fehlende Liebe, die betrübten Tage und die Einsamkeit in meiner Jugend wie ein schwarzes Gemälde vor Augen hält. So bleibt mir nichts anderes übrig, als mich wie ein verängstigter Spion in meinem Zimmer zu verstecken.
Der Schmerz, den ich in meiner betrübten Seele empfinde, ist so tief, dass ich mich immer wieder mit diesem Baum vor meinem Fenster vergleiche: Der Unterschied zwischen mir und ihm ist, dass ich im Sommer dazu neige, mich zu entblößen und mich dem schwachen Sonnenlicht zu stellen, das in etwa die Stärke von drei brennenden Kerzen hat, er hingegen bedeckt sich mit zahlreichen Blättern. Im Winter verstecke ich mich hinter einem dicken Mantel und unter einer Fellmütze vor der Kälte, er aber steht nun ungeschützt da. Dieses Land besteht aus großen Waldflächen, für mich aber zählt nur dieser eine Baum, den ich stundenlang betrachte. Obwohl ich kein Maler bin, könnte ich ihn aus dem Gedächtnis heraus abbilden. Bis zum Erstarren, bis meine Gedanken mich auf eine lange Reise entführen, bis mir schwarz vor Augen wird und alles sich dreht in meinem Kopf, beobachte ich diesen Baum. Am Ende sehe ich nur mehr die wild vorbeischießenden Bilder aus meiner Vergangenheit. Immer kehre ich in die Zeit meiner Kindheit zurück und wenn ich dann wieder bei mir bin, habe ich das Gefühl, als wären meine Augen mit diesem Baum verwachsen. Er zeigt sich mir in immer anderen einander abwechselnden Formen.
** *
Je weiter die Nacht fortschritt, umso stiller wurde es in und um das Flüchtlingsquartier, das etwas abgelegen von der Stadt lag. Nachts lauschte ich dieser Ruhe und verstand dadurch, dass die herrschende Stille erfüllt war von Schreien und lauten Stimmen. Hin und wieder erschreckte mich das Aufjaulen eines Hundes, das Gekicher eines Mädchens oder das Gegröle eines Betrunkenen. Beim zweiten Glas Wein, der ziemlich stark war, spürte ich, wie mein Blut sich erhitzte und schäumend bis in den letzten Winkel meines Kopfes Wellen schlug. Das Schöne an einem Rausch ist doch, dass sich die Sorgen und Wünsche in anderen Farben und Formen präsentieren. Niemals waren meine Probleme, meine Sorgen und meine geistige Verfassung vor und nach dem Trinken dieselben.
Auch die sanfte Melodie der Passionsmusik aus dem Kassettenspieler machte die Welt, in die ich versunken war, noch zauberhafter, und sie entführte mich immer weiter. Sie war für Jesus komponiert worden. Bach muss ihn wohl sehr geliebt haben. Es gibt viele für Jesus komponierte Musikstücke, aber dieses erinnerte mich ganz besonders an die Schmerzen, unter denen er am Kreuze gelitten hat. Ich hatte Angst davor, noch betrunkener zu werden und vor lauter Einsamkeit anzufangen zu weinen. Ich vermisste meine geliebte Familie und meine Freunde so sehr, dass meine Brust schmerzte, als würde ich meine Handfläche über eine Kerzenflamme halten und langsam verbrennen. Der Schmerz, den ich in der Hand empfand, setzte sich fort bis zu meinem Herzen. Ich wagte es nicht, wie in anderen vergangenen Nächten, ihre Fotos hervorzuholen. Mit jedem Schluck wallte die Sehnsucht noch weiter auf. Die sie begleitende Verzweiflung zerfraß mich allmählich.
In ihrem letzten Brief hatte meine Frau geschrieben: »Lass doch in dieser besinnlichen Zeit deinen Kopf nicht hängen. Nimm teil an der Freude der Feiertage, mein Ein und Alles.«
Die Worte »mein Ein und Alles« zerrissen jede Faser meines Herzens. Ich frage mich, warum ich dieses Gefühl in der Fremde intensiver spürte und warum ich ein solcher Hornochse gewesen war und all die Liebe und Leidenschaft nicht wahrgenommen hatte, als sie mich noch umgab. Warum sind wir von der Selbstverständlichkeit der Nähe der Menschen, die uns lieb sind, so geblendet? Warum macht sie uns zu Ignoranten?
Oh, ich konnte nicht auf meine Frau hören und an den Vergnügungen dieser Nächte teilnehmen. Sie wusste, dass ich mich an Weihnachten und zu Neujahr fürs Alleinsein entscheiden und dutzende Ausreden erfinden würde, um den Feierlichkeiten zu entgehen. In der Christnacht denke ich vielmehr jedes Jahr aufs neue an meine Vergangenheit mit all ihren Höhen und Tiefen. Ich denke an die Schmerzen von Jesus und darüber nach, warum wir überhaupt in dieser Nacht Christi Geburt feiern, statt seiner Ermordung am Kreuz zu gedenken. Diese Gedanken lassen mich dann nicht mehr los. Ich interessiere mich nicht für die Festtagsfreude der Menschen, sei sie nun ehrlich oder aufgesetzt, sondern ich stelle fest, dass Menschen Anlässe brauchen, um sich selbst und alle Probleme zu vergessen. Oder es ist genau das Gegenteil der Fall. Wie bei mir: Ich finde immer einen Anlass, um mich selbst zu bemitleiden und um nicht auch nur eine einzige Nacht in Freude und Unbeschwertheit zu verbringen.
Ich saß also seit dem Abend hier und dachte über das Blut nach, das über das Kreuz herunterrann. Über dieses arme Wesen, das schließlich am Kreuz, von Himmel und Erde verlassen, hing, bis seine Gliedmaßen ausgeblutet waren und die Liebe für die Menschheit in seinen Augen erlosch. In dieser Nacht hörte ich das Klopfen seines Herzens, wie es immer schwächer schlug, bis es schließlich verstummte. Am Anfang spürte ich in seinem Rhythmus die Lebendigkeit und die Kraft, eine Revolution auszulösen. Aber später kippte sein Kopf auf die Seite und er starb. Schade, dass niemand Prophet ist im eigenen Lande.
** *
In meinen Gedanken werde ich mit Jesus Christus in jener Nacht geboren, in der ein Stern am Himmel für mich leuchtet. Es ist ein schüchterner, ein erschöpfter Stern, dessen Lichtstrahlen kaum auf der Erde auftreffen. Ich schlüpfe in Jesu Haut und Kleidung und verspüre sogleich das Misstrauen derjenigen, die daran zweifeln, dass ich vom reinen Atem des Himmels erschaffen worden bin. Ich höre die Verleumdungen und die Beleidigungen der Menschen um mich herum, die mein Herz noch mehr erzittern lassen. Ich wachse mit diesem Schmerz der Heimatlosigkeit auf: Schon als Neugeborenes werde ich von einem Haus zum anderen, von einem Viertel ins nächste getragen und versteckt. Als Erwachsener dann wage ich es, in meine Heimat zurückzukehren, wo Hass und Gewalt vorherrschen, wo ich aber versuche, die Botschaft der Liebe zu verkünden und gegen Unterdrückung, Unrecht und machtgierige Tyrannen zu kämpfen. Sie entgegnen mir: »Du legst damit nur deinen Kopf in die Schlinge!« Und ich antworte bestätigend: »Ich war noch nicht einmal geboren, als der König schon ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt hatte.«
Ich setze mich für die benachteiligten Frauen ein, werde gegen die unsägliche Bestrafung von Kindern, die mit einem heißen Löffel gebrandmarkt werden, wenn sie etwas angestellt haben, aufbegehren und ich erhebe meine erstickte Stimme gegen die Ungerechtigkeit, bis sie zu den Ohren der Tyrannen vordringt. Ich begleite Jesus. Ich gehe neben ihm, Schritt für Schritt, ob zu Fuß oder auf einem Esel reitend, und ich verkünde ununterbrochen die Würde des Menschen und die Liebe. Sie fragen: »Wie lautet deine Botschaft?« Ich sage: »Die Antwort auf diese Frage ist ganz einfach: Das Gute, das du dir wünschst, solltest du von ganzem Herzen auch deinem Nachbarn wünschen. Und du sollst deinen Nächsten so lieben wie dich selbst.«
Es ist erschütternd, kaum einer hört mir zu. Die geächteten Frauen mit ihren betrübten Seelen versammeln sich um mich und himmeln mich an. Sie sind es, die mich mit ihren gutgläubigen Herzen verstehen. Die obdachlosen, armen Menschen schütteln hoffnungslos den Kopf und folgen mir, weil sie sehen, dass ich, wie sie, schäbig gekleidet bin, auch wenn ich ihnen keine Wunder schenken kann, sondern nur die Liebe. Unterwegs sehe ich, wie Maria Magdalena wegen Ehebruchs gesteinigt wird. Ich laufe schnell auf sie zu, um sie vor den drohenden Steinen zu retten: »Um Himmels willen, hört auf! Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein!«
Ich fasse sie am Arm, helfe ihr, sich wieder aufzurichten, und wispere ihr ins Ohr: »Erhebe dich, meine Schwester, und bedenke: Es kann nicht immer ein Jesus zufällig vorbeikommen, um dich zu retten.«
Je größer meine Liebe wird, desto stärker wird der Hass der gefräßigen, kaltherzigen Männer. Ich kümmere mich weder um die Kälte noch um die Hitze. Die weiten Wege erschöpfen mich nicht und die Drohungen können mir keine Angst einflößen. Ich setze meinen Weg fort und streue die Samen der Liebe auf die harte Erde der Herzen. Hoffnungslos werde ich auch in den Seelen, die voll Zorn sind, Liebe säen.
Sie binden mir das Kreuz auf den Rücken, lassen es mich schleppen, während sie mich verhöhnen. Oh, meine blutige Reise, den Hügel hinauf bis zur Anhöhe des Berges Golgatha. Immer wieder stürze ich und schlage mit dem Gesicht am Boden und auf Steinen auf. Hungrig, durstig, nackt.
Hin und wieder greife ich zu meinem Glas Wein, damit meine Kehle nicht wie der Oleander austrocknet. Die Melodie der Matthäuspassion aus dem Kassettenspieler trägt mich bis auf den Gipfel der Schädelstätte. Ich höre, wie sie mein Kreuz in die Erde rammen und es so tief verankern, dass kein Wind es zum Wanken bringen kann.
Dieses Mal tauschen Jesus und ich die Plätze beim Hinaufgehen. Wir schleppen uns voran und stürzen. Wir blicken zurück und sehen den langen, schmalen Pfad, der sich den Hang hinaufschlängelt. Unser beider Blut wurde auf dem Weg vergossen und er ist übersät mit Fleischfetzen, abgefallen von unseren Körpern, die zerschunden sind von den Peitschenhieben der Henker. Hunderte Geier und Krähen tummeln sich hinter uns, kämpfen gegeneinander und versuchen, sich gegenseitig die Augen auszupicken, im Gerangel um unser Fleisch und unser geronnenes Blut. Wir heben unseren Blick und sehen, dass riesige Vogelschwärme über unseren Köpfen und Kreuzen kreisen. Sie lassen sich nicht verscheuchen, fliegen einmal tiefer, dann wieder höher. Sie geben die Hoffnung nicht auf, unsere dampfenden gekreuzigten Leiber, deren blutiger Geruch sie schon jetzt rasend macht, zerfleischen zu können. Wir sehen, wie sie ihre Schnäbel in unsere Köpfe hacken werden, um an das von der Sonne gekochte Hirn zu gelangen. Sie reißen uns mit ihren gnadenlosen Krallen Haare und Kopfhaut vom Schädel. Sie beugen sich kopfüber und kämpfen um Ohren, Augäpfel, Brust, Hals, Kinn und die zerschundenen Wangen, trinken das Blut, das aus den Wunden der Handflächen rinnt. Im Sturzflug landen sie auf unseren Bäuchen und zwischen den Beinen, um herunterzureißen, was sie können. Wir sehen uns mit blutverschmierten Gesichtern an, mit großem Kummer in der Stimme spricht er zu mir:
»Mit diesem Bart ähnelst du Jesus Christus.« Ich, noch mehr in Blut getunkt und erschöpfter als er, kann nur noch mit größter Mühe Luft holen:
»Heißt das, ich bin dir ähnlich, mein Bruder Christus?«
»Wieso mir? Für wen hältst du mich denn? Waren du und ich nicht beide Wanderer, die vor den Häschern des Statthalters flohen? Zwei Wanderer, deren Wege sich an einer Gabelung kreuzten?«
Es macht mich noch trauriger und hoffnungsloser zu sehen, dass Jesus dermaßen verwirrt ist, dass er sich selbst nicht mehr erkennt. Er hat so viel Blut verloren, dass er seinen eigenen Namen vergisst. Aber er spricht so klar, dass ich an meiner Wahrnehmung zweifle.
»Es ist zu spät für die Erwartung, wir würden beide gerettet werden. Unser Ende ist bereits gekommen, mein Bruder Jesus«, flüstere ich ihm zu.
Am Fuße des Berges weinen und klagen die Frauen. Sie ähneln Krähen, deren Flügel gebrochen sind und die sich in ihrem Schmerz hin und her wiegen. Ihre Klagerufe vermischen sich mit dem Krächzen der Krähen und machen uns mehr Angst als der Tod, der uns erwartet. Die Vögel fliehen, aufgeschreckt von dem Lärm, in die Weiten des Himmels.
»Oh, du geschundener Jesus, mir kommt es so vor, als hätte ich zum hundertsten Mal, mit dem Kreuz auf der Schulter, diesen blutigen Weg eingeschlagen. Es ist nicht mein erstes Mal«, wehklage ich. Er, gebrochen und verwundet, kann mit seinen angenagelten Handflächen das Blut nicht abwischen, das langsam in seinen Augen und den Augenbrauen gerinnt. Seine Worte fallen ihm wie Nägel aus dem Mund:
»Ich bin diesen blutigen Weg schon einmal gegangen. Ob nun in der Realität oder in meinen Träumen, ich habe das bereits erlebt.«
»Ja, ich auch. Ich habe das Gefühl, dass ich in früheren Tagen, an einem anderen Ort, den gleichen Schmerz schon einmal ertragen habe müssen. Und ich werde es noch einmal erleben. Derselbe Weg, derselbe Berg, dasselbe Kreuz, dasselbe Blut, dieselben Krähen, dieselben Geier. Ich kann mich erinnern, dass ich es beim letzten Mal eiliger hatte, zu sterben. Der Tod kam aber nicht, um mich zu erlösen, denn er wäre süß gewesen und hätte mich errettet. Ich kann mich erinnern, wie uns schwindlig wurde, weil die Sonne über uns stand und das Hirn in unserem Kopf zum Schmelzen brachte. Du sagtest in deinem Leid immer und immer wieder: ›Es ist noch zu früh, um zu sterben, wir sind dazu noch zu jung.‹ Aber niemand erhörte dich, nicht einmal der Himmel.«
Wir mustern gegenseitig unsere zerschundenen Gesichter und unsere blutüberströmten Körper. Es ist, als wäre jeder der Spiegel des anderen. Ich weine um ihn und er um mich. Im dichten Nebel dieses Spiegels suche ich meinen Schatten und er den seinen.
»Wir sind Märtyrer, nicht wahr?«, flüstert Jesus.
»Mag sein, ich bin mir nicht sicher«, antworte ich.
»Nicht aufgeben, versuche diesen Schmerz zu besiegen.«
»Du siehst, meine Knie zittern, dennoch stemme ich mich dagegen, um nicht zu fallen.«
»Ich spüre meine Hände, meine Füße und meine Knie nicht mehr, aber ich schäme mich, vor den Schergen des Statthalters auf die Knie zu fallen. Es ist würdevoller, im Stehen zu sterben, so wie ein Baum.«
»Oder am Kreuz.«
»Sind wir noch unterwegs? Haben wir die Kreuze auf der Schulter, gehen wir diesen Hang hinauf, oder haben sie uns schon ans Kreuz genagelt?«
»Lass uns schweigen, denn das Sprechen raubt uns Kraft.«
»Da wir bald sterben werden, ist mir aber nach Sprechen.«
»Ich will nur noch sterben. Ich habe solche Schmerzen …«
»Wenn sie uns aufs Kreuz hängen, trennen sie uns voneinander, und wenn sie dann die Nägel in unsere Hände und Füße treiben, sind wir machtlos.«
»Ich habe das Gefühl, dass ich bereits am Kreuz hänge, denn der Schmerz der Nägel treibt mir die Augäpfel aus den Höhlen.«
»Mir ist kalt …«
»Ich brenne, mir ist heiß. Verflucht sei jener Schmied, der solch lange und dicke Nägel angefertigt hat!«
»Bete für ihn um Gnade, dieser alte Schmied hatte keine andere Wahl. Er war entweder hungrig, oder er handelte aus Angst … Wer sind die zwei anderen, die neben uns gekreuzigt wurden und mich und meinen Vater beschimpfen?«
»Angeblich sind sie Diebe. Sie sind böse auf dich, weil du bei Gott nicht um Gnade für uns alle bittest, um uns zu erretten.«
»Warum sollte ich das tun?«
»Weil du der Sohn Gottes bist. Du bist Jesus, der Retter.«
»Aber nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, du und ich, die Diebe sind! Jesus, das ist, wenn ich mich nicht täusche, einer von den beiden da drüben.«
»Und wer bin dann ich?«, will ich von ihm wissen.
»Du bist mein Begleiter. Was haben du und ich denn gestohlen? Aus welchem Grund wurden wir verhaftet? Und wenn wir etwas gestohlen haben, wo haben wir es dann versteckt?«
»Ich habe nichts gestohlen, nur du. Ich bin bloß dein Seelengefährte. Ob du dir dessen bewusst bist oder nicht: Du bist ein Herzensdieb, du hast die Herzen vieler Menschen gestohlen. Von jungen Frauen, Armen, Glücklosen und Gescheiterten. Du stiehlst Herzen, gnadenlos. Ah, du weißt es nicht, du weißt es nicht! Du hast das Herz meiner großen Liebe gestohlen! Deinetwegen hat sie mich für immer verlassen!«
** *
Wir flüsterten noch miteinander, als auf einmal der Staub vom Boden aufgewirbelt wurde, dieser sich wie ein Wolkenberg über uns auftürmte und einen schweren Schatten über uns warf, der sich nur langsam auflöste. Wir konnten kaum atmen. Um uns herum waren Kreuze, die in den Himmel hinaufragten. Der Gestank der zerfetzten Leichen derjenigen, die vor ein paar Tagen gekreuzigt worden waren, ließ uns beinahe die Besinnung verlieren.
Allein die gegorene Luft, die wir einatmeten, hätte gereicht, uns zu töten. Wer vor kurzem auf diesen Anhöhen gekreuzigt oder gehängt worden war, war verschmiert von seinen Exkrementen. Die sengende Steppenluft, gemischt mit dem Geruch von geronnenem Blut, dem Gestank der Ausscheidungen und den Schweißausdünstungen der noch Lebenden, machte die Menschen schwindelig. Ich wusste, bei Anbruch des Abends würden die Wächter mit ihren Stöcken kommen, um die Knochen der anderen Gekreuzigten zu brechen. Der Gedanke daran war so bedrückend, dass Jesus und ich den eigenen Schmerz, den Kummer und die Folter vergaßen. Als sie unsere Arme brutal an das Kreuz drückten und anfingen, die Nägel zuerst in die rechte, dann in die linke Hand zu treiben, dann in beide Füße, spürten wir unsere Herzen vor Schmerz kaum noch schlagen und unsere Köpfe fielen von einer Seite zur anderen. Ich hatte das Gefühl, ein glühender Nagel, der bis zur Seele vordringt und sie brennen lässt, würde mir ins Herz gerammt. Ich konnte die Augen kaum offen halten.
** *
Von weitem hörte ich noch Bachs schöne Passion, einmal lauter, dann wieder leiser. Sie floss wie das Blut, das an Christi Leib herunterrann, in mein Ohr. Aus meinen Füßen rann ununterbrochen Blut. Es war überall. Es klebte am Kreuz und an meinen Beinen, und das versetzte mich in Angst und Schrecken. Plötzlich, als würde ich aus einem bösen Traum erwachen, sah ich, dass der Rotwein vor mir so wie das Blut des Gekreuzigten eine Kruste gebildet hatte. Ich hob meinen Kopf und sah das Gemälde in meinem Zimmer, sah die Dornenkrone auf dem Kopf Jesu, die von seinem Blut in ein noch tieferes Rot getränkt war als das Glas Wein auf dem Tisch. Ich sah, wie Jesus seine Lippen bewegte:
»Trink, das ist mein Blut, lass es dir schmecken.« Ich sah, wie Fetzen seines Fleisches von seinem geschundenen Leib abfielen.
»Auch sie kannst du aufheben und essen. Es ist Brot für dich, iss davon. Dies tu zu meinem Gedächtnis«, sagte er.
»Lass mich dich herunternehmen. Lass uns gemeinsam spazieren gehen heute Nacht. Wie lange sollen alle wie Jesus am Kreuz hängen und all die Tyrannen frei und ungehindert die Welt durchpflügen?«, fragte ich ihn traurig.
»Sie sind niemals frei, sie sind mordlüstern. Sie folgen blind einem Zwang und lechzen nach unserem Blut, das vom Fuß des Kreuzes auf den Boden rinnt«, sprach er mit einer Stimme, die den ganzen Raum erfüllte.
»Das ist eine Täuschung – sie sind frei, sie haben eine Wahl!«, widersprach ich. »Du bist aber nicht der Einzige, der am Kreuz hängt! Niemand weiß von der blutigen Geschichte der vielen anderen Gekreuzigten. Warum steigst du nicht herunter von deinem Kreuz, damit du mit deinen eigenen Augen all ihr Blut, ihre Tränen und ihren Schweiß sehen kannst?«
Aber halt, ich überlegte dann, warum er gerade in dieser Nacht, in der sich alle betranken, vom Kreuz steigen sollte, denn niemand würde ihm zuhören. Warum sollten all die Engel mit ihm herabsteigen, wer würde ihm Aufmerksamkeit schenken? Wie sollte ich ihn vor Betrunkenen, Rassisten und anderen üblen Gestalten schützen? Wie sollte ich ihn verteidigen? Ich sah mich gezwungen, meine Stimme zu erheben: »Halt! Komm nicht herunter, bleib dort oben! Dort bist du schöner und wahrer. Ich bin selbst nur ein mittelloser Flüchtling. Wo soll ich dich beherbergen? Wie soll ich dir Brot, Wasser und Kleidung besorgen? Du mit deiner Dornenkrone und all deinen Wunden, halbnackt, mit einem Fetzen Stoff am Leib. So werden sie dich noch einmal töten, die Judasse, die Römer, die Soldaten, die verlogenen Richter, die getreuen Gefolgsleute der Machthaber, die Wächter und die Gesetzeshüter … oder die, die immer schon alles Fremdartige gehasst haben.«
War ich betrunken oder im Halbschlaf? Ich war erschöpft und besorgt wegen der Gefahr, die diese Nacht in sich barg. Ich sah mich wieder anstelle von Jesus am Kreuz hängen und hörte die Schreie und Klagen der Frauen, die ihre Tränen vor ihren Ehemännern verbargen. Ich fragte mich, warum mein Leben lang nur Frauen um mich geweint hatten und nie ein junger Mann. Haben diese Männer überhaupt Tränendrüsen? Ich bewunderte die Frauen, die heimlich, damit ihre Männer es nicht bemerkten, mir auf dem schweren Weg eine Schale mit Wasser reichten oder ein Stück Brot zusteckten. Wenn die Wächter es mitbekamen, bedachten sie die Frauen mit Tritten, sodass sie den Hang hinunterstürzten, und Soldaten stellten sich diesen Frauen in den Weg, damit sie sich uns Sterbenden nicht nähern konnten. Während ich das Kreuz trug und mich unter seiner schweren Last Rücken, Beine und Arme im Stich ließen, schenkten mir die liebevollen Blicke der Frauen Kraft. Auch als ich dann am Kreuz hing, machten sie den Schmerz der Nägel, die durch meine Füße und Hände getrieben wurden, erträglich. Ich spürte den Rost der Nägel und wie er sich mit meinem Blut vermischte, durch die Adern meine Augen erreichte und ich nur mehr verschwommen, wie im Nebel, sehen konnte. Ich hörte das Gelächter der verlogenen Männer und der untreuen Freunde, wandte meinen Kopf nach links und erblickte Judas, wie er beschämt sein Haupt senkte. Beschämt durch den Verrat, der mich ans Kreuz gebracht hatte, wanderte sein Blick über das Blut an meinem Körper. Ich war in Sorge, dass sein giftiger Kuss an meiner Wange einen bleibenden, schwarzen Fleck hinterlassen würde. Mit meinen festgenagelten Händen gelangte ich nicht an die Stelle, wo seine Lippen meine Wange berührt hatten. Gleichzeitig empfand ich Mitleid mit meinem Mörder, der nie gewusst hatte und nie wissen würde, dass die Kraft der Vergebung stärker ist als alle Macht der Soldaten. Auch die Handlanger des Präfekten wussten es nicht, genauso wenig die Vollstrecker, die hämisch schrien