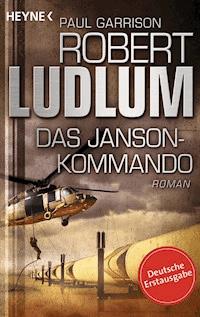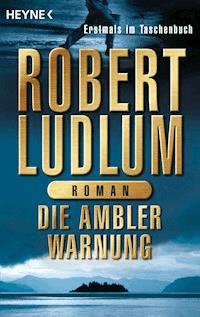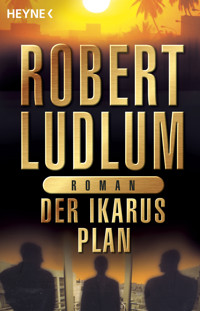9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Kampf gegen den Terror
Jon Smith von der geheimen US-Sondereinheit Covert One ist mit einer scheinbar einfachen Aufgabe konfrontiert: In einem japanischen Fischerdorf soll ihm ein Informant einen Koffer mit unbekanntem Inhalt übergeben. Zurück in den Staaten, erfährt Smith, dass es sich um radioaktive Stoffe aus dem Atomkraftwerk Fukushima handelt, die ein Techniker nach der Katastrophe beiseitegeschafft hat. Smith lässt das Material von einem befreundeten Kerntechniker untersuchen, der eine entsetzliche Entdeckung macht. Die porösen Brocken aus Stahl, Beton und Kunststoff sind offenbar in der Lage, sich endlos zu vervielfältigen. Was verbirgt sich hinter dieser bizarren Technologie? Die Spur führt zu einem Kommandanten der japanischen Streitkräfte, der offenkundig Fürchterliches im Schilde führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Ähnliche
Zum Buch
Jon Smith von der geheimen US-Sondereinheit Covert One ist mit einer scheinbar einfachen Aufgabe konfrontiert: In einem japanischen Fischerdorf soll ihm ein Informant einen Koffer mit unbekanntem Inhalt übergeben. Zurück in den Staaten, erfährt Smith, dass es sich um radioaktive Stoffe aus dem Atomkraftwerk Fukushima handelt, die ein Techniker nach der Katastrophe beiseitegeschafft hat. Smith lässt das Material von einem befreundeten Kerntechniker untersuchen, der eine entsetzliche Entdeckung macht. Die porösen Brocken aus Stahl, Beton und Kunststoff sind offenbar in der Lage, sich endlos zu vervielfältigen. Was verbirgt sich hinter dieser bizarren Technologie? Die Spur führt zu einem Kommandanten der japanischen Streitkräfte, der offenkundig Fürchterliches im Schilde führt
Zu den Autoren
Robert Ludlum erreichte mit seinen Romanen, die in mehr als dreißig Sprachen übersetzt wurden, weltweit eine Auflage von über 280 Millionen Exemplaren. Robert Ludlum verstarb im März 2001. Die Romane aus seinem Nachlass erscheinen bei Heyne.
Kyle Mills, Jahrgang 1966, erobert mit seinen Romanen in den USA regelmäßig die Bestsellerlisten und gilt neben Tom Clancy, Frederick Forsyth oder David Baldacci als Erneuerer des intelligenten Politthrillers. Mills lebt in Jacksonville, Wyoming.
ROBERT LUDLUM
KYLE MILLS
DIE NANO INVASION
Roman
Aus dem Amerikanischen
Prolog
Kernkraftwerk Fukushima Daiichi
NORDOST-JAPAN, 11. MÄRZ 2011
Dr. Hideki Ito spürte, wie der Boden unter ihm zu zittern begann, und stützte sich an der Kontrollkonsole ab. Er wartete darauf, dass das Beben abebbte, und erinnerte sich an die starken Erschütterungen zwei Tage zuvor, die die Anlage ohne Zwischenfälle überstanden hatte. Dennoch konnte er die innere Anspannung nicht ignorieren, die ihn jedes Mal erfasste, wenn die Erde in Bewegung geriet. Aber es gab keinen Grund zur Sorge, sagte er sich erneut. Der General hatte den Reaktorblock vier abschalten lassen, um ihn als Forschungsanlage zu nutzen, angeblich weil dieser Block besonders gut geeignet war, im Falle eines Erdbebens den Austritt von radioaktiver Strahlung zu verhindern. In Wahrheit ging es hier jedoch nicht um Strahlung, die es im Zaum zu halten galt. Die Arbeit, der Ito sein Leben gewidmet hatte, war noch viel gefährlicher und schwerer zu kontrollieren.
Die Erschütterungen schienen diesmal nicht aufhören zu wollen, und er blickte sich nervös um. Die Betonwände des neun mal neun Meter großen Raumes waren von isolierten Rohren in allen Größen überzogen. Der Zugang erfolgte durch eine kleine Tür aus Titan zwischen den Computertischen. Seine beiden Forschungsassistenten hielten sich an den Kanten ihrer Stühle fest, die Beine gespreizt, um nicht auf den mit Gummi überzogenen Boden zu stürzen.
Der junge Mann zeigte den stoischen Gesichtsausdruck, den Ito seit dem Tag vor zwei Jahren, an dem er ihn eingestellt hatte, von ihm gewohnt war. Die Frau, eine brillante Absolventin der Universität Tokio, blickte sich mit kurzen, vogelartigen Kopfbewegungen in dem Bunker um. Sie sucht nach Rissen, dachte Ito verständnisvoll. Er verspürte jeden Tag tausendmal den Drang, das Gleiche zu tun.
Der alte Wissenschaftler wandte sich wieder nach vorne und blickte durch die zehn Zentimeter dicke Glaswand in den angrenzenden kleinen Raum. In der Mitte stand ein würfelförmiger Glaskasten mit Proben aus Beton, Kunststoff und Stahl. Dazwischen befand sich organisches Material: Erdproben und verschiedene sorgfältig ausgesuchte Pflanzen. Über allem lag eine weiße Ratte faul auf einem der Roboterarme, mit dem einzelne Teile von außen bewegt werden konnten.
Das Elektronenmikroskop reagierte auf den Steuerknüppel in Itos Hand, mit dem er es trotz der Vibrationen auf eine Moosprobe richtete. Die tiefgrüne Farbe deutete darauf hin, dass das Moos ebenso wie die Ratte keinen Schaden durch seine Experimente davongetragen hatte. Natürlich musste diese Annahme erst durch eine Untersuchung auf atomarer Ebene bestätigt werden. Auch an den vom Menschen hergestellten Materialien war mit bloßem Auge keinerlei Beschädigung zu erkennen. Wenn man tiefer blickte, ergab sich jedoch ein ganz anderes Bild.
Während Ito die Probe unter dem Mikroskop hatte, konnte er deren Struktur auf einem in die Wand eingelassenen Monitor untersuchen. Sie sah aus wie immer. Eine gesunde biologische Probe, allem Anschein nach unberührt von dem unsichtbaren Krieg, der in den anderen Materialien tobte.
Nach so vielen Jahren des Scheiterns konnte Ito immer noch nicht recht glauben, welche Erfolge ihm seit Kurzem beschieden waren. Waren sie tatsächlich Realität, oder war irgendwo dahinter ein fataler Fehler verborgen, der ihm in den Tausenden Berechnungen unterlaufen war? Und waren seine sorgfältig ausgearbeiteten Sicherheitsvorkehrungen wirklich so zuverlässig, wie es den Anschein hatte? Oder war sein Eindruck, das Geschehen völlig unter Kontrolle zu haben, nur eine Illusion?
Die Euphorie angesichts der Tatsache, dass es ihm gelungen war, die grundlegenden Kräfte der Natur zu beeinflussen, war allmählich einem Schaudern gewichen. Hatte Einstein genauso empfunden, als seine Gleichungen zum Bau der Atombomben benutzt wurden, die vor vielen Jahren auf Itos Land abgeworfen worden waren? Hatte Einstein verstanden, dass sich die Natur niemals von etwas so vergleichsweise Einfachem wie dem menschlichen Verstand würde beherrschen lassen?
Wie als Antwort auf seine Fragen nahm die Intensität des Erdbebens zu. Diesmal fühlte es sich anders an als sonst. Ito hatte plötzlich Mühe, sich auf den Beinen zu halten, obwohl er sich mit beiden Händen an der Konsole festhielt. Die Erschütterungen dröhnten so laut in seinen Ohren, dass er die Schreie seiner jungen Assistentin kaum hören konnte.
Ein Rohr an der Decke platzte und übergoss ihn mit einem Schwall eiskalten Meerwassers, das ihn schließlich von den Beinen riss. Jähe Panik stieg in ihm auf, während er mit vom Salzwasser brennenden Augen über den schwankenden Boden zu einem Absperrventil kroch. Als er die Wand erreichte, konnte er seine Augen nicht mehr offen halten. Er tastete sich am feuchten Beton entlang, bis er das Metallrad fand.
Es ließ sich zunächst nicht bewegen, doch seine vom Adrenalin befeuerten Muskeln vermochten es schließlich zu lösen. Ito riss das Rad herum, und im nächsten Moment war alles weg: das Beben, der Wasserschwall und das Licht im Raum. Das Chaos hatte sich von einem Moment auf den anderen in Stille verwandelt.
Ito drückte sich mit dem Rücken an die Wand und kämpfte gegen das beängstigende Gefühl der Orientierungslosigkeit an, das ihn in der plötzlichen Dunkelheit überkam. Er konzentrierte sich auf das Tröpfeln des Wassers und öffnete die Augen, obwohl um ihn herum alles schwarz war.
Der Strom war ausgefallen. Deshalb waren die Lichter ausgegangen. Ganz einfach.
Auf dieser simplen Tatsache baute er seine Analyse der Situation auf. Außer dem Tropfgeräusch hörte er das unregelmäßige Atmen seiner beiden Assistenten. Der Raum war stabil – das Erdbeben war also vorbei. Natürlich konnte es Nachbeben geben, deren Stärke sich nicht vorhersagen ließ.
Ito ging davon aus, dass in der gesamten Anlage bereits das Notfallprogramm aktiv war. Die Reaktoren wurden automatisch abgeschaltet, und die Kühlsysteme liefen mithilfe von Generatoren weiter. Das alles war jedoch nebensächlich. Was wirklich zählte, waren die Sicherheitsvorkehrungen seines eigenen Labors.
»Isami!«, rief Ito in die Dunkelheit. »Die Notbeleuchtung! Können Sie sie einschalten?«
Ito hörte ein zustimmendes Grunzen und das platschende Geräusch von Schritten auf dem überfluteten Boden. Sie waren auf solche Situationen vorbereitet, und nach wenigen Sekunden war der Raum in gedämpftes rotes Licht getaucht. Isami stand wie erwartet beim Lichtschalter, doch Mikiko kauerte unter einem Tisch, den Blick starr auf die dicke Glaswand gerichtet, die sich über die gesamte Nordseite des Raumes erstreckte.
Staub und Wasserdampf hingen in der Luft und erzeugten einen Kaleidoskop-Effekt, der jedoch nicht zu verbergen vermochte, was ihre Augen fixierten: einen gezackten Riss vom Boden bis zur Decke.
Im nächsten Augenblick sprang Mikiko auf, rannte zur Tür und griff nach der Klinke. Ito reagierte schneller, als er es selbst für möglich gehalten hätte. Er sprang auf, stieß die junge Frau zur Seite und zog die Abdeckung des Tastenfelds zurück, um seinen persönlichen Verriegelungscode einzugeben. Er hatte erst zwei Ziffern eingetippt, da packte Mikiko ihn von hinten, schlang ihm den Arm um den Hals und schnürte ihm die Kehle zu. Ito hielt sich mit einer Hand am Türgriff fest und ließ sich nicht losreißen. Mikikos panische Schreie hallten durch den Raum, während er den Rest des Codes eingab.
Isami eilte von hinten herbei und zog die Frau zurück, während das metallische Knirschen der Schließriegel ertönte. Das Geräusch verstärkte den Widerstand der jungen Frau, und Isami warf sie zu Boden, griff sich einen heruntergefallenen Schreibtischtacker und knallte ihn ihr zweimal gegen den Kopf.
Ito sah entsetzt das Blut aus ihrer Schläfe strömen, wandte sich dann aber ab. Dem jungen Mann war nichts anderes übrig geblieben. Ihr Leben war nichts im Vergleich zu dem enormen Schaden, der eintreten würde, wenn sein Werk diese Räume verließ.
Es war wieder still im Raum. Nur das stete Tröpfeln des Wassers und ihr schweres Atmen waren noch zu hören.
Zögernd trat Ito zu der Tür in der gesprungenen Glaswand und öffnete sie, während sein Herz hart gegen den Brustkorb hämmerte. Als er durch die Tür schritt, hatte er die bewusstlose Frau und den emotionslosen Mann, der bei ihr stand, bereits vergessen.
Der gläserne Würfel, der sein Experiment beherbergte, war auf hydraulischen Stoßdämpfern und dicken Gummimatten gelagert, die als zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für Ereignisse wie dieses installiert waren. Sie schienen ihren Zweck erfüllt zu haben – das Glas sah völlig unbeschädigt aus. Ito ging langsam um den Würfel herum und strich mit der Hand vorsichtig über die glatten Flächen. Sein Herzschlag begann sich zu beruhigen, bis seine Finger auf etwas stießen. Es war kaum zu spüren – nur eine winzige raue Stelle in der makellos geschliffenen Oberfläche. Ito hielt den Atem an und betete im Stillen zum Gott des Christentums, zu dem er sich vor Jahren bekannt hatte, dass es sich um eine Täuschung handelte.
Doch wie so oft in seinem Leben wurde sein Gebet nicht erhört. Der Riss war nur wenige Zentimeter lang, und es war unmöglich zu sagen, ob er die Wand völlig durchdrungen hatte. Es war jedoch letztlich unwichtig. Er konnte es sich nicht leisten, auch nur das kleinste Risiko einzugehen. Nichts davon durfte nach außen dringen.
»Wir haben ein mögliches Leck«, erklärte Ito mit zitternder Stimme, als er durch die Tür zurückging.
Er und sein Assistent mussten ihre ganze Kraft aufbieten, um den verzogenen Schrank zu öffnen, in dem sich ihre Strahlenschutzanzüge befanden. Schweigend legten sie die Anzüge an. Es gab nichts mehr zu sagen.
Ito fixierte die Atemmaske und schloss sie an die Sauerstoffversorgung an, während Isami zu dem bewusstlosen Mädchen trat und sich bemühte, den leuchtend gelben Schutzanzug über ihren schlaffen Körper zu ziehen. Die Ausrüstung würde sicherstellen, dass die Strahlung, die für die notwendige Sterilisation eingesetzt wurde, sie nicht sofort tötete, mehr aber auch nicht. Statt eines relativ schnellen Todes würde ihnen ein qualvolles Dahinsiechen beschieden sein.
Mit dem Schlüssel, den er um den Hals trug, öffnete Ito ein Gehäuse, das einen orange leuchtenden Hebel schützte. Mit seiner behandschuhten Hand griff er danach und schloss die Augen. In diesem Moment war es unmöglich, nicht zurückzublicken und die Sinnhaftigkeit seines gesamten Berufslebens anzuzweifeln. Unweigerlich fragte er sich, ob er die vergangenen fünfundvierzig Jahre nicht darauf verwendet hatte, etwas ans Licht zu bringen, von dem Gott wollte, dass es im Dunkeln blieb.
Kapitel Eins
Nordwest-Japan
HEUTE
Lieutenant Colonel Jon Smith hatte seinen Mietwagen zwischen den Bäumen geparkt und ging den Rest des Weges zu Fuß. Der Weg führte steil bergab und wurde immer rutschiger, doch ohne Boot gab es keine andere Möglichkeit, das entlegene Fischerdorf zu erreichen.
Die Berge hinter ihm verdeckten die Sterne, doch vor ihm war der Himmel über dem Japanischen Meer von winzigen Lichtpunkten übersät. Zusammen mit den wenigen Lampen, die im Dorf noch brannten, genügte es, um die schrägen Dächer der Häuser an der Küste auszumachen und die Boote, die dahinter vertäut waren. Zwischen den dicht stehenden Wohnhäusern, Bootshäusern und Gebäuden zur Fischverarbeitung war es zum Glück dunkel.
Smith wich dem gedämpften Lichtschein einer Außenlampe aus und schlich an einem Schuppen vorbei, aus dem ein Geruch nach Diesel und verfaultem Fisch drang. Der Rhythmus der umgebenden Geräusche blieb unverändert: das leise Plätschern der Wellen, der Südwind, der da und dort an einem lockeren Brett zerrte, und das kaum hörbare Summen der Stromleitungen. Ansonsten war es still.
Smith folgte dem Pfeil auf seiner GPS-Uhr zu einem schmalen Durchgang zwischen den Gebäuden und fragte sich einmal mehr, warum er für diesen Job ausgewählt worden war. Sein relativ dunkel getöntes Gesicht und die kurz geschnittenen schwarzen Haare mochten ein Argument sein – dennoch würde ein über eins achtzig großer blauäugiger Amerikaner, der um zwei Uhr nachts durch ein japanisches Dorf schlich, möglicherweise stärker auffallen, als es unter diesen Umständen wünschenswert war. Darüber hinaus beschränkten sich seine Kenntnisse der japanischen Sprache auf ein paar vage erinnerte Brocken aus dem Roman Shogun, den er in der Highschool gelesen hatte.
Bestimmt verfügte Covert One auch in Japan über qualifizierte Leute, die die Aufgabe hätten übernehmen können. Verdammt, selbst Randi wäre weit besser geeignet gewesen. Ein wenig Schminke und gefärbte Haare hätten sie so gut wie unsichtbar gemacht. Zudem hatte sie genügend Einsatzerfahrung in China gesammelt, um sich auch in Japan zurechtzufinden.
Doch Fred Klein hatte mit Sicherheit seine Gründe, warum er ausgerechnet ihn damit betraut hatte. Zudem schien es sich um keinen allzu schwierigen Job zu handeln. Er sollte sich mit einem Mann treffen, einen etwa fünf Kilo schweren Aktenkoffer übernehmen, damit in Okinawa in ein Militärflugzeug einsteigen und nach Maryland zurückfliegen.
Ein Kinderspiel, oder? Wahrscheinlich würde sogar noch ein bisschen Zeit bleiben, um sich eine Portion Sushi und eine erholsame Massage zu gönnen.
Es wurde noch dunkler um ihn herum, als er in den schmalen Weg zwischen den Gebäuden einbog und ganz langsam weiterging. Laut GPS war er nur noch knapp zwanzig Meter vom Treffpunkt entfernt. Er zog eine schallgedämpfte Glock unter dem Pulli hervor, es war zwar nicht anzunehmen, dass er sie brauchen würde, aber man konnte nie wissen.
Der Weg zweigte nach links und rechts ab. An der Ecke eines Lagerhauses warf Smith einen kurzen Blick in beide Richtungen. Nichts als Dunkelheit. Zu gern hätte er jetzt ein Nachtsichtgerät bei sich gehabt, doch als groß gewachsener, blauäugiger Amerikaner hatte er es ohnehin schon schwer genug, unauffällig zu bleiben. Mit einem Nachtsichtgerät hätte er mit Sicherheit Aufsehen erregt.
Smith bog nach rechts ab und schlich einige Sekunden den Weg entlang – leider nicht so geräuschlos, wie er es gewollt hätte. Seine Schuhsohlen knirschten auf etwas, das sich wie Fischgräten anfühlte.
»Ich bin hier!«
Eine Flüsterstimme mit starkem Akzent. Smith erstarrte und spähte in die Dunkelheit, aus der eine menschliche Gestalt hinter einem Stapel Holzpaletten auftauchte. Er widerstand dem Drang, sich zu beeilen, und näherte sich dem Unbekannten vorsichtig, die Pistole in der gesenkten Hand haltend. Selbst in dem schwachen Sternenlicht hier zwischen den Gebäuden konnte er an der Körpersprache des Mannes erkennen, dass er Angst hatte. Es wäre nicht hilfreich gewesen, mit der Waffe im Anschlag auf ihn zuzugehen.
Leider schien sein Bemühen, Ruhe und Gelassenheit auszustrahlen, wenig erfolgreich zu sein. Der Mann atmete hastig, als Smith zu ihm trat. Zum Glück waren keine langen Diskussionen nötig, und der Aktenkoffer wurde problemlos übergeben, wenn man davon absah, dass er deutlich schwerer war, als man ihm gesagt hatte. Es kam nicht oft vor, dass Fred Klein in solchen Details ein Fehler unterlief.
»Kommen Sie allein zurecht?«, fragte Smith leise.
Der Mann nickte, da hörte Smith einen plötzlichen Windhauch. Die alten Gebäude ächzten, doch das Geräusch klang irgendwie anders als zuvor. Als wäre es mehr als nur ein Windstoß.
Smith fasste den Überbringer am Hemd, um ihn hinter die Paletten zu ziehen, doch der Mann geriet in Panik und wehrte sich. Im nächsten Augenblick ertönte ein dumpfes Geräusch, und der Japaner brach zusammen.
Smith ging mit dem verwundeten Kontaktmann zu Boden und zog ihn in Deckung. Der Mann atmete noch, jedoch mit einem Röcheln, das Smith als Militärarzt an der Front allzu oft gehört hatte. Nach einer kurzen Untersuchung – während der er sich immer wieder nach eventuellen Angreifern umsah – fand er einen Armbrustbolzen zwischen den Rippen. Der Mann würde an seinem eigenen Blut ersticken, und Smith zögerte einen Augenblick. Als Arzt brachte er es nicht fertig, den Mann einfach liegen zu lassen, obwohl nichts und niemand ihm noch helfen konnte. Als erfahrener Agent war ihm jedoch klar, dass er hier in der Falle saß und schleunigst verschwinden musste, wollte er nicht genauso enden wie der Mann, der vor ihm auf dem Boden lag und nach Luft rang.
Da er genau wusste, wie qualvoll die letzten Lebensminuten des Schwerverletzten verlaufen würden, drückte ihm Smith den Schalldämpfer an den Brustkorb und schoss ihm eine Kugel ins Herz. Auf den gedämpften Knall folgte das gleiche dumpfe Geräusch wie zuvor – diesmal aus der entgegengesetzten Richtung. Smith warf sich zurück und krachte gegen die verwitterten Holzbretter, während der Bolzen an seinem Gesicht vorbeizischte.
Er wusste nun, dass die Hurensöhne aus beiden Richtungen angriffen. Und sie waren verdammt gut. Er hatte bisher keinen von ihnen gehört, und der zweite Bolzen war durch eine Lücke zwischen den Paletten geschossen worden.
Smith griff sich den Koffer, sprang auf und sprintete in die Richtung, aus der das tödliche Geschoss gekommen war. Die Armbrust war eine präzise, nahezu lautlose und absolut tödliche Waffe, doch sie hatte einen Nachteil: Man brauchte relativ lange, um nachzuladen.
Wenige Meter entfernt sah Smith eine klapprige Holztreppe, die an der Seite des Lagerhauses zu seiner Rechten nach oben führte. Sich nach oben zu flüchten wäre keine gute Idee, doch er hatte auf dem Hinweg unter der Treppe ein Fenster bemerkt und es für einen Notfall wie diesen in seinem Gedächtnis gespeichert.
Der schwere Aktenkoffer, den er hinter sich über der Schulter hielt, bremste ihn zwar, doch die Maßnahme machte sich dennoch bezahlt, als ein Bolzen in den Koffer einschlug. Mit der rechten Hand fasste Smith einen Stützpfeiler, duckte sich unter die Treppe, warf den Koffer durchs Fenster und sprang hinterher.
Die Glasspitzen im Fensterrahmen ritzten seinen Oberkörper, und er landete hart auf einem Stapel Holzkisten, doch er atmete noch, und die paar Kratzer und Schrammen würden ihn nicht aufhalten.
Tief geduckt schlich er durch den Lagerraum zu einer Tür, die derart verzogen war, dass etwas Licht hereinfiel. Doch statt hinauszustürmen, tastete er mit den Fingern über die Wand. Als er fand, wonach er gesucht hatte, verharrte er vollkommen reglos, um möglichst mit den Holzbrettern zu verschmelzen, während er das zertrümmerte Fenster im Auge behielt. Er selbst hatte zwar auf ein Nachtsichtgerät verzichtet, doch die unbekannten Angreifer mit Sicherheit nicht.
Als eine menschliche Gestalt auftauchte und vorsichtig durch das Fenster schlüpfte, knipste Smith das Licht an. Wie erwartet, griff der Mann sofort an sein Nachtsichtgerät, und Smith drückte ab. Er war ein guter Schütze, doch in dem plötzlichen grellen Licht ein halb verborgenes, bewegliches Ziel zu treffen, noch dazu mit einem galoppierenden Herzschlag, war ein schwieriges Unterfangen. Deshalb war er selbst überrascht, als der Kopf des Mannes zurückgerissen wurde und er zu Boden sank. Wie hatte Smiths Vater immer gesagt: Gut zu sein ist gut, Glück zu haben ist besser.
Er stürmte durch die Tür hinaus, wo, wie erwartet, bereits jemand lauerte. Und Smith hatte auch damit gerechnet, dass der Mann eine gute Sekunde damit verlor, das Nachtsichtgerät abzunehmen, sodass der Kerl nun mit seiner mittelalterlichen Waffe einem Gegner mit Pistole gegenüberstand. Sein Vorteil war dahin.
Smith feuerte ihm eine Kugel in die Brust und sprintete vom Lagerhaus weg in Richtung Küste. Der Mann stürzte zu Boden, rappelte sich jedoch sofort wieder auf. Die Schutzweste, die er unter dem schwarzen Pullover trug, half ihm jedoch wenig, als ihm Smith im Vorbeilaufen eine Kugel ins Gesicht feuerte.
Hinter sich hörte Smith, wie ein weiterer Bolzen abgeschossen wurde, und duckte sich instinktiv. Das Geschoss pfiff rechts an ihm vorbei. Denkbar knapp – und es waren noch gut zehn Meter bis zum Ufer. Die Chance, lebend das Wasser zu erreichen, war verschwindend gering.
Er brach nach links aus, sprintete zu einem Fischerboot, das zur Hälfte im Sand lag, und hechtete hinein. Die kurze Illusion, sich in Sicherheit zu befinden, zerplatzte jäh, als er hinter sich Holz splittern hörte und einen mächtigen Schlag am rechten Schulterblatt spürte. Er kroch hinter eine Kühlbox aus Stahl, rollte sich unter Schmerzen auf die Seite, und der Bolzen in seinem Rücken scharrte über den Boden des Bootes.
In einigen Häusern an der Küste gingen Lichter an, und die Schatten begannen sich ebenso aufzulösen wie das Adrenalin, das ihn befeuerte. Er hörte Schritte im Sand näher kommen, schraubte den Schalldämpfer von der Pistole ab und feuerte ein paar blinde Schüsse in die Richtung der Angreifer.
Das Krachen der Schüsse würde auch die letzten Dorfbewohner wecken, wenn auch wahrscheinlich nicht schnell genug, um die Männer zu verscheuchen, die ihn töten wollten. Das Wasser bot eindeutig die größere Überlebenschance.
Der Koffer war zu schwer, um damit zu schwimmen. Smith drückte mit dem Daumen auf eine bestimmte Stelle hinter dem Griff. Zu seiner Überraschung sprang das Schloss tatsächlich auf. Kleins Fehlinformation über das Gewicht war damit wieder wettgemacht.
Smith hatte keine Ahnung, was er darin finden würde, doch einen allem Anschein nach mit Müll gefüllten Druckverschlussbeutel hätte er sicher nicht erwartet. Schon absurd, wegen dieses Plunders zu sterben, ging es ihm durch den Kopf, während er den Beutel in eine Tasche seiner Cargohose steckte und noch einige Kugeln abfeuerte.
Der Schmerz im Rücken wurde immer heftiger. Er brauchte mehr als fünf Sekunden, um ans Ende des Bootes zu kriechen. Mit zusammengebissenen Zähnen hielt er sich am Außenbordmotor fest und hebelte sich über Bord.
Das Wasser war tiefer, als er gedacht hatte – gut, um sich vor den Angreifern zu schützen, aber schlecht, weil er nicht wusste, ob er mit seinen Schmerzen überhaupt schwimmen konnte. Schließlich überwand er sich, setzte sich mit verzweifelten Beinstößen in Bewegung und half mit dem Arm mit, den er bewegen konnte. Die Pistole glitt ihm aus der Hand, während er nahe der Oberfläche vom Ufer wegschwamm. Nach wenigen Augenblicken hörte er Geschosse ins Wasser einschlagen. Armbrustbolzen, vielleicht auch Pistolenkugeln. Da die Dorfbewohner ohnehin alarmiert waren, brauchten sich die Jäger nicht länger zurückzuhalten.
Smith tauchte tiefer hinunter. Zumindest kam es ihm so vor. Sein Orientierungssinn war vom Blutverlust, den Schmerzen und dem zunehmenden Sauerstoffmangel beeinträchtigt. Als seine Benommenheit stärker wurde, folgte er den Luftblasen nach oben, hielt den Mund über Wasser und schnappte verzweifelt nach Luft. Sein Kopf klärte sich, und er streckte den Kopf weit genug nach oben, um zum Strand zu blicken. Drei Männer wateten ins Wasser, um ihn zu verfolgen.
Smith tauchte erneut hinunter und schwamm, so gut es ging, weiter. Er versuchte den Bolzen im Rücken zu ignorieren, der sich immer tiefer in Muskeln und Knochen bohrte. Erst als er das Bewusstsein zu verlieren drohte, tauchte er wieder auf, um Luft zu holen und sich zu vergewissern, dass die Richtung noch stimmte. Leider führte sein Weg ins offene Meer hinaus.
Smith hatte keine Ahnung, wie lange er schon im Wasser war, als er sich eingestehen musste, dass er nicht weiterkonnte. Er tauchte auf, drehte sich auf den Rücken und trieb hilflos auf den Wellen. Nach den Lichtern zu urteilen, die immer zahlreicher am Ufer angingen, hatte er kaum vierhundert Meter geschafft. Schattenhafte Gestalten kamen aus den Häusern hervor, doch er hörte nur das einlullende Plätschern des Wassers.
Ein leiser Grunzlaut riss ihn aus seiner Benommenheit, und er schwamm in Seitenlage von dem Geräusch weg, mit dem unbeweglichen rechten Arm unter der Oberfläche. Er kam jedoch kaum noch von der Stelle, und wenige Sekunden später packte ihn eine Hand am Fußknöchel.
Smith drehte sich auf den Rücken und sah einen Arm mit einem Messer aus dem Wasser auftauchen. Mit einem Fußtritt gegen den Kopf vermochte er sich den Angreifer fürs Erste vom Leib zu halten, doch es reichte nicht, um ihn außer Gefecht zu setzen. Da er keine andere Option sah, holte Smith tief Luft, packte den Mann an der Hand mit dem Messer und zog ihn unter Wasser.
Der Mann wehrte sich, und Smith war zu geschwächt, um irgendetwas anderes tun zu können, als das Messer auf Distanz zu halten. Er schlang dem Angreifer die Beine um die Taille und konzentrierte sich darauf, den Messerstößen auszuweichen.
Smith zählte darauf, dass er sich zuvor ein wenig erholt hatte, als er sich einfach hatte treiben lassen, während sein Gegner mit voller Kraft geschwommen war, um ihn einzuholen. Er hoffte, dass dem Kerl früher die Luft ausging als ihm selbst.
Smiths Lunge brannte, was es nicht leichter machte, die quälenden Schmerzen im Rücken zu ertragen. Er blickte in die Richtung, von der er annahm, dass es oben war, und sah nur Dunkelheit. Schließlich ließen die Schmerzen nach, und ein seltsames Gefühl der Ruhe breitete sich in ihm aus.
Die Luft entwich langsam aus seinem Mund, als ihm plötzlich bewusst wurde, dass sich der Mann nicht mehr wehrte. Was bedeutete das? Was sollte er tun?
Irgendein Urinstinkt brachte ihn dazu, den Mann wegzustoßen und sich mit Beinstößen in Bewegung zu setzen. Er spürte, wie er sanft nach oben schwebte … aber wohin?
Mit dem Sauerstoff, der in seine Lunge strömte, flammte auch der Schmerz umso heftiger wieder auf, und das Bewusstsein seiner aussichtslosen Lage. Die Menge der schattenhaften Gestalten am Ufer war angewachsen, und da waren immer noch zwei Männer im Wasser hinter ihm her. Sie schienen jedoch bei Weitem nicht so gute Schwimmer zu sein wie derjenige, der ihn eingeholt hatte und jetzt am Grund lag.
Smith drehte sich auf die Seite und tauchte erneut in die Dunkelheit hinab, um sich weiter vom Ufer zu entfernen.
Als er nicht mehr weiterkonnte, waren die Lichter an der Küste nicht mehr zu erkennen. Er ließ sich auf dem Rücken treiben und spürte, wie die Strömung an dem Bolzen in seinem Rücken zerrte. Der Schmerz hatte sich gelegt. Wie alles andere auch. Es lag wahrscheinlich am Blutverlust. In seinem Kopf war alles verschwommen – er wusste kaum noch, wo er war. Im Meer, aber in welchem? Oder war es ein See? Aber war das noch wichtig?
Ein Lichtstrahl flammte vor ihm auf, und er kniff die Augen zusammen. Das Licht war nicht besonders hell, doch in der Dunkelheit nicht zu übersehen. Stimmen. Das Plätschern des Wassers an einem hölzernen Bootsrumpf.
Ein letzter schwacher Adrenalinstoß holte ihn für einen Moment ins Hier und Jetzt zurück. Der Inhalt des Koffers befand sich noch in seiner Hosentasche, doch er hatte keine Ahnung, worum es sich handelte oder was daran wichtig sein sollte. Keine Ahnung, welche Bedrohung vielleicht davon ausging, wenn es in die falschen Hände geriet. Doch die Tatsache, dass ihn Klein auf diese Mission geschickt hatte, bedeutete, dass er eine Gefangennahme um jeden Preis vermeiden musste.
Er verfügte nicht mehr über die Kraft, um dem Boot zu entkommen oder sich gegen die Männer darauf zu behaupten. Damit waren seine Möglichkeiten eng begrenzt.
Smith atmete aus, ließ sich fallen und spürte, wie das Wasser über ihm zusammenschlug.
Eine Mission zu viel.
Kapitel Zwei
Al Qababt
ÄGYPTEN
Der Straßenmarkt war prall gefüllt mit lachenden, plaudernden Menschen, die um alle möglichen Waren feilschten, von Teppichen über Haushaltsartikel bis zu ausgestopften Tieren. Schon jetzt, am frühen Vormittag, war zu spüren, dass es ein heißer Tag werden würde. Es roch nach Schweiß, Gewürzen und Fleisch, eine Atmosphäre, die auf Randi Russell seltsam beruhigend wirkte.
Es war schon seltsam, dass für sie als Frau ausgerechnet muslimische Länder die Einsatzgebiete darstellten, in denen sie am leichtesten operieren konnte. In ihren Hidschab gehüllt, bewegte sie sich völlig anonym und unbemerkt in der Menge, zwischen all den chauvinistischen Idioten, die sie gar nicht zur Kenntnis nahmen. Sie könnte einen Raketenwerfer unter ihrem langen Gewand tragen, die würden nichts merken. Aber warum sollten sie auch? Was hatten sie schon von einer Frau zu befürchten?
»Okay, Randi. Er ist direkt vor dir. Vier, fünf Meter.«
Sie bestätigte die Meldung, die sie über ihren Ohrhörer erhalten hatte, mit einem kurzen Nicken, obwohl sie nicht wusste, ob die Angehörigen ihres Teams es von ihrer Position in einem mehrstöckigen Hotel überhaupt sehen konnten.
Randi spürte, wie ihr der Schweiß auf die Stirn trat, was jedoch nicht an der Sonne lag, die ihre schwarze Kopfbedeckung aufheizte. Es war eine fast kindliche Aufregung, die ihr den Mund austrocknete und ihren Herzschlag beschleunigte. Nur vier, fünf Meter. Sie hatte sich schon gefragt, ob sie jemals so nahe an ihn herankommen würde.
Charles Hashem hatte sich zu einem Spitzenmann von Al Qaida hochgearbeitet, der neben seinem abgrundtiefen Hass auf den Westen leider auch über erstaunliche Fähigkeiten verfügte. Die CIA hatte zwei Jahre benötigt, um herauszufinden, dass er sich in Ägypten aufhielt. Anschließend hatte Randi fünf aufreibende Monate damit zugebracht, seiner Spur zu folgen, bis es an diesem Vormittag auf diesem Markt endlich so weit war.
»Ich hab ihn.«
Mit seinem grauen Hemd, der Sonnenbrille und der unauffälligen Frisur unterschied er sich kaum von den anderen Männern auf der Straße, doch Randi hatte sich in den vergangenen eineinhalb Jahren alle verfügbaren Fotos von ihm an die Wand geheftet. Fast so wie einst in ihren Teenagerjahren – nur dass sie nicht mehr davon träumte, von Luke Perry auf sein Pferd gehoben zu werden, sondern sich ihre Gedanken darauf konzentrierten, das Leben des Mannes zu beenden, der jetzt vor ihr herging.
In diesem Moment tat es ihr leid, dass sie nicht wirklich einen Raketenwerfer bei sich trug. Es hätte sie mit immenser Genugtuung erfüllt, seine Körperteile überall auf dem Pflaster verstreut zu sehen. Ihre Handykamera wäre bereit gewesen.
Das beste Foto, das je eine Weihnachtskarte der CIA geziert hätte.
»Können wir ihn an einen passenden Ort für die Ausschleusung bringen?«, fragte die Stimme in ihrem Ohr. Eine unwillkommene Erinnerung daran, dass ihre Mission in einem wesentlichen Punkt von ihren Fantasien abwich.
»Machst du Witze?«, murmelte Randi in ihr Kehlkopfmikrofon. »Sieh dich um. Achthundert Leute würden sehen, wie wir ihn in einen Van stecken. Und wohin sollten wir fahren? Der Verkehr kommt langsamer voran als ich hier zu Fuß.«
Randi verlor ihn aus dem Blick und spürte Panik in sich aufsteigen, während sie vergeblich versuchte, sich durch die Menschenmassen vor ihr zu schlängeln. Sie war stärker und schneller als die meisten Männer, doch ihre siebenundfünfzig Kilo genügten einfach nicht, um die Wand vor ihr zu durchdringen.
Ein Mann, der ihretwegen seinen Kaffee verschüttete, blickte auf den braunen Fleck auf seinem Hemd hinunter und packte sie am Arm. Im nächsten Augenblick stürzte er rücklings über einen riesigen Sack Pistazien, und der Rest des heißen Kaffees spritzte ihm ins Gesicht. Randi verschwand ungehindert in dem allgemeinen Gedränge. Niemand hier würde einer Frau zutrauen, einen großen, starken muslimischen Mann umzuwerfen.
»Verdammt! Wo ist er, Bill?«
»Mach dir nicht ins Hemd, Randi. Er ist unter die Markise links von dir gegangen, während du mit dem Kerl am Nussstand Zoff hattest. Wir können ihn im Moment nicht sehen, also schwing deinen Arsch rüber. Wenn wir ihn verlieren, nachdem wir so nahe dran waren, sind wir es, die das Waterboarding zu spüren kriegen, und nicht er.«
Erneut fühlte sie Panik aufsteigen. Hashem hatte es nicht nur meisterhaft verstanden, dem Fadenkreuz der Amerikaner zu entgehen, er hatte zudem in Stanford ein Biologiestudium mit besten Noten abgeschlossen. Der Kerl durfte ihnen nicht entwischen.
Hinter einem Stoß bunter Tücher tauchte ein vertrautes Profil auf. Sie hatte ihr Ziel wiedergefunden. »Ich sehe ihn und schnappe ihn mir.«
»Was hast du vor?« Der Argwohn in Bills Stimme war nicht zu überhören. »Wie gesagt, hier kriegen wir ihn nicht raus. Du bleibst einfach nur dran, bis wir ihn an einem passenden Ort haben.«
Obwohl sich hier jede Menge Frauen aufhielten, die genauso aussahen wie sie, würde Hashem irgendwann merken, dass er verfolgt wurde. Und wenn das passierte, würde er sich mit seinem über eins achtzig großen, neunzig Kilo schweren Körper mit einer Geschwindigkeit durch die Menge pflügen, mit der sie nicht mithalten konnte.
»Komm schon, Bill. Du weißt genauso gut wie ich …«
Randi verstummte, als sich eine mächtige Hand um ihren Arm schloss und sie herumriss. Sie griff instinktiv nach dem Messer, das sie unter ihrem weiten Gewand trug, doch dann sah sie das kaffeebefleckte Hemd und die rot glühenden Wangen. Der Pistazienmann.
Normalerweise hätte sie ihre beträchtlichen Sprachkenntnisse eingesetzt, um sich mit demütiger Gebärde aus der Affäre zu ziehen, doch dafür fehlte ihr im Moment die Zeit.
In einer fließenden Bewegung, die sie bewusst nicht so schnell ausführte, dass es unnatürlich gewirkt hätte, packte sie einen Finger der Hand, mit der er sie festhielt, und brach ihn mit einem kurzen Ruck. Der Mann jaulte vor Schmerz, sank in die Knie und hielt sich den malträtierten Finger.
»Hilfe!«, rief Randi auf Arabisch. »Ich glaube, er hat einen Herzanfall!«
Die Leute strömten herbei, ohne sie weiter zu beachten, sodass sie unbemerkt verschwinden konnte.
»Wo ist er?«, fragte Randi etwas abseits der Menge. Vor ihr teilte sich der Markt in zwei Richtungen. »Links oder rechts?«
Die Antwort kam verständlicherweise nicht sofort. Eine Eliminierung der Zielperson war aus zwei Gründen nicht autorisiert worden. Der erste Grund war nur zu verständlich: Den Mann lebend zu schnappen hätte ihnen die Möglichkeit gegeben, interessante Informationen aus ihm herauszuholen. Der zweite Grund war eher bürokratischer Natur: Charles Hashem war amerikanischer Staatsbürger. Und zwar nicht irgendein unzufriedener eingebürgerter Zuwanderer, der in seiner neuen Heimat für sich keine Chancen sah. Er war in Cleveland geboren, als Sohn persischer Eltern, die froh und dankbar waren, dass Amerika es ihnen ermöglicht hatte, den Iran zu verlassen. Sie selbst hatten die Behörden schließlich auf die zunehmende Radikalisierung ihres Sohnes hingewiesen.
Randi hörte ein paar gedämpfte Wörter, so als würde Bill mit seinem Partner sprechen. »Nein, nein. In ungefähr einer Stunde.«
Randi lächelte. In einer Stunde war es elf Uhr. Hashem befand sich also auf elf Uhr.
Sie schlängelte sich zwischen den Leuten vor ihr hindurch, bis sie direkt hinter ihm war. Statt eines Raketenwerfers, den sie leider nicht zur Hand hatte, zog sie einen Kugelschreiber aus einer Tasche, klickte ihn an und achtete darauf, keinem der unschuldigen Menschen, die sich an ihr vorbeidrängten, damit zu nahe zu kommen.
Hashem zuckte kurz, als er den Stich im Rücken spürte, doch als er sich umdrehte, eilte Randi bereits zu einem Stand mit Olivenfässern.
Der Schmerz würde in wenigen Sekunden vergehen, und in ein paar Minuten würde auch der Einstich nicht mehr zu erkennen sein. Das winzige Kügelchen würde sich jedoch langsam in seinem Blutkreislauf auflösen. Und es würde ein Gift freisetzen, das – so hatte man ihr versichert – einen äußerst unangenehmen Tod nach sich ziehen würde.
Angeblich stammte die Substanz von einer hochgiftigen Seeschlange. Was würden sich die Jungs in Langley als Nächstes ausdenken?
Kapitel Drei
Nordost-Japan
Weiß.
Die Farbe des Himmels, oder?
Wenn es stimmte, gab es für Smith nur zwei mögliche Erklärungen: Entweder er lebte noch, oder Gott war ein krasses Fehlurteil unterlaufen.
Nach und nach sah er wieder schärfer, und ihm wurde klar, dass Ersteres zutraf. Da waren keine Engelschöre. Nur eine Zimmerdecke.
Smith versuchte sich aufzusetzen, was die Schmerzen im Rücken sofort ins Unerträgliche steigerte und ihn zwang, sich wieder auf die Matratze fallen zu lassen. Seinen Oberkörper schien er einigermaßen normal bewegen zu können, und eine kurze Überprüfung ergab, dass das auch für seine Finger und Zehen galt. Keine Lähmung. Vorsichtig drehte er den Kopf ein kleines Stück, um einerseits die Umgebung zu erkunden und andererseits anhand der Schmerzen festzustellen, wie schwer seine Verletzungen waren.
Sein neues Zuhause war jedenfalls kein Krankenhauszimmer. Dafür sah es zu nett aus mit seinen kunstvoll gefertigten japanischen Wandschirmen in modernem Design, den ebenso teuren wie geschmackvollen Möbeln und den farbenfrohen modernen Kunstwerken. Es gab keine Fenster, die ihm hätten verraten können, ob es Tag oder Nacht war, und kaum Geräusche außer dem Summen der Apparate zu seiner Linken.
Er warf einen Blick auf den Monitor neben dem Bett und las die Angaben für Herzfrequenz und Blutdruck ab. Die Werte waren nicht toll, deuteten aber auch nicht darauf hin, dass er auf der Kippe zum Tod stand.
Smith schloss für einen Moment die Augen und versuchte tief einzuatmen, doch die jäh aufflammenden Schmerzen ließen ihn den Versuch schnell wieder abbrechen. Er musste davon ausgehen, dass ihm der Armbrustbolzen zusätzlich zu der Wunde im Rücken auch noch ein paar gebrochene Rippen eingetragen hatte.
Während sich seine Gedanken schärften, begutachtete er den Tropf an seinem Arm und versuchte vergeblich, die Aufschrift am Beutel zu lesen. Wahrscheinlich Antibiotika, Salzlösung und möglicherweise ein Opiat als Schmerzmittel, wie die vertraute Übelkeit vermuten ließ. Beunruhigender war allerdings der Drainageschlauch zwischen seinen Rippen, der in ein Gefäß auf dem Fußboden mündete. Kollabierte Lunge. Nicht so toll.
Smith griff nach dem Stethoskop auf dem Infusionsständer und steckte es in die Ohren. Er biss die Zähne zusammen, um sich gegen den Schmerz zu wappnen, und zwang sich einzuatmen, während er das Instrument an seine Seite drückte. Es klang, als würde sich seine Lunge wieder entfalten. Nicht gerade ein Grund zum Feiern, aber besser als die Alternative.
Er hatte die Arbeit in den MASH-Einheiten, den Feldlazaretten der Army, schon vor langer Zeit aufgegeben, um sich der Mikrobiologie zu widmen, aber was er damals gelernt hatte, war nicht vergessen. Aufgrund der Fakten ließ sich eine solide Prognose stellen. Mit viel Ruhe und der entsprechenden Pflege konnte er wieder völlig gesund werden. Die Tatsache, dass er sich nicht in einem Krankenhaus befand, ließ ihn jedoch bezweifeln, dass ihm die dafür nötigen Voraussetzungen vergönnt sein würden.
Smith hörte ein Geräusch auf der anderen Seite der einzigen Tür, die sich im nächsten Augenblick langsam öffnete. Er überlegte kurz, ob er sich bewusstlos stellen sollte, doch er wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Kamera überwacht. Sein mysteriöser Wohltäter würde sich nicht so leicht täuschen lassen. Was hätte es ihm auch genutzt? An Flucht war im Moment nicht zu denken. In seinem Zustand hätte er das Zimmer bestenfalls auf allen vieren verlassen können. Es war besser herauszufinden, mit wem er es zu tun hatte, als dazuliegen und zu rätseln.
Der Japaner, der das Zimmer betrat, war etwa Mitte vierzig und hatte grau meliertes Haar und eine massige Statur. Sein Anzug und seine Frisur wirkten teuer, schienen aber irgendwie nicht ganz zu ihm zu passen. Selbst mit seiner von Schmerzmitteln verschleierten Wahrnehmung erkannte Smith, dass der Typ nicht die besten Schulen und Universitäten besucht hatte, wie er vielleicht vortäuschen wollte. Wahrscheinlicher war, dass er seinen Aufstieg einer etwas brachialeren Methode verdankte: indem er seine Konkurrenten aus dem Weg geräumt hatte.
»Wer sind Sie?«, brachte Smith mit einem heiseren Krächzen heraus. Der Mann griff nach einer Tasse und hielt sie ihm hin, und Smith nahm einen Schluck mit dem Strohhalm.
»Das wollte ich Sie auch gerade fragen.«
Sein Englisch war besser als erwartet. Vielleicht hatte er einige Rivalen auch mithilfe seines Verstandes besiegt.
Smith legte sich zurück und verzog das Gesicht, um anzudeuten, dass die Schmerzen zu groß waren, um von sich zu erzählen.
»Sie erscheinen mir äußerst interessant«, erklärte der Mann und vermied es seinerseits, etwas von sich preiszugeben. »Mein Arzt hält es für nahezu undenkbar, dass jemand mit einem Armbrustbolzen im Rücken so weit schwimmen kann. Und doch haben Sie es getan.«
»Highschool-Meister im Brustschwimmen«, brachte Smith heraus und hustete schwach. Der Schmerz, den es auslöste, hätte ihm den Atem genommen, vorausgesetzt, er hätte überhaupt atmen können.
»Verstehe.«
Smith deutete auf die Tasse, und der Mann musterte ihn einen Moment, ehe er ihm die Tasse hinhielt, um ihn trinken zu lassen. Wahrscheinlich weniger aus Güte, sondern vielmehr, um seine Stimme wieder in Gang zu bringen.
»Noch bemerkenswerter fand ich aber die Männer, die hinter Ihnen her waren. Sie waren unglaublich hartnäckig und gaben die Verfolgung nicht auf, bis sie alle ertranken.«
Smith strengte sein benebeltes Gehirn an. Konnte das stimmen? Falls der Mann das Geschehen tatsächlich so beobachtet hatte, wie er es schilderte, würde das bedeuten, dass er nichts mit dem Angriff auf ihn zu tun hatte. Das elegante Haus, die Männer, die in leisen Booten vor der Küste unterwegs waren. Vielleicht ein Schmuggler? Oder ein einfacher Drogenkurier?
»Sie werden verstehen, dass es mich interessiert, was in meinen Gewässern vor sich geht.«
Smith erkannte, dass es in seinem Zustand nicht sinnvoll war, mit dem Mann Katz und Maus zu spielen, und schickte sich an, eine Ohnmacht vorzutäuschen – doch im nächsten Augenblick zeigte sich, dass er sich die Schauspielerei sparen konnte. Seine Sicht verschwamm, und seine Augen begannen zu flattern. Es gab keinen Grund, dagegen anzukämpfen, also ließ er die Dunkelheit über sich kommen.
Als der Mann wieder sprach, klang seine Stimme tausend Meilen entfernt. »Natürlich. Ruhen Sie sich aus. Wir haben alle Zeit der Welt, um zu plaudern.«
Kapitel Vier
Kairo
ÄGYPTEN
Randi Russell fuhr sich mit den Fingern durch ihr kurzes Haar, rückte näher an den Duschkopf und beobachtete, wie die schwarze Farbe im Abfluss verschwand. Die Wirkung der Bräunungscreme, mit der sie ihr Gesicht verdunkelt hatte, würde sich mit der Zeit verflüchtigen.
Als das abfließende Wasser klar war, drehte sie den Hahn ab und trat aus der Dusche auf den Fliesenboden. Der beschlagene Spiegel zeigte nur ein verschwommenes Abbild ihres schlanken, dunkel getönten Körpers und ihrer dunklen Augen unter dem blonden Haarschopf. Ihre athletische Anmut hatte ihr immer schon Türen geöffnet, Männer abgelenkt und dazu verleitet, sie falsch einzuschätzen.
In den letzten Jahren war ihr einiges gelungen. Sie hatte sich nicht nur die Dankbarkeit von Staats- und Regierungschefs erworben, sondern auch einiges Ansehen unter den Kollegen von CIA, MI6 und verschiedenen anderen Geheimdiensten. Das Problem war nur, dass die toten Feinde und Freunde, die vielen Missionen und das ständige Unterwegssein ihr ein wenig zuzusetzen begannen. Sie nahm sich vor, daran zu arbeiten, wenn sie wieder zurück in die Staaten kam. Und jetzt, da Charles Hashem endlich in der Hölle schmorte, konnte sie sich vielleicht wirklich ein wenig Ruhe und Entspannung gönnen.
Sie schlüpfte in eine alte Jogginghose und ein T-Shirt mit einem riesigen Smiley-Gesicht und der Aufschrift: »Have a Nice Day«. Ein Geschenk von einem Mossad-Agenten mit Sinn für Humor.
Was sie jetzt vor allem brauchte, waren ein Drink, ein bequemes Bett und zehn Stunden bewusstloser Schlaf. Morgen würde sie sich unter die Touristen und Geschäftsleute mischen und einen Vormittagsflug zum Reagan National Airport in Washington nehmen, wo sie sich dann hysterische Vorwürfe würde anhören müssen, weil sie einen amerikanischen Staatsbürger getötet hatte, obwohl alle gefunden hatten, dass der Mann ausgeschaltet werden musste. Letztlich waren die Bürokraten immer nur darauf bedacht, ihren Arsch abzusichern. Randi wusste, sie brauchte sich keine größeren Sorgen deswegen zu machen als beim letzten und vorletzten Mal, als sie so gehandelt hatte.
Sicher, eines Tages würden sie sie vielleicht über die Klinge springen lassen, aber dieser Tag war noch fern. Sie würden damit warten, bis Randis Fähigkeiten nachließen und sie nicht mehr ganz so nützlich war wie jetzt. Vorläufig konnte sie sich darauf verlassen, dass ihre Vorgesetzten sie für Dinge benötigten, die sie selbst nicht zustande bringen würden oder von denen sie fürchteten, dass sie ihnen in einer Anhörung vor dem Kongress den Kragen kosten könnten. Leute mit Randis Fähigkeiten und ihrer Erfahrung waren schwer zu ersetzen.
Sie rieb sich mit dem Handtuch auf dem Kopf die Haare trocken und trat aus dem Badezimmer in ihre Hotelsuite.
Dass sie so viele gefährliche Situationen überlebt hatte, lag nicht zuletzt daran, dass ihr Körper stets blitzschnell ausführte, was ihre Gedanken wollten. Als der Mann, der im Lederstuhl an der Bar saß, zu ihr aufblickte, hatte sie bereits das Messer aus der Hosentasche gezogen, um es zu werfen.
Er runzelte missbilligend die Stirn und betrachtete sie über seine Stahlbrille hinweg.
»Mr. Klein«, sagte Randi, ohne das Messer zu senken. »Was machen Sie hier?«
Fred Klein war der Kopf einer geheimen Sondereinheit namens Covert One, die sich aus handverlesenen Agenten und diversen Spezialisten zusammensetzte. Der Präsident der Vereinigten Staaten, ein Jugendfreund Kleins, hatte die Organisation vor einigen Jahren ins Leben gerufen, um die zunehmende Lähmung der Regierungsbehörden zu umgehen. Covert One sprang immer dann in die Bresche, wenn die Zeit drängte und ein Scheitern fatale Konsequenzen nach sich gezogen hätte.
Randi arbeitete erst seit relativ kurzer Zeit für Covert One, nachdem sich Jon Smith für ihre Rekrutierung ausgesprochen hatte. Sie war sich noch immer nicht ganz sicher, worauf sie sich eingelassen hatte. Eines war ihr jedoch klar: Wenn Fred Klein so unerwartet auftauchte, war irgendetwas nicht nach Plan verlaufen. Und das bedeutete, dass auch sie selbst bedroht war.
»Ich muss mit Ihnen sprechen«, erklärte Klein.
»Dafür haben sie das Telefon erfunden.« Randi trat langsam vom Fenster weg. Die Vorhänge waren zugezogen, doch es gab für einen Scharfschützen auch andere Wege, um sein Ziel anzuvisieren.
Klein war nicht unbedingt eine stattliche Erscheinung. Mittelgroß, schütteres Haar und ein ewig zerknitterter Anzug. Doch in der kurzen Zeit, die sie ihn kannte, hatte sie den Mann respektieren gelernt. Er verfügte über eine fast schon beunruhigende Fähigkeit, zehn Schritte vorauszudenken, und leistete sich nur selten einen Fehler. Es war gut, jemanden wie ihn im eigenen Team zu haben, doch in diesem Geschäft war die Zugehörigkeit zu einem Team oft nur von kurzer Dauer.
»Es handelt sich um etwas, das wir besser persönlich besprechen.« Klein wischte sich einen nicht vorhandenen Schweißtropfen von der Oberlippe. »Wir haben den Kontakt mit Jon verloren.«
»Der letzte Kontakt?«
»In einem Fischerdorf nordöstlich von Toyama in Japan.«
»Ich kenne die Gegend.« Randi ließ das Messer sinken. »Ich fliege hin und finde ihn.«
Klein erhob sich so abrupt, dass sie das Messer unwillkürlich etwas fester umfasste, doch er trat nur zur Bar und schenkte zwei Whiskys ein. Er reichte ihr ein Glas und setzte sich wieder auf den Stuhl.
»Jon wurde von einem Armbrustpfeil in den Rücken getroffen und wurde zuletzt gesehen, wie er ins offene Meer hinausschwamm, von drei Männern verfolgt. Ich lasse seit zwei Tagen mehrere Leute nach ihm suchen …« Er verstummte.
Es war klar, was er damit andeutete. Randi trat mit etwas wackeligen Beinen zu einem Sofa ihm gegenüber.
»Ich wollte es Ihnen mitteilen, bevor Sie es von jemand anderem erfahren«, fügte er hinzu, als sie sich setzte. »Die Erklärung für die Öffentlichkeit ist, dass er zum Höhlentauchen an die Küste von Okinawa gefahren ist. Dort gab es einen Unfall, und seither gilt er als vermisst.«
Schlau wie immer, dachte Randi benommen. Unter diesen Umständen würde niemand erwarten, die Leiche zu finden.
»Ich habe gehört, dass Ihre Mission in Ägypten beendet ist und Sie morgen nach Washington zurückfliegen.« Er wirkte etwas gebeugt, als er aufstand und zur Tür schlurfte. »Wir müssen reden, wenn Sie zurückkommen. Über das, woran Jon gearbeitet hat.«
Randi sah ihm nach, als er schweigend hinausging, und starrte einige Sekunden auf die geschlossene Tür. Einen Moment lang glaubte sie, sich übergeben zu müssen, doch die Übelkeit legte sich und wich einem Gefühl der Einsamkeit, was noch schlimmer war.
Nein. Jon hatte schon genug brenzlige Situationen erlebt und immer einen Ausweg gefunden. Kleins Leute hatten ihn einfach noch nicht gefunden. Außerdem … wer sagte denn, dass der Mann nicht log? Was wusste sie denn schon über ihn?
Randi zwang sich aufzustehen und holte das Handy von ihrem Nachttisch. Sie scrollte durch die verschlüsselte Liste ihrer Kontakte, bis sie den gesuchten fand: eine namenlose Nummer mit japanischer Vorwahl.
Kapitel Fünf
Vor den Senkaku-Inseln
OSTCHINESISCHES MEER
Die Ernennung zum Ersten Offizier von Japans neuestem Kriegsschiff war für Gaku Akiyama der stolzeste Moment seines Lebens gewesen, das immer schon unter einem glücklichen Stern gestanden hatte. Er war ein herausragender Sportler gewesen, hatte ein Geschichtsstudium in Oxford absolviert und war danach, so wie sein Vater vor ihm, den japanischen Seestreitkräften beigetreten. Sein Bemühen, der Familie Ehre zu machen für alles, was sie für ihn getan hatte, war über alle Erwartungen von Erfolg gekrönt.
Seine Träume waren Wirklichkeit geworden, hatten jedoch mit der Zeit auch ihre Schattenseiten mit sich gebracht.
Er stand am Rand des Decks und beobachtete im Licht der untergehenden Sonne einen chinesischen Raketenkreuzer, der unglaublich provokant nur einen halben Kilometer entfernt vorbeilief. Dahinter waren die orangen Silhouetten von acht weiteren chinesischen Kriegsschiffen zu erkennen, die die Entschlossenheit und die militärische Überlegenheit des Landes demonstrieren sollten. Den Rand seines Sichtfelds bildeten die gezackten Umrisse einer Gruppe nutzloser Felsbrocken, die in Japan als Senkaku-Inseln bekannt waren, während die Chinesen sie die Diaoyu-Inseln nannten.
Akiyama blickte hinter sich zu den Männern, die ihren Pflichten nachgingen, den Hubschraubern, die in einer Reihe standen und auf ihren Einsatz warteten, und über das Deck des zweihundertfünfzig Meter langen Schiffes, das so großen Unmut auf chinesischer Seite ausgelöst hatte.
Obwohl er sich selbst als glühenden Patrioten betrachtete, konnte er in diesem Punkt nicht umhin, ein gewisses Verständnis für die Gegenseite aufzubringen. Es wäre in der Tat recht einfach, die Izumo binnen weniger Monate für den Abschuss von Angriffswaffen aufzurüsten.
Andererseits wies die Führung seines Landes mit Recht darauf hin, dass eine solche Maßnahme völlig sinnlos wäre. Japan war zwar vor dem Zweiten Weltkrieg in China eingefallen, doch das war lange her. Der zunehmend aggressive Nachbar im Westen verfügte heute über eine Armee von über zwei Millionen Mann, ein Budget, das dreimal so hoch war wie das von Japan, und eine Marine mit über siebenhundert Schiffen. Zudem hörte man aus zuverlässigen Quellen, dass China beabsichtigte, seinen neuen Flugzeugträger in die Region zu schicken, um Japan noch mehr zu demütigen, indem es das Kronjuwel seiner Flotte um vieles überragte.
Und das alles wofür? Für ein paar Felsen, die aus dem Meer ragten? Oder etwas Erdöl, das vielleicht aus dem Meeresboden gefördert werden konnte? Für die Fischereirechte?
Nein, in Wahrheit war das alles belanglos. In diesem Zwist ging es allein um die Vergangenheit. Um die Gräueltaten, die seine Vorfahren vor so vielen Jahren gegenüber dem chinesischen Volk verübt hatten. Ebenso um die Demütigung, die das japanische Volk mit der Kapitulation erlitten hatte. Um die wachsende Überzeugung seiner Generation, nicht für etwas büßen zu müssen, was sich viele Jahre vor ihrer Geburt zugetragen hatte.
Die Amerikaner hatten aus verständlichen Gründen in der japanischen Verfassung festschreiben lassen, dass das Land lediglich über begrenzte Streitkräfte zur Selbstverteidigung verfügen dürfe. Seine Vorfahren waren ein kriegerisches und oft auch brutales Volk gewesen. Doch diese Welt existierte nur noch in den Schulbüchern seiner Jugend. Japan hatte sich zu einem unglaublich wohlhabenden Land entwickelt, das auf dem fragilen Fundament von wirtschaftlicher Stabilität und Zusammenarbeit beruhte. Es war seit vielen Jahren eine der innovativsten Kräfte der Welt und unterstützte seine weniger wohlhabenden Nachbarn mit Milliarden. Dennoch durfte man die wachsende Bedrohung durch China und Nordkorea nicht ignorieren. Konnte man sich darauf verlassen, dass die Vereinigten Staaten Japan im Notfall beistehen würden? Die noch wichtigere Frage war, ob man das von den Amerikanern überhaupt noch erwarten sollte. Nach Akiyamas Ansicht lautete die Antwort darauf klar und deutlich Nein. Es war Zeit für Japan, auf eigenen Füßen zu stehen.
Das erforderte jedoch viel politisches Geschick und Feingefühl. Was er hier beobachtete, waren beileibe nicht die besonnenen ersten Schritte hin zu militärischer Selbstständigkeit. Nein, was sich hier abspielte, war eine sinnlose Eskalation, die Politiker zu verantworten hatten, denen es lediglich um den eigenen Machterhalt ging. Solche Szenarien hatte es in der Geschichte immer wieder gegeben, doch anscheinend war niemand bereit, daraus zu lernen. Sobald das Feuer des Nationalismus ein bestimmtes Ausmaß erreichte, ließ es sich nur noch mit Blut löschen.
Der Wind wurde stärker, und Akiyama schlug den Kragen seiner Jacke hoch, während er den Sonnenuntergang im Westen betrachtete. Er wollte schon unter Deck gehen, als der trügerische Frieden von einem durchdringenden Alarmton gebrochen wurde. Der Erste Offizier wirbelte herum und sah seine Männer für einen Moment erstarren, ehe sie in alle Richtungen davoneilten.
»Auf Gefechtsstation!«, rief Akiyama den vorbeilaufenden Männern zu. »Alle Mann auf Gefechtsstation!«
Aus dem Kopfhörer drang ein nahezu unverständliches Stimmengewirr. Für einen Moment ignorierte er die ruhige Stimme des Kapitäns, der seine Befehle durchgab, und konzentrierte sich auf die fast panische Stimme eines jungen Offiziers, der den Grund für den Alarm nannte. Ein chinesischer Lenkwaffenzerstörer der Luzhou-Klasse hatte die Izumo mit seinem Zielradar erfasst.
Akiyama rannte über das Deck, überprüfte die Positionen seiner Männer, sprach ihnen Mut zu und brüllte scharfe Zurechtweisungen, wo es nötig war. Vor allem aber bemühte er sich nach Kräften, Ruhe auszustrahlen.
»Niemand hebt einen Finger ohne ausdrücklichen Befehl!«, rief er wieder und wieder. »Ist das klar? Es ist mir egal, wie die Umstände sind. Niemand handelt ohne ausdrückliche Anweisung eines Offiziers!«
Er legte einem verängstigt wirkenden Jungen von höchstens neunzehn Jahren die Hand auf die Schulter und drückte sie aufmunternd. »Es gibt keinen Grund zur Sorge, verstanden? Sie haben für diese Situation trainiert und wären nicht auf der Izumo, wenn Sie nicht zu den Besten unseres Landes gehören würden.«
Der Junge nickte schwach, und Akiyama eilte weiter. Es erfüllte ihn mit Stolz zu sehen, wie schnell und effizient seine Männer ihre Aufgaben ausführten. Doch noch mehr als Stolz empfand er Angst. Tatsache war, dass keine Seite in diesem Konflikt über kampferprobte Truppen verfügte. Er konnte nichts anderes tun, als auf seine etwas erfahreneren Männer zu setzen, auch wenn sie genauso wie die jüngsten unter ihnen über keinerlei Gefechtserfahrung verfügten.
Der Erste Offizier konnte nicht umhin, der Realität ins Auge zu sehen: Hier standen sich Hunderte verängstigte junge Leute gegenüber, die auf den beiden Enden einer Rasierklinge balancierten.
Kapitel Sechs
Weißes Haus, Washington, D.C.
USA
»Freut mich, Sie zu sehen, Mr. Klein«, grüßte der Leiter des Sicherheitsteams des Präsidenten.
»Dave«, erwiderte Klein den Gruß.
Er kannte David McClellan, seit der Mann vor fast zwanzig Jahren zum Secret Service gekommen war, und es gab in allen Regierungsbehörden keinen verschwiegeneren Mitarbeiter als ihn. Der perfekte Mann für diesen Job.
Präsident Sam Adams Castilla war allein. Es war kurz vor Mitternacht, und seine Frau Cassie war längst zu Bett gegangen. Er stand nicht auf, sondern erwartete seinen alten Freund mit einer gut gekühlten Dose Coors-Bier in der Hand.
Früher hatten sie weniger darauf geachtet, aus ihren Zusammenkünften ein Geheimnis zu machen. Für die anderen sollte es so aussehen, als würden sie sich als zwei gute Freunde treffen, die wieder einmal Lust hatten, über die alten Zeiten zu plaudern. Seit einiger Zeit war Klein jedoch zunehmend besorgt, dass seine Geheimdienstvergangenheit, die ihn zum Chef von Covert One prädestinierte, so manchen misstrauisch machen könnte. Deshalb besuchte er den Präsidenten nun möglichst unbemerkt.
Castilla nahm einen Schluck Bier, bevor er zur Sache kam. »Es ist noch nicht in den Medien, aber gestern hat ein chinesischer Lenkwaffenkreuzer ein neues japanisches Kriegsschiff mit seinem Zielradar erfasst.«
»Bei den Senkaku-Inseln, nehme ich an?«