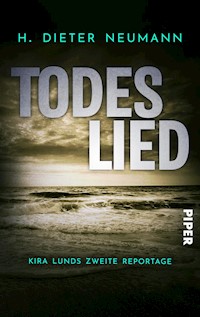5,99 €
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Johannes Clasen ermittelt
- Sprache: Deutsch
Wenn du nicht weißt, ob du schuldig bist oder nicht … Der packende Thriller „Die Narben der Hölle“ von H. Dieter Neumann jetzt als eBook bei dotbooks. Er war immer überzeugt, auf der richtigen Seite zu kämpfen. Doch nach seinem Einsatz in Afghanistan zweifelt Offizier Johannes Clasen nicht nur am Krieg, sondern auch an sich selbst: Seit einem Angriff auf seine Einheit leidet er unter einer partiellen Amnesie. Dass man ihm vorwirft, im Gefecht zwei unschuldige Kinder getötet zu haben, belastet ihn zusätzlich. In der Hoffnung, dass die Erinnerung zurückkehrt, flüchtet er in die Einsamkeit seiner Yacht – aber der Segeltörn entpuppt sich bald als Höllentrip! Unbekannte attackieren Clasen mit einer Erbarmungslosigkeit, die nur einen Schluss zulässt: Auch fernab vom Hindukusch ist sein Kampf auf Leben und Tod noch lange nicht vorbei … „DIE NARBEN DER HÖLLE ist nicht nur ein spannender Thriller, sondern auch eine politische Anklage.“ Flensburger Tageblatt Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Die Narben der Hölle“ von H. Dieter Neumann. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch:
Er war immer überzeugt, auf der richtigen Seite zu kämpfen. Doch nach seinem Einsatz in Afghanistan zweifelt Offizier Johannes Clasen nicht nur am Krieg, sondern auch an sich selbst: Seit einem Angriff auf seine Einheit leidet er unter einer partiellen Amnesie. Dass man ihm vorwirft, im Gefecht zwei unschuldige Kinder getötet zu haben, belastet ihn zusätzlich. In der Hoffnung, dass die Erinnerung zurückkehrt, flüchtet er in die Einsamkeit seiner Yacht – aber der Segeltörn entpuppt sich bald als Höllentrip! Unbekannte attackieren Clasen mit einer Erbarmungslosigkeit, die nur einen Schluss zulässt: Auch fernab vom Hindukusch ist sein Kampf auf Leben und Tod noch lange nicht vorbei …
„DIE NARBEN DER HÖLLE ist nicht nur ein spannender Thriller, sondern auch eine politische Anklage.“ Flensburger Tageblatt
Über den Autor:
H. Dieter Neumann, Jahrgang 1949, wurde nach dem Abitur zunächst Offizier in der Luftwaffe der Bundeswehr. Später kündigte er sein Dienstverhältnis, um Finanzwirtschaft zu studieren. Er arbeitete als Vertriebsleiter und Geschäftsführer in der Versicherungsbranche, bis er seine Leidenschaft für das Schreiben von Kriminalromanen, Thrillern und Sachbüchern entdeckte. H. Dieter Neumann ist ein passionierter Segler. Er lebt mit seiner Frau in Flensburg.
Der Autor im Internet: www.hdieterneumann.de
Bei dotbooks erscheint von H. Dieter Neumann außerdem:
Das Erbe der Wölfin
***
Überarbeitete eBook-Neuausgabe November 2016
Copyright © der Originalausgabe 2012 Verlag Jürgen Wagner Südwestbuch, SWB-Verlag Stuttgart
Copyright © der überarbeiteten Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/De Visu
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-821-2
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Die Narben der Hölle an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
H. Dieter Neumann
Die Narben der Hölle
Thriller
dotbooks.
Für Kirsten
»Alles, was man vergessen hat,schreit im Traum um Hilfe.«
Elias Canetti
1
September
Türkei
Er geht über die Wellen. Sein Blick ist fest auf den Punkt am Horizont gerichtet, an dem die Sonne als glutroter Ball dicht über der See steht.
Ganz leicht ist er, spürt sein eigenes Gewicht nicht, schwebt fast federgleich über das Wasser. Seine bloßen Füße fühlen die Säume der Wellen wie kleine Unebenheiten in einem warmen, weichen Teppich. Der Wellenteppich bewegt sich sanft, bringt ihn nicht aus dem Gleichgewicht. Er zieht ihn in seinen gleichförmig wogenden Rhythmus, an den Fußsohlen beginnend, weiter durch den ganzen Körper und bis hinein in den Kopf. Der Rhythmus nimmt ihn ganz und gar in Besitz.
Ewig wollte er so gehen. Der Feuerball am Horizont bewegt sich nicht, geht nicht unter, verharrt wie ein strahlendes Richtfeuer direkt am Rande der sichtbaren Welt. Der Himmel wölbt sich als Kuppel über ihm, stahlblau im Zentrum, zum Horizont hin weich in nebliges Grau übergehend …
»… and switch off all electronic equipment until we have reached our final parking position.«
In einer weiten Rechtskurve zog der Airbus A-321 im Sinkflug durch den wolkenlosen Himmel und begann seinen Endanflug auf den Flughafen von Izmir. Als er die Augen öffnete, konnte Johannes Clasen von seinem Platz am Fenster die Bucht vollständig überblicken. Unter der Tragfläche lag der riesige Hafen der Millionenstadt. Mächtige Containerschiffe, kastenförmige Autotransporter und Frachter jeder Größe in einer langen Kette wie auf einer Autobahn. Zwischen ihnen geschäftige Personenfähren und unzählige Fischerboote und Segelschiffe. Draußen die blaue Weite der Ägäis. Am Horizont die Nordspitze der großen Halbinsel Karaburun.
Im Flugzeug war er von den Kopfschmerzen verschont geblieben, die ihn oft noch heimsuchten. Den Flug hatte er seit dem Start in Stuttgart fast vollständig verschlafen.
Nun aber war er hellwach. Drei Wochen Freiheit warteten auf ihn. Warmer Wind und weiße Segel im Licht.
Und vielleicht keine Angst.
Geduldig schlurfte er in der schwitzenden Menschenschlange durch die Ankunftshalle. Endlich die Zollkabine, eine streng blickende Uniformierte, das Kärtchen mit dem Einreisestempel – geschafft! Er holte seine beiden Reisetaschen vom Gepäckband und trat aus dem Terminal hinüber in die Empfangshalle.
Wildes Stimmengewirr, begleitet von türkischer Popmusik aus unzähligen Lautsprechern, schlug ihm entgegen, laute Rufe, Kindergeschrei. Herzzerreißende Begrüßungsszenen. Und mittendrin die Abgesandten von Dutzenden Reiseveranstaltern, die ihre Pappschilder hochhielten und fortgesetzt verheißungsvolle Hotelnamen brüllten.
Johannes lächelte. Alles so wie immer. Herrliches levantinisches Chaos – wie hatte er sich darauf gefreut! Sein Blick fiel auf zwei junge Männer in bunten Hemden, die nur wenige Meter entfernt standen. Ein merkwürdiges Unbehagen beschlich ihn auf einmal. Ihm war, als hätten die beiden ihn schon begleitet, seit er aus dem Terminal gekommen war. Hatten sie ihn gerade angestarrt? Jetzt senkten sie ihre Blicke, betrachteten ein Stück Papier, das einer von ihnen in der Hand hielt, und diskutierten miteinander.
Johannes spürte auf einmal, dass seine Kehle ausgedörrt war. Er brauchte etwas zu trinken. Suchend sah er sich in der riesigen Halle um. Seine Körpergröße half ihm, mühelos über das Gewimmel hinwegzublicken. Da, ein Stück entfernt, war eine Saftbar, vielfarbig beleuchtet und von ein paar künstlichen Palmen umstanden. Sofort steuerte er zielstrebig auf die kleine Theke zu. Und nun war er sich sicher: Die jungen Männer folgten ihm! Beide waren mittelgroß. Die Muskeln ihrer durchtrainierten Körper zeichneten sich unter den engen Hemden ab. Sie traten fast gleichzeitig neben ihm an den Tresen und unterhielten sich. Keine zwei Meter entfernt standen sie vor dem Tresen, doch der Lärmpegel in der Halle war so hoch, dass Johannes nicht einmal hören konnte, in welcher Sprache sie redeten. Einer von ihnen schickte einen verstohlenen Blick zu ihm herüber, wandte sich aber sofort wieder seinem Gefährten zu.
Wahrscheinlich hatten sie es auf sein Gepäck abgesehen. Er blickte hinunter auf die beiden Reisetaschen, die vor seinen Füßen standen. Ein blitzartiger Griff, und sie wären mit den Taschen zwischen all den Menschen untergetaucht. Das war ihm zu riskant. Erst mal nichts gegen den Durst …
Er griff sein Gepäck, ging mit schnellen Schritten zum Ausgang und trat hinaus in die trockene Hitze des Septembernachmittags. Vorsichtig schaute er über die Schulter. Da waren sie wieder, zielstrebig kamen sie auf ihn zu. Johannes umklammerte die Henkelgriffe seiner Taschen und blickte sich hilfesuchend um. Nirgends ein Polizist zu entdecken. Niemand nahm Notiz von ihm.
Ruhig jetzt – einfach stehen bleiben. So leicht ließ er sich nicht beklauen!
Als sie ihn erreicht hatten, gingen die beiden Bunthemden schweigend an ihm vorbei, ohne ihn überhaupt zu beachten, überquerten die breite Zufahrtsrampe und verschwanden auf der anderen Seite zwischen den Reisebussen.
Und er war sich so sicher gewesen, dass die Burschen etwas im Schilde führten. Verfolgungswahn. Kommt davon, wenn man zu lang in der Hand von Psychiatern ist … Höchste Zeit, sich wieder an ein normales Leben zu gewöhnen!
Mit einem tiefen Seufzer holte er sein Mobiltelefon aus der Hemdtasche, schaltete es ein und wartete ein paar Augenblicke darauf, dass es sich in das türkische Netz einloggte. Gerade wollte er Mehmets Nummer aus dem Kurzwahlspeicher aufrufen, da rauschte auch schon ein staubbedeckter silberfarbiger S-Klasse-Mercedes heran, zwängte sich zwischen die wartenden Taxis und hielt am Bordstein direkt vor ihm.
Mehmet Görgün, bärtig, dick und gutgelaunt wie eh und je, ließ den Motor einfach laufen und sprang heraus. Das Jackett seines hellgrauen Maßanzuges hatte er im Wagen gelassen, aber die elegante Seidenkrawatte war trotz der Hitze perfekt um den Kragen seines makellos weißen Hemdes gebunden.
»Hoşgeldiniz, Jo!«, rief er aufgeräumt und kam mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu. »Hab dich schon gesehen, als du aus dem Terminal gekommen bist«, fügte er in akzentfreiem Deutsch hinzu. In sehr bayerisch gefärbtem allerdings, stellte Johannes amüsiert fest. Kein Wunder: Mehmet war gebürtiger Münchener. Erst seit ein paar Jahren lebte er hier im Land seiner Vorfahren.
Sollte er Mehmet von den beiden Bunthemden erzählen?
Der würde ihn sicher auslachen. Stattdessen brachte er gerade noch ein »Ganz schöne Hitze habt ihr hier« heraus, bevor er von seinem alten Freund in die Arme genommen wurde.
Es wurde ihm warm ums Herz bei dieser Begrüßung.
»Du hast mir sicher viel zu erzählen«, sagte Mehmet. »Aber lass uns losfahren. Im Auto ist’s schön kühl, und bis Ayvalık haben wir viel Zeit zum Ratschen.«
Die Taschen verschwanden im Kofferraum, sie stiegen ein und Mehmet zündete sich eines seiner gefürchteten Zigarillos an, deren Rauch nach alter Matratzenfüllung roch. Fröhlich paffend legte er einen schwungvollen Start auf den heißen Asphalt.
Die Klimaanlage war eine Wohltat. Johannes lümmelte sich entspannt in den bequemen Sitz, streckte seine langen Beine aus und blickte aus der Seitenscheibe. Vorbei an den tristen Hochhaus-Neubauten, die im Süden der Millionenstadt in den letzten Jahren entstanden waren, ging es vom Adnan-Menderes-Flughafen zunächst auf dem Izmir Cevre Yolu nach Osten.
Wie oft war er diesen Weg wohl schon gefahren? Izmir war der ideale Zielflughafen fürs Segeln in der Ägäis. Die hoffnungslos überfüllten Häfen von Bodrum oder Marmaris im Süden, in denen man bis in den letzten Winkel nächtelang mit Lärm aus den Diskotheken beschallt wurde, hatte er immer gemieden.
Johannes segelte seit seiner Jugend. Ein Lehrer, selbst passionierter Segler, hatte das Kunststück vollbracht, seine Schüler davon zu überzeugen, auf der Klassenfahrt einen Segelkurs zu machen. Damals waren sie dreizehn Jahre alt und keineswegs alle von dieser Idee begeistert. Klang alles doch sehr nach Schule. Doch für immer würde er das Glücksgefühl in seinem Herzen haben, das ihn unvermittelt überfiel, als zum allerersten Mal auf der Flensburger Förde das Tuch am Mast der Jolle vom frischen Ostseewind gefüllt wurde und er, die Großschot in der Hand, die Ruderpinne so legte, dass das kleine Boot auf einen strammen Am-Wind-Kurs drehte und Fahrt aufnahm. Regelmäßig verbrachte er danach seine Sommerferien in Glücksburg an der Hanseatischen Yachtschule.
Süße Erinnerungen an abendliche Fahrten mit dem Folkeboot auf der Förde. Und an Angelika. So um die sechzehn Jahre alt waren sie da. Seine erste Liebe – die Erinnerung an sie war mit den Jahren verblasst. Bis heute aber hatte er ihren wunderbaren Geruch in der Nase.
Niemals wieder hatte jemand so gut gerochen wie Angelika.
Nach wenigen Kilometern erreichten sie die Abzweigung auf die E 87 Richtung Ayvalık. Die Görgüns besaßen in der Nähe der kleinen Stadt ein Ferien- und Wochenendhaus. Die Landstraße dorthin führte über weite Strecken direkt an der Küste entlang. Fasziniert sog Johannes das Bild in sich auf.
Dieses Panorama hatte er gesehen, wenn er im Dämmerlicht seines Krankenzimmers an die Decke starrte. Lange Monate dumpfer Verzweiflung – manchmal erträglich allein durch die Erinnerung an den atemberaubenden Ausblick auf das Meer, die Inseln, die Tupfer aus weißen Segeln dazwischen.
Kaum stand sein Entlassungstermin fest, hatte er sofort Mehmet angerufen und ihn gebeten, nach einem Boot zu suchen, das er kurzfristig chartern konnte. Der Rückruf erfolgte rasch und ließ ihn auch noch die letzten paar Tage in der Klinik überstehen. Heute Abend endlich konnte er im Yachthafen von Ayvalık an Bord gehen. Die Landleinen lösen. Ablegen.
War dieser Segeltörn die erhoffte Chance, doch noch zu seinen verschütteten Erinnerungen vorzudringen? Oder machte er sich etwas vor? Die Botschaft, die Karen ihm mitgegeben hatte, war unmissverständlich: »Du kannst es nicht erzwingen. Niemand weiß, ob diese Stunde jemals in dein Bewusstsein zurückkehren wird. Das hängt davon ab, welche Bilder auftauchen – und ob du diese Bilder ertragen kannst …«
Das vertraute Krampfgefühl im Magen war sofort wieder da. Wie immer, wenn seine Gedanken zu nahe an den kritischen Punkt kamen. Ihm fiel ein, dass er seit dem Abflug in Stuttgart noch keine seiner Tabletten genommen hatte. Wenn Karen das wüsste …
»Lass dir Zeit«, sagte Mehmet nach einem kurzen Seitenblick auf seinen Beifahrer. »Reden können wir auch später.« Dann schwieg er. Johannes nickte dankbar. Mehmet kannte ihn gut – kaum erstaunlich nach der langen Zeit.
Doktor Mehmet Görgün war Lehrbeauftragter für internationales Management an der Münchener Bundeswehr-Universität gewesen, als sie sich kennenlernten. Er betreute Johannes damals bei seiner Diplomarbeit – herrliche, verrückte Zeit. Der lebenslustige Deutschtürke, zu dieser Zeit noch Junggeselle, war kein Unbekannter in der Schwabinger Szene. Auf manchem nächtlichen Streifzug, in langen Gesprächen und vielen leidenschaftlichen politischen Diskussionen entwickelte sich die Freundschaft zwischen ihnen, der auch Mehmets Umzug in die Türkei nichts hatte anhaben können. Hier in Izmir hatte er ein Im- und Exportgeschäft gegründet, das vor allem mit Deutschland regen Handel trieb.
»Nur noch eine knappe Stunde, dann sind wir da«, verkündete er nun und forderte die Klimaanlage mit ein paar dichten Schwaden aus seinem Zigarillo. »Ayse freut sich schon auf dich!«
Es wurde eine schweigsame Fahrt. Mehmet, der von der Seefahrt nicht allzu viel verstand, erzählte nur noch kurz von dem Segelschiff, ›so ein französisches Boot, ungefähr zwölf Meter‹. Dann überließ er Johannes seinen Gedanken.
Endlich bogen sie wenige Kilometer vor Ayvalık von der Hauptstraße ab und fuhren in Serpentinen eine Schotterstraße bergauf. Kurz darauf kamen sie auf einen Seitenweg, und Johannes’ Blick fiel auf das Ferienhaus. Es erstrahlte, von der Nachmittagssonne beleuchtet, in fröhlichem Gelb.
Als hätte sie gemerkt, dass dies nicht ihre Farbe war, ebbte sofort auch seine dunkle Angst ab.
Ayse, Mehmets zierliche Ehefrau, stieg schon die Treppe von der Terrasse herunter und ging ihnen entgegen. Sie freute sich sichtlich über seinen Besuch und begrüßte ihn mit Wangenküssen, ein Ritual, zu dem Johannes ziemlich tief in die Knie gehen musste. Sofort war er wieder verzaubert von ihren feinen, klaren Gesichtszügen und den großen, tiefdunklen Augen.
»Ich freue mich, dass du wieder bei uns bist. Mehmet hat mir erzählt, was für eine schwere Zeit du hinter dir hast. Bist du denn nun wieder, äh … gesund?«, fragte sie in Englisch, bemerkte aber sofort das Zögern in Johannes´ Gesicht. Rasch legte sie ihm eine Hand auf den Arm und sagte: »Aber kommt erst mal herein, ihr müsst ja hungrig sein nach der Fahrt. Ich habe auf der Terrasse einen kleinen Imbiss vorbereitet.«
»Wunderbar«, erwiderte Johannes dankbar. »Im Flugzeug habe ich nämlich den Lunch verschlafen.«
Er langte kräftig zu, und alle genossen ausgiebig die köstlichen türkischen Spezialitäten, die Ayse auf den Tisch stellte. Dazu tranken sie roten Landwein von der Schwarzmeerküste. Die Spannung aber war mit Händen zu greifen. Je länger sie zusammen saßen, desto schweigsamer wurde Johannes. Das Ehepaar sprang ein und erzählte ein paar Neuigkeiten von den drei Kindern, die für ein paar Tage bei ihren Großeltern in Izmir geblieben waren.
»Und nun die übliche Geduldsprobe«, lachte Mehmet und wischte sich ein paar Krümel aus dem Bart. »Die neuesten Fotos der Kinder – wir erwarten begeisterte Kommentare!«
Johannes nahm Ayse den stattlichen Stapel ab, und sein Blick fiel auf das oberste Bild.
Wie vom Blitz getroffen, zuckte er zusammen. Der Anblick dieser türkischen Kinder mit ihren dunklen Augen versetzte ihm einen plötzlichen Schlag. Er wurde blass, kalter Schweiß trat auf seine Stirn und seine Hände begannen zu zittern. Die Fotos glitten ihm aus den Fingern und fielen auf den Tisch zwischen die Teller und Gläser. Ayse sah ihn erschrocken an, und Mehmet paffte wie wild an seinem Zigarillo.
Johannes starrte angestrengt auf das Meer hinaus und sagte leise: »Es tut mir leid. Ihr glaubt sicher, ich bin verrückt geworden. Es sind die Bilder. Die Kinder auf den Bildern. Ihre Augen …« Wie in Trance stand er auf und trat an die Terrassenmauer, den Blick noch immer starr auf den fernen Horizont gerichtet. Ayse streckte eine Hand nach ihrem Mann aus. Der griff behutsam zu und hielt ihre schmalen Finger mit seiner Pranke fest. Verzweifelt schaute Johannes über das weite Panorama, ohne irgendetwas wahrzunehmen. Seine Augen wurden feucht. ›Vielleicht findest du die Kraft, mit deinen Freunden darüber zu reden‹, hatte Karen zu ihm gesagt. ›Dann bist du auf dem richtigen Weg.‹
Es war so weit. Er drehte er sich um, sah die beiden an und sagte fast unhörbar: »Natürlich hat es nichts mit euren Kindern zu tun, wie sollte es auch. Aber ihre Gesichter, vor allem die Augen …« Er stockte, fuhr sich mit der Hand über die kalte, schweißnasse Stirn und fuhr fort: »Es war bei meinem letzten Einsatz dort unten …« Vage deutete er mit einem Kopfnicken in Richtung Südost. »Der, bei dem ich verwundet wurde. Ich habe …« Er stockte erneut.
»Du musst uns nichts sagen, Jo«, sagte Ayse schlicht. »Das weißt du doch, oder?«
Johannes lächelte matt. »Ich weiß, Ayse, aber ich will. Und ich muss auch!« Dann straffte er sich und sagte laut und klar: »Ich habe wahrscheinlich zwei Kinder getötet.«
Entsetzt riss Ayse ihre Hand los und schlug sie sich vor den Mund. Mehmet starrte Johannes entgeistert an. Aufgebracht fragte er: »Wahrscheinlich? Du sagst, du hast wahrscheinlich Kinder getötet. Was soll das denn heißen? So was weiß man doch!«
»Sollte man, ja. Aber genau das ist mein Problem: Ich kann mich nicht erinnern. An die entscheidenden Minuten dieser ganzen Aktion kann ich mich nicht erinnern.«
»Das war der Einsatz, nach dem du nach Deutschland ausgeflogen worden bist, richtig?«
»Ja, es war in einem Dorf am Hindukusch. Die Taliban …« Er brach ab. Waren das denn wirklich Taliban gewesen? Unwillig schüttelte er den Kopf. »Jedenfalls waren es Aufständische, und zwar ziemlich viele. Die hatten zwei von meinen Soldaten als Geiseln genommen und Lösegeld erpressen wollen.« Nochmals ein kurzes Stocken. »Ich darf über die Hintergründe dieser Aktion nicht sprechen. Strengste Geheimhaltung – hat man mir mehr als einmal eingebläut.«
»Also eine Sache, die nicht an die Öffentlichkeit dringen soll?«, fragte Ayse.
»So ungefähr. Es gibt Gründe, warum die … Befreiungsaktion geheim bleiben soll«, antwortete Johannes und setzte vielsagend hinzu: »Politische Gründe natürlich.«
»Politische Gründe, aha«, grunzte Mehmet vielsagend.
»Ja, und man hat sich sehr bemüht, alles unter der Decke zu halten.«
»Dann weißt du also doch, was geschehen ist? Du musst nur so tun, als könntest du dich nicht daran erinnern?«, kam es ungläubig von Ayse.
»Nein, so ist es natürlich nicht«, geriet Johannes in die Defensive. »Ich darf nichts über die Befreiungsaktion erzählen, über ihren Ablauf, über ihre … na, sagen wir mal über ihre besonderen Umstände. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich ab einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich keine Erinnerung an das habe, was dort geschehen ist. Ich war bewusstlos.«
»Ab einem bestimmten Zeitpunkt?«, fragte Mehmet nach. »Darfst du darüber sprechen, wann genau das war?«
»Vermutlich darf ich das nicht, aber das ist mir jetzt egal. Sie haben später herausgefunden, dass ein Schuss meinen Schutzhelm getroffen hat. Danach weiß ich nichts mehr. Ohne den Helm … na ja.« Er holte tief Luft. »Aufgewacht bin ich erst eine Woche später in Deutschland im Bundeswehrkrankenhaus. Und da habe ich gemerkt, dass ich mich an die ganze Aktion nicht mehr erinnern kann, dass alles fehlt. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich mit meinen Leuten aus dem Hubschrauber gesprungen und in die Höhle eingedrungen … ah, verdammt …« Er hatte schon viel zu viel gesagt. Langsam ging er wieder zu seinem Stuhl und setzte sich. Die Verzweiflung in seiner Stimme war unüberhörbar. »Alles, was ich von alldem heute weiß, habe ich nachträglich von meinem Freund Paule erfahren, der bei dem Einsatz dabei war. Und natürlich aus dem Untersuchungsbericht. Aber Paule war schon nicht mehr auf dem Schauplatz, als die Kinder erschossen wurden. Genau davon hat also auch er nichts gesehen. Und ich weiß nichts davon aus eigener Erinnerung. Die Untersuchungskommission stützt sich auf einige Indizien. Und die sprechen gegen mich. Trotzdem …«
Das Wort hing trostlos in der Luft.
»Ich will, ich kann einfach nicht glauben, dass ich das getan haben soll. Indizien hin oder her.«
Ayse fragte sanft: »Wie kann nur jemand – vor allem du selbst, Jo – auf die Idee kommen, dass du diese Kinder getötet hast?« Sie brach ab, Tränen standen in ihren Augen. Sie nahm seine Hand. Dann sagte sie leise: »Es tut mir so leid. Du tust mir so leid.«
Mehmet trat zu ihr, legte einen Arm um ihre Schultern und sah Johannes an. »Mich würde aber wirklich interessieren, was da passiert sein soll. Schließlich hat man dafür gesorgt, dass du dich wie ein …« Er stockte.
»Dass ich mich wie ein Mörder fühle«, stieß Johannes hervor und traf in diesem Moment eine Entscheidung: Er würde sich nicht länger vorschreiben lassen, mit wem er reden und was er sagen durfte! Entschlossen fuhr er fort: »Wenigstens ihr müsst erfahren, was ich getan haben soll. Karen … äh, die Ärzte haben mir sogar dringend empfohlen, darüber zu sprechen, sobald ich es mir zutraue. Ich weiß nicht, ob es schon geht. Aber ich bin euch dankbar, dass ihr mir zuhören wollt.« Er dachte einen Augenblick nach. »Also: Am besten fahren wir jetzt hinunter in den Hafen. Ich möchte mir das Schiff ansehen, bevor es dunkel wird. Danach setzen wir uns zusammen. Ist das okay für euch?«
Mehmet drückte sein Zigarillo aus und nickte.
Ayse sagte: »So machen wir’s. Wir packen rasch noch den Proviant in den Kofferraum und dann fahren wir!« Offensichtlich froh, etwas Praktisches vor sich zu haben, stand sie auf, sammelte die auf dem Tisch verstreuten Fotos ein und stapfte resolut ins Haus.
Es dämmerte bereits, als sie ankamen. Leuchtstoffröhren von vielen Laternen erhellten die Stege mit ihrem gelblichen Licht. Der Eigner hatte Mehmet alles genau beschrieben, als er ihm in Izmir die Schlüssel übergeben hatte, so dass sie die Yacht, die auf den Namen Akgül getauft war, sofort fanden.
Die ›Weiße Rose‹ hatte ihren Liegeplatz direkt am Kai, ganz in der Nähe des Hafenbüros, in dem bereits Licht brannte. Zwei große Kartons mit Konservendosen, Tüten und Päckchen, natürlich auch ein Karton mit Rotwein, verschwanden im Boot. Bemühte Geschäftigkeit in gedrückter Stimmung, aufgesetzte Heiterkeit. Unsicherheit hatte sich zwischen ihnen breitgemacht. Wo war auf einmal ihre jahrelange Vertrautheit?
Traurig arbeitete Johannes die Checkliste ab. Nach einer reichlich oberflächlichen Überprüfung stand aber fest: Alles war funktionstüchtig, wenn auch nicht mehr neu. Das Schiff war eine vielfach gebaute Serienyacht aus Frankreich, 36 Fuß lang, bereits über zwölf Jahre alt, aber gut in Schuss. Der Eigner pflegte es offenbar liebevoll, nutzte es jedoch selten.
»Bist du zufrieden?«, fragte Mehmet. Seine Verwirrung war ihm deutlich anzumerken.
»Sehr sogar, vielen Dank für alles!«
»Du kennst ja meine Kontonummer. Ich habe die Charter schon bezahlt. Hier sind die Kassenzettel für den Proviant und den Wein. Frisches Obst und Gemüse müsstest du aber noch selbst besorgen.«
»Hab ich mir für morgen früh vorgenommen«, erwiderte Johannes. Der Supermarkt lag direkt am Sportboothafen. Vorher würde er sich im Ort eine Rasur beim Friseur gönnen. Er blickte kurz auf die Quittung für die Charter. »Das ist ein fairer Preis, çok teşekkürler! Was ist mit der Kaution?«
»Wollte der Eigner nicht haben; er kennt mich ja.«
Ayse kam an Bord zurück, als es schon fast dunkel war. Sie hatte im Ort ofenfrisches Pide, ein paar aromatisch duftende Tomaten, Oliven, scharfe Paprika und eingelegten Schafskäse eingekauft. Alles richtete sie in der Kombüse auf einem Holzbrett an und stellte dies auf den ausgeklappten Tisch im Cockpit. Johannes bemerkte, dass auch sie außergewöhnlich still war. Mit zittrigen Händen entkorkte er eine Flasche Rotwein, schenkte ein, und sie setzten sich still zusammen um den Tisch.
Bleischwere Sprachlosigkeit. Jeder hing seinen Gedanken nach. Kaum ein Wort fiel, während sie eher lustlos ein paar Käsehappen aßen und ab und zu einen Schluck Wein tranken. Es war ruhig geworden im Hafen. Manchmal klangen von anderen Booten Stimmen herüber oder jemand ging den Kai entlang.
Johannes füllte die Gläser noch einmal auf.
2
Januar
Deutschland
Um vier Uhr morgens tönte aus dem Radiowecker die durchdringende Stimme einer Popkünstlerin, die mit Hingabe von ihrem Herzen sang, welches angeblich wie eine Buschtrommel schlug.
Johannes war blitzartig hellwach. Um Corinna nicht weiter mit den Urwaldklängen zu malträtieren, langte er schnell hinüber zum Nachttisch und stellte das Gerät ab. Sie hatte schließlich noch über zwei Stunden Schlaf vor sich, bevor sich der Wecker auf ihrer Seite des Bettes melden würde. Neidisch warf er einen Blick auf sie. Jeden Tag wollte er weiß Gott nicht um diese Zeit aufstehen müssen. Aber regelmäßige Dienstzeiten waren in seinem jetzigen Job nicht garantiert.
Leise schloss er die Schlafzimmertür hinter sich und schlurfte in die kleine Küche. Er schaltete die vorbereitete Kaffeemaschine an und warf einen kurzen Blick aus dem Fenster. Winter. Das neue Jahr war erst drei Wochen alt. Zu dieser Stunde herrschte noch vollständige Dunkelheit, nur von zwei Straßenlaternen müde mit fahlen Lichtkegeln durchbrochen.
In der Nacht war neuer Schnee gefallen – gute Voraussetzungen für die heutige Einsatzübung. Auf den Bergen des Hindukusch lag fast das ganze Jahr über Schnee. Im Winter gab es oft meterhohe Schneeverwehungen, die jeder Patrouille zum Verhängnis werden konnten. Damit war der Schwarzwald natürlich nicht vergleichbar. Aber das ›Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr‹, kurz KSK, konnte hier dennoch realistische Übungen durchführen. Man hatte sogar ein typisches afghanisches Dorf aufgebaut. Auch durchzogen tiefe Gräben das Gelände, vergleichbar den Wadis im Land am Hindukusch.
Heute würden sie wieder einmal Patrouillenfahrten üben, derzeit ihre wichtigste Aufgabe in Afghanistan. Gar nicht oft genug konnte man das durchspielen, immer wieder die Teams verändern und alle denkbaren Szenarien nachstellen.
Johannes wusste aus eigener Erfahrung, dass später im Einsatz alles ganz anders kommen konnte. Unter Zeitdruck galt es dann, eine Lage schnell zu überblicken und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Draufgängertypen waren da völlig fehl am Platze. Gebraucht wurden ausgeglichene Menschen, seelisch und körperlich hoch belastbar. Nur wenige Bewerber konnten diese Anforderungen erfüllen.
Während er mit Sorge daran dachte, wie viele Soldaten ihm auch in seiner Kommandokompanie fehlten, ließ Johannes sich vom heißen Wasserstrahl aus der Dusche den Körper massieren. Dabei summte er das Lied mit der Buschtrommel vor sich hin.
Im Wohnzimmer, wo er seine Bekleidung am Vorabend auf dem Sofa bereitgelegt hatte, um Corinna nicht im Schlaf zu stören, zog er sich an und ging dann in die Küche. Dort goss er sich den heißen schwarzen Kaffee in einen Becher und schaltete das Radio ein. Diese Musik gefiel ihm schon deutlich besser. Als er John Bon Jovi singen hörte: »We weren´t born to follow«, musste er grinsen. Hübscher Text für Soldaten …
Vorsichtig schlürfte er den heißen Kaffee. Hunger hatte er so früh am Morgen noch nicht. Er riss ein Blatt vom Notizblock, fischte einen Kugelschreiber aus der Brusttasche seines Feldanzuges und schrieb: »Lieber Schatz, ich wünsche dir einen schönen Tag. Komme heute erst später (Nachbesprechung usw.). ICH LIEBE DICH, Jo.«
Nachdenklich trank er die letzten Schlucke, schob den Zettel in die Mitte des Tisches und stellte den Becher darauf.
Auch eine Art, miteinander zu kommunizieren.
Bedrückend. Lange konnte das nicht mehr gut gehen. Über seinen Dienst, über seine Einsätze in Afghanistan, durfte er nicht viel erzählen. So wusste Corinna nicht mehr, als dass er dort mit seinen Leuten zur QRF, der Schnellen Eingreiftruppe gehörte, die im Feldlager Camp Marmal bei Mazar-i-Sharif stationiert war.
Afghanistan. Ihr beherrschendes Thema. Ihre Beziehung drohte an seinen Einsätzen zu zerbrechen. Corinna würde sich damit nie arrangieren können. Endlose, quälende Diskussionen. Beunruhigende Fragen. Corinna bohrte erbarmungslos bis zur Wurzel.
Doch er war Soldat. Er folgte seinen Befehlen, wenn er in den Einsatz ging. Darauf lief es hinaus. Was sonst sollte er tun – etwa kündigen? An diesem Punkt hatte er bisher immer gekniffen.
Über Weihnachten hatten sie endlich einmal ein paar Tage Zeit füreinander gehabt. Gefährliche Muße. Während eines Spaziergangs hatte Corinna ihm so offen wie noch nie von ihren Ängsten erzählt, von ihrer Einsamkeit und dem, was sie ausstand, wenn er im Einsatz war. Während Johannes hilflos neben ihr hergestapft war, hatte sie weinend ihre Albträume geschildert. Regelmäßig suchten die sie heim, nachdem im Fernsehen erneut der verwüstete Ort eines blutigen Selbstmordattentats gezeigt wurde.
Seit jenem Spaziergang war das Thema zwischen ihnen nicht mehr zur Sprache gekommen. Es schien, als hätten sie es stillschweigend zum Tabu erklärt.
Zu viel Schweigen, zu viele Zweifel, zu viele Ängste. Wie lang hielt ihre Liebe das noch aus? Schon vier Mal war er in Afghanistan gewesen, zwei Mal in der Zeit, seit sie sich kannten. In jedem der beiden Jahre ihres Zusammenlebens hatte er vier Monate dort im Einsatz verbracht. Und im April dieses Jahres stand der nächste Einsatz am Hindukusch für ihn und vierundzwanzig Männer aus seiner Kompanie bevor. Also, rechnete er, blieben Corinna und ihm noch zwei Monate, bevor er sie wieder allein lassen musste.
Gestern Abend hatten sie gemeinsam ein kleines historisches Gasthaus in der Stadt besucht und Rostbraten mit hausgemachten schwäbischen Spätzle genossen. Als die Teller abgetragen waren, sah Corinna ihn über ihr Weinglas hinweg an und fragte: »Merkst du das?«
Verwirrt fragte er: »Was soll ich merken?«
»Dass wir nur über Belanglosigkeiten sprechen. Wir reden nur noch belangloses Zeug.« Sie trank einen großen Schluck Wein, stellte das Glas ab und sah ihn ernst an. »Je näher der Termin rückt, desto mehr versuchen wir, so zu tun, als ob …«
»Na, sag schon!«
»Es ist wie die alte Geschichte von dem Kind im dunklen Wald, das Angst hat und laut singt, damit es die bedrohlichen Geräusche nicht hört.«
Er musste nicht lange überlegen, welchen Termin sie gemeint hatte. Leise sagte er: »Lass uns nachher darüber reden, bitte«, bestellte noch zwei Schoppen und versuchte, Corinnas Blick auszuweichen.
Zu Hause hatten sie halbherzig versucht, den Abend zu retten, ein bisschen Musik gehört, noch ein Glas getrunken, und waren schließlich in Sprachlosigkeit zu Bett gegangen. Wieder einmal.
Ach, Corinna. Mit einem resignierten Seufzer holte er seine Tasche aus dem Wohnzimmer, zog den gefütterten Feldparka an und überzeugte sich, dass die Handschuhe in den Taschen waren. Dann nahm er sein bordeauxrotes Barett von der Garderobe im Flur, löschte das Licht in der Wohnung und machte sich auf den Weg.
Als er nach dem langen Tag aus dem Gebäude der Kommandokompanie in die eiskalte Abendluft hinaustrat, war es schon fast zwanzig Uhr. Die Übung war seit achtzehn Uhr beendet, anschließend aber hatte er mit seinen Leuten noch eine Nachbesprechung abgehalten. Der Übungstag war ordentlich verlaufen, abgesehen von kleineren Pannen. Und die waren wichtig, da sie im Einsatz natürlich auch vorkamen.
Leider war ausgerechnet Hauptfeldwebel Paul Sahler, sein bester Zugführer, langjähriger Weggefährte und persönlicher Freund, bei dem Versuch, vom FUCHS, einem gepanzerten Radfahrzeug, herunter zu springen, auf der vereisten Schneespur ausgerutscht und unglücklich gegen einen Baumstumpf geprallt. Er hatte sich mit einer schmerzhaften Schulterverletzung im Sanitätszentrum beim Truppenarzt vorstellen müssen.
Hoffentlich ist es nichts Ernstes, dachte Johannes. Auf Paule wollte er auf keinen Fall verzichten, wenn es wieder nach Afghanistan ging. Er entschloss sich, dem Sanitätszentrum in der Kaserne einen Besuch abzustatten. Vielleicht hatte der Arzt Paule ja dabehalten müssen, oder, schlimmer noch, er war sogar ins Krankenhaus im Ort gebracht worden.
Nach wenigen hundert Metern, die er der Kälte wegen im Laufschritt zurücklegte, erreichte er das Gebäude mit dem großen Roten Kreuz neben dem Eingang.
»Den Hauptfeldwebel haben wir nach Hause geschickt, der fällt für ein paar Tage aus. Ich soll Ihnen vom Oberstabsarzt bestellen, dass er zum Abendessen im Offizierheim ist, Herr Hauptmann«, meldete ihm der Diensthabende auf der Krankenstation. »Er meinte, Sie würden nach der Übung auch dort hinkommen.«
Johannes dankte dem Unteroffizier und machte sich auf den Weg.
Hörte sich ja nicht ganz so dramatisch an. Nun lockte ihn die Aussicht auf ein warmes Abendessen nach dem langen Tag in der Kälte. Wenn er so spät Dienstschluss hatte, aß er meistens hier. Corinna nahm abends kaum je etwas Handfestes zu sich. Und er hatte keine Lust, sich etwas zu kochen, wenn er so spät nach Hause kam.
Wie immer nach einer Übung, an der mehrere Einheiten beteiligt waren, herrschte reger Betrieb im Offizierheim. In einer Ecke des Raumes stand der Kommandeur, der sich mit ein paar Offizieren seines Stabes unterhielt. Johannes ging hinüber und wartete, bis der Brigadegeneral ihn ansah. »Herr General, ich melde: Einsatzübung um achtzehn Uhr beendet, Waffen und Gerät vollzählig, ein besonderes Ereignis: Hauptfeldwebel Sahler leicht verletzt. Ich spreche gleich mit dem Truppenarzt, wie die Sache steht.«
Der Kommandeur nickte und antwortete: »Danke, Herr Hauptmann. Nun trinken Sie erst mal ein Bier. Da vorn an der Bar steht der Doc, den können Sie ja dabei gleich ausquetschen. Was hat Paule denn?«
Johannes musste lächeln. Der Alte kannte seine Leute. Er bewunderte den General immer wieder für dessen Fähigkeit, sich die Gesichter und Namen fast aller seiner Soldaten zu merken, obwohl er erst ein halbes Jahr auf diesem Dienstposten war. »Schulterverletzung, Herr General. Wie schlimm, weiß ich auch noch nicht. Ist vom FUCHS gesprungen und auf dem Eis ausgerutscht. Ich spreche jetzt mit dem Doc, dann wissen wir, wie´s weitergeht.«
»Wollen wir hoffen, dass es nichts Ernstes ist.« Damit drehte der Kommandeur sich wieder zu seiner Gruppe um, und Johannes ging zum Tresen. Auf dem Weg begrüßte er einige Kameraden, die in kleineren Gesprächsgruppen, meist mit einem Getränk in der Hand, im Raum herumstanden.
An der Bar angekommen, bemerkte er eine heftige Diskussion, die ein paar Meter weiter zwischen drei Kameraden geführt wurde. Das Wort ›Strategiewechsel‹ konnte er hören, auch ein ›Nicht so laut!‹, das wohl der Anwesenheit des Kommandeurs geschuldet war. Johannes grinste, als er Hauptmann Albers, Kompaniechef einer Kommandokompanie wie er, unter den Diskutanten entdeckte. Charly war bekannt für seine Vorliebe für politische Streitgespräche. Hoffentlich war noch nicht zu viel Bier im Spiel, sonst konnte das durchaus hitzig werden. »Ein Hefeweizen bitte!«, rief er dem Mann hinter der Theke zu und setzte sich auf den Barhocker neben Oberstabsarzt Dr. Fiedler, der seinen Chef, der derzeit in Afghanistan war, als Leiter des Sanitätszentrums vertrat.
»Fiete, du kannst mir sicher …«
»… etwas über Hauptfeldwebel Sahler sagen.«, ergänzte der Arzt. »Kann ich, Jo: Hat sich die Schulter ausgerenkt. Drei Tage zu Hause, dann eine Woche Schonung im Dienst. Dann ist er wieder wie neu!«
»Gut! Auf den hätte ich nicht gern verzichtet.«
»Ihr habt schon was zusammen erlebt, richtig?«
»Kann man so sagen.«
Mehr war nicht hinzuzufügen. Es gab keine Heldentaten, keine großartigen Geschichten von Todesmut, Entbehrungen und Siegen – von denen schon gar nicht. Was es gab, war eine Freundschaft, die gewachsen war in einigen gefährlichen Einsätzen, in jahrelangem gegenseitigem Vertrauen und aus der Gewissheit, sich aufeinander verlassen zu können. Alles eher unspektakulär.
Johannes trank einen tiefen Schluck von seinem Bier und zeigte mit dem Daumen auf die streitbare Gruppe ein paar Barhocker weiter. »Was haben die denn für ein Thema am Wickel?«
»Charly wütet gerade mal wieder gegen die Obrigkeit.«
»Bierpegel?«
»Noch ungefährlich, würde ich sagen.«
Johannes stand auf und schlenderte hinüber zu seinen Kameraden, die weiter heftig diskutierten. Als er sich mit seinem Bierglas in der Hand zu der Gruppe gesellte, sagte Charly gerade: »In zehn Jahren ISAF-Einsatz hat sich Afghanistan einmal um sich selbst gedreht, und wir haben nichts daran ändern können. Wir werden einen Scherbenhaufen hinterlassen. Und die Taliban werden wieder die Macht in den Händen haben – wie vor zehn Jahren. Und dafür die ganze Scheiße …« Sein Blick fiel auf Johannes. »Hallo Jo, gut, dass du da bist! Was sagst du denn dazu?«
»Wozu denn, Charly?«
»Mensch, du liest doch Zeitung! So lange haben wir da unten den Kopf hingehalten – wofür? Was zum Teufel soll denn aus dem Land werden, wenn wir demnächst einfach abhauen? Dann war doch alles umsonst!« Charly hatte sich in Rage geredet. Mit gerötetem Kopf bestellte er noch ein Bier und sah Johannes fordernd an: »Nun sag schon was dazu. Hab ich nicht recht?«
Und wie, dachte Johannes. Aber was nützt uns das? Noch sind wir da – und müssen das Beste daraus machen, zusehen, dass unsere Leute immer wieder heil dort herauskommen.
»Wir werden ein Chaos zurücklassen. Und in kürzester Zeit sind die alten Kräfte wieder an der Macht, die Glaubenskrieger und die Warlords«, stieß Charly hervor. »Dafür hätten wir da nicht reingehen müssen, oder?«
Schon wieder diese Frage. War es schon damals falsch gewesen, an den Hindukusch zu ziehen – falsche Solidarität mit den USA nach Nine-Eleven? ›Ein unkontrollierbares Abenteuer‹, nannte es Corinna oft. »Was die Warlords betrifft«, sagte Johannes nachdenklich, »so ist deren Macht ungebrochen. Daran haben wir überhaupt nichts geändert mit unserer Präsenz …«
»Unterstützt von korrupten Politikern, die der Westen auf ihre Stühle gehievt hat, und die mit den Mächtigen im Lande gemeinsame Sache machen«, ergänzte Charly.
Johannes stand auf. »Ich will noch einen Happen essen, entschuldigt mich.« Er trank den letzten Schluck aus seinem Glas, stellte es auf die Theke und ging in den Speisesaal.
Seit vielen Monaten lauerten Fragen in ihren Köpfen. Zweifel waren an der Tagesordnung. Gab es überhaupt die richtigen Antworten? Und selbst wenn: Die Zukunft Afghanistans entschied sich wahrhaftig nicht in diesem Offizierheim.
Oder überhaupt irgendwo in Deutschland.
3
April
Afghanistan
Abdul Kalakani saß im bequemen Ledersitz rechts im Fonds seines Luxus-Geländewagens. Er war auf dem Rückweg von einer Kontrollfahrt, hatte aber noch ein Objekt vor sich. Mit seinen schlanken Fingern schob er den Ärmel des Kaftans zurück. Ein Blick auf seine weißgoldene Rolex Oyster zeigte ihm, dass er nun schon seit sieben Stunden unterwegs war. Der breite Wagen war zwar gut gefedert, aber die lange Fahrt auf den kaum befestigten Schotterwegen hatte den alten Mann ermüdet.
Dennoch, er liebte er diese Touren über das Land. Sein Land. Herrliche Heimat, weite Ebene am Fuße des gewaltigen Gebirges. Hier, in den verstreut liegenden kleinen Dörfern, hatte er seine wichtigsten Einrichtungen. Unverzichtbar, immer wieder alles, was in seinem Einflussbereich geschah, persönlich zu kontrollieren. Zu nie vorhersehbaren Zeiten tauchte er in seiner Fabrik auf und vor den Lagerhäusern, die über das ganze Land verteilt lagen. Und besonders im Stützpunkt seiner Privatarmee.
Abdul Kalakani war das, was man einen Warlord nannte, ein nicht nur für afghanische Verhältnisse sehr reicher Provinzfürst und Kriegsherr. Er lebte strikt nach dem jahrhundertealten Ehrenkodex der Paschtunen: Glaube und Freiheit.
Zu beiden Seiten des Flusses Kunduz, der der ganzen Region und auch der Provinzhauptstadt seinen Namen gegeben hatte, besaß er große Ländereien. Bis hoch in den Norden an die Grenze zu Tadschikistan erstreckte sich sein Besitz. Damit war er der mächtigste Mann im Norden Afghanistans. Auch in den Nachbarprovinzen geschah in Politik und Wirtschaft wenig ohne seine Zustimmung.
Zu ihm kamen die Menschen aus dem ganzen weitläufigen Gebiet, wenn sie sich nicht mehr selbst zu helfen wussten. Er wies niemanden ab, der ihm Respekt zollte, und mehrte so stetig die Schar seiner Getreuen. Überall im Land am Fuße des Hindukusch wusste man, wie viel Gutes er für die Menschen tat. Er gab verzweifelten Familien Geld für Medizin und nahm Stammesbrüder unter seinen persönlichen Schutz, wenn sie von staatlicher Willkür bedroht wurden. Auch entschied er bei größeren Streitigkeiten und hielt dabei ein strenges Gericht.
Sein Urteil galt. Die verhängten Strafen wurden stets widerspruchslos angenommen. Er zahlte vielen Polizisten in der Provinz noch einmal das Doppelte des Lohns, den sie höchst unregelmäßig vom Staat erhielten. Und er hatte die getreuen Kämpfer seiner stattlichen Privatarmee mit Waffen und Gerät gut ausgerüstet. Sogar einige russische T 55-Panzer gehörten dazu, zwar alt, aber, wie das gesamte Waffenarsenal, in gutem Zustand.
Vor allem aber war er der Hauptabnehmer für die Ernten hunderter von kleinen Bauern, die mit ihren Frauen und Kindern die Äcker bearbeiteten. Getreide, Hülsenfrüchte und Gemüse ernteten die Familien für ihren Eigenbedarf und verkauften auch manches davon auf den dörflichen Märkten.
Diese Feldfrüchte spielten für Kalakani keine Rolle. Sein Reichtum gründete sich auf andere Pflanzen. Sein Reichtum hieß Mohn und Hanf.
In einer Staubwolke fuhr ein Toyota Landcruiser als Sicherungsfahrzeug vorweg, besetzt mit vier seiner besten Kämpfer. Auch in Kalakanis Wagen saßen außer dem Fahrer noch zwei von ihm selbst ausgesuchte, bestens bewaffnete Leibwächter.
Er beugte sich zu dem vor ihm sitzenden Führer seiner Bodyguards und sagte: »Hashmat, wir machen einen kleinen Umweg. Wenn wir auf diesem Weg weiter zum Lager fahren, sehen sie die Staubwolken schon eine Stunde, bevor wir ankommen. Wir fahren lieber von Norden ans Lager.«
Der Angesprochene nickte, hob sein Funkgerät vor den Mund und gab seine Befehle an das vorausfahrende Fahrzeug durch. Nie hatte er gesehen, dass sein Arbeitgeber eine Landkarte zur Hand genommen hätte. Kalakani hatte jeden Quadratmeter des weiten Landes in seinem Kopf gespeichert, kannte jedes Wadi, jeden Weg, jede Furt.
»Wir könnten die letzten Meilen durch den nördlichen Nebenfluss fahren, bevor wir in den Sichtschutz des Berges kommen. Ist nicht mehr viel Wasser drin. So sehen sie im Lager keine Staubwolken«, schlug Hashmat mit ruhiger Stimme vor, ohne sich dabei umzudrehen und den Blick vom Weg zu nehmen.
»Sehr gut!«, rief Kalakani befriedigt und lehnte sich in seinen Sitz zurück. Auf Hashmat konnte er sich verlassen. Er war einer seiner besten Soldaten, ihm nicht nur treu ergeben, sondern auch intelligent und einfallsreich. In diesen schwierigen Zeiten war es so wichtig, fähige Leute zu haben. Die Probleme, die die zunehmende Neugierde der fremden Besatzungssoldaten schuf, beunruhigten den Warlord mehr, als er zeigte.
Die größten Schlafmohnfelder lagen im Süden des Landes. Dennoch hatte er hier oben, fern vom Zentrum der afghanischen Opiumproduktion nahezu unbehelligt seinen guten Anteil an diesem Markt erwirtschaften können. Das Anbauverbot der Regierung in Kabul beeindruckte ihn nicht sonderlich. Aber die Besatzer. Die Ungläubigen drangen mit ihren Patrouillen immer weiter ins Land vor. Zwar hatten die Deutschen, die in seiner Provinz das Kommando führten, keinerlei Befugnisse, direkt gegen den Anbau von Mohn und Hanf vorzugehen. Dennoch waren sie zu einer echten Bedrohung geworden. Vor allem, seit sie mit den amerikanischen Anti-Terror-Kommandos zusammenwirkten. Sie waren schon auf zwei seiner geheimen Lagerstätten gestoßen, und die Amerikaner hatten die dort aufgefunden Zwischenprodukte einfach verbrannt.
Der Warlord schäumte, wenn er daran dachte, dass dabei mehr als zwei Millionen Dollar in Flammen aufgegangen waren. Seither ließ er die wichtigsten Orte rund um die Uhr von seinen Kämpfern bewachen. Breite Landstreifen wurden zwischen den Feldern und den Straßen und Wegen zur Tarnung mit anderen Feldfrüchten bepflanzt. Die Landarbeiter mussten lange Wege gehen, um ihre Arbeit an den Pflanzungen zu verrichten. Arbeits- und Transportfahrzeuge konnten kaum noch bis an die Felder heranfahren; alles musste über weite Strecken mit Kamelen transportiert werden.
Natürlich hatte Kalakani keine Angst vor irgendwelchen Gerichtsverfahren oder gar vor Strafen, falls man ihm doch einmal seine Rolle bei einem dieser Geschäfte würde nachweisen wollen. In seinem Herrschaftsbereich hielt er über die Provinzgrenzen hinweg alle Fäden in der Hand. Niemand würde es wagen, ihn in Schwierigkeiten zu bringen. Weder die Gouverneure noch der Polizeipräsident dachten auch nur daran, irgendeine Weisung aus Kabul zu vollstrecken, die zu Kalakanis Nachteil wäre. Dennoch blieb es für ihn unerträglich, dass er von den Truppen der Ungläubigen in seinem eigenen Land ausspioniert wurde. Sie zwangen ihn zu unglaublich aufwändigen Gegenmaßnahmen, um seine Existenz zu sichern.
Solange er sich erinnern konnte, hatte Abdul Kalakani erleben müssen, wie man sein geliebtes Land zerstörte. Als junger Mann hatte er jahrelang bei den Mudschaheddin gegen die sowjetischen Invasoren gekämpft. Ein blutiger Kampf, hart und voller Entbehrungen.
Ausgestattet mit Waffen, Gerät und Munition aus den USA – von Saudi-Arabien mit horrenden Summen mitfinanziert –, machten er und seine Mitbrüder den kommunistischen Eindringlingen das Leben zur Hölle. So vereitelten sie den Versuch, die im heiligen Islam gewachsenen Strukturen zu vernichten und ihr Land unter die Kontrolle Moskaus zu zwingen. Bis heute konnte man überall noch zerbombte Gebäude, rostende Panzerwracks und zerstörte Militärfahrzeuge finden.
Schaudernd dachte er an diese Jahre am Salang-Pass auf fast 4000 Meter Höhe. Immer wieder fügten sie dem Feind empfindliche Verluste zu, für den dieses Nadelöhr die Lebensader und Nachschublinie für seine Operationen zwischen dem Norden und der Hauptstadt Kabul war. In Nord-Süd-Richtung gab es keinen anderen Pfad über den Hindukusch als diesen. Der Pass war daher eine Schlüsselstelle im Guerillakampf.
Unzählige Male sprengten sie die Straße und legten Minen. Fast täglich wechselten sie ihre Stellungen im Gebirge, schleppten die schweren Maschinengewehre in der dünnen Luft von Ort zu Ort. Wurden sie von feindlichen Flugzeugen angegriffen, zogen sie sich in vorbereitete, mit Verpflegung, Feuerholz und Munition ausgestattete Höhlen tiefer im Gebirge zurück und kämpften weiter.
Auch unten in der erbarmungslosen Hitze der Tiefebene mit ihren Sandstürmen verfolgten die Mudschaheddin diese Taktik. Tausende von Hinterhalten, tausende Male schnelles Zuschlagen und Abtauchen in den Weiten der Stein- und Sandwüste, immer neue über Nacht ausgebrachte Minen.
Zehn lange Jahre, dann hatten sie den übermächtigen Feind zermürbt. Sein Vater, dessen Nachfolger als Stammes- und Provinzfürst er seit jener Zeit war, musste verbittert den Tod zweier seiner drei Söhne beklagen und hatte dennoch im Hintergrund weiter dafür gesorgt, dass die Waffentransporte aus dem Nachbarland niemals versiegten. Täglich schwor der alte Mann, bereits gezeichnet von Altersschwäche und Krankheit, Rache für den Tod seiner Söhne und betete für die Vernichtung der Invasoren.
Schließlich erhörte Allah seine Gebete: Geschlagen zog die Sowjetarmee aus seinem Land ab. Nicht geordnet allerdings. Es war eine regelrechte Flucht.
Der alte Mann schickte nach Abdul, seinem einzig verbliebenen Sohn, betete mit ihm und starb.
Inzwischen näherte sich die kleine Fahrzeugkolonne dem Stützpunkt, nachdem sie einige Zeit durch das knietiefe Wasser eines Flussbettes gefahren war.
»Nicht zum Haupttor, Hashmat«, befahl Kalakani. »Wir fahren hinten um das Lager herum an das östliche Nebentor!«
Einige Minuten später fuhren sie auf den hohen Drahtzaun zu, in den das abseits gelegene Nebentor eingelassen war. Kalakani erstarrte. Er traute seinen Augen nicht. Das Tor stand weit offen! »Da stimmt etwas nicht«, rief er und lehnte sich hastig nach vorn. »Kein Mann zu sehen – was ist da los?«
Hashmat konnte nicht antworten, denn er gab bereits mit schneidender Stimme über Funk seine Befehle an die Männer im Sicherungsfahrzeug durch. Der Warlord sah, dass innerhalb weniger Sekunden vier Männer mit Maschinenpistolen aus dem Wagen sprangen und links und rechts neben den Fahrspuren hinter dem Geröll und zwischen den niedrigen vertrockneten Dornensträuchern am Wegrand in Deckung gingen.
Hashmat rief dem Fahrer zu: »Du bleibst am Steuer sitzen! Wenn ich dir ein Zeichen gebe, fährst du sofort hundert Meter zurück. Masud bleibt auch im Wagen und sichert euch!«
Der Mann links neben dem Warlord bestätigte den Befehl mit einem kurzen Laut, dann sprang Hashmat auch schon aus dem Fahrzeug und verschwand ebenfalls zwischen den Steinen.
Angespannt, aber äußerlich gelassen, blieb Kalakani sitzen und beobachtete durch die Frontscheibe, was weiter geschah. Alles blieb ruhig. Nach wie vor war niemand am Tor zu sehen. Auch von seinen fünf Männern, die sich, immer auf Deckung bedacht, auf das Lager zubewegten, war nichts zu erkennen. Plötzlich entdeckte er eine Staubwolke innerhalb des Lagers, die sich schnell dem Tor näherte. Ein Geländewagen hielt kurz darauf auf der Innenseite am Tor an und einer der hier stationierten Kämpfer stieg aus. Erst jetzt erblickte der Mann die vor dem offenen Tor stehenden Fahrzeuge und riss vor Schreck seine umgehängte Maschinenpistole nach oben. Hektisch blickte er um sich. Ein lauter Wortschwall im Befehlston war auf einmal zu hören, ohne dass man sah, wer da rief. Sofort ließ der Mann verwirrt seine Waffe sinken. Im selben Augenblick standen, wie aus dem Nichts erschienen, zwei der Bodyguards aus dem Sicherungsfahrzeug neben dem Kämpfer und hielten ihm ihre Waffen vor das Gesicht. Nach einem kurzen Wortwechsel rief einer von ihnen in Richtung Tor: »Alles in Ordnung. Lage im Griff!« Die übrigen beiden Personenschützer und Hashmat selbst kamen daraufhin aus ihrer Deckung und gingen durch das offene Tor.
Der Warlord stieg aus und trat kurz darauf ebenfalls zu der Gruppe. Streng schaute er auf den jungen Soldaten in dem ölverschmierten Kaftan. Er sah sofort, dass die Pupillen der dunklen Augen, die ihm unter einem schmutzigen Turban angstvoll entgegenblickten, geweitet waren. In seiner zitternden Hand hielt der Mann ein massives Vorhängeschloss.
Hashmat wandte sich an Kalakani und sagte mit unbewegter Miene: »Du wirst es nicht glauben, ehrwürdiger Abdul, aber er wollte nur das Tor abschließen. Als die Streife vorhin nach ihrer Zaunkontrolle von außen wieder hier durchfuhr, haben die Männer festgestellt, dass das Schloss eingerostet war. Dieser hier hat aus dem Lager ein neues geholt und wollte das jetzt hier anbringen.«
Eine unangenehme Pause entstand, in der der junge Kämpfer weiter in sich zusammenzusacken schien. Schließlich wandte der Warlord sich an ihn und fragte in scharfem Ton: »Wieso hast du das Tor nicht wenigstens provisorisch geschlossen, als du losgefahren bist, um das Schloss zu holen? Wie lange standen denn die Torflügel ohne Bewachung offen?«
»Nur ein paar Minuten, ehrlich, verehrter Abdul, nur ganz kurz …«, stammelte der Mann verzweifelt.
Kalakani schüttelte den Kopf und wandte sich an Hashmat: »Fahr sofort zu Jamals Haus. Er wird vermutlich auf seiner schattigen Veranda sitzen und Tee trinken. Er soll sofort hierher kommen.« Dann drehte er sich auf dem Absatz um und begab sich wieder zu seinem Fahrzeug.
Hashmat rief seinen Männern ein paar kurze Befehle zu, stieg dann in den Geländewagen, mit dem der unglückliche Kämpfer hergekommen war, und verschwand mit einer gewaltigen Staubwolke im Lagerinneren.
Lange brauchte der Warlord nicht zu warten, nachdem er in seinem Ledersessel im Fonds Platz genommen hatte. Nach wenigen Minuten schon kam das Fahrzeug wieder aus dem Inneren des Lagers zurück. Die Beifahrertür wurde aufgestoßen und Oberst Jamal, Chef seiner Truppen und Kampfgefährte aus gemeinsamen Mudschaheddin–Tagen, eilte auf ihn zu. Er war von kleiner, drahtiger Figur und hatte einen gepflegten eisgrauen Bart, der sein scharf geschnittenes, tief zerfurchtes Gesicht gänzlich umrahmte. Seinen Kopf krönte ein dunkelbrauner Turban. In Hüfthöhe hatte er einen breiten ledernen Gürtel um seinen Kaftan geschnallt, an dem eine große Pistolentasche hing. Mit ein paar Schritten erreichte er den Wagen, blieb neben der Fondstür stehen und blickte durch die geschlossene Scheibe auf Kalakani.
Der aber stieg nicht aus, öffnete auch die Tür nicht, sondern drückte lediglich den Knopf für den elektrischen Fensterheber. Die Scheibe glitt nach unten. Jamal stand nun direkt davor.
Kalakani blickte starr nach vorn und würdigte ihn keines Blickes. »Du hast sicher von Hashmat schon erfahren, was hier passiert ist?«
Jamal wollte etwas antworten, doch der Warlord hob knapp seine Hand und fuhr mit eiskalter Stimme fort: »Ich dulde keine derartigen Fahrlässigkeiten, Jamal. Der Mann ist offensichtlich im Rausch. Ich will gar nicht wissen, wie er hier im Lager an das Zeug gekommen ist.«
Wieder versuchte der Oberst, das Wort zu ergreifen. Der Fürst aber fuhr fort, ohne seine Stimme zu erheben: »Wie kannst du es wagen, deine Pflichten so zu vernachlässigen? Deine Leute nehmen am helllichten Tag Drogen, während sie Dienst haben. Hast du dir den Mann einmal angesehen? Er sieht in seiner schmutzigen Kleidung aus wie ein Bettler. Außerdem stinkt er wie ein geiler Ziegenbock!« Seine gespielte Gelassenheit war jetzt verflogen. Er wandte Jamal das Gesicht zu und schrie ihn wütend an: »Meine Kämpfer verlottern vor deinen Augen! Und du sitzt in deinem Haus, trinkst Tee und lässt sie gewähren!« Schnell brachte er sich wieder unter Kontrolle und fuhr mit ruhiger Stimme fort: »Ich werde mir Gedanken über dich machen, während ich nach Hause fahre. Du solltest dies ebenfalls zu tun. Wir sehen uns ja morgen Abend.« Dann rief er durch das offene Fenster: »Hashmat, wir fahren!«, ließ die Fensterscheibe hoch gleiten und lehnte sich in seinen Sitz zurück.
Die Bodyguards stiegen in ihren Wagen, Hashmat setzte sich wieder auf den Beifahrerplatz, die Fahrzeuge wendeten und fuhren los. Kalakani drehte sich um und sah, dass Jamal immer noch regungslos an derselben Stelle stand.
Was war nur los mit ihm? Jamal war immer zuverlässig gewesen, voller Stolz darauf, Führer einer der gefährlichsten Privatarmeen Afghanistans zu sein. Viele Jahre lang hatten sie Seite an Seite gekämpft. Kalakani wusste genau, dass jeder Mensch hier im Norden seinen Namen kannte. Jeder fürchtete Oberst Jamal und seine bis an die Zähne bewaffnete Miliz. Jetzt stand dieser Mann da, ängstlich beobachtet von einem seiner Kämpfer, starrte vor sich hin und schluckte den Staub der davonfahrenden Wagenkolonne.
Ich würde jetzt gern seinen Gesichtsausdruck sehen, dachte der mächtige Mann versonnen. In seine Augen blicken.
Aber sie waren schon zu weit weg. Niemand konnte Jamal jetzt in die Augen sehen. Die Staubwolke hatte ihn vollständig eingehüllt.
Im Wagen herrschte tiefes Schweigen. Der Warlord fragte sich wieder einmal, ob er an alles gedacht und alles getan hatte, um seine Stellung abzusichern. Man musste auf der Hut sein, auch vor den eigenen Leuten. Auch die waren nicht gefeit gegen die allfällige Korruption im Land.
Der kleine Zwischenfall eben hatte ihn nicht wirklich aus der Ruhe gebracht. Dennoch fragte er sich, was wohl passiert wäre, wenn eine der deutschen Patrouillen gerade dann vor dem Lager aufgetaucht wäre, als das Tor offenstand. Sicherlich wären die Besatzungssoldaten, die alles ausspionierten, was sich in ihrem Einsatzgebiet befand, in das Lager hineingefahren. Nicht auszudenken, was sie dort alles hätten fotografieren und dokumentieren können! Und alle diese Aufklärungsergebnisse, das wusste er, landeten schließlich bei den eigentlichen Feinden Afghanistans, den Feinden aller Muslime, bei den verfluchten Amerikanern. Die waren auch die Hauptverantwortlichen für alle Schmach, die ihm und seinen Landsleuten jetzt zugefügt wurde. Sie hatten die Ungläubigen in aller Welt dazu angestachelt, seinem Land mit Waffengewalt ihre falschen Ideale, ihre so genannte Demokratie und ihre gottlose Lebensweise aufzuzwingen.
Er blickte noch einmal auf seine Uhr. Noch ungefähr eine Stunde, dann wäre er zu Hause. Sayed, sein erwachsener Sohn, würde schon ungeduldig darauf warten, dass sein Vater ihm von der heutigen Inspektionsfahrt erzählte. Es war Kalakanis größte Freude, dass Sayed bald so weit wäre, ihm einen Teil der Arbeit abzunehmen.
Ja, schwor sich der Warlord, gemeinsam mit seinem Sohn würde er schon dafür sorgen, dass die bewährten Herrschaftsstrukturen in Afghanistan immer noch existierten, wenn die fremden Länder ihre tausenden von Soldaten, entmutigt von der Aussichtslosigkeit ihrer Mission, wieder abziehen würden.
Und dieser Tag nahte! Es galt jetzt, so lange klug und entschlossen zu handeln, bis die lästigen Eindringlinge wieder fort waren aus seinem Land. Das musste ihm gelingen.
Allah war auf seiner Seite im Kampf für die gerechte Sache.
In der Abenddämmerung kamen sie zu Hause an. Das stattliche Anwesen lag ungefähr dreißig Kilometer nordwestlich von Kunduz in den Bergen auf einem Plateau mit ausgezeichneter Sicht über das gesamte weite Flusstal. Eine Feldsteinmauer umschloss das große Haupthaus mit Flachdach und einige Nebengebäude, die in größerem Abstand davon errichtet waren. Nur ein einziger schmaler Schotterweg, stets gut unterhalten, führte von dem kleinen Dorf am Fuße des Plateaus bis hinauf zum Tor. Ein Postenhäuschen, das ständig mit zwei bewaffneten Wachen besetzt war, stand unten am Anfang des Zufahrtsweges. Weitere Wachen waren im Torhaus und auf drei Plattformen verteilt, die auf die Mauerecken aufgesetzt waren.
Der Geländewagen, inzwischen über und über mit gelbbraunem Staub bedeckt, hielt ein paar Meter hinter dem vorausfahrenden Toyota vor dem Tor in der hohen Mauer aus Feldsteinen. Kalakani war müde geworden. Ein anstrengender Tag. Doch diese Anstrengungen waren notwendig, das hatte er heute wieder feststellen müssen.
Die Wachen öffneten die beiden Flügel des massiven Holztores und traten respektvoll zur Seite. Die Fahrzeuge fuhren in den Innenhof, wo der Toyota stehen blieb, um den Wagen des Fürsten vorbei zu lassen. Der hielt direkt vor dem Eingang zum Haupthaus. Mit einem Sprung war Hashmat aus dem Wagen und öffnete die rechte Fondstür.
Wortlos, aber mit einem leichten Lächeln im Gesicht, nickte der Hausherr seinem Bodyguard kurz zu. Dann verschwand er mit raschen Schritten im Gebäude.
Sayed wartete sicher schon auf ihn.
4
September
Türkei
Johannes erzählte.
Er saß, das Glas Rotwein in der Hand, im Cockpit der Yacht neben dem großen Ruderrad. Während sich die warme spätsommerliche Nacht über den Hafen von Ayvalık legte, redete er über das, was sich angeblich an jenem Tag vor sechs Monaten zugetragen hatte. Langsam sprach er und konzentriert, immer wieder kurz stockend. Ein verstörter Ausdruck wie von Ungläubigkeit über seine eigenen Worte stand ihm dabei im Gesicht.
Er scherte er sich nicht mehr um die militärische Geheimhaltung, sondern berichtete Ayse und Mehmet alles, was er von Paule und von Jim Woods, dem Chef der US-Marines in Camp Marmal, über den verhängnisvollen Tag erfahren hatte. Und natürlich das, was in dem elenden Untersuchungsbericht stand. Auf einmal gab es für ihn nichts Wichtigeres, als dass diese beiden Menschen verstanden, was ihn umtrieb.
Aber konnte das überhaupt gelingen? Wie sollten sie etwas verstehen, was er selbst nicht fassen konnte? Endlich darüber zu sprechen, war ihm zunächst wie ein Schritt zur inneren Befreiung vorgekommen. Doch jetzt wurde ihm schmerzlich klar, dass er so viel reden konnte, wie er wollte – dem Kern seiner Qualen kam er damit kaum näher. Hörensagen. Mehr nicht. Nichts, was er von jenen verlorenen Stunden erzählte, wusste er tatsächlich. Alle Anstrengungen der Ärzte hatten daran nichts ändern können. Auch Karens monatelange Arbeit mit ihm nicht. Als hätte er in diesen Stunden gar nicht existiert, als läse er seinen Freunden eine Horrorgeschichte vor. Er selbst war darin die Hauptperson und musste staunend zur Kenntnis nehmen, dass sie angeblich von seinen Taten handelte.
»Übrigens nennt man das ›Kongrade Amnesie‹, was ich habe. Das ist so, als hätte ich es gar nicht erlebt. Ich kann es nicht fühlen, mein inneres Auge kann es nicht reflektieren. Ich kann mich nur mit dem auseinandersetzen, was die Zeugen berichten, was die Untersuchung ergeben hat.«
»Das muss furchtbar sein, Jo«, sagte Ayse leise. »Aber der Bericht kommt doch, wenn ich es richtig verstanden habe, zu dem Schluss, dass dich keine Schuld trifft. Es war also ein … eine Art Unfall, den du gar nicht verhindern konntest, oder?«
Johannes schwieg einen Augenblick. Der englische Begriff, den Ayse gewählt hatte, klang ihm in den Ohren: ›Sort of an accident‹, hatte sie gesagt. Er ließ diesen Ausdruck in sich nachklingen.
Hörte sich gar nicht so schlecht an. Könnte er damit leben?
»Das sehe ich ähnlich«, warf Mehmet ein, der sich während Johannes’ vorangegangenen Berichts hinter dichten Rauchschwaden versteckt hatte. »Warum akzeptierst du nicht, dass die Untersuchung deine Unschuld ergeben hat? Wenn diese Fanatiker ihre Kinder in die Schusslinie stellen, sobald das Feuer eröffnet wird, dann darfst du dir doch nicht für den Rest deines Lebens die Schuld dafür geben, wenn so etwas Schreckliches dabei passiert!«