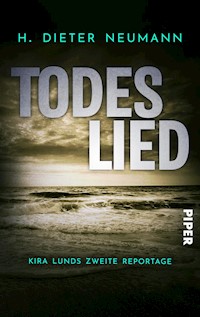
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Spannungsvoll
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Mörderische Konzerttournee – Zweiter Band der Küstenkrimis mit der jungen TV-Journalistin Kira Lund
Bei der Generalprobe für den Auftritt eines bekannten norddeutschen Kammerchors in Dänemark wird die Solosopranistin vermisst und bleibt verschwunden. Zwei Wochen später entdecken Urlauber ihre Leiche.
Die gemeinsamen Ermittlungen von deutscher und dänischer Kripo ergeben, dass mehrere Personen ein Mordmotiv gehabt haben, nicht zuletzt auch der Ehemann des Opfers. Kira Lund bricht einen Urlaubs-Segeltörn ab, um für ihren Sender über den Fall zu berichten. Wenig später begeht ein Sänger des Kammerchors Suizid, und es wird klar, dass die tote Sopranistin ein dunkles Geheimnis gehütet hat. Als Kira schließlich kurz davor steht, es zu lüften, gerät sie jedoch selbst in höchste Gefahr.
Hochspannung aus dem deutsch-dänischen Grenzland zwischen den Meeren!
H. Dieter Neumann hat mit einer früheren Geschichte (»Dunkles Wasser«) beim »NordMord Award 2018« den ersten Platz (Jurypreis) gewonnen. Der »NordMord Award« ist der traditionsreichste Krimipreis in Norddeutschland.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Todeslied« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literaturagentur Drews.
Redaktion: Christiane Geldmacher
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Emily Bähr, www.emilybaehr.de
Covermotiv: Ricardo Reitmeyer/Shutterstock; lifeforstock/Freepik
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Epilog
Randnotizen
Dank
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für denNordland Kammerchor
Prolog
November 2000
Die Scheibenwischer rasen wie zwei entfesselte Derwische hin und her, schaffen aber immer nur für Sekundenbruchteile klare Sicht. Sturzflutartig donnert der Regen auf das Dach des Jaguars. Nichts anderes ist in der edlen Leder- und Wurzelholzwelt des Innenraums zu hören als unaufhörliches dumpfes Dröhnen – vielfach lauter noch als beim Durchfahren einer Waschanlage.
Der etwa sechzigjährige Mann am Steuer ist immer noch von Kopf bis Fuß durchnässt. Sein volles eisgraues Haar hängt ihm in Strähnen in die Stirn. Die Heizungsdüsen des Luxuswagens blasen warme Luft in sein Gesicht und auf die klamme Kleidung, während ihm ein Schauer nach dem anderen heftig durch den Leib fährt.
Der dumpfe Druck in seiner Brust irritiert ihn. Eben, als er auf der Lichtung im Wald wieder in den Wagen gestiegen ist, hat er ihn plötzlich gespürt.
Unwillig stößt er ein Zischen aus, löst seine linke Hand vom Lenkrad, schüttelt sie und lässt die Schulter kreisen. Das taube Gefühl im Oberarm will nicht weichen. Ganz leicht, wie von vielen winzigen Nadeln gestochen, prickelt die Haut unter seinem Hemd. Verkrampft hockt er auf dem cremefarbenen Ledersitz, rutscht ein Stück näher nach vorn, als könnte er mehr von der Straße erkennen, wenn er ein paar Zentimeter dichter an der Scheibe säße. Immer langsamer wird er, kann dennoch im Scheinwerferlicht durch die Wasserfluten kaum noch den Straßenrand erkennen.
Vor einer halben Stunde, gerade als er aus dem Waldweg heraus auf die Landstraße fuhr, ist der merkwürdige Druck unvermittelt stärker geworden. Nicht schmerzhaft, aber spürbar.
Mehr verwundert als verängstigt hat der Grauhaarige in sich hineingelauscht. Schwäche ist ihm zuwider, körperliche ebenso wie charakterliche. Dennoch hat ihn eine unbekannte Beklommenheit überfallen, eine diffuse Angst sogar.
Genau in diesem Moment haben sich die Schleusen geöffnet. Schon zuvor hat es geregnet – den ganzen Tag ohne Pause. Sonst wäre er dort im Wald nicht so nass geworden. Aber was mittlerweile aus dem Himmel stürzt, lässt ihn an das biblische Märchen von der Sintflut denken.
Ihm ist das schlechte Wetter gar nicht so unrecht gewesen, als er – die Tragetasche auf dem Rücksitz festgeschnallt und unter einer leichten Decke verborgen – zu seinem Ziel fuhr. Was er zu tun hatte, duldete keine Zeugen. Daher auch die sorgfältige Wahl des abgelegenen Treffpunkts. Und der Dauerregen hatte das Seine dazu getan, dass kein Jäger oder irgendwelche abenteuerlustigen Nachtwanderer sich dorthin verirrten. Was angesichts der späten Stunde sowieso kaum denkbar gewesen wäre.
Er ist zufrieden. Niemand hat das beobachtet, was an jener Weggabelung passierte. Außer ihm selbst weiß nur die Frau von diesem Handel, die sich in den letzten zwei Monaten um die Schwangere gekümmert und ihr gestern bei der Geburt beigestanden hat. Und die für ihr Schweigen fürstlich entlohnt worden war – wie auch der schweigsame Mann mit dem rötlichen Vollbart, der vor ein paar Minuten eine Menge Geld in einer Plastiktüte und die Tragetasche mit dem ruhiggestellten Kind an sich genommen hat. Beides fest in seinen Händen, ist der Bärtige dann ohne ein weiteres Wort zwischen den nassen Baumstämmen im Dunkel verschwunden.
Tief atmet der Grauhaarige jetzt durch, blickt konzentriert durch die Windschutzscheibe. Der Druck in seiner Brust ist schwächer geworden, kaum noch zu spüren.
Na also. Wahrscheinlich nichts als die Anspannung.
Und auch der Regen scheint ein wenig nachzulassen. Ein rascher Blick auf den Tacho: siebzig Stundenkilometer. Niemand ist zu dieser Stunde auf der Landstraße unterwegs. Ein wenig schneller könnte er also schon fahren, denkt er, und beschleunigt. Nicht allzu stark, denn auf der nassen, kurvigen Straße könnte er immer noch die Kontrolle über den neuen Wagen verlieren. Undenkbar.
Erst letzten Monat hat er den weinroten XJ 4.0 Sovereign bekommen, und das herrliche Auto ist sein ganzer Stolz.
Natürlich hat er immer schon feine Wagen gefahren. Aber dieser ist die Krönung. Zumindest, wenn man aus Gründen der Contenance darauf verzichtet, sich in einem Rolls Royce fortzubewegen. Das könnte er sich problemlos leisten – finanziell. Aber nicht gesellschaftlich. Da ist ein Hauch Understatement sehr viel angemessener.
Langsam wird sein Haar trocken, spürt er, als er sich eine Strähne aus der Stirn wischt. Er schaut auf den Tageskilometerzähler: Die ersten vierzig der immerhin über dreihundert Kilometer seines Rückwegs hat er schon geschafft. Etwa gegen fünf Uhr morgens wird er zu Hause ankommen, schätzt er. Noch viereinhalb Stunden Fahrt also.
Eine lange, einsame Reise durch die Nacht, aber was macht das schon? Danach wird die leidige Angelegenheit endgültig erledigt und vergessen sein.
Die Lösung dieses Problems hat präzise Planung und einige Diskretion gefordert. Und viel Geld. Nicht eine Minute lang jedoch hat der Grauhaarige in all den Monaten Gefühle für das Kind empfunden – familiäre gar.
Absurder Gedanke! Es war nichts weiter als eine Bedrohung für die Familie. Und die musste beseitigt werden, bevor größeres Unheil entstand.
Seine Aufgabe. Wer sonst hätte sie übernehmen können?
Seine Tochter wird bald darüber hinwegkommen. Noch leistet sie sich hysterische Anfälle – zu jung, um die großen Zusammenhänge zu erkennen. Und die ehernen Verpflichtungen zu akzeptieren, die Menschen wie sie haben.
Jetzt eine Zigarette!
Er tastet mit der rechten Hand auf dem Beifahrersitz herum. Dort liegt irgendwo das goldene Zigarettenetui. Ein Erbstück seines Großvaters.
Plötzlich fährt ein stechender Schmerz in seine Brust, als würde ein scharfes Messer mit wütender Kraft hineingestoßen, und der Mund des Grauhaarigen formt sich zum Schrei.
Doch kein Laut kommt ihm mehr über die Lippen.
Alles um ihn herum scheint für Sekundenbruchteile in gleißendem Licht zu erstrahlen, und direkt danach umfängt ihn nachtschwarze Dunkelheit.
Der Wagen kommt von der Straße ab und gerät mit dem rechten Vorderrad auf das weiche Bankett. Das Heck schleudert herum, und das tonnenschwere Fahrzeug fliegt sekundenlang durch die Luft, bevor es jenseits der Böschung auf einem Acker aufprallt und sich überschlägt.
1
»Eine Katastrophe! Wenn Susanna nicht sofort hier erscheint, müssen wir die Generalprobe absagen! Wo steckt sie bloß?«
Wie oft Siegfried Sagebiehl, Chorleiter des Kammerchors canticum novum, diese Frage seinen Sängerinnen und Sängern schon gestellt hatte, hätte niemand von ihnen sagen können.
Ziemlich oft jedenfalls – und mit stetig wachsender Erregung. Mittlerweile hatte seine Stimme einen panischen Unterton angenommen, und dicke Schweißperlen glänzten auf seiner hohen Stirn.
Bereits vor einer halben Stunde hatten sie das Einsingen beendet. Sagebiehl war nichts anderes übrig geblieben, als ohne seine Solistin damit zu beginnen – »wir fangen schon mal an, sie muss ja jeden Augenblick kommen« –, denn nebenan im Saal sammelte sich bereits die kleine Besetzung des Südjütland Symphonieorchesters.
»Jana, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie mit ihr verabredet waren, nicht wahr?«
»Das stimmt«, gab die Sopranistin zurück, schnäuzte sich und krächzte: »Wir wollten uns um dreizehn Uhr im Bistro Grand Mère in der Sønder Havnegade treffen, um eine Kleinigkeit zu essen.«
Sagebiehl sah auf seine Uhr. »Das war ja schon vor vier Stunden! Mein Gott, da müsste sie inzwischen längst aufgetaucht sein, wenn sie sich bloß verspätet hätte.«
Jana Hellmann hob ratlos die Hände. »Ist sie aber nicht.«
»Du wolltest mit Susanna essen gehen?«, kam es mit einem spöttischen Unterton von dem jungen Rolf Schüssler aus dem Tenor. »Dann habt ihr euch also wieder vertragen?«
»Was soll das denn heißen?«, fuhr Jana auf.
»Na, ihr beide seid ja nicht gerade die besten Freundinnen. Ich wundere mich eben.«
Aus dem Bass ertönte Jochen Kramers sonore Falstaff-Stimme: »Hör auf zu stänkern, Rolf! Wir haben im Augenblick andere Sorgen.«
»Genau!«, rief Jana. »Was geht es dich eigentlich an, was ich mache?«
»Beruhige dich, war nicht böse gemeint.«
»Das Treffen war Susannas Idee«, erwiderte die Sopranistin aufgebracht. »Sie sagte, wir sollten mal miteinander reden. Keine Ahnung, was sie wirklich wollte. Jedenfalls ist sie nicht erschienen. Fast eine Stunde habe ich auf die gnädige Frau gewartet und immer wieder versucht, sie auf ihrem Handy zu erreichen. Erst bin ich nur auf ihrer Mailbox gelandet, und später hat sie das Gerät anscheinend ausgeschaltet.« Sie zuckte mit den Schultern und murmelte. »Eine Frechheit ist das.«
Sagebiehl rang die Hände und blickte in die Runde. »Kann sich das irgendjemand erklären? Warum wollte sie überhaupt allein nach Sonderburg fahren? Es war doch geplant, dass Fahrgemeinschaften gebildet werden.«
»Das hat ja auch prima geklappt«, sagte eine Frau aus dem Alt. »Wir sind mit wenigen Autos hergekommen. Nur lebt Susanna eben nicht in Flensburg und Umgebung. Fahrgemeinschaften sind schwierig, wenn man so weit weg wohnt. Sie fährt eigentlich immer allein, soviel ich weiß.«
»Was sollen wir denn jetzt …« Mit einer hilflosen Geste brach der Chorleiter ab. »Geht sie denn immer noch nicht ans Telefon?«
»Wir versuchen es fortwährend«, sagte Lena Haber, die erste Vorsitzende des Chors. »Aber ihr Handy ist ausgeschaltet. Auch die WhatsApp-Nachrichten gehen nicht durch.«
»Hat denn schon jemand bei ihr zu Hause angerufen?«, fragte Sagebiehl.
»Natürlich«, meldete sich Jana Hellmann wieder und schniefte ausgiebig. »Als sie nicht ins Bistro kam und ich sie auf dem Handy nicht erreichen konnte, habe ich auf dem Gut angerufen. Die Haushälterin ging ans Telefon und sagte, Susanna habe ihr am Morgen gesagt, sie müsse zu einer Chorprobe nach Dänemark und sei dann etwa um elf Uhr weggefahren.«
Lena Haber wandte sich an den Chorleiter: »Wir verstehen ja deine Besorgnis, Siegfried. Wir alle sind besorgt, aber ich fürchte, wir können im Moment nicht mehr tun.«
Resigniert senkte Sagebiehl den Kopf. »Eine Schande ist das«, sagte er leise. »Wir stehen vor der wichtigsten Generalprobe, die der Chor jemals hatte, und die Solistin fehlt. Ich fasse es einfach nicht!«
Vier Jahre hatte es ihn, der im Hauptberuf Professor für Musik an der Europa-Universität in Flensburg war, gekostet, das weltweit auftretende Sønderjyllands Symfoniorkester, das hier im Alsion seit dessen Einweihung im Jahr 2007 seine Heimat hatte, für ein Projekt zu gewinnen. Erst mithilfe des dänischen Konsuls in Flensburg war es ihm schließlich gelungen, den ebenso vielbeschäftigten wie anspruchsvollen Orchesterchef für canticum novum zu interessieren. Und zwar so erfolgreich, dass bald darauf der Zweite Konzertmeister der bekannten Musiker ein Weihnachtskonzert des Kammerchors im Dom zu Meldorf besucht hatte. Gleich nach der Aufführung zeigte sich der Mann sehr beeindruckt und sprach Sagebiehl noch in der Kirche seine Anerkennung aus.
Schon eine Woche später bekam der Chorleiter eine Mail aus Dänemark. Er möge gern einmal einen Programmvorschlag für ein geistliches Konzert mit dem kleinen Ensemble seines Orchesters im Alsion in Sonderburg machen, schrieb der Chef der berühmten Symphoniker höchstpersönlich.
Sagebiehl platzte fast vor Stolz über die Wertschätzung. Dennoch war ihm bewusst, dass dieses Projekt für canticum novum, einem Chor, der aus – wenngleich gesanglich ausgebildeten – Laien bestand, eine Herausforderung werden würde. Zumal der Konzertsaal des Alsion einer der akustisch besten in ganz Nordeuropa war.
Der Chor war bekannt für sein breites Repertoire, das von Klassik bis Pop reichte, und längst nicht alle waren von dem Gedanken begeistert, nun monatelang nur geistliche Chorsätze einzuüben. Aber die Chance, an einer solchen Stätte zusammen mit einem Weltklasseorchester aufzutreten, wollte sich natürlich niemand entgehen lassen. Nach intensiven Diskussionen einigte man sich schließlich auf ein Programm, das aus zwei Teilen bestand, dem Requiem in C von Charles Gounod und dem von Felix Mendelssohn Bartholdy vertonten 42. Psalm. Dass dieser Psalm ausgerechnet Wie der Hirsch schreit hieß, löste nicht nur deshalb unter den Chormitgliedern anhaltende Heiterkeit aus, weil einer der Tenöre Hansjörg Hirsch hieß, sondern auch, weil kaum jemand den gestelzten Bibeltexten aus längst vergangener Zeit etwas abgewinnen konnte. Für die Ohren moderner Menschen war dies eine allzu exaltierte Sprache. Das gelegentliche Feixen über den »schreienden Hirschen«, das »Wallen mit dem Haufen« und andere befremdliche Textstellen fand jedoch ein schnelles Ende unter den intensiven Proben und den hohen Anforderungen, die der Chorleiter dabei stellte. Beide Werke waren anspruchsvoll, und Sagebiehl machte allen unermüdlich bewusst, dass der Chor vor seiner bisher wichtigsten Aufgabe stehe.
Und jetzt das!
Ein Desaster: Die wichtigste Sopranistin fehlte bei der Generalprobe, und niemand wusste, wo sie war. Nicht nur dem Chorleiter stand inzwischen die blanke Panik ins Gesicht geschrieben. Alle waren unruhig geworden, warfen immer wieder verzweifelte Blicke zur Tür des Probenraumes.
Sie hatten bewusst zwei Stücke mit Solopartien für das Konzert gewählt, denn bei canticum novum gab es in jeder Stimme ein bis zwei Sängerinnen und Sänger, die diese Aufgabe meistern konnten. Der strahlende Stern des Chores aber war die Sopranistin Susanna von Hohenmarschen-Klamroth, eine Siebenunddreißigjährige mit langjähriger klassischer Gesangsausbildung.
»Wir müssen sofort eine Entscheidung treffen. Ich habe das Orchester vorhin um eine halbe Stunde Zeitaufschub gebeten, aber noch länger dürfen wir die Musiker auf keinen Fall warten lassen«, sagte Sagebiehl. Er sah Jana Hellmann in ihre geröteten Augen. »Jana, bitte! Wir brauchen Sie jetzt. Meinen Sie, Sie können Susannas Part übernehmen – selbstverständlich nur für diese Probe? Sie haben das doch drauf!«
»Unmöglich!«, protestierte die Angesprochene. »Ich kriege ja kaum einen Ton heraus. Bin sowieso nur hergekommen, weil ich mit Susanna den Termin ausgemacht hatte. Und selbstverständlich wollte ich bei der Probe mit Orchester anwesend sein, um zu wissen, worauf wir bei der Aufführung zu achten haben. Eigentlich gehöre ich ins Bett.«
»Ja, Sie haben natürlich recht«, erwiderte Sagebiehl verzweifelt und knetete wieder seine Hände. Tief sog er die aufgeheizte Luft in seine Lungen und wischte sich fahrig über die Stirn. »Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mit dem Orchester zu sprechen. Die Aufschubfrist ist eh schon abgelaufen. Mal sehen, ob ich den Probenbeginn noch einmal verschieben kann, so peinlich das für uns ist. Vielleicht kommt sie ja doch noch, obwohl …« Er ließ den Satz unvollendet, atmete tief durch, straffte sich und ging mit schweren Schritten zur Tür.
Susanna von Hohenmarschen-Klamroth kam auch später nicht, und die Generalprobe musste abgesagt werden.
Bis zum Konzertabend waren es nur noch drei Tage. Für das freundliche Angebot der Dänen, bis dahin einen Ersatz für die Solosopranistin aufzutreiben, bedankte sich Sagebiehl höflich, doch musste zunächst geklärt werden, was mit Susanna geschehen war. Man konnte ja nicht einfach so tun, als bliebe sie dauerhaft verschwunden.
Was mochte da geschehen sein? Wieder und wieder erörterten die Chormitglieder diese Frage und fanden keine plausible Erklärung. Susanna war immer die Zuverlässigkeit in Person gewesen. Niemand konnte sich vorstellen, dass sie leichtfertig die Probe verpasst hätte.
Doch wer oder was hatte sie aufgehalten? War ihr gar etwas zugestoßen?
Lange noch saßen sie im Alsion zusammen, versuchten wiederholt, die Vermisste auf ihrem Handy zu erreichen und riefen bei ihr zu Hause an – vergeblich. Allmählich dämmerte ihnen, dass etwas Schlimmes passiert sein musste.
Was konnte man tun? Schon nach so kurzer Zeit eine Vermisstenmeldung abgeben? Würde die Polizei die überhaupt aufnehmen?
Schließlich beschloss man, zwei Sänger, die fließend Dänisch sprachen, zur Polizei zu schicken, um den Vorfall wenigstens zu melden. Bedrückt machte sich der Rest des Chores auf den Weg nach Hause.
Auch Siegfried Sagebiehl fuhr grübelnd zurück nach Flensburg. So sehr er sich auch mühte, er fand keine harmlose Erklärung für Susannas rätselhaftes Verschwinden. Von dunklen Ahnungen getrieben, rief auch er bei Familie von Hohenmarschen-Klamroth an, doch die Haushälterin sagte stets dasselbe: Susanna sei um etwa zehn Uhr weggefahren und bisher nicht wieder aufgetaucht. Und als er Susannas Ehemann sprechen wollte, erfuhr er, dass der vermutlich erst spät am Abend aus seinem Büro in Hamburg zurückkehren werde.
Sagebiehl ließ sich die Hamburger Telefonnummer geben. Eine Mitarbeiterin sagte ihm, Jens Klamroth, ein international bekannter Architekt, sei geschäftlich unterwegs, und schlug ihm vor, es auf dessen Handy zu versuchen. Aber auch unter seiner Mobilfunknummer war Klamroth nicht erreichbar.
Sagebiehl hinterließ eine Rückrufbitte auf der Mailbox und verbrachte dann einen unruhigen Abend in seinem Fernsehsessel, fiel immer wieder kurz in Schlaf, aus dem er ständig hochschreckte.
Als die Zeiger seiner Wohnzimmeruhr auf Mitternacht zugingen, klingelte doch noch das Telefon, und Susannas Ehemann meldete sich.
Seine Frau sei immer noch nicht zu Hause, sagte Klamroth, und hörte sich bestürzt an, was der Chorleiter ihm zu sagen hatte.
»Ich bin erst vor einer halben Stunde nach Hause gekommen und habe mich gewundert, dass meine Frau noch nicht da ist«, sagte er. »Aber Sorgen habe ich mir keine gemacht, denn ihr sitzt ja oft noch länger zusammen nach den Chorproben. Erst als Line, unsere Haushälterin, mir von den vielen Anrufen erzählt hat, und dass Susanna angeblich vermisst wird, bin ich unruhig geworden. Bitte sagen Sie mir, was Sie wissen.«
»Nichts weiß ich, leider«, erwiderte Sagebiehl niedergeschlagen. »Ihre Haushälterin hat Susanna angeblich um zehn Uhr zu Hause wegfahren sehen, und seither scheint sie wie vom Erdboden verschluckt.« Sie sei vor der Probe mit einer anderen Sängerin in einem Sonderburger Bistro verabredet gewesen, fuhr er fort, aber dort nicht aufgetaucht. »Und auch später nicht. Deshalb haben wir die Chorprobe abgesagt, dann die örtliche Polizei in Kenntnis gesetzt und eine Beschreibung Ihrer Frau hinterlassen. Mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen.«
»Um Himmels willen, wie ist so etwas denn möglich?« Klamroths Stimme hatte einen schrillen Klang angenommen. »Das ist einfach irre! Haben Sie eine Erklärung dafür?«
Die hatte Sagebiehl natürlich nicht. »Tut mir leid, Herr Klamroth, ich habe keine Ahnung, was man im Moment in dieser Sache noch unternehmen könnte.«
»Die Polizei müsste eigentlich ihr Handy orten können, oder?«
»Davon verstehe ich nichts«, sagte Sagebiehl bedauernd. »Soviel ich weiß, war Susannas Mobiltelefon die ganze Zeit über ausgeschaltet. Jedenfalls haben das die Chormitglieder gesagt, die versucht haben, sie zu erreichen. Aber vielleicht hat die Polizei ja trotzdem Möglichkeiten …«
»Ich rufe die sofort an. Die deutsche Polizei muss sowieso erfahren, dass Susanna vermisst wird«, erwiderte Klamroth, verabschiedete sich knapp und legte auf.
Minutenlang noch saß Sagebiehl still in seinem Sessel. Dann raffte er sich auf und ging, von verstörenden Gedanken verfolgt, zu Bett.
Aus dem Traum vom größten Auftritt des Kammerchors canticumnovum war ein Albtraum geworden.
2
Am Anleger standen ein paar Einheimische, aber vor allem sommerlich bunt gekleidete Urlauber, und warteten darauf, dass der Kutter anlegte. Dreimal in der Woche wurde hier, direkt vor der eindrucksvollen Kulisse des Sonderburger Schlosses, fangfrischer Fisch direkt vom Schiff verkauft. Einer der letzten Berufsfischer der Stadt, der rund um die Insel Alsen seine Fanggründe hatte, machte hier vor allem in der Ferienzeit hervorragende Geschäfte.
Auch Familie Gabbert – Mutter, Vater und zwei Jungen – aus Freiberg in Sachsen stand erwartungsvoll am Steg und schaute über das in der spätsommerlichen Nachmittagssonne funkelnde Wasser des Alsensunds, auf dem das hellblaue dänische Fischerboot gerade herannahte.
Die Eltern freuten sich, hatten schon den ganzen Tag davon geschwärmt, hier meeresfrische Schollen kaufen zu können, um sie danach in der kleinen Campingküche im Vorzelt vor ihrem Wohnwagen zu filetieren und, mit Kräuterbutter und einer Scheibe Zitrone in Alufolie gewickelt, auf den Grill zu legen. Dazu sollte es Mutter Mandys kulinarische Spezialität geben, ihren sächsischen Kartoffelsalat mit Zwiebeln, Dill und natürlich fein gehackten sauren Spreewaldgurken. Sie hatte eine große Schüssel davon bereits gestern zubereitet und in die Kühlung gestellt.
Seit fast zehn Tagen schon genossen sie ihre Ferien auf dem Campingplatz in Sønderby am Strand von Kegnæs, nur ein paar Kilometer von Sonderburg entfernt. Heute hatte ein Ausflug auf dem Programm gestanden – Kultur inklusive. Eben war die Führung durch das Museum des Schlosses, dem Stammsitz des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg, zu Ende gegangen, an der die beiden Jungen allerdings nicht viel Gutes hatten finden können. Während des für sie quälend langen Rundgangs durch das uralte Gemäuer war ihr Quengeln immer lauter geworden.
Wie befreit waren sie nach zwei Stunden endlich aus dem Portal heraus und den Weg zum Wasser hinunter gerannt und stellten gerade aufgeregte Mutmaßungen darüber an, ob sich wohl unter dem Fang auch ein weißer Hai befände.
»Nu her doch mol zu, wennsch da was sog: Haie gibt’s ni in da Ostsee«, sächselte Leon, der ältere der beiden, zum wiederholten Mal mit großer Überzeugung, konnte aber seinen Bruder nicht umstimmen.
»Du host doch geene Ahnung«, erklärte Justin ernsthaft. »S’ Wosser uff da Weld is iberall verbunden, des sogsch da! Un däswägn genn de Fische hinschwimm, wo se wolln!«
Der Ältere jedoch hatte unvermittelt das Interesse an diesem tief schürfenden Diskurs verloren. Ihm fiel auf, dass der Fischkutter etwa zwanzig Meter entfernt vom Steg aufgestoppt hatte. Nun dümpelte er im Wasser, nur leicht bewegt von den kleinen Wellen rundum, und laute Rufe erschollen an Deck. Zwei Männer in orangefarbenen Arbeitsanzügen traten an die Reling und schauten hinunter.
Leon kniff die Augen zusammen, konnte aber zunächst nicht genau erkennen, was die Aufmerksamkeit der Fischer erregt hatte. Ein großer, länglicher Gegenstand, grün in der Mitte und mit einem hellen Büschel am einen Ende. Mehr war nicht auszumachen.
Schließlich holte einer der Männer eine lange Stange mit einem Haken und stocherte damit nach dem seltsamen Objekt an der Bordwand, konnte aber offenbar nichts finden, woran er die Stange festhaken konnte.
»Eine Frau!«, rief plötzlich jemand aus der Menge der Wartenden. »Da schwimmt eine Frau, ich seh’s ganz deutlich.« Wie auf Kommando drehten sich alle zu dem rotgesichtigen Mann um, der ein Fernglas vor den Augen hatte. Eine junge Frau zog ihr Smartphone hervor und begann, die Szene draußen auf dem Wasser zu filmen. Hektisch taten es ihr andere Umstehende gleich.
»Was sagen Sie da?«, rief Mandy Gabbert fassungslos.
»Der spinnt doch«, murmelte ihr Mann. »Der hat se ni alle.«
»Eine Leiche, ganz klar. Die haben eine Wasserleiche gefunden!«, rief der Mann und setzte sein Glas ab. »Und da kommt auch schon die Polizei!« Er wies in Richtung des Stadthafens. Von dort näherte sich in rasender Fahrt und mit hoher Bugwelle ein graues Boot mit Blaulicht.
Zum Ärger der Gaffer legte sich das Polizeiboot, kaum dass es herangekommen war, zwischen sie und das Fischerboot. Was dann geschah, war von Land aus nicht mehr zu erkennen, dauerte aber nur wenige Minuten. Schließlich jagte das schnittige kleine Schiff wieder davon, der Fischkutter stieß eine ölige Qualmwolke aus seinem Auspuff aus, fuhr einen großen Bogen und legte am Steg an.
Während einer der beiden Fischer die Kisten mit dem Fang zum Verkauf bereitstellte, wechselte sein Kollege ein paar Worte mit Landsleuten, die vorn standen. Im Nu sprach sich unter den Wartenden herum, dass die Polizei die Leiche einer blonden Frau in grünem Kleid an Bord genommen hatte und nun an Land brachte.
»Dassse blond is uff’n Gopp, habsch glei gesähn, wo se noch im Wossr log!«
»Und isch, dasse ä grienes Gleid anhodde!«
Die beiden Jungen aus Sachsen bebten vor wohligem Schaudern. Eine Wasserleiche und ein Polizeieinsatz mit Blaulicht – direkt vor ihren Augen!
Nie hätten sie für möglich gehalten, dass dieser Tag, der so langweilig begonnen hatte, ihnen noch eine derartige Sensation bescheren würde.
»Habt ihr einen Ausweis bei ihr gefunden?«, fragte Politikommissær Jacobsen von der Kripo in Sonderburg die beiden Kollegen, die die Leiche hergebracht hatten.
»Nein, Arne, gar nichts, was uns weiterhelfen könnte. Ihr Sommerkleid hat keine Taschen. Aber immerhin trägt sie einen Ehering. Vielleicht ist eine Gravur drin, und wir kommen damit an ihre Identität. Wird bestimmt nicht ganz einfach werden.«
Jacobsen nickte und sah auf die Leiche der schlanken, etwa eins siebzig großen Frau, die jetzt vor ihm auf einem Metalltisch im Untergeschoss des Krankenhauses in der Innenstadt von Sonderburg unweit des Hafens lag.
Ein unerfreulicher Anblick.
Er hatte in seiner Zeit als Polizist erst zwei oder drei Tote gesehen, die aus dem Wasser gezogen worden waren, erkannte jedoch sofort die typische Waschhaut und das Fettwachs, das den Körper aufgedunsen aussehen ließ. Soweit sich Jacobsen erinnerte, kamen Wasserleichen frühestens nach etwa einer Woche wieder an die Oberfläche – je nach Wassertemperatur. So lange brauchte der Verwesungsprozess mindestens, um ein allmähliches Aufschwimmen auszulösen. Die Frau war vermutlich also bereits seit über einer Woche tot.
Er biss sich auf die Lippe. Für solch eine Festlegung wusste er eigentlich viel zu wenig. Sie könnte ja auch schon längere Zeit tot gewesen sein und die Verwesung bereits eingesetzt haben, bevor sie in Wasser geworfen wurde.
Keine Spekulationen, warte erst einmal ab, was die Obduktion ergeben wird, mahnte er sich. Dass der Frau die Kehle durchgeschnitten worden war, konnte allerdings jeder erkennen, auch wenn er kein forensischer Pathologe war.
Er trat einen Schritt näher an die Leiche heran.
Ihr Alter ließ sich nur schwer schätzen, dafür war der Verwesungsprozess zu weit fortgeschritten. Das volle blonde Haar und die sportliche Figur ließen aber vermuten, dass es sich hier um eine relativ junge Frau handelte. So zwischen dreißig und vierzig, mutmaßte der Polizeikommissar.
Das flaschengrüne, dezent geblümte Sommerkleid war zwar durchnässt, teilweise von Algen bedeckt und mit allerlei Schlamm- und Schmutzresten besudelt, ansonsten jedoch unversehrt.
Die Beine waren nackt; Schuhe oder Strümpfe gab es nicht. An den Hacken der Füße entdeckte Jacobsen Abschürfungen, die aussahen, als wäre der Körper über rauen Untergrund geschleift worden.
Widerwillig warf er noch einen Blick auf den Kopf. Schon zuvor hatte er gesehen, dass die Augenhöhlen leer waren. Während die tote Frau im Meer getrieben war, hatten sich wohl die Fische über ihre Augen hergemacht. Oder später, als sie an die Oberfläche gekommen war, die Möwen.
Am Hals gab es einen tiefen Schnitt, der fast von einem Ohr bis zum anderen reichte. Alles Blut war längst ausgewaschen, sodass sich keine Verkrustungen zeigten. Die Wunde klaffte weit auf und schien von einem scharfen Messer zu stammen, denn ihre Ränder waren glatt. Hinten in der breiten Öffnung waren Gewebeteile von bleicher Färbung zu erkennen.
Angewidert wandte Jacobsen sich ab.
»Also«, seufzte er und drehte sich zu seinen Kollegen um. »Was habt ihr veranlasst?«
»Sie wird jetzt in die Pathologie gebracht. Dann sehen wir weiter.«
Jacobsen nickte. Sein Handy meldete sich. Er zog das Gerät aus der Brusttasche seines Diensthemds und blickte auf das Display.
Jesper Bohn stand da. Der Revierleiter.
»Du bist im Krankenhaus, höre ich?«
»Ja, wollte schon mal einen ersten Blick auf die Leiche werfen«, antwortete Jacobsen.
»Komm bitte gleich zurück zur Dienststelle, Arne. Wir glauben zu wissen, wer die Tote ist.«
»Tatsächlich? Wie das?«
»Die Kollegen haben sie beschrieben, nachdem sie sie geborgen hatten. Und Größe, Figur, Haarfarbe, aber auch das grüne Kleid – alles passt zu einer Vermisstenmeldung, die hier vor etwa vierzehn Tagen von zwei Deutschen aufgegeben wurde.«
3
Kein Land in Sicht. Kein Laut zu hören außer dem stetigen Zischen des Wassers am Rumpf und dem Gurgeln der Hecksee.
Es rauscht wie Freiheit,
Es riecht wie Welt.
Natur gewordene Planken
Sind Segelschiffe.
Ihr Anblick erhellt
Und weitet unsre Gedanken.
Kira lächelte. Wieder so ein Augenblick, in dem ihr spontan diese Zeilen von Joachim Ringelnatz in den Sinn kamen.
Sie blickte sich um. Auch hinter dem Boot sah sie nur blaugrünes Wasser, gesprenkelt mit einigen weißen Segeln. Ærø war hinter dem Horizont verschwunden. Dort schwebten jetzt ein paar zarte Federwolken am hellblauen Himmel über der See.
Heute Morgen hatten sie im Hafen von Marstal am südöstlichen Ende der dänischen Insel Ærø abgelegt und nun etwa die halbe Strecke bis zur Einfahrt in die Flensburger Förde hinter sich. Bald würde steuerbord voraus die Südspitze von Alsen auftauchen, das ebenfalls zu Dänemark gehörte.
Ihr letzter Urlaubstag.
Am späten Abend würden sie in Flensburg festmachen und noch einmal an Bord übernachten. Morgen nach dem Frühstück dann aufräumen, alles, was sie an Kleidung und persönlicher Habe an Bord gebracht hatten, wieder im Auto verstauen und gegen Mittag das Schiff an den Vercharterer zurückgeben.
Fast vierzehn Segeltage lagen hinter ihnen. Ihr Törn hatte sie mit einigen Zwischenstationen in kleinen Häfen oder auf lauschigen Ankerplätzen durch die dänische Südsee nach Svendborg geführt. Danach waren sie nordwärts durch den Großen Belt nach Samsø gelaufen, hatten zwei Tage auf diesem zauberhaften Eiland im Kattegat verbracht und waren schließlich durch den Kleinen Belt zwischen Fünen und dem Festland wieder nach Süden gesegelt. Die letzten beiden Tage hatten sie auf Ærø verbracht, von wo aus es nur noch ein Tagestörn bis in die Flensburger Innenförde war.
»Magst du etwas essen?«, rief Lukas vom Niedergang hoch. »Zwei Brötchen sind noch übrig vom Frühstück. Schinken, Mettwurst oder Käse drauf?«
Kira grinste. »Iss du sie«, rief sie hinunter. »Hab noch keinen Hunger.«
Lukas’ Kopf erschien an der Treppe. »Echt nicht?«, fragte er hoffnungsvoll.
»Kannst dir ruhig beide einverleiben«, bestätigte Kira. »Ich habe in diesem Urlaub schon viel zu viel gegessen.«
»Aber kein Gramm zugenommen, das garantiere ich dir«, behauptete Lukas und grinste. »Segeln macht schlank!«
Da mochte er sogar recht haben, dachte Kira. Bei der ständigen Bewegung auf dem Boot verbrannte sie anscheinend eine Menge Kalorien. Zu ihrem Erstaunen nämlich zwickten die Jeans selbst nach zwei Segelwochen noch nicht am Bund. Jedenfalls nicht mehr als sonst auch. Und das, obwohl sie den Eindruck hatte, ständig irgendetwas gegessen oder getrunken zu haben.
»Schade, dass wir schon nach Hause müssen«, sagte sie, ließ ihren Blick über das in der Mittagssonne glitzernde Wasser gehen und seufzte. »Mit dieser Art Diät könnte ich noch eine Weile weitermachen.«
»Ich auch, Schatz, das kannst du mir glauben«, gab Lukas zurück, stieg auf der Niedergangstreppe noch eine Stufe höher und schaute hoch in den Mast. »Wie viel laufen wir denn?«
Kira sah auf die Logge auf der Rudersäule. »Sechs Knoten. Knapp.«
»Hm.« Lukas nahm nun auch noch die letzten beiden Stufen, trat ins Cockpit und warf einen Blick auf die Segel.
»Was zu meckern?«, fragte Kira.
»Nö, überhaupt nichts. Wieso fragst du?«
»Weil ich dich kenne. Dich drängt es doch, an den Schoten zu zupfen, um noch einen halben Knoten mehr herauszukitzeln, stimmts? Tu dir keinen Zwang an.«
Lukas lachte. »Würde nichts bringen. Für unseren Kurs stehen die Segel bei diesem Wind ganz ordentlich. Hast alles gut getrimmt. Mehr ist aus diesem Wohnwagen kaum herauszuholen.«
»Dann bin ich ja zufrieden.«
»Kannst du auch sein. Du machst das fantastisch.« Er drückte ihr einen schmatzenden Kuss auf die Wange. »Weiter so, wackere Steuerfrau! Ich schmiere rasch die Brötchen, dann komme ich wieder hoch und setze mich zu dir.«
»Bring mir bitte eine kalte Cola light mit hoch!«, rief Kira ihm hinterher.
Lukas war ein begeisterter Regattasegler gewesen, hatte schon in seiner Jugend auf der Kieler Förde im Laser gute Plätze bei den Wettfahrten belegt. Inzwischen ließen ihm jedoch sein Job als Meteorologe – und nun auch noch die Dissertation, an der er seit seiner Rückkehr von einem Forschungsauftrag in der Antarktis vor einem halben Jahr arbeitete – nicht mehr genug Freizeit, um diesen Sport intensiv zu betreiben. So hatte er sich aufs gelegentliche Hochseesegeln verlegt. Wegen seiner Fachkenntnisse war er heute auch ein gefragter Berater bei den Profis in dieser Szene. Dass ein eher gemütliches Charterschiff für ihn ein »Wohnwagen« war, konnte da nicht überraschen.
Kira allerdings fand an der 38-Fuß-Serienyacht, die sie gechartert hatten, nichts auszusetzen. Sie hatte sich schnell mit der einfachen Bedienbarkeit und den gutmütigen Segeleigenschaften des Bootes angefreundet. Natürlich war dies kein Rennboot, aber auf denen suchte man auch vergeblich nach bequemen Kojen, einem komfortablen Salon oder einem Kühlschrank mit Eisfach – vom kleinen, aber feinen Duschbad ganz zu schweigen. Für Kiras Geschmack gab es hier an Bord alles, was das Seglerleben im Urlaub angenehm machte.
Außer zwei, drei Wochenendtörns mit Bekannten auf deren Fahrtenyachten hatte sie überhaupt keine Segelerfahrung gehabt, als sie Lukas vor vier Jahren kennenlernte. Doch seine Leidenschaft für alles, was mit Segelbooten, der See und dem Wind zu tun hatte, war schnell auf sie übergesprungen. Ein eigenes Boot konnten sie sich zwar nicht leisten, aber Lukas war in der Seglerszene bestens vernetzt, hatte in der Saison zahlreiche Gelegenheiten zum Mitsegeln, und bald war auch Kira immer öfter mit an Bord. Als leidenschaftliche Journalistin, die es gewohnt war, allem auf den Grund zu gehen, ärgerte sie sich allerdings schon nach kurzer Zeit darüber, viel zu wenig von dem zu verstehen, was die Leute um sie herum ständig redeten, wenn sie auf dem Wasser waren. Ebenso wie Juristen, Bergleute oder Jäger hatten Segler nämlich ihre ganz eigene Sprache, benutzten Fachausdrücke, die keine Landratte je gehört hatte. Luv und Lee, aber auch Schoten und Fallen voneinander zu unterscheiden, war für sie kein Problem, aber wenn Begriffe wie »halber Wind«, »Schothorn« oder »Hahnepot« fielen, war das für sie reinstes Seglerlatein. Und auch die Grundlagen von Seemannschaft und Navigation fehlten ihr.
Inakzeptabel für sie.
Als Lukas dann zum ersten Mal die Idee aufbrachte, sie beide sollten eine Yacht chartern und zusammen auf einen Urlaubstörn gehen, stand für Kira fest, dass sie den Sportbootführerschein erwerben und ein Skippertraining absolvieren wollte. Im Frühling hatte sie beides an der Hanseatischen Yachtschule in Glücksburg erfolgreich hinter sich gebracht und ihre Prüfung bestanden.
Lukas hatte sich auf diesem spätsommerlichen Urlaubstörn stark zurückgenommen, was die Führung des Bootes betraf. Er überließ ihr viele Aufgaben, vor allem die Navigation, gab ihr nur hin und wieder Ratschläge. Selten musste er korrigierend eingreifen, und Kira konnte vieles von dem, was sie gelernt hatte, in der Praxis ausprobieren. Ein rundum befriedigendes Erlebnis – ganz abgesehen von dem herrlichen Wetter, das sie die vollen zwei Wochen begleitet hatte. Von Tag zu Tag stieg ihre Begeisterung für das Segeln. Kurzum: Lukas hatte genau das Richtige getan, damit seiner Partnerin die sprichwörtlichen »Seebeine« wachsen konnten.
»Dein Handy hat gebrummt!«, sagte Lukas, setzte sich, den Teller mit den Brötchen in einer Hand, auf die Cockpitbank und reichte Kira mit der anderen das Gerät.
Sie warf einen Blick auf das Display. »Signal-Nachricht von Michael.«
»Michael de Jong, dein Chef?«
»Yep«, erwiderte Kira, tippte auf das Smartphone und las. »Na, der hat Nerven!«
»Was will er denn?«
»Er fragt, ob ich vielleicht schon wieder zu Hause sei, und ob ich nach Sonderburg fahren könne. Für eine Reportage. Es sei dringend.«
»Erstens bist du noch nicht zu Hause, und zweitens hast du noch bis Sonntag Urlaub.« Lukas schüttelte missbilligend den Kopf.
»Er muss ein ernstes Problem haben, sonst würde er mir nicht so eine Frage stellen.«
»Soll er sein Problem allein lösen«, knurrte Lukas, biss in ein Mettwurstbrötchen und kaute mit finsterem Blick.
Kira sagte nichts, sondern schaute nach vorn zum Bug, ohne eine Miene zu verziehen.
Schweigen.
Nachdem er auch dem zweiten Brötchen – belegt mit reifem dänischem Esrom-Käse, den man aus olfaktorischen Gründen tatsächlich am besten unter freiem Himmel verzehrte –, den Garaus gemacht hatte, sagte Lukas: »Du willst doch wohl nicht wirklich …«
Kira sah ihn an, und er verstummte.
»Ja, ja, ich weiß«, kam es resigniert von ihm. »Du hast keine ruhige Minute mehr, bevor du weißt, was da los ist, richtig?« Er stand auf. »Na gut, dann lass mich ans Ruder und ruf ihn halt an, du … Sensationsreporterin.«
»Wie nennst du mich, du … Wetterfrosch?« Lachend gab Kira ihm einen Knuff auf die Brust, trat zur Seite, setzte sich auf die Bank und tippte auf dem Display des Smartphones herum. Sie hielt es sich ans Ohr, während sie zu Lukas sagte: »Hast ja recht, ich muss wissen, was ihn umtreibt. Er hat es sich bestimmt nicht leicht gemacht, mich …« Sie hob die Hand, als de Jong sich meldete. »Hallo, Michael, ich bin’s. Was gibt es denn so Wichtiges in Sonderburg, dass du mich dafür im Urlaub … Aha. Und wieso ist das … Ja, ja, schon gut, ich höre dir zu.«
Das Gespräch dauerte nur drei, vier Minuten, änderte die Planung der letzten beiden Urlaubstage jedoch gründlich.
Im Wasser der Bucht von Sonderburg habe man gestern eine Leiche gefunden, die offenbar einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sei, berichtete der Leiter des Studios Flensburg und fragte übergangslos, wo sie denn mit dem Boot gerade seien. »Vielleicht schon in der Außenförde?«
»Warum willst du das denn wissen?«, hakte Kira misstrauisch nach.
»Kira, das ist eine ganz große Sache, das rieche ich förmlich! Als die Dänen heute Morgen bekannt gaben, dass die Wasserleiche, die sie aufgefischt haben, eine Deutsche sei, hat sich Kollege Tim Scholler sofort nach Sonderburg aufgemacht, damit wir die Sache schon mal in unserer App online stellen konnten. Trotzdem brauche ich für heute noch einen Vor-Ort-Beitrag für Unser Land am Abend.«
»Das kann Scholli doch ebenso gut machen!«
»Klar, er hat auch schon mit den Recherchen begonnen und erste Kontakte zur dänischen Kripo geknüpft. Aber er war damit einverstanden, dass ich dich anrufe. Er hätte dich gern dort vor Ort – auch weil du fließend Dänisch sprichst.«
»Alles andere wäre auch verwunderlich für jemanden, der der dänischen Minderheit angehört«, fiel Kira ihm spöttisch ins Wort.
»Eben«, konterte de Jong. »Und nicht nur deshalb bist du geradezu prädestiniert für diese Aufgabe.«
»Danke für die Blumen, Michael, aber sag doch einfach, was genau du von mir willst.«
»Es läge mir viel daran, wenn du dich mit Tim Scholler zusammen der Sache annimmst. Du kommst doch mit dem Boot direkt an Sonderburg vorbei – jedenfalls so gut wie. Da dachte ich mir … ich meine …«
»Noch mal zur Erinnerung«, fiel ihm Kira ins Wort, »ich habe Urlaub!«
»Meine Güte, ja, aber schließlich nur noch zwei Tage. Die kriegst du natürlich gutgeschrieben und …«
»Okay, ich hab dich verstanden«, würgte Kira ihn ab. »Ich bespreche das mit Lukas und melde mich wieder. Maile mir bitte inzwischen alles, was bisher über diesen Leichenfund bekannt ist, okay?«





























