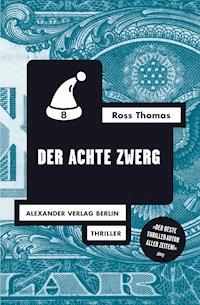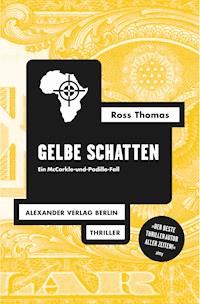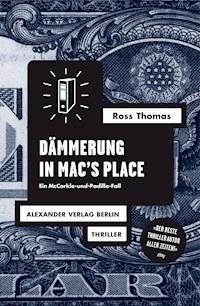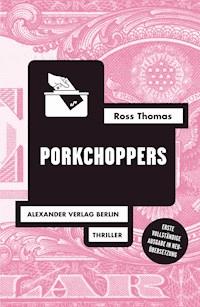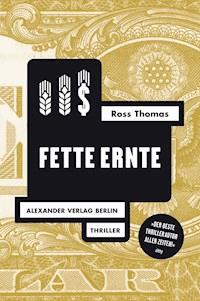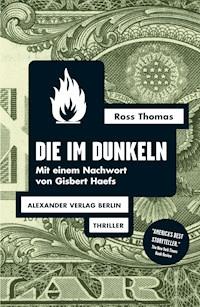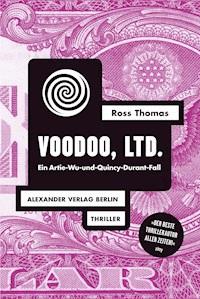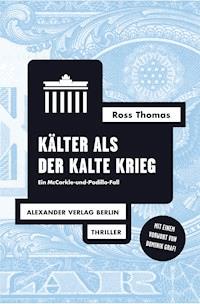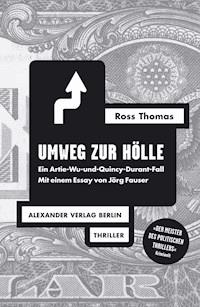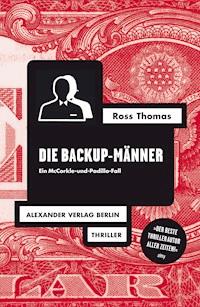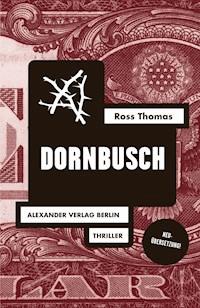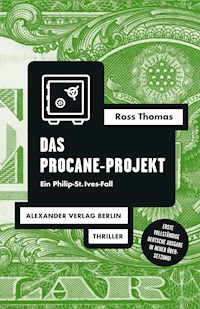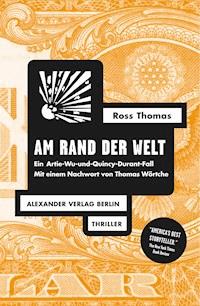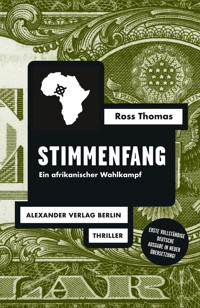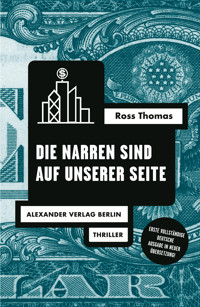
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alexander Verlag Berlin
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Als Lucifer Dye aus einem Hongkonger Gefängnis entlassen wird, erfährt er, dass seine Karriere als Agent der US-Spionageabteilung Sektion Zwei endgültig beendet ist. Gleich nach seiner Ankunft in San Francisco tritt der Troubleshooter Victor Orcutt mit einem Angebot an ihn heran: Dye soll die texanische Stadt Swankerton korrumpieren. An seiner Seite die ehemalige Prostituierte Carol Thackerty und der Ex-Polizeichef Homer Necessary. Während Orcutt die Regie führt, erschleicht sich Dye das Vertrauen des inoffiziellen, von der Mafia unterstützten Oberhaupts von Swankerton. Und bald fragen sich beide Parteien im Kampf um die Kontrolle der Stadt, auf welcher Seite der Ex-Spion eigentlich steht. Aus dem Amerikanischen von Gisbert und Julian Haefs Eine um mehr als die Hälfte gekürzte deutsche Ausgabe erschien 1972 unter dem Titel »Unsere Stadt muss sauber« werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 620
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ross Thomas, Die Narren sind auf unserer Seite
Ross Thomas, geboren 1926 in Oklahoma, verarbeitete seine vielfältigen beruflichen Erfahrungen in seinen Politthrillern, in denen er vor allem die Hintergründe des (amerikanischen) Politikbetriebs entlarvt und bloßstellt. Ihm wurde zweimal der Edgar Allan Poe Award und mehrmals der Deutsche Krimipreis verliehen. Bis zu seinem Tod 1995 entstanden 25 Romane.
Ross Thomas
Die Narren sind auf unserer Seite
Aus dem amerikanischen Englisch von Gisbert Haefs und Julian Haefs
Die Arbeit der Übersetzer am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds im Rahmen des Programms »NEUSTART KULTUR« der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.
Erste vollständige deutsche Ausgabe in neuer Übersetzung.
Die stark gekürzte deutsche Erstausgabe erschien 1972 unter dem Titel Unsere Stadt muß sauber werden im Ullstein Verlag, Frankfurt a. M./Berlin/Wien.
Die amerikanische Originalausgabe The Fools in Town Are on Our Side erschien 1970.
© 1970 by Ross Thomas
Licensed with Ross E. Thomas, Inc.
© für diese Ausgabe by Alexander Verlag Berlin 2024
Alexander Wewerka, Fredericiastr. 8, D-14050 Berlin
[email protected] · www.alexander-verlag.com
Lektorat: Marilena Savino
Umschlaggestaltung: Antje Wewerka
Korrektorat: Katja Karau
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-89581-627-7 (eBook)
»Ham wir denn nich alle Narreninne Stadt auf unsere Seite? Un isdas nich in jede Stadt ne ausreichendgroße Mehrheit?«
MARK TWAIN, Huckleberry Finn
Inhalt
Teil Eins
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Teil Zwei
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Teil Drei
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Ross Thomas im Alexander Verlag Berlin
TeilEins
1
Das Debriefing dauerte zehn Tage in einer abgeriegelten Suite in der alten Sektion des Letterman General Hospital der Army auf dem Presidio in San Francisco, und als es beendet war, galt das auch für meine Karriere – falls man sie so nennen konnte.
Sie waren die ganze Zeit durchaus höflich, vielleicht sogar ein bisschen verlegen, falls sie überhaupt etwas empfanden, was ich bezweifelte, und die Verlegenheit hatte möglicherweise ihre ungewöhnliche Großzügigkeit bewirkt, als es um die Abfindung ging. Diese betrug 20.000 Dollar, und wie Carmingler mehrmals sagte, war alles steuerfrei, so dass sie also im Grunde 28.000 oder sogar 30.000 entsprach.
Carmingler höchstpersönlich händigte mir den neuen Pass aus, zusammen mit dem beglaubigten Scheck, ausgestellt von etwas namens Brookhaven Corporation. Er tat dies schnell, ohne Kommentar, ganz so, wie er wohl einen verkrüppelten Gaul erschossen hätte – vielleicht sein Lieblingspferd – und als dieser letzte amtliche Akt erledigt war, ging er sogar so weit, zum Telefon zu greifen und ein Taxi zu bestellen. Ich war fast sicher, dass dies das erste Mal war, dass er für einen anderen als sich selbst ein Taxi bestellt hatte.
»Es müsste gleich kommen«, sagte er.
»Ich warte draußen.«
»Das ist nicht nötig.«
»Ich glaube schon.«
Carmingler setzte seine skeptische Miene auf. Das gelang ihm, indem er die Unterlippe vorschob und gleichzeitig die Stirn runzelte. Diesen Gesichtsausdruck würde er auch verwenden, wenn ihm jemand sagte, es hätte aufgehört zu regnen. »Es gibt wirklich keinen Grund, jetzt …«
Ich unterbrach ihn. »Wir sind doch fertig, oder? Die losen Fäden sind sauber abgebunden. Alle Krümel sind weggewischt. Es ist vorbei.« Carmingler gegenüber benutzte ich gerne schräge Wendungen. Das störte ihn.
Er nickte langsam, nahm seine Pfeife heraus und begann sie mit seiner Spezialmischung zu stopfen, die er von irgendeinem Tabakladen in New York bezog. Dessen Namen konnte ich mir nie merken, wenn er ihn auch oft genug erwähnt hatte. Er nickte immer weiter, während er die Pfeife füllte. »Also, ich würde das nicht so sagen.«
»Nein«, sagte ich, »würden Sie nicht. Ich aber wohl, und deshalb werde ich draußen warten.«
Carmingler, der Pferde liebte, falls er überhaupt etwas liebte, was abermals zweifelhaft war, stand auf und kam um seinen Schreibtisch herum, bis dorthin, wo ich stand. Er muss damals vierzig oder sogar zweiundvierzig gewesen sein und bestand nur aus Ellbogen und Knien und was ich seit langem für eine sorgsam eingeübte fohlenhafte Unbeholfenheit hielt. Das feuerrote Haar, dem nur wenig zu einem lodernden Scharlachrot fehlte, bildete einen halben Rahmen um sein langes schmales Gesicht, von dem er, wie ich annahm, insgeheim wünschte, es ähnelte einem Pferd. Tatsächlich sah es eher nach einem Maultier aus. Einem störrischen. Er reichte mir die Hand.
»Dann viel Glück.«
Lieber Himmel, dachte ich, der feste Händedruck eines traurigen Abschieds. »Also, das weiß ich bei Gott zu schätzen, Carmingler«, sagte ich mit einem kurzen harten Händedruck. »Sie wissen ja gar nicht, wie sehr ich das zu schätzen weiß.«
»Kein Grund für Sarkasmus«, sagte er steif. »Überhaupt nicht.«
»Dafür nicht und auch sonst für nichts«, sagte ich.
»Ich meine es ernst«, sagte er. »Viel Glück.«
»Ja, klar«, sagte ich und nahm den neuen Plastikkoffer in die Hand, dem es absolut nicht gelingen wollte, wie Korduanleder auszusehen. Ich drehte mich um, ging durch eine Tür und eine Halle entlang, hinaus auf den Halbkreis der Auffahrt, wo ein Paar angekettete Mörser, 1859 hergestellt von einer Firma namens C. A. & Co. in Boston, den Eingang zum Letterman General Hospital hüteten, das 1898 pünktlich zum Krieg gegen Spanien gegründet worden war. In der Ferne war der Russian Hill zu sehen.
Nach zehn Minuten kam das Taxi und ich stellte den Koffer auf den Beifahrersitz. Der Fahrer drehte sich nach mir um.
»Wohin, Kumpel?«
»Zu einem Hotel.«
»Welches?«
»Hab ich noch nicht drüber nachgedacht. Was würden Sie empfehlen?«
Er musterte mich noch ein bisschen mit Augen, die zu alt waren für sein Messdienergesicht. »Hätten Sie’s gern teuer, mittelteuer oder billig?«
»Mittel.«
»Wie wär’s mit dem Sir Francis Drake?«
»In Ordnung.«
Er ließ mich am Eingang Sutter Street aussteigen, und der Mann am Empfang gab mir ein Zimmer in der sechzehnten Etage mit Blick auf die Bay Bridge. Ich packte den neuen Plastikkoffer aus, den sie mir gegeben hatten, und hängte die beiden Anzüge und den Mantel in den Kleiderschrank. Ich trug einen der drei neuen Anzüge, den grauen mit den kleinen matten Fischgrätenstreifen. Zu ihm gehörte eine Weste, wie zu den beiden anderen, und ich vermutete, dass Carmingler sie persönlich ausgesucht hatte. Er trug immer eine Weste. Und rauchte Pfeife. Und fummelte an seinem Phi-Beta-Kappa-Schlüssel herum.
Ich war ein wenig überrascht gewesen, dass mir alles so gut passte, bis mir einfiel, dass sie ja meine genauen Maße in ihren Unterlagen hatten, seit elf Jahren schon, und sie sogar alljährlich, immer zum 15. Januar, neu abfragten, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich eine Vorliebe für saucengetränkte Nudeln entwickelt und zwölf oder dreizehn Kilo zugelegt hätte oder aber dem Alkohol verfallen wäre, das Essen aufgegeben hätte und ungesund unter meine gewohnten 75 Kilo abgesackt wäre. Sie wollten immer alles ganz genau haben. Größe 1,90 m. Kragenweite 39 cm. Brustumfang 105 cm. Taillenumfang 83 cm. Armlänge rechts 87 cm. Armlänge links 86,3 cm. Schuhgröße 43 mit extraschmalem Absatz. Hutgröße 58. Einen Hut hatten sie mir aber nicht gekauft, nur die drei Anzüge als Ersatz für die pyjamaartige Gefängnisuniform aus grauer Wolle, in der ich angekommen war, plus einen Überzieher und sechs Oxford-Hemden (alle weiß, mit Button-Down-Kragen – wieder Carmingler); sechs Paar wadenlange Socken (alle schwarz); ein Paar Schuhe: schwarz, glatte Spitze, Kieselleder und teuer; sechs Jockey-Boxershorts; einen Gürtel (schwarz, Alligator) und vier Krawatten (scheußlich).
Schätzungsweise hatte ich sie um die sieben- oder achthundert Dollar gekostet. Jedenfalls unter tausend. Wenn ich wichtiger gewesen wäre, hätten sie vielleicht an die fünfzehnhundert ausgegeben, aber was sie gezahlt hatten, entsprach genau meinem bisherigen Platz in der Hierarchie. Es entsprach auch ihrer pingeligen Überzeugung, dass kein ehemaliger Mitarbeiter, wie erbärmlich oder schändlich er auch sei, ohne angemessene (wenn auch nicht kostspielige) Garderobe in die reale Welt abgeschoben werden sollte.
Schrank und Kommode enthielten meinen ganzen Besitz, abgesehen von meinem neuen Pass und dem Scheck über 20.000 $. Ferner besaß ich eine erneuerte Aversion, oder vielleicht nur Antipathie, gegenüber dem Wort Debriefing, die aber keinen Wert in bar hatte.
Als die Kleidung verstaut war, rief ich den Empfang an, um herauszufinden, wie spät es war, wo sich die nächste Bank befand und ob sie noch geöffnet hatte. Eine Uhr besaß ich nicht. Die hatte man mir im Gefängnis abgenommen, diesem feuchten, verschwitzten, grauen Steingebäude, fast ein Jahrhundert zuvor von den Briten errichtet. Als ich nach drei Monaten entlassen wurde, wusste niemand etwas von der Uhr. Ich hatte nicht wirklich erwartet, sie zurückzubekommen, hatte aber trotzdem gefragt.
Der Mann am Empfang sagte, die nächste Bank sei nur ein Stückchen die Straße hinauf, es sei jetzt 12:36 Uhr, die Bank sei offen, und wenn ich keine Uhr hätte, könnte ich aus dem Fenster zu dem Gebäude einer Versicherungsgesellschaft schauen, dessen Leuchtzeichen mir nicht nur die Zeit, sondern auch die Temperatur angäben. Ich bat den Mann vom Empfang, mir eine Flasche Scotch heraufzuschicken.
Als der Hotelboy mit dem traurigen Gesicht mir die Rechnung für den Whisky überreichte, überraschte mich der Preis.
»Ist teurer geworden«, sagte ich.
»Was denn nicht?«
»Gerede«, sagte ich. »Das ist noch immer billig.«
Ich unterschrieb die Rechnung und addierte zwanzig Prozent Trinkgeld, was den Hotelboy fröhlich oder jedenfalls etwas weniger vergrämt dreinblicken ließ. Als er gegangen war, mixte ich mir einen Drink, stellte mich ans Fenster und blickte hinaus über die Stadt mit der Brücke im Hintergrund. Es war einer dieser spektakulär schönen Tage, die San Francisco manchmal Anfang September zustande bringt: ein paar ruhige Wolken, eine nachsichtige Sonne und die Luft so sprudelnd, dass man weiß, jemand wird sie irgendwann auf Flaschen ziehen. Ich stand da in meinem Zimmer in der sechzehnten Etage, nippte an dem Scotch und starrte hinaus auf das, was man einmal als Amerikas beliebteste Stadt beworben hatte. Vielleicht ist sie das noch immer. Ich dachte auch an die Zukunft, die weniger zu bieten schien als die Vergangenheit, und an die Vergangenheit, die überhaupt nichts bot. Carmingler hatte dafür gesorgt.
Ich trank aus und zog los, um die Bank aufzusuchen, bei der es sich um eine Filiale von Wells Fargo handelte. Einer der kleineren Angestellten, ein junger Mann mit gezwirbeltem Schnurrbart, wirkte beflissen müßig, deshalb sagte ich ihm, ich wollte ein Girokonto eröffnen. Darauf zuckte der Schnurrbart ein wenig, und ich nahm an, dass es sich bei dem Zucken um ein Lächeln des Willkommens oder zumindest der Zustimmung handelte. Ein Namensschild auf seinem Schreibtisch teilte mit, dass er C. D. Littrell hieß, und ich versuchte mich zu erinnern, ob ich je einen Bankangestellten mit Zwirbelschnäuzer gesehen hatte, was nicht der Fall war, außer in irgendwelchen alten Western, und da stellte er sich gewöhnlich als Gauner heraus. Aber dies hier war Wells Fargo und vielleicht förderten die Traditionen des Hauses Zwirbelschnäuzer.
Nachdem ich mich gesetzt hatte, zog Littrell mehrere Vordrucke hervor, und die Vordrucke enthielten Fragen, auf die ich mir Antworten ausdenken musste. Ich beschloss, die Wahrheit zu sagen, wenn es mir passte, und zu lügen, wenn nicht.
»Ihr vollständiger Name?«, sagte Littrell.
»Dye, D-y-e. Lucifer C. Dye.« Das C stand für Clarence, aber ich hielt es nicht für nötig, das zu erwähnen. Lucifer war schlimm genug.
»Ihre Adresse bitte?«
Auch eine gute Frage. »Im Moment das Sir Francis Drake.«
Der Schnurrbart zuckte leicht, und diesmal wusste ich, es war kein Lächeln. Littrell blickte von seinem Blatt auf und starrte mich an. Ich erwiderte seinen Blick – seriös, wie ich hoffte.
»Wie lange beabsichtigen Sie dort zu bleiben?«, sagte er, wobei er das dort sehr betonte, als wäre er der Meinung, jeder, der lange in einem Hotel blieb, sei entweder verrucht oder flatterhaft. Vielleicht beides.
»Weiß ich noch nicht«, sagte ich.
»Sobald Sie eine feste Adresse haben, sollten Sie uns das wissen lassen.«
»Ich werde es Sie wissen lassen.«
»Ihre letzte Adresse?«
»Hongkong. Brauchen Sie Straße und Nummer?«
Littrell schüttelte den Kopf, ein wenig verdrossen, wie ich fand, und notierte Hongkong. Er wäre glücklicher gewesen, wenn ich Boise oder Denver oder notfalls sogar East St. Louis gesagt hätte.
»Ihre bisherige Bank?«
»Barclays«, sagte ich. »Auch in Hongkong.«
»Ich meine in den Staaten.«
»Keine.«
»Überhaupt keine – nie?« Er schien ein bisschen schockiert.
»Überhaupt keine.«
Nun schüttelte Littrell wieder den Kopf. Ich konnte nicht sagen, ob es eine Geste der Missbilligung oder des Mitleids war. »Wo arbeiten Sie, Mr. Dye?«, sagte er, und ich hörte an seinem Ton, dass er mit dem Schlimmsten rechnete.
»Selbständig.«
»Ihr Firmensitz?«
»Das Sir Francis Drake.«
Littrell hatte aufgegeben. Er kritzelte jetzt eilig. »Was für eine Art Geschäft, Mr. Dye?«
»Import-Export.«
»Wie heißt ihre Firma?«
»Ich habe mich noch nicht festgelegt.«
»Ah ja«, sagte Littrell ein wenig mürrisch und schrieb Keine Anstellung. »Wie viel möchten Sie einzahlen?«
Ich wusste, wenn ich fünfzig Dollar sagte, wäre er angenehm überrascht. Wenn ich hundert sagte, wäre er begeistert.
»Zwanzigtausend«, sagte ich. »Nein, sagen wir lieber neunzehntausendfünfhundert.«
Littrell murmelte etwas vor sich hin, was ich nicht verstand, und schob mir dann zwei Karten zu. »Das ist für die Unterschriftsprobe. Würden Sie sie bitte so signieren, wie Sie Ihre Schecks unterschreiben?«
Ich signierte die Karten und gab sie ihm zurück, zusammen mit dem beglaubigten Scheck über 20.000 $. Littrell untersuchte den Scheck sorgfältig, und einen Moment lang dachte ich, er könnte daran schnüffeln, auf der Suche nach einem verräterischen Duft. Aber er musterte ihn weiter, stellte fest, dass er gut war, und, glaubte ich, hasste diese Tatsache. Er drehte ihn um und suchte nach der Indossierung. Es gab keine. »Könnten Sie ihn bitte indossieren, Mr. Dye?« Zum dritten Mal schrieb ich meinen Namen.
»Haben Sie irgendeinen Ausweis?«
»Ja«, sagte ich. »Habe ich.«
Wir warteten beide ab. Er würde schon darum bitten müssen. Nach etwa fünfzehn Sekunden seufzte er und sagte: »Könnte ich ihn bitte sehen?«
Ich reichte ihm den Pass, frisch ausgestellt, noch nie benutzt, in dem stand, dass mein Haar dunkelbraun sei, meine Augen nussbraun, dass ich 1933 in einem Ort namens Moncrief, Montana, geboren und, falls das noch jemanden interessierte, Geschäftsmann sei. Es stand dort nicht, dass meine etwas schiefen Zähne eben erst von einem Armeezahnarzt gereinigt worden waren, einem Major, der ganz dringend wieder als Zivilist praktizieren wollte.
Littrell nahm den Pass entgegen, warf einen Blick darauf, sammelte die Vordrucke ein und entschuldigte sich. Er ging zu einem von Holz- und Glaswänden umschlossenen Büro, ein paar Schritte entfernt, in dem sich ein älterer Mann gegen Leute verbarrikadiert hatte, die vorbeikamen, um sich Geld zu leihen. Der Kopf des älteren Mannes war rosig kahl, die Farbe seiner Augen ein argwöhnisches Blau.
Littrell gab sich nicht die Mühe, leise zu sprechen, und ich konnte dem Gespräch gut folgen. »Eine Knalltüte mit beglaubigten zwanzigtausend«, sagte er. »Normales Girokonto.«
Der Ältere sah sich zuerst den Scheck an, blätterte die Vordrucke durch und untersuchte dann den Pass. Sorgfältig. Einen langen Moment spitzte er den Mund und zeichnete schließlich die Papiere ab. »Es ist ja nur Geld«, sagte er, und ich hatte das Gefühl, dass er es zum vierhundertsten Mal in diesem Jahr sagte.
Littrell nahm den Scheck und die Vordrucke, verschwand hinter den Kassenschaltern und kam dann zurück an seinen Platz, wo er, immer noch stehend, 500 $ auf die Schreibtischplatte und dann noch einmal in meine Hand zählte. Danach setzte er sich, langte in eine Schublade und nahm ein Scheckheft und ein paar Einzahlungsvordrucke heraus, die er mir aushändigte.
»Die Schecks sind nur für den Übergang, die Vordrucke auch«, sagte er. »Wir schicken Ihnen weitere, bedruckt mit Ihrem Namen und der Adresse, falls Sie eine dauerhafte Adresse kriegen.«
Ich ignorierte das falls und steckte Schecks und Vordrucke in die Innentasche meiner Jacke. Die 500 $ faltete ich und steckte sie wie nebenbei in meine rechte Hosentasche, was Littrell zu irritieren schien. Wahrscheinlich machte ich es genau deswegen – und weil ich weder ein Portemonnaie noch eine Brieftasche besaß und außer den 500 $ nichts, was ich hätte hineinstecken können. Keinen Führerschein, keine Kreditkarten. Keine Schnappschüsse oder alten Briefe, nicht einmal einen Taschenkalender vom Schnapsladen an der Ecke. Der einzige Beweis dafür, dass ich war, wer ich zu sein vorgab, befand sich in meinem neuen Pass, der es mir mit ein paar Ausnahmen erlaubte, an jeden Ort der Welt zu reisen, zu dem es mich hinzog, immer vorausgesetzt, mir wäre einer eingefallen, der das tat, was gerade nicht der Fall war.
Ich verabschiedete mich von Littrell, der mir ein letztes Schnurrbartzucken gönnte. Draußen vor der Bank ging ich nach rechts, die Sutter Street hinauf. Ich hielt Ausschau nach einem Juwelierladen, wo ich mir eine Uhr kaufen konnte, und es dauerte mindestens zehn Minuten, bis ich einen fand, und fünf Minuten, bis ich den Mann im braunen Anzug bemerkte, der mich beschattete, und sieben Minuten, bis ich zur angenehmen Feststellung gelangte, dass es mir absolut egal war, und wenn er mir bis ans Ende der Welt gefolgt wäre – von dem einige bedächtige Bewohner San Franciscos behaupteten, es läge gleich jenseits der Bucht, in Oakland.
2
Das ganze Schlamassel – man könnte es wohl auch nennen »Wie ich in Ungnade fiel« – hatte mit den Anweisungen begonnen, die sie mit normaler Post aus der Hauptgeschäftsstelle von Minneapolis Mutual schickten, die sich aus irgendeinem unerfindlichen Grund in Las Vegas befand. Die Nachricht traf am 20. Mai in Hongkong ein. Abgefasst war sie in einem antiquierten, ein einziges Mal zu verwendenden Code, der sich in dieser Woche auf Seite 356 der 13. Auflage von Bartlett’s Familiar Quotations bezog; wie sich herausstellte, handelte es sich um Auszüge aus Oliver Goldsmiths The Deserted Village. Ich brauchte eine gute halbe Stunde, um ihn zu entziffern, und ich dachte, jeder halbwegs helle Computer hätte es binnen Sekunden schaffen können und, soviel ich wusste, mochte das sogar schon geschehen sein. Auch entschlüsselt war die Nachricht immer noch kindisch verrätselt, als ob der Absender sich an die verschwommene Hoffnung geklammert hätte, außer für mich wäre sie für jeden bedeutungslos. Ihre drei Wörter lauteten: Den Dorfstaatsmann chiffrieren.
Es war einer ihrer dämlicheren Befehle, noch ein bisschen dümmer als die meisten, deshalb zerriss ich alles und spülte es die Toilette hinunter. Dann rief ich Joyce Jungroth herein, meine in Minnesota geborene Sekretärin, die nach drei Jahren immer noch an ihren romantischen Vorstellungen von Hongkong festhielt, einen schlechten Teint hatte und immer schwach nach Noxzema roch. Ich gab ihr den Bartlett’s.
»Werfen Sie das weg«, sagte ich.
Sie seufzte und nahm das Buch entgegen. »Benutzen Sie nie unanständige Romane, irgendwas, was ich lesen könnte?«
»Sie sollen so was nicht lesen; Sie sollen’s wegwerfen.«
Ich vermutete, dass sie die Bücher in ihr Apartment mitnahm. Es hatte aber keine Bedeutung, weil die Methode – unentschuldbar altmodisch, verjährt, ja sogar pubertär – nur ein- oder zweimal pro Jahr benutzt wurde, und zwar immer von einem wie Carmingler, den sein anerzogenes Misstrauen gegenüber technologischen Neuerungen dazu bewog, Streichhölzer einem Gasfeuerzeug, ein Fahrrad (so oft wie möglich) einem Auto und sogar ein Messer einem Revolver vorzuziehen. Man konnte Carmingler nicht so viel bezahlen, dass er die U-Bahn genommen hätte.
Bis dahin hatte ich in Hongkong zehn Jahre verbracht, als Geschäftsführer einer Lebensversicherungsgesellschaft in amerikanischem Besitz namens Minneapolis Mutual. In dieser Zeit hatte ich eigenhändig drei einfache Lebensversicherungspolicen verkauft. Ich leitete sechs Agenten, angeblich Versicherungsvertreter, die Südostasien bearbeiteten. Sie hatten das Glück, nicht von ihren Provisionen leben zu müssen, denn ihre gesamten Bemühungen während des Jahrzehnts hatten die Anzahl von verkauften Policen der Minneapolis Mutual auf glatte zwölf hochgetrieben.
Zwei meiner eigenen drei Verkaufsabschlüsse, jeder im Nennwert von 100.000 $, waren vor sechs Jahren mit einem Fordhändler aus Mobile und seiner Frau zustande gekommen, die sich auf einer Weltreise befanden und beide an Durchfallerkrankungen litten, welche ausreichend unangenehm waren, um sich davon zu überzeugen, dass sie das Herz der Südstaaten nie wiedersehen würden. Sie hatten Hongkong per Schiff erreicht, und da sie entschlossen waren, ihre Tour bis zum Ende durchzuziehen, hatten sie sich nach Versicherungsgesellschaften umgetan und waren froh und dankbar, Minneapolis Mutual zu entdecken, die ja immerhin amerikanisch war, wenn der Hauptsitz in den Staaten auch ein bisschen sehr weit im Norden lag. Als man mir die Geschäftsführung anhängte, hatte niemand mit Laufkundschaft gerechnet, und ich wusste noch immer so gut wie nichts über Versicherungen. Deshalb hatte ich, als mich das amerikanische Paar mit dem Scheckheft in der Hand überfiel, meine Sekretärin (nicht Joyce Jungroth; damals hatte ich eine andere) hereinrufen müssen, die sich wenigstens ein bisschen mit dem Verfahren auskannte und immerhin wusste, wo die Vordrucke waren, und sie stellte die Policen aus und schickte die beiden zu einem Arzt, sowohl wegen ihrer Diarrhö als auch für den vorgeschriebenen Gesundheitscheck.
Das war der einzige Abschluss mit Laufkundschaft, den das Inselbüro von Minneapolis Mutual in der neunten Etage an der Pedder Street je machte, aber er beunruhigte mich genug, um am selben Nachmittag eine Lebensversicherung über 10.000 $ für mich abzuschließen. Ich setzte sie sogar selbst auf, unter der amüsierten Anleitung meiner Sekretärin. Da aber nie wieder jemand vorbeikam außer gelegentlich einem Vertreter für Bürobedarf, ließ ich die Police nach ein paar Jahren auslaufen.
Dies war so ungefähr das Einzige, was ich je über den Verkauf von Lebensversicherungen lernte: Südostasien ist dafür ein lausiges Terrain.
Nachdem Joyce Jungroth gegangen war, das Exemplar von Bartlett’s an ihren unterschwelligen Busen gedrückt, lehnte ich mich in meinem Sessel zurück – dem mit der geformten Rückenlehne, die angeblich die Haltung korrigieren sollte – und dachte über die Anweisungen aus Las Vegas nach.
Seit sechs Monaten hatte ich versucht, einen pummeligen fünfzigjährigen chinesischen Agenten zu überreden, Doppelagent zu werden. Es war ein seltsames Werben gewesen, und für meine Bemühungen waren mir lange Vorträge vermischter Zitate des Vorsitzenden Mao zuteilgeworden. Immerhin hielt Li Teh alle Verabredungen ein. Wenn ihm schließlich die Zitate ausgingen, murmelte ich meistens »Wie wahr« oder etwas ähnlich Sinnloses, ließ zwei Hunderter auf den Boden, das Deck oder sogar den Schreibtisch fallen und setzte hinzu: »Denken Sie drüber nach, ja?« Li nahm das Geld immer an.
Nach und nach erfuhr ich, dass Li Teh kaum dreißig gewesen war, als er Ende September 1949 nach Hongkong kam, nicht zu unterscheiden von den anderen im Schwarm der Chinesen, die in der Kolonie Zuflucht suchten, als Tschiang Kai-schek die zu Ehren seiner gefürchteten Gattin Mei-ling genannte C-47 bestieg und nach Formosa flog, wobei er nicht vergaß, die Goldreserven (200 Millionen US-$) der chinesischen Zentralbank einzupacken.
Was Li Teh von den anderen pai hua, den Flüchtlingen, unterschied, war Kapital, eine größere Menge in amerikanischen Dollar, die Maos Leute dem Geldgürtel an der Leiche eines der besonders korrupten Mitglieder im persönlichen Stab des Generalissimus entnommen hatte. Es war genug, um es Li zu ermöglichen, auf der Nathan Road in Kowloon einen Kameraladen aufzumachen mit der Konzession eines ostdeutschen Herstellers, der vor dem Zweiten Weltkrieg für die Qualität seiner Linsen berühmt gewesen war. Der Laden gedieh, und Li eröffnete nach ein paar Jahren einen weiteren in der Kimberley Road, diesmal spezialisiert auf Canons und Nikons aus Japan.
Von da war es nur noch ein kleiner Schritt zu Schweizer Uhren (ich hatte eine bei ihm gekauft), Kassettenrekordern, Minifernsehern und Transistorradios – alles, was Touristen mit harter Währung heimschleppen konnten. Hätte sein Kapital ihm gehört, wäre Li mit fünfzig ein reicher Mann gewesen, aber seine Profite flossen entweder zurück in seine blühenden Geschäfte oder wurden nach Peking umgelenkt, wo seine Vorgesetzten reichlich Verwendung für die Dollar, Pfund, Franken und Mark hatten.
Ich fand immer, dass Li eher zum Geschäftsmann taugte als zum Spion, wenngleich er das auch war und mit Informationen jeder Art handelte, die er stahl, wenn er konnte, und kaufte, wenn nicht. Einmal im Monat fuhr er mit dem Zug nach Peking – eine lange, anstrengende, unbequeme Reise – und trug dabei einen mit so viel Bargeld vollgestopften Koffer, wie es ihm der Profit seiner diversen Unternehmen erlaubte. Natürlich wäre es einfacher und effektiver gewesen, das Geld bei der Bank of China zu deponieren, aber Li nahm auch alles an Informationen mit, was er hatte ermitteln oder zusammentragen können, und die waren, soweit ich weiß, in Peking durchaus willkommen, wurden allerdings nicht mit dem gleichen Grad an Wärme aufgenommen wie die harte Währung.
Li war Kommunist, und zwar ein guter, wie ich annehme. Er erzählte mir einmal, alles habe 1938 begonnen; da sei es ihm als Oberschüler gelungen, einem Presskommando der Nationalistenarmee zu entkommen, das ihn mit elf weiteren Schülern eingefangen hatte. Er fand seinen Weg nach Yanan in Nordchina, wo sich provisorisch Maos Befehlsstand oder Hauptquartier befand. Zwar war er noch ein Teenager, aber offensichtlich aufgeweckt und für chinesische Verhältnisse gebildet. Man ließ ihn in einer der sauberen weißgetünchten Höhlen wohnen, dem Heim eines höheren Offiziers, der sich um Lis militärische Ausbildung, politische Indoktrination, Moral sowie Einführung in Techniken und Praxis der Spionage kümmerte. Er bekleidete einen mittleren Rang im Nachrichtendienst der Kommunisten, und wie der Offizier aufstieg, so auch Li Teh, bis 1949, als sie ihn nach Hongkong schickten, seine schon damals üppige Leibesmitte von einem Geldgürtel voll amerikanischer Dollar umschlungen.
Als einer der einigermaßen prominenten Geschäftsleute Hongkongs hatte Li seine Vorgesetzten in Peking halbwegs davon überzeugen können, dass er seinem Ruf entsprechend leben sollte. Sie hatten es ihm wohl mürrisch und widerwillig gestattet, und er fuhr einen Porsche, den er liebte, wohnte als Witwer in einem eleganten Apartmentgebäude nicht allzu weit von der Bank of China und dem Cricket Club entfernt, und er gab oft Empfänge mit einigem Aufwand an Charme und sogar Geschmack. Er war Mitglied in der Handelskammer von Hongkong, drei Gemeindeorganisationen und einem privaten chinesischen Club mit einer ganz vorzüglichen Speisekarte. Li betrieb dies alles mit Billigung seiner Vorgesetzten, wenn auch nicht gerade zu ihrer Begeisterung; ihre Toleranz für seinen gehobenen Lebensstil endete immer am letzten Tag jedes Monats, wenn sie seine Bücher prüften, um sicherzugehen, dass ihm kein einziger Groschen blieb, den er sein Eigen nennen konnte.
Also lebte Li Teh ein bisschen zu gut, und folglich war er pleite. Schlimmer noch, er hatte Schulden, und Geldverleiher in Hongkong sind sogar noch weniger nachsichtig als ihre Kredithai-Kollegen in den Staaten. Also korrumpierte ich Li Teh mit Geld. Das war es, wofür ich bezahlt wurde und was ich am besten konnte. In manchen Kreisen hieß es sogar, ich sei darin sehr gut.
Unser letztes Treffen fand in einem vorübergehend leeren Lagerhaus statt, und wir folgten dem gewohnten Drehbuch; allerdings verkürzte Li seinen Vortrag um beinahe sechs Minuten, und was er sagte, brachte er auf eine mechanische, völlig uninspirierte Art vor. Als er fertig war, schwieg er ein paar lange Momente. Ich wartete ab. So leise, dass ich es kaum hören konnte, sagte er schließlich: »Ihr bester Preis?«
»Nennen Sie ihn mir.«
Er entschloss sich zu einem Schuss ins hohe Blaue. »Dreitausend Dollar im Monat.«
Ich versuchte zu kontern. »Hongkong-Dollar natürlich.«
»Amerikanische.«
Wir saßen auf ein paar leeren Packkisten. Li Teh lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor seinem gewölbten Bauch, der glatt eingefasst war in einen dunkelgrünen Sharkskinanzug, welcher an die hundertfünfzig (US-)Dollar gekostet haben musste, was in Hongkong ein hoher Preis für einen Anzug ist, auch einen maßgeschneiderten. Er hatte die Augen halb geschlossen und saß da, wobei er sich sanft vor und zurück wiegte, ein fetter, nicht lachender kommunistischer Buddha, zufrieden in der Gewissheit, dass er gerade einen Preis festgesetzt hatte, den abzulehnen sich der Käufer unmöglich leisten konnte. Es war ein besonders gutes Beispiel für Angebot und Nachfrage. Oder ein besonders schlechtes.
»Na schön«, sagte ich. »Sie kriegen’s – wenn es das wert ist.«
»Das wird es sein.«
»Was?«
»Mündliche Berichte zweimal pro Monat. Nichts Schriftliches.«
»Von wem?«
»Von mir.«
»Und wenn sie wertlos sind?«
Er lächelte freundlich. »Dann, Mr. Dye, bezweifle ich stark, dass Sie zahlen werden.«
Ich erwiderte das Lächeln. »Sie kennen mich inzwischen ganz gut.«
»Ja, nicht wahr?«
»Wann wollen Sie wieder hinfahren?«
»Nach Peking?«
»Ja.«
»In zwei Wochen.«
»Gut«, sagte ich. »Das gibt mir die Möglichkeit, Zustimmung einzuholen.«
Das beunruhigte Li. Um das zu beweisen, hob er die Brauen. »Haben Sie denn noch keine Zustimmung?«
»Ich rechne nie mit guten Nachrichten, deshalb habe ich noch nicht darum ersucht.«
»Und schlechte Nachrichten?«, sagte Li.
»Mit denen rechne ich auch nie.«
»Dann führen Sie offenbar ein sehr unaufgeregtes Dasein, Mr. Dye.«
Ich nickte, zog zwei Hunderter aus der Tasche und legte sie sorgfältig auf die Packkiste, die Li als Sitz diente. Niemals hatte ich ihm direkt Geld gegeben. Er ignorierte die Scheine.
»In unserem Gewerbe, Mr. Li«, sagte ich, »wünscht man sich manchmal händeringend ein unaufgeregtes Dasein.«
3
Der Juwelierladen, den ich fand, war in der Nähe von Taylor Street und Bush Street, ungefähr drei Blocks entfernt vom Hotel. Es war ein kleiner Laden, und als ich die Tür öffnen wollte, war sie abgeschlossen. Drinnen konnte ich einen Angestellten oder vielleicht den Besitzer sehen, der zur Tür eilte. Er schloss sie schnell auf. Der Mann im braunen Anzug war drei oder vier Türen weiter stehengeblieben, wo er sich der gründlichen Betrachtung von Bruchbändern und Beinprothesen hingab, die ein Orthopädiegeschäft ausgestellt hatte.
»Ich schließe jetzt immer ab«, sagte der Mann, der die Tür öffnete. »In den letzten sechs Monaten bin ich dreimal ausgeraubt worden, deshalb schließ ich jetzt immer ab.«
»Wahrscheinlich schrecken Sie damit mehr Kunden als Diebe ab«, sagte ich.
»Na und?«, sagte er. »Ich geh sowieso pleite. Wenn mich nicht die Verbrecher ruinieren, dann tun’s die Versicherungsprämien. Wissen Sie, ich kann mich noch daran erinnern, dass das hier mal ’ne einigermaßen anständige Stadt war. Schauen Sie sich hier doch heut mal um.«
Er war ein kleiner dünner Mann um die fünfzig und trug eine Brille mit schwerem Gestell und dicken Gläsern, die seine braunen Augen ein bisschen hervortreten ließen. Sein schmaler Mund, ein bitterer Strich, hatte fast keine Lippen, und die Nase schnüffelte dauernd, als ob er sein drohendes geschäftliches Unheil riechen könnte.
»Ich würde mir gern eine Uhr ansehen«, sagte ich.
»Was Spezielles?«
»Ich möchte eine Omega Seamaster, Edelstahl, das Modell mit Kalender.«
»Das ist eine gute Uhr«, sagte der Mann, weil er irgendwas sagen musste und wohl das Gefühl hatte, es wäre sinnlos, seine Verkaufstalente an jemanden zu vergeuden, der sich schon für etwas entschieden hatte. Er huschte hinter den Ladentisch und reichte mir eine Uhr. Es war genau die gleiche wie die, die man mir im Gefängnis abgenommen hatte, nur hatte diese ein Lederarmband.
»Haben Sie eine mit dehnbarem Metallarmband?«, sagte ich.
»Nein, die haben alle Leder, wir können Ihnen aber im Handumdrehen eins dranmachen.«
»Wie viel?«
»Für die Uhr oder das Armband?«
»Zusammen.«
Er nannte mir den Preis, und es waren fünfzig Dollar mehr, als ich Li Teh in Hongkong gezahlt hatte, aber unter anderem dafür gab es Hongkong ja. Billige Uhren. »In Ordnung«, sagte ich. »Nehm ich.«
»Wird nur eine Minute oder zwei dauern«, sagte der Mann, nahm die Uhr und ging zum hinteren Teil des Ladens, wo offenbar der hiesige Metallarmbandspezialist wartete. Ich drehte mich um und blickte durch das Schaufenster hinaus. Der Mann im braunen Anzug stand davor, offenbar fasziniert von den Auslagen hinter der Scheibe, in die dünne graue Metallstreifen eingelassen waren, die Alarm auslösen würden, falls jemand versuchen sollte, sie mit einem Ziegel einzuschlagen und sich etwas zu schnappen.
»Da wären wir«, sagte der Mann, als er nach ein paar Minuten mit der Uhr zurückkam, und wie immer wollte ich sagen »wo?«, aber es kam mir sinnlos vor. Ich bezahlte die Uhr, stellte fest, dass sie korrekt gestellt war, und schob sie mir über das linke Handgelenk. Der Ladenbesitzer begann, das schwarze Etui, in dem sich die Uhr befunden hatte, in einen Papiersack zu stecken. Ich sagte ihm, er solle es behalten.
»Darin steckt aber der Garantiezettel.«
»Den will ich auch nicht«, sagte ich.
Draußen auf dem Trottoir blieb ich einen Moment neben dem Mann im braunen Anzug stehen, der noch immer von der Auslage im Schaufenster fasziniert zu sein schien. Ich schaute sie mir an, konnte aber nichts Besonderes entdecken, abgesehen von einigen Armbanduhren, mehreren Tabletts mit kitschigen Ringen und einer mittelgroßen Uhr, die mit einem kleinen Zettel prahlte, sie weiche nur maximal drei Sekunden von der absoluten Genauigkeit ab. Ich blickte auf meine neue Armbanduhr und freute mich irgendwie zu sehen, dass sie noch immer richtig ging.
»Faszinierend, nicht wahr?«, sagte ich zu dem Mann im braunen Anzug, wandte mich um und begann, zur Sutter Street und dem Sir Francis Drake zurückzugehen.
Er war als Beschatter gut, wenn er wollte. Sogar sehr gut. Er machte alle richtigen Bewegungen, so als hätte er sie schon sein ganzes Leben lang gemacht, tat dies aber jetzt nur noch aus Gewohnheit, als wäre es ihm egal, ob man ihn bemerkte oder nicht.
Nicht weit vom Hotel blieb ich vor einem Buchladen in der Sutter Street stehen und musterte die neuesten Bestseller. Das Fenster stand schräg zur Straße, deshalb konnte ich die Namen der Autoren und die Titel lesen und zugleich dank der Spiegelung das Trottoir hinter mir im Blick behalten. Einige der Autoren kannte ich, dafür nur zwei der Titel, aber das kommt davon, wenn man an die hundert Tage lang keine Zeitung liest. Der Mann im braunen Anzug kam schnell auf mich zu, jetzt, da es bergab ging und das Gehen leicht war.
Beinahe fett, dachte ich. Mindestens zehn Kilo Übergewicht. Vielleicht sogar fünfzehn. Um die eins achtundsiebzig, wahrscheinlich fünfundvierzig oder sechsundvierzig, vielleicht aber auch verlotterte zweiundvierzig. Der braune Anzug war nicht schäbig, nur ungebügelt, und die schwarzen Schuhe mussten dringend geputzt werden. Der Kragen seines weißen Hemdes war zu klein, und die Spitzen ragten in die Luft. Er trug einen blau und lila gestreiften Schlips, und einen Moment fragte ich mich, ob er farbenblind war. Als er noch ungefähr sechs Meter entfernt war, drehte ich mich um und schaute ihm entgegen. Er ging auf den Absätzen, die er hart auf dem Gehsteig aufsetzte. Sein Körper mochte fett sein, das Gesicht war es nicht. Es bestand aus lauter Flächen und Kanten, mit dunkelbraunen Augenbrauen, die aussahen, als müssten sie gekämmt werden. Auch sein Haar war braun, aber durchsetzt von schmutzig grauen Flecken, als wäre der Schopf hier und da einmal rasiert worden und in der falschen Farbe nachgewachsen. Unter den buschigen Brauen saßen Augen, die mich beim Näherkommen fixierten. Als er nah genug war, konnte ich sehen, dass eines braun war und das andere blau, und beide enthielten nicht mehr Wärme, als man im Kühlraum eines Schlachthauses fände.
Etwa einen Meter vor mir blieb er stehen und musterte mich mit seinen zweifarbigen Augen sorgfältig von oben bis unten. »Sie heißen Dye«, sagte er mit einer harten, ruhigen Stimme, so dass es eher wie eine Drohung als wie eine Feststellung klang.
»Ich heiße Dye«, sagte ich. »Wozu die Beschattung?«
»Ich war nicht sicher, ob Sie es sind, bis Sie sich auf den Rückweg zum Hotel gemacht haben. Die Rezeption hat mir gesagt, Sie wären zur Bank gegangen, aber ich hatte bloß eine allgemeine Beschreibung. Die passte ganz gut auf Sie, deswegen bin ich Ihnen gefolgt.«
»Hab ich bemerkt«, sagte ich.
»Hätten Sie nicht, wenn ich’s drauf angelegt hätte.«
»Haben Sie aber nicht.«
»Nein.«
»Na schön«, sagte ich. »Was wollen Sie?«
»Ich arbeite für Victor Orcutt«, sagte er, als erkläre das alles.
»Was will er verkaufen?«
»Nichts.«
»Wieso ich?«
Er langte in die Tasche seines braunen Anzugs und zog eine Packung Camel heraus. Er bot mir eine an. Ich schüttelte den Kopf. Er zündete sie mit einem Edelstahl-Zippo an, inhalierte tief und blies dann Rauch in die Luft empor. Er schien alle Zeit der Welt zu haben. Er schien fast so viel Zeit zu haben wie ich.
»Er hat nicht geglaubt, dass Sie sehr interessiert wären«, sagte der Mann im braunen Anzug.
»Woran?«
»Einer Einladung, sich mit ihm zu treffen.«
»Er hat recht«, sagte ich. »Bin ich nicht.«
Er wandte seinen blaubraunen Blick nicht von meinem Gesicht. »Wie ich gesagt habe, hat er nicht geglaubt, dass Sie eine Einladung annehmen würden, deshalb hat er mich angewiesen, Ihnen das zu geben.« Er langte in die innere Brusttasche seiner Jacke und zog einen quadratischen, beigen Umschlag heraus, den er mir reichte.
»Den hätten Sie am Empfang lassen können«, sagte ich und steckte den Umschlag ungesehen ein.
Er nickte, aber nur knapp. Sein schweres, dickes Kinn bewegte sich etwa einen Zentimeter nach unten und dann wieder nach oben. Zweimal. »Hätte ich, nicht wahr«, sagte er, »bloß hat Victor Orcutt mir gesagt, ich soll Ihnen den persönlich geben. Manchmal ist er ein bisschen eigen, deswegen tue ich lieber, was er sagt. Sorgt für Harmonie, wenn Sie wissen, was ich meine.«
»Nur zu gut«, sagte ich.
»Ja«, sagte er; mit den zweifarbigen Augen schien er sich immer noch mein Gesicht einprägen zu wollen. »Ich wette, dass Sie das wissen.« Dann drehte er sich abrupt um und ging die Sutter Street hinunter, ohne sich mit einem Wort oder wenigstens einer Handbewegung zu verabschieden. Ich registrierte, dass er noch immer hart mit den Absätzen auftrat.
Ich öffnete den Umschlag erst, als ich im Hotelzimmer war. Das beige Papier hätte aus feinen alten Leinenlumpen gemacht sein können und knisterte kräftig, als ich die Lasche aufriss. Er enthielt ein einziges einmal gefaltetes Blatt. Nicht ganz oben in der Mitte stand der Name, victor orcutt, in dezenten, serifenlosen Kapitälchen. Sonst war nichts im Briefkopf. Keine Adresse, keine Telefonnummer, keine Postleitzahl. Der Name war dunkelbraun gedruckt, in der Farbe von altem Mahagoni, und ich fuhr mit dem Daumen über die Buchstaben, um mich zu vergewissern, dass sie eingraviert waren. Die handschriftliche Nachricht, ebenfalls in dunkelbrauner Tinte, war schlicht, vielsagend und sogar höflich:
Lieber Mr. Dye,
ich werde Sie im Verlauf des Nachmittags (sagen wir gegen vier?) in einer Angelegenheit kontaktieren, die in unser beider Interesse sein dürfte. Ich hoffe, dass Ihr kurzer Aufenthalt im Letterman General Hospital für Sie sowohl behaglich als auch erbaulich war.
Mit freundlichen Grüßen
Victor Orcutt
Die Handschrift war tatsächlich Kalligrafie und so gut, dass das den Anschein von Affektiertheit beinahe aufwog. Es war eine saubere, kräftige Schrift, deren Auf- und Abstriche ohne überflüssige Kringel, Schnörkel oder Serifen auskamen. Der Stil war beflissen und seltsam ökonomisch, und ich fand, dass es Victor Orcutt einige Jahre intensiver Übung gekostet haben musste, um ihn zu vervollkommnen.
Ich warf den Brief auf einen Tisch, mixte mir einen Drink und trat ans Fenster, um die Ankunft der Nebelschwaden zu betrachten und mich bösen Gedanken über Carmingler, seine abgeriegelte Suite und seine Sicherheits-Boyscouts hinzugeben.
Sie hatten eine C-130 gechartert, um mich die etwa 8.000 Meilen nach San Francisco zu fliegen. Unterwegs hatte es nur eine Zwischenlandung zum Auftanken gegeben, in Honolulu, und selbst dort hatte ich das Flugzeug nicht verlassen dürfen. An Bord waren nur zwei Passagiere gewesen, Carmingler und ich, und Carmingler hatte mich um Mitternacht allein an der grauen, verfallenden Ruine von einem Gefängnis abgeholt, als ich entlassen wurde. Er hatte eine heiße Tweedjacke mit Lederflicken an den Ärmeln getragen und darauf bestanden, dass ich keine Zeit zum Umziehen hätte und die pyjamaähnliche graue Baumwolluniform anbehalten sollte, dieselbe, die ich drei Monate lang ununterbrochen getragen hatte.
An Bord der C-130 sagte ich ihm: »Ich habe Läuse.«
»Tatsächlich?«, sagte er. »Nun ja, ich nehme an, viele Leute haben die. In ein paar Stunden werden wir dafür sorgen, dass Sie sie loswerden. Bis dahin können Sie sich kratzen, wenn Sie wollen. Es stört mich nicht.«
Vom Honolulu International flogen wir zur Air-Force-Basis Hamilton; dort wartete ein privater Krankenwagen mit sorgsam geschwärzten Fenstern. Die Ambulanz sauste mit Carmingler und mir zum Letterman General Hospital, und ich durfte die abgeriegelte Suite nur verlassen, um den Zahnarzt aufzusuchen. Laut Carmingler wusste niemand, dass ich im Letterman General Hospital war. Und vielleicht wusste es wirklich keiner, außer Victor Orcutt. So viel zu Carminglers Sicherheitsmaßnahmen.
Auf dem langen Flug hatte er wenig gesagt, außer in Honolulu, wo wir auftankten und er solange seine Pfeife nicht rauchen konnte. »Es hat ein bisschen Ärger gegeben, wissen Sie«, sagte er.
»Wie schlimm?«
»Ziemlich schlimm, fürchte ich.«
»Und?«
Er nahm die kalte Pfeife lange genug aus dem Mund, um mir ein Lächeln zu gönnen, das er vermutlich für aufmunternd hielt. »Wir werden das schon geradebiegen. In San Francisco.«
»Wie schlimm?« fragte ich noch einmal.
Carmingler zog seine Fohlen-Nummer ab. Er stand ungeschickt auf, balancierte auf dem rechten Fuß und klopfte die Pfeife am Absatz seines angehobenen linken Schuhs aus.
»Es ist ziemlich schlimm«, sagte er und bückte sich zu der Pfeife, mit der er gegen seinen Schuh klopfte. »Eigentlich könnte es kaum schlimmer sein.«
4
Ich hatte seit mehr als einer Woche auf das Startsignal in Sachen Li Teh gewartet, als die kindische Nachricht eintraf und mich anwies, den Dorfstaatsmann zu chiffrieren. Übersetzt hieß das, ich sollte Li Teh einem Test mit dem Lügendetektor unterziehen. Trotz seines Abscheus vor fast allem Mechanischen, besonders vor Computern, grenzte Carminglers Glaube an Lügendetektoren ans Mystische. Es war jene Art von Glaube, die Geistliche gern tief und beständig nennen.
Ich befand, es müsse ein Komiteebeschluss gewesen sein. Vier oder fünf oder sogar sechs von ihnen, die um einen Tisch saßen und mit Bleistift auf ihre linierten gelben Notizblocks Männchen malten, während sie über Li Teh debattierten und ob er den Steuerzahlern 3.000 $ im Monat wert wäre. Natürlich hatte es den Misstrauischen gegeben, vielleicht einen alten Hasen, wahrscheinlicher jedoch einen neuen Jungen, der sich einen Namen machen wollte. Er dürfte einige Zeit den Radiergummi am oberen Ende seines Bleistifts zerkaut, besorgt dreingeblickt und dann die Frage gestellt haben, ob man Li Teh wirklich trauen konnte. Sie wissen schon. Wirklich. Wenn er schon bereit ist, den Doppelagenten zu spielen, könnte er dann nicht ebenso leicht Dreifachagent sein? Der junge Masterman könnte da an etwas dran sein, würde ein anderer von ihnen sagen und eine Augenbraue hochziehen, Merkmal des wahren Skeptikers.
Und Carmingler, der ruhig dasaß und an seiner alten Pfeife nuckelte, warf beiläufig ein, ganz als ob es ihn nicht ernsthaft bekümmerte, dass die Lügenmaschine, wenn man wirklich Bedenken wegen Li hätte, alles zu allseitiger Zufriedenheit klären könnte. Wenn Sie einverstanden sind, schicke ich Dye noch heute Nachmittag eine Nachricht. Dann dürften sie alle beifällig genickt haben, ausgenommen der nicht vertretene Li Teh, der alles platzen lassen konnte mit einer Abschiedsrede in seinem gewohnten Kreischton und gespickt mit ein paar ausgesuchten Zitaten des Vorsitzenden Mao. Und schon wären sechs Monate Arbeit zum Fenster hinausgeschmissen oder in die Tonne gekloppt oder sogar im Eimer, je nachdem, welches Klischee ich an diesem Tag verwenden wollte. Ich seufzte, nahm den Hörer ab und rief Joyce Jungroth an.
»Verbinden Sie mich bitte mit Shoftstall«, sagte ich.
»Das könnte eine Weile dauern«, sagte sie. Joyce Jungroth missbilligte extravagante Überseegespräche.
»Verbinden Sie mich einfach.«
Sie registrierte meinen Unterton und sagte: »Ja, Sir.« Mindestens dreimal pro Jahr nannte sie mich Sir. Während ich auf die Verbindung wartete, wählte ich eine andere Nummer, und als Li antwortete, sagte ich »hallo« auf Englisch und wechselte dann zu schnellem fließenden Mandarin. Ich weiß, dass es fließend war, weil ich kaum etwas anderes gesprochen hatte, bis ich fast sechs war.
»Es gibt eine Änderung bei den Plänen«, sagte ich.
»Sie haben meinen Antrag abgelehnt?«, sagte Li.
»Überhaupt nicht. Es ist lediglich so, dass die Versicherer eine sorgfältige Untersuchung verlangen, einen simplen Test, könnte man sagen.«
»Von solchen Tests habe ich schon gehört«, sagte Li.
Darauf möchte ich wetten, dachte ich. »Alles reine Routine.«
»Wo soll er stattfinden?«
Ich erwähnte den Insel-Stadtstaat, der etwa zweitausend Meilen südlich seiner Halbschwester Hongkong liegt.
»Ziemlich weit weg«, sagte Li. »Ich bin nicht sicher, ob ich überhaupt noch an der Police interessiert bin.«
»Sobald der Gutachter Sie gebilligt hat, gibt es einiges an zusätzlichen Boni.«
»Wann wird der Gutachter dort sein?«, fragte er.
»Morgen Abend gegen neun.«
»Wo genau?«
»Das ist noch nicht entschieden«, sagte ich. »Am Ticketschalter der Fluglinie wird aber eine Nachricht auf Sie warten.«
Es gab ein kurzes Schweigen, und ich konnte beinahe hören, wie Lis Gehirn, dieser Rechenschieber, die Vorzüge addierte und die Nachteile subtrahierte. Schließlich sagte er: »Ich gehe davon aus, dass Sie auch dort sein werden.«
»Angesichts der Höhe der Police wäre es leichtfertig von mir, nicht da zu sein.«
Weiterem Schweigen folgte ein leiser Seufzer. »Ich werde alles Nötige arrangieren«, sagte Li und legte auf.
Der Zufall, der im Grunde für alle Erfolge und Fehlschläge der Geheimdienste verantwortlich ist, hatte mich über Li Teh stolpern lassen. Ein in Peking stationierter kanadischer Journalist war Li einmal auf einer Cocktailparty in Hongkong begegnet. Mit einem ungewöhnlichen Gedächtnis für Namen und Gesichter gesegnet, war der Journalist neugierig geworden, als Li eines der verbotensten Regierungsgebäude in Peking betrat, der Verbotenen Stadt verbotener Gebäude. Er wartete zwei Stunden darauf, dass Li wieder auftauchte, aber als er dies nicht tat, notierte der Journalist Datum und Zeit. Unser Büro in Tokio zahlte dem kanadischen Journalisten regelmäßig eine kleine Pauschale, und als er ihnen routinemäßig über Li berichtete, hatten sie es ebenso routinemäßig an mich weitergeleitet.
Ich hatte ein bisschen herumgeschnüffelt, bis ich sicher war, dass es sich bei Li um einen Agenten handelte und seine persönlichen Finanzen nicht so üppig waren, wie sie schienen. Drohungen, ihn bloßzustellen, oder Appelle an seine Sorge um die Zukunft der Menschheit trafen entweder auf Feindseligkeit oder Gelächter, so dass ich beschloss, direkte Finanzhilfe wäre der verheißungsvollste Weg, und ich ging ihn so oft hin und her, dass ich fast begann, wie einer zu denken, der ich bestimmt nicht war: ein Lebensversicherungsvertreter mit guter Aussicht auf schnellen Abschluss einer Millionenpolice.
Nun, da ich ihn »gedoppelt« hatte, musste ich ihn zweitausend Meilen weit fliegen lassen und einem Test von zweifelhafter Gültigkeit unterziehen durch eine Maschine, die wahrscheinlich wegen der Luftfeuchtigkeit nicht mehr zuverlässig war. Ich erinnerte mich an meinen eigenen Lügendetektortest, den sie mit mir gemacht hatten, kurz bevor sie mich einstellten. Bloß für die Akten, hatten sie gesagt. Zuerst kam eine Menge harmloser Fragen: »Sind Sie heute Morgen mit dem Auto hergekommen? Hat die Sonne geschienen? Haben Sie gefrühstückt?« Alle mit ja oder nein zu beantworten. Dann schalteten sie einen Gang hoch: »Hatten Sie je eine homosexuelle Beziehung?« Ich hatte mit ja geantwortet.
Meine Antwort erschreckte sowohl den Techniker als auch die Maschine. Die Maschine sagte, ich löge, und der Techniker bestand darauf, die ganze Fragenliste nochmals durchzugehen, fünfmal, aber die Maschine sagte immer noch, dass ich löge.
»Hören Sie, Kumpel«, hatte der Techniker gesagt. »Die Kiste sagt, dass Sie bei dem Homodings lügen.« Ich weiß noch, dass in dem Jahr alle »-dings« benutzten.
»Dann funktioniert sie nicht. Ich hatte mal was, einvernehmlich. Ich war vier und mein Partner fünfeinhalb.«
»Ach Scheiße«, sagte der Techniker. »Sagen Sie einfach nein; mal sehen, was dann passiert.«
»Das wäre aber doch ’ne Lüge, oder?«
»Sagen Sie einfach nein. Mir zuliebe.«
Ich sagte nein, und die Maschine registrierte nichts, nicht einmal ein Zucken. »Vier Jahre«, murmelte der Techniker. »Lieber Himmel.«
Während ich darauf wartete, dass das Ferngespräch zustande kam, dachte ich über die neuen Assistenten nach, die Carmingler mir geschickt hatte. Bei mir nannte ich sie die zwei smarten Boys aus Illinois. Der erste, der sogenannte Detektorexperte, war Lynn Shoftstall aus Evanston. Der andere war John Bourland aus Libertyville. Beide hatten gerade das absolviert, was Carmingler als »unser neues internes Trainingsprogramm« bezeichnete, was lediglich bedeutete, dass man sie ganz unten billig anfangen lassen konnte, bis sich gezeigt hatte, ob sie es als Juniorspione packen würden. Ich hielt das Programm nicht für einen durchschlagenden Erfolg.
Carmingler hatte sie geschickt, um zwei meiner früheren Vertreter-Agenten zu ersetzen, erfahrene Leute; der eine war nach Tokio versetzt worden, eine Art Beförderung, und der andere war an einem unmöglich heißen Nachmittag in Bangkok aufgewacht, mit einem scheußlichen Kater, der neben anderen Gründen dazu führte, dass er sich sagte, zum Teufel mit allem, und den nächsten Flug nach Sydney nahm, wo er, wie es hieß, ein Buch schrieb. Ich hoffte, dass es ihm viel Geld einbringen würde.
Bourland war der Sprachbegabte und beherrschte sowohl Thai als auch Mandarin fließend. Shoftstall, als Sprachstudent längst nicht so gut, tatsächlich sogar kaum ausreichend, war ein Wunderkind in Sachen Technik. Mir wurde mitgeteilt, er wisse buchstäblich alles, was man über Geräte wie Telefonwanzen, Abhöranlagen für Räume und zahlreiche andere Miniaturwunder wissen konnte, von denen die meisten für Carmingler Teufelszeug und für mich Mysterien waren, wenn auch einige meinten, sie könnten nützlich sein. Shoftstall galt als Experte im Umgang mit Lügendetektoren, aber es spielte eigentlich keine Rolle, ob das stimmte oder nicht. Er hatte den einzigen verfügbaren Lügendetektor, und angeblich konnte nur er in Li Tehs Kopf lugen, indem er dessen Puls, die Atemfrequenz, die Menge Schweiß in den Handflächen und das Herzflimmern maß, während die Lügen so eilig über seine Zunge liefen, dass sie dabei über die eigenen kurzen Beine stolperten.
Mein Telefon klingelte und Joyce Jungroth teilte mir mit, die Verbindung mit Shoftstall sei hergestellt und er am Apparat.
»Was macht das Geschäft mit der Wahrheit heute?«, sagte ich, nachdem wir einander begrüßt hatten.
»Läuft bestens.«
»Morgen Abend«, sagte ich.
»Welches Thema?«
»Egal.«
»Wo?«
»Wie üblich«, sagte ich.
»Wir werden da sein.«
»Wie üblich« war ein Hotel, erbaut vor etwa hundert Jahren, als man Hotels noch mit schönen dicken Wänden baute. Es war weltbekannt, und da es nun auch klimatisiert war, machte es sogar dem neuen Hilton echte Konkurrenz.
»Sehen Sie zu, dass morgen Abend um neun alles klar ist.«
»Wollen Sie es permanent haben?«, fragte Shoftstall. Er meinte: auf Band aufgenommen.
»Ja«, sagte ich.
»So gut wie erledigt. Ah, übrigens«, sagte er, »ich habe ein paar Experimente mit einer neuen Art von …«
»Später«, sagte ich und legte auf.
Li und ich ignorierten einander auf dem Flug mit Philippine Airlines zum Insel-Stadtstaat, dessen chinesischer Premier, gewappnet mit Topnoten aus Cambridge, immer noch nach einer Formel suchte, die aus seiner winzigen Republik eine funktionierende, aufstrebende, blockfreie Gemeinschaft machen würde. Eine Nation konnte man sie kaum nennen.
Es war für Li und mich nicht schwer, einander zu ignorieren, denn Li flog erster Klasse, während ich mich mit der Touristenklasse begnügte, oder Economy, dem aktuellen Euphemismus zufolge. Nach der Landung hinterließ ich für Li eine Nachricht am Schalter der Airline. Darauf stand, wohin er sich begeben und wann er dort sein sollte. Ich nahm ein Taxi zu dem alten Hotel und ging eine breite Treppe hinauf in die erste Etage, wo Shoftstall und Bourland ein großes Zimmer gemietet hatten.
Mit 26 Jahren hatte John Bourland knappe zehn Kilo Übergewicht, was nicht so schlimm gewesen wäre, wenn sich nicht alles an seinem Wanst angesammelt hätte, der ihn wegen seiner kleinen Statur aussehen ließ, als ob er versuchte, unter dem Jackett einen Fußball zu verstecken. Bourland war es, der auf mein Klopfen hin öffnete und mich auf Mandarin begrüßte. Er schien immer noch verblüfft darüber zu sein, dass, wenn er den Mund öffnete, möglicherweise eine andere Sprache herauskäme.
»Bleiben Sie über Nacht?«, fragte Bourland.
»Nur wenn es sich nicht vermeiden lässt«, sagte ich.
»Wie geht’s Ihnen, Luci?«, sagte Shoftstall, der ausgestreckt auf dem Bett lag. Er war groß und hager und hatte einmal in der Abwehr eines erfolglosen Basketballteams im Nordwesten gespielt; als Elektroingenieur war er angeblich so etwas wie ein Überflieger, hatte aber für seine Abschlussprüfungen in Geschichte, Englisch und Politikwissenschaft einen Ersatzmann anheuern müssen. Ich versuchte, bei dem »Luci« nicht zusammenzuzucken, aber es gelang mir nicht. Das spielte keine Rolle, weil Shoftstall es nicht bemerkte. Er bemerkte überhaupt nicht viel, außer, es war mit einem Kabel versehen.
»Haben Sie alles vorbereitet?«, sagte ich.
»Wir haben’s im Büro komplett durchgecheckt. Perfekt.«
»Wer ist der Kandidat?«, fragte Bourland.
»Einfach ein Mann.«
»Soll ich Ihnen bei den Fragen helfen?«, sagte Bourland. Er drängte sich ein bisschen vor, dachte ich, und wieder einmal fragte ich mich, was man denen jetzt bei diesem internen Trainingsprogramm beibrachte. Nicht genug, wie es schien.
»Helfen Sie einfach mit den Apparaten«, sagte ich.
Shoftstall schwang seine langen Beine über die Bettkante und setzte sich auf, wobei er sich ausgiebig rekelte und gähnte. Der strebsame blauäugige Stolz unserer Nation, wie irgendwer geschrieben hat. Cummings, entschied ich. Oder cummings.
»Wann soll er hier sein?«, fragte Shoftstall und gähnte wieder.
»Gleich, wenn Sie es schaffen, wach zu bleiben.«
Drei Minuten später klopfte es an der Tür und ich öffnete. Li Teh kam schnell herein; seine Augen zuckten hin und her, während er Anwesende, Mobiliar und Gerätschaften katalogisierte und klassifizierte. »Das ist Mr. Jones«, sagte ich, ohne schlau sein zu wollen, nur sachlich. »Meine Mitarbeiter.«
Li nickte ihnen nicht einmal zu. »Fangen wir an«, sagte er auf Englisch.
Ich nickte Shoftstall zu, der zu einem Schreibtisch ging, auf dem der Lügendetektor in seinem grauen Metallbehälter stand. »Würden Sie bitte das Jackett ausziehen und die Ärmel aufrollen, Mr. Jones?«, sagte er. »Und dann setzen Sie sich bitte auf den Stuhl hier vor den Schreibtisch.«
Li zog die Jacke aus, faltete sie sauber zusammen und legte sie sorgfältig aufs Bett. Geziert, fand ich. Shoftstall fummelte herum, machte seine Geräte fertig und sonderte dabei unaufhörlich Geplapper ab, was wohl seiner Meinung nach den offensichtlich nervösen Li beruhigen sollte, ihn aber tatsächlich nur noch zappliger machte. Offensichtlich wollte Li nur, dass der amerikanische Trottel die Klappe hielt.
Ich ließ Shoftstall reden. »Der Zweck dieser Maschine, Mr. Jones, ist lediglich, Validität zu ermitteln. Das ist alles. Nicht mehr. Es tut nicht weh und es gibt absolut keinen Grund zur Besorgnis – Mr. Dye hier wird Ihnen nur ein paar einfache Fragen stellen, die Sie mit ja oder nein beantworten können. Das ist alles. Nur ja oder nein. Ehe Sie sich’s versehen, sind wir schon fertig.«
Li sagte nichts. Bourland stöpselte sein Tonbandgerät in den Stecker unter dem Schreibtisch. Shoftstall plapperte weiter, während er die Sensoren des Detektors an Lis Brust, Unterarm und Handfläche befestigte. »Wenn Sie jetzt nur den Stuhl ein bisschen hierhin drehen könnten – nach rechts«, sagte er. »Gut. Sehr schön so.«
»Wir haben den großen Verstärker mitgebracht«, sagte Bourland. »Ich dachte, Sie hätten’s gern in HiFi, und das Mikro fängt alles auf.«
»Gut«, sagte ich; eigentlich war es mir egal, ich wollte nur, dass die ganze trübe Szene so schnell wie möglich endete.
Shoftstall trat von Li zurück, als wollte er sein Werk bewundern. »Okay«, sagte er zu Bourland. »Sie können das Band starten.«
Bourland drehte einen Knopf am Aufnahmegerät, nahm ein paar Feineinstellungen vor und sagte: »Alles klar, Band läuft. Interview mit Mr. Jones.« Er blickte Shoftstall an. »Läuft.«
Shoftstall ließ sich auf Hände und Knie nieder und tastete nach dem Stecker des Detektors, der hinter dem Schreibtisch baumelte. Er schaute zu mir hoch. »Sobald ich einstecke, können Sie anfangen«, sagte er.
»In Ordnung.«
Er tastete wieder nach dem Kabel, fand es und steckte es in die Dose, die auch den Verstärker versorgte.
Die Blitze waren kobaltblau, glaube ich. Was auch immer die Farbe war, sie zuckten einen Meter weit ins Zimmer, zweimal, begleitet von einer Reihe stotternder, feucht klingender plops. Die Lichter im Raum starben sofort, aber Li Teh brauchte ein bisschen länger. Er schrie nur einmal. Es war kein besonders lauter Schrei, eher so etwas, was ein sterbendes Kätzchen von sich geben würde.
Ich tastete mich zu Li Teh hin und machte vor seinem Gesicht das Feuerzeug an. Die Augen waren geöffnet, aber er sah die Flamme nicht. Ich stand da und starrte ihn an, bis das Feuerzeug ausging. Shoftstall und Bourland tappten hin und her; sie fluchten und murmelten, während sie an den Geräten hantierten. Es kam mir so vor, als wären wir mit dem Toten lange Zeit im Dunkel, aber es dauerte nur ein paar Minuten, bis die Polizei an die Tür hämmerte und ich hinging, um aufzumachen, ehe sie sie aufbrachen.
5
Sie überließen es Carmingler, mir mitzuteilen, dass ich erledigt sei. Das sagte er, als wir im Letterman General Hospital etwa die Hälfte des Debriefings hinter uns hatten. Ich glaube nicht, dass es ihm Vergnügen machte, aber es bekümmerte ihn auch nicht. Eigentlich bekümmerte ihn gar nichts, außer wenn eines seiner Pferde an Krupp oder Atemrasseln litt oder was Pferde sonst noch an Krankheiten kriegen. Er saß da hinter einem grauen Metallschreibtisch in dem kahlen dunkelbraunen Raum und fummelte an seinem Phi-Beta-Kappa-Schlüssel herum, von dem die meisten glaubten, er sei aus Princeton – ein Irrtum, den Carmingler nie korrigierte –, der aber tatsächlich von der Louisiana State University stammte. Eins durfte man Carmingler jedenfalls zugutehalten: Er hatte seinen Bayou-Akzent abgelegt.
»Es ist natürlich ein Jammer«, hatte er gesagt. »Vor allem, da es nicht Ihr Fehler war. Absolut nicht Ihr Fehler. Aber ich bin sicher, Sie können unsere Position verstehen.« Wenn er subtiler gewesen wäre oder der irgendwann einmal absolvierte Sensibilitätskurs etwas bewirkt hätte, hätte Carmingler deren Position gesagt, nicht unsere. Ich ignorierte es.
»Nachdem die ihr erstes Dementi herausgegeben hatten, dass ja keiner von Ihnen zu denen gehört, tja, da ist es an uns kleben geblieben, fürchte ich.«
»Sie hätten es bereinigen können«, sagte ich; eigentlich war es mir gleichgültig, aber der Form halber war ich bereit, ein wenig zu argumentieren.
»Ich fürchte, nein.«
»Sie haben schon Schlimmeres bereinigt.«
Er runzelte die Stirn, ließ seinen Phi-Beta-Kappa-Schlüssel los und begann, mit seiner Pfeife zu hantieren. »Länger nicht mehr«, sagte er.
»Was ist mit den beiden anderen?«, sagte ich.
»Welche beiden anderen?«
»Diese Clowns, die Sie mir geschickt hatten. Shoftstall und Bourland.«
»Ach so, natürlich«, sagte Carmingler, als hätte ich gerade zwei gemeinsame Bekannte erwähnt, die wirklich nicht ganz in seine Gesellschaftskreise passten. »Für die gilt das Gleiche; allerdings sind wir da nicht ganz so freigiebig. Finanziell, meine ich.«
»Warum denn auch?«, sagte ich. »Die sind doch erst achtzehn Monate dabei. Ich elf Jahre, und wenn ich mich nach einem Job umsehe, kann ich ja einem möglichen Arbeitgeber schlecht erzählen, ich hätte die letzten elf Jahre mit Amnesie zugebracht.«
Carmingler war es endlich gelungen, die Pfeife anzuzünden, und er sog heftig an ihr. »Das stellt ein kleines Problem dar, und wenn es nicht die ganze Publicity gegeben hätte …«
»Mein Name ist nie genannt worden«, sagte ich.
»Natürlich nicht. Wohl aber der Name dieser Versicherungsgesellschaft. Minneapolis Mutual. Das werden die Leute noch wissen. Möglicherweise können wir die Sache etwas hinbiegen, ein paar Empfehlungsschreiben von dieser oder jener Firma, in denen steht, dass Sie für die gearbeitet haben. Etwas in der Art. Lassen Sie mich noch etwas darüber nachdenken.«
»Tun Sie das«, sagte ich und kam nie wieder darauf zurück, weil ich wusste, dass es sinnlos war.
Carmingler schielte auf seine Uhr. »Nun denn, ich glaube, das wäre alles für heute.«
»Nur eins noch«, sagte ich.
»Was denn?«
»Ich hoffe, diese elf Jahre, die ich für Sie gearbeitet habe, waren es wert.«
»Was wert?«
»Die Million Dollar, die Sie ausgegeben haben, um mich aus dem Gefängnis zu holen.«
Ich dachte über Carmingler nach (vielleicht war es auch ein Grübeln) und über die letzten drei Monate meines Lebens, als ich da in der sechzehnten Etage des Sir Francis Drake stand und zusah, wie der Nebel in die Stadt rollte. Auch bei geschlossenen Fenstern konnte ich das anachronistische Klirren der Kabelbahnen hören, wie sie die Powell Street hinauf- und hinabfuhren. Die Straßen waren noch zu sehen, aber die Bay Bridge war verschwunden. Noch ein paar Minuten, dann würde sich der Nebel für den Abend niederlassen, und mir bliebe zum Bewundern lediglich der Turm der Versicherungsgesellschaft, dessen elektrische Anzeige mir mitteilte, dass es draußen 18 °C und drinnen wie draußen 15:59 Uhr war. Ich prüfte meine neue Armbanduhr und stellte fest, dass der Turm richtig ging.
Das knappe Klopfen an meiner Tür erfolgte exakt um 16:02, dem Turm zufolge. Ich öffnete die Tür und er war jünger als erwartet, viel jünger.
»Mr. Dye«, sagte er mit einem durchaus angenehmen Lächeln. »Ich bin Victor Orcutt. Dürfen wir eintreten?«
Ich öffnete die Tür weiter und trat beiseite. »Natürlich«, sagte ich. »Kommen Sie rein. Wir können entweder eine Party veranstalten oder eine Runde Rubberbridge spielen.«