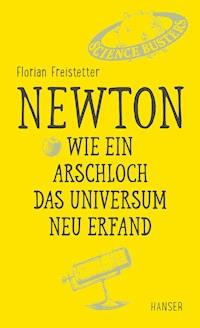Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Seit wenigen Jahren haben wir den Beweis: Es gibt sie, fremde Welten, auf denen ideale Bedingungen für die Entstehung von Leben herrschen. Dank der Erkenntnisse moderner Astrophysik erhöht sich die Wahrscheinlichkeit täglich, dass wir dieses Leben irgendwo dort draußen aufspüren. Florian Freistetter schildert, wie die moderne Astronomie erst lernen musste, das Unsichtbare zu sehen, um Supererden und Heiße Jupiter zu finden. Wie die fremden Welten beschaffen sein müssen, damit auf ihnen Leben entstanden sein kann – und wie wir mit Hilfe neuer Teleskope bald herausbekommen, wie Außerirdische wirklich aussehen. "Die Neuentdeckung des Himmels" ist die Chronik eines der größten Abenteuer der Menschheit: der Suche nach einer Antwort auf die Frage "Sind wir allein im Universum?".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Florian Freistetter
Die Neuentdeckung des Himmels
Auf der Suche nach Leben im Universum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches oder von Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – mit Ausnahme der in den §§ 53, 54 URG genannten Sonderfälle –, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
© 2014 Carl Hanser Verlag München
Internet: http://www.hanser-literaturverlage.de
Herstellung: Thomas Gerhardy
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, Dominic Wilhelm, unter Verwendung eines Fotos von © NASA
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
Bildnachweise:
Bild 1: Astrolabium planisphaerium/© akg-images/bilwissedition
Bild 2: Engraving Of Astronomical Telescope/© Bettmann/CORBIS
Bild 3: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Armillary_sphere.png
Bild 4: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Star-Spectroscope.jpg
ISBN 978-3-446-43878-1
E-Book-ISBN 978-3-446-43882-8
Für Fabian. Wir entdecken den Himmel noch gemeinsam.
Inhalt
Einleitung: Eine unendliche Geschichte
Teil I: Keine Planeten
Kapitel 1: Ist da draußen noch etwas? Religion vs. Wissenschaft
Kapitel 2: Das Unsichtbare sehen
Kapitel 3: Was ist ein Planet?
Kapitel 4: Zu viel unsichtbares Sternenlicht
Exkurs: Aliens auf der Suche nach uns
Teil II: Komische Planeten
Kapitel 5: Echte Planeten und tote Sterne
Kapitel 6: Unmögliche Planeten im Regenbogen
Kapitel 7: Migration und Supererden
Exkurs: Die Technologie der Aliens
Teil III: Viele Planeten
Kapitel 8: Ab in den Weltraum
Kapitel 9: Ein Universum voller Planeten
Exkurs: Die Sonne wird interessant
Teil IV: Bewohnte Planeten
Kapitel 10: Die Suche nach der zweiten Erde
Kapitel 11: Wo sind die Aliens?
Kapitel 12: Kontakt – wie man mit Außerirdischen kommuniziert
Exkurs: Angriff der Aliens
Die Neuentdeckung des Himmels: Das letzte Kapitel?
Dank
Einleitung:Eine unendliche Geschichte
„Sind wir alleine im All, oder ist irgendwo dort draußen noch jemand?“ Diese Frage stellen sich Menschen schon seit Jahrtausenden. Wann das erste Mal jemand zum Himmel gesehen und sich gefragt hat, ob dort oben noch andere Welten zu finden sind, wissen wir nicht. Aber spätestens die Philosophen im antiken Griechenland haben konkret darüber nachgedacht, ob unsere Welt die einzige ist und wir die alleinigen Bewohner des Universums sind. Das Interesse an dieser Frage wurde in den folgenden Jahrhunderten nicht geringer, aber die Antwort war außer Reichweite. Es gab keine Möglichkeit, über unsere Welt hinauszublicken. Die Menschen konnten nur spekulieren.
Erst seit wenigen Jahren haben wir konkrete Antworten gefunden. Nach mehreren Jahrtausenden können wir endlich mit Sicherheit sagen: Ja, es gibt dort draußen noch andere Welten! Und es wird vermutlich auch nicht mehr lange dauern, bis wir herausgefunden haben, ob wir die einzigen Lebewesen im Universum sind oder nicht.
Wir haben das große Glück, genau in der Zeit zu leben, in der diese lange Suche ihr Ende gefunden hat. Auf dem Weg zu einer Antwort mussten wir philosophische und religiöse Dogmen überwinden. Wir mussten zuerst lernen, wie unsere eigene Welt wirklich aussieht. Immer wieder mussten Weltbilder gestürzt werden, bis wir am Ende unseren Platz im Universum erkannt haben. Und auch dann standen wir noch vor der scheinbar unüberwindlichen Schwierigkeit, die unvorstellbar weit entfernten fremden Welten zu finden und zu beobachten. Wir mussten nicht nur lernen, auf eine neue Art zu denken und unsere Welt mit neuen Augen zu sehen, sondern auch neue Instrumente bauen, neue Techniken entwickeln und ganz neue Wissenschaften hervorbringen, um am Ende erfolgreich zu sein. Aber wir waren erfolgreich. Wir haben den Himmel neu entdeckt.
Dieses Buch erzählt die Geschichte der langen Suche nach der Antwort auf eine der fundamentalen Fragen der Menschheit. Die wissenschaftliche Erforschung der extrasolaren Planeten ist heute eines der aktivsten und spannendsten astronomischen Forschungsgebiete. Kaum ein Monat vergeht ohne neue und wichtige Entdeckungen. In den letzten paar Jahren haben die Erkenntnisse über die fremden Planeten unser Weltbild noch ein weiteres Mal verwandelt und unsere eigene Rolle im Universum völlig neu definiert.
Einem Universum, das in den letzten Jahrhunderten immer größer geworden ist. Bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts bestand es aus der Erde, der Sonne, dem Mond und ein paar hellen Punkten am Nachthimmel, die wenig mehr als der schöne Hintergrund für die gottgeschaffene Heimat der Menschen waren und kein eigenständiger Teil des Kosmos. Aber dann lernten wir, dass die Erde nur einer von mehreren Planeten ist, die unsere Sonne umkreisen, und dass die Lichtpunkte am Himmel ebenfalls Sonnen sind, die sich aber in großer Entfernung befinden. Und wir lernten, dass auch diese Sterne nicht das Ende sind. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckten wir, dass die Sterne, die wir nachts sehen können, eine Galaxie bilden, die nur eine von vielen ähnlicher Galaxien ist, die über den ganzen Kosmos verteilt sind. Im sichtbaren Universum befinden sich etwa 200 Milliarden Galaxien, und jede von ihnen besteht aus ungefähr 200 Milliarden Sternen. Dass sich dort überall auch Planeten befinden, wissen wir allerdings erst seit wenigen Jahren.
Ob es auf diesen Planeten Leben gibt, wissen wir aber nicht. Noch nicht. Die Macht der großen Zahlen ist zwar verlockend und es ist schwer zu glauben, dass unsere Erde der einzige Planet unter all den Milliarden Milliarden Planeten sein soll, auf dem Leben existiert. Aber Glauben ist nicht Wissen. Vielleicht ist Leben ein äußerst seltenes Phänomen: Wir wissen noch zu wenig über das Leben, und wir wissen noch zu wenig über die Eigenschaften der fremden Welten – wir haben sie ja gerade erst entdeckt. Aber mit jedem Tag lernen wir mehr und werden besser darin, die fernen Planeten zu beobachten. Die Suche ist noch nicht am Ende angelangt. Der modernen Astronomie stehen bald technische Möglichkeiten zur Verfügung, die sich unsere Vorfahren nicht einmal vorstellen konnten. Wenn es dort draußen irgendwo Leben gibt, dann werden wir es in den nächsten Jahrzehnten finden!
Oder sind wir es, die vielleicht bald gefunden werden? Sollten wir doch nicht alleine im All sein, dann ist möglicherweise irgendwer dort draußen gerade ebenfalls auf der Suche. Wenn es anderswo noch Lebewesen gibt, dann wollen sie vielleicht auch wissen, ob sie alleine im All sind. Wir sind dann die Aliens und werden vielleicht gefunden, bevor wir selbst fündig werden. Ein Teil des Buches beschäftigt sich daher in Exkursen auch mit der hypothetischen Suche der Aliens nach uns – und der Frage, ob es ihnen dabei besser oder schlechter ergehen würde. Ist es für uns leichter, gefunden zu werden, als selbst Leben zu finden? Und wollen wir überhaupt gefunden werden?
Die fremden Welten jedenfalls haben wir schon aufgespürt, und mittlerweile sind sie uns gar nicht mehr so fremd, wie wir anfangs dachten. Die lange und schwierige Suche nach anderen Planeten macht aber nur einen Teil der Neuentdeckung des Himmels aus. Denn die Suche nach Leben auf fremden Welten dauert immer noch an. Doch wir haben gute Chancen, sie bald zu einem Ende zu bringen. Der Erste, der sich nachweislich mit der Frage nach anderen Welten und außerirdischen Lebewesen beschäftigt hat, war der griechische Philosoph Leukipp im 5. Jahrhundert vor Christus. Heute, fast 2500 Jahre später, stehen wir kurz davor, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Sind wir allein im Universum?
TEIL I: KEINE PLANETEN
Kapitel 1: Ist da draußen noch etwas? Religion vs. Wissenschaft
Um nach extrasolaren Planeten suchen zu können, muss man erst einmal auf die Idee kommen, dass da draußen noch irgendetwas existiert. Wenn die Menschen nachts zum Himmel blicken, sehen sie heute genauso wie vor Tausenden Jahren nur jede Menge Lichtpunkte. Nichts deutet auf den ersten Blick darauf hin, dass einige davon Sterne sein könnten wie unsere Sonne oder Planeten wie unsere Erde. Es sind einfach nur Lichtpunkte, und es fällt schwer, in ihnen fremde Welten zu sehen.
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit extrasolaren Planeten ist gleichzeitig sehr alt und sehr jung. Sehr jung, weil es erst in den letzten Jahren möglich wurde, konkrete Informationen über diese Himmelskörper zu sammeln. Und sehr alt, weil sich die Menschen immer schon für die faszinierende Möglichkeit anderer Welten interessiert haben und sich nicht davon abhalten ließen, darüber nachzudenken, auch wenn sie keine Möglichkeit hatten, ihre Spekulationen zu überprüfen.
Der Weg von den ersten Gedanken über andere Welten bis hin zum aktiven und seriösen Forschungsgebiet, das die Suche nach Exoplaneten heute ist, war lang und mühsam. Denn früher waren die Lichtpunkte am Himmel eben noch nicht mehr als nur Lichtpunkte. Niemand wusste, was sie tatsächlich darstellten. Niemand wusste, in welcher Beziehung sie zur Erde stehen. Vor ein paar Tausend Jahren war das Universum der Menschen noch ziemlich klein. Aber vielleicht war gerade das der Grund, warum man schon damals intensiv über andere Welten nachdachte.
Aus heutiger Sicht erscheinen viele der damaligen Gedanken seltsam, absurd und manchmal sogar dumm. Und manche davon waren es sicherlich auch. Aber man darf nicht vergessen, wie anders die Welt damals war. Nicht nur die stoffliche Welt, die eine Welt ohne Technik und so gut wie ohne wissenschaftliche Instrumente war. Sondern auch die Welt in den Köpfen der Menschen, die von völlig anderen Vorstellungen dominiert war als heute. Wenn wir verstehen wollen, wie bedeutend und revolutionär die astronomischen Entdeckungen der letzten Jahre wirklich sind, lohnt sich ein Blick auf die Vergangenheit. Es ist ein Blick auf den ewigen Konflikt zwischen Glaube und Forschung, ein Blick auf Vorurteile und Vordenker, ein Blick auf jede Menge Irrwege und Sackgassen.
Für die Gelehrten im antiken Griechenland war die Frage „Ist da draußen noch etwas?“ eng mit einer anderen Frage verbunden: „Woraus besteht eigentlich alles?“ Genauso wie die Frage nach fremden Welten ist auch die Frage nach der fundamentalen Struktur der Materie eine, die die Wissenschaftler heute immer noch so stark beschäftigt wie die Menschen der Vergangenheit. Damals waren es Leukipp und Demokrit, die versuchten, den Dingen auf den Grund zu gehen. Im 5. Jahrhundert vor Christus stellten der Grieche Leukipp und sein Schüler Demokrit eine erste Theorie auf. Leukipp war der Meinung, dass die gesamte Welt aus Leere und aus Atomen besteht. Das klingt vertraut, denn genau so beschreiben wir auch heute den Aufbau der Materie. Sie besteht aus den Atomen der verschiedenen chemischen Elemente, die durch leeren Raum voneinander getrennt sind. Überraschend viel leeren Raum.
Alles das, was uns als so feste und undurchdringliche Materie erscheint, besteht in Wahrheit zum überwiegenden Teil aus Nichts. Ein Atom besteht aus einem Atomkern, der von einer Hülle aus ihn umkreisenden Elektronen umgeben ist.1 Würden wir auf die Größe eines Atomkerns schrumpfen, dann würden wir uns ziemlich einsam fühlen. Von der Elektronenhülle wäre weit und breit nichts zu sehen. Wir müssten mehr als 120 000 Schritte durch die Leere gehen, um vom Kern bis zum äußersten Rand des Atoms zu kommen. In der echten Welt würde das einem Spaziergang von 90 Kilometern entsprechen. Wir können uns ein Atom auch wie ein Fußballstadion vorstellen: In der Mitte des Feldes liegt eine Erbse, das ist der Atomkern. Die Elektronen kreisen irgendwo in den Zuschauerrängen herum, dazwischen ist leerer Raum.
Die „Festigkeit“, die wir spüren, ist nur der Effekt der elektromagnetischen Abstoßungskräfte zwischen den Elektronenhüllen der Atome. Wenn wir barfuß über den Boden laufen, berühren unsere Füße nicht wirklich den Boden. Beziehungsweise, es hängt davon ab, was man als „wirklich“ definiert. Die Elektronen in der Hülle der äußeren Atome, aus denen unser Fuß besteht, treffen auf die äußeren Elektronen der Materie, aus denen der Boden besteht. Elektronen sind elektrisch negativ geladene Teilchen, und genauso wie zwei Magnete gleicher Polung stoßen sich auch zwei Elektronen voneinander ab. Diese Abstoßung spüren wir als „fest“.
In Wahrheit ist die Sache noch etwas komplizierter. Wir wissen mittlerweile, dass auch die Atomkerne aus einzelnen Teilchen zusammengesetzt sind (den positiv geladenen Protonen und den nicht geladenen Neutronen), und selbst diese Teilchen sind wiederum aus anderen Bausteinen aufgebaut, den Quarks. Ob sie das Ende der Suche darstellen oder selbst wieder nur zusammengesetzt sind, wissen wir noch nicht. Auf der Suche nach dem Ursprung der Materie sind wir zwar schon ein großes Stück weiter als die alten Griechen, aber noch lange nicht am Ziel.
Leukipp machte vor 2500 Jahren jedenfalls den ersten Schritt. Er überlegte sich, was passiert, wenn man ein Stück Materie – zum Beispiel einen Holzscheit – immer weiter zerteilt. Man bekommt immer kleinere und kleinere Holzstücke, so lange, bis man irgendwann bei einem so kleinen Stück angelangt ist, dass eine weitere Teilung unmöglich ist. Dieses Ding nannte Leukipp das „Atom“, das unteilbare Kleinste. Das Universum war in Leukipps Vorstellung angefüllt mit den verschiedensten Atomen. Sein Schüler Demokrit führte diese Gedanken weiter. Auch er war der Meinung, dass es nichts gibt außer den Atomen und leerem Raum. Er stellte sich Atome in unterschiedlichen Formen vor: als Kugel, Würfel, Zylinder, Pyramide und so weiter. All diese Atome konnten sich auf die unterschiedlichste Art und Weise miteinander verbinden und so die verschiedenen Formen der Materie erzeugen.
Diese ganzen Atome bewegen sich in der Vorstellung von Demokrit ständig durch das Universum. Es gibt schwere und leichte Atome, große und kleine, und alle bewegen sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Dadurch kollidieren sie miteinander und ändern ihre Richtung. Es bilden sich verschiedene Ströme und Wirbel und ganz allgemein ein großes Durcheinander.
So soll nach Demokrit auch die Welt entstanden sein: Das ursprüngliche Universum war komplett mit durcheinanderwirbelnden Atomen angefüllt. Die Atome kollidierten miteinander und bildeten größere Brocken aus Materie, bis am Ende daraus die Erde entstand und alles, was sich auf ihr befand. Obwohl Demokrits Idee der Atome kaum etwas mit den heutigen Vorstellungen von Atomen zu tun hat, ist er mit diesem Modell doch erstaunlich nahe an der Wahrheit (siehe dazu Kapitel 3). Aber viel wichtiger sind die Folgerungen, die sich für Demokrit aus diesem Prozess ergaben: Warum sollte aus dem Gewusel der Uratome nur eine Welt entstehen? Wenn die Erde so entstehen konnte, dann konnte es doch auch noch andere Welten geben?
Im 4. Jahrhundert vor Christus führte Epikur die Gedanken Demokrits genauer aus. Er ging davon aus, dass es im Universum unendliche viele Atome gibt, aber nur eine endliche Anzahl an Elementen beziehungsweise Atomformen. Damit war auch die Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten nicht unendlich groß. Wenn also alles voll mit Atomen war, die wild durcheinander wirbelten und sich zu den immer gleichen Strukturen verbanden, dann musste es auch überall Welten geben. Sogar eine unendliche Anzahl von fremden Welten, wie Epikur meinte!
Epikur war Materialist. Er wollte die Welt ohne metaphysische oder religiöse Annahmen erklären. Für ihn war daher auch die Entstehung des Lebens kein willkürlicher Akt der Götter, sondern ein Resultat der Verbindung von Atomen. Und wenn das Leben so auf der Erde entstehen konnte, dann natürlich auch auf den vielen fremden Welten, die nach Epikur das Universum bevölkerten. Die Erde war im Kosmos der griechischen Atomisten also nicht nur nicht alleine, sondern auch die Menschen waren nur ein Volk unter vielen, die im Universum lebten.
Man darf sich die fremden Welten der Griechen aber nicht einfach nur als weit entfernte Planeten vorstellen. Im damaligen Weltbild war die Erde das Zentrum des Universums (wenn auch einige der griechischen Gelehrten schon vermuteten, dass sich die Erde in Wahrheit um die Sonne bewegt), und Sonne, Mond und Sterne bewegten sich auf Sphären aus Kristall, die die Erde wie die Schalen einer Zwiebel umgaben. Die Welt der Menschen war also ein abgeschlossener Kosmos, und die fremden Welten von Demokrit und Epikur waren ebensolche kompletten Welten, die von Sonne, Planeten und Sternen umgeben waren. Aus heutiger Sicht würden sie eher Paralleluniversen entsprechen als extrasolaren Planeten.
Diese ganz auf die Erde bezogene Vorstellung des Universums hat die Suche nach neuen Welten in den folgenden Jahrhunderten und Jahrtausenden nicht gerade vereinfacht. Die Erde stand im Mittelpunkt; sie und die Menschen, die auf ihr lebten, waren Sinn und Zweck der gesamten Schöpfung. Die Sonne, der Mond und die damals bekannten Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn waren nur helle Lichter am Himmel und genauso wie die Sterne im Wesentlichen Dekoration für den Nachthimmel beziehungsweise Symbole oder Manifestationen der Götter. Sie befanden sich nicht sehr weit entfernt von der Erde an ihren Schalen aus Kristall und drehten sich um sie herum. Für andere Welten war in diesem Kosmos schlicht und einfach kein Platz.
Das zeigt sich besonders gut an der Philosophie des Aristoteles. Aristoteles, der im Jahr 384 vor Christus geboren wurde, ist heute wahrscheinlich der bekannteste griechische Gelehrte und Philosoph. Auch er machte sich Gedanken über den Aufbau der Materie, kam dabei aber zu einem ganz anderen Ergebnis als Demokrit und Epikur. Aristoteles vertrat die Meinung, die wir auch heute noch meistens mit den alten Griechen verbinden: Er glaubte nicht an die vielen unsichtbaren Atome, sondern an nur vier grundlegende Elemente: Feuer, Wasser, Erde und Luft. Alles bestand für ihn aus verschiedenen Kombinationen dieser klassischen Bestandteile. Außerdem wohne jedem dieser Elemente eine bestimmte Bewegung inne. Jedes Element bewege sich zu seinem „natürlichen Ort“. Erde zum Beispiel sei schwer und immer bestrebt, sich in Richtung des Mittelpunkts der Erde zu bewegen. Deswegen fielen auch alle Dinge nach unten. Feuer dagegen sei leicht, und sein natürlicher Ort liege irgendwo oben, über dem Himmel. Darum strebe es auch immer von der Erde weg. Die Welt der vier Elemente reichte nur bis zum Mond. Alles darüber war nach der Auffassung des Aristoteles Teil der heiligen, göttlichen Welt, die von einem anderen Element dominiert wurde, dem Äther.
Aristoteles war nicht bereit, die Leere zu akzeptieren, die Demokrit mit seinen Atomen gefüllt hatte. Es durfte sie nicht geben, der Raum musste immer von etwas erfüllt sein, und im Kosmos war das eben der Äther. Die natürliche Bewegung des Äthers war kreisförmig. Deswegen bewegten sich auch alle Himmelskörper um die Erde herum. In diesem Universum konnte es nur eine einzige Welt geben, meinte Aristoteles. Wenn es da draußen noch eine zweite Erde gäbe, müsse sich dessen Element Erde ebenfalls zum Zentrum unserer Erde bewegen, denn diese sei ja ihr natürlicher Ort. Die Dinge würden dort also nach oben fallen. Beziehungsweise, unsere Erde müsste sich dann zum Zentrum der anderen Erde bewegen. Das erschien Aristoteles höchst absurd und widersprach auch seiner Erfahrung. Denn die Dinge fielen ja ganz offensichtlich in Richtung des Zentrums unserer Erde. Deswegen musste sie die einzige Welt sein, die existiert. „Es kann nicht mehr als eine Welt geben“, schrieb er in seinem Werk „Über den Himmel“.
Die Gedanken des einflussreichen Aristoteles sollten die Diskussion über fremde Welten für die nächsten Jahrhunderte bestimmen. Das gilt ganz besonders für die christliche Kirche, die viel auf das gab, was Aristoteles dachte. Die Debatte begann zwar mit Demokrit und Epikur, die probierten, die Welt mit Atomen zu erklären, ohne dabei auf das Wirken der Götter zurückgreifen zu müssen. Aber vor knapp 2000 Jahren kehrte Gott in die Debatte zurück und blieb dort fast bis zum heutigen Tag. Seitdem drehte sich alles um die Frage, zu was Gott fähig ist und zu was nicht.
Wie wenig die Kirche von der Vorstellung anderer Welten hielt, zeigte sich schon Anfang des 3. Jahrhunderts. Da schrieb der Kirchenvater Hippolyt von Rom (der erste Gegenpapst der Geschichte, Schutzheilige von Pferden und Gefängniswärtern sowie Namenspatron der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten) ein Buch mit dem Titel „Widerlegung aller Häresien“. Darin zählte er all das auf, was der Meinung der Kirche widersprach, und angesichts der noch recht jungen Kirche war das eine überraschend lange Liste. Hippolyt war auch nicht zimperlich oder zurückhaltend mit seiner Kritik, was deutlich wird, wenn man sich ein paar der Überschriften ansieht, die seine Widerlegungen einleiteten. Er schrieb zum Beispiel von den „Faseleien des Monoimos“, dem „Wahnsinn des Markion“, dem „Unsinn des Karpokrates“ oder der „gotteslästerlichen Torheit des Noetus“. Auch mit Demokrit war Hippolyt so überhaupt nicht zufrieden. Er war empört, weil überliefert wurde, dass Demokrit ein Mann gewesen war, der gerne lachte; vor allem aber störte Hippolyt die Behauptung Demokrits, es gäbe mehrere Welten, die überall entstehen und wieder vernichtet werden können:
„Er lehrt, dass sich die Dinge ständig im Leeren bewegen, dass es zahllose, verschieden große Welten gebe; in einigen Welten gebe es weder Sonne noch Mond, in anderen hätten sie einen größeren Umfang, in wieder anderen seien sie mehrfach vorhanden. Die Abstände der Welten voneinander seien ungleich, bald größer, bald kleiner; die Welten seien zum Teil im Wachsen, zum Teil stünden sie auf dem Höhepunkt, zum Teil seien sie am Vergehen, hier bildeten sich solche, dort verschwänden sie; ein Zusammenstoß vernichte sie.“
Auch Filastrius, der sechste Bischof der italienischen Stadt Brescia, ärgerte sich im 4. Jahrhundert über die Häresie, „die besagt, dass es unendlich und unzählbar viele Welten gibt“, und über die „leere Meinung mancher Philosophen“. Die Bibel spricht nur von der Entstehung einer einzigen Welt, daher könne es auch nur eine Welt geben. Diese Meinung herrschte in der frühen Kirche vor, es gab nur wenige, die sich trauten, etwas anderes zu behaupten. Einer von ihnen war der Gelehrte Origenes, der im 3. Jahrhundert in Alexandrien lebte. Er dachte darüber nach, was Gott wohl gemacht hatte, bevor er die Erde erschuf. Er habe sicherlich nicht faul auf seiner Haut gelegen, so etwas würde nicht zum allmächtigen Wesen Gottes passen. Viel wahrscheinlicher sei es, dass er davor eine andere Welt erschaffen hatte und davor wieder eine andere. Und wenn unsere eigene Welt irgendwann nicht mehr existiere, würde Gott sicherlich nicht einfach in Rente gehen, sondern weiter Welten schaffen. Nach Origenes war die Erde zwar tatsächlich die einzige Welt im Universum – aber nur eine in einer Reihe von vielen, die nacheinander von Gott geschaffen wurden.
Die Frage nach dem, was Gott kann und will oder nicht kann und nicht will, beschäftigte die christlichen Gelehrten weiterhin. Aber bei all der Theologie war die grundlegende Frage nach dem „Ist da noch etwas?“ immer noch so faszinierend, wie sie es für die alten Griechen war. Der deutsche Bischof Albertus Magnus schrieb im 13. Jahrhundert: „Ob es nur eine Welt oder viele Welten gibt, ist eine der erstaunlichsten und nobelsten Fragen über die Natur. Es ist eine Frage, die der menschliche Geist aus sich selbst heraus verstehen will. Deswegen ist es wünschenswert, dass wir uns darüber Gedanken machen.“ Diese Gedanken machte sich Albertus auch, allerdings bestanden sie in seinem Fall aus einer Wiederholung der Gedanken von Aristoteles und dem Schluss, dass unsere Welt die einzige sei.
Albertus Magnus ist es auch zu verdanken, dass die Lehren des Aristoteles Teil des christlichen Weltbildes wurden. Der „Heide“ Aristoteles war bis dahin von vielen eher skeptisch betrachtet worden. Albertus aber setzte sich stark für die aristotelischen Lehren und ihre Aufnahme in die christliche Philosophie ein. Das sollte die Debatte um die fremden Welten stark beeinflussen. Man war immer mehr davon überzeugt, dass es keine fremden Welten geben konnte, sondern nur die Erde. Das dachte auch einer der einflussreichsten christlichen Theologen und Gelehrten des Mittelalters, Thomas von Aquin. Er argumentierte, dass es nur einen Gott gibt, der perfekt ist, und er deswegen auch nur eine Welt geschaffen hat, die Gottes Perfektion widerspiegelt.
Die Debatte zwischen den Befürwortern und Gegnern der Existenz fremder Welten war gleichzeitig eine zwischen Wissenschaft und Religion. Leukipp, Demokrit und Epikur verzichteten noch auf religiöse Argumente und versuchten die Frage mit dem zu beantworten, was sie über die Natur und die Welt zu wissen glaubten. Für die christlich geprägte Welt des Mittelalters war klar, dass die Frage nicht ohne Rückgriff auf Gott beantwortet werden kann. Ob es neben der Erde noch andere Welten geben kann oder nicht, hing für sie einzig davon ab, zu was Gott fähig und was sein Wille ist. Die Theologen beantworteten die Frage also mit dem, was sie über Gott und seinen Willen zu wissen glaubten.
Zur damaligen Zeit waren beide Ansätze zum Scheitern verurteilt. Denn die Gelehrten hatten schlicht und einfach nicht die Möglichkeit, genug über die Welt herauszufinden, um die Frage nach der Existenz fremder Welten auf wissenschaftlichem Weg zu beantworten. Und theologische Spekulationen sind erst recht ungeeignet, um irgendetwas über die reale Welt zu lernen. Der französische Bischof und Philosoph Nikolaus von Oresme erkannte das Dilemma schon im 14. Jahrhundert und war der Meinung, wir sollten aufhören zu raten, ob irgendetwas so ist oder nicht ist, wenn denn keine ausreichenden Daten zugrunde liegen. Damit hatte er natürlich vollkommen recht. Wissenschaft ohne Daten ist reine Spekulation und führt selten zu etwas. Aber die Frage, ob es dort draußen vielleicht noch andere Welten gibt, vielleicht sogar Welten, auf denen andere Lebewesen existieren, war zu faszinierend, um sie einfach fallen zu lassen.
Heftig spekuliert hat im 15. Jahrhundert der berühmte deutsche Philosoph und Theologe Nikolaus von Kues. Mittlerweile war man dazu übergegangen, sich nicht nur Gedanken über die Erde und eventuelle andere Erden zu machen, sondern auch über die Sterne. Was war der Unterschied zwischen Himmelskörpern wie der Erde und der Sonne? Warum leuchtete die Sonne so hell, warum die Sterne in der Nacht und die Erde nicht? Nikolaus von Kues vermutete, dass es in Wahrheit keinen Unterschied zwischen den Himmelskörpern gibt. Die Sonne stellte er sich genauso wie die Erde vor. In seinem Buch „Die gelehrte Unwissenheit“ schrieb er 1440:
„Betrachtet man nämlich den Körper der Sonne, dann besitzt er in der Mitte etwas, das der Erde gleicht und im Umkreis etwas Lichthaftes, das Feurige, und dazwischen eine Art Wasserwolke und klarere Luft; er besitzt dieselben Elemente wie die Erde.“
Die Sonne sei also ein Planet wie die Erde, jedoch von einer Schicht aus leuchtenden Wolken umgeben, und deswegen könnten wir nicht auf ihre Oberfläche blicken, sondern nur den hellen, strahlenden Ball am Himmel sehen. Könnten wir die Erde vom Weltall aus betrachten, würden wir nach Nikolaus von Kues ebenfalls eine leuchtende Kugel sehen, denn auch sie besitze eine sie einhüllende Schicht aus leuchtenden Wolken, die wir vom Erdboden nicht wahrnehmen können. Für Nikolaus von Kues folgt daraus, dass alle Sterne am Himmel Planeten wie die Erde sein könnten. Jeder einzelne der leuchtenden Punkte in der Nacht sei eine Welt wie die unsere, die von leuchtenden Wolken umgeben ist. Und jede dieser Welten könnte auch bewohnt sein. Der Charakter der Bewohner sei vom Himmelskörper geprägt, meine Nikolaus von Kues. Die Bewohner der hellen Sonne seien spirituell erleuchtet, die Bewohner des Mondes dagegen eher verrückt (Aristoteles war der Meinung, das Licht des Mondes könnte bei bestimmten Menschen Geisteskrankheiten verursachen).
Aber obwohl Nikolaus von Kues sich mit seinen Gedanken über die Existenz fremder Welten gegen die vorherrschende Meinung stellte, war er davon überzeugt, dass die Erde etwas Besonders ist. Sie war der „nobelste“ und „perfekteste“ Ort im Kosmos, und es war für ihn unvorstellbar, dass es anderswo Welten geben könnte, die besser wären als unsere. Aber auch er stellte fest, das niemand genau wissen kann, ob es all diese Welten wirklich gibt. Kein Mann könne darüber Bescheid wissen, „wenn er nicht speziell von Gott instruiert wird“, war seine abschließende Meinung.
Gott aber hielt sich – so wie in den Jahrtausenden zuvor – aus der Debatte heraus und wollte immer noch nicht verraten, ob er nun nur eine Welt erschaffen hatte oder mehrere. Dafür begannen nun endlich die Menschen, das Universum besser zu verstehen, vor allem deswegen, weil sie sich endlich von den religiösen Vorstellungen und Dogmen zu lösen begannen und die Antworten durch die Beobachtung der Natur zu geben versuchten.
Die große Revolution, an deren Ende sich die Welt – zumindest in den Köpfen der Menschen – komplett verändert haben sollte, begann mit Nikolaus Kopernikus. In seinem 1543 veröffentlichten Buch „De Revolutionibus Orbium Coelestium“beschrieb er einen Kosmos, in dem die Sonne im Zentrum stand und nicht die Erde. Die Erde war ein Planet, der sich um die Sonne drehte, und nicht anders herum. Die Idee war nicht neu. Schon fast 2000 Jahre zuvor berechnete der griechische Gelehrte Aristarch von Samos aus seinen Beobachtungen, dass die Sonne viel größer sein musste als die Erde. Er kam zu dem Schluss, es sei plausibler, dass die kleine Erde die große Sonne umkreiste, und nicht umgekehrt. Aber seine Meinung setzte sich nicht durch. Schuld war wieder Aristoteles.
Die Vertreter eines heliozentrischen Weltbildes mit der Sonne im Zentrum mussten sowohl bei den alten Griechen als auch im christlichen Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit gegen die Religion ankämpfen. Die Vorstellung einer Erde, die nicht das Zentrum des Universums war, stand den religiösen Lehren entgegen. Auch die Nachfolger des Kopernikus gerieten noch in Konflikt mit der Kirche. Martin Luther zum Beispiel war ein ausgesprochener Gegner der kopernikanischen Ideen und sagte dazu: „Dieser Dummkopf möchte die gesamte Kunst der Astronomie verdrehen. Jedoch hat das heilige Buch uns erklärt, dass Josua die Sonne und nicht die Erde bat, still zu stehen.“ Die Bibel war das Maß aller Dinge, wenn es darum ging, die Welt zu erklären.
Trotzdem konnte niemand leugnen, dass das kopernikanische Weltbild deutlich einfacher und eleganter war als das alte geozentrische Weltbild, das vor allem auf den Arbeiten des griechischen Gelehrten Claudius Ptolemäus basierte. Um die Bewegung der Sterne und Planeten zu erklären, hatte er sich eine komplizierte Mechanik ausdenken müssen. Die simple Idee, dass sich Sonne, Mond und Planeten auf Kreisbahnen um die Erde bewegen, konnte nicht funktionieren, denn die Planeten laufen mal schneller und mal langsamer, manchmal scheinen sie sich sogar ein Stückchen rückwärts über den Himmel zu bewegen.2 Die Planeten des Ptolemäus bewegten sich entlang von kreisförmigen Bahnen, deren Mittelpunkt sich aber selbst auch bewegte und nicht mit dem Mittelpunkt der Erde übereinstimmte. Und auch an diesen Kreisbahnen musste Ptolemäus lange herumbasteln, sie verschieben, verformen und verändern, um sein Modell halbwegs mit der beobachteten Realität in Einklang zu bringen.
Das Modell des Kopernikus vereinfachte die Sache enorm und schaffte mit einem Schlag die verschachtelten Kreisbahnen ab. Allerdings verlor die Erde ihren prominenten Platz im Universum. Für die Frage nach der Existenz anderer Welten ergaben sich daraus aber interessante Konsequenzen. Wenn die Erde nur mehr ein normaler Planet war, der die Sonne umkreiste, konnten doch auch die vielen Sterne helle Sonnen sein, die ebenfalls von Planeten umkreist werden?
Die Kirche aber war nicht geneigt, sich dieser Meinung anzuschließen. In der Bibel stand nichts davon, dass die Erde sich um die Sonne bewegt. In der Bibel stand auch nicht, dass Gott andere Welten erschaffen hatte. Philipp Melanchthon, ein Zeitgenosse Martin Luthers und mit ihm einer der großen Reformatoren, verwarf die Idee fremder Welten komplett. Der Sohn Gottes sei einzig und allein auf unserer Erde geboren und gestorben, erklärte er. Der Konflikt zwischen der Kirche und ihren Kritikern spitzte sich Ende des 16. Jahrhundert zu: Der italienische Philosoph und Astronom Giordano Bruno wurde am 17. Februar 1600 als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Grund dafür waren unter anderem seine unkonventionellen Gedanken über fremde Welten.
Bruno war der Meinung, dass ein allmächtiger und unendlicher Gott nur ein unendliches Universum habe erschaffen können. Dieses unendliche Universum sei von einer Vielzahl an Welten erfüllt: „Es gibt unzählige Sonnen und unendlich viele Erden, die sich um diese Sonnen bewegen, genau so wie die sieben,3 die sich um unsere Sonne bewegen.“ Wir können diese Planeten nur deswegen nicht sehen, weil sie viel zu klein und die Sterne viel zu weit entfernt sind. Bruno vermutete auch, dass unsere Sonne noch von weiteren Planeten umkreist wird, die zu weit entfernt, zu klein oder zu dunkel seien, um von uns gesehen zu werden. Wie sich im Laufe der Jahrhunderte herausstellen sollte, hatte er mit all diesen Aussagen recht. Die Kirche allerdings interessierte sich viel mehr dafür, dass in Brunos auch zeitlich unendlichem Universum kein Platz für ein Jüngstes Gericht und damit auch kein Platz für das Jenseits und das Reich Gottes war. Er wurde wegen Ketzerei angeklagt, verurteilt und hingerichtet. Es dauerte bis zum 12. März 2000, bis sich die katholische Kirche unter Papst Johannes Paul II. offiziell dazu bekannte, dass dieses Urteil Unrecht war.
Der Beginn des 17. Jahrhunderts war aber auch noch in anderer Hinsicht ein Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Zu dieser Zeit tauchte das erste wissenschaftliche Gerät auf, das es den Forschern erlaubte, den Bereich der Spekulation zu verlassen und neue Daten über das Universum zu sammeln: das Teleskop. Der niederländische Brillenmacher Hans Lipperhey baute im Jahr 1608 das erste Fernrohr, ein Jahr später richtete es der italienische Wissenschaftler Galileo Galilei als erster Mensch auf den nächtlichen Himmel und veränderte damit die Welt: Man konnte endlich Wissenschaft betreiben und auf die Vermutungen darüber verzichten, was Gott kann und was nicht.
Es würde zu weit führen, hier die kompletten wissenschaftlichen Leistungen Galileos aufzuzählen. Seine Beobachtungen mit dem Teleskop waren in vielen Bereichen revolutionär. Seine Beobachtungen der Venus zum Beispiel zeigten, dass das alte Weltbild des Ptolemäus nicht korrekt sein konnte.4 Er sah aber noch viel mehr. Das Teleskop ließ ihn Dinge sehen, die vorher niemand zu Gesicht bekommen hatte.
Schon der erste Blick auf den nächtlichen Himmel zeigte Galileo, dass viel mehr Sterne existierten, als man mit bloßem Auge sehen konnte. Ihr Großteil war den Menschen bis dahin verborgen gewesen. Diese Erkenntnis war für viele religiöse Zeitgenossen Galileos schwer zu akzeptieren. Warum sollte Gott Sterne erschaffen, die mit dem ebenfalls gottgeschaffenen Auge nicht zu sehen sind? Anfangs wollten sie Galileos Beobachtungen nicht akzeptieren, sondern hielten sie für optische Täuschungen, die im Teleskop erzeugt wurden.
Wie wenig man bereit war, den eigenen Augen und dem neuen technischen Gerät zu vertrauen, zeigt ein Briefwechsel zwischen Galileo und dem Kardinal Giacomo Muti. Galileo berichtete von einer weiteren Entdeckung, die er gemacht hatte: Im Teleskop war deutlich zu sehen, dass der Mond keine perfekte Kugel war, wie man bisher dachte. Dort existierten Berge und Täler wie auf der Erde. Muti wollte das nicht glauben. Die Berge, so argumentierte er, seien auf der Erde speziell von Gott geschaffen worden, damit Menschen und Tiere von den unterschiedlichen Lebensräumen profitieren können. Wenn es auch am Mond Berge gebe, dann müsse es dort ebenfalls Lebewesen geben, für die diese Berge geschaffen wurden. Es könne aber nur auf der Erde Leben geben. Deswegen sei es unmöglich, dass es auf dem Mond Berge gibt. Galileo müsse sich getäuscht haben.
Galilei beharrte auf seiner Beobachtung: Berge müssten nicht zwangsläufig für Lebewesen geschaffen worden sein, es sei außerdem unwahrscheinlich, dass es auf dem Mond Lebewesen gäbe. Immerhin dauere ein Mondtag fast 30 Erdtage. Es ist also immer 15 Tage am Stück hell und dann wieder 15 Tage am Stück dunkel. Das schien für Galilei keine besonders gute Umgebung für Leben zu sein. Außerdem konnte er in seinem Teleskop keine Spur von Seen, Meeren oder Flüssen entdecken; das fehlende Wasser war ein weiteres Argument gegen einen bewohnten Mond.
Die vielleicht beeindruckendste Entdeckung Galileos waren aber die vier kleinen Himmelskörper, die den Planeten Jupiter umkreisten. In seinem Teleskop konnte er sie deutlich erkennen und ebenso deutlich beobachten, wie sie sich weder um die Erde noch um die Sonne drehten, sondern um den Jupiter. So wie die Erde hatte also auch der Jupiter Monde. So wie die Erde hatte auch der Erdmond Berge und Täler. Die Objekte im All waren bei näherer Betrachtung also keine perfekten „göttlichen“ oder „himmlischen“ Welten. Die Erde verlor langsam ihren besonderen Status. Und dann waren da noch die vielen neuen Sterne, die man im Teleskop sehen konnte. Wenn die Sterne also Sonnen waren und ebenfalls von Planeten umkreist wurden, musste es im Universum sehr, sehr viele Planeten geben. Galileos Beobachtungen machten die Existenz fremder Welten wahrscheinlicher als je zuvor, und es waren erstmals tatsächlich Beobachtungen, auf denen diese neue Sicht der Dinge beruhte.
Galileos Schaffen bildete den Beginn der modernen Astronomie; eigentlich den Beginn der modernen Naturwissenschaft. Man wollte nicht mehr über die Motivation irgendwelcher Götter spekulieren, sondern die Welt anhand konkreter Beobachtungen erforschen. Aber der Übergang war nicht einfach, und keiner zeigt diesen Zwiespalt besser als der große Astronom Johannes Kepler.
Im gleichen Jahr, in dem Galileo seine ersten Beobachtungen mit dem Teleskop anstellte, veröffentlichte Kepler sein Buch „Astronomia Nova“. Darin begründete er eine völlig neue Astronomie. Jahrelang hatte er die Beobachtungsdaten seines Lehrers, des dänischen Astronom Tycho Brahe ausgewertet. So konnte er schließlich das Weltbild des Nikolaus Kopernikus entscheidend verbessern. Denn obwohl es viel einfacher war als das alte ptolemäische Modell, war es doch immer noch recht ungenau und stimmte nicht mit den Beobachtungsdaten überein. Auch Kopernikus hatte es nicht geschafft, sich völlig von den alten Dogmen zu lösen. Er glaubte, die „himmlischen“ Körper müssten sich auf perfekten Bahnen bewegen – und nichts war perfekter als der Kreis.
Kepler erkannte, dass das falsch war. Die Bahnen der Planeten waren oval: Ellipsen und keine Kreise. Die Planeten sind der Sonne manchmal ein wenig näher und dann wieder ein wenig weiter von ihr entfernt. Er erkannte außerdem, dass sich die Planeten nicht immer mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen, sondern schneller werden, wenn sie sich der Sonne nähern. Und schließlich entdeckte er noch einen mathematischen Zusammenhang zwischen dem mittleren Abstand eines Planeten von der Sonne und der Zeit, die er für einen Umlauf braucht. Das sind die drei berühmten Keplerschen Gesetze. Zum ersten Mal hatte man ein mathematisches Modell, mit dem sich die Bewegung der Himmelskörper äußerst exakt (zumindest für die damalige Zeit) vorhersagen ließ. Ein paar Jahrzehnte später lieferte der große Wissenschaftler Isaac Newton die theoretische Basis für Keplers Gesetze: Mit seiner Formel für die Gravitationskraft konnte er erklären, warum sich die Planeten genau so bewegten, wie Kepler es beschrieben hatte.
Keplers Arbeit revolutionierte die Astronomie und stellte sie auf eine völlig neue Basis. Trotzdem konnte sich Kepler nicht ganz von den alten Vorstellungen lösen. Er schrieb zwar im Vorwort zur „Astronomia Nova“, dass es sich ausdrücklich um ein astronomisches Werk handele, das mit Astrologie nichts zu tun habe. Bei der Interpretation von Galileos Entdeckung der Jupitermonde griff Kepler aber doch wieder auf astrologische und religiöse Argumente zurück und spekulierte über die Motivation hinter der Schöpfung der Welt: So wie unser Mond für die Astrologie der Menschen eine Rolle spiele, müssten die vier neu entdeckten Monde des Jupiters für die Astrologie der Jupiterbewohner wichtig sein. Außerdem könne man vom Jupiter aus ferne und kleine Planeten wie Merkur oder die Erde kaum sehen und sie daher nicht in Horoskopen verwenden. Die Jupitermonde seien der Ausgleich für diesen Mangel, deswegen müsse der Jupiter auch bewohnt sein.
Auch für Kepler mussten die Himmelskörper einen bestimmten Zweck erfüllen. Die Planeten konnten nicht einfach sein; ihre Existenz musste durch die Rolle gerechtfertigt werden, die sie für bewusste und gottgeschaffene Lebewesen spielen. Und auch Kepler war davon überzeugt, dass unsere Welt, die Erde, von allen Welten die beste und perfekteste war.5 Er war sich allerdings bewusst, dass er nur spekulierte: „Es ist schwierig, dieses Rätsel zu lösen, weil wir noch nicht alle nötigen Informationen haben.“
In den folgenden Jahrhunderten sammelte man sie. Und genau wie die ersten Daten, die Galileo mit seinem Teleskop gewann, waren es Informationen, die bei vielen Menschen ein unbehagliches Gefühl hervorriefen.
Wenn wir heute an das Weltall denken, kämen wir nie auf die Idee, das All als „klein“ zu bezeichnen. Das Weltall ist groß, es ist sehr groß, es ist unvorstellbar groß. „Der Weltraum. Unendliche Weiten“: So wie im Intro der Fernsehserie „Raumschiff Enterprise“ ist das All für uns heute größer als alles, was wir uns vorstellen können.