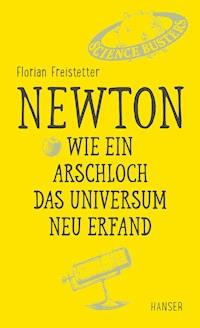Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Vom Urknall über den Stern von Bethlehem zur GAIA-Mission: Florian Freistetter nimmt uns in 100 Sternengeschichten mit auf eine Reise durch den Kosmos.
Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Mehr, als man sich vorstellen kann – und alle erzählen sie eine Geschichte über das Universum. Dank Gamma Draconis wissen wir, dass die Erde sich um ihre Achse dreht, und 61 Cygni hat uns verraten, wie groß der Kosmos ist. Die Sterne nehmen uns mit auf die Suche nach außerirdischem Leben, sie erklären uns, wie schwarze Löcher funktionieren und warum die Dinosaurier ausgestorben sind. Sie zeigen, wie wir durch den Weltraum reisen und andere Planeten besiedeln können. Florian Freistetter erzählt die Geschichte des Universums anhand von 100 Sternen – und erschließt in 100 kurzweiligen Kapiteln nicht weniger als die Vergangenheit und die Zukunft des Kosmos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Vom Urknall über den Stern von Bethlehem zur GAIA-Mission: Florian Freistetter nimmt uns in 100 Sternengeschichten mit auf eine Reise durch den Kosmos.Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Mehr, als man sich vorstellen kann — und alle erzählen sie eine Geschichte über das Universum. Dank Gamma Draconis wissen wir, dass die Erde sich um ihre Achse dreht, und 61 Cygni hat uns verraten, wie groß der Kosmos ist. Die Sterne nehmen uns mit auf die Suche nach außerirdischem Leben, sie erklären uns, wie schwarze Löcher funktionieren und warum die Dinosaurier ausgestorben sind. Sie zeigen, wie wir durch den Weltraum reisen und andere Planeten besiedeln können. Florian Freistetter erzählt die Geschichte des Universums anhand von 100 Sternen — und erschließt in 100 kurzweiligen Kapiteln nicht weniger als die Vergangenheit und die Zukunft des Kosmos.
Florian Freistetter
Eine Geschichte des Universums in 100 Sternen
Carl Hanser Verlag
Eine Geschichte des Universums in 100 Sternen
Reichen 100 Sterne für eine Geschichte des ganzen Universums? Nein — der Kosmos ist sehr viel größer, als wir es uns vorstellen können, und er enthält eine ebenso unvorstellbar große Anzahl von Sternen. Wie viele es tatsächlich sind, ist das Thema einer der 100 Geschichten dieses Buchs, die zusammengenommen eine der vielen möglichen Geschichten des Universums erzählen.
Dieses Buch soll kein reines Inventar des Kosmos sein. Natürlich erfährt man alles über Sterne, Galaxien, Planeten und all die anderen Himmelskörper und Phänomene, denen man im Universum begegnen kann. Wir werden auf Sterne treffen, die von galaktischen Kollisionen erzählen und uns verraten, wie ein Schwarzes Loch funktioniert. Sterne, die von Planeten umkreist werden, die seltsamer sind als alles, was die Science-Fiction zu bieten hat. Manche Sterne erlauben uns einen Blick auf den Anfang des Universums, und andere können uns zeigen, wie seine Zukunft aussehen wird.
Aber eine Geschichte des Universums ist immer auch eine Geschichte über uns Menschen. Seit es uns gibt, übt der Himmel eine unstillbare Faszination auf uns aus. Die Sterne haben unsere Kultur beeinflusst, unser Denken, und uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Deswegen spielen auch all die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Rolle, die in der Vergangenheit unser Wissen über das Universum erweitert haben. Die Sterne erzählen die Geschichten bekannter Persönlichkeiten wie Isaac Newton oder Albert Einstein ebenso wie die von Menschen, die kaum jemand kennt: von Dorrit Hoffleit, die die Antwort auf die Frage »Weißt du, wie viel Sternlein stehen?« gefunden hat. Von Henrietta Swan Leavitt, dank derer wir wissen, wie groß der Kosmos ist. Von Amina Helmi und ihrer Erforschung stellarer Fossilien. Von Cecilia Payne, die herausfand, woraus Sterne bestehen. Und von Georg von Peuerbach, der dem heliozentrischen Weltbild den Weg bereitete, und James Bradley, der ein für alle Mal zeigte, dass die Erde sich um die Sonne bewegt. Sie und all die anderen Menschen, die in diesem Buch auftauchen, haben dafür gesorgt, dass wir den Nachthimmel nicht nur bewundern, sondern auch verstehen können.
Das Licht der Sterne hat uns verraten, wie alles vor 13,8 Milliarden Jahren seinen Anfang genommen hat, wie unsere Sonne entstanden ist und der Planet, auf dem wir leben. Es hat uns Mythen erfinden und Geschichten erzählen lassen, uns zu technologischen Höchstleistungen angespornt und zum philosophischen Nachdenken über das, was uns ausmacht. Heute treibt es uns dazu an, die Antwort auf die Frage zu finden, ob wir allein im Universum sind und wie unsere Zukunft im Kosmos aussehen könnte.
Die 100 Sterne, die ich für dieses Buch ausgewählt habe, haben kaum etwas gemeinsam. Manche sind hell und seit Jahrtausenden Teil der Geschichten, die Menschen sich über den Himmel erzählen. Manche leuchten so schwach, dass sie nur mit den größten Teleskopen zu erkennen sind. Einige tragen prominente Namen, andere nur Katalogbezeichnungen voller Zahlen und Buchstaben. Es sind große Sterne, kleine Sterne, nahe Sterne und ferne Sterne. Manche Geschichten handeln von Sternen, die erst noch entstehen müssen, andere von solchen, die schon längst gestorben sind.
Die Sterne sind so vielfältig wie das Universum selbst. Jeder Stern erzählt seine ganz eigene Geschichte, und zusammen erzählen sie die Geschichte der ganzen Welt. Genauso kann auch dieses Buch gelesen werden: Man kann es zu Beginn eines beliebigen Kapitels aufschlagen und sich in eine Teilgeschichte des Universums vertiefen, denn jedes Kapitel ist so konzipiert, dass es unabhängig von den anderen gelesen werden kann. Oder aber man beginnt am Anfang, liest bis zum Ende und dringt mit jeder einzelnen Geschichte tiefer in die Geheimnisse des Universums ein.
Die Geschichte des Universums ist zu komplex, um von einem einzigen Menschen in einem einzigen Buch aufgeschrieben zu werden. Aber die Version, die sich mithilfe der hier ausgewählten 100 Sterne erzählen lässt, gehört zu den größten Geschichten, die man über das Universum erzählen kann. Es ist die Geschichte all der Menschen, die im Laufe der Jahrtausende versucht haben, die Welt zu verstehen, in der sie leben, und die Geschichte der faszinierenden Erkenntnisse, die sie dabei gewonnen haben. Viel Spaß bei der Reise durch den Kosmos.
1
Hikoboshi
Der Rinderhirte und die himmlische Weberin
Der hellste Stern im Sternbild Adler ist schwer zu übersehen. Er ist nur 16 Lichtjahre von uns entfernt, hat eine Leuchtkraft, die elfmal größer ist als die der Sonne, und ist der zwölfthellste Stern an unserem Nachthimmel. Sein offizieller Name lautet »Altair«, und wie so viele andere Sternnamen stammt er aus dem Arabischen.
Im 8. und 9. Jahrhundert griffen arabische Astronomen das Wissen der griechischen Antike auf, erweiterten es und brachten eigene Übersetzungen der klassischen Werke heraus. Als dann die Gelehrten des mittelalterlichen Europa ihrerseits diese arabischen Texte übersetzten, übernahmen sie dabei auch die Bezeichnungen für die Sterne. So wurde aus al-nesr al-tā’ir (»der fliegende Adler«) der heute immer noch gültige Name Altair.
So gut wie alle hellen Sterne am Himmel tragen Namen, die aus dem Arabischen stammen, wie etwa Ras Algethi, Algol, Dschubba, Fomalhaut, Mizar, Zuben-el-dschenubi und viele mehr. Einige wenige tragen lateinische Bezeichnungen, zum Beispiel Polaris, Regulus und Capella. Aber auch wenn die westliche Kultur fest auf dem Fundament der griechisch-römischen Antike und ihrer arabischen Rezeption ruht, dürfen wir über dieser Dominanz nicht vergessen, dass der Himmel zu allen Zeiten von allen Menschen beobachtet worden ist.
Jedes Volk hat seine eigenen Namen für die Sterne und erzählt seine eigenen Geschichten. In Japan kennt man Altair zum Beispiel als »Hikoboshi« und feiert ihm zu Ehren jedes Jahr am 7. Juli ein eigenes Fest. Beziehungsweise: ein Fest zu Ehren von Hikoboshi und Orihime — dem Kuhhirten und der Weberin. Ihre Geschichte geht auf eine chinesische Volkssage zurück, die mindestens 2600 Jahre alt ist.
Orihime, die Tochter des Himmelsgottes Tentei, ist damit beschäftigt, Stoff für die Gewänder der Götter zu weben. Um seiner Tochter ein wenig Abwechslung von der Arbeit zu verschaffen, verkuppelt Tentei sie mit dem Rinderhirten Hikoboshi. Aber wie das eben so ist bei jungen Leuten, vergessen sie vor lauter Liebe die Arbeit. Die Kühe laufen unbeaufsichtigt durch die Gegend, und die Götter warten vergeblich auf den Stoff für ihre Kleidung. Tentei muss einschreiten und die beiden trennen. Sie werden auf verschiedene Seiten von Amanogawa verbannt, dem großen Himmelsfluss. Aber auch jetzt bleibt die Arbeit liegen, denn Orihime und Hikoboshi sind viel zu unglücklich, um sich auf ihre Aufgaben konzentrieren zu können. Deswegen ist es ihnen erlaubt, sich einmal im Jahr zu treffen — immer am 7. Tag des 7. Monats. Als sich die beiden Liebenden aber das erste Mal besuchen wollen, fehlt eine Brücke über den Himmelsfluss. Orihime beginnt daraufhin so heftig zu weinen, dass ein großer Schwarm Elstern Mitleid mit ihr hat. Mit ihren Flügeln bilden sie eine Brücke über Amanogawa und versprechen dem Paar, ihnen diesen Gefallen auch in Zukunft jedes Jahr zu tun — sofern es am 7. Tag des 7. Monats nicht regnet und der Himmelsfluss nicht zu viel Wasser führt.
Die tragische Liebesgeschichte und ihr Happy End kann man auch heute noch am Himmel betrachten. Hikoboshi ist, wie schon gesagt, der Stern Altair. Orihime, die himmlische Weberin, wird durch den hellen Stern Wega repräsentiert. Und so wie in der Sage kann man zwischen ihnen die Milchstraße sehen — den Himmelsfluss Amanogawa. Wer ganz genau hinsieht, kann sogar die hilfreichen Elstern erkennen. Denn tatsächlich sind Teile der zwischen Wega und Altair sichtbaren Region der Milchstraße von großen interstellaren Staubwolken verdeckt, und ein dunkler Streifen zieht sich über den »Himmelsfluss«.
Orihime und Hikoboshi kann man im Sommer besonders gut und hoch am Himmel stehen sehen. Genau dann, wenn in Japan das Tanabata-Fest gefeiert wird. Man erinnert sich an die Geschichte des Hirten und der Weberin, stellt Bambusbäume auf und hängt daran Zettel mit Wünschen auf, die man gerne erfüllt sehen will.
Schon lange bevor wir wussten, was es mit den Sternen auf sich hat, haben sie uns zu Geschichten inspiriert. Der Himmel ist voll damit, und wir sollten keine davon vergessen. Denn genauso wie die Sterne uns etwas über das Universum erzählen, erzählen uns unsere Geschichten über sie etwas über uns selbst.
2
2MASS J18082002-5104378 B
Ein Blick auf den Urknall
Der Stern 2MASS J18082002-5104378B ist viel spannender, als es seine eher unhandliche Bezeichnung vermuten lassen würde. Es handelt sich um einen kleinen roten Zwergstern, knapp 2000 Lichtjahre von der Erde entfernt, der uns einen kurzen Blick direkt auf den Anfang des Universums erlaubt.
Als das Universum vor 13,8 Milliarden Jahren entstand, gab es noch nichts. Oder vielmehr: Es gab potenziell alles, aber noch nicht in der heutigen Form. Heute ist das Universum voll mit komplizierten Dingen aus Materie. Es gibt große heiße Kugeln aus Gas, die von kleineren kühlen Kugeln umkreist werden, auf denen sich wiederum (zumindest in einem Fall) noch kleinere Wesen breitgemacht haben, die zumindest in Ausnahmefällen kugelsymmetrisch sind. Die Materie und die vielen verschiedenen Arten der Atome, aus denen all das besteht, existierten zu Beginn des Universums allerdings noch nicht.
Über den Moment des Urknalls selbst können wir noch keine verbindlichen Aussagen treffen — von der Zeit unmittelbar danach haben wir aber recht genaue Vorstellungen. Am Anfang war es enorm heiß, und alles, was es gab, waren Energie und Elementarteilchen. Diese mussten sich erst zu den Atomen, wie wir sie heute kennen, zusammensetzen, und das war gar nicht so einfach. Ein Atom besteht aus einer Hülle und einem Atomkern, der aus elektrisch positiv geladenen Protonen und ungeladenen Neutronen aufgebaut ist. Diese wiederum bestehen aus Quarks, bei denen es sich unserem aktuellen Kenntnisstand zufolge tatsächlich um Elementarteilchen handelt, also um subatomare Teilchen, die selbst nicht in andere Teilchen zerfallen.
Die Zahl der Protonen im Atomkern bestimmt, um welches chemische Element es sich handelt. Ein Proton ergibt den Kern eines Wasserstoffatoms, zwei braucht man für Helium, drei für Lithium und so weiter. Die Zahl der Neutronen in einem Atomkern kann dagegen variieren und verändert die grundlegenden chemischen Eigenschaften eines Elements nicht. Für ein vollständiges Atom braucht es um den Kern herum außerdem noch eine Hülle, die aus den elementaren und elektrisch negativ geladenen Elektronen besteht.
Damit Atome dieser Art stabil existieren können, sind gewisse äußere Bedingungen notwendig, die sich in unserem Universum erst im Lauf der Zeit eingestellt haben. Im sehr jungen Universum war es noch viel zu heiß, sodass Quarks und Elektronen sich aufgrund der enormen Temperaturen viel zu schnell bewegten, als dass aus ihnen stabile Atome hätte entstehen können. Zum Glück kühlte der Kosmos jedoch rasant ab. Schon nach einer Hundertstelsekunde herrschten im neugeborenen Universum nur noch frische 10 Milliarden Grad Celsius, und das reichte den Quarks, um sich zu Protonen und Neutronen zu verbinden. Ein wenig später konnten diese dann auch die ersten Atomkerne und damit die ersten chemischen Elemente bilden.
Wasserstoff ist ganz einfach; dafür muss gar nichts weiter passieren, denn ein Proton bildet bereits einen fertigen Wasserstoffatomkern. Für Heliumkerne müssen sich jedoch zwei Protonen und dazu noch zwei Neutronen im Teilchengewirr des jungen Universums finden und zusammentun. Das Problem dabei: Ein allein durchs Universum fliegendes Neutron ist — im Gegensatz zu einem Proton — nicht stabil. Es zerfällt innerhalb weniger Minuten aufgrund radioaktiver Kräfte. Nach dem Urknall hatten Protonen und Neutronen also auch nur wenige Minuten Zeit, einander zu finden und sich zu Atomkernen zu verbinden.
In dieser kurzen Zeit konnten sich keine komplexen Kerne bilden. Es gab im frühen Universum daher entsprechend viele Atomkerne des Wasserstoffs (75%) und etwas weniger des Heliums (25%), dazu noch hier und da vereinzelte Lithium- und Beryllium-Atomkerne in verschwindend geringen Mengen.
Dieses Mengenverhältnis der chemischen Elemente sagen zumindest die kosmologischen Theorien voraus, mit denen zurzeit der Urknall beschrieben wird. Ob sie korrekt sind, kann nur durch Beobachtung überprüft werden — zum Beispiel an sehr alten Sternen. Die allerersten Sterne des Universums konnten logischerweise nur aus den Elementen bestehen, die damals vorhanden waren: aus Wasserstoff und Helium, und zwar im vorhergesagten Verhältnis. All die anderen chemischen Elemente sind erst später durch Kernfusion im Inneren von Sternen entstanden. Je älter ein Stern ist, desto genauer muss seine Zusammensetzung also dem errechneten Massenverhältnis nach dem Urknall entsprechen.
Und genau das ist es auch, was wir beobachten. 2MASS J18082002-5104378 B ist einer der ältesten Sterne, die wir kennen — vielleicht sogar der älteste. Er entstand nur ein paar Hundert Millionen Jahre nach dem Urknall. Und besteht tatsächlich fast ausschließlich aus Wasserstoff und Helium in genau dem Verhältnis, das zu erwarten war.
Es scheint kaum vorstellbar, dass wir wirklich konkrete Aussagen über den unvorstellbar weit zurückliegenden Anfang des Universums treffen können. Aber dank Sternen wie diesem sind solche Aussagen keine Science-Fiction. Wir können unsere Theorie überprüfen und einen kurzen Blick auf den Moment werfen, in dem unser Kosmos seinen Anfang genommen hat.
3
34 Tauri
Der Planet, der mal ein Stern war
Den Stern 34 Tauri gibt es nicht. Mit seiner Beobachtung hätte der britische Astronom John Flamsteed aber trotzdem weltberühmt werden können. Wenn er denn erkannt hätte, was er da wirklich am Himmel sah.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts arbeitete der königliche Astronom an der Sternwarte von Greenwich an der Erstellung einer großen Himmelskarte. Dazu musste er den Himmel systematisch absuchen und alle Sterne mit ihren Positionen in einen Katalog eintragen. Eigentlich die ideale Ausgangsposition für neue Entdeckungen.
Einer der Sterne, die er in seinen Katalog aufnahm, bekam den Namen »34 Tauri«. Nur dass es sich nicht um einen Stern handelte — sondern um den Planeten Uranus, von dessen Existenz damals noch niemand wusste. Uranus zieht seine Runden um die Sonne weit außerhalb der Bahn des Saturn. Er ist mit bloßem Auge so gut wie nicht zu sehen und auch im Teleskop kaum von einem Stern zu unterscheiden. Aber im Laufe mehrerer Tage verändert er im Gegensatz zu den echten Sternen seine Position merkbar.
Es ist noch verständlich, dass Flamsteed die wahre Natur des Lichtpunkts bei seinen ersten Forschungen entgangen ist. Zwischen den Beobachtungen lagen mehrere Jahre; dass ihm dabei nicht aufgefallen ist, dass es sich immer um dasselbe Objekt handelt, das seine Position am Himmel veränderte, ist zumindest nachvollziehbar. Sein Teleskop war zudem nicht gut genug, um ihm den Planeten als kleine Scheibe zu zeigen. Er sah nur einen Punkt, der genauso aussah wie all die anderen Punkte am Himmel.
Als er aber im März 1715 den Uranus innerhalb einer Woche gleich dreimal im Sichtfeld seines Teleskops hatte, hätte er eigentlich merken müssen, dass sich hier etwas bewegte vor dem Hintergrund der Sterne. Hat er aber nicht — und weil er bei der Auswertung seiner Daten nicht sorgfältig genug arbeitete, entging ihm somit der Ruhm, als erster Mensch einen neuen Planeten gefunden zu haben. Dieses tragische Schicksal teilt er mit einigen anderen Beinahe-Entdeckern des Uranus, wie etwa dem deutschen Astronomen Tobias Mayer, der den Planeten ebenfalls registrierte, aber nicht erkannte, womit er es zu tun hatte.
Das gelang erst 66 Jahre später dem britischen Astronomen Wilhelm Herschel. Als der am 13. März 1781 von seinem Garten aus die Gegend um das Sternbild Stier herum beobachtete, bemerkte er einen Lichtpunkt, der da eigentlich nicht hingehörte. Herschel baute seine Teleskope selbst, und er baute sie besser als alle anderen. Damit konnte er erkennen, dass er es nicht mit einem Stern zu tun hatte. Zuerst hielt er das Objekt noch für einen Kometen; Berechnungen seiner Kollegen zeigten aber schon bald, dass es sich um einen Planeten handeln musste, der die Sonne in einer 19-mal größeren Entfernung umrundet, als es die Erde tut.
Diese Entdeckung war eine Sensation. Bis dahin kannte man nur die sechs Planeten, die man mit bloßem Auge sehen konnte: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn. Niemand ging davon aus, dass noch mehr große Himmelskörper ihre Runden um die Sonne ziehen könnten. Herschels Entdeckung des Uranus verdoppelte mit einem Schlag die Größe des bekannten Sonnensystems, und erst sie öffnete den Menschen die Augen für das, was in der Astronomie noch alles möglich war.
Da draußen warteten noch viele neue Welten auf ihre Entdeckung, und Herschels Planet war erst der Anfang. Man fand die Asteroiden, man fand Neptun und Pluto, und man fand irgendwann sogar die Planeten anderer Sterne. Und wenn John Flamsteed ein klein wenig sorgfältiger gewesen wäre, hätten wir schon 66 Jahre früher mit dem Entdecken beginnen können.
4
Alkione
Georg von Peuerbach und der Anfang einer Revolution
Den Wechsel vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild datieren wir heute meistens in die ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts, als Galileo Galilei und Johannes Kepler mit ihren neuen Erkenntnissen zeigten, dass sich die Erde um die Sonne bewegt und nicht im Zentrum des Universums steht. Aber jede Revolution hat ihre Vorgeschichte.
Schon Aristarch von Samos vermutete im 3. Jahrhundert vor Christus, dass die Erde nicht bewegungslos im Mittelpunkt des Kosmos verharrt. Aber hier lassen wir die Vorgeschichte am 3. September 1457 beginnen. Damals standen Georg von Peuerbach und sein Schüler Regiomontanus in der niederösterreichischen Stadt Melk zusammen und beobachteten den Stern Alkione. Dass die Aufmerksamkeit der beiden Astronomen nicht ausschließlich der gerade ebenfalls stattfindenden Mondfinsternis galt, hatte einen guten Grund. Sie wollten nicht nur sehen, wie der Schatten der Erde den Vollmond verdunkelte, sondern auch ganz genau wissen, wann das passiert. Die Uhren im 15. Jahrhundert waren allerdings nicht sehr genau, weswegen sie sich der großen Uhr des Himmels bedienten. Und dazu musste man Ahnung von Sternen haben.
Georg von Peuerbach hatte sein Studium an der Universität erst recht spät begonnen, im Alter von 23 Jahren. Aber schon drei Jahre danach hielt er Vorlesungen an italienischen Hochschulen und wurde schließlich an der Universität Wien der (vermutlich) erste Professor speziell für Astronomie. Dort war er mit der Erstellung astronomischer Tafeln beschäftigt: So bezeichnete man die langen Tabellen mit Formeln und Zahlen, aus denen man die Position von Sonne, Mond und den Planeten am Himmel berechnen konnte.
Um die Daten in den Tafelwerken überprüfen zu können, waren konkrete Messungen nötig. Dazu brauchte es klar definierbare und vorhersagbare Ereignisse am Himmel — zum Beispiel die Bedeckung eines Planeten durch den Mond oder eben eine Mondfinsternis, wie sie am 3. September 1457 stattfand. Um die Genauigkeit der Berechnungen zu kontrollieren, musste der Zeitpunkt bestimmt werden, an dem das Ereignis stattfand.
Georg von Peuerbach nutzte dazu die Tatsache, dass sich die Erde einmal pro Tag um ihre Achse dreht. Oder, wie man es damals noch sah, dass sich der Sternenhimmel einmal pro Tag um die im Zentrum des Universums ruhende Erde bewegt. Aber egal, wie man es betrachtet: Man kann sehen, wie ein Stern im Laufe der Nacht am Himmel immer höher steigt und dann wieder sinkt, nachdem er seinen höchsten Punkt erreicht hat. Das tut er mit einer konstanten Geschwindigkeit, die der Geschwindigkeit entspricht, mit der sich die Erde um ihre Achse dreht. Misst man, wie hoch ein Stern über dem Horizont steht, kann man damit gleichzeitig den Verlauf der Zeit messen — und genau deswegen hatten Georg von Peuerbach und Regiomontanus Alkione im Blick. Dieser hell leuchtende Stern ist Teil des markanten Sternhaufens der Plejaden. Man kann ihn auch ohne Teleskop sehr gut sehen, was damals recht praktisch war. Denn die beiden Forscher hatten natürlich noch kein solches optisches Instrument zur Verfügung; das wurde erst 150 Jahre später erfunden.
Aber auch so konnte Peuerbach feststellen, dass die Vorhersagen der klassischen Tafelwerke nicht so exakt waren, wie man es gerne hätte. Er begann die astronomischen Tafeln zu korrigieren, entwickelte mathematische Methoden zu ihrer Verbesserung und baute Geräte, mit denen man die Position von Sternen genauer bestimmen konnte als zuvor. Wegen seines recht frühen Todes im Jahr 1461 konnte er diese Arbeit nicht vollenden; das erledigte Regiomontanus, der eigentlich Johann Müller hieß und seinen späteren Namen der lateinischen Übersetzung seines Geburtsortes Königsberg in Bayern verdankt. Er setzte das Werk seines Lehrers fort, stellte noch genauere Berechnungen an und entwickelte noch bessere mathematische Techniken. Auch er starb jung, im Jahr 1476, im Alter von 40 Jahren in Rom.
Drei Jahre zuvor wurde weit im Norden ein Junge mit dem Namen Niklas Koppernigk geboren. Von Regiomontanus und Peuerbach wusste er damals natürlich noch nichts, aber als er sich später selbst mit Astronomie beschäftigte, stützte er sich auf ihre Theorien und Daten über die Bewegung der Planeten. Heute kennen wir Koppernigk besser als »Nikolaus Kopernikus« und als den Mann, der erklärte, dass nicht die Erde, sondern die Sonne im Zentrum steht und von den Planeten umkreist wird. Dies wurde erst 1543, im Jahr seines Todes, veröffentlicht, und danach dauerte es immer noch mehr als ein halbes Jahrhundert, bis Galileo Galilei, Johannes Kepler und Isaac Newton mit ihrer Arbeit zeigen konnten, dass das geozentrische Weltbild tatsächlich nicht der Realität entsprach. Die »Kopernikanische Wende« hat also erst lange nach Kopernikus’ Zeit stattgefunden. Und sie hat schon lange davor begonnen.
5
Freistetters Stern
Kann man Sternnamen kaufen?
»Freistetters Stern« gibt es nicht. Von all den Sternen am Himmel trägt keiner meinen Namen, und das wird sich mit ziemlicher Sicherheit auch nicht ändern. Persönlich finde ich das auch gar nicht so tragisch; mir macht es viel mehr Spaß, etwas über Himmelskörper herauszufinden, als mich mit meinem Namen am Himmel zu verewigen. Was im Übrigen auch gar nicht so einfach ist, wie es einem diverse Firmen im Internet weismachen wollen.
Da werden etwa »Sterntaufen mit Registereintrag und Zertifikat« angeboten. Für ein wenig Geld kann man sich einen der vielen Sterne am Himmel aussuchen und ihm einen Namen geben. Man kann ihn nach sich selbst benennen oder nach einem Menschen, dem man ein Geschenk machen will. Nach der Bezahlung, die im Allgemeinen umso höher ausfällt, je heller der Stern am Himmel zu sehen ist, wird dieser Name dann in »weltweit anerkannte Sterntaufenregister« oder ein »internationales Sternenregister« eingetragen. Man bekommt eine offiziell aussehende Urkunde und kann sich nun daran erfreuen, dass ein Stück des Universums von nun an einen ganz besonderen Namen trägt.
Freuen tun sich aber vor allem die Firmen, die diese Zertifikate verkaufen. Denn sie bieten ein Produkt an, das eigentlich gar nicht existiert. Die Sterne gehören niemandem, und niemand hat daher ein Recht darauf, ihre Namen zu verkaufen. Oder, wenn man es anders herum betrachtet: Jeder Mensch hat das Recht, sie zu benennen.
Das, was wir als »offizielle« Namen betrachten, sind nur die Bezeichnungen, auf die sich die Wissenschaft geeinigt hat und die sie für sich selbst als verbindlich betrachtet. Und sieht man von ein paar Hundert Sternen ab, die in der Antike und im Mittelalter ihre arabischen, griechischen und lateinischen Eigennamen bekommen haben, sind das vor allem diverse aus Zahlen und Buchstaben zusammengesetzte Katalogbezeichnungen. Für die Wissenschaft ist es viel wichtiger und praktischer, ein systematisches und einheitliches System zur Bezeichnung der Sterne zu haben, als ihnen poetische Namen zu verpassen.
Erst seit 2016 hat die Internationale Astronomische Union (IAU), die weltweite Vereinigung zur Förderung der astronomischen Forschung und Zusammenarbeit, eine eigene Arbeitsgruppe zur Benennung von Sternen gegründet. Ziel der Gruppe ist die Standardisierung der Eigennamen von Sternen und, bei Bedarf, die Vergabe von neuen Namen. Bis jetzt umfasst der Katalog von »offiziellen« Namen 330 Einträge, und darunter sind nur sechs, die den Namen einer Person tragen. Es gibt »Cervantes« und »Copernicus«, benannt nach dem spanischen Schriftsteller und dem berühmten Astronomen. »Barnards Stern«, benannt nach dem Astronomen Edward Emerson Barnard, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts die schnelle Bewegung dieses Sterns entdeckte. »Cor Caroli«, das »Herz des Karl«, benannt nach dem englischen König Charles II., der hellste Stern im Sternbild der Jagdhunde. Und dann sind da noch »Sualocin« und »Rotanev« im Sternbild Delfin, die seit 1814 den rückwärts geschriebenen Namen des italienischen Astronomen Nicolaus Venator tragen, wobei niemand so genau weiß, wie es dazu gekommen ist.
Diese Sterne wurden schon vor langer Zeit nach Personen benannt, und die Namen haben sich so weit eingebürgert, dass die IAU sie in ihren offiziellen Katalog aufgenommen hat. Daneben gibt es noch einige andere Sterne, die ebenfalls die Namen von Menschen tragen. Dabei handelt es sich um Astronominnen und Astronomen, die diese Himmelskörper erforscht haben und deren Namen als »inoffizielle« Spitznamen verwendet werden. Zum Beispiel »Tabbys Stern« (nach der Astronomin Tabetha Boyajian) für das Objekt mit der Katalogbezeichnung »KIC 8462852«, das 2015 so viel Aufmerksamkeit erregt hatte, weil man dort seltsame Helligkeitsschwankungen beobachtete, die manche auf die Aktivität von Außerirdischen zurückführen wollten.
Wenn diese Spitznamen ausreichend lange und von ausreichend vielen Leuten in der Wissenschaft verwendet werden, kann es gut sein, dass auch sie irgendwann einmal von der IAU offiziell anerkannt werden. Aber selbst dann hat das nichts mit den »Sternenregistern« der kommerziellen Anbieter zu tun. Alles, was man dort für sein Geld bekommt, ist ein Eintrag in irgendeiner Firmendatenbank. Der ist weder für irgendwen verbindlich, noch ist er eindeutig, denn niemand kann die Firmen daran hindern, mehrere Namen für ein und denselben Stern zu verkaufen. Anstatt also Geld für eine nicht verbindliche »Sterntaufe« auszugeben, kann man auch einfach das tun, was die Menschen immer schon getan haben. Den Anblick des Nachthimmels genießen und sich eigene Geschichten und Namen zu den Sternen und Sternbildern ausdenken. Niemand kann uns daran hindern. Der Himmel gehört uns allen.
6
HR0001
Frau Hoffleit zählt die Sterne
»Weißt du, wie viel Sternlein stehen?«, fragt das bekannte Kinderlied, das 1837 vom evangelischen Pfarrer Wilhelm Hey aus dem thüringischen Leina verfasst wurde. Hey liefert auch gleich die Antwort. Beziehungsweise so etwas Ähnliches wie eine Antwort: »Gott, der Herr hat sie gezählet«, heißt es im Text weiter — zu welchem Ergebnis der Schöpfer bei seiner kosmischen Inventur gekommen ist, verrät er aber leider nicht.
Wo die Theologie nicht weiter weiß, kann die Astronomie helfen. Astronominnen und Astronomen tun allerdings viel mehr, als die Sterne am Himmel nur zu zählen. Sie wollen sie in allen Details verstehen. Um das zu tun, müssen sie die Sterne jedoch zunächst einmal katalogisieren. Am Anfang jeder astronomischen Arbeit steht daher ein Katalog, der möglichst viele Eigenschaften möglichst vieler Sterne in sich versammelt. Man muss wissen, wo sich ein Stern befindet, wie hell er leuchtet und wie schnell er sich bewegt, wenn man zum Beispiel seine Masse berechnen oder sein Alter bestimmen will. Kataloge wirken langweilig, sind aber das Fundament, auf dem unser Wissen über das Universum ruht.
Am 25. April 2018 wurde dieses Fundament massiv erweitert. Das Weltraumteleskop GAIA veröffentlichte den GAIA-DR2-Katalog, der immerhin 1.692.919.135 Sterne auflistet. Das ist eine beeindruckende Zahl und eine deutliche Verbesserung zu den »nur« 2,5 Millionen Sternen, die man zuvor im umfangreichsten Sternenkatalog (Tycho-2) finden konnte. Andererseits besteht allein unsere Milchstraße aus ein paar Hundert Milliarden Sternen. Der enorme GAIA-Katalog enthält also nur circa ein Prozent dessen, was wirklich da draußen zu finden ist. Noch viel weniger, wenn wir all die anderen Galaxien im Universum berücksichtigen. Bis zu einer Billiarde dieser Sternensysteme gibt es im sichtbaren Kosmos, und jedes davon besteht aus Hunderten Milliarden von Sternen.
Am Himmel finden wir also insgesamt ein paar Hundert Quadrillionen Sterne. Theoretisch zumindest, denn in der Praxis können wir die meisten davon nicht sehen. Dafür sind unsere Teleskope zu schwach und zu klein. In absehbarer Zukunft können wir nur darauf hoffen, das Wissen über die Sterne unserer eigenen Galaxie zu vertiefen — und selbst hier erscheint es unwahrscheinlich, dass wir irgendwann all die Milliarden Sterne der Milchstraße vollständig aufgelistet und gezählt haben werden.
Bleiben wir stattdessen lieber bei den Sternen, die wir ohne Teleskope sehen können. Unsere Augen sind zwar schwach, aber in einer klaren Nacht durchaus in der Lage, einen beeindruckenden Sternenhimmel zu beobachten, sofern die künstliche Beleuchtung unserer Städte die natürlichen Lichtquellen nicht überstrahlt. In einer typischen mitteleuropäischen Stadt wäre »Gott, der Herr« schnell fertig mit dem Zählen: Nur knapp drei Dutzend Sterne sind es, die man in stark besiedelten und beleuchteten Gebieten noch erkennen kann.
Wie es unter optimalen Bedingungen aussehen könnte, zeigt uns ein Blick in den »Yale Catalogue of Bright Stars«. Den hat die amerikanische Astronomin Dorrit Hoffleit im Jahr 1956 zusammengestellt. Sie hat dort alle Sterne gelistet, die zumindest theoretisch mit bloßem Auge zu sehen sind. Der lange Katalog beginnt mit dem Stern HR0001, der ungefähr 530 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt und so schwach leuchtet, dass man schon wirklich sehr gute Augen haben muss, wenn man ihn noch erkennen möchte. Insgesamt findet man im Katalog 9095 Sterne — zusammen mit allen damals bekannten und relevanten Daten über sie.
Die wissenschaftlich korrekte Antwort auf die Frage »Weißt du, wie viel Sternlein stehen?« muss also lauten: Nein. Das weiß niemand. Sehr, sehr viele auf jeden Fall. Sehen kann man davon mit bloßem Auge aber nur 9095 Stück — und die hat auch nicht Gott der Herr gezählet, sondern Dorrit Hoffleit von der Yale University.
7
Wega
Der unterschätzte Staub
Staub braucht ein besseres Image! Waschanlagen, Staubwedel, Staubsauger: Hier auf der Erde haben wir eine ganze Industrie entwickelt, um ihn loszuwerden, aus unseren Wohnungen, unseren Autos, von unserer Kleidung. Astronominnen und Astronomen dagegen lieben Staub. Sofern er weit draußen im All ist zumindest; ihre Instrumente halten sie durchaus auch gerne sehr sauber.
Der kosmische Staub ist eine einzigartige Informationsquelle, wie der Astronom Hartmut Aumann und seine Kollegen im Jahr 1984 eindrucksvoll unter Beweis stellten. Sie nutzten IRAS, den »Infrared Astronomical Satellite«, um den Stern Wega zu untersuchen. Der Hauptstern im Sternbild Leier, der fünfthellste Stern an unserem Nachthimmel und seit Jahrtausenden das Ziel astronomischer Aufmerksamkeit, stand auch auf der Liste der Sterne, die mit dem neuen Weltraumteleskop in Augenschein genommen werden sollten.
Infrarotstrahlung, also der für unsere Augen nicht sichtbare Teil des Lichts, der im Spektrum noch hinter dem roten Teil des Regenbogens angesiedelt ist, kann die Atmosphäre der Erde nur sehr schwer durchdringen. Sie wird durch das Wasser in unserer Lufthülle blockiert. Um sie zu beobachten, müssen wir ins Weltall, wo nichts unseren Blick stört. IRAS war das erste große Weltraumteleskop, das den Himmel mit Infrarotaugen untersuchen sollte. Denn dort gibt es jede Menge zu sehen, was unseren Augen zwangsläufig entgeht.
Sterne strahlen nicht nur sichtbares Licht ab; sie leuchten in allen Farben — auch denen, die wir mit unseren Augen nicht sehen können. Auch Objekte wie Kometen und Asteroiden werden von der Sonne erwärmt und geben die Wärme in Form von Infrarotstrahlung wieder ab. Und dann ist da noch der Staub: Überall im Universum, zwischen den Planeten, zwischen den Sternen und auch zwischen den Galaxien befindet sich der kosmische Kleinkram, aus dem neue Sterne und andere Himmelskörper entstehen können.
Als die ersten Daten von IRAS auf der Erde eintrafen, war man ein wenig irritiert. Einige Sterne leuchten im Infrarotlicht heller, als sie es eigentlich tun sollten. Wie viel Energie ein Stern bei einer bestimmten Farbe des Lichts abstrahlt, folgt klar definierten Gesetzen. Man kann sehr genau berechnen und vorhersagen, wie viel rotes, blaues, grünes oder eben auch infrarotes Licht von einem bestimmten Stern mit einer bestimmten Masse und Temperatur abgegeben werden sollte. Nur: Einige Sterne hielten sich offenbar nicht an diese Vorhersage, ganz besonders Wega.
Hier war ein Phänomen zu beobachten, das mit dem unhandlichen Begriff »Infrarotexzess« bezeichnet wird, was nichts anderes meint als »Zu viel Infrarotstrahlung!«. Hartmut Aumann und seine Kollegen kamen der Ursache jedoch schnell auf die Schliche: Es lag am Staub. Die winzigen Staubteilchen können wir natürlich nicht direkt sehen, aber wenn sie sich in der Nähe eines Sterns aufhalten, dann werden sie von seiner Strahlung erwärmt und geben diese Wärme dann in Form von Infrarotstrahlung wieder ab. Insgesamt hat es dann den Anschein, als würde der Stern heller im Infrarotlicht leuchten, als er sollte.
Wega war also von einer großen Scheibe aus Staub umgeben! Staub kommt aber nicht aus dem Nichts (auch wenn es in manchen Wohnungen so erscheinen mag). Wenn Wega von Staub eingehüllt ist, dann muss der irgendwo herkommen, und vor allem muss an dieser ominösen Quelle permanent neuer Staub produziert werden. Sich selbst überlassen, verschwindet er nämlich in relativ kurzer Zeit irgendwo im All. Es reicht schon die Kraft des auf ihn treffenden Lichts, um ihn wegzuschieben.
Wo Staub ist, müssen also auch Objekte sein, die Staub erzeugen: kollidierende Asteroiden zum Beispiel. Es kann also nicht nur Staub sein, der Wega einhüllt; in ihrem direkten Umfeld muss es noch mehr geben. Und tatsächlich ist Wega von Asteroidengürteln umgeben — ein Anzeichen dafür, dass an dieser Stelle die gleichen Prozesse abgelaufen sind, die auch in unserem Sonnensystem vor 4,5 Milliarden Jahren abliefen, als dort zuerst Asteroiden und dann Planeten entstanden.
Dass auch bei anderen Sternen Planeten entstehen könnten, hatte bis dahin im Jahr 1984 aber noch niemand mit Sicherheit gewusst. Erst der Staub von Wega hat demonstriert, dass das, was bei uns passiert ist, auch anderswo im Universum stattfindet und dass die Suche nach den Planeten anderer Sterne nicht hoffnungslos ist.
8
Ras Alhague
Die Astrologen sind verwirrt
Ras Alhague (arabisch für »Kopf der Schlange«) ist der hellste Stern im Sternbild des Schlangenträgers. Und genau das sorgt immer wieder mal für Aufregung — zumindest in der Boulevardpresse und bei den Fans der Astrologie. Die NASA hätte die Sternzeichen neu geordnet, heißt es da zum Beispiel, und jetzt gäbe es ein »dreizehntes Sternzeichen«.
»13 Sternzeichen?! Hast du in Wahrheit ein ganz anderes?«, lautet etwa eine Schlagzeile vom Januar 2019. Und: »Eine Studie sagt, dass die meisten eigentlich unter einem ganz anderen Sternzeichen geboren sind«. Wer zwischen 30. November und 18. Dezember zur Welt kam, sei demnach kein Schütze mehr, sondern eigentlich ein Schlangenträger.
Der Grund für diese regelmäßigen Wellen der Hysterie ist — neben der medialen Suche nach schneller Aufmerksamkeit — der Unterschied zwischen »Sternbild« und »Sternzeichen«, der nicht wenigen Menschen Kopfzerbrechen zu bereiten scheint. Und, damit eng verwandt, der Unterschied zwischen Astronomie und Astrologie.
Früher gab es diese Trennung nicht. Menschen beobachteten den Himmel und erforschten nicht nur die Bewegung und die Eigenschaften all der Lichtpunkte, die sie dort sahen, sondern waren auch überzeugt, dass die Himmelskörper eine mythologische und religiöse Bedeutung hatten. Kometen etwa galten jahrhundertelang als Vorboten des Unglücks oder als himmlische Begleitmusik besonders wichtiger Ereignisse (wie etwa der Geburt Jesu …). Das, was am Himmel passierte, so glaubte man, hatte konkrete Auswirkungen auf das Leben der Menschen, und wer die Sterne und Planeten nur genau genug beobachtet und versteht, kann daraus wichtige Informationen über die Zukunft gewinnen.
Erst ab dem 17. Jahrhundert begann sich das, was heute die moderne Naturwissenschaft der Astronomie ist, von dem alten Aberglauben der Astrologie zu trennen. All die mythologischen Figuren und Geschichten, die die Menschen früher in Form von Sternbildern an den Himmel projizierten, spielen heute nur in historischer Hinsicht eine Rolle. Die Astronomie kennt zwar immer noch offizielle Sternbilder. Mit den Sternzeichen der Astrologie haben sie aber nicht mehr viel zu tun.
Die zwölf Tierkreiszeichen, wie sie korrekt heißen, anhand derer man auch heute noch in fast jeder Zeitung sein Horoskop ablesen kann, sind Sternbilder, die sich an einer ganz speziellen Position des Himmels befinden. Sie sind entlang der Ekliptik aufgereiht, also ausgerichtet an der scheinbaren Bahn, der die Sonne im Laufe eines Jahres an unserem Himmel folgt. Die Ekliptik ist nichts anderes als die an den Himmel projizierte Umlaufbahn der Erde um die Sonne, und auch die restlichen Planeten bewegen sich in oder zumindest in der Nähe dieser Ebene. Aus genau diesem Grund spielten die zwölf Tierkreiszeichen in der antiken Himmelsdeutung auch so eine besondere Rolle: Man konnte beobachten, wann und wie die Planeten sich durch die einzelnen Sternbilder bewegen — und daraus ließen sich astrologische Schlussfolgerungen ziehen.
Das Sternbild des Schlangenträgers stammt, wie die Bilder von Skorpion, Schütze, Steinbock und den anderen, ebenfalls aus der Antike, und es wird auch von der Ekliptik durchkreuzt. Man hat es jedoch nicht zu den offiziellen Tierkreiszeichen gezählt; vermutlich weil die Zahl 12 eine bessere Symbolik darstellte als die 13.
Lange Zeit gab es auch keine verbindliche Regelung, was die Sternbilder angeht. Nirgendwo war festgehalten, welche Sternbilder es überhaupt gibt, oder gar festgelegt, welche Sterne nun wirklich zu welchen Sternbildern gehören. Das holten Wissenschaftler erst im Jahr 1928 nach: Die Internationale Astronomische Union teilte damals den gesamten Himmel in 88 klar abgegrenzte Bereiche ein und schuf so die heute immer noch gültigen 88 offiziellen Sternbilder. Entlang der Ekliptik finden wir immer noch die 12 Sternbilder, deren Namen den 12 astrologischen Sternzeichen entsprechen. Und eben auch Ras Alhague im Sternbild des Schlangenträgers.
Das bedeutet jedoch nicht, dass es sich beim Schlangenträger auch um ein astrologisches Sternzeichen handelt. Die Astrologie ignoriert die Erkenntnisse der Astronomie in vielen Bereichen, und hier ist es genauso. Die astronomischen Sternbilder nehmen unterschiedlich große Bereiche am Himmel ein; die Sternzeichen der Astrologen sind hingegen alle gleich groß. Daraus ergeben sich große Abweichungen. Wer zum Beispiel das Sternzeichen Wassermann hat, geht astrologisch gesehen davon aus, dass sich die Sonne zum Zeitpunkt seiner Geburt in dem entsprechenden Himmelsabschnitt befunden hat. Aus astronomischer Sicht stand sie allerdings im Sternbild der Fische.
Die Astrologie ist keine Wissenschaft, und die Sternzeichen haben nichts mit den offiziellen Sternbildern und der realen Position der Sonne am Himmel zu tun. Dennoch erzählen auch die Sternzeichen ihren Teil der Geschichte des Universums. Sie sind ein Zeugnis für das Bedürfnis der Menschen, ihr Leben in einen vermeintlich kosmischen Kontext zu stellen. Aber niemand muss sich Sorgen machen, bisher das »falsche« Sternzeichen gehabt zu haben. Man sollte höchstens darüber nachdenken, wieso man immer noch so viel Wert auf einen antiken Aberglauben legt.
9
TXS0506+056
Astronomie mit dem Eiswürfel
Das vermutlich seltsamste Teleskop der Welt befindet sich am Südpol der Erde. Oder genauer gesagt: mehr als einen Kilometer tief unter dem Südpol, eingefroren im Eis der Antarktis. Dort unten ist es auf der Suche nach einer ganz speziellen Art von Licht. Man will Neutrinos finden, und um das zu erreichen, muss man einiges an Aufwand treiben.
Ein Neutrino ist ein Elementarteilchen. Es hat fast keine Masse und tritt mit dem Rest der Materie so gut wie gar nicht in Wechselwirkung. In jeder Sekunde flitzen an die 100 Millionen von ihnen durch jeden Quadratzentimeter unserer Körperoberfläche, und wir kriegen nichts davon mit. Die gesamte Erde ist einem ständigen Strom von Neutrinos ausgesetzt, ohne dass sie dadurch auf irgendeine Art und Weise beeinträchtigt wird. Aus Sicht dieser Elementarteilchen ist die Erde nicht nur durchsichtig; sie ist quasi nicht vorhanden.
Neutrinos entstehen bei atomaren Reaktionen — ganz besonders viele bei der Kernfusion im Inneren von Sternen. Unsere Sonne produziert nicht nur Licht, das sie hinaus ins All strahlt, sondern auch einen beständigen Strom von Neutrinos. Um diesen zu registrieren, müssen wir uns jedoch deutlich mehr anstrengen.
Nur in ganz seltenen Fällen reagiert eines der unzähligen Neutrinos, die auf unseren Planeten treffen, doch mit der normalen Materie. Bei dieser Kollision entstehen andere Teilchen, und für kurze Zeit geben sie Energie in Form von hellem Licht ab. Damit wir diesen Vorgang beobachten können, muss allerdings einiges zusammenkommen: Zuerst einmal braucht es sehr viel Materie, um den Neutrinos die Möglichkeit zu bieten, überhaupt auf irgendetwas zu treffen; und man benötigt spezielle Detektoren, genauer gesagt, sehr viele hochempfindliche optische Sensoren, die in der Lage sind, die kurzen Lichtblitze zu sehen.
Das Teleskop am Südpol ist genau so ein Neutrinodetektor und unter anderem deswegen so tief im Eis vergraben, weil dort unten der Druck der darüberliegenden Schichten jede noch so kleine Luftblase aus dem Eis gequetscht hat. Es ist extrem klar und durchsichtig — nur so haben die Sensoren eine Chance, die Lichtblitze zu sehen. Auf einem Volumen von einem Kubikkilometer hat man 5160 Sensoren versenkt; es handelt sich quasi um einen riesigen, unterirdischen Eiswürfel, der hier zu einem Neutrinodetektor umgebaut wurde, weswegen das Projekt auch den Namen »IceCube« trägt.
Die Daten der Sensoren werden mit Kabeln an die Oberfläche geleitet und können dort ausgewertet werden. Aus der Stärke des Lichtblitzes kann man berechnen, wie viel Energie das Neutrino in sich trägt. Je größer diese Energie ist, desto gewaltiger muss das Ereignis gewesen sein, bei dem das Neutrino erzeugt worden ist. Zusätzlich kann man mit IceCube auch die Richtung bestimmen, aus der es gekommen ist. Die meisten Neutrinos, die dort nachgewiesen werden, stammen von der Sonne. Sie ist die mit Abstand stärkste Quelle dieser Teilchen in unserer Umgebung, und wir konnten die dort produzierten Neutrinos schon lange vor IceCube detektieren. Dadurch konnten wir erst so richtig verstehen, welche speziellen Kernreaktionen in ihrem Inneren ablaufen, und herausfinden, auf welche Art und Weise die Sonne ihre Energie erzeugt.
Aber natürlich würde man gerne auch die Neutrinos anderer Himmelskörper im Universum beobachten. Das gelang 1987, als in 170.000 Lichtjahren Entfernung eine Supernova explodiert ist. Damals konnte man insgesamt 25 Neutrinos detektieren — was nach wenig klingt, aber in der Neutrinoastronomie einen wahren Teilchensturm darstellt.
Normalerweise bekommt man die flüchtigen Teilchen so selten zu Gesicht, dass man ihnen individuelle Namen geben kann. 2013 beobachtete IceCube zwei Neutrinos mit so hohen Energien, dass sie definitiv nicht von der Sonne stammen konnten, sondern irgendwo weit aus dem Universum zu uns gekommen sein müssen. Sie bekamen die Namen »Ernie« und »Bert« — aber ihre Herkunft ließ sich nicht zurückverfolgen.
Am 22. September 2017 fand man ein weiteres hochenergetisches Neutrino, das nun aber nicht mehr nach Charakteren aus der Sesamstraße benannt wurde, sondern die nüchterne Bezeichnung »IceCube-170922A« bekam. Sofort nach der Detektion versuchten normale Teleskope überall auf der Welt, seine Quelle auszumachen. Und tatsächlich wurde man fündig: Genau in der Richtung, aus der es kam, ist TXS0506+056 am Himmel zu sehen. Es handelt sich um einen »Blazar«. So nennt man die extrem aktiven Zentren ferner Galaxien. Dort sitzen Supermassereiche Schwarze Löcher, und die Materie, die in ihnen verschwindet, strahlt zuvor noch jede Menge Energie ab. Dabei werden auch Neutrinos erzeugt — und genau so eines scheint IceCube gemessen zu haben.
Die extreme Unwilligkeit der Neutrinos, mit dem Rest der Materie zu reagieren, macht sie extrem wertvoll für uns. Sie entstehen in allen Sternen, in den Zentren anderer Galaxien, in der Umgebung Schwarzer Löcher. Und im Gegensatz zu Licht lassen sie sich von so gut wie nichts aufhalten. Sie können die Information über ihren Ursprung ungestört durch das ganze Universum tragen.
Der unterirdische Eiswürfel am Südpol ist das bis jetzt beste Neutrinoteleskop und das erste, mit dem wir den Himmel auf eine ganz neue Art und Weise betrachten können. Um den Kosmos aber wirklich gut im Licht der Neutrinos sehen zu können, werden wir wohl noch größere Detektoren benötigen.
10
π1 Gruis
Ein Riesenstern brodelt
530 Lichtjahre von der Erde entfernt brodelt im Sternbild Kranich ein Riesenstern. Sein Name ist π1 Gruis, und würde er sich in unserem Sonnensystem befinden, dann hätte er die Erde längst verschluckt. Er hat sein Leben schon fast beendet, aber uns zuvor noch etwas gezeigt, was wir in der Form bis jetzt noch nie beobachten konnten.