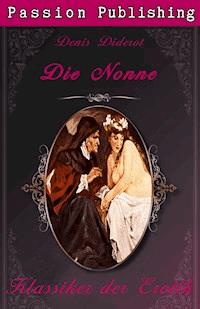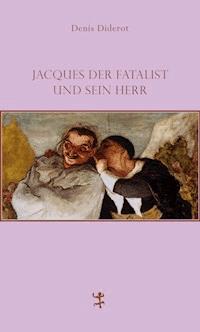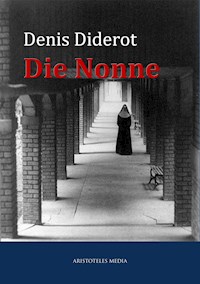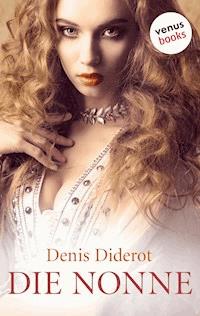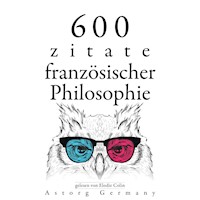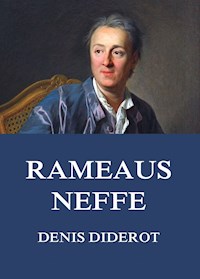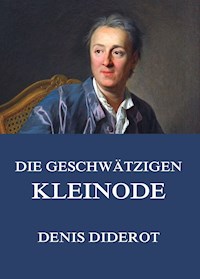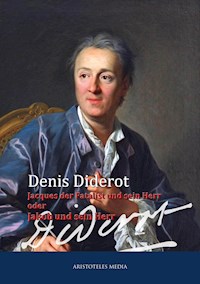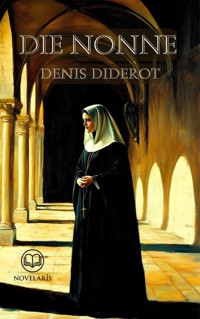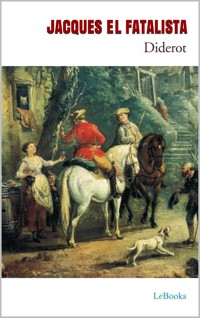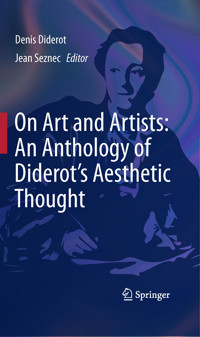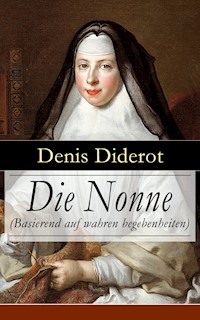
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Die Nonne (Basierend auf wahren begebenheiten)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Wie fast allen Werken Diderots liegt auch diesem Werke eine Thatsache zu Grunde. Im Jahre 1757 strengte eine Nonne des Klosters Longchamp einen Prozeß gegen ihre Eltern an, die sie gezwungen hatten, den Schleier zu nehmen. Der damals noch allmächtige Klerus verstand es, alle Versuche des unglücklichen Opfers, sich dem ihm aufgedrungenen Berufe zu entziehen, zu unterdrücken, und selbst der von der Unglücklichen in Scene gesetzte öffentliche Skandal hatte keine andere Wirkung, als der Ärmsten eine noch schlimmere Behandlung zu verschaffen, die in ihrer ausgesuchten Grausamkeit vor den gewagtesten Mitteln nicht zurückschreckte. Aber trotz aller Vertuschungsversuche der Geistlichkeit drang doch einiges von dem Prozeß in die Öffentlichkeit; einige wohlwollende Leute bemächtigten sich der Sache; doch all ihr Bemühen war vergeblich, die Unglückliche blieb in den Händen der Geistlichkeit, und wer weiß unter welch körperlichen und seelischen Martern man sie in majorem Dei gloriam zu Tode gemartert hat. Denis Diderot (1713-1784) war ein französischer Schriftsteller, Philosoph, Aufklärer und einer der wichtigsten Organisatoren und Autoren der Encyclopédie. Diderot trat in seinen Werken für die Verbreitung des Geistes der Aufklärung, den Atheismus und gegen Aberglauben und Bigotterie ein. Diderot und seine Mitstreiter, die philosophes, überließen nicht mehr der Kirche und ihren Agenturen die alleinige Deutungs- und Interpretationshoheit über die Welt und die Wissenschaften. Somit gab es für übernatürliche und irrationale Kräfte im aufgeklärten Europa sowie in Nord- und Südamerika weniger Raum.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Nonne (Basierend auf wahren begebenheiten)
Historischer Roman
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Der vorliegende Roman, »Die Nonne« von Denis Diderot, erregte, als er in Frankreich zur Veröffentlichung gelangte, einen Sturm der Entrüstung. Ganz besonders war es die hohe und niedere Geistlichkeit, welche sich in Schmähungen und Verwünschungen gegen den Verfasser nicht genug thun konnte und diesen gar zu gerne dem Scheiterhaufen überliefert hätte – wenn er nicht schon vorher gestorben wäre. Denn erst im Jahre 1793, nachdem der Sturmwind der Revolution die Privilegien des Adels und des Klerus hinweggefegt, erschien der Roman »Die Nonne« mit verschiedenen anderen Schriften Diderots im Druck; doch ist anzunehmen, daß das Werk etwa um dreißig Jahre früher entstand und handschriftlich wie auch durch Vorlesungen in den den Enzyklopädisten nahe stehenden Kreisen bekannt war.
Wie fast allen Werken Diderots liegt auch diesem Werke eine Thatsache zu Grunde. Im Jahre 1757 strengte eine Nonne des Klosters Longchamp einen Prozeß gegen ihre Eltern an, die sie gezwungen hatten, den Schleier zu nehmen. Der damals noch allmächtige Klerus verstand es, alle Versuche des unglücklichen Opfers, sich dem ihm aufgedrungenen Berufe zu entziehen, zu unterdrücken, und selbst der von der Unglücklichen in Scene gesetzte öffentliche Skandal hatte keine andere Wirkung, als der Ärmsten eine noch schlimmere Behandlung zu verschaffen, die in ihrer ausgesuchten Grausamkeit vor den gewagtesten Mitteln nicht zurückschreckte. Aber trotz aller Vertuschungsversuche der Geistlichkeit drang doch einiges von dem Prozeß in die Öffentlichkeit; einige wohlwollende Leute bemächtigten sich der Sache; doch all ihr Bemühen war vergeblich, die Unglückliche blieb in den Händen der Geistlichkeit, und wer weiß unter welch körperlichen und seelischen Martern man sie in majorem Dei gloriam zu Tode gemartert hat.
Diesen Stoff hat Diderot im ersten Teile seines Romans behandelt, während der zweite einer genauen Schilderung der in den Klöstern herrschenden Unsittlichkeit gewidmet ist. Die Beschreibung der unsittlichen Scenen hat dem Buche den Vorwurf der Frivolität eingetragen, doch mit Unrecht, denn der Verfasser hat dieselben nicht als Selbstzweck, sondern nur zur Schilderung der in den Klöstern herrschenden Sittenlosigkeit benutzt. Selbst Schlosser, der in seinen Urteilen über die französische Litteratur oft recht schroffe und herbe Meinungen abgegeben hat, sagt in seiner Geschichte des 18. Jahrhunderts, dritter Zeitraum, zweiter Abschnitt, zweites Kapitel:
»Die Geschichte ist so genau aus den Erfahrungen jener Zeit und dem, was alle Tage in gewissen Familien vorging, entlehnt, daß man wirkliche Denkwürdigkeiten zu lesen glaubt. Jede fühlende Seele schaudert, wie innig ergriffen und von Rührung durchdrungen, sie muß einen Zustand des Staats und der Kirche verabscheuen, der Dinge, wie die hier erzählten, möglich machte. Diderot hat mit einer bewunderungswürdigen Kunst die Erzählung von Anfang bis zum Ende so durchgeführt, daß er nie aus dem Tone gefallen ist. Das Klosterleben und Klosterwesen der Zeit kurz vor der Revolution ist in keinem Buche mit mehr Wahrheit und Lebendigkeit geschildert, als in diesem Roman.«
Der Übersetzer hat sich bemüht, dem Originale ganz getreu zu folgen, nur einige Stellen, die gewisse Längen enthalten, sowie die durchaus überflüssigen Obscönitäten sind dem Rotstift zum Opfer gefallen. Diese Streichungen sind um so berechtigter, als das Werk dadurch nur an Knappheit und Schärfe gewinnt, auch ging Diderot selbst mit einem Plan der Umarbeitung der »Nonne« um, ein Plan, der wohl nur infolge seines Todes nicht zur Ausführung gelangte.
Der Übersetzer.
I.
Mein Vater war Advokat, er hatte meine Mutter in ziemlich vorgerücktem Alter geheiratet, und sie hatte ihm drei Töchter beschert. Er hatte mehr Vermögen, als nötig war, um sie gut zu versorgen; doch zu diesem Zweck hatte er seine Zärtlichkeit allen dreien in gleicher Weise zuteil werden lassen müssen; und ich kann ihm leider dieses Lob nicht angedeihen lassen. Zweifellos übertraf ich meine Schwestern durch die Vorzüge des Geistes und der Gestalt; ich war ihnen an Charakter und Talent überlegen; doch es machte mir den Eindruck, als wenn sich meine Eltern darüber betrübten. Wenn jemand zufällig zu meiner Mutter sagte, sie habe reizende Kinder, so durfte mir das niemals gelten. Ich bin zuweilen für diese Ungerechtigkeit gerächt worden, doch die Lobsprüche, die man mir zuteil werden ließ, kamen mir, wenn wir allein waren, so teuer zu stehen, daß ich Gleichgültigkeit und selbst Schimpfworte vorgezogen hätte; je mehr mich die fremden Besucher verhätschelten, eine desto schlimmere Laune trug man gegen mich zur Schau, sobald sie fortgegangen waren. O, wie oft habe ich darüber geweint, daß ich nicht häßlich, dumm, albern, hochmütig, mit einem Wort, mit all' den Fehlern zur Welt gekommen bin, die meinen Schwestern die Liebe ihrer Eltern verschafften. Ich habe mich gefragt, wie wohl ein Vater und eine Mutter, die sonst durchaus ehrenhaft, gerecht und fromm waren, sich so eigentümlich benehmen konnten. Einige Bemerkungen, die meinem Vater im Zorn entschlüpft sind – denn er war sehr heftig – einige Umstände, die mir zu verschiedenen Zeiten aufgefallen sind, Äußerungen von Nachbarn, von Dienstboten, haben mich einen Grund vermuten lassen, der eine kleine Entschuldigung für sie bieten würde. Vielleicht hegte mein Vater einige Zweifel in betreff meiner Geburt, vielleicht erinnerte ich meine Mutter an einen Fehltritt, den sie begangen, und an die Undankbarkeit eines Mannes, dem sie zu sehr zu Willen gewesen, was weiß ich? –
Da wir kurz hintereinander zur Welt gekommen waren, so wuchsen wir auch alle drei zusammen auf. Es stellten sich Bewerber ein; meine älteste Schwester erhielt den Antrag eines reizenden jungen Mannes; doch bald bemerkte ich, daß er mich auszeichnete, und ich ahnte, daß sie bald nur der Vorwand, für seine häufigen Besuche sein würde. Ich sah es voraus, daß mir dieses Benehmen Kummer bereiten würde, und setzte meine Mutter davon in Kenntnis. Das ist vielleicht das einzige Mal in meinem Leben gewesen, daß ich etwas ihr Wohlgefälliges gethan habe, und wie wurde ich dafür belohnt? Vier Tage später oder wenigstens doch kurze Zeit darauf sagte man mir, man hätte für mich einen Platz in einem Kloster besorgt, und schon am nächsten Tage wurde ich dorthin überführt. Ich fühlte mich im Hause so unbehaglich, daß mich dieses Ereignis nicht besonders betrübte, und so fuhr ich nach Sainte-Marie – das war mein erstes Kloster – in heiterster Stimmung. Inzwischen vergaß mich der Liebhaber meiner Schwester, als er mich nicht mehr sah und wurde ihr Gatte. Er heißt K..., ist Notar und lebt in Corbeil, wo er eine höchst unglückliche Ehe führt. Meine zweite Schwester wurde mit einem Herrn Bauchon, einem Seidenwarenhändler in der Straße Quincampoix in Paris verheiratet und lebt mit ihm ziemlich gut. Als meine beiden Schwestern versorgt waren, glaubte ich, man würde auch an mich denken, und ich würde das Kloster bald verlassen. Ich zählte damals 16 1/2 Jahr. Man hatte meinen Schwestern eine bedeutende Mitgift gegeben; ich erhoffte ein dem ihren ähnliches Schicksal, und mein Kopf war von allerlei verführerischen Plänen voll, als man mich eines Tages in das Sprechzimmer rief. Ich erblickte den Pater Seraphin, den Beichtvater meiner Mutter; er war auch der meinige gewesen, und daher hatte er auch keine Schwierigkeit, mir den Grund seines Besuches zu erklären; es handelte sich darum, mich zu veranlassen, den Schleier zu nehmen. Ich protestierte heftig gegen diesen seltsamen Vorschlag und erklärte ihm frei heraus, ich fühle keinen Beruf für den geistlichen Stand.
»Um so schlimmer«, sagte er zu mir, »denn Ihre Eltern haben sich Ihrer Schwestern wegen vollständig ruiniert, und ich sehe nicht ein, was sie in der beschränkten Lage, in der sie sich befinden, für Sie thun könnten. Denken Sie darüber nach, mein Fräulein; entweder müssen Sie für immer in dieses Haus eintreten, oder sich in ein anderes Provinzkloster begeben, wo man Sie gegen eine mäßige Pension aufnehmen wird, und das Sie erst nach dem Tode Ihrer Eltern verlassen werden, was noch lange dauern kann!«
Ich beklagte mich bitter und vergoß wahre Ströme von Thränen. Die Oberin war bereits in Kenntnis gesetzt und erwartete mich, als ich das Sprechzimmer verließ. Ich war in einer unbeschreiblichen Aufregung.
»Was ist Ihnen denn, mein liebes Kind?« sagte sie zu mir. »Wie sehen Sie denn aus? Haben Sie Ihren Herrn Vater oder Ihre Frau Mutter verloren?«
Ich wollte schon antworten: »Das wolle Gott!« doch ich begnügte mich mit den Worten: »Leider habe ich weder Vater noch Mutter; ich bin eine Unglückliche, die man haßt und lebendig begraben will.«
Sie ließ den Sturm vorübergehen und wartete auf den Augenblick der Ruhe. Ich erklärte ihr nun deutlicher, was man mir eben mitgeteilt. Sie schien Mitleid mit mir zu haben und beklagte mich; dann ermutigte sie mich, nicht einen Stand zu ergreifen, für den ich keine Neigung fühlte; außerdem versprach sie mir, für mich zu bitten, Vorstellungen zu machen, und sich für mich zu verwenden. Sie schrieb in der That, wußte aber ganz genau die Antwort, die man ihr erteilen würde und teilte mir dieselbe mit; erst nach längerer Zeit lernte ich an ihrer Aufrichtigkeit zweifeln. Inzwischen kam der Termin, an dem ich meinen Entschluß kund geben sollte, heran, und sie setzte mich mit guteinstudierter Traurigkeit davon in Kenntnis. Zuerst sprach sie keine Silbe, dann ließ sie einige mitleidige Worte fallen, aus denen ich das übrige begriff. Wieder fand eine Scene der Verzweiflung statt, und ich glaube, sie weinte wirklich, während sie sagte:
»Nun, mein Kind, Sie werden uns also verlassen? Teures Kind, wir werden uns nicht mehr wiedersehen!«
Dann führte sie noch andere Reden, die ich nicht hörte. Ich war auf einen Stuhl gesunken, schwieg oder schluchzte. Bald blieb ich unbeweglich, bald erhob ich mich, bald lehnte ich mich gegen die Wand, bald hauchte ich meinen Schmerz an ihrem Busen aus.
Nach einer Weile sprach sie folgendes: »Hören Sie, sagen Sie aber nicht, daß ich Ihnen den Rat gegeben habe; ich zähle auf Ihre unverletzliche Verschwiegenheit; denn ich möchte um keinen Preis der Welt, daß man mir daraus einen Vorwurf machen könne. Was verlangt man von Ihnen? – Daß Sie den Schleier nehmen? Nun wohl, warum nehmen Sie ihn nicht? Wozu verpflichtet denn das? Zu nichts, höchstens, daß Sie noch zwei Jahre bei uns bleiben. In zwei Jahren kann vielerlei geschehen.«
Mit diesen heimtückischen Reden verband sie soviele Liebkosungen, soviele Freundschaftsversicherungen, soviele süße Falschheiten, daß ich mich überreden ließ. Sie schrieb also an meinen Vater, der Brief war vortrefflich: mein Schmerz und mein Widerstreben waren darin durchaus nicht verhehlt; doch schließlich teilte man meine Einwilligung mit. Mit welcher Eile wurde nun alles vorbereitet, der Tag wurde festgesetzt, meine Kleider angefertigt, und der Tag der Ceremonie war herangerückt, ohne daß ich heute den geringsten Zwischenraum zwischen diesen Dingen entdecken kann.
Ein Doktor der Sorbonne, der Abbé Blain, hielt die Ermahnungsrede, und der Bischof von Aleppo kleidete mich ein. Obwohl die Nonnen eifrig bemüht waren, mich zu stützen, so fühlte ich doch wohl zwanzigmal, wie die Kniee unter mir zusammenbrachen, und es fehlte nicht viel, so wäre ich auf den Stufen des Altars niedergesunken. Ich hörte nichts, ich sah nichts, ich war wie verblödet; man führte mich, und ich ging; man fragte mich und antwortete für mich. Indessen nahm diese grausame Ceremonie ein Ende; alle zogen sich zurück, und ich blieb inmitten der Herde, der man mich eben zugesellt hatte. Meine Gefährtinnen umstanden mich; sie umarmten mich und sagten: »Aber seht doch, Schwestern, wie schön sie ist; wie dieser schwarze Schleier die Weiße ihres Teints hebt, wie dieses Band ihr steht, wie es ihr Gesicht umrahmt, wie dieses Kleid ihre Taille und ihre Arme hervortreten läßt.«
Ich hörte sie kaum an, ich war verzweifelt; dennoch mußte ich zugeben, daß ich, als ich allein in meiner Zelle war, mich ihrer Schmeicheleien erinnerte. Ich konnte nicht umhin, mich in einem kleinen Spiegel prüfend zu betrachten, und ich glaubte, ihre Worte waren nicht so ganz unangebracht.
Als wir des Abends vom Gebet kamen, trat die Oberin in meine Zelle und sagte, nachdem sie mich eine Weile betrachtet:
»Ich weiß wirklich nicht, warum Sie einen so großen Widerwillen vor diesem Kleid hegen; es steht Ihnen wunderbar, und Sie sind reizend. Schwester Susanne ist eine schöne Nonne; Sie wird man aber noch mehr lieben. Nun lassen Sie einmal sehen; gehen Sie; Sie halten sich nicht gerade genug; Sie dürfen nicht so gebückt gehen...«
Sie richtete mir den Kopf, die Füße, die Hände; dann setzte sie sich und sagte zu mir:
»Es ist gut; jetzt wollen wir aber ein wenig ernsthaft reden. Zwei Jahre wären nun gewonnen; Ihre Eltern können ihren Entschluß ändern. Sie selbst würden vielleicht hierbleiben wollen, wenn jene Sie fortnehmen möchten, das wäre durchaus nicht unmöglich...«
»Madame; glauben Sie das nicht...«
»Sie sind lange unter uns gewesen, doch Sie kennen unser Leben noch nicht; es hat zweifellos seine Leiden, aber es hat auch seine Freuden.«
Man kann sich denken, was sie sonst noch von der Welt und von dem Kloster hinzufügen konnte; das steht überall geschrieben, und zwar überall in derselben Weise, denn Gott sei Dank hat man mich das ganze Zeug lesen lassen, das die Mönche über ihren Stand geschrieben haben, den sie recht wohl kennen und verabscheuen.
Die Einzelheiten eines Noviziats will ich nicht berühren; wenn man es mit der ganzen Strenge beobachtete, so würde man es nicht aushalten; so aber ist es die schönste Zeit des Klosterlebens. Eine Novizenmutter ist immer die nachsichtigste Schwester, die man finden kann; ihr ganzes Streben ist stets darauf gerichtet, einem alle Dornen des Standes zu verbergen, es ist gleichsam ein Kursus der feinsten und ausgeklügelsten Verführung. Unsere Novizenmutter schloß sich ganz besonders an mich an, und ich glaube nicht, daß eine junge unerfahrene Seele dieser verhängnisvollen Kunst zu widerstehen vermag. Hatte ich zweimal hintereinander geniest, so wurde ich von der Messe, vom Gebet, von der Arbeit entbunden; ich ging frühzeitig schlafen und stand spät auf. Die Klosterregel existierte nicht für mich.
Indessen kam die Zeit heran, die ich manchmal durch meine Wünsche zu beschleunigen versuchte. Nun wurde ich träumerisch und fühlte, wie mein Widerwille aufs neue erwachte, und sogar stärker und stärker wurde. Ich bekannte das der Oberin oder der Novizenmutter. Diese Frauen rächen sich bitter für die Langeweile, die wir ihnen bereiten, denn man darf nicht glauben, daß die heuchlerische Rolle, die sie spielen und die Dummheiten, die sie uns erzählen müssen, ihnen Spaß machen. Das wird ihnen schließlich sehr zuwider; doch sie entschließen sich dazu, und zwar für tausend Thaler, die ihrem Hause zufallen. Das ist der wichtige Gegenstand, für den sie ihr Leben lang lügen, und unschuldigen jungen Seelen, vierzig bis fünfzig Jahre lang oder gar ewig ein unglückliches Leben bereiten; denn sicherlich sind von hundert Nonnen, die vor dem fünfzigsten Jahre sterben, gerade fünfundsiebzig verdammt, ganz abgesehen von denen, die vorher wahnsinnig, blödsinnig oder rasend werden.
Eines Tages geschah es, daß eine der letzteren aus der Zelle, in der man sie gefangen hielt, entwich. Ich sah sie, und niemals war mir etwas Schrecklicheres zu Gesicht gekommen. Mit wirren Haaren und fast unbekleidet, schleppte sie eiserne Ketten nach sich; die Augen irrten wild umher, sie raufte sich die Haare, schlug sich mit den Fausten auf die Brust und lief heulend herum; dann suchte sie sich unter den schrecklichsten Verwünschungen aus dem Fenster zu stürzen. Das Entsetzen packte mich, ich zitterte an allen Gliedern, und da ich mein Schicksal in dem der Unglücklichen erkannte, so beschloß ich in meinem Herzen, lieber tausendmal zu sterben, als mich einer solchen Gefahr auszusetzen. Man ahnte, welche Wirkung dieses Ereignis auf meinen Geist ausüben könnte und glaubte, dem zuvorkommen zu müssen. Man erzählte mir von dieser Nonne lächerliche, widerspruchsvolle Lügen; sie wäre bereits geistesgestört gewesen, als man sie aufgenommen hätte; sie hätte in einer kritischen Zeit einen Schreck erlitten, wäre Visionen unterworfen und glaubte, mit den Engeln in Verkehr zu stehen. Sie hätte schändliche Bücher gelesen, die ihr den Geist zerrüttet, und sehe jetzt nur noch Dämonen, die Hölle und Flammenschlünde vor sich. Das alles machte auf mich nicht den geringsten Eindruck, denn jeden Augenblick kam mir die wahnsinnige Nonne in den Sinn, und ich schwor mir von neuem zu, keinerlei Gelübde abzulegen.
Dennoch war der Augenblick gekommen, in dem es sich darum handelte, zu zeigen, ob ich mir selbst Wort zu halten verstand. Eines Morgens nach der Messe trat die Oberin in mein Zimmer; sie hielt einen Brief in der Hand, und ihr Gesicht drückte Niedergeschlagenheit und Traurigkeit aus. Die Arme sanken ihr hernieder, und ihre Hand schien nicht die Kraft zu haben, den Brief zu halten. Ängstlich sah sie mich an, Thränen standen in ihren Augen, sie schwieg, und ich that dasselbe. Endlich fragte sie mich, wie ich mich befände, die Messe hätte heute recht lang gedauert, ich hätte ein wenig gehustet und schiene unpäßlich zu sein.
»Nein, teure Mutter,« antwortete ich darauf.
Sie hielt noch immer den Brief in der Hand; dann legte sie ihn auf die Kniee, und ihre Hand verdeckte ihn zum Teil; endlich, nachdem sie noch mehrere Fragen über meinen Vater und meine Mutter an mich gerichtet, sagte sie zu mir:
»Hier ist ein Brief.«
Bei diesen Worten fühlte ich, wie mir das Herz klopfte, und ich fügte mit zitternden Lippen hinzu:
»Ist er von meiner Mutter?«
»Sie haben es erraten; da, lesen Sie!«
Ich faßte mich ein wenig, las den Brief, und zwar zuerst mit ziemlicher Festigkeit, doch je weiter ich kam, desto lauter regten sich verschiedene Leidenschaften in mir, wie Zorn, Schreck, Entrüstung, Ärger. Stellenweise konnte ich das Papier kaum halten, oder ich hielt es, als hätte ich es zerreißen mögen, aber ich drückte es heftig, als fühlte ich mich versucht, es zu zerknittern und weit von mir zu werfen.
»Nun, mein Kind, was wollen wir darauf antworten?«
»Aber, Madame, Sie wissen es doch!«
»Nein, ich weiß nichts. Die Zeiten sind schlimm, Ihre Familie hat Verluste erlitten, die Vermögensverhältnisse Ihrer Schwestern sind zerrüttet; sie haben beide viele Kinder, man hat sich erschöpft, als man sie verheiratete und ruiniert sich, sie zu unterstützen. Es ist unmöglich, Ihnen eine sichere Lebensstellung zu bereiten; Sie haben das Ordenskleid angelegt; man hat sich damit in Unkosten gestürzt; durch diesen Schritt haben Sie Hoffnungen erweckt, und das Gerücht der bevorstehenden Ablegung Ihres Gelübdes hat sich in der Gesellschaft verbreitet. Rechnen Sie übrigens stets auf meinen Beistand. Ich habe niemals jemanden zum Eintritt in den Orden verlockt; das ist ein Stand, zu dem Gott uns beruft, und es ist sehr gefährlich, die menschliche Stimme mit der seinen zu vermischen. Ich will nicht versuchen, zu Ihrem Herzen zu sprechen, wenn die Gnade es Ihnen nicht sagt; bis heute habe ich mir noch nicht das Unglück eines andern vorzuwerfen, und soll ich damit bei Ihnen, mein Kind, die Sie mir so teuer sind, den Anfang machen? Ich habe nicht vergessen, daß Sie die ersten Schritte nur auf mein Zureden gethan haben, und werde nicht dulden, daß man Mißbrauch mit Ihnen treibe, um Sie gegen Ihren Willen zu etwas zu verpflichten. Verständigen wir uns also; Sie haben keine Neigung für den geistlichen Stand?«
»Nein, Madame!«
»Sie werden Ihren Eltern nicht gehorchen?«
»Nein, Madame!«
»Was wollen Sie dann werden?«
»Alles, nur nicht Nonne; ich will und werde es nicht!«
»Nun gut. Sie sollen es ja auch nicht werden. Doch einigen wir uns wegen einer Antwort an Ihre Mutter.«
Wir einigten uns über einige Gedanken. Sie schrieb einen Brief, der mir recht gut schien. Indessen sandte man mir den Beichtvater des Hauses; man schickte mir auch den Doktor, der mir bei meiner Einkleidung gepredigt hatte; ich sah den Bischof von Aleppo und mußte mit frommen Frauen, die sich in meine Angelegenheiten mischten, ohne daß ich sie kannte, Lanzen brechen; es fanden beständige Konferenzen mit Mönchen und Priestern statt; mein Vater kam; meine Schwestern schrieben mir; zuletzt erschien meine Mutter, doch ich widerstand allen. Indessen wurde der Tag meiner Einkleidung bestimmt, man ließ nichts unversucht, meine Einwilligung zu erlangen; doch als man sah, daß es unnütz war, faßte man den Entschluß, ohne meine Zustimmung zum Ziele zu gelangen.
II.
Von diesem Augenblick an war ich in meine Zelle eingeschlossen; man gebot mir Schweigen, ich wurde von aller Welt getrennt, mir selbst überlassen, und ich sah klar, daß man entschlossen war, ohne meine Einwilligung über mich zu verfügen. Ich wollte mich zu nichts verpflichten; das war mein fester Wille, und alle wahren und falschen Schrecken, in die man mich unaufhörlich stürzte, erschütterten mich nicht. Ich bekam niemand mehr zu sehen, weder die Oberin, noch die Novizenmutter, noch meine Gefährtinnen. Deshalb ließ ich die erstere benachrichtigen und that, als beuge ich mich dem Willen meiner Eltern; doch mein Plan war, dieser Verfolgung ein Ende zu machen und öffentlich gegen die Gewaltthat, die man mit mir im Sinne hatte, zu protestieren. Ich sagte also, man könne über mein Schicksal bestimmen, und darüber verfügen, wie man wolle. Jetzt herrschte Freude im ganzen Hause, und mit den Zärtlichkeiten kehrten auch die Schmeicheleien und die Verführungskünste wieder. Gott hatte zu meinem Herzen gesprochen, niemand war für den Zustand der Vollkommenheit besser geschaffen, als ich. Es war unmöglich, daß es hätte anders sein können; man hatte das stets erwartet. Man erfüllte seine Pflichten nicht mit solchem Eifer und solcher Ausdauer, wenn man sich nicht dazu wahrhaft berufen fühlt. Die Novizenmutter hatte nie bei einem ihrer Zöglinge eine besser zu Tage tretende Berufung bemerkt; sie war über die Laune, die ich gehabt, ganz überrascht gewesen, hatte aber stets zu unserer Oberin gesagt, man müsse nur zu warten wissen, es würde vorübergehen; die besten Nonnen hätten solche Momente gehabt, das wären Einflüsterungen des bösen Geistes, der seine Bemühungen verdoppelte, wenn er sieht, daß ihm seine Beute verloren geht; ich war im Begriff, ihm zu entwischen, und es würde von nun an für mich nur noch Rosen geben; die Pflichten des religiösen Lebens würden mir um so erträglicher erscheinen, als ich sie mir stark übertrieben vorgestellt hatte, und diese plötzliche Erschwerung des Joches wäre eine Gnade des Himmels, der sich dieses Mittels bedient, um es zu erleichtern.
Ich benahm mich sehr vorsichtig und glaubte, für mich bürgen zu können. Ich sah meinen Vater; er sprach in kühlem Tone mit mir; ich sah meine Mutter, sie umarmte mich, ich erhielt Glückwunschschreiben von meinen Schwestern und vielen andern. Ich erfuhr, daß ein Herr Sornin, Vikar von Saint-Roch, die Predigt halten und daß Herr Thierrn, Kanzler der Universität, mein Gelübde entgegennehmen würde. Alles ging gut, bis zum Vorabend des großen Tages, bis aus den Punkt, daß ich erfahren hatte, die Ceremonie würde heimlich stattfinden, es würden derselben sehr wenig Leute beiwohnen, und die Kirchenthür würde nur den Verwandten geöffnet werden. Deshalb ließ ich durch die Pförtnerin alle Personen aus der Nachbarschaft, alle meine Freunde und Freundinnen einladen; auch bekam ich die Erlaubnis, einigen meiner Bekannten zu schreiben. Alle diese Leute, die man nicht erwartet hatte, erschienen; man mußte sie eintreten lassen, und die Versammlung war ungefähr so groß, wie ich sie zu meinem Plane brauchte.
Man hatte schon am vorigen Abend alles vorbereitet, die Glocken wurden geläutet, um aller Welt zu verkünden, daß ein armes Mädchen unglücklich gemacht werden sollte.
Mir schlug das Herz heftig. Man schmückte mich, denn an diesem Tage wird sorgfältig Toilette gemacht, und wenn ich mir jetzt alle diese Ceremonien wieder vorstelle, so glaube ich, die Sache hat etwas Rührendes und Feierliches für ein unschuldiges junges Mädchen, das ihre Neigung nicht anderswohin zieht. Man führte mich in die Kirche; die heilige Messe wurde celebriert, der gute Vikar, der eine Entsagung bei mir voraussetzte, die ich nicht besaß, hielt eine Rede, in der auch nicht ein Wort enthalten war, das nicht mit meinen Gefühlen im Widerspruch gestanden hätte. Endlich rückte der schreckliche Augenblick heran; als ich in den Raum treten sollte, wo ich das Gelübde aussprechen mußte, fühlte ich, wie mir die Beine den Dienst versagten; zwei meiner Gefährtinnen nahmen mich unter den Arm; mein Kopf sank auf die Schulter der einen, und ich schleppte mich mühsam weiter. Ich weiß nicht, was in der Seele der Anwesenden vorging, doch sie sahen ein junges sterbendes Opfer, das man zum Altar trug, und von allen Seiten hörte ich Seufzer und Schluchzen; nur von meinem Vater und meiner Mutter hörte ich nichts.
Alle waren aufgestanden, mehrere junge Mädchen waren auf Stühle gestiegen und hielten sich an den Gitterstäben fest. Es trat eine tiefe Pause ein, dann sagte der Priester, der bei meiner Einkleidung den Vorsitz führte:
»Marie Susanne Simonin, geloben Sie Gott Keuschheit, Armut und Gehorsam?« Mit fester Stimme erwiderte ich ihm:
»Nein, mein Herr, nein.«
Er hielt inne und sagte:
»Mein Kind, fassen Sie sich, und hören Sie mich an!«
»Monseigneur,« versetzte ich, »Sie fragen mich, ob ich Gott Keuschheit, Armut und Gehorsam gelobe, ich habe Sie angehört und sage Ihnen: Nein!«
Damit wandte ich mich zu den Anwesenden, unter denen sich ein ziemlich lautes Gemurmel erhoben hatte; ich machte ein Zeichen, daß ich sprechen wollte, das Gemurmel hörte auf, und ich sagte:
»Ich nehme Sie zum Zeugen, meine Herren, und vor allem Sie, mein Vater und meine Mutter ...«
Bei diesen Worten ließ eine der Schwestern den Vorhang fallen, und ich sah ein, daß es unnütz war, fortzufahren. Die Nonnen umringten mich und überhäuften mich mit Vorwürfen, die ich anhörte, ohne ein Wort zu erwidern. Man führte mich in meine Zelle und schloß mich dort ein.