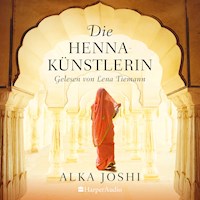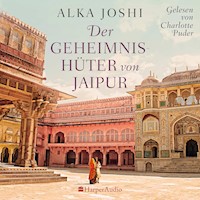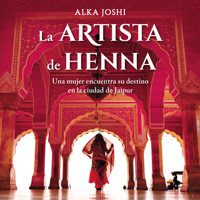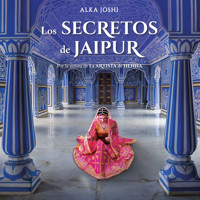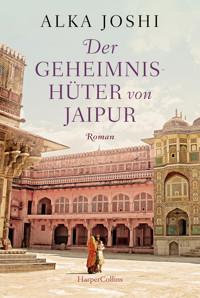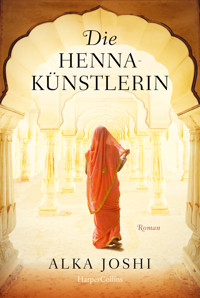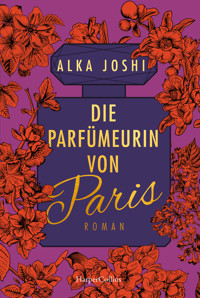
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Jaipur-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Paris, 1974. Radha liebt es, Mutter von zwei Töchtern zu sein. Doch nachdem ihr ein Job in einer Parfümerie angeboten wird, wird schnell klar, dass Radha neben dem Muttersein noch eine Leidenschaft hat: Düfte. Jetzt, zehn Jahre später, arbeitet sie für einen Meisterparfümeur und baut allmählich ihre Karriere auf, während privat immer mehr Sorgen in das Leben der mittlerweile erfahrenen Parfumeurin treten. Vor allem die Frustration ihres Mannes Pierre darüber, dass sie arbeiten will, ist eine Belastung. Mit ihrem ersten großen Projekt beauftragt reist Radha nach Indien, wo sie die Hilfe ihrer Schwester Lakshmi und der Kurtisanen von Agra in Anspruch nimmt - Frauen, die die Macht der Düfte nutzen, um zu verführen, zu reizen und zu locken. Sie steht kurz vor ihrem Durchbruch, als sie herausfindet, dass der Sohn, von dem sie ihrem Mann nie erzählt hat, auf dem Weg nach Paris ist, um sie zu finden. Ein Geheimnis, das nicht nur ihre sorgfältig geordnete Welt ins Wanken bringt, sondern auch eine gefährdete Ehe zu zerstören droht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 561
Ähnliche
Zum Buch
Paris, 1974. Radha lebt mit ihrem Mann Pierre und ihren beiden Töchtern in Paris. Sie trauert immer noch um den kleinen Jungen, den sie vor Jahren aufgeben musste, als sie selbst noch ein Kind war, aber sie liebt es, ihren Töchtern eine Mutter zu sein, und sie hat endlich ihre Leidenschaft gefunden – die Schatzkammer der Düfte. Die junge Frau hat eine aufregende und herausfordernde Stelle bei einem Meisterparfümeur, wo sie dabei hilft, völlig neue Düfte für Kunden zu entwerfen und ihre Karriere mit einem Duft nach dem anderen aufzubauen. Sie wünschte nur, Pierre könnte ihr Bedürfnis zu arbeiten verstehen. Sie spürt seine Frustration, doch kann sie das, was sie antreibt, nicht aufgeben. Mit ihrem ersten großen Projekt beauftragt, reist Radha nach Indien, wo sie die Hilfe ihrer Schwester Lakshmi und der Kurtisanen von Agra in Anspruch nimmt – Frauen, die die Macht der Düfte nutzen, um zu verführen, zu reizen und zu locken. Sie steht kurz vor einem Durchbruch, als sie erfährt, dass der Sohn, von dem sie ihrem Mann nie erzählt hat, auf dem Weg nach Paris ist, um sie zu finden – und damit ihre sorgfältig geordnete Welt ins Wanken bringt und eine gefährdete Ehe zu zerstören droht.
Zur Autorin
Alka Joshi wurde in Indien geboren und lebt seit ihrem neunten Lebensjahr in den USA. Sie hat in Stanford studiert und besitzt einen Master of Fine Arts vom California College of Arts. Mit 62 Jahren veröffentlichte Alka Joshi ihren Debütroman Die Hennakünstlerin. Der Roman stand monatelang auf der Bestsellerliste der New York Times und wird momentan als TV-Serie verfilmt.
Weitere Bücher von Alka Joshi:
Die Hennakünstlerin
Der Geheimnishüter von Jaipur
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem TitelThe Perfumist of Paris bei bei Mira Books, Toronto.
© 2023 by Alka Joshi
Deutsche Erstausgabe
© 2024 für die deutschsprachige Ausgabe
by HarperCollins in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Covergestaltung von zero-media.net, München
Coverabbildung von FinePic®, München
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783749906871
www.harpercollins.de
Widmung
Für meine Brüder Madhup und Piyush Joshi, die mich davon überzeugten, weiter zu gehen, als ich mir je erträumt hätte. Und an alle, die glauben, dass sie es nicht können: Ihr könnt es.
Zitat
Der Geruch ist ein mächtiger Zauberer, der dich über Tausende von Meilen und all die Jahre deines Lebens hinwegträgt.
Helen Keller
Das Schöne an Düften ist, dass sie Ihr Herz und hoffentlich auch das von anderen ansprechen.
Elizabeth Taylor
Auftretende Personen
In Paris
Radha Fontaine: 32, Mutter von Asha und Shanti; Laborassistentin im Maison d’Yves, einem spezialisierten Parfümhaus in Paris
Pierre Fontaine: 42, Radhas Ehemann; Vater von Asha und Shanti; arbeitet als Architekt am Centre Pompidou in Paris
Florence Fontaine: 67, Pierres Mutter; stammt aus einer wohlhabenden Pariser Familie; ist jetzt in mehreren Gremien und Komitees aktiv
Shanti Fontaine: 9, Tochter von Radha und Pierre
Asha Fontaine: fast 7, Tochter von Radha und Pierre
Mathilde: 32, Radhas älteste Freundin aus der Auckland-House-Schule; Single; stammt aus einer wohlhabenden Pariser Familie
Delphine Silberman: 60, Meisterparfümeurin im Maison d’Yves
Celeste: Delphines Sekretärin
Michel LeGrand: dienstältester Laborassistent von Delphine im Maison d’Yves
Ferdie (Ferdinand): einer von Delphines Laborassistenten im Maison d’Yves
Yves du Bois: Eigentümer des Maison d’Yves – ein spezialisiertes Parfümhaus
Agnes: Mathildes Mutter; zog früher als Hippie durch Indien, bis die Demenz sie dazu zwang, nach Paris zurückzukehren
Antoine: verstorben, Vater von Agnes und Großvater von Mathilde; früherer Besitzer einer exklusiven Pariser Parfümerie
In Agra
Hazi und Nasreen: 55 und 54, Schwestern und Besitzerinnen einer Kotha, eines renommierten Vergnügungshauses
Mr. Metha: Besitzer einer indischen Attar-Manufaktur
Hari Shastri: 51, Lakshmis Ex-Ehemann; als 17-Jähriger heiratete er Lakshmi, die ihn aber zwei Jahre später verließ; jetzt besitzt Hari eine Manufaktur für Räucherwerk in Agra
Binu: Teenager, Küchenhilfe in Hazis und Nasreens Vergnügungshaus
In Jaipur
Kanta Agarwal: 45, Ehefrau von Manu Agarwal; Adoptivmutter von Niki, Radhas leiblichem Sohn
Manu Agarwal: 45; Ehemann von Kanta; Adoptivvater von Niki; Liegenschaftsdirektor im Palast von Jaipur
Niki Agarwal: 18, Adoptivsohn von Kanta und Manu; Radhas leiblicher Sohn
Baju: ein alter Diener von Kantas und Manus Familie
Saasuji: Kantas Schwiegermutter; wenn eine Frau ihre Schwiegermutter direkt anspricht, nennt sie sie respektvoll »Saasuji«.
Munchi: alter Mann aus dem kleinen Dorf Ajar, der Lakshmi das Zeichnen und Radha das Mischen von Farben beigebracht hat
In Shimla
Lakshmi Kumar: 49, Radhas ältere Schwester; Leiterin des Lady-Bradley-Heilkräutergartens in Shimla; arbeitet in Teilzeit mit ihrem Ehemann, Dr. Jay Kumar, in der Gemeindeambulanz in Shimla
Malik: 26, unterstützte Lakshmi bei ihrer Arbeit als Hennakünstlerin in Jaipur; leitet jetzt das Heilkräutergarten-Geschäft in Shimla
Jay Kumar: 57, Lakshmis Ehemann; Arzt im Lady-Bradley-Hospital in Shimla; früherer Mitbewohner von Samir Singh in Oxford
Nimmi: 28, mit Malik verheiratet; Mutter von Chullu und Rekha (aus einer früheren Ehe); lebt mit ihrer Familie zusammen mit Lakshmi und Jay in deren Haus
Madho Singh: sprechender Alexandersittich, der Malik vor 18 Jahren von der Maharani Indira aus Jaipur geschenkt wurde
In Amerika
Parvati Singh: 53, Ehefrau von Samir Singh; Mutter von Ravi und Govind Singh; entfernt mit der königlichen Familie von Jaipur verwandt; ehemalige führende Dame der Gesellschaft in Jaipur
Samir Singh: 57, Ehemann von Parvati Singh und Vater von Ravi und Govind Singh; ehemals ein renommierter Architekt in Jaipur aus einer Rajputen-Familie aus einer hohen Kaste; führt jetzt ein florierendes Immobilienunternehmen in Los Angeles
Ravi Singh: 36, Sohn von Parvati und Samir Singh; mit Sheela Sharma verheiratet; Vater von zwei Töchtern; arbeitet im Immobiliengeschäft seiner Familie in Los Angeles
Sheela Singh: 34, mit Ravi Singh verheiratet; Mutter zweier Töchter; lebt mit ihrer Familie und ihren Schwiegereltern zusammen in Los Angeles
Prolog
Prolog
Stell dir vor, du läufst mit deinen Freunden durch ein Feld mit Lavendelbüschen. Ihr spielt Verstecken zwischen den Reihen von Jasminranken.« Antoine schloss die Augen. »Deine Freundin kitzelt deine Nase mit einem Grashalm, und du erkennst allein am Geruch, dass er von den Wiesen unten am Hügel stammt und nicht von denen oben am Hang. Stell dir vor, du pflückst eine reife Tomate im Garten deiner Mutter, nur um ihr intensives Aroma tief einzuatmen.« Er seufzte. »Genau so sah eine Kindheit in Grasse aus.«
Ich brauchte mir das nicht vorzustellen. Der zarte Duft der Hennablüte begrüßte mich auf meinem Weg zum Flussufer beim Dorf, wo ich die Kleider wusch. Mir lief das Wasser im Mund zusammen beim Duft der Mangos, an denen Prem sich gütlich tat, während seine Ochsen Weizen und Mais zu Mehl mahlten, und der mich an reife Melonen erinnerte. Und in dem Moment, in dem ich Ganesh meinen kostbarsten Besitz darbot, das Peepal-Blatt, das Munchi-ji für mich mit dem Milchmädchen Radha, meiner Namensschwester, und Krishna bemalt hatte, und meine Hände faltete, um den Gott um Glück zu bitten, atmete ich tief den Sandelholzgeruch ein.
So wie die von Antoine waren auch meine Erinnerungen durchzogen von den wunderbarsten Düften. Genauso wie meine Geheimnisse.
Teil eins
Teileins
Paris – 2. September 1974
Europäer tauschten einst Gold gegen Nelken aus Südindien ein, um das Gewürz auf den Böden in ihren Häusern zu verteilen, damit es den Geruch ihrer Füße aufnahm.
Paris
2. September 1974
Schon beim ersten Klingeln gehe ich an den Apparat; ich weiß, dass sie es ist. Sie ruft mich immer an seinem Geburtstag an. Nicht, um mich an den Tag zu erinnern, an dem er auf die Welt kam, sondern um mir zu zeigen, dass ich mit meinen Erinnerungen nicht allein bin.
»Jiji?«, sage ich leise. Ich will Pierre und die Mädchen nicht aufwecken.
»Kaisa ho, Choti Behen?«, fragt meine Schwester. Ich kann das Lächeln in ihrer Stimme hören und antworte mit meinem eigenen. Es ist so schön, hier in meinem Pariser Appartement viertausend Meilen entfernt Lakshmis weiches Hindi zu hören. Ich habe sie immer Jiji – große Schwester – genannt, aber sie mich nicht immer Choti Behen. Es war Malik, der mich bei unserer ersten Begegnung in Jaipur vor neunzehn Jahren als kleine Schwester bezeichnete, und er ist noch nicht einmal mit Jiji und mir blutsverwandt. Er war nur ihr Lehrling. Meine Schwester fing erst später an, mich Choti Behen zu nennen, nachdem unser Leben in Jaipur völlig auf den Kopf gestellt worden war, was uns am Ende dazu zwang, nach Shimla zu ziehen.
Heute wird meine Schwester über alles Mögliche mit mir reden, nur nicht über den Grund ihres Anrufs. Sie hat keinen anderen Weg gefunden, um sicherzustellen, dass ich es an diesem besonderen Tag schaffe, aufzustehen, nicht in der Dunkelheit versinke, am zweiten September jedes Jahres, dem Tag, an dem mein Sohn Niki geboren wurde.
Diese Tradition besteht seit seinem ersten Geburtstag, 1957. Ich hatte Niki bald nach seiner Geburt hergeben müssen, da war ich gerade einmal vierzehn Jahre alt. Jiji kam mit einem Picknickkorb in der Schule an; sie hatte von der Schuldirektorin die Erlaubnis erwirkt, dass ich dem Unterricht fernbleiben durfte. Wir waren kurz zuvor von Jaipur nach Shimla gezogen, und ich musste mich noch an unser neues Zuhause gewöhnen. Ich glaube, Malik war der Einzige von uns, der problemlos mit den kühleren Temperaturen und der dünneren Luft im Himalaya zurechtkam, aber jetzt, wo er mit seiner eigenen Schule, der Bischof-Cotton-Jungenschule beschäftigt war, sah ich ihn seltener.
Wir hatten gerade Geschichte, als Jiji in der Tür erschien und mich mit einem Lächeln zu sich rief. Ich verließ den Raum, und sie sagte: »Es ist solch ein wunderschöner Tag, Radha. Sollen wir eine Wanderung machen?« Ich sah an meiner Schuluniform aus einem Wollblazer und -rock hinunter auf meine steifen Lacklederschuhe und fragte mich, was in sie gefahren war. Sie lachte und meinte, ich solle die Sachen anziehen, die ich im Naturerlebnislager trug, das unsere Sportlehrerin jeden Monat auf den Stundenplan setzte. Ich wollte schon ablehnen, denn bereits beim Aufwachen am Morgen hatte ein schwerer Druck auf meiner Brust gelastet, aber ein Blick in ihr strahlendes Gesicht sagte mir, dass ich sie nicht abweisen konnte. Sie hatte meine Lieblingsgerichte fürs Picknick zubereitet. Makki ki Roti, aus dem das Ghee tropfte. Palak Paneer, so cremig, dass ich mir immer eine zweite Portion nehmen musste. Gemüse-Korma. Und Chole, das Kichererbsencurry mit reichlich frischem Koriander.
An jenem Tag wanderten wir den Jakhu Hill hinauf. Ich erzählte ihr, dass ich Mathematik hasste, aber meine reizende alte Lehrerin mochte. Dass meine Zimmergenossin Mathilde im Schlaf pfiff. Jiji erzählte mir, dass Madho Singh, Maliks sprechender Sittich, angefangen hatte, Punjabi-Wörter zu lernen. Sie nahm ihn mittlerweile in die Gemeindeambulanz mit, um die Patienten zu beschäftigen, während sie darauf warteten, von ihr und Dr. Jay behandelt zu werden. »Die Bergmenschen haben ihm die Wörter beigebracht, die sie fürs Hüten ihrer Schafe verwenden, und er benutzt dieselben Wörter jetzt, um Patienten im Wartezimmer zu hüten!« Sie lachte, und ich fühlte mich leichter. Ich habe ihr Lachen immer geliebt; es klingt wie die Tempelglocken, die die Gläubigen anschlagen, um von Bhagwan gesegnet zu werden.
Als wir den Tempel am Ende des Wegs erreicht hatten, hielten wir an, um etwas zu essen, und sahen den Affen zu, die in den Bäumen tobten. Ein paar der kühneren Makaken beäugten unser Mittagessen aus nur wenigen Fuß Entfernung. Ich begann, ihr eine Geschichte über das Shakespeare-Stück zu erzählen, das wir in der Schule aufführen wollten, und hielt abrupt inne, als ich mich an die Theaterproben gemeinsam mit Ravi erinnerte, das Vorspiel für unsere Liebelei. Auch damals war es Shakespeare gewesen. Ich erstarrte, und da wusste sie, dass es Zeit war, die Unterhaltung in weniger gefährliches Fahrwasser zu lenken; sie wechselte geschmeidig das Thema und berichtete mir, wie oft sie Dr. Jay beim Backgammon geschlagen hatte.
»Ich lasse Jay denken, dass er gewinnt, bis ihm klar wird, dass das nicht der Fall ist.« Lakshmi grinste.
Ich mochte Dr. Kumar damals schon (Dr. Jay für Malik und mich), er hatte sich hier in Shimla um mich gekümmert, als ich mit Niki schwanger war. Mir war als Erste aufgefallen, dass er seine Augen nicht von Lakshmi abwenden konnte, was sie abtat; für sie waren sie beide nur gute Freunde. Und jetzt ist sie schon seit elf Jahren mit ihm verheiratet! Er ist gut zu ihr – besser als ihr Ex-Ehemann. Brachte ihr das Reiten bei. Anfangs fürchtete sie sich davor, so hoch über dem Boden zu sitzen (insgeheim denke ich, dass sie Angst davor hatte, die Kontrolle zu verlieren), aber jetzt kann sie sich ihr Leben ohne ihren Lieblingswallach Chandra nicht mehr vorstellen.
Ich bin so in die Erinnerungen an die scharfen Gerüche von Shimlas Kiefern, des frischen Heus, das Chandra so liebt, an den Duft von Limettenrasierwasser und Antiseptikum am Kittel von Dr. Jay versunken, dass ich Lakshmis Frage überhöre. Sie wiederholt sie. Meine Schwester kann unendlich geduldig sein; das musste sie oft genug bei jenen Damen der Gesellschaft in Jaipur beweisen, deren Körper sie stundenlang mit Hennapaste bemalte.
Ich werfe einen Blick auf die Uhr an der Wand in meinem Wohnzimmer. »Nun, in einer Stunde werde ich die Mädchen wecken und ihnen Frühstück machen.« Ich gehe hinüber zu den Balkonfenstern, um die Vorhänge zu öffnen. Heute ist es bedeckt, aber etwas wärmer als gestern. Dort unten schlängelt sich ein Moped zwischen den geparkten Autos auf unserer Straße durch. Ein älterer Herr schließt die Tür seines Ladens wenige Meter vom Eingang zu unserem Appartementgebäude auf, die Schlüssel klirren in seiner Hand. »Die Mädchen und ich gehen vielleicht noch ein Stück, bevor wir in die Metro einsteigen.«
»Bringt denn das Kindermädchen sie nicht in die Schule?«
Ich wende mich vom Fenster ab und erkläre Jiji, dass wir unser Kindermädchen ganz plötzlich entlassen mussten und es jetzt meine Aufgabe ist, meine Töchter zur internationalen Schule zu bringen.
»Was ist passiert?«
Glücklicherweise kann Jiji nicht sehen, wie ich erröte. Es ist mir peinlich, zuzugeben, dass meine neunjährige Tochter Shanti ihr Kindermädchen auf den Arm gehauen hat und Yasmin daraufhin das tat, was sie mit ihren Kindern zu Hause in Algerien getan hätte: Sie gab Shanti eine Ohrfeige. Selbst als ich das erzähle, spüre ich die Schuld wie Nadelstiche in der empfindlichen Haut gleich unterhalb meines Bauchnabels. Was ist das für eine Mutter, deren Kind andere angreift? Habe ich ihr nicht beigebracht, was richtig und was falsch ist? Liegt es daran, dass ich sie vernachlässige und lieber Trost in meiner Arbeit suche, statt ein Mädchen aufzuziehen, das mich vor Herausforderungen stellt? Herausforderungen, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob ich ihnen gewachsen bin? Ist es nicht genau das, was Pierre angedeutet hat? »Genau das passiert, wenn eine Mutter ihre Arbeit über ihre Familie stellt«, kann ich ihn fast sagen hören. Ich fasse mir an die Stirn. Warum nur hat er Yasmin gefeuert, ohne vorher mit mir zu sprechen? Ich hatte nicht einmal die Chance, zu verstehen, was dort passiert war, und jetzt erwartet mein Ehemann, dass ich einen Ersatz für sie finde. Warum muss ich die Lösung für ein Problem finden, das ich nicht verursacht habe?
Meine Schwester erkundigt sich nach meiner Arbeit. Das Terrain ist sicherer. Mein Unbehagen weicht der Aufregung. »Ich arbeite gerade an einer Formel für Delphine. Ihrer Ansicht nach wird das der Lieblingsduft der nächsten Saison sein. Ich bin jetzt in der dritten Runde des Iterationszyklus. Es ist wirklich bemerkenswert, wie sie es versteht, eine Zutat zurückzufahren und nur einen Hauch von einer anderen hinzuzufügen, damit der Duft ein Erfolg wird, Jiji.«
Ich kann ewig über Düfte sprechen. Wenn ich eine Formel anmische, kann es passieren, dass ich mich erst Stunden später einmal strecke oder das Labor für ein Glas Wasser und ein Schwätzchen mit Delphines Sekretärin Celeste verlasse. Oft ist es auch Celeste, die mich daran erinnert, dass es Zeit ist, die Mädchen von der Schule abzuholen, wenn ich gerade kein Kindermädchen habe. Und wenn ich eins habe, erkundigt Celeste sich beiläufig, was ich zum Abend kochen will, um mir so mitzuteilen, dass ich zu arbeiten aufhören muss, um rechtzeitig nach Hause zu kommen. Wenn Pierre kocht, bleibe ich nur zu gerne eine weitere Stunde im Labor, bevor ich mein Tagewerk beende. Es ist friedlich dort. Und ruhig. Und die Düfte – Honig und Nelke, Vetivergras, Jasmin und Zeder, Myrrhe, Gardenie und Moschus – sind solch tröstliche Gefährten. Sie verlangen nichts von mir außer der Freiheit, die Welt mit ihrer Essenz zu durchdringen. Meine Schwester versteht das. Sie hat mir erzählt, wie früher alles von ihr abfiel – Zeit, Pflichten, Sorgen –, wenn sie das Schilfrohr in die Hennapaste tauchte und damit über die Handfläche, den Oberschenkel oder den Bauch einer Kundin glitt, um eine türkische Feige oder ein Boteh-Blatt oder ein schlafendes Baby zu zeichnen.
Meine Tochter Asha hat demnächst Geburtstag. Sie wird sieben, aber ich weiß, dass Jiji das nicht ansprechen wird. Heute wird meine Schwester keinerlei Geburtstage, Babys oder Schwangerschaften erwähnen, denn diese Themen würden schmerzliche Erinnerungen in mir wecken. Lakshmi weiß, wie hart ich daran gearbeitet habe, die Existenz meines Erstgeborenen zu verdrängen, das Baby, das ich zur Adoption freigeben musste. Ich war kaum mit der achten Klasse fertig, als Jiji mir erklärte, warum meine Brüste plötzlich so empfindlich waren, warum ich unter diffuser Übelkeit litt. Wie gerne wollte ich Ravi die gute Nachricht überbringen: Wir würden ein Kind bekommen! Ich war mir so sicher, dass er mich heiraten würde, wenn er erfuhr, dass er Vater wurde. Aber bevor ich es ihm erzählen konnte, schickten seine Eltern ihn nach England, damit er dort den Highschool-Abschluss machte. Seitdem habe ich ihn nicht wiedergesehen. Weiß er, dass wir einen Sohn bekommen haben? Dass unser Baby Nikhil heißt?
Ich wollte mein Kind unbedingt behalten, aber Jiji bestand darauf, dass ich meinen Schulabschluss machte. Als knapp Vierzehnjährige war ich zu jung, um Mutter zu sein. Was für eine Erleichterung, als die engsten Freunde meiner Schwester, Kanta und Manu, sich bereit erklärten, das Baby als ihr eigenes aufzuziehen, und mich dann als sein Kindermädchen, seine Ayah einstellten. Sie sehnten sich nach einem Kind, verfügten über das Geld und ein leeres Kinderzimmer. Ich konnte den ganzen Tag mit Niki zusammen sein, ihn wiegen, in den Schlaf singen, seine pfefferkorngroßen Zehen küssen, mich so fühlen, als würde er ganz mir gehören. Doch nach zwei Monaten begriff ich, dass ich in erster Linie Schaden anrichtete, dass ich Kanta und Manu wehtat, weil ich wollte, dass Niki nur mich liebte.
In jener Zeit dachte ich jede Minute an ihn. An die Locke auf der einen Seite seines Kopfes, die sich nicht bändigen ließ. Wie sein Bauchnabel hervorstach. Wie gierig seine pummeligen Fingerchen nach der Milchflasche griffen, die ich ihm doch nicht geben sollte. Kanta hatte gerade ihr eigenes Baby verloren und wollte Niki gerne selbst die Brust geben. Das machte mich eifersüchtig – und wütend. Warum durfte sie mein Baby stillen und so tun, als wäre es ihres? Ja, es war besser für ihn, wenn er sie als seine neue Mutter akzeptierte, aber dennoch. Ich hasste sie dafür.
Ich wusste, dass ich so lange, wie ich in Kantas Haus blieb, Niki davon abhalten würde, die Frau zu lieben, die ihn aufziehen wollte und langfristig für ihn sorgen konnte. Auch Lakshmi erkannte das, aber sie überließ die Entscheidung mir. Am Ende sah ich nur eine einzige Möglichkeit. Ich verließ ihn. Und tat fortan mein Allerbestes, mir einzureden, dass er nie existiert hatte. Wenn ich mich selbst davon überzeugen konnte, dass die Stunden, die Ravi Singh und ich mit dem Proben von Shakespeare verbrachten – unsere Körper als Othello und Desdemona einander fest umklammernd, uns gegenseitig bis zur Erschöpfung förmlich verschlingend –, nur ein Traum gewesen waren, konnte ich mir doch bestimmt auch einreden, dass unser Baby nur ein Traum war.
Und es funktioniert. An allen Tagen außer dem zweiten September.
Seit ich Jaipur verlassen habe, schickt Kanta Briefe, die so dick sind, dass ich sie gar nicht öffnen muss, um zu wissen, was sie enthalten: Fotos von Niki, dem Baby, dem Kleinkind, dem Jungen. Ich schicke alle zurück, ungeöffnet, sicher in dem Wissen, dass die Vergangenheit mich dann nicht berühren, mein Herz nicht zerreißen, mich nicht blutend zurücklassen kann.
Bei meinem letzten Besuch in Shimla zeigte Jiji mir einen ähnlichen Umschlag, der an sie adressiert war. Ich erkannte das blaue Papier wieder, Kantas elegante Handschrift – die Buchstaben g und y graziös verschlungen – und schüttelte den Kopf. »Wenn du dazu bereit bist, können wir uns die Fotos gemeinsam ansehen«, sagte Jiji.
Aber das werde ich niemals sein.
Heute überstehe ich Nikis achtzehnten Geburtstag wie im Nebel, so wie immer. Ich weiß, dass der morgige Tag besser sein wird. Morgen werde ich das tun können, was ich heute nicht schaffe. Ich werde die Erinnerung an meinen Erstgeborenen so fest in mir verschließen, als würde ich den Deckel eines stählernen Tiffins fürs Mittagessen verschließen, um sicherzugehen, dass nicht ein Tropfen Masala Dal herausfließen kann.
Paris – Oktober 1974
Eine Zutat, die sich in fast jedem westlichen Parfüm finden lässt – aus den Wurzeln von Vetivergras extrahiertes Öl –, ist holzig, rauchig, erdig, perfekt für Herrendüfte.
Paris
Oktober 1974
Ich schwenke das Parfümtestpapier unter meiner Nase. Dreimal schon habe ich die Formel angemischt, aber irgendetwas stimmt nicht. Also schaue ich noch einmal in die Auftragsbeschreibung. Der Kunde hat einen Duft bestellt, der erdig, aber kühl und leicht ist, so wie die belaubte mittlere Schicht eines Waldes – nicht das feuchte Gestrüpp darin. In der Probe, die ich vor acht Stunden angemischt habe, hält sich der stechende Geruch von verfaulendem Holz. Delphine wird nicht erfreut sein.
Ich werfe einen Blick auf die Uhr an der Wand auf der anderen Seite des Duftlabors. Zehn vor zwei. Um Punkt zwei Uhr wird Delphine hier sein. Sie kommt immer pünktlich. Von den Meisterparfümeuren im Maison d’Yves besteht sie als Einzige darauf, ihre Assistenten im Labor aufzusuchen; die anderen beiden Meisterparfümeure bitten ihre Assistenten, ihnen Proben ins Büro zu bringen. In unserem winzigen Labor vermischen sich mehr als dreitausend Duftnoten zu einem ganz eigenen Parfüm, und ich glaube, dass sie das liebt. Jedes Mal, wenn sie das Labor betritt, sehe ich, wie sie kurz die Augen schließt. Ob sie sich selbst auf die Probe stellt und versucht, so viele verschiedene Düfte wie möglich zu identifizieren, bevor sie zu einem von uns hinübergeht? Für mich, die ich schon seit fünf Jahren im Labor arbeite, ist die Flut der Duftnoten nicht mehr als ein Hintergrundrauschen. Ich konzentriere mich immer nur auf die Formel, die ich gerade anmische.
Direkt gegenüber von mir richtet Michel das Tablett mit den Düften an, die er für ein anderes von Delphines Projekten angemischt hat. Sein Arbeitsplatz ist makellos, als wäre er immer für eine Inspektion bereit. Er ist in den Vierzigern, ein Jahrzehnt älter als ich, und der erfahrenste Laborassistent von uns. Delphine wird zuerst zu ihm gehen. Michels Arbeit besteht hauptsächlich darin, die Düfte, die von Kunden abgenommen wurden, zu Eau de Parfum, Eau de Toilette, Eau de Cologne und Eau Fraîche weiterzuentwickeln.
Ferdie, der mit richtigem Namen Ferdinand heißt, arbeitet zu meiner Rechten. Sein Platz ist unordentlich und schlampig; manchmal beobachte ich, wie Delphine ihn sich genau ansieht, sich aber eines Kommentars enthält. Durch die Glaswand, die unser Labor vom Empfangsschalter trennt, sehe ich, wie er Delphines Sekretärin etwas erzählt; Ferdie ist ein ausgezeichneter Geschichtenerzähler. Schon bevor er fertig ist, fängt Celeste zu lachen an. Ihr Telefon läutet, und sie scheucht ihn weg, immer noch kichernd.
Unsere Arbeitsplätze erinnern alle ein wenig an eine Kirchenorgel. Vor uns befinden sich in einem Halbkreis angeordnet drei Reihen von Phiolen mit Düften – fast dreihundert Stück –, sodass gerade noch genug Platz auf dem Tisch bleibt für eine winzige Waage, ein Tablett mit Pipetten, einen Becher mit Teststreifen – alle so breit wie ein Bleistift – und ein Notizbuch, in welchem wir unsere Versuche dokumentieren. Ich habe meine Parfümorgel nach Duftfamilien sortiert. Am Anfang stehen die pudrigen, betäubenden Blumendüfte – Orangenblüten, Damaszenerrose, Lavendel, Maiglöckchen. Die nächste Reihe von Flaschen enthält süße, fruchtig-saftige Düfte wie Zitrone, Bergamotte und Mango. Es gibt eine Gruppe von robusten grünen Bouquets – Kiefernnadeln und Rosmarin zum Beispiel – und natürlich die beständige, profunde Gourmand-Familie von Düften wie Schokolade, Vanille und Nelke. Die erdigen Hölzer nehmen die oberste Reihe ein: Vetivergras, Sandelholz, Rosenholz und Zeder, um nur einige zu nennen.
Im Labor werden jedem von uns Aufträge zugeteilt. Die Instruktionen beschreiben, was der Kunde – ob nun eine größere Parfümmarke, ein Modedesigner oder ein Unternehmen für Schönheitsprodukte – kreieren möchte. Für jedes Projekt entwickelt Delphine verschiedene potenzielle Formeln, wobei sie ihre Kenntnisse von Tausenden von Gerüchen als Basis nutzt. Ihre Kreationen können zwischen zehn und fünfzig Bestandteile enthalten. Unsere Aufgabe als Laborassistenten ist es, ihre Formel anzumischen, wobei wir eine Pipette benutzen, um alle Bestandteile akkurat auf der Waage abzumessen und mit einer geringen Menge Alkohol zu vermischen. Handelt es sich bei dem Bestandteil um einen Feststoff, wie das nach Moschus riechende wächserne Ambra (erstaunlicherweise ein Abfallprodukt aus der Verdauung von Pottwalen!) oder ein dunkles und würziges Harz wie Weihrauch oder Myrrhe, müssen wir ihn erst zu einem feinen Pulver mahlen oder pressen, bevor wir ihn der Mixtur hinzufügen können. Wenn ein ätherisches Öl wie Rose oder Fenchel im Kühlschrank aufbewahrt wird, damit es länger hält, müssen wir es erst auf Zimmertemperatur bringen, bevor wir es verwenden. Nachdem wir dann Delphines Formeln angemischt haben, tauchen wir die bleistiftdünnen Teststreifen in unsere Probe und riechen daran, um sicherzugehen, dass wir auch das zusammengestellt haben, was sie uns vorgegeben hat. Das erfordert Erfahrung und Zeit und die Fähigkeit, Aromen zu unterscheiden. Ich bin schon seit fünf Jahren dabei und lerne immer noch.
Ich lese die Formel, an der ich arbeite, zum zehnten Mal, vielleicht habe ich ja irgendetwas übersehen. Hat die Vorliebe meiner Chefin für holzige Düfte möglicherweise dazu geführt, dass sie eine größere Menge Vetivergras vorgegeben hat, als das Parfüm braucht? Ich überprüfe noch einmal die Kalibrierung meiner Waage. Selbst die winzigste Abweichung bei den Mengen von Rohstoffen kann den Duft verändern. Ich nage an meiner Unterlippe. Soll ich die Formel abliefern, die Delphine konzipiert hat? Oder sollte ich mit einer leicht abgewandelten Formel herumexperimentieren, die möglicherweise die Erwartungen des Kunden erfüllt? Ich habe Delphines Formeln noch nie zuvor infrage gestellt, und als die unerfahrenste Laborassistentin habe ich auch keinerlei Recht dazu, das jetzt zu tun.
Ich werfe einen Blick zu Michel hinüber, unserem Laborleiter. Als Yves du Bois Delphine von einem anderen Parfümhaus in Paris abgeworben hat, versprach er ihr ein engagiertes Labor mit ihren eigenen Assistenten: Michel, den sie von ihrem früheren Arbeitsplatz mitgebracht hat, und Ferdie, der zufälligerweise Yves Neffe ist.
Michel hat einen Abschluss in Chemie. Er arbeitet seit neun Jahren mit Delphine zusammen. In der ganzen Zeit, die ich hier schon bin, ist er auf Distanz geblieben und redet nur mit mir, wenn es notwendig ist. Wenn er mich anspricht, sieht er mir kaum in die Augen. Ich habe mich oft gefragt, ob er missgünstig ist. Ich hatte erst ein Jahr Chemieunterricht, bevor Delphine mich eingestellt und damit angefangen hat, mich zur Nachwuchslaborassistentin auszubilden. Ich bin eine zweiunddreißigjährige Inderin, keine Französin, wie all die anderen Angestellten der Firma. Die meisten sind noch nie in Indien gewesen und haben auch nicht den Wunsch geäußert, dorthin zu reisen. Für sie bin ich eine Anomalie, eine Kuriosität, und das nicht unbedingt im positiven Sinn.
Ferdie ist ein paar Jahre jünger als ich. Er hat ebenfalls einen Abschluss in Chemie, aber ich bezweifle, dass er dafür brennt, einmal Meisterparfümeur zu werden. Er arbeitet nur die ihm vorgegebenen Stunden und feiert so viele Tage krank, wie er darf, aber er ist ein willkommener Kontrast zu Michels gesetztem Auftreten. Ferdie ist immer gut gelaunt. Er scheint sich darüber zu freuen, dass ich zu ihnen ins Labor gekommen bin. Michel lacht nicht über Ferdies Witze. Ich schon. Ferdie singt und pfeift und tanzt gerne. Wenn er nervös wird (was immer der Fall ist, wenn ein Besuch von Delphine ansteht), pfeift er einen der Discosongs, die er so gerne mag. Heute pfeift er »Lady Marmalade«. Er fragt die Düfte, die er gerade mischt: »Voulez-vous coucher avec moi ce soir?«
Michel räuspert sich und erinnert Ferdie daran, dass das Labor kein Ort für Frivolitäten ist. Mit einem gespielt betretenen Blick zu Michel flüstert Ferdie: »Désolé«, aber dann treffen sich unsere Blicke quer durch den Raum. Er lächelt und winkt mir zu. Ich erwidere sein Lächeln. Er ist harmlos. Manchmal, wenn wir zusammen zu Mittag essen, führt er mir seine neuesten Tanzschritte vor und erzählt mir von seinem neuesten Schwarm. Letzte Woche war es Sergio. Eine Woche davor Miguel.
»Radha?«
Ich zucke zusammen und stoße fast die offene Flasche Vetiveröl vom Tisch, die mehr kostet, als ich in einer Woche verdiene. Ich drehe mich um und sehe, dass Celeste mir über die rechte Schulter schaut, die Hände gefaltet. Ihr schlaffes hellbraunes Haar reicht ihr gerade bis über die Schultern. Heute trägt sie ein langärmeliges braunes Strickkleid, das ihrem knochigen Körper nicht schmeichelt.
»Zut alors, Celeste! Wie oft muss ich Ihnen sagen, dass Sie sich nicht so an mich anschleichen sollen, wenn ich etwas mische?«
Die junge Frau errötet, ein tiefes Rosa zieht sich über ihr Gesicht bis zu den Haarwurzeln. »Aber er hat jetzt schon zum zweiten Mal angerufen. Pierre.« Sie beugt sich näher zu mir und flüstert mir ins Ohr: »Es geht um Shanti.«
Mir sinkt der Magen in die Kniekehlen. Meine Handflächen werden schweißnass. Was ist jetzt wieder? Von meinen beiden Mädchen ist Shanti diejenige, die meine Autorität als ihre Mutter nie wirklich akzeptiert und immer fragt, Warum muss ich das und Wer sagt das und Warum darfst du mir sagen, was ich machen soll?. Als sie noch klein war, bestand sie darauf, genau das blaue Kleid zu tragen, das gerade nicht in ihrem Schrank hing, wenn ich ihr ein gelbes Kleid herausgesucht hatte. Sie lehnte Kheer ab, was sonst alle indischen Kinder bekommen, weil der süße Reispudding sanft zu dem wachsenden Zahnfleisch ist, und bestand auf Nutella, immer Nutella. Erst gestern ging ich mit ihr ihren Englisch-Vokabeltest durch (sie besucht eine internationale Schule). Trotz meiner wiederholten Korrekturen buchstabierte sie Friend immer F-r-e-n-d. Sie kann es richtig buchstabieren, das weiß ich, sie ist ein intelligentes Mädchen. Ich bin davon überzeugt, dass sie mir gerne Kontra gibt, um mich zur Verzweiflung zu bringen. Habe ich mich so meiner Schwester gegenüber verhalten? Eine flüchtige Erinnerung schießt mir durch den Kopf: Wie ich mich gegen Lakshmis Versuche sträube, mich darüber aufzuklären, wie es in der Welt zugeht, Jijis Stirn ist gerunzelt, ihre Lippen fest aufeinandergepresst.
Ich wende mich von Celeste ab und murmele: »Merci. J’ arrive.«
In solchen Momenten greife ich zu der Kette in der Tasche meines Laborkittels. Daran hängt eine kleine Phiole mit einem persönlichen Parfüm, das ich nur für mich kreiert habe. Ich schraube den Deckel ab und inhaliere tief. Innerhalb von Sekunden verlangsamt sich mein Herzschlag. Ich atme noch einmal ein und lasse die Ruhe über mich kommen. Dann schraube ich die Phiole wieder zu und stecke sie in die Kitteltasche zurück. Diese Kette trage ich immer bei mir; ich weiß nie, wann ich sie vielleicht brauchen könnte. Aber ich traue mich nicht, sie um den Hals zu tragen; Pierre könnte fragen, was darin ist.
Ich schiebe meinen Stuhl vom Tisch zurück und wische mir die feuchten Handflächen am Laborkittel ab. Michel blickt erst mich an, dann die Uhr an der Wand. Ich nicke ihm zu, um ihm zu bedeuten, dass ich zurückkommen werde. Er wendet sich wieder seiner Arbeit zu.
Celeste sitzt an ihrem Schreibtisch und tippt einen Brief. Sie ist die Empfangsdame für Delphines Abteilung und kümmert sich um die Telefonanrufe, die Korrespondenz und den Terminkalender und begrüßt die Kunden in der Werkstatt. Celeste ist gut in ihrer Arbeit, verlässlich und bezaubernd. Es tut mir leid, dass ich sie vorhin angefaucht habe. Sie ist so alt wie ich, aber viel schüchterner, als sie sein sollte, was mich irritiert. Wenn ich gereizt bin – insbesondere wenn ich Streit mit Shanti hatte –, verspüre ich immer wieder das Bedürfnis, »Buh!« zu schreien und zuzusehen, wie Celeste zu Tode erschrickt. Wegen ihres nervösen Naturells ist sie die perfekte Kontrastfigur zu Delphine; Celeste braucht eine autoritäre Hand, die sie leitet, und Delphine tut ihr den Gefallen.
Ich gehe zu Celeste, nehme den Hörer und drücke auf die blinkende Taste auf ihrem grauen Telefon, das am Rande ihres Schreibtisches steht. Wenn einer von uns einen privaten Anruf bekommt, müssen wir dieses Telefon benutzen. Infolgedessen weiß Celeste über alles Bescheid, was in unserem Leben los ist. Aber welche Wahl hat sie schon? Und soweit ich weiß, behält sie unsere persönlichen Angelegenheiten für sich. Ich habe sie nie gefragt, aber möglicherweise wäre es ihr lieber, wenn sie nicht zuhören müsste, wie ich mit Pierre spreche oder wie Ferdie mit Freunden zusammen lacht, die nach der Arbeit mit ihm einen trinken gehen wollen.
Ich drehe mich zur Seite, um mir etwas Privatsphäre zu verschaffen. »Chérie?«, sage ich leise und ruhig.
Pierres panische Stimme dringt an mein Ohr: »Hast du meine erste Nachricht nicht bekommen?«
Mein Blick huscht dankbar zu Celeste. Ich werde sie morgen zum Mittagessen einladen, als Ausgleich zu meiner Gereiztheit vorhin. »Qu’ est qu’ il ya?«, frage ich Pierre.
»Shantis Schule hat angerufen. Sie hat ein Mädchen geschubst – tatsächlich geschubst! – und ist aus dem Klassenzimmer hinausgerannt. Sie haben sie wieder bei den Fontänen in den Jardins des Trocadéro gefunden. Um Himmels willen, sie ist erst neun! Was denkt Shanti sich nur dabei, einfach so allein loszulaufen?«
Hai Ram! Wenn ich es doch nur wüsste. Seit einem Jahr wird Shanti anderen Kindern gegenüber handgreiflich, weigert sich, die Fragen des Lehrers zu beantworten, und schwänzt sogar den Unterricht, um im Jardin du Luxembourg mit den Booten zu spielen. Warum, sagt sie nicht. Sie kräuselt nur die Lippen, wenn man sie fragt, runzelt die Stirn und verschwindet in dem Zimmer, das sie sich mit ihrer Schwester teilt. Wenn es doch nur jemanden gäbe, der mir sagen könnte, wie man eine perfekte Mutter ist. Wenn ich nur meine engste Freundin Mathilde oder meine Schwester Lakshmi fragen könnte, aber die sind beide kinderlos. Ich ermahne mich, nicht in Panik zu verfallen; zumindest ist Shanti in Sicherheit – diesmal.
Ich massiere die beiden Linien, die sich in den letzten paar Jahren auf meiner Stirn vertieft haben. »Was soll ich deiner Ansicht nach tun?«, frage ich Pierre.
»Die Schule will sie nach Hause schicken. Kannst du sie abholen?«
Gerade will ich ihn fragen, warum Yasmin das nicht machen kann, da fällt mir wieder ein, dass Pierre sie entlassen hat. Würde ich immer noch in Indien leben, hätte ich Shanti in einer solchen Situation vielleicht genauso wie Yasmin geohrfeigt. Und auch Maa war großzügig mit Ohrfeigen, wenn ich den Reis anbrennen ließ oder es ihr zu lange dauerte, bis ich mit dem Wasser vom Bauernbrunnen wieder zurück war. Ich versuche, für meine Mädchen eine freundlichere, liebevollere Mutter zu sein. Doch bei Shanti habe ich versagt.
Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Delphine auf die Labortür zugeht. Meine Gedanken wandern zurück zu dem Duft, den ich gerade gemischt habe. Was, wenn ich einen der milderen Akkorde, die Vetivergras enthalten, durch etwas anderes ersetze, statt das intensive ätherische Öl selbst zu verwenden? Würde dies das Problem mit Delphines Formel beseitigen?
»Pierre, ich kann jetzt gerade nicht weg von der Arbeit. Delphine …«
Er zischt wütend. »Immer Delphine! Glaubst du, dass meine Arbeit weniger wichtig ist? Herrgott noch mal, du spielst mit Parfüms herum, ich dagegen entwerfe Gebäude, die die Menschen brauchen!«
Ich schließe die Augen und schüttle den Kopf. »Mais …« Als ich sie wieder öffne, sehe ich, wie Delphine mich von der Glastür zum Labor aus stirnrunzelnd ansieht. Ich habe sie warten lassen.
»Écoute, chérie. Bitte kümmre du dich dieses eine Mal darum! Ich werde es dir heute Abend erklären.« Ich lege auf, lasse aber meine Hand auf dem Hörer ruhen, als wollte ich mich bei meinem Ehemann entschuldigen. Celeste lächelt mich mitfühlend an, was in mir das Bedürfnis weckt, ihr anzuvertrauen, wie furchtbar es im vergangenen Jahr zu Hause war. Meine langen Arbeitstage im Labor. Shantis Verhalten. Die ständig wechselnden Kindermädchen. Ich verlasse Celestes Schreibtisch und öffne die Tür zum Labor.
Delphine möchte gern, dass wir alle drei bei ihren Laborbesuchen anwesend sind und uns an der Auswertung jedes Projektes beteiligen. Wir schnuppern an den Teststreifen auf Michels Schreibtisch und diskutieren darüber, welche von seinen Duftmustern funktionieren, welche nicht und warum nicht. Delphine schlägt Veränderungen an den Formeln vor, damit sie den Vorgaben des Kunden näherkommen. Ich hänge ehrfürchtig an ihren Lippen angesichts ihres Wissens, ihrer absoluten Überzeugung, dass sie mit ihrer Einschätzung richtigliegt.
Als Nächstes entscheidet sie, dass Ferdies Projekt, das sich verzögert hat (es ist schon seit sechs Monaten in der Entwicklung), endlich so weit ist, ein zweites Mal dem Modedesigner präsentiert zu werden, der es in Auftrag gegeben hat. Delphine sagt zu Ferdie: »On se vend comme des pains!« Heutzutage bestellen immer mehr renommierte Designer maßgeschneiderte Düfte, um ihre Modemarke aufzuwerten. Parfüms sind ein großes Geschäft; selbst wenn die Entwürfe der Saison nicht beim Publikum ankommen, hält der Duft der Marke das Geschäft am Laufen. Ich wäre liebend gerne beim Treffen mit dem Kunden dabei, um die Reaktion des Designers zu sehen und wie Delphine damit umgeht. Bisher durfte ich noch nie bei einem Kundentreffen dabei sein.
Jetzt dreht sich Delphine zu mir. Ich mache keinen Versuch, zu meinem Arbeitsplatz zurückzukehren. Meine Handflächen sind wieder feucht, und ich wische sie an meinem Laborkittel ab.
»Désolé, Madame. Ich bin noch nicht fertig.« Ich bete, dass meine Stimme nicht zittert.
Delphine Silberman neigt den Kopf zur Seite und zieht ihre bleistiftdünnen Augenbrauen hoch. So wie immer ist sie gut frisiert. Im Gegensatz zu den meisten Französinnen trägt sie ihre dunklen, lockigen, mit hellbraunen Strähnen durchzogenen Haare kurz geschnitten. Wenn ich raten sollte, würde ich sagen, dass ihr Friseur ein Meister in Balayage à coton ist, um ihrem Haar im Winter das sonnenverwöhnte Aussehen zu verleihen. Ihr Make-up fällt kaum ins Auge, abgesehen von dem rosa Lippenstift, der immer ihre schmalen Lippen bedeckt. Heute trägt sie einen Tweedanzug von Chanel in Rot, Weiß und Kastanienbraun. Sie hat mir einmal erzählt, wie dankbar sie Coco Chanel sei, weil sie es Frauen so leicht gemacht hat, sich morgens mit minimalem Aufwand gut anzuziehen. Ihre Gucci-Pumps passen zu ihrem Anzug.
Delphine sieht mich immer noch an und wartet auf eine Erklärung.
Es wäre unklug, ihr vor den Augen von Michel und Ferdie zu sagen, dass meiner Ansicht nach etwas mit ihrer Formel nicht stimmt. Ich unterdrücke den Impuls, meine Hände erneut an meinem Kittel abzuwischen, und sage nichts.
Sie nickt. »Kommen Sie zu mir, bevor Sie nach Hause gehen.« Sie lächelt Michel und Ferdie erfreut an. »Bien fait.« Ferdie wird vor Erleichterung rot; normalerweise macht Delphine ihm keine Komplimente.
Als sie mich ansieht, ist ihr Lächeln verschwunden. Ich habe sie enttäuscht.
An meinem Arbeitsplatz wähle ich die Flaschen aus, die ich brauche, um die Intensität des Vetivers abzumildern, ein Duft, der mir so vertraut ist wie meine eigene Haut. Damals in Indien kühlten Jiji und ich uns in der brennenden Hitze des Jaipurer Sommers immer mit feuchten Fächern aus Khus, dem Hindi-Wort für Vetivergras. Die Damen der Gesellschaft, deren Hände Jiji mit Henna schmückte, beschäftigten Diener, die ständig Wasser auf große Khus-Blenden über den Türen und Fenstern sprenkelten, welche die kühle, holzige Duftnote des Vetivers in den Räumen verbreiteten. Ich erinnere mich noch daran, wie Antoine, mein erster Arbeitgeber in Paris, mir erzählte, dass Chanel No. 5 im Jahr 1921 der erste Duft für Damen war, für den Vetiver verwendet wurde. Und dabei benutzen wir Inder es schon seit Tausenden von Jahren und exportieren das duftende Gras in die Welt!
Ich habe es noch nie erlebt, dass Michel Zweifel an einer von Delphines Formeln geäußert hat (aber vielleicht macht er das nur unter vier Augen), und mir ist klar, dass ich meine Behauptungen belegen muss, wenn ich als Laborassistentin die Arbeit meiner Meisterparfümeurin infrage stelle. Ich mische die Formel erneut an, reduziere diesmal das Vetiver, füge einen Hauch von Vanille hinzu und notiere mir alles genau. Das Gleiche mache ich mit ein paar anderen Duftkombinationen, die die holzige Note simulieren. Ich versuche es mit Eichenmoos. Dann Flechte. Dann lasse ich das Vetiveröl komplett weg.
Vier Stunden rasen vorbei. Ich reibe mir die Augen. Durch das innere Fenster des Labors werfe ich einen Blick zu Celestes Schreibtisch. Die Schreibmaschine ist abgedeckt; sie hat ihre Arbeit für heute beendet. Dass Ferdie gegangen ist, habe ich kaum bemerkt. Michel murmelte Bonsoir, als er auf dem Weg nach draußen an meinem Arbeitstisch vorbeikam. Hier bin ich nun, die einzige Mutter in der Gruppe, immer noch bei der Arbeit, und vernachlässige meine Töchter und meinen Ehemann. Ein plötzliches Schuldgefühl kriecht mir den Rücken hinunter: Du hast Pierre dazu gezwungen, sich um Shanti zu kümmern! Aber dann hallt eine andere Stimme – wo kommt die jetzt her? – durch meinen Kopf: Pierre musste noch nie seine Arbeit verlassen, um die Mädchen abzuholen. Das habe immer ich gemacht. Sollte er das nicht auch gelegentlich übernehmen können? Lakshmi hat mir mal erzählt, dass sie und Jay einen Leitspruch haben, wenn sie sich wegen der Hausarbeit streiten: Wenn wir beide Königinnen sind, wer wird dann die Wäsche aufhängen? Ich lächele, atme ein, fühle mich etwas ruhiger. Ich werde mit Pierre reden, wenn ich nach Hause komme. Bestimmt wird alles wieder gut.
Yves du Bois, der Gründer des Maison d’Yves, steckt seinen Kopf zur Labortür herein. Er ist ein attraktiver silberhaariger Mann in den Sechzigern. Ich glaube, er bevorzugt dreiteilige Anzüge, weil er dann eine viktorianische Uhrkette aus seiner Westentasche heraushängen lassen kann. Aus Rücksicht auf die heutige Mode trägt er aber seine Haare so lang, dass sie seinen Kragen berühren. Vermutlich denkt er, dass ihn das mehr au courant erscheinen lässt. Ich habe andere Angestellte darüber spekulieren hören, ob er und Delphine etwas laufen hätten; sie kommen so gut miteinander aus und essen regelmäßig zusammen zu Mittag. Aber wir haben niemals irgendeinen Beweis dafür gesehen. Was mich anbetrifft, bezweifle ich, dass er überhaupt meinen Namen kennt. In all den Jahren, die ich schon hier bin, habe ich kaum fünf Wörter mit ihm gewechselt. Normalerweise spricht er nur mit seinen drei Meisterparfümeuren.
»Ist Ferdinand hier irgendwo?«, fragt er.
»Er hat für heute Schluss gemacht.«
Er blinzelt ein paarmal, während er diese Information verdaut. Dann wirft er einen Blick auf seine Uhr. »Ich dachte, wir wollten uns heute Abend zum Essen treffen.« Er bleibt noch einen Moment länger stehen. »Hélène wird enttäuscht sein.« Hélène ist seine Frau. Yves wirkt selbst ziemlich enttäuscht. »Alors … Bonsoir.« Er klopft mit den Fingerknöcheln gegen den Türrahmen und geht.
Ferdie hat offenbar vergessen, dass er mit seiner Tante und seinem Onkel zum Abendessen verabredet war. Das überrascht mich nicht; Ferdie hat ein reges Sozialleben. Ich erinnere mich noch daran, wie er mal versprach, mit uns allen zu Celestes Geburtstag auszugehen, und sich dann stattdessen mit seinem neuen Freund Christophe traf. Celeste sah so niedergeschlagen aus, dass Michel und ich sie in ihr Lieblingsbistro ausführten. Ich weiß nicht, ob Ferdie sich jemals bei Celeste entschuldigt hat; uns gegenüber hat er nie etwas davon gesagt.
Sobald Yves gegangen ist, kehre ich zu meiner Arbeit zurück. Aber jetzt beherrscht die Sorge um meine ältere Tochter meine Gedanken. Shanti war ein schwieriges Baby und wurde noch schwieriger, als ich ihr nur wenige Jahre später wegen Ashas Geburt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken konnte. Pierre versuchte, das auszugleichen, indem er mit Shanti besondere Ausflüge unternahm, während ich mit Baby Asha beschäftigt war, aber Shanti wollte lieber mehr Zeit mit mir verbringen. Habe ich meine ältere Tochter zugunsten ihrer pflegeleichteren jüngeren Schwester vernachlässigt? Das Sprichwort sagt: Ein schlechtes Gewissen ist ein lebhafter Feind. Der Kampf tobt beständig in mir.
Wie war ich in Shantis Alter? Ich weiß noch, wie wütend mich die Sticheleien der Dorffrauen machten, wenn ich auf meinem Weg zum Bauernbrunnen an ihnen vorbeiging; ich durfte weder den Dorfbrunnen benutzen noch mit irgendjemandem im Dorf reden außer mit dem alten Munchi, der wegen seines lahmen Beins selbst ein Paria war. War es wirklich mein Fehler, dass mein Vater, der einst ein brillanter Lehrer gewesen war, zu trinken begonnen hatte? Oder dass meine Mutter erblindet war? Oder dass meine ältere Schwester ihrem Ehemann davongelaufen war? Kann ein kleines Mädchen solche Turbulenzen verursachen? Natürlich nicht. Aber wir leben hier in Paris, nicht in einem indischen Dorf, und Pierre und ich sind hart arbeitende Eltern. Shanti hat keinen Grund, sich so zu benehmen.
Das Telefon auf Celestes Schreibtisch klingelt. Ob das Pierre ist? Hat er gemerkt, dass ich gerade an ihn denke? Ich gehe hin, um das Gespräch anzunehmen.
»Arbeitest du wieder so spät?« Es ist Mathilde, meine älteste Freundin, mit der ich mir viele Jahre lang in Shimla ein Zimmer an der Auckland-House-Schule geteilt habe. Im Laufe der Jahre ist ihre Stimme durch die vielen Zigaretten tiefer geworden, sodass sie jetzt getragen und kehlig klingt.
»Nein, ich trinke Wein und esse Austern«, erwidere ich.
»Entzückend. La Reine hat mich zum Abendessen bei euch eingeladen, also dachte ich mir, dass du immer noch bei der Arbeit bist.« Mathilde nennt Pierres Mutter Florence La Reine, weil sich jede Bitte aus dem Mund meiner Schwiegermutter wie der Befehl einer Königin anhört. Manchmal witzeln wir über Florence’ offensichtliche Versuche, Pierre und Mathilde zusammenzubringen, wenn ich nicht da bin. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie Pierre vorschlüge, eine Affäre mit meiner besten Freundin zu beginnen. Mathilde ist Catherine Deneuve mit blonden Ponyfransen, und die Lücke zwischen ihren Schneidezähnen scheint sie für die Männer nur noch attraktiver zu machen. Abgesehen von ihrer Kettenraucherei vergöttert meine Saas Mathilde. Liegt es daran, dass Mathilde nicht wie ich außer Haus arbeitet? Aber das muss sie auch nicht; Mathilde hat geerbt, was Florence immer ignoriert. Wenn Mathilde bei uns ist, fragt Florence sie, wo der Pfannenwender ist oder ob die Mädchen an den Wochenenden genug Bewegung bekommen haben – als wäre Mathilde Pierres Ehefrau und nicht ich. Ich vermute, dass sie das mit Absicht macht, um mich zu ärgern.
»Florence kocht bei uns zu Hause?«, frage ich.
»Exact.« Ich höre, wie Mathilde eine Wolke Zigarettenrauch ausstößt.
Zut! Statt Shanti und Asha von der Schule abzuholen, muss Pierre seiner Mutter diese Aufgabe aufgehalst haben, die einzige Verwandte, die wir hier in Paris haben. Pierre ist ein Einzelkind; sein Vater, Philippe, hat die Familie verlassen, als Pierre acht Jahre alt war. Mein Mann glaubt, dass Philippe jetzt in Spanien lebt, aber er ist sich nicht sicher. Florence ist eine überzeugte Katholikin; sie hat der Scheidung nie zugestimmt. Im vergangenen Jahr, wo Delphine mehr von meiner Zeit in Anspruch genommen hat, mussten wir für die Mädchen gelegentlich auf Florence’ Hilfe zurückgreifen, was ich nur ungern mache. Sie ist schnell mit kaum verschleierten Gehässigkeiten bei der Hand, um mir das Gefühl zu geben, eine schlechte Mutter zu sein, nur weil ich außer Haus arbeite. Manchmal frage ich mich, ob Pierres Abneigung gegen meine Arbeit von Florence’ Vorstellungen davon gesprägt ist, was Frauen der besseren Gesellschaft tun und lassen sollten.
Ich strecke mich und seufze. »Danke für die Warnung, chérie. Kommst du also zum Abendessen?«
»Non. Ich bin bereits verabredet.« Ich kann fast schon den Tabak ihrer Tigra-Zigarette durch den Hörer schmecken, während sie inhaliert. »Ich treffe mich um acht mit Jean-Luc im La Petite Chaise.«
Ich kichere. Mathilde hat eine solch große Anzahl von Verehrern, dass sie selbst Kleopatra beschämen würde. Wann immer wir uns zum Mittagessen treffen, unterhält sie mich mit Geschichten über die Männer, die nie ihre Erwartungen erfüllen können. Bei Jean-Luc wird es vermutlich nicht anders sein, auch wenn sie schon seit drei Monaten mit ihm ausgeht – ganz schön lange für ihre Verhältnisse.
»Und deine Mutter? Wer passt heute Abend auf sie auf?«, frage ich meine Freundin.
Vor ein paar Jahren erhielt Mathilde einen Anruf von einer Frau, die ein Stück weiter die Straße runter wohnte und ihr sagte, dass Mathildes Mutter Agnes auf der Suche nach ihr sei, sich aber nicht an ihre Adresse erinnern könne. Das war seltsam, schaute doch ihre Mutter ständig ohne Vorwarnung bei Mathilde vorbei. Einmal platzte sie sogar mitten hinein, als sich ihre Tochter mit einem Mann im Bett amüsierte. Mathilde war das ziemlich peinlich, aber ihre Mutter sagte nur beiläufig, dass ihr der Kaviar ausgegangen sei. Ob Mathilde vielleicht welchen dahätte? Mehrere Arztbesuche führten zu der Diagnose, dass Agnes angefangen hatte, ihr Erinnerungsvermögen zu verlieren. Mathilde musste ihre Mutter zu sich nehmen. Wenn sie sich jetzt mit Männern trifft, dann in Hotels oder deren Wohnungen; außerdem engagiert sie an zwei Abenden pro Woche eine Pflegerin.
»Basira ist schon da. Sie ist Mamans Liebling. Sie sehen sich zusammen Les Shadoks an.«
»Die Zeichentrickserie?«
»Maman liebt sie. Sie ist – oh, ich muss mich noch anziehen!« Sie hat wohl gerade einen Blick auf die Uhr geworfen. »A tout a l’ heure, ma petite puce!« Sie legt auf. Seit dem Tag, an dem wir uns im Internat kennengelernt haben, nennt Mathilde mich Kleiner Floh.
Dass ich Pierre kennengelernt habe, verdanke ich Mathilde. An unserer Schule war es üblich, sonntags Briefe an die Verwandtschaft zu schreiben, aber in unserem letzten Jahr sind wir oft lieber zum katholischen Nonnenfriedhof im Kiefernwald gewandert. Warum hätten wir auch Briefe an Verwandte schreiben sollen? Lakshmi und Jay wohnten nur wenige Meilen entfernt, und wir sahen uns häufig. Mathildes Mutter folgte immer wieder anderen Gurus nach Varinasi oder Cooch Behar oder Kerla und hatte deshalb nie eine feste Adresse. Eines Sonntags saßen wir also im Schneidersitz vor einem Grab, das Mathilde ausgesucht hatte, und rauchten die Gauloises, die ihre Cousins ihr postlagernd geschickt hatten. Der Geruch nach Moos, kühler Erde und alten Grabsteinen war tröstlich. Salamander linsten hinter den Felsen hervor auf uns herab, bevor sie zum Boden hinunterhuschten. Ein einsames Rebhuhn rief zwischen den Grillen, die sich im Gestrüpp versteckten.
Sehr ernsthaft dreinschauend bekreuzigte Mathilde sich und begann: »Schwester Marie, wir danken dir für deine Dienste und rauchen diese Zigarette zu deinen Ehren. Du, die du vielleicht niemals den Geschmack von Tabak auf deinen Lippen kosten durftest, würdest den Rausch dieses ersten Zugs lieben. Vielleicht hast du Wein aus dem sonntäglichen Kelch gepichelt, aber du warst so freundlich, genug für die anderen Gläubigen übrig zu lassen. Du warst streng mit deinen Schützlingen, aber in deiner Freizeit hast du für sie gebetet. Nicht, dass du allzu viel freie Zeit gehabt hättest, wo du so sehr damit beschäftigt warst, Kerzenhalter zu polieren, dich vor Jesus niederzuwerfen und schweigend mit den anderen Nonnen zusammen trockenes Brot zu essen. Dennoch bewundern wir dich und dein Leben. Amen.«
Sie wollte, dass ich auch etwas sage, aber ich glaube nicht an ein Gespräch mit Toten und begnügte mich deshalb mit: »Jai hind.« Lang lebe Indien.
Da hörten wir einen erstickten Laut und drehten uns um. Ein junger Mann irgendwo in den Zwanzigern versuchte, sein Lachen zu unterdrücken, eine Hand auf den Brustkorb gepresst. Als er unsere Blicke bemerkte, bekreuzigte er sich – ein Katholik – und sagte: »Désolé. War sie vielleicht eine Verwandte von Ihnen?«
Mathilde verdrehte die Augen.
Er kam näher. »Würden Sie mir eine Ihrer heiligen Gauloises überlassen? Ich würde Schwester Marie ebenfalls gerne meinen Respekt zollen.«
Das brachte uns nun wieder zum Lachen. Er erzählte uns, dass er Pierre Fontaine heiße und an der Fertigstellung von Le Corbusiers Kapitol-Komplex für Chandigarh mitarbeite, drei Zugstunden von hier entfernt. Er fuhr gerne gelegentlich übers Wochenende nach Shimla, um der Hitze und den heftigen Winden in Premierminister Nehrus idealer Stadt zu entkommen.
Schnell stellte sich heraus, dass Pierre und Mathilde beide aus Paris stammten, und sie fingen an, sich auf Französisch zu unterhalten. Ich war an die Aufmerksamkeit gewohnt, die meine Freundin mit ihren blonden Haaren, den mattrosa Lippen und der schwarzen Mascara (sie eiferte da ihrem Idol Sophia Loren nach) üblicherweise auf sich zog. Aber schließlich lächelte Pierre mich an und sagte: »Ihre Augen sind bezaubernd. So wunderschön.«
Meine blaugrünen Augen machten viele Menschen neugierig. Hatte ich ein britisches Elternteil? War ich Anglo-Inderin? Fast zwölf Jahre waren vergangen, seit Indien unabhängig geworden war, und ich wollte nicht mit den Briten in Verbindung gebracht werden. Ich errötete und sah weg. Aber seine tief liegenden bernsteinfarbenen Augen, seine Lippen, die den gleichen Farbton wie seine helle mediterrane Haut hatten, die Art, wie sein hellbraunes Haar auf die eine Seite seiner breiten Stirn fiel – sie brannten sich mir ins Gedächtnis ein, als hätte ich ihn fotografiert.
Am nächsten Tag rief er in der Schule an und bat darum, mit mir sprechen zu dürfen. Nicht mit Mathilde, sondern mit mir.
Ich war hin und weg.
Ich muss gähnen und werfe einen Blick auf die Uhr an der Wand über Michels Arbeitsplatz. Es ist fast Abendessenszeit. Endlich bin ich so weit, Delphine meine Ergebnisse zu präsentieren. Eigentlich würde ich lieber bis morgen früh warten und den Mischungen Zeit zum Reifen geben, aber den Luxus habe ich nicht. Ich ziehe die Kette aus meiner Tasche und inhaliere tief den Duft aus der Glasphiole. Wieder etwas ruhiger lege ich die Duftmuster von meinen verschiedenen Versuchen zusammen auf ein Edelstahltablett. Die Bestandteile habe ich auf den einzelnen Teststreifen in meiner eigenen Kurzschrift vermerkt. Ich drücke die Labortür auf, gehe zu Delphines Büro am Ende des Flurs und klopfe an.
»Entrez.«
Ihr Büro ist eine Studie des Modernismus der 1960er-Jahre. Die Wände sind vom Fußboden bis zur Decke in Walnuss getäfelt. Sie sitzt auf einem Eames-Stuhl der Aluminium Group hinter einem schnittigen Walnussschreibtisch, der über dem Boden zu schweben scheint; die Beine sind praktisch unsichtbar. Auf ihrer Seite des Schreibtisches befinden sich lange Schubladen, die auf einen Fingerdruck hin aufspringen, sodass die Mitte – und ihre wohlgeformten Beine – exponiert sind. Weißer Carrara-Marmor krönt den Schreibtisch. An der Wand hinter ihr befindet sich ein Charlotte-Perriand-Bücherregal in Gelb, Ziegelrot und Beige. Links im Raum steht die antike Parfümorgel, die sie von ihrem Mentor geerbt hat und bis zum heutigen Tag benutzt. Auf der gegenüberliegenden Seite hängt ein abstraktes Bild in Blau, Senfgelb und Schwarz; sie hat mir einmal erzählt, dass es sich um einen Joan Miró handelt. Weitere Bilder oder Fotografien gibt es im Zimmer nicht. Der Industrieteppich ist ringelblumengelb.
Ich schätze Delphine auf Anfang sechzig. Sie ist der einzige weibliche Meisterparfümeur, den ich je kennengelernt habe, und wahrscheinlich ist das der Grund dafür, warum die Laborassistenten und Sekretärinnen im Maison d’Yves ihren Namen voller Ehrfurcht aussprechen.
Sie blickt kurz auf und registriert mich, dann klopft sie die Asche ihrer Gitane am großen dreieckigen Aschenbecher ab und beendet den Brief, den sie gerade schreibt. Als sie damit fertig ist, lehnt sie sich auf dem Stuhl zurück und gibt mir ein Zeichen, dass ich näher treten soll. Wie üblich ist der Aschenbecher voll mit Filtern, an denen Lippenstift klebt, und der Raum ist nebelig vor lauter Qualm. Wenn Kunden zu Besuch kommen, werden sie üblicherweise in einen separaten, weiß gestrichenen Raum mit einem Quarzkonferenztisch von Saarinen, weißen Tulpen-Stühlen und einem weißen Teppich geführt – ohne auch nur den kleinsten Hauch von Zigarettenqualm.
Ganz zu Anfang war ich schockiert von Delphines Kettenraucherei. Beeinflusst das nicht ihren Geruchssinn?, fragte ich Antoine. Doch er erklärte mir, dass Meisterparfümeure, Les Nez, nicht nur über ein angeborenes Talent verfügten, sondern Tausende von Düften im Gedächtnis abgespeichert hätten, so wie ein Musiker Noten, Akkorde und Melodien. Es ist ein Muskel, den sie ständig trainieren. Antoine zufolge war Delphine die außerordentlichste Le Nez, die er kannte – trotz ihrer Tabaksucht.
Ich stelle mein Tablett auf Delphines Schreibtisch ab, bleibe aber mit gefalteten Händen stehen.
»Machen Sie das nicht«, sagt sie ruhig.
Ich greife nach dem Tablett.
»Lassen Sie das Tablett stehen. Falten Sie nicht die Hände. Damit sehen Sie so aus, als hätten Sie etwas zu verbergen oder wollten gleich beten.« Sie nimmt einen langen, tiefen Zug von ihrer Zigarette und kneift die Augen gegen den Rauch zusammen.
Oh. Ich stelle das Tablett wieder hin. Ihr Mundwinkel hebt sich zu einem kleinen Lächeln. »Wollen Sie weiter auf mich herabschauen oder setzen Sie sich hin?«
Eilig lasse ich mich in einen der vornehmen Ledersessel vor ihrem Schreibtisch nieder.
»So ist es besser.« Sie klopft mit der Zigarette gegen den Aschenbecher. »Und jetzt sagen Sie mir, was mit meiner Formel nicht stimmt.«
Mir klappt der Kiefer hinunter. War ich bei dem Treffen vorhin so leicht zu durchschauen?
Sie gestikuliert in Richtung meines Tabletts, um mich zu ermutigen.
Ich schlucke. »Alors, ich habe die Formel sechsmal angemischt. Jedes Mal hat der Vetiver die Mischung dominiert.« Ich räuspere mich. »Vielleicht habe ich die Anweisungen missverstanden, aber …«
Sie erschreckt mich, indem sie plötzlich mit ihrem Stuhl nach vorne rollt, bis ihre Taille an den Schreibtisch gepresst ist, und zeigt mit der Zigarette auf mich. »Entschuldigen. Sie. Sich. Niemals. Sagen Sie mir, was Sie denken.«
Hitze steigt mir ins Gesicht, und mir bricht der Schweiß aus. »D’ accord. Der Auftrag lautet, einen Duft zu kreieren, der so leicht ist wie die Luft, aber Ihre … die Formel ist viel kompakter.« Ich beeile mich, den letzten Satz zu beenden, bevor mir die Nerven durchgehen. Mein Herz rast, als wäre ich gerade eine Meile gerannt. »Sie werden sicherlich verlangen, dass wir sie überarbeiten.«
»Warum denken Sie das?«
»Das Vetiveröl – es bringt die Formel aus dem Gleichgewicht.«
Sie drückt ihre Zigarette aus und stößt eine letzte Qualmwolke aus. Die Jahrzehnte als schwere Raucherin haben Hunderte feine Linien entstehen lassen, die sich von ihrer Ober- und Unterlippe ausgehend auffächern. »Und jetzt holen Sie einmal Luft und zeigen mir, was Sie damit gemacht haben.«
Wieso wusste sie schon, dass ich ihr Alternativen vorschlagen würde? Ich erkläre ihr, was ich gemacht habe, welche Bestandteile ich ersetzt habe, und reiche ihr die Teststreifen. Delphine nimmt sich für jede Kombination Zeit und schwenkt die Duftmuster vor ihrer Nase, runzelt die Stirn und schwenkt sie erneut. Sie stützt sich mit den Ellbogen auf den Schreibtisch und bettet ihr elegantes Kinn auf die ineinander verschränkten Finger. Ihre Nasenlöcher weiten sich, während meine Chefin immer wieder an den zehn neu von mir kreierten Mustern schnuppert.
»Lassen Sie sie hier bei mir.«
Ich wende mich zur Tür, werfe Delphine aber einen verstohlenen Blick zu, bevor ich die Tür schließe. Sie steckt sich gerade eine weitere Gitane an.
Als ich die Stufen der Metrostation hochsteige und die zwei Blocks bis zu unserer Wohnung gehe, ist es fast neun Uhr abends. Ich will meine Mädchen sehen, bevor sie einschlafen, ihnen einen Gutenachtkuss auf ihre glatten Wangen geben, mit den Fingern durch ihre Haare fahren, aber die Furcht davor, Pierre gegenüberzutreten, lastet wie ein Stein auf meiner Brust. Früher habe ich es geliebt, zu Pierre nach Hause zu kommen. In den ersten Jahren unserer Ehe – nachdem ich angefangen hatte, bei Antoine zu arbeiten, und bevor ich mit Shanti schwanger wurde – konnte ich es kaum erwarten, ihn zu umarmen, wenn er nach Hause kam, und seinen eigentümlichen Geruch zu inhalieren, der für mich so exotisch war, eine Kombination aus Gauloise-Tabak, spritziger Zitrone, frischem Rosmarin und einem Hauch von Vetiver (er benutzte Dior Eau Sauvage, wie ich heute weiß, aber damals kannte ich mich noch nicht mit Parfüms aus). Wir hatten einander schon ausgezogen, noch bevor wir es zum Sofa oder ins Bett schafften. Manchmal schliefen wir nach dem Sex ein und wachten Stunden später wieder auf, heißhungrig aufs Abendessen. Wann hat sich all das nur geändert?
Wir wohnen mitten in Paris, in Saint-Germain-des-Prés, dem sechsten Arrondissement, in einem Appartement, das Pierre von seiner wohlhabenden Großmutter geerbt hat. Sogar ihre Le-Corbusier-Möbel haben wir geerbt – lauter Stahlröhren und schwarzes Leder. Wir wohnen nur einen Steinwurf vom Café de Flore entfernt, wo Autoren wie Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir (die ich beide in der Auckland-House-Schule lesen musste) ihre bahnbrechenden Werke verfasst haben und wo Dichter und Autoren sich immer noch beim Kaffee unter die Pariser Schickeria mischen. Pierres grand-mère schloss sich oft ihren Diskussionen an und spendierte hungrigen, kreativen Gestalten, die das Café frequentierten, etwas zu trinken.