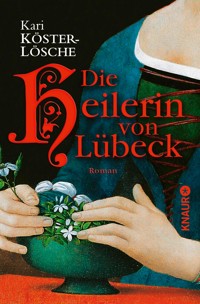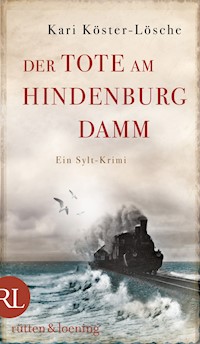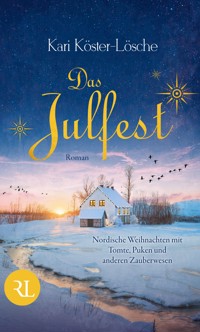6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Pestheilerin Roman 1347. Auf der Krim bricht die Pest aus und verbreitet sich in Windeseile in ganz Europa. Hunderttausende sterben an der Krankheit, die als »Strafe Gottes« über die Menschen gekommen zu sein scheint. Eine mutige junge Frau wird zur Retterin der Kranken, denn mit Hilfe der alten Heilkunst ihres Volkes gelingt es ihr, die Menschen zu heilen – und auf rätselhafte Weise bleibt sie von der Seuche verschont … Nachdem ihre Eltern von den Osmanen ermordet wurden, gerät die junge Arinna in die Fänge eines Sklavenhändlers, der sie in Konstantinopel an den mächtigen Genueser Kaufmann Boccanegra verkauft. Als in der Hauptstadt des Byzantinischen Reiches die Pest ausbricht, nimmt Boccanegra seine Sklavin mit auf das Schiff der Genueser Kaufleute. Der geldgierige Kaufmann hat von einem kostbaren Schwamm gehört, der nur auf Malta wächst und das alleinige Heilmittel gegen den Schwarzen Tod sein soll. Boccanegra will damit ein Vermögen machen. Doch dann erkranken auf der Galeere die ersten Seeleute, und Arinna muss sie pflegen. Und tatsächlich gelingt es ihr dank ihrer Heilkunst und Unvoreingenommenheit, den Schwarzen Tod zu besiegen. Bald schon verbreitet sich Arinnas Ruhm als Heilerin im ganzen Mittelmeerraum, doch dann wird sie der Hexerei verdächtigt, und ihr Leben gerät in ernste Gefahr … Die Pestheilerin von Kari Köster-Lösche im eBook
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Kari Köster-Lösche
Die Pestheilerin
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
I. Flucht vor den Osmanen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
II. Der Malteserschwamm
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
III. Rodrigo Lopez de Ayala
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Anmerkungen zum historischen Hintergrund
Wortverzeichnis
Verzeichnis der handelnden Figuren
I. Flucht vor den Osmanen
Kapitel 1
Der gelbe Staub machte Arinna das Atmen schwer, aber die rissige Hand lastete wie ein Fels auf ihrem Nacken und drückte ihn nieder. Oschin konnte ziemlich grob sein.
In der Nähe hörte sie das Geräusch vieler Hufe, deren Galopp in Trab überging und schließlich verklang.
»Sie sind fort.«
Oschins mürrische Stimme war so laut wie zuvor, bevor er die Reiterkolonne gesichtet hatte, doch immerhin ließ er sie jetzt los.
Sie hob den Kopf und setzte sich schließlich im Schneidersitz hin. Die Stadt, die vor ihr lag, wirkte wie eine Festung aus gelben und roten Steinen. Nach rechts und links erstreckten sich gewaltige Mauern, und durch das noch offene Stadttor konnte sie Häuser sehen. Der Weg zur Küste, nach Konstantinopel, in die Freiheit und Sicherheit eines christlichen Landes führte dort hindurch. Durch das altehrwürdige Nikäa.
»Was ist das?«, fragte Arinna beunruhigt. Ihr Finger deutete auf die fremdartigen Gebäude. »Die Minarette da vorn … Ist auch Nikäa besetzt?«
»Und wie«, antwortete der Kerl, der ihr vor einigen Tagen seinen Schutz angeboten hatte, spöttisch. »Schon seit mehreren Jahren. Das weißt du nicht?«
»Nein. Ich dachte, eine so heilige Stadt, in der die Kaiser von Byzanz residiert haben, könnte nie erobert werden …«, gab Arinna kleinlaut zu.
Oschin lachte rauh. Sein Lachen ähnelte dem eines Hahnes, der von einer Mauer herab seine Hühnerschar überblickt. »Die Türken werden noch viel mehr erobern. Egal, mit welchen Mitteln. Weißt du nicht, dass Emir Orhan Theodora, eine Tochter des Kaisers, heiraten wird?«
Arinna schüttelte widerwillig den Kopf. Sie mochte Oschins überhebliche Art nicht. Aber sie hatte genug Verstand, um zu wissen, dass man, um durch die Linien von osmanischen Soldaten, umherschweifenden türkischen Banden und übriggebliebenen marodierenden Kreuzfahrern nach Konstantinopel hinein-zugelangen, einen Führer brauchte. Mit seinem einen guten Auge wirkte Oschin wie ein Raufbold, aber er hatte von ihr für seinen Schutz kein Geld verlangt. Und er stammte immerhin aus ihrer Gegend, aus dem kappadokischen Caesarea, wie er glaubhaft versichert hatte, wenn sein Name und seine Sprache in ihren Ohren auch befremdlich klangen. Er sei von armenischem Adel, hatte er behauptet, was stimmen konnte oder auch nicht. Sein größter Vorzug aber war, dass sie in seiner Begleitung erstmals seit langem satt geworden war, ohne selbst stehlen zu müssen.
»Die Luft ist rein«, murmelte Oschin und erhob sich. »Wir schließen uns den Leuten da vorn mit dem Esel an. Bleib dicht hinter mir und halte den Kopf gesenkt. Und zieh gefälligst das Tuch über deine verfluchten hellen Haare. Ich hätte sie dir beizeiten abscheren sollen.«
Indem Arinna in aller Hast gehorchte, drehte sie sich um. Auf dem Weg, den sie selbst gewandert waren, schlurfte eine müde Gruppe von Männern und Frauen hinter einem hochbeladenen Karren her, der von einem Esel gezogen wurde. »Ist das nicht zu gefährlich?«, flüsterte sie. »Lass uns Nikäa umgehen!«
»Wage ja nicht, immer von Nikäa zu reden«, fauchte Oschin. »Die Osmanen nennen es Iznik, verstanden? Und jetzt los! Ich will heute endlich etwas Anständiges zwischen die Zähne bekommen. Außerdem habe ich nicht das geringste Verlangen, in diese Berge zu klettern.«
»Klettern!« Die Berge, die in Nikäas Rücken lagen, waren weder sehr hoch, noch wirkten sie mit den kleinen Dörfern an den Hängen ungastlich. Aber es würde ein ziemlich weiter Umweg sein, denn die Stadt lag an einem See, so dass ein Ausweichen zur anderen Seite nicht möglich war.
Beklommen folgte Arinna Oschin, der sich den Wanderern mit einer Selbstverständlichkeit anschloss, als ob er zu ihnen gehöre.
Die Leute, zwei Männer, drei Frauen und fünf Kinder, nahmen von ihnen keine Notiz. Zwei der Frauen sprachen halblaut miteinander.
Osmanen!
Arinna stolperte vor Schreck, und Blut stieg ihr in die Wangen. Sie hatte trotz der unterschiedlichen bunten Kopfbedeckungen der Frauen und ihrer langen Kleider über den Hosen gehofft, dass die Wanderer Griechen wären, auf der Flucht durch das weite anatolische Land in christliches Gebiet wie sie selbst. So viele unterschiedliche Gruppen von Menschen waren unterwegs, und ihre zusammengewürfelten Kleidungsstücke machten sie in gewisser Weise ähnlich.
Oschin warf ihr einen warnenden Blick zu. Zurück konnten sie nicht mehr. Arinna zog ihr Kopftuch, das von der Stirn bis über die Schultern reichte, bis an die Augenbrauen herunter und versuchte, mit gebeugtem Rücken kleiner zu wirken. Unglücklicherweise waren die Angehörigen ihres Volkes, das in den Felsenhöhlen von Matiana lebte, durchweg größer als die Griechen der Nachbarschaft. Und die Frauen der türkischen Stämme waren meistens noch kleiner.
Sie konzentrierte sich auf ihre Füße und tappte im Gleichschritt mit den Frauen vorwärts, bis die kleine Kolonne haltmachte. Sie hatten das Stadttor erreicht. Arinna beugte den Nacken und lauschte angestrengt.
Die tiefe Stimme eines Wächters fragte etwas in hochfahrendem Ton. Einer der Wanderer antwortete beflissen und machte sich dann am Karren zu schaffen. Die Ladung wurde von allen Seiten begutachtet, und der Anführer stand mühsam Rede und Antwort. Seine Stimme wurde heller und ängstlicher.
Eins der jüngeren Kinder begann zu schluchzen, zwei andere fielen ein. Die Frauen nahmen sie in die Arme, trösteten sie und flüsterten mit ihnen. Eine summte leise. Aber das Weinen steigerte sich zum Geschrei.
Wenn sie doch nur aufhören wollten, dachte Arinna gereizt und beobachtete verstohlen, wie die Aufmerksamkeit der Wächter sich jetzt auf die Frauen zu konzentrieren begann – wie zu erwarten gewesen war.
Das älteste der Mädchen wich voll Panik vor den grimmigen Gesichtern und den auf den Boden gestoßenen Lanzen zurück, stolperte über einen Fuß und fiel der Länge nach auf den Rücken. Unter Geheul verwickelte sie sich mit den Füßen in ihren weiten Hosenbeinen und im Rock und fing erbärmlich mit den Beinen zu strampeln an.
Arinna bückte sich hastig, gab beschwichtigende Geräusche von sich, strich der Kleinen die schwarzen Haarsträhnen aus dem Gesicht und die Tränen von den Wangen.
Das Mädchen stoppte ihr Weinen so urplötzlich, wie es begonnen hatte, und starrte Arinna bestürzt ins Gesicht. Es war schmutzig, wie sie wusste, aber das war es nicht. Die Kleine konnte ihr in die blauen Augen sehen. Wahrscheinlich hatte sie noch nie jemanden wie Arinna zu Gesicht bekommen. Bevor sie womöglich erneut losbrüllte und ihr den Finger ins Gesicht stieß, ergriff Arinna sie an den Händen, stellte sie auf die Füße und klopfte den Staub aus dem bunten Röckchen.
All dies erlaubte ihr, in der Hocke zu bleiben und sich überdies hinter dem Kind zu verstecken.
Sie hatte das Gefühl, endlos geklopft zu haben, bis plötzlich Bewegung in die Gruppe kam. Sie wurden vorwärts gewinkt.
Mit dem türkischen Mädchen an der Hand, das inzwischen Vertrauen zu Arinna gefasst hatte, passierten sie zwei mächtige Rundtürme und dann den düsteren, quälend langen Tordurchgang. Arinna hielt den Atem an. Wer wusste schon, welche Soldaten, Zolleinnehmer oder anderen Männer des Sultans sie auf der anderen Seite in Empfang nehmen würden? Um sie dann in einen Kerker zu schicken oder gleich um einen Kopf kürzer zu machen. Arinna hatte in einer osmanischen Stadt weit fort von der Heimat nichts zu suchen, und solcher Probleme entledigte man sich am schnellsten auf diese Weise.
Oschin schien von Ängsten nicht geplagt. Eine Hand am Karren, stemmte er diesen mit gebeugtem Nacken in der aufgewühlten Fahrspur voran.
Die schwarzen Schatten, den die Türme und baumhohen Mauern in der tiefstehenden Sonne warfen, wollten Arinna nicht aus ihrem bedrückenden Bann lassen. Das Mauerwerk bestand aus großen Quadern, aus schmalen Ziegelsteinen und runden Flusskieseln und hatte gewiss schon Hunderte von Jahren fremden Eindringlingen standhalten müssen. Bröckelndes Gestein und Scharten bewiesen, dass dies nicht immer gelungen war.
Ganz unerwartet fand sich Arinna im grellen Licht der staubigen Hauptstraße wieder, die keineswegs in ein prächtiges Stadtinneres führte, sondern auf ein größeres Dorf zulief.
Und weit und breit gab es keine Soldaten.
Die osmanischen Männer hielten im Schatten der Innenmauer an, um miteinander zu beratschlagen. Arinna sah sich erleichtert und mit wachsender Zuversicht neugierig um. Dies war Nikäa! Auch wenn es nun Iznik hieß und statt der alten Kirchen jetzt hier Moscheen standen, war es eine wichtige Etappe auf ihrer weiten Wanderung aus dem Tal der Tauben in Kappadokien ins christliche Konstantinopel. Konstantinopel war nicht mehr weit. Sie hatte es fast geschafft!
Oschin scherte mit energischen Schritten aus der türkischen Gruppe heraus an den Straßenrand, mit einer Miene, in der sich Verachtung für die Menschen spiegelte, die ihm für eine Weile Schutz geboten hatten. Herrisch winkte er Arinna an seine Seite.
Ein letztes Streicheln des schmalen bräunlichen Kindergesichtes, dann begann sich Arinna den Weg durch die Frauen und Kinder zu Oschin zu bahnen. Sie fing den Blick einer der Frauen auf. Diese sagte etwas zu ihr und lächelte vorsichtig. Gleichzeitig schob sie mit zwei Fingern verstohlen eine imaginäre Haarsträhne unter ihre runde, streng anliegende Kopfbedeckung. Arinna nickte, lächelte zurück und war dankbar, dass die Frau sie auf ihre widerspenstigen Haare aufmerksam gemacht hatte.
»Blödsinn«, knurrte Oschin, als sie bei ihm anlangte.
»Was ist Blödsinn?«, erkundigte sich Arinna. »Hast du etwa verstanden, was die Frau gesagt hat?«
»Natürlich.«
»Und was sagte sie?« Arinna verbarg ihr Erstaunen darüber, dass der Armenier des Türkischen mächtig war.
»Wer Hilfe gibt, wird auch Hilfe erhalten. Ein dummes Sprichwort dieser Leute. Ich hätte es auch ohne sie in die Stadt geschafft«, verkündete Oschin großspurig.
»Natürlich«, sagte Arinna nachgiebig, obwohl die Türkin Oschin gar nicht gemeint hatte, und begann, über ihren Begleiter nachzudenken. Vermutlich hatte er sich ihr nur als Begleiter angeboten, weil ein Paar unauffälliger reiste.
An der Weggabelung nahm Oschin die linke Straße, die am Westrand des Ortes entlangführte. Die Stadtmauer schlug einen großen Bogen um sie herum, und Arinna sah ein weiteres Tor. Dann kamen sie an einem römischen Theater vorüber, das inmitten von Steintrümmern lag und in die Erde hineingebaut war. Ziegen kletterten auf den Sitzreihen herum und zupften Gras aus den Ritzen.
»Was suchst du?«, fragte Arinna angesichts der Blicke, die der Armenier immer wieder über die Silhouette des Dorfes warf.
»Ich schaue, ob es eine neue Moschee gibt. Dieser Ort hat schon zwei, die alte Hagia Sophia, die sie gerade für ihren Gott umbauen, und noch eine weitere, kleine. Und wer weiß, wie viele noch. Die Sultane, ihre Gemahlinnen und Wesire wetteifern geradezu miteinander, die schönste Moschee und die beste Armenküche zu stiften. Wenn es eine neue Küche gibt, ist sie besser als die alte. Ich bin jedenfalls hungrig wie ein Wolf, ich will heute Fleisch essen, und nicht zu knapp, und die Küche muss ich finden, bevor die Sonne untergeht. Danach heißt es warten.«
»Worauf?«
»Auf das Ende ihres Abendgebetes natürlich. Sie essen immer erst nach dem Gebet, und das gilt auch für die Armenküchen. Weißt du denn gar nichts über die neuen Besitzer dieses Landes?« Oschin musterte sie scharf.
Arinna schüttelte den Kopf. Dass sich im Tal der Tauben von Matiana auch türkische Siedler niedergelassen hatten, erwähnte sie lieber nicht. Christen und Osmanen wohnten streng getrennt voneinander und pflegten keine freundschaftliche Nachbarschaft.
In diesem Augenblick begann der Muezzin zu rufen. Sein eintöniger Gesang war ganz ähnlich wie der des griechischen Priesters, dessen Stimme vor allem an Ostern von einer Felswand zur anderen durch ihr Tal getragen worden war. Dazu hatte in der Ferne eine kleine Glocke gebimmelt und über allem das leise Gurren zufriedener Tauben gelegen. Arinna schloss die Augen, um zu verhindern, dass ihr die Tränen über die Wangen liefen.
Sie konnte sich noch gut an das helle Klingeln der Glocke erinnern. Aber nachdem die Osmanen auch in das Tal mit den Felsenhöhlen und den uralten christlichen Felsenkirchen eingedrungen waren, war es den Mönchen und Priestern verboten worden, ihre Glocken zu läuten. Arinna und ihre Familie waren zwar nicht oft in die Felsenkirche gegangen, da ihr Glaube ein anderer und viel älter war, aber sie erinnerte sich mit Sehnsucht an den Klang der Glocke.
Seit der Eroberung des Tals durch die Osmanen durfte nur noch das Semantron die Gläubigen zum Gottesdienst rufen. Das Hämmern auf dem Schallbrett pflegte Arinna Angst einzujagen, denn damit verband sich für sie auf ewig das Eindringen von Feinden, die ihr friedliches Leben so grundlegend verändert hatten. Vor allem aber mit dem Tod des Vaters, den die türkischen Janitscharen getötet hatten.
Die alte große Basilika mit drei kuppelbedeckten Schiffen war noch im Umbau, derzeit aber von den Maurern verlassen. »Hier gibt es keine Küche«, stellte Oschin mürrisch fest und schlug mit seinem ihm eigenen wiegenden Gang den Weg in das Innere des Dorfes ein.
Arinna blieb hinter ihm wie bei den Türkinnen üblich. Es war unauffälliger, außerdem wurde ihr seine Begleitung immer unangenehmer. Sie fragte ihn auch nicht nach dem wunderschönen Gebäude, das sich aus der Nähe als ein türkischer Pavillon mit einem Sarkophag erwies.
Oschin gönnte ihm ohnehin keinen Blick, sondern strebte zum benachbarten Kiosk, der aus einer Kuppel auf Säulen bestand. Im Inneren sprudelte ein Brunnen. Wie selbstverständlich hakte Oschin eine Tasse, die mit einer Kette am umlaufenden Gitter befestigt war, aus und reichte sie dem Brunnenwärter, der sie aus einer Kanne füllte. Arinna tat es ihm nach. Kalt und köstlich wie aus einem Bergsee war das Wasser. Als sie sich bedanken wollte, zeigte der Wärter gleichgültig auf den Sarkophag, in dem offenbar der Erbauer des Brunnens lag, und bedeutete ihr, sie möge ein Dankesgebet für ihn errichten.
Danach musste sie sich beeilen, um Oschin nachzulaufen.
Ganz am Ende der langen Straße, die kurz vor einem Stadttor und einem Aquädukt mündete, machte er vor einer Mauer halt, über die Kuppeln und ein Minarett emporragten. Ohne die geringsten Bedenken trat er durch einen Torbogen in den Vorhof ein.
»Da drüben ist die Küche«, sagte er und wies auf eine Reihe von vier Kuppeln hinter einer weiteren Mauer.
Sie warteten schweigend. Endlich verließen Männer die Moschee, streiften sich ihre Schuhe über und verliefen sich in verschiedene Richtungen.
Oschin folgte denjenigen, die zum anderen Tor hinausgingen, Arinna dicht hinter sich. Eine Gasse trennte die Moschee von der Armenküche, deren Arkadengänge sich in Hufeisenform um einen Hof herum gruppierten.
Eine Schar von Männern machte sich dort zu schaffen, einige eilten mit Schüsseln und Schalen durch das Geviert, während Bedürftige dabei waren, sich Plätze zu sichern, indem sie Lederdecken auf dem Boden ausbreiteten und die Kinder schon Platz nehmen ließen.
»Viele Leute hier. Die Küche scheint sich gebessert zu haben. Wir bleiben.«
»Meinst du, dass wir uns wirklich hintrauen sollen?«, fragte Arinna.
»Wieso nicht? Dies ist unser Land, und sie machen sich hier breit«, antwortete Oschin grob. »Das Mindeste, das man von ihnen erwarten kann, ist, dass sie uns mit den Früchten ernähren, die sie uns gestohlen haben.«
»Ja«, sagte Arinna zweifelnd. Sie fragte lieber nicht, woher er seine Kenntnisse von Nikäa hatte. Je weniger sie von ihm wusste, desto besser.
Oschin schob sich seine runde Kappe in die Stirn und machte sich unverzüglich auf den Weg in den Innenhof.
Die Gruppe, in deren Schutz sie das Stadttor passiert hatten, war schon dort. Schier ungläubig wegen der Vielzahl an Gerichten sah Arinna zu, wie für sie mehrere große Schüsseln gefüllt wurden, die die Frauen in eine Ecke der Arkaden trugen. Die beiden Männer folgten mit einer Waschschüssel und mehreren Kannen.
Arinna bekam einen Stoß in die Seite, der sie stolpern ließ. »Pass auf! Wir sind dran«, murmelte Oschin und blickte gierig, aber auch ein wenig unzufrieden zu den Essensschüsseln.
In den Augen des Türken, der das Essen austeilte, las Arinna abweisende Verwunderung, aber sie erhielten nicht weniger zugeteilt als die anderen, abgesehen von der Waschschüssel und dem Waschwasser. Ein Mann in der Nähe aber nahm Anstoß an Oschin. Er kam heran und sprach ihn in scharfem Ton an.
Oschin lachte abfällig, ohne sich die Mühe einer Antwort zu machen, und wandte sich ab.
Schon im Gehen begann Oschin, die Suppe zu schlürfen. Nicht weit von der Essensausgabe pflanzte er sich hin, nicht ohne dem Aufseher einen aufreizenden Blick zuzuwerfen. Arinna, die ihm mit der Schale mit dem heißen Reisgericht, das die Türken Pilaw nannten, gefolgt war, errötete vor Scham über ihren Begleiter. Das Essen war reichhaltig, sie konnte die Butter, mit der nicht sparsam umgegangen worden war, sogar riechen.
»Was hat er dir gesagt?«, wollte sie wissen.
»Unwichtiges. Ich brauchte nicht nach einer Vogelkäfigküche Ausschau zu halten, meinte er. Etwas Besseres würde ich nicht bekommen.«
»Was bedeutet das?«
»In der Vogelkäfigküche bereiten sie das auserlesene Essen für den Herrscher zu«, erklärte Oschin unbefangen. »Für die Frauen, die Kinder und die Eunuchen werden andere Gerichte in einer größeren Küche gekocht. Weniger gutes.«
Arinna nickte nachdenklich und beobachtete ihn verstohlen. Vermutlich hatte der Aufseher die unzufriedenen Blicke des Armeniers ganz richtig gedeutet. Oschin ließ es an jeglicher Höflichkeit beim Essen fehlen, wie man sie jedem byzantinischen Kind beibrachte. Er raffte den größeren Teil des Lammragouts auf seine Seite der Schüssel und schaufelte den Reis mit dem Fladenbrot so schnell in sich hinein, dass für Arinna nur ein kleiner Teil blieb.
Aber es machte ihr nichts aus. Sie hatte lange nichts so Gutes zu essen bekommen, nicht einmal bei den Christen von Metropolis, die ganz ähnlich versteckt in einem abgelegenen Tal lebten wie die Christen im Tal der Tauben bei Matiana. Und von den Türken hatte sie unterwegs Vorräte gestohlen, nur einmal war sie eingeladen worden. In der Grenzfeste Doryläum, die man nicht umgehen konnte und die seit der Einnahme durch die Seldschuken Eskischehr hieß, hätte sie bestimmt in einer Volksküche essen können, aber sie hatte es nicht gewagt.
Während Arinna noch tief in Gedanken die Reissuppe mit Petersilie genoss, die Oschin übriggelassen hatte, sprang er so hastig auf die Füße, dass sie erschrak. Besorgt blickte sie ihm nach, als er sich aufmachte, um sich einen Nachschlag zu holen. Hoffentlich verstieß er nicht wieder gegen die Regeln ihrer Gastgeber.
Oschin kam mit einer Portion Pilaw zurück, die für sie beide gereicht hätte, die er aber, mit der Schüssel auf den Knien, ganz allein verzehrte. Wie üblich war dabei sein einziges Auge auf das Gericht gerichtet, so dass er den Kopf etwas schräg legte.
»Was ist eigentlich mit deinem anderen Auge?« Auf Dauer konnte Arinna ihre Wissbegier nicht bezähmen.
»Hab’s eingebüßt«, brummelte Oschin gleichgültig.
»Wie das? Hattest du einen Unfall?«
»Nein. Die Osmanen haben es mir ausgestochen.«
Arinna erschrak. »War es eine Strafe?«
»Das geht dich nichts an«, fuhr Oschin sie an.
»Zu uns sind die Osmanen aber sehr freundlich«, sagte Arinna hartnäckig.
Oschin blickte über den Schüsselrand hoch. »Du irrst dich. Sie verachten uns. Jeder türkische Schaftreiber dünkt sich etwas Besseres als der byzantinische Kaiser. Zu essen bekommen wir nur, weil ihnen Barmherzigkeit von ihrem Gott vorgeschrieben ist. Aus dem gleichen Grund überlassen sie den Straßenkötern Eselkadaver.«
Arinna schwieg gekränkt. Sie wusste nicht, ob er sie beleidigen wollte oder ob er recht hatte.
»Sie halten uns für dreckig und verkommen. Du siehst ja, dass sie Wasser für uns als unnötig erachten. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie die von uns verunreinigten Schüsseln später zerschlagen.« Als Oschin endlich die Schüssel neben sich stellte, rülpste er ungeniert. Der Hall stieß sich an den Mauern.
Sämtliche Gäste auf dem Hof, der sich inzwischen gefüllt hatte, drehten sich um und musterten ihn befremdet. Wie aus dem Erdboden gewachsen, stand plötzlich der Aufseher von vorhin neben ihnen. »Ungehobelter christlicher Klotz«, sagte er verächtlich auf Griechisch.
Bevor Oschin eine grobe Antwort geben konnte, versuchte Arinna, die Situation zu retten. »Es hat sehr gut geschmeckt«, richtete sie sich mit weicher Stimme an den Türken, »wie kann ich mich bedanken und bei wem?«
Der Türke beachtete sie nicht, sondern behielt Oschin im Auge.
»Wie kann ich mich bedanken und bei wem?«, wiederholte Arinna hartnäckig.
Der Türke überwand sich endlich, Arinna ins Gesicht zu sehen. »Genau mit diesen Worten«, antwortete er. »Bei den Männern, die das Essen ausgegeben haben. Sie werden es schon verstehen. Oder du sagst Allah a çok s ̧ükür, was heißt, ich danke Gott.«
»Ist dir etwa die volle Form des Dankgebetes nicht bekannt? Dann bist du aber sehr ungebildet«, bemerkte Oschin gelangweilt, der sich inzwischen zurückgelegt hatte und mit den Ellenbogen auf dem Boden lümmelte. »Elhamdüllah, çok s ̧ükür ya Rabbi, Allahu Teala Padis ̧ahımız’ın bir gününün bin eylesin, was in unserer Sprache heißt: Danken wir Gott, dem Allmächtigen, und möge ein einziger Tag unseres gepriesenen Herrschers so viel wert sein wie tausend Tage.«
Der Türke betrachtete ihn nachdenklich, während er an seinem Schnurrbart zupfte. »Du bist ein seltsamer Mann. Man sollte ein Auge auf dich haben, damit du keinen Schaden anrichtest. Ich werde es veranlassen.«
»Selam aleikon«, sagte Oschin scharf und gab ihm mit einer gebieterischen Handbewegung zu verstehen, dass er sich entfernen möge.
»Und du, Frau?«, fuhr der Aufseher fort. »Bist du aus Rumelien gebürtig, wo besonders hellhäutige Menschen leben sollen? Gibt es dort nicht bessere Männer als deinen ungehobelten Begleiter aus dem armenischen Bergland?« Ohne auf eine Antwort zu warten, warf er ihnen ein gleichgültiges »aleikon« hin und schritt mit den Händen auf dem Rücken davon.
»Ich fluche dir ebenfalls«, murmelte Oschin wütend hinter ihm her.
Stumm sammelte Arinna die Schüsseln zusammen. Hoffentlich rief der Osmane nicht wirklich die Obrigkeit herbei. Oschin hatte es herausgefordert. Mit jeder Stunde wurde es ihr in seiner Gegenwart unbehaglicher.
Niemand beachtete sie, als sie das Geschirr ablieferte und sich auf Türkisch bedankte. Aber viele Augen ruhten auf Oschin.
Es war schon dunkel, doch Oschin kannte die Gegend offenbar gut. Ohne zu zögern, marschierte er nach Westen, wo man durch das zerstörte Seetor eine Mole sehen konnte, an der einige Fischerboote lagen. Sie folgten der Stadtmauer außen entlang nach Norden. Kurze Zeit später machte er am Seeufer halt und warf seinen Packsack ab.
Arinna wälzte sich schlaflos auf dem Bett aus Schilf, das sie in aller Hast eingesammelt hatte. Die trockenen Gräser raschelten, neben ihr schnarchte Oschin, und sie bildete sich ein, es sei der Lärm, der sie wach hielt. In Wahrheit war es ihre eigene Angst.
Der Armenier plante, an die Küste des Marmarameeres zu marschieren und von Pylai aus mit einem Schiff nach Konstantinopel überzusetzen. Seitdem sie das erfahren hatte, überlegte Arinna, ob es nicht ratsamer wäre, sich von ihm zu trennen und, immer am Meeresufer entlang, bis in die Hauptstadt zu wandern. Diese Straße gab es, das wusste sie mit Sicherheit. Gegen ihren Plan sprach, dass sich hier, so dicht an der Grenze zum Byzantinischen Reich, die türkischen Truppen sammelten wie Fliegen auf Maultieräpfeln. Angeblich unternahmen sie immer wieder Vorstöße auf Konstantinopel.
Oder sollte sie bei Oschin bleiben? Ihr Vater Taru hatte sie immer ermahnt, Fremden gegenüber vorsichtig zu sein, sich vor allem nie zu offenbaren. Zu leicht konnten Kenntnisse über einen Menschen zu dessen Nachteil ausgenutzt werden. Er selber hatte sich strikt daran gehalten.
Und doch hatte Klugheit sein Leben nicht gerettet. Er, der Gelehrte, hatte sich von einem Augenblick zum anderen genötigt gesehen, seinen Sohn Theodor mit der Waffe gegen die Janitscharen zu verteidigen. Im Auftrag des Sultans streiften diese durch das Land, um christliche Jungen mit wacher Intelligenz ausfindig zu machen und an den Hof des Sultans zu bringen.
Der Anführer der Janitscharen, in roter Bluse und mit blütenweißer Haube auf dem Kopf, schien für einen friedlichen Umzug zu Ehren des Sultans bekleidet. Aber der lange Waffenrock, Säbel, Pfeil und Bogen bewiesen, dass er mit seiner Schar auf dem Kriegszug war. Stolz, höflich und in geläufigem Griechisch hatte er Arinnas Vater Theodors Aufstiegsmöglichkeiten in der Elitegarde des Sultans in glühenden Farben geschildert.
Taru hatte sich geweigert. Worte wie Knabendiebstahl, Raub und Entführung waren ihm über die Lippen gesprudelt, und schließlich hatte er sich in seiner Not dazu bekannt, dass sie gar keine Christen seien, und Theodors eigentlicher Name Ammuna sei.
Das hatte den Soldaten nicht im Geringsten beeindruckt. Die Kinder durften jeden Glauben haben, nur Muslime durften sie nicht sein. Und gegen die einmal gefallene Entscheidung eines Janitscharenführers, einen Jungen mitzunehmen, gäbe es keinen Einspruch.
Da hatte Taru nach dem alten persischen Schwert gegriffen, das immer auf der Innenseite des Höhleneingangs hing, und war unter Tränen auf die Soldaten losgegangen. Seiner Frau und Tochter hatte er noch zugerufen, dass sie fliehen sollten. Das Einzige, das Arinna von diesen letzten schrecklichen Augenblicken behalten hatte, war, wie gleich danach Tarus grauhaariger Kopf unter einen Pferdeleib gerollt war. Was danach geschehen war, blieb für sie wie in einem dichten, dunklen Nebel.
Ihre Erinnerung setzte erst später wieder ein. Man hatte Arinna in einer der Fluchthöhlen tief unter der Erde gefunden, die mit rollenden Steinplatten versperrt werden konnten und wo sich ansonsten nur Vorräte befanden, und sie wusste nicht, wie sie dort hingekommen war. Zwei Tage war sie von einer Nachbarin gepflegt worden, bevor sie wieder aufgewacht war.
Vater und Mutter waren tot, die Janitscharen fort und mit ihnen der Bruder, und Arinna mochte an diesem blutigen Ort nicht bleiben, obwohl der Nachbar ein sechzehnjähriges Mädchen auch noch würde durchfüttern und verheiraten können, wie er sagte.
Und so hatte sie beschlossen, nach Konstantinopel zu gehen, um ihren Bruder zu suchen, und war jetzt fast ein Jahr unterwegs. Wie sie sich in der Stadt durchschlagen wollte, wusste sie nicht. Aber Prusa, die Hauptstadt der Osmanen, war nicht weit weg von Konstantinopel. Vielleicht würde sie in der byzantinischen Stadt einen Hinweis darauf finden, wo die christlichen Knaben zu Janitscharen erzogen wurden.
Oder schon morgen. Prusa lag dichter an Nikäa als Konstantinopel. Ammuna musste hier irgendwo sein. Mit diesem hoffnungsvollen Gedanken schlief Arinna endlich ein.
Noch in dunkler Nacht erwachte Arinna von einem Geräusch. Sie lauschte. Es waren Stimmen. Die Obrigkeit, die hinter Oschin her war? Fast in Panik krabbelte sie auf die Füße, lautlos trotz des raschelnden Schilfs, vergewisserte sich, dass ihr krummer schmaler Frauendolch sicher im Gürtel stak, und ergriff ihr Bündel. Oschin lag auf der Seite, zusammengekrümmt wie ein gefangener Fisch und atmete mit offenem Mund auch so.
Ohne Bedauern ließ sie ihn zurück. Ihr neuer Wanderweg lag klar vor ihr: Sie musste sich durch die Hügel schlagen, in die Oschin nicht gewollt hatte, Nikäa umgehen und dann die Straße, die sie gekommen waren, bis zur Abzweigung nach Prusa zurückwandern.
Über den Bergen lag ein schmaler Streifen Helligkeit. Dahinter ging schon die Sonne auf. Die Luft roch frisch und feucht, als sie sich ihren Weg zwischen Zitronenbäumen über die steinige gelbe Erde suchte. Es dauerte jedoch nicht lange, bis sie einen schmalen Karrenweg fand, der sich mit vielen Biegungen sanft aufwärts schlängelte.
Prusa! Oder Bursa bei den Türken. Plötzlich war Arinna froh über ihre Entscheidung. Sie war so weit gekommen, was konnte der kleine Umweg in die türkische Hauptstadt ihr schon anhaben? Und den zwielichtigen Armenier war sie los. Sie blieb kurz stehen, um zu lauschen. Die Stimmen waren verstummt, und von Oschin hörte sie auch nichts.
Ihr fiel ein, dass sie nie erfahren hatte, warum Oschin nach Konstantinopel wollte. Vielleicht um in den Dienst eines Handelshauses zu treten: Er beherrschte Armenisch, wie sie vermutete, Griechisch und Türkisch. Das waren nicht zu verach-tende Kenntnisse, vor allem, weil im Osten viele türkische Völker lebten. Und die Abendländer, die jene Gegenden bereisten, sprachen wenigstens zum Teil Griechisch, hatte ihr Vater erzählt.
Es ging jetzt steiler aufwärts. Die Zitronenbäume blieben hinter Arinna zurück, abgelöst wurden sie durch Granatapfelbäume und Felder, auf denen alte, schwärzliche Gerippe von Baumwollpflanzen standen.
All dieses hatte sie unterwegs auf ihrer Wanderung schon kennengelernt. Die Welt des Westens war so viel aufregender als ihre Heimat mit den winzigen Parzellen von Kürbiskulturen, von Quitten-, Walnuss- und Apfelbäumen, den Schaf- und Ziegenherden und den Tauben. Und doch würde sie zu ihr zurückkehren.
In dem allmählich grauenden Morgen fiel ein schwarzer Schatten auf Arinnas Weg, lang und breit wie der eines Riesen. Erschrocken blickte sie auf.
Oschin. Seine Hand lag auf dem Knochengriff seines beängstigenden kaukasischen quama, der in der Schärpe steckte.
Kapitel 2
Du wolltest doch wohl nicht allein weiterziehen?«, fragte Oschin lauernd. »Unerfahren, wie du bist. Ohne mich werden die Osmanen dich einfangen. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was sie mit dir machen würden. Alle Scheußlichkeiten der Welt. Für eroberte Weiber lassen sie sich viel einfallen …«
Auch ihm fiel anscheinend viel ein. Seine Hose rührte sich im Schritt, obwohl sie weit geschnitten war wie die der Osmanen. Arinna trat unwillkürlich rückwärts.
Er grinste hässlich, ballte die Fäuste und atmete mühsam durch, während der Stoff seiner Pumphose langsam in sich zusammenfiel. Die Erwartung in seiner Stimme war nicht zu überhören gewesen, aber trotzdem hatte er sich bezwun-gen.
»Deine Gesellschaft ist mir zu gefährlich geworden«, sagte Arinna mühsam, nachdem sie ihre Geistesgegenwart wiedergefunden hatte. »So, wie du dich benimmst, bist du derjenige, den sie einfangen.«
»Mach dir um mich keine Sorgen«, sagte er arrogant. »Ich schlage mich im schlimmsten Fall auch als Türke durch, wenn es sein muss.«
»Das glaube ich dir«, murmelte Arinna.
»Und dein kleines nettes Messerchen wollen wir doch lieber entfernen, nicht wahr?« Ohne dass Arinna es verhindern konnte, riss er ihr den immerhin fast unterarmlangen Dolch aus dem Gürtel und schleuderte ihn weit weg. Er stank nach Schweiß und Fett. Und nach Undefinierbarem.
Und sie war nun ganz ohne Schutz.
Pylai besaß neben dem Hafen ein altes römisches Theater. Arinnas Blicke gingen immer wieder dorthin, als sie festgestellt hatte, dass Oschin mit dem Bootseigner in türkischer Sprache verhandelte, wovon sie kein Wort verstand.
Auf ihrer Wanderung hatte sie vieles gesehen, aber noch keinen solch gewaltigen Bau der einstigen Bewohner des Landes.
Endlich waren die beiden Männer sich handelseinig. Voll Überraschung registrierte Arinna, dass mit dem Handschlag auch einige Münzen den Besitzer wechselten. Sie erinnerte sich noch genau daran, wie der Armenier ihr versichert hatte, dass er kein Geld besäße.
Sie zwängte sich zwischen Körben mit Zitronen hindurch, bis sie im Bug ein Plätzchen zum Sitzen fand. Der Schiffer löste die Leinen vom Land, setzte sich ans Ruder und drückte kurz nach der Abfahrt das dreieckige Segel weit nach außen. Das Boot zog im lauen Wind eine schnurgerade Bahn durch das Meer, kleine Kräuselwellen liefen unter ihm hinweg, und mit dem Bug hob und senkte sich Arinna. Staunend stellte sie fest, dass ein Boot aufrecht segeln konnte. Sie hatte sich die Seefahrt aufgrund vieler Schilderungen viel ungemütlicher und gefährlicher vorgestellt. Dies war dagegen die angenehmste Art zu reisen, die sie jemals erlebt hatte.
Irgendwann nickte sie ein.
Kurz bevor es ganz dunkel wurde, legten sie an einem Ufer an. Die Männer lachten Arinna aus, als sie vergeblich begann, sich nach den Mauern und Kirchen von Konstantinopel umzu-sehen. Plötzlich erklärte der Türke, der sich Ali nannte, ihr auf Griechisch, dass sie die Stadt erst am nächsten Tag erreichen würden.
»Und wer wohnt hier?«, fragte sie beunruhigt. Ganz in der Nähe, aber auch über der schwarzen Silhouette eines Waldes, blinkten Lichter.
»Du hast ja mehr Schiss als eine Eidechse«, meinte der Schiffer, aber ohne jede Boshaftigkeit. »Wir sind hier auf der Insel Prinkipo, und was du hier unten siehst, sind die Lichter des Klosters vom Heiligen Nikolaos und oben die des Georgsklosters.«
»Dann sind wir gar nicht mehr im türkischen Gebiet?«
Ali schüttelte abweisend den Kopf. »Ab jetzt bin ich übrigens Alexios für euch.«
Aber erst als er das Abendessen vorzubereiten begann, ohne ein Abendgebet zu verrichten, war Arinna davon überzeugt, dass er wirklich Grieche war und sie im Byzantinischen Reich angekommen waren. Vor dem Essen, bei dem er großzügig Fladenbrot, Käse, Oliven und Walnüsse mit ihnen teilte, schlug er das Kreuz, und Oschin tat es ihm flüchtig nach. Dazu gab es Ayran zu trinken, den türkischen Joghurt, den sie sehr gern mochte. Den geharzten griechischen Wein hingegen lehnte sie ab. Oschin und Ali jedoch leerten eine Amphore und wurden immer lustiger.
Als Arinna das Boot verließ, um ihre Notdurft zu verrichten, folgte Oschin ihr, jedoch ohne ihr zu nahe zu kommen. Ganz offensichtlich achtete er darauf, sich nicht um den Verstand zu trinken. In dieser Nacht würde es nicht möglich sein zu fliehen. Sie hatte bereits das Nikolaoskloster im Sinn gehabt.
Am Nachmittag des folgenden Tages steuerte der Schiffer das Goldene Horn an. Der Schiffsverkehr war schon im Marmarameer beängstigend dicht. Das Wasser schäumte von Handels-seglern, die zugleich mit ihnen Kurs auf einen der Stadthäfen oder auf den Bosporus nahmen, und von Entgegenkommenden, die in das Mittelmeer segelten. Dazwischen kreuzten kleinere Boote und Fähren ihren Weg, die ungeachtet der Feindschaft zwischen Byzanz und osmanischem Sultanat die Verbindung zwischen beiden Reichen für Menschen und Handelsgüter aufrechterhielten.
Arinna war so aufgeregt, dass sie ihre Ängste wegen der plötzlichen Schieflage ihres Schiffes und der Schaukelei im kabbeligen Wasser ganz vergaß. Wie am Vortag saß sie im Bug und spähte in alle Richtungen. »Was ist das denn?«, rief sie und zeigte auf ein sonderbares, langgestrecktes Gebilde, das sich anscheinend nur durch Ruderkraft durch das Wasser bewegte. »Ein Tausendfüßler der Meere, Alexios?«
»So ungefähr«, antwortete er. »Ein Dromon. Irgendein idiotischer Kaiser, verzeih mir den Ausdruck, oder einer seiner genauso idiotischen militärischen Ratgeber hat vorzeiten Befehl erteilt, die byzantinische Flotte aufzulösen. Söldner sind ja billiger. Inzwischen hat ein neuer Kaiser bemerkt, dass solche gekauften Leute nicht die Zuverlässigsten sind, und jetzt üben sie mit diesem albernen, längst eingemotteten Großdromon die Seefahrt gegen die Osmanen! Da sitzen gepresste Byzantiner an den Rudern.«
»Aha«, sagte Arinna und beobachtete gebannt, wie das unendlich lange Kriegsschiff schnell an ihnen vorbeizog, die Ruderschläge offenbar gesteuert durch Pauken, die mal schneller, mal langsamer schlugen.
»Unter dem vorderen Aufbau befindet sich der Syphon«, bemerkte der Schiffer grollend, während sein eigenes Boot in den Heckwellen des Dromons steckenblieb und nur noch auf und nieder tanzte.
»Was ist der Syphon, und woher weißt du über Kriegsschiffe so gut Bescheid?«, erkundigte sich Arinna, ohne die Augen von dem davonziehenden Ungetüm zu lassen und ohne ihre klammernden Griffe um die Relingsleiste loszulassen. Die Strömung war stark, und sie mussten gegenan.
»Unter dem Syphon ist die Anlage, aus der das griechische Feuer geschleudert wird«, brummelte der Grieche widerwillig. »Alle meine Vorväter fuhren als Offiziere auf byzantinischen Kriegsschiffen. Die Flotte war einst der Stolz des Kaiserreiches. Und die Männer waren Könner als Seeleute. In meinen kleinen Küstensegler wäre von ihnen keiner gestiegen.«
»So? Das tut mir leid, Alexios«, bemerkte Arinna spontan. »Es ist doch ein schönes Boot.«
»Na ja«, knurrte der Schiffer missvergnügt. »Vielleicht ändert sich demnächst wieder einiges. Es heißt, der Kaiser will eine neue Flotte bauen …«
»Tatsächlich?«, schaltete Oschin sich ein. Seine gebogene Nase richtete sich wie ein Rabenschnabel auf den Schiffer, und seine Augen glitzerten. »Warum?«
»Die Genuesen bluten mit ihren Handelsschiffen Byzanz aus. Wenn wir uns den Häfen nähern, wirst du erkennen, dass sämtliche großen Schiffe, die jetzt Kurs auf das Goldene Horn nehmen, in Galata anlegen. Die Genuesen kassieren die Zölle für ihre Kolonie, und die städtischen Häfen von Konstantinopel bleiben leer. Man spricht von 200 000 Hyperpyra pro Jahr für die Genuesen, 30 000 für Konstantinopel. Nur damit du dir vorstellen kannst, warum der Kaiser schäumt.«
Oschin gab einen langgedehnten Pfiff von sich und richtete seine Aufmerksamkeit auf die Türme und Mauern beidseits des Goldenen Horns. Arinna, die abwechselnd die blauen Häuser von Konstantinopel und die mehr in weiß und gelb gehaltenen von Galata betrachtete, vermutete, dass er seine Zukunft offensichtlich im Handel sah. Auf der osmanischen Seite des Bosporus überwog hingegen das Grün der Wälder, das sich bis zu den Berggipfeln hochzog.
»Genua und Venedig tragen immer wieder ihre Kämpfe in unseren Gewässern aus«, fuhr Alexios fort, »verwüsten nebenbei griechische Dörfer, was übrigens die türkischen Banden auf ihren Piratenschiffen noch besser können, und deshalb wäre eine byzantinische Flotte schon längst wichtiger gewesen als wieder ein paar neue Kirchen in Konstantinopel. Oder ein Hafen, der nicht versandet. Möge die Heilige Antonia von Nikäa die dreisten Worte eines einfachen Schiffers verzeihen …« Er schlug mit ausladender Bewegung das Kreuz.
»Aber auf dich hört wohl keiner«, spottete Oschin.
»Nein, auf mich hört keiner«, bestätigte Alexios ihm mit spürbarer Verärgerung und kämpfte mit dem Strom, der das Boot inzwischen immer mehr in Richtung auf die Seemauer der Stadt drückte.
Oschin grinste.
»Ist das der Hafen?«, erkundigte sich Arinna und zeigte nach vorn, wo unterhalb der Seemauer einige Masten hinter einer Mole emporragten.
»Nein. Das ist der alte Hafen des Bukoleonpalastes, den du dort in die Mauer hineingebaut siehst. Er ist aufgegeben worden wie alle anderen Einrichtungen des Großen Palastes mitsamt den Palais, den Triumphbögen und Bädern, den Wandelhöfen, den Gärten und dem Poloplatz. Die Hirsche, Rehe und Pfauen sind geschlachtet. Das ganze kostspielige kaiserliche Pack ist in den kleinen Blachernenpalast am anderen Ende der Stadt umgezogen. Sie merken allmählich selbst, dass sie Geld brauchen, um das alles zu unterhalten, und dass sie selbst dazu keinen einzigen Stavraton beitragen. Vom Volk kommt nichts mehr. Das ist verarmt.«
»Aha«, murmelte Arinna verwundert. Den Berichten ihres Vaters über den Glanz und den Prunk in der wichtigsten Stadt der Welt hatte sie nie entnommen, dass er jemals verschwinden könnte.
»Wir werden im Stadthafen im Goldenen Horn anlegen«, ergänzte Alexios freiwillig. »In der Nähe sind der Gemüsemarkt und der Gewürzmarkt, wo ich hin will. Direkt am Hafen ist aber auch der Fischmarkt, wo ihr euch für wenig Geld verköstigen könnt. Wenn ich den Nährstrom zu fassen bekomme, dauert es nicht mehr lange, bis wir da sind.«
Oschin schwieg zu alldem. Er widmete sich mit interessier-ten Blicken der Betrachtung von Galata, der genuesischen Kolonie, die sie auf der rechten Seite sahen, während der Schiffer dicht am byzantinischen Ufer blieb.
Dann bog Alexios in ein Hafenbecken ein, in dem einige große Schiffe aneinander vertäut waren, das hauptsächlich aber überquoll von Fischerbooten und einmastigen Küstenseglern, die unter Gebrüll ihrer Schiffer an- und ablegten oder entladen wurden.
Endlich, dachte Arinna mit leisem Triumph. Konstantinopel! Sie hatte es erreicht.
Arinna kletterte steifbeinig auf den Kai. Im ersten Augenblick fühlte sie sich fast erschlagen von dem Lärm, den die Händler, die Aufkäufer, Fischer, Esel und Hunde machten, und von der wirbelnden Geschäftigkeit so vieler Menschen. Hätte Oschin nicht nach ihr gegriffen, wäre sie rücklings ins schwärzliche Hafenwasser zwischen Abfälle gefallen, als sie einem Fischer ausweichen musste, der leere Körbe von einem Wagen holte und in sein Boot warf.
»Pass auf, Kerl«, brüllte Oschin ihm nach, aber der Mann beachtete ihn gar nicht. Grinsend zwinkerte er Arinna zu. »Lebhaft hier, was?«
Arinna nickte gedämpft. So überwältigend betriebsam hatte sie es sich nicht vorgestellt.
»Wer wird dir bei deiner Suche nach deinem Bruder behilflich sein? Jemand am Hof? Wie heißt er?«, forschte Oschin.
Arinna hatte ihm so wenig wie möglich erzählt. Jetzt musste sie bekennen, dass sie überhaupt niemanden in der Stadt kannte.
»Dann bringe ich dich zu jemandem, den ich kenne. Da kannst du bestimmt ein paar Tage bleiben, während du dir überlegst, wie du vorgehen willst. Sie ist mir einen Gefallen schuldig.« Oschin zog konspirativ sein eines Augenlid herunter.
Arinna mochte weder sein schmieriges Grinsen, das ungepflegte gelbe Zähne freigab, noch seine vertraulichen Gesten. Aber es schien ihr das Beste, das Angebot anzunehmen. Angst hatte sie vor Oschin nicht mehr. Er hatte sie heil nach Konstantinopel gebracht. Und sie konnte auf der Stelle gehen, wohin sie wollte. »Ja, das wäre nett von dir«, sagte sie bemüht.
»Dann komm!«
Arinna heftete sich an Oschins Fersen. Sie hatte Hunger, und der Duft gegrillter Fische zog mitsamt dem schwärzlichen Rauch und den Rufen der Garköche eine verlockende Spur über den Fischmarkt. Aber Oschin bahnte sich zielstrebig seinen Weg an ihnen vorbei, vorbei auch an den Gewürzhändlern, wo sämtliche Düfte der orientalischen Gewürzstraße aus grünen, gelben und roten Pulvern aufstiegen und aufeinanderprallten. Zu gerne wäre Arinna stehen geblieben, um diese Wunder zu genießen, aber um Oschin im Gedränge nicht zu verlieren, musste sie darauf verzichten.
Der Armenier schien zu spüren, wo in dem Straßengetümmel Gefahren lauerten. Gelegentlich zog er Arinna im letzten Augenblick vor einem dösenden, aber schnell zuschnappenden Hund beiseite oder vor den Lastenträgern, die schnurgerade voranstapften und nie auswichen. »Was geht eigentlich in deinem dummen Eierkopf vor, dass du auf nichts achtest?«, fragte er boshaft.
Eierkopf! Oschins Hinterkopf war flach wie ein Wäscheklopfer, und der Rest sah auch nicht klüger aus. Aber sie verzichtete auf eine Erwiderung, er konnte wohl nicht anders.
Nach einer langen Wanderung hinauf auf einen dichtbebauten Hügel, dem zweiten neben dem Großen Palast, ging es zu ebener Erde weiter durch enge Gassen zwischen verfallenden Häusern, wo viele ärmlich gekleidete Menschen unterwegs waren. Unvermittelt blieb Oschin stehen und deutete nach vorn, wo die Gasse an einem Tor endete. »Da ist es. Wir sind gleich da.«
Arinna nickte erleichtert. Die Gegend gefiel ihr nicht. Nicht einmal die Reste einer Kirche, neben denen sie stand, flößten ihr Vertrauen ein. Außer runden Bögen aus roten Mauersteinen, die aus der Erde ragten, war von dem Gotteshaus nicht viel üb-riggeblieben. Seltsam jedoch, dass sie meinte, aus dem Inneren Geräusche zu hören.
Neben dem Tor stand ein Wächter, dem der schussbereit gespannte Bogen eines Osmanen über die Schulter ragte. Hinter der Schärpe stak ein gebogenes türkisches Schwert.
Arinna zögerte.
Da schloss sich Oschins Hand wie ein eiserner Ring um ihr Handgelenk. Er zog sie durch den Durchgang hindurch, hinter dem sich ein Platz öffnete, auf dem zwei Platanen standen. Eingerahmt war er von Galerien, in denen schwarzhaarige Männer in unterschiedlichsten Trachten saßen, von denen sich manche ein Brettspiel oder eine Kanne mit einem Getränk teilten. Manche sprachen mit Passanten, die vorbeibummelten, oder luden sie ein, in vergitterte Öffnungen zu spähen.
Laute Diskussionen und Geschrei wie gewöhnlich auf Marktplätzen gab es hier nicht, Frauen waren nicht zu sehen, Fleisch und Gemüse auch nicht. Arinna sah im ersten Augenblick keinen Ausgang aus diesem befremdlichen Marktplatz. Er machte vielmehr den Eindruck einer Falle. Sie sträubte sich weiterzugehen.
»Ist es nicht schön hier?« Oschin blickte sinnend in die Krone der Platane in der Platzmitte. »Reiher. Man könnte sie für Geier halten. Ich würde dir den Anblick gönnen, wie sie eine Leiche zerfleischen!«
Unwillkürlich sah auch Arinna nach oben, während ihr Herzschlag zu rasen begann. Die langbeinigen Vögel, die vom Ast in ein halbfertiges Nest hüpften, schienen ihr wie Todesboten in einer alten Tragödie. »Was willst du damit sagen?«, fragte sie beklommen und spürte eine wachsende Furcht vor der Häme, die sie in seinen Augen entdeckte.
»Du hast mich gequält, Nacht für Nacht, die ich neben dir verbringen musste, ohne dich zu nehmen wie eine Straßenhure. In meine Träume bist du gekrochen … Aber ich bin auch Geschäftsmann. Du warst mir zu kostbar. Zur Strafe wirst du jetzt in eine eigene Hölle gehen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen Erfolg als Hure …«
Arinna hörte ihm fassungslos zu.
Plötzlich schoss seine Hand vor und packte sie an der Kehle. Sie biss zu, ohne zu überlegen. Verblüffung malte sich in seinem groben Gesicht, während er sie abzuschütteln versuchte.
Auf einmal war sie frei.
Sie hetzte los, dem Tor entgegen, und prallte gegen das blankgezogene Schwert des krummbeinigen Wächters, der belustigt zu ihr hochschaute. An ihm würde sie nicht vorbeikommen.
Arinna drehte sich um sich selbst. Hinter den Platanen vielleicht? Es musste noch einen anderen Ausgang geben! Sie rannte zum Stamm eines der Bäume, hielt sich zitternd an der gefleckten Borke fest, hörte, wie die Reiher abhoben, und spähte voll Panik in die hinteren Arkaden, um irgendwo den hellen Fleck eines Tordurchgangs zu entdecken.
Sie fand keinen.
Gelächter erhob sich ringsum. Am lautesten war Oschins triumphierendes Lachen hinter ihrem Rücken, und gleich darauf spürte sie seine Faust.
Unter den belustigten Blicken der in Gruppen herumstehenden Männer schleifte er sie vor eine der Galerien und ließ sie dort fallen.
Als Arinna aufsah, lag sie auf Knien vor einem Mann mit dunkler Haut und tiefschwarzen Haaren, die sich vor seinen Ohren ringelten. Sein langer dunkler Mantel war abgetragen, fleckig und schäbig. Er taxierte sie, als wäre sie ein junges Kamel, bevor er halbherzig nickte und Oschin in einer Arinna unbekannten Sprache eine Frage stellte.
Das Gespräch ging in schnellem Wortwechsel hin und her, während Arinna allmählich begriff, dass dieses ein Sklavenmarkt war und sie gerade verkauft wurde.
Wie um ihre Erniedrigung zu bestätigen, kehrten die Männer nach einer Weile wieder zur griechischen Sprache zurück, so dass Arinna Oschins ganzen Zynismus anhören konnte.
»Ist sie unberührt?«, fragte der Händler namens Zebulun.
»Bei Oschin, ganz sicher«, sagte Oschin überzeugt. »Ich habe sie nicht angerührt, wenn’s mir auch schwerfiel. Und das ganze unausgegorene Zeug, das sie in den letzten Tagen von sich gegeben hat, spricht für ein kindliches Gemüt.«
»Da du wie ein echter Byzantiner schwörst, glaube ich dir erst einmal«, versetzte Zebulun und ließ wieder seine Blicke über Arinna wandern, bis sie dort liegenblieben, wo sich auf ihrer knabenhaften Gestalt der Busen befand. »Ich werde es später überprüfen, und wenn es nicht stimmt, ziehe ich dir den Zuschlag für besondere Qualitäten beim nächsten Handel ab.«
Oschin hatte keine Einwände, und schließlich wurden die beiden sich mit einem Handschlag handelseinig. Der Händler erhob sich und holte aus einem Gelass in der Tiefe des Gewölbes einen gefüllten Beutel, den er Oschin in die Hand fallen ließ.
Der Armenier zählte nicht einmal nach. Die beiden kennen sich, dachte Arinna wie gelähmt. Oschins ganze Aufmerksamkeit während Alexios’ sachkundiger Erklärungen zu Konstantinopel war gespielt gewesen, um ihren Argwohn zu dämpfen. Er musste schon oft hier gewesen sein.
Oschin ließ den Beutel um die Schnur wirbeln, während er an seinen Zähnen saugte und Arinna mit einem zufriedenen Grinsen bedachte. »Viel Spaß mit Zebulun aus Bolgar. Du wirst bei ihm und deinen späteren Herren wesentlich aufregender leben als in deinem Tal der Tauben.«
Während Oschin in Richtung Tor schlenderte, nicht ohne in die eine oder die andere Galerie hineinzuspähen, sprach der Händler Arinna in Griechisch an. »Versuch erst gar nicht zu fliehen, mein Täubchen aus dem Tal der Tauben. Du entkommst nicht. Noch keine Frau hat es geschafft. Wir pflegen hier kaiserlich-byzantinische Sitten, musst du wissen.«
Arinna sah ihn fragend an.
»Die rhinokopia. Naseabschneiden. Außerdem blenden. Beides fürchtet jeder Wächter mehr als die härteste Bastonade. Keine Frau kann einem Wächter etwas bieten, das so viel Verlust wert wäre.«
Arinna glaubte ihm aufs Wort. Ohne Widerstand zu leisten, ließ sie sich in einem verwinkelten Gang vorwärts stoßen, um schließlich in einem engen dunklen Raum mit niedriger Decke zu landen. Während hinter ihr der Jude die Tür abschloss, wankte sie zur vergitterten Fensteröffnung. Wie betäubt starrte sie hinaus auf den Platz der Sklavenhändler.
Sklavin. Sie war eine Sklavin.
Kapitel 3
Christophoro Boccanegra hörte den Bericht des Dieners, den er ausgeschickt hatte, um sich zu erkundigen, wie es in der Stadt stand, mit missmutiger Miene an. »Sie halten also noch den äußeren Mauerring, sagst du. Ist er völlig intakt?«
»Soviel ich weiß, Herr«, antwortete der Mann vorsichtig und trat mit einem Bückling einen weiteren Schritt rückwärts in Richtung Kontortür.
»Bleib hier, Kerl! Ich bin noch nicht fertig mit dir«, herrschte ihn der genuesische Kaufmann an und klatschte ihm mahnend mit der flachen Hand rechts und links auf die runzeligen Wangen. »Und wie sieht es vor den Mauern aus?«
»Es sind noch keine Einheiten abgezogen, Herr. Aber vielleicht kommt das bald, es heißt, die Tataren hätten eine Krankheit im Heer.«
»Es heißt, es heißt … Drück dich gefälligst genauer aus. Was ist das für eine Krankheit?« Boccanegra zupfte an seinen modisch engen Manschetten, die ihm jeden Morgen an die samtenen Ärmel genäht wurden und heute gänzlich schief saßen. Selbst die Schamkapsel schien zu klemmen. Nichts verlief an diesem Tag normal, alle einheimischen Helfer der genuesischen Handelsniederlassung waren außergewöhnlich nervös, selbst die dumme Näherin. Er wusste nicht warum und hatte deshalb diesen Tölpel Kayghalagh, Diener für alle Arten von Anliegen, ausgeschickt, um sich in der Stadt umzuhören. Bisher hatte er, der gegenwärtig Vornehmste dieser Niederlassung und verpflichtet, mehr als andere zu wissen, nichts erfahren, das über das übliche Gerede hinausging. Die Tataren versuchten eben die Stadt zu erobern. Ein Ärgernis wie viele andere, mit denen man es als Fernhandelskaufmann zu tun hatte. Gottlob war es vergebliche Liebesmüh der Barbaren. Was konnten sie mit ihren Pfeilen schon gegen Mauern ausrichten, die Genuesen und, zugegeben, Venezianer errichtet hatten?
Als Boccanegra wieder aus seiner Gedankenflut auftauchte, stand Kayghalagh an der Tür, die eine Hand hinter seinem Rücken und gewiss schon auf der Klinke. »Was das für eine Krankheit ist, will ich wissen!«, brüllte Boccanegra ihn an.
»Man weiß es nicht, Herr«, jammerte der Chasare. »Ich habe mir alle Mühe gegeben, es zu erfahren. Die Tataren sterben einfach, sagt man.«
Boccanegra beruhigte sich schnell. »Na ja, sie werden wohl von ihren eigenen Teufeln vernichtet. Nichts, um das wir uns kümmern müssten. So abergläubisch wie sie sind, werden sie Kaffa verwünschen, uns verfluchen und woanders hinziehen, wo sie leichtere Beute finden. Zurück zum Geschäft: Wie viele Gefangene haben wir bis jetzt?«
»Zwanzig Tataren, Herr, dazu einige Kirgisen und Georgier«, antwortete der Gehilfe, jetzt viel eifriger als vorher.
»Nur Männer?«
»Ja, leider«, gab Kayghalagh zu. Seine stämmige, aber zwergenhaft kleine Gestalt schien unter der Schuld, die er sich offenbar zu eigen machte, zu schrumpfen.
»Wann kriegt ihr Faulpelze denn endlich mal eure Ärsche hoch?«, fluchte Boccanegra auf Italienisch, das der Chasare zwar nicht verstand, aber doch wohl die Verachtung, die er in seinen Tonfall legte. »Die werden wir in Konstantinopel für den Palast los, wenn sie ansehnlich genug sind, um entmannt zu werden, aber für Genua taugen sie nun mal nicht! Gute Geschäfte machen wir nur mit weißhäutigen Frauen auf den italienischen Märkten. Nicht getauft, offiziell jedenfalls nicht!«
»Auf der Krim gibt es keine mehr, Herr! Außerdem schwärmen die Tataren gegenwärtig über die ganze Halbinsel. Ihr würdet kein Dorf erreichen, ohne auf ihre Krieger zu treffen. Und die sind auf das Gleiche aus wie Ihr: auf Gold und goldhaarige Weiber.«
Boccanegra schwieg verärgert.
»Wie wäre es denn, wenn Ihr den kleinen Umweg über Tscherkessien nehmen und dort weibliche Kinder kaufen würdet? Das ginge schnell …«
»Die Tscherkessen sind Christen und verkaufen ihre Bälger nur an Muslime, wie du ganz gut weißt«, unterbrach Boccanegra ihn mit gelangweilter Miene. »Außerdem liegt ihr Land zu nahe an der zivilisierten Welt, als dass ich dort noch heimlich kaufen könnte. Früher mal, ja … Nein, bis ich zu Hause angelangt bin, weiß es schon der Heilige Vater, und ich möchte mir die Vorhaltungen seines Bischofs nicht anhören.«
»Und ein kleiner Raubzug in Georgien?«
»Georgien«, schnaubte Boccanegra. »Georgien ist das Einzugsgebiet von Francesco Doria aus der Niederlassung Trapezunt. Der ist giftiger als eine Natter, ob man auf ihn drauftritt oder nicht. Mit dem will ich nichts zu tun haben.« Dass die Dorias eine adelige Familie mit viel Macht in Genua waren, fand er nicht nötig zu erwähnen. Besonders Giustiniani Doria, Francescos Bruder, der in Kaffa beständig seine Nase in Geschäfte steckte, die ihn nichts angingen, war für ihn ein rotes Tuch. Irgendwann würde er den Kerl in die Hölle schicken. Mit Mühe wandte Boccanegra seine Gedanken wieder seinem Geschäft zu. »Es wird, verdammt noch mal, immer schwieriger und teurer, Sklaven zu bekommen. Da muss sich grundlegend etwas ändern!«
»Ich müsste jetzt …«, murmelte Kayghalagh demütig, ohne auszusprechen, was er müsste.
»Dann verschwinde, du Chasarengesicht«, schimpfte Boccanegra auf Italienisch.
»Kayghalagh, du gottloser Faulpelz! Komm gefälligst endlich her!«, brüllte zwei Tage später Boccanegra in den Flur vor dem Kontor, außer sich vor Wut über die Unzuverlässigkeit der einheimischen Angestellten.
Nach einer Weile klopfte es verhalten, und der jüngste der Genuesen trat ein, Niccolò, ein Schreiber, der den Kaufmannsberuf anstrebte. »Euer Diener ist nicht im Haus, ehrenwerter Christophoro Boccanegra«, meldete er mit einer tiefen Verbeugung. »Auch kein anderer von unseren Einheimischen. Es scheint so, als hätten sie alle zugleich ihren Dienst aufgegeben.«
»Ihren Dienst aufgegeben?«, wiederholte Boccanegra ungläubig.
Niccolò nickte.
»Lassen sie sich etwa von den Tataren ins Bockshorn jagen?«, mutmaßte Boccanegra mit seiner üblichen Portion von Verachtung für alle Eingeborenen außer denjenigen der Stadt Genua.
»Ich würde es anders ausdrücken«, meinte Niccolò und stolperte vor lauter Eifer, gefällig zu sein, über seine hastig ausgestoßenen Worte. »Die Tataren sterben inzwischen wie die Fliegen, hört man, und sie haben eine Leiche über die Mauern katapultiert. Die liegt zwischen der äußeren und der inneren Ringmauer, und aus Furcht vor dem Fluch wagt niemand, sie zu beseitigen. Selbst die Griechen und Armenier im innersten Stadtkern verkriechen sich. Und die Chasaren, die wissen, dass dieser unappetitliche Streich uns Händlern des Westens gilt, meiden jetzt die Faktoreien.«
»Was für ein Fluch?«, knurrte Boccanegra.
»Man behauptet, dass die Zauberer der Tataren dem Geist der Krankheit versprochen haben, dass er sich an den Armeniern und Syrern von Kaffa laben darf. Die sind besonders ansehnlich und fett im Fleisch, und das könnte den Geist befrieden und von den mageren Tataren ablenken.«
»Ist da etwas Wahres dran?«, fragte Boccanegra mit gerunzelter Stirn.
Der junge Kaufmann blickte verlegen zu Boden. »Ich glaube schon. Den Armenier Vasak Ablgharib, den Vater des Dreifachkinns, der in der Stuhlsänfte von einem Haus zum anderen getragen werden muss, hat es erwischt. Die Zauberer verstehen ihr Handwerk.«
»Unsinn«, blaffte Boccanegra. »Was hat der Armenier mit der fremden Leiche zu schaffen?«
Niccolòs Augen funkelten vor Begeisterung. »Er hat sich hintragen lassen müssen, weil keiner seiner Bedienten sich traute, sie zu holen. Er wollte wissen, warum der Mann gestorben ist. Feige ist er nicht.«
»Na gut, dann stirbt er also auch«, bemerkte Boccanegra lakonisch. »Ein Konkurrent weniger.«
»Hoffentlich sind es nicht bald viele Konkurrenten weniger«, sagte Niccolò plötzlich in verändertem Ton, der Angst signalisierte.
»Du kleinmütiger Geist«, tadelte Boccanegra ihn herablassend. »Vertraue der Weisheit unserer Dogen, deren Verbindun-gen uns in aller Welt gesicherte Stützpunkte und Kolonien auf ewig verschaffen. Ein Kaufmann gibt nicht beim ersten Schrecken auf. Du musst noch viel lernen, Niccolò. Ich bin nicht sicher, ob du zum Kaufmann geeignet bist, überhaupt nicht sicher.«
»Mag sein«, wandte Niccolò eigensinnig ein, »aber ich lebe schon zwei Jahre hier. Irgendetwas liegt in der Luft. Mir wäre lieber, wir Genuesen würden schleunigst abreisen.«
»Wir Genuesen denken überhaupt nicht daran«, entgegnete Boccanegra, bis in seine Seele hinein erzürnt über diesen jungen Spund, der es wagte, ihm zu sagen, was er zu tun hatte. Bevor er sich vergaß, schickte er ihn mit einer Handbewegung aus dem Raum. Wäre Niccolòs Vater nicht der Lieferant des besten Olivenöls für seine häusliche Küche gewesen, hätte er den jungen Mann auf der Stelle zum Laufburschen degradiert.
Nachdem Boccanegra ein inniges Gebet auf seinem Bänkchen verrichtet hatte, spürte er wieder, dass der Herr auf seiner und der Genueser Seite war. Kein Grund zur Beunruhigung.
Am nächsten Morgen wurde Boccanegra durch Geschrei im Hof der Faktorei und Aufruhr in den Gängen des Hauses geweckt. Er schob die kleine rothaarige Sklavin, die sein Lager geteilt hatte, so hastig von sich, dass sie aus dem Bett rollte, und begann, seine Füßlinge überzustreifen.
Sein Kammerdiener eilte herein, um ihm beflissen beim Anziehen zu helfen. »Herr, in der Nähe brennt es. Es wäre besser …«
Boccanegra unterbrach ihn. »Was besser ist, entscheide ich.«
»Jawohl. Natürlich, Herr«, stieß der weißhaarige alte Mann klagend aus und rang die Hände.
Als Boccanegra wenig später gemessenen Schrittes aus dem Handelshof auf die Straße trat, brannten nicht nur zwei Anwesen, die Griechen gehörten, lichterloh, sondern auf der Straße lagen auch mehrere Leichen. Sonst war niemand zu sehen.
Kochend vor Wut, stürzte Boccanegra zurück in den Hof. »Alle herhören!«, brüllte er, ohne zu wissen, wie viele Kaufleute überhaupt noch anwesend waren.
Giustiniani Doria und Andrea Longo erschienen auf der Galerie in den Türen zu ihren Gemächern, beide mit indignierten Gesichtern, offensichtlich unterbrochen mitten in ihrer Ankleideprozedur. Hinter ihnen reihten sich ihre persönlichen Bediensteten mit missbilligenden Mienen auf.
»Wir müssen die Stadt verlassen«, schrie Boccanegra so laut, dass es in jede der Kammern dringen musste. »Wer nicht innerhalb einer Stunde auf der Sant Jacobus ist, bleibt zurück!«
»Aber wertgeschätzter Christophoro Boccanegra«, warf Giustiniani Doria gelangweilt ein, »welche Hetze, welche Panik! Was ist nur in Euch gefahren?«
»Noch nichts, gottlob«, bemerkte Boccanegra knapp. »Die tatarischen Zauberer haben begonnen, ihren Krankheitsgeist auf uns zu hetzen. Ich möchte nicht warten, bis einer in mich fährt. In einer Stunde also.«
Niccolò, der hinter ihm stand, nickte nachdrücklich zur Bestätigung und klemmte eine kleine Truhe noch fester als vorher schon unter seinen Arm.
Boccanegra drehte sich zu ihm um. »Lauf in den Hafen, Niccolò, und sag dem Kapitän Bescheid, dass wir noch in dieser Stunde aufbrechen. Er soll seine Mannschaft zusammentreiben, alle, die sich schnell finden lassen! Wir werden auf Seeleute, die in abgelegenen Schänken hocken, nicht warten.«
»Ihr könnt doch nicht einfach über die Sant Jacobus verfügen, als ob sie Euer persönliches Eigentum wäre«, keifte der ältliche Andrea Longo, Besitzer eines kleinen Handelshauses, das sich hauptsächlich mit Pelzen, Wachs und Honig befasste. »Sie steht dank des Dekretes unseres consiglio schließlich allen genuesischen Kaufleuten zur Verfügung, und wir sollten darüber abstimmen, ob und wann sie segelt.«
Seine trotz der Entrüstung zitternde Stimme entlockte Boccanegra ein herablassendes Lächeln. Der Mann hatte fürchterliche Angst. Aber er selber hatte sich entschieden, es wurde brenzlig in dieser Stadt, und sie würden sie umgehend verlassen. »Ich kann, verehrter Longo. Als Mitglied des Consiglio trage gegenwärtig ich die Verantwortung für die Niederlassung, und als consigliero befehle ich den Aufbruch«, rief er nach oben. »Aber es steht Euch natürlich frei zu bleiben.«
Doria schob ohne Hast seinen ausladenden Wanst an die Brüstung und legte die von einer Spitzenbordüre bedeckten Hände darauf. Boccanegra kräuselte verächtlich die Lippen. Er wusste, warum der Kerl die altmodischen Spitzen trug: Sie verdeckten die Wurstfinger, die auch fünf Ringe nicht attraktiver machen konnten.
»Die Geschäfte meines Hauses erfordern meine Anwesenheit in Kaffa noch für einen, höchstens zwei Tage«, hob Doria in getragenem Tonfall an. »Solltet Ihr tatsächlich heute abreisen wollen, wird dies ein Nachspiel in Genua haben, Boccanegra. Ich warne Euch!«
»Sprecht es ruhig offen aus, Doria. Ihr seid zu geizig, um den Tagespreis für die Edelsteine zu bezahlen. Ihr hofft, dass sie preiswerter werden, je länger Kaffa von den Tataren bedrängt wird, weil keine neuen Aufkäufer anreisen, stimmt’s?«, spottete Boccanegra. »Dabei dürftet Ihr Euch gründlich irren, denn in naher Zukunft erreichen auch keine Karawanen aus dem Osten mehr die Stadt. Der Khan der Tataren fängt sie ab, wie ich hörte. Der Einkaufspreis wird ganz gewaltig steigen.«
»Versucht nicht, mich in meinem eigenen Geschäft zu be-lehren!«, schnaubte Doria. »Das steht Euch nicht zu, Euch nicht!«
»Was soll das heißen?«, fragte Boccanegra lauernd und stemmte die Hände in die Seiten.
»Glaubt Ihr denn, ich wüsste nicht, dass hin und wieder auch Christen unter Euren Sklaven sind?«, rief Doria abgehackt, einzelne Worte unterbrochen durch kurzatmiges Schnaufen. »Besonders wenn es sich um schöne junge Frauen handelt, nehmt Ihr es nicht so genau, trotz Eures frommen Gehabes!«
»Pah«, stieß Boccanegra abfällig aus und verbarg seine Beunruhigung. Wenn Doria sein Wissen an der richtigen Stelle einsetzte, konnte es ihn seine Position als Kopf seines Handelshauses kosten. »Mir ist es ein Rätsel, wer Euch solchen Unsinn erzählt. Wenn es aber stimmt, hätten mir die jüdischen Händler die Ware untergeschoben, ohne dass ich davon wusste!«
»Lügen fällt Euch nie schwer, nicht wahr?«, stellte Doria mit Genugtuung fest. »Boccanegra, der Mann mit der gespaltenen Zunge, der Listige, der von Ehrgeiz Zerfressene. Und was ist nun der wahre Grund dafür, dass Ihr mich unbedingt aus der Stadt haben wollt? Möchtet Ihr selbst ins Diamantengeschäft einsteigen?«
In Boccanegra wuchs grenzenlose Wut über die Dreistigkeit dieses Mannes. Während er verstohlen nach seinem dreiseitigen Dolch tastete, wurde vorsichtig an seinem Gewand gezupft. Er wandte sich um.
»Man sollte Meister Doria vielleicht darauf aufmerksam machen, dass der tatarische Krankheitsgeist sich bevorzugt an gut Ernährten labt«, flüsterte Niccolò in Boccanegras Ohr. »Meister Doria würde sich dann möglicherweise ohne weiteren Widerspruch fügen und uns keine Zeit kosten.«
»Beim heiligen Syrus, Märtyrer von Genua!«, schnauzte Boccanegra ihn ungehalten an. »Bist du noch nicht fort?«
»Ich laufe schon, ich renne«, rief der sechzehnjährige Gehilfe, verbeugte sich hastig und schoss davon.