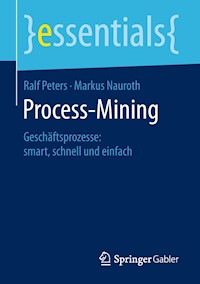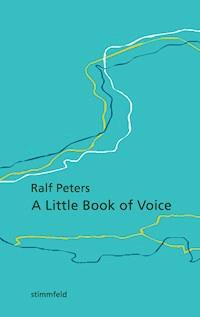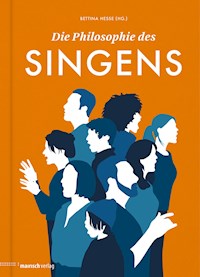
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mairisch Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Die Philosophie des Sports
- Sprache: Deutsch
Die Stimme ist unser ureigenes Instrument, und wir haben sie jederzeit bei uns. Sie steht im Zentrum einer Philosophie des Singens, wenn wir uns fragen: Was ist Singen überhaupt? Ist es künstlerischer Ausdruck, Spiegel der Seele oder ein politischer Akt? Was bedeuten cantabile, parlando oder die ganze Stimme, und was können wir für sie tun? Wie singen Tiere? Reicht der Gesang auch bis in die Stille? Welche Rolle spielt er in Nietzsches Philosophie? Und ist es ein Unterschied, gemeinsam im Kneipen- oder Kirchenchor zu singen oder alleine unter der Dusche? 21 Autor*innen schreiben über philosophische, poetische und praktische Aspekte einer Kulturtechnik, die immer auch Teil unseres ganz natürlichen Ausdrucks ist. Seit dem Orpheus-Mythos hat das Singen die Philosophie und Literatur geprägt – und tut es noch heute. Herausgeberin und Autorin Bettina Hesse singt seit vielen Jahren. Und auch alle Autor*innen, die in diesem Band zu Wort kommen, haben Spaß am Singen, als Philosoph*innen und Literat*innen, als Chorleiter*innen und Sänger*innen, mit Stimmperformance und Weltmusik, auf der Bühne, in der Natur, in der Liturgie oder Musiktherapie, selbst im Duett mit Bienen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
Und überall können wir singen. Von Marie T. Martin
Vorwort. Singen nach Orpheus. Von Bettina Hesse
Die Suche nach einer Philosophie des Singens. Von Ralf Peters
Atmen muss ich sowieso. Von Lisa Pottstock
Erste Schreie, letzte Gesänge. Über das Wesen der Stimme im Lebenslauf. Von Alexandra Naumann
Die Stimme erheben, leben. Von Maximilian Probst
Schreiben und Lesen als Singen. Von Angela Steidele
Sprechend singen - Ein philosophisches Parlando. Von Volkmar Mühleis
Mädchen, die Birken bewachen - Weisse Gesänge aus der Ukraine. Von Mariana Sadovska
Der Daimon des Flamenco - Die Quelle, die Monteverdi suchte. Von Ernesto Pérez Zúñiga. Aus dem Spanischen von Maite Serrano,
Mit Bienen singen. Von Jeanette Zippel
Gesang und Freiheit. Von Bettina Wenzel
Vokale Improvisationen. Musiktherapeutische Methode und künstlerischer Ausdruck. Von Konrad Heiland
Cantabile - Was macht Stimme zu Gesang? Von Julia Hagemann
Der singende Holunder - Betrachtungen zum Kneipensingen. Von Ute Almoneit
Major Tom to Ground Control. Eine Space-Pop-Odysee. Von Nika Bertram
All things are connected - Vom Glück, im Chor zu singen. Von Maria Gorius
Chorsingen und Verbundenheit. Von Simone Rummel
Das Wort Gottes verkosten - Singen in der christlichen Liturgie. Von Josef-Anton Willa
Das Schweigen der Sirenen. Hören - Singen - Stille. Von Bettina Hesse
Kaum dass er noch Atem findet für seinen Gesang. Monolg der Eurydike. Von Monika Buschey
Singen und Stille – Wenn die Seele singt. Von Markus Stockhausen
Aus der gleichen Reihe
Impressum
Und überall können wir singen.
Von Marie T. Martin
Und überall können wir singenim Hinterhof an der Kasse des Supermarktsin der Küche nachts wenn die Nachbarindie Stirn auf die Tischplatte legt und die Schaufensterleuchten überall können wir den Mund öffnenund das Licht schlucken das gerade eben nochda war zwischen deinen Fingern überall könnenwir drei Schritte gehen im Takt über die Betonplattendes Gehwegs den Spielplatz auf dem die Kinderzwischen Himmel und Hölle stehen überallkönnen wir singen am Briefkasten der voller Sandist am Parkplatz der Haltestelle und der Bus fährtzu den Gärten die Hände in den Taschen die Händeauf den Händen die Taschen voll Federn und Laub
VORWORT - SINGEN NACH ORPHEUS
Von Bettina Hesse
Was ist Singen? Was für eine Frage, wo wir doch unser ureigenes Instrument immer dabeihaben und täglich benutzen: die Stimme. Mindestens zwölf Mal atmen wir in der Minute, und mit jedem Atemzug könnten wir einen Ton hervorbringen und singen. Jederzeit. Überall. Singen ist unmittelbar, gratis und grenzenlos.
Doch wir wollen herausfinden, was es bedeutet, zu singen. Ist es künstlerischer Ausdruck, Spiegel der Seele oder ein Trostmittel? Oder ist es als politischer Akt zu verstehen, als Königsweg zum Selbst? Und wie lässt sich von den ersten Schreien bis zu den letzten Gesängen erzählen? Als körperliche Aktion gehört Singen zu den natürlichen Lebensäußerungen. Dabei gehen Singende nicht nur in Resonanz mit sich selbst und schaffen einen Klangraum, der zum ästhetischen Raum wird, sie gehen auch in Resonanz mit einer symbolischen Ordnung.
Die Philosophie des Singens fragt nach der Bedeutung dieser alten Kulturtechnik, und sogleich öffnet sich ein Feld von überraschender Vielstimmigkeit. Die 21 Autorinnen und Autoren befassen sich in diesem Band mit philosophischen und praktischen Aspekten des Singens und erzählen von dessen mythologischen und poetischen Voraussetzungen. Sie zeigen, was unter cantabile oder parlando zu verstehen ist und warum wir versuchen sollten, die ganze Stimme zu nutzen und erklingen zu lassen. Und sie erzählen vom eigenen Singen, denn damit haben sie alle Erfahrung.
Möglicherweise ist Gesang eine Metapher. Sie verweist auf den Ursprungsmythos, nach dem Orpheus als Vater des Gesangs gilt. Seine Geschichte geht so: Der große Sänger erhält von den Göttern die Erlaubnis, in die Unterwelt zu steigen, um Eurydike, seine geliebte Gattin, aus dem Hades wieder ins Leben zu holen. Unter der Bedingung, sich nicht nach ihr umzudrehen. Während sie an den dunklen Seelen vorbeigehen, wirft er den verbotenen Blick zurück und verliert Eurydike endgültig. Aber sein Gesang lebt fort und berührt die Menschen, selbst nach seinem Tod.
Mit seiner Rettungsaktion steht Orpheus exemplarisch für die Überschreitung der Grenze zwischen Leben und Tod – ein Erlösungsmotiv. Orpheus rettet die Geliebte nicht, aber den Gesang, und trägt mit dieser ersten Kulturleistung dazu bei, dass Gesang als eine Urform von Kunst angesehen wird.
Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg schrieb Gottfried Benn das Gedicht Orpheus’ Tod mit den Schlusszeilen: »… nun schon die Wimper naß / der Gaumen blutet / und nun die Leier / hinab den Fluß – / die Ufer tönen –.« Es ist Orpheus’ Gesang, der selbst den Tod des Sängers überdauert – er wird von den Mänaden in Stücke gerissen – während sein Kopf singt und sinkt und nur die Stimme nicht, die auf diese Weise unsterblich wird. Singen bekommt archetypischen Charakter.
Seit der Antike, in der Dichtung und Gesang als ein und dieselbe Kunst galt, spielt Gesang eine wesentliche Rolle in der Literatur. Die Verbindung von Sprache und Klang führt in eine tönende Welt und mit poetischer Notwendigkeit zu einem ganzheitlichen künstlerischen Denken. Die Romantiker wie Hölderlin, der sich den Gesang als endlosen wünscht, oder Karoline von Günderrode – sie lässt in ihrem Gedicht Die Töne melodisch aus der Stille dringen –, empfinden die anthropologische Bedeutsamkeit des Singens, bis hin zu Eichendorff, neben Goethe und Heine der meistvertonte deutsche Dichter, mit seinem berühmten Gedicht Wünschelrute: … Schläft ein Lied in allen Dingen. Und Rilke erhebt nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs den Gesang zum philosophischen Prinzip: Die Sonette an Orpheus betonen das orphische Prinzip als Erfahrung des Dunkels und die metaphysische Kraft des Singens, die das Leben durchdringt: Gesang ist Dasein.
Eine genuine Philosophie des Singens gibt es nicht. Doch die Beiträge in diesem Band gehen den unterschiedlichsten Denkpositionen nach. Mit seiner Suche nach einer Philosophie des Singens zeigt Ralf Peters im Eingangstext auf, warum das Singen seit Platon philosophisch kaum wahrgenommen wurde und erst in Nietzsches und Rilkes Denken größere Bedeutung erlangt. Als singender Philosoph steht er dafür ein, dass Gesang nur dann in einem umfassenden Sinn verstanden werden kann, wenn er auch praktiziert wird. Das umfassende Verständnis von Singen geht auf den anthropologischen Ansatz von Alfred Wolfsohn und seinem Schüler Roy Hart zurück, mit dem sie die Idee einer Stimmentwicklung zur ganzen Stimme begründeten. Ralf Peters, selbst Roy-Hart-Lehrer, und einige der Autorinnen fühlen sich dieser Stimmarbeit verbunden und lassen es in ihren Texten anklingen.
In der Praxis bedeutet Singen, die Stimme zu benutzen. Sie befindet sich an der Schnittstelle von Körper und Sprache und ist einerseits Organ, aber andererseits so flüchtig wie der Luftstrom, auf dem der gesungene Ton reist. Jedes Lied braucht einen Körper, und jeder Körper sollte in seinem künstlerischen Tätigsein anerkannt werden, wie Lisa Pottstock in ihrem Beitrag betont und damit die politische Dimension des Gesangs in den Blick nimmt. Über das Wesen der Stimme im Verlauf unseres Lebens schreibt Alexandra Naumann, und Maximilian Probst zeigt musikalisch die Doppeldeutigkeit von Stimme erheben innerhalb fragiler demokratischer Prozesse. Dass Literatur einst gesungen vorgetragen wurde und was das Singen für das eigene Schreiben bedeutet, erläutert Angela Steidele. Ein veritables philosophisches Parlando führt uns Volkmar Mühleis vor, während Mariana Sadovska von den weißen Gesängen ihrer Heimat Ukraine erzählt und Ernesto Pérez Zúñiga vom Daimon im Flamenco. Ja, sogar die Tiere singen. Walgesänge sind allgemein bekannt, die Minne der Fledermäuse weniger, aber warum Bienen einen faszinierenden Wechselgesang anstimmen, davon berichtet Jeanette Zippel. In vielen Beiträgen sind die eigenen Erfahrungen in der Praxis des Singens tonangebend: Sie reichen vom Singen als Gratwanderung auf dem Weg zur Freiheit, der musiktherapeutischen Arbeit bis zum gelungenen Songschreiben und Chorleiten. Vier Stimmen erzählen vom Chorgesang und wann er glücklich macht, ob in der Kneipe, im Pop-Chor oder beim Erleben der Klangqualität im resonierenden Raum.
In der religiösen und spirituellen Praxis nimmt der gemeinsame Gesang von jeher einen festen Platz ein, wie es hier im liturgischen Kontext von Josef-Anton Willa beschrieben wird. Das Singen hat in dem Zusammenhang nicht den performativen Charakter einer Aufführung, es bleibt bei sich. So reicht der Gesang bis in die Stille.
Atmen, unsere erste, existenzielle Äußerung, liegt dem Singen zugrunde. Und die singende Bewegung verbindet im Singen innen mit außen und bringt zwei unterschiedliche Prinzipien in Einklang. Wie eng Hören, Singen und Stille miteinander verbunden sind, versuche ich in meinem Text Das Schweigen der Sirenen zu ergründen. Und Monika Buschey greift Orpheus’ Geschichte auf und gestaltet sie als Monolog der Eurydike.
Als Einstimmung galt das Gedicht Und überall können wir singen von Marie T. Martin, mit Singen und Stille lässt Markus Stockhausen den Reigen ausklingen.
Seit dem Orpheus-Mythos hat Singen die Literatur und Philosophie geprägt – und tut es noch heute. Welche erstaunlichen Klangfarben das Singen annehmen kann, davon erzählt dieser Band. Wir möchten Sie dazu ermuntern, dieser einfachen und wesentlichen Lebensäußerung mehr Raum zu schenken, denn jeder Stimmklang ist Gesang. Also, worauf warten Sie noch?
BETTINA HESSE
Bettina Hesse lebt als Autorin, Herausgeberin und Dozentin in Köln. Ihre Leidenschaft gilt der Literatur, doch das Singen ist seit dem Philosophiestudium Lebenselixier. Ihren ersten Gesangsunterricht nahm sie in Italien, wo sie elf Jahre gelebt hat. Heute tritt sie regelmäßig mit einem Jazzkammerchor, in Projektchören und ihrem Stimm-Ensemble auf. Während beim Singen der Akzent auf dem musikalischen Ausdruck liegt, sucht sie als Stimmperformerin – wie im Schreiben – nach der Verbindung von innen und außen, nach verborgenen Aspekten der eigenen Stimme. www.stimmfeld-verein.de
Bei allen, die zu diesem Buch beigetragen haben, möchte ich mich herzlich bedanken. Es war eine bereichernde Erfahrung. Jeder Stimmklang ist Gesang – in diesem Sinne: Vielen Dank für das schöne Konzert.
DIE SUCHE NACH EINER PHILOSOPHIE DES SINGENS
ODER: DER SINGENDE PHILOSOPH
Von Ralf Peters
»Es gehört zu den Eigenheiten nicht erst der hochgradigen Spezialisierung, sondern schon der in ihrem Selbstbewusstsein konsolidierten Wissenschaften, dass sie immer sehr viel sehr viel genauer zu wissen glauben, als es gewusst werden kann (...). Das interdisziplinäre Unternehmen muss hier notwendig zunächst enttäuschend wirken, indem es den Gegenstand in seiner wohldefinierten und bewährten Abgrenzung nicht akzeptiert.« Hans Blumenberg1
»Gesang ist Dasein.« R. M. Rilke
Singen und Stimme – philosophisch betrachtet. Persönliche Vorbemerkung
Als ich das Angebot bekam, für dieses Buch einen Text über die Philosophie des Singens beizusteuern, war meine erste Reaktion zurückhaltend. Mir wurde plötzlich klar, dass ich mich in allem Nachdenken zu diesem Thema bislang an dem Leitbegriff der Stimme orientiert habe und nicht an dem des Singens. Damit bin ich einer Konvention gefolgt, die sich praktisch durch die gesamte, mittlerweile umfangreiche Literatur zu diesem Bereich zieht. In den vergangenen Jahrzehnten wurde im kulturwissenschaftlichen und philosophischen Rahmen viel über die Stimme geschrieben, doch meines Wissens hat niemand den Versuch unternommen, das Singen zu einem philosophischen Grundbegriff zu machen. Ich habe mich ziemlich unreflektiert in diesen philosophischen Mainstream eingegliedert und das ist umso erstaunlicher, als in der Tradition, in der ich mich als Künstler, Lehrer und Denker verorte, fast durchgehend vom Singen die Rede ist und die Stimme gar nicht so sehr im Vordergrund steht. Schon bei Alfred Wolfsohn und Roy Hart, den Begründern der Idee der Stimmentwicklung, der ich mich verpflichtet fühle, wird das Singen in einem umfassenden Sinn verstanden, der eine philosophische Anschlussfähigkeit bietet.
Nachdem mir diese Zusammenhänge etwas deutlicher wurden, habe ich dankbar die Gelegenheit ergriffen und mich auf die Suche nach Material gemacht, das für den Entwurf einer Philosophie des Singens hilfreich sein könnte. Die Suche hat mich in verschiedene Richtungen geführt: zuerst in die Philosophiegeschichte, wo ich bei Platon nach den paradigmatischen Vorentscheidungen gesucht habe, die es dem Singen so schwer machen, philosophisch wahrgenommen zu werden.
Danach habe ich mich ansatzweise mit der zeitgenössischen Philosophie und Kulturwissenschaft, die sich mit der Stimme beschäftigt, befasst – mit der Aufmerksamkeit auf der französischen und der deutschsprachigen Debatte sowie auf einen angelsächsischen Philosophen, weil er mir hilft, eine erste Arbeitshypothese für die Suche nach der Philosophie des Singens zu formulieren. Schließlich habe ich einen Ausflug in die Idee des Singens bei Rilke unternommen und außerdem meine eigenen Überlegungen neu geordnet und formuliert.
Meine Absicht ist es, die Position des oder der Singenden mehr in den Vordergrund zu stellen, als dies bislang geschehen ist. Damit meine ich nicht nur, dass dem Singenden als Gegenstand der Überlegungen mehr Beachtung geschenkt werden könnte, sondern auch und besonders, dass der oder die Philosophierende sich als Singende(r) versteht. Das bringt die klassische Gefahr mit sich, dass die Philosophie durch Persönliches verunreinigt wird. Die Gefahr gehe ich sozusagen offenen Auges und Ohres ein.
Ich berufe mich dabei auf Stanley Cavell, der den Aspekt der eigenen Stimme in die Philosophie systematisch eingeführt hat.2 Nach seinem Ansatz besitzt jede Philosophie eine ihr eigentümliche Stimme, die nicht adäquat kopiert werden kann. Mit dieser Stimme ist mehr gemeint als ein bloßer Stil des Schreibens oder Denkens, den man im Gegensatz zur Stimme kopieren kann. So findet man etwa in den vielen Kopien des berühmten Adorno’schen Jargons zwar Reminiszenzen an dessen Stil, aber die Stimme Adornos, dass, was ihn wirklich ausmacht, bleibt seinen eigenen Schriften vorbehalten.
Cavell spricht in seinen Arbeiten allerdings von einer philosophischen Stimme im übertragenen Sinn, die nicht viel mit dem Stimmklang des sprechenden oder gar singenden Philosophen zu tun hat.
Von anthropologisch relevanten Themen wie dem Singen kann man meiner Vermutung nach nur auf eine Weise sprechen, die sich aus der streng theoretischen Position löst und die lebenspraktische miteinbezieht. Da kommt der singende Philosoph aus dem Titel um die Ecke.
Außerdem möchte ich behaupten, dass keine Philosophie ohne Entscheidungen auskommt, die sich nicht restlos philosophisch begründen lassen. Den Beleg für diese Behauptung muss ich schuldig bleiben, aber ich werde im Folgenden so offen wie möglich machen, welche Entscheidungen mit meinen eigenen Erfahrungen als Singender – und als im Hören auf gewisse Weise Geschulter – zu tun haben. Damit bewege ich mich gefährlich nah an der Grenze dessen, was man noch Philosophie zu nennen bereit ist, aber das Risiko muss eingegangen werden, um dem Gegenstand, dem Singen, und damit auch der menschlichen Stimme, so gerecht wie möglich zu werden. Der Philosoph und die Philosophin, die nicht singen, kennen nicht das ganze phänomenale Feld der Stimme.
Mich interessiert hier weniger, ob das Singen als vokale Aktion etwas darstellt, was sie nicht selbst ist, etwa eine musikalische oder sprachliche Gestalt, sondern vielmehr, dass und wie sie sich selbst präsentiert. Das Singen zeigt die Stimme in Bewegung – ein Pleonasmus, denn die Stimme ist per se in Bewegung. Die Stimme singt, sie ist als Ereignis immer Singen. Doch zugleich ist sie immer Stimme von jemandem, wenn sie singt. Daraus ergibt sich, dass sich die Stimme im Singen nicht nur als ein klangliches Ereignis präsentiert. Stimmklang ist mehr als ein akustisches Phänomen. Im Singen zeigen sich Sängerin und Sänger auch in ihrer jeweiligen aktualen Situation, und zwar nicht nur einem von außen Zuhörenden, sondern zugleich sich selbst.
Was Singen ist, weiß doch jede(r)!. Methodische Vorbemerkung
Wenn man einen ernsthaften Versuch starten will, über das Singen philosophisch Relevantes zu sagen, stößt man auf verschiedene Schwierigkeiten.
Die erste Schwierigkeit gehört zu den klassischen Problemen des Philosophierens. Man muss nämlich bis zu einem gewissen Grad schon wissen, worüber man redet, bevor man die philosophische Untersuchung beginnen kann. Doch das herauszufinden ist zugleich Teil der philosophischen Untersuchung. Damit befindet man sich in einem Zirkel, aus dem sich nicht ohne Weiteres ein Ausweg anbietet. Ausweglos wird der Zirkel aber nur dann, wenn man den Aspekt der Erfahrung außen vor lässt. Denn das Nachdenken über das Singen beginnt in meinem Fall ja nicht erst mit dem Schreiben dieses Textes, sondern hat bereits eine lange Geschichte, in der es zu ersten Einsichten und Vermutungen gekommen ist, die mehr als ein reines Vorverständnis mit sich bringen.
Damit kommen wir zur zweiten Schwierigkeit. In meiner Geschichte des Nachdenkens über das Singen habe ich nicht nur Einsichten und sogenannte Erkenntnisse gewonnen, sondern zu der Geschichte gehören auch Entscheidungen darüber, wie ich das Singen verstehen will. Ich hätte andere Wege einschlagen können und andere Untersuchungen haben andere Wege beschritten. Das Festlegen auf einen sogenannten Gegenstand des Singens, der in der philosophischen Meditation betrachtet werden soll, ist immer mit einer Entscheidung verbunden, die mitbestimmt, was am Ende als Erkenntnis des Nachdenkens gefunden wird. Wenn die Entscheidung anders ausgefallen wäre, was immer möglich ist, dann wären am Ende andere Ergebnisse zustande gekommen. Damit ist die Geltung dessen, was hier von mir geschrieben und formuliert wird, rückgebunden an die Entscheidungen, die ich gefällt habe, um den Gegenstand des Singens für mich zu fassen. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht gute Gründe für meine Thesen gäbe und ich nicht versuchen würde, stringent zu argumentieren.
Die Entscheidungen, die ich getroffen habe, haben ganz direkt mit meinem Leben und meinen Erfahrungen mit Stimme und Singen zu tun. Das führt zur dritten Schwierigkeit für eine Philosophie des Gesangs. Was Singen eigentlich und wesentlich ist, kann nicht durch die philosophische Überlegung alleine erkannt und verstanden werden. Denn Singen ist eine Praxis und die entscheidenden Erfahrungen müssen aktiv gemacht werden, indem man eben singt! Die Interpretation dessen, was man in der Aktion erfährt, wird zwar immer vom theoretischen Rahmen abhängen, innerhalb dessen man nach dem Verständnis für die Erfahrungen sucht, aber ohne die Erfahrungen selbst gemacht zu haben, hängen die Überlegungen zum Singen quasi im leeren Raum.
Meine vorläufige Bestimmung dessen, was ich Singen nennen und philosophisch erkunden möchte, lautet: Singen ist eine intendierte stimmliche Äußerung. Oder mit den Worten meines Stimmlehrers Paul Silber gesagt: Singen ist eine vokale Aktion.3
Das ist ein sehr weiter Begriff des Singens, der nicht nur die musikalischen Verlautbarungen der Stimme umfasst, sondern im umfassenden Umkehrschluss jede stimmliche Äußerung zu Gesang erklärt. Singen als vokale Aktion zu verstehen gibt dem Begriff des Singens den weitestmöglichen Spielraum, ohne dass er ganz beliebig wird. Jeder Stimmklang ist Gesang. Jede stimmliche Äußerung des Menschen kommt aus einem Feld von Intentionen und stellt daher immer mehr dar als ein bloß akustisches Ereignis. Die menschliche Stimme trägt immer Informationen und Dimensionen in sich, die es erlauben, ihren Klang auf verschiedenen Ebenen zu hören und zu verstehen.
Gegen den Wechsel von der Stimme zum Singen liegt der Einwand nahe, dass der Begriff der Stimme einen viel weiteren Bereich abdeckt als das Singen und deswegen der grundlegendere Ansatzpunkt ist. Dagegen würde ich behaupten, dass das Singen grundlegender ist, weil sich in diesem Begriff drei Aspekte verbinden, die nur zusammen so etwas wie die Bedingung der Möglichkeit einer vokalen Aktion eröffnen. Singen ereignet sich im Zusammenspiel von Atem, Gehör und Stimme. Auf keines dieser drei Elemente kann verzichtet werden und die Stimme muss sich hier in die grundlegende Dreiheit einreihen. Trotzdem ordnet sich der Phänomenbereich, der philosophisch behandelt werden soll, durch die Entscheidung, mit dem Singen zu beginnen, neu. Vom Singen aus betrachtet rückt die reale Stimme, die immer mit einem Menschen, der sie zeigt, in Verbindung steht, in das Zentrum des Interesses und die vielen anderen metaphorischen und transzendenten Stimmen, die trotz ihrer potenziell großen Wirkungen stumm bleiben und im stimmphilosophischen Diskurs großen Raum einnehmen, rutschen aus dem zentralen Fokus an den Rand. Womöglich zeigt sich am Ende, dass viele der Qualitäten und Funktionen, die den Stimmen im stummen und übertragenen Sinn zugeschrieben werden, ihren Ursprung eigentlich im echten Stimmklang, also ganz nah am Menschen haben.
Mit meiner vorläufigen Definition des Singens als vokaler Aktion oder Praxis, die ich als einen Startpunkt für meine Überlegungen wähle, stelle ich mich also willentlich ins Abseits zum zeitgenössischen Diskurs über die Stimme, wie er seit Mitte des 20. Jahrhunderts besonders in Frankreich und seit einigen Jahrzehnten auch in Deutschland geführt wird. Darin steht am Anfang fast aller Ansätze, die dazu geliefert wurden, der Hinweis, dass es bei einer Philosophie der Stimme nicht nur um die Stimme, die sich als hörbar äußert, gehen kann, sondern die Suche nach der dahinter liegenden stummen, aber gleichwohl sehr wirksamen Stimme in ihrer transzendenten Qualität sich dazugesellen muss. Man könnte hier lange darüber spekulieren, warum Philosophen so gerne von der im Grunde stumm bleibenden mächtigen Stimme sprechen. In jedem Fall liegt diesem ganzen Diskurs eine Entscheidung zugrunde, die man mit einigem Recht metaphysisch nennen kann. Diese Entscheidung mache ich hier nicht mit und beharre darauf, vom Singen auszugehen und die Stimme bei aller Flüchtigkeit, die ihr eigen ist, als hörbare ins Zentrum zu stellen. Hier liegt der Einwand gegen mich nahe, dass ich einem überkommenen Subjektbegriff auf den Leim gehe, indem ich von einem souveränen Verhältnis eines Stimme habenden Subjektes und seiner identifizierbaren Stimme ausgehe und man könnte mir entgegenhalten, dass man weder dieses eine Subjekt noch die eine Stimme ohne Not voraussetzen kann. Mit Letzterem bin ich ganz einverstanden, aber über die Frage, wer stimmlich handelt und ob und wie die Stimme als eine Einheit, die zu einem Subjekt gehört, gefasst werden kann, habe ich noch gar nichts sagen wollen und können. Zu meinen Arbeitsthesen gehört die starke Vermutung, dass das Singen über die Körperlichkeit und Leiblichkeit des singenden Menschen verortet werden kann. Es gibt also wenigstens eine topologische Identität oder Identifizierungsmöglichkeit von laut werdender Stimme und dem Menschen, der gerade diese Stimme erhebt. Nur so ist Singen möglich.
Singen ist gefährlich oder Platon und der Generalverdacht gegen das Singen
Die erste Expedition führt mich in die antike Gründerzeit, als die Entscheidungen darüber gefallen sind, wie Singen und Gesang philosophisch verortet werden können und was darüber gesagt werden kann. Anders ausgedrückt kann man dort erfahren, welche Weichenstellungen verhindert haben, dass sich eine Philosophie des Gesangs entwickeln konnte. Der maßgebliche Weichensteller ist hierbei Platon, der den ersten großen und umfassenden Rahmen geliefert hat, an dem sich seitdem das philosophische Denken in Europa orientiert.4
Für Platon ist die Stimme in Bezug auf das Sprechen nicht mehr und nichts anderes als ein dienendes Werkzeug bzw. das Transportmittel, mit dem in Worte gefasste Gedanken geäußert werden. Sie dient einzig dazu, die Gedanken in eine Form zu bringen, die es ermöglicht, ihren Inhalt zu kommunizieren. Für seine philosophische Untersuchung von Denken und Sprache spielt die Stimme keine weitere Rolle. Erst Jean-Jacques Rousseau hat geahnt, dass Sprache und Sprechen der Stimme viel mehr verdanken, als Platon und die auf ihn folgende Tradition ihr zugestehen.5 Doch die Idee des instrumentalen und funktionalen Charakters der Stimme für das Sprechen ist bis heute im Denken präsent, etwa im instrumental ausgerichteten Zweig der Medientheorie.
Die Stimme als ein Werkzeug zu betrachten, mit dessen Hilfe Gedanken als Worte und Sätze ausgesprochen werden, ist nicht falsch.6 Falsch ist es, die Stimme auf diesen einen Aspekt zu reduzieren und zu behaupten, sie damit ganz erfasst zu haben. Platons Vorgaben haben dazu geführt, eine philosophische Betrachtung von Stimme und dann auch des Singens und ihrer Relevanz für die Frage »Was ist der Mensch?« zu behindern statt sie anzuregen. Noch die auf Saussure aufbauende moderne Linguistik steht mit ihrem Zweig der Phonologie in der platonischen Tradition.7
Im Gegensatz zu der relativ eindeutigen Zuordnung der Stimme für das Sprechen erweist sich Platons Einschätzung von Singen und Gesang ambivalenter. Einerseits ist er darum bemüht, den Gesang auf seine Funktion für Wahrheit und Sittlichkeit festzunageln. »Der Wohlerzogene wird also schön tanzen und singen können«, heißt es an einer Stelle.8 Der Gesang, der nur gefallen will, wird von ihm als bloße Schmeichelei beurteilt.9 Doch manchmal zweifelt Platon daran, dass der Gesang seine große ethische Funktion erfüllen kann. In jedem Fall muss das Singen dafür genauestens und streng reguliert werden. Platon legt fest, welchen Bewohnern der Polis welche Gesänge erlaubt sind. Wer welche Tonarten singen darf, wird von ihm en détail bestimmt. Männer verschiedenen Alters singen Verschiedenes (immer aber auf Tapferkeit Hinweisendes und Erhabenes), Frauen wieder anderes (nämlich Sittsames und Bescheidenes) und auch Sklaven haben die ihnen zugeordneten Gesänge. »..… eine Abweichung von den staatlich festgesetzten heiligen Gesängen und von der gesamten Tanzweise unserer Jugend soll sich in Sangesweise und Tanzbewegung niemand erlauben.«10 Zugleich scheint Platon aber durchaus bewusst, wie sehr er sich mit einer solchen Reglementierung des Gesangs und des Tanzes lächerlich machen kann. Er fragt sich deshalb, wie er diese Art der »Gesetzgebung gegen den allgemeinen Spott sicherstellen«11 könnte.
Platon konzediert, dass Gesang viel mehr kann und viel mehr ist als bloß ein Mittel zur Erziehung zum guten Menschen, der der Wahrheit verpflichtet ist. Er will nicht bestreiten, sogar selbst manchmal vom Gesang angerührt zu werden.12 Im Gespräch mit einem Rhapsoden, einem in diesem Falle ganz auf Homer spezialisierten Sänger, sagt er, dass er die Rhapsoden oft um ihre Kunst beneidet.13 Doch das Anrührende des Gesanges scheint ihm in erster Linie unheimlich zu sein, und er stellt das Singen unter den Generalverdacht, die Sittlichkeit des Menschen zu gefährden.14 Platon sah deutlich das Verführungspotenzial des Singens. Der Gesang berührt Menschen tief und versetzt sie in Stimmungen, gegen die man sich, so lange man dem Sänger oder der Sängerin zuhört, nicht leicht wehren kann. Platon hat diese Kraft des Gesangs weitgehend negativ bewertet. Sein Verständnis des Singens ist moralisch geprägt und das hält ihn davon ab, den gesamten Phänomenbereich des Gesangs in all seiner Vielfalt und Bezogenheit auf das Dasein des Menschen philosophisch anzuerkennen, zu untersuchen oder zu würdigen.
Erst Nietzsche deckt die untergründige Moralisierung der europäischen Philosophie auf, die, grob formuliert, dazu führte, dass die Gegenstände des Denkens nicht als sie selbst thematisch wurden, sondern im verzerrenden Lichte der jeweiligen Moral aufschienen.15
In Bezug auf den Gesang sieht Platon die Aufgabe von »Stimme und Gehör« darin, dem Menschen die Erkenntnis von Harmonie, und zwar nicht nur im musikalischen, sondern im kosmologischen Sinn zu ermöglichen. Diese Aufgabe teilen sich Stimme und Gehör mit dem Sehsinn und im Prinzip mit allen Sinnen. Nur die Erkenntnis der Harmonie der größeren Weltzusammenhänge erlaubt es dem Menschen, seinen eigenen, potenziell oder faktisch disharmonischen Zustand zu konstatieren und sich um innere Harmonie zu bemühen.
An Platons Behauptung, dass Gesang zur Harmonisierung der Seele beiträgt, kann ich mich in gewisser Hinsicht anschließen. Zumindest gehört die enge Wirkungsbeziehung von seelischen Prozessen und Singen zu den grundlegenden Thesen einer theoretischen Erfassung des Gesangs, wie ich sie im Anschluss an Alfred Wolfsohn im Sinn habe.
Einen positiven Wert bekommt der Gesang bei Platon dann, wenn das Singen mit einem Wissen davon vonstattengeht, was der Sänger da macht. Ganz gegen die alltägliche Intuition und Erfahrung, nach der man singen kann, ohne in allen Einzelheiten genau zu wissen, was da technisch oder sittlich passiert, will Platon auch in dieser Hinsicht Wissen und Tugend so eng wie möglich aneinanderbinden.
An einer Stelle im Dialog Laches lässt Platon den Gesprächspartner von Sokrates behaupten, dass der wahre Sänger eigentlich der Philosoph sei. Denn der Philosoph ist nicht darauf angewiesen, ein gut gestimmtes Instrument zur Verfügung zu haben, um die Harmonien im Zusammenspiel von Stimme, Dichtung und Musik hervorzurufen. Für den Philosophen steht vielmehr die Übereinstimmung von Haltung und Leben, von Gedanke und Tat im Vordergrund. »Und ein solcher scheint mir durchaus der wahre Tonkünstler zu sein, der zum schönsten Einklange nicht etwa eine Lyra gestimmt hat, überhaupt nicht Instrumente der Kurzweil, sondern in Wahrheit sein eigenes Leben harmonisch gestaltet hat, übereinstimmend in Wort und Werk.«16 Mit diesem Trick wird der schöne Gesang ganz von den Sangeskünsten entkoppelt und nur noch auf die Authentizität, wie wir heute sagen würden, projiziert – wobei es Platon nicht darum gehen würde, authentisch zu klingen, sondern authentisch zu sein. In jedem Fall gibt es hier offenbar ein paar interessante Anknüpfungspunkte zu einem heutigen Kunstverständnis, in dem die Lebensnähe manchmal mehr zählt als die Kunstfertigkeit von Musik und Gesang. Platon hat dabei im Sinn, den wirklichen Gesang in seinem sittlichen Wert abzutun. Seine Idee des singenden Philosophen, an der ich in diesem Text interessiert bin, ist weit entfernt von dem, was ich damit meine.
Platon lässt seinen realen Lehrer und literarischen Protagonisten Sokrates über Gesang immer nur entweder von der Metaebene des Philosophen oder aus der Position des Hörenden sprechen, aber nie als selbst Singender. Erst am Ende seines Lebens kommen Sokrates Zweifel, ob er seinen immer wiederkehrenden Traum, in dem er aufgefordert wird, »die musische Tätigkeit«17 zu üben und zu treiben, richtig verstanden hat, indem er glaubte, der Forderung schon mit seinem Philosophieren nachzukommen. Meinte der Traum nicht eher, dass der Philosoph weit genug ins Leben hätte eintauchen sollen, um selbst zu singen und zu tanzen?
Die Expedition zu Platon hat keine direkten Hinweise auf eine Philosophie des Singens zutage gefördert. Doch haben sich Hinweise und gedankliche Figuren gezeigt, von denen einige im zeitgenössischen Nachdenken über Stimme und Gesang auftauchen. An vorderster Stelle sind hier der funktionale und instrumentale Charakter der Stimme zu nennen, die sich nicht nur in der gesanglichen Praxis im Bild der Stimme als Instrument verankert haben, sondern auch bis in die zeitgenössische medientheoretische Debatte hineinreichen.
Singen: Medium, Performanz, Dasein
Ein beträchtlicher Teil der zeitgenössischen kulturtheoretischen Auseinandersetzung mit der menschlichen Stimme spielt sich in einem theoretischen Rahmen ab, der durch die Begriffe Medium und Performanz bzw. Performativität abgesteckt ist.18 Da ist viel Wichtiges gesagt worden. An einigen Stellen dieses Diskurses stößt man auf Zweifel daran, dass sich die medialen und performativen Paradigmen auf Singen und Stimme übertragen lassen.19 Besonders für den hochartifiziellen Gesang in der europäischen Operntradition ist fraglich, ob er sich angemessen medientheoretisch erfassen lässt, zumindest sofern man an einen instrumentellen Medienbegriff denkt. In der Oper hört die Stimme nach Susan McClary »auf, der Sprache als reines Transportmittel zu dienen, und führt stattdessen metaphorisch vor, wie sich ein von den Zwängen der Schwerkraft befreiter Körper empfinden würde«20. Denn wie auch der Kulturphilosoph K. Ludwig Pfeiffer hervorhebt, ist die Opernstimme gerade kein Mittel, das etwas anderes, Gefühle, musikalische Vorgaben oder sprachlich gefasste Geschichten transportiert, sondern in erster Linie eine Körper-Technik (im griechischen Sinne von techné als Kunstfertigkeit), die für sich steht und durch medial geformte Funktionszusammenhänge in ihrer Bedeutsamkeit und Kraft nur verwässert würde. Zwar zeigt sich die Opernstimme nur in der durch und durch medialen Ursituation der Bühne, aber dadurch wird das Singen noch nicht zu einem Phänomen, das sich medientheoretisch erschöpfend durchdringen ließe. »Auf die Operngesangsstimme passt (...) keine Theorie der Performanz, des Performativen oder auf der anderen Seite, der (Medien-)Technologien, obwohl natürlich gerade die Oper von allen möglichen Technologien nachgerade umzingelt ist.«21
Mit dem Begriff der Körper-Technik verbindet Pfeiffer einen für unsere Fragestellung hochinteressanten Gegenentwurf zum Begriff Medium, ohne sich ganz aus dem medientheoretischen Raum verabschieden zu wollen. »Einen anthropologischen Stellenwert gewinnt diese in jahrelanger Ausbildung und kontinuierlichem Training perfektionierte Technik (des Operngesanges R. P.), weil sie eine Kunstfertigkeit am Körper und im Medium (sic!) eines seiner zentralen Bestandteile, der Stimme, darstellt. Als einer der wenigen, beispielsweise neben dem Tanz verbliebenen Bereiche demonstriert sie die Unersetzbarkeit der ins Spiel kommenden Körperelemente und damit des Körpers gerade dadurch, dass sie diese nicht als Gegebenheit behandelt.«22 Sondern, so möchte ich hinzufügen, als in der regelmäßigen Praxis des Gesangs sich andauernd verändernde Bedingungen im lebendigen System namens Singen.
Trotz der Einschränkungen des medientheoretischen und performativen Ansatzes für den Gesang bleibt das Singen ein prototypisches Beispiel für einen performativen Akt. »Die Stimme ist ein performatives Phänomen par excellence«23, und das in fünf Hinsichten, die von Kolesch und Krämer aufgelistet und wert sind, genauer betrachtet zu werden.
Ganz oben auf der Liste steht die Ereignishaftigkeit des Singens. Es gibt keinen Gegenstand Stimme, der in irgendeiner Weise dauernd präsent wäre, sondern Stimmklang taucht auf und vergeht. Die Stimme zeigt sich singend in der Zeit als Ereignis. Kolesch/Krämer fügen an: »Die den Augenblick ihrer Entäußerung überschreitende Wirksamkeit der Stimme liegt alleine darin, dass die Stimme von anderen wahrgenommen und aufgenommen wird.«24 Das ist eine Einschränkung, die der singende Philosoph nicht mitmachen wird. Die Wirksamkeit der Stimme richtet sich nicht nur auf die anderen, die sie wahrnehmen, sondern auch und je nach Situation ganz besonders auf den oder die Singende selbst. Meine Stimme wirkt auf mich ein! Stimme hat nicht nur Aufführungscharakter – womit die zweite performative Charakterisierung der Autorinnen genannt ist. Zwar ist die stimmliche Verlautbarung oft eine Aufführung »von etwas für andere und vor anderen«, aber das ist keinesfalls immer so und zugleich ist selbst in der Aufführungssituation die Rückgebundenheit des Singens an die Person, die sich stimmlich zeigt, von Belang. Hinzu kommt, dass die stimmliche Verlautbarung mit anderen vollzogen werden kann. Singen ist eine Tätigkeit, die ich gemeinsam mit anderen vollziehen kann, ohne dass man noch klar zwischen Akteur und Rezipient unterscheiden könnte.
Als dritte performative Hinsicht wird der Verkörperungscharakter der Stimme genannt. »Die Stimme ist die Spur unseres individuellen wie auch sozialen Körpers. Sie ist gleichermaßen Index der Singularität wie der Kultur.« Das ist ein ganz entscheidender Aspekt für eine Philosophie des Singens.
Weiter besitzt die performative Stimme nach Kolesch/Krämer ein Subversions- und Transgressionspotenzial. Hinter dem vielleicht etwas großspurig daherkommenden Begriff verbirgt sich im Grunde die Erkenntnis, die schon Nietzsche notiert hat, als er davon sprach, dass Sprechen mehr ist als das, was man davon aufschreiben kann.25 »Die Stimme entzieht sich ihrer bruchlosen semiotischen, medialen oder instrumentellen Dienstbarkeit«, formulieren die beiden Autorinnen. Für eine Philosophie des Singens wäre dem hinzuzufügen, dass die regelmäßige Praxis mit der eigenen Stimme genau die genannten Aspekte der Dienstbarkeit in den Hintergrund rückt. Aus dem Grunde ist auch die Intersubjektivität als fünftes genanntes Charakteristikum der performativen Stimme für eine umfassende Erkundung des Singens zwar wichtig, aber isoliert betrachtet zu eng.
Zentral für die Erkundung des Singens sind die Beziehungen, die im Singen zwischen dem/der Singenden selbst und seiner/ihrer stimmlichen Aktivität entstehen und in beide Richtungen Wirkungen entfalten. Hier ist der erwähnte singende Philosoph gefragt, denn die Untersuchung dieses Aspekts des Singens ist zwingend auf Erfahrungen aus der Ich-Perspektive angewiesen.
Von dem Selbstverhältnis im Singen führt eine Linie zu dem zweiten Bereich, der in der zeitgenössischen Stimmphilosophie oft vergessen wird. Das Phänomen des gemeinsamen Singens (das ein gemeinsames Sprechen miteinschließt) wird von den üblichen philosophischen Herangehensweisen oft an den Rand gedrängt. Dabei spielt die gemeinsame vokale Aktion nicht nur in Musik und Theater und zumindest früher bei mehr oder weniger allen festlichen Anlässen eine große Rolle. In so gut wie jeder religiösen oder spirituellen Praxis hat der gemeinsame Gesang ebenfalls seinen Platz, sowohl in liturgischen Kontexten – in denen das Singen immer mehr ist als bloße performative Aufführung – als auch in den im weiteren Sinne meditativen Zusammenhängen.
Die Suche nach einem vielversprechenden Anknüpfungspunkt für eine philosophische Behandlung dieser weitgehend vernachlässigten Bereiche des Singens verleitet mich zu einem Ausflug aus der Philosophie hinaus in die Poesie, genauer zu Rilke und dessen Überlegungen zum Gesang, wie man sie u. a. in den Sonetten an Orpheus lesen kann:
»Gesang, wie du ihn lehrst, ist nicht Begehr,
nicht Werbung um ein endlich noch Erreichtes;
Gesang ist Dasein.«
Rilke hebt in dem Sonett hervor, dass Singen nicht immer und nicht notwendig in Begehrensstrukturen eingebettet ist. Ich muss nichts wollen mit meiner vokalen Aktion. Der wahre Gesang ist für ihn gerade frei von Begehren jeder Art und frei vom Eros des Verliebtseins. Darüber hinaus ist Gesang für ihn kein Mittel für einen anderen Zweck, d. h. Singen soll nicht instrumentell verstanden werden. Sondern? Gesang ist dasjenige, das sich ereignet, wenn ein Mensch unbelastet von allen Absichten und Wünschen bei sich ist und durch dieses Beisichsein einen offenen Zugang zur Welt findet. Das ist zwar ein ziemlich utopischer Entwurf (»ein Gott vermags!«), doch zugleich ist für Rilke diese Idee des Gesangs in jedem faktischen Singen schon präsent. »Ein für alle Male ists Orpheus, wenn es singt«, sagt er in einem anderen Sonett. So gewendet ist das Singen immer schon bei sich. Ob es in dieser Weise gehört werden kann, ist die andere Frage. Viele Singende und viele gesangsbegeisterte Hörende werden sich an Momente erinnern, bei denen dieses Beisichsein des Singens sich ereignet hat. Solche Momente sind im wahrsten Sinn ergreifend.
In der Beschäftigung mit dem Singen zeigt sich auch im Anschluss an Rilke eine Struktur, die trotz aller modernen Entfremdungstendenzen existenzielle anthropologische Grunderfahrungen noch immer möglich macht. Die Stimme ist einerseits ein relativ einfach strukturiertes Phänomen, das aber zugleich die ganze Welt – als meine Welt – in sich trägt. Die Erkundung der Klangräume meiner Stimme ist deshalb die Erkundung meiner Welt. Das zeigt sich auch in der praktischen Arbeit der Stimmentwicklung. Dort stoßen wir immer wieder an die persönlich und kulturell existenziellen Fragen, ohne uns durch das Dickicht der Welt, das uns potenziell überfordert, winden zu müssen. Orpheus ist für diesen Prozess der richtige Symbolträger, weil ihm Stimme (und Sprache) zum Weg wurde, durch die Sphären der Lebenden und der Toten zu gelangen.
Der orphische Gesang bringt nach Rilke zwei entscheidende Qualitäten mit sich. Er ordnet die Elemente der Welt nach musikalischen Strukturen, denen sich alles Weltliche anpasst. Mythologisch betrachtet besteht darin die erste Kulturleistung des Menschen, der sich aus dem Wilden, Naturnahen und Ekstatischen in die Formgebung bewegt. Zugleich steht Orpheus für die Überschreitung. Er überschreitet mit seinem Gesang die Grenze zwischen Leben und Tod, zwischen Welt und Unterwelt. Ordnung (als Formgebung) und Überschreitung. So betrachtet wird das Singen zum Urphänomen26 der menschlichen Kunst. Die einzige Überschreitung, die Rilke seinem Orpheus nicht zugesteht, ist die hin zum Dionysischen, also gewissermaßen zurück ins Wilde. Hier bleiben die Sonette an Orpheus dem Antagonismus zwischen dem wohlgeformten apollinischen Gesang Orpheus’ und den orgiastischen Ritualen im Namen von Dionysos treu. Der Stimmlehrer Wolfsohn hat seinen revolutionären Ansatz der ganzen Stimme mit dem Namen Orpheus verbunden.27