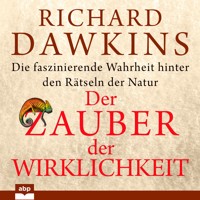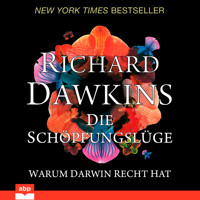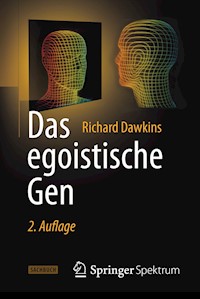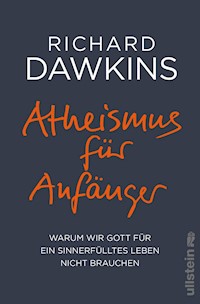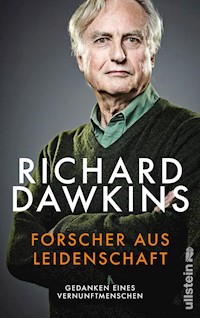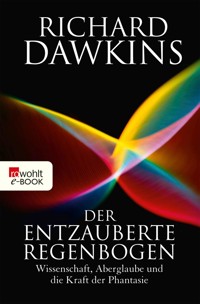29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Richard Dawkins erzählt die Geschichte seines Lebens — von der Kindheit im kolonialen Afrika über sein Studium in Oxford bis zur Karriere als einer der einflussreichsten Wissenschaftler weltweit. Er berichtet von seiner Ankunft im Flower-Power-Kalifornien der 60er Jahre, von der Party zum 42. Geburtstag seines Freundes Douglas Adams, den freundschaftlichen Streitgesprächen mit dem Erzbischof von Canterbury, von bahnbrechenden Erkenntnissen in der Evolutionsbiologie und seiner großen Liebe zur Lyrik. Richard Dawkins ist nicht nur ein herausragender Naturwissenschaftler, er ist auch ein begnadeter Erzähler. Anhand seines weitverzweigten Familienstammbaums erklärt er die Vererbungslehre, und die Entwicklung der Theorie des egoistischen Gens wird bei ihm zum Wissenschaftsthriller. Wenn er beschreibt, wie er vom Gläubigen zum Atheisten wurde, versteht man, welche Rolle Religion für den Menschen spielt. Großer Erkenntnisgewinn wird
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Richard Dawkins erzählt die Geschichte seines Lebens — von der Kindheit im kolonialen Afrika über sein Studium in Oxford bis zur Karriere als einer der einflussreichsten Wissenschaftler weltweit. Er berichtet von seiner Ankunft im Flower-Power-Kalifornien der 60er Jahre, von der Party zum 42. Geburtstag seines Freundes Douglas Adams, den freundschaftlichen Streitgesprächen mit dem Erzbischof von Canterbury, von bahnbrechenden Erkenntnissen in der Evolutionsbiologie und seiner großen Liebe zur Lyrik. Richard Dawkins ist nicht nur ein herausragender Naturwissenschaftler, er ist auch ein begnadeter Erzähler. Anhand seines weitverzweigten Familienstammbaums erklärt er die Vererbungslehre, und die Entwicklung der Theorie des egoistischen Gens wird bei ihm zum Wissenschaftsthriller. Wenn er beschreibt, wie er vom Gläubigen zum Atheisten wurde, versteht man, welche Rolle Religion für den Menschen spielt. Großer Erkenntnisgewinn wird.
Der Autor
Richard Dawkins, 1941 geboren, ist Evolutionsbiologe. Von 1995 bis 2008 hatte er den Lehrstuhl für Public Understanding of Science an der Universität Oxford inne. Sein Buch Das egoistische Gen gilt als zentrales Werk der Evolutionsbiologie. Seine Streitschrift Der Gotteswahn ist ein Bestseller.
Richard Dawkins
Die Poesie der Naturwissenschaften
Autobiographie
Aus dem Englischen von Sebastian Vogel
Ullstein
Die Originalausgaben erschienen 2013 und 2016 unter dem Titel An Appetite for Wonder bzw. Brief Candle in the Dark bei Transworld Publishers, London.
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweise zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1315-3
© 2015 © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Lektorat: Palma Müller-Scherf Umschlaggestaltung: Sabine Wimmer, Berlin Fotos: getty images / Kontributor: Robert Wilson
E-Book: L42 Media Solutions Ltd., Berlin
Editorische Notiz
Die Autobiographie von Richard Dawkins besteht aus zwei Teilen, Staunende Neugier (An Appetite for Wonder) und Eine Kerze im Dunkeln (Brief Candle in the Dark). Beide Bände sind im englischen Original separat erschienen. Der Ullstein Verlag hat sich entschieden, beide Bücher ungekürzt in einem Band unter dem Titel Poesie der Naturwissenschaften zu veröffentlichen, um ein umfassendes Bild vom Wissenschaftler und Menschen Richard Dawkins zu vermitteln.
DIE POESIE DER NATURWISSENSCHAFTEN
BAND I Staunende Neugier
1 Gene und Tropenhelme
»Schön, Sie kennenzulernen, Clint.« Der freundliche Beamte an der Passkontrolle war offenbar nicht darüber im Bilde, dass manche Menschen in Großbritannien einen Familiennamen erhalten, und erst dann folgt der Name, den sie nach dem Willen der Eltern benutzen sollen. Ich hieß immer Richard, wie mein Vater immer John war. Unseren ersten Namen Clinton hatten wir so gut wie vergessen, und das war auch die Absicht unserer Eltern gewesen. Für mich war er nie mehr gewesen als eine lästige Belanglosigkeit, auf die ich mit Vergnügen verzichtet hätte (und das trotz der Zufallserkenntnis, dass ich damit die gleichen Initialen hatte wie Charles Robert Darwin). Aber leider hatte niemand mit dem Heimatschutzministerium der Vereinigten Staaten gerechnet. Dort hatte man sich nicht damit zufriedengegeben, unsere Schuhe zu durchleuchten und unsere Zahnpasta zu rationieren, sondern auch die Vorschrift erlassen, dass jeder unter seinem ersten Namen in das Land einreisen musste, und zwar genau so, wie er im Pass steht. Also musste ich meine lebenslange Identität als Richard aufgeben und mich in Clinton R. Dawkins umbenennen, wenn ich in die Vereinigten Staaten reisen wollte – und natürlich auch, wenn ich jene wichtigen Formulare ausfüllte, in denen man ausdrücklich erklärt, man habe nicht die Absicht, nach der Einreise in die USA die Verfassung mit Waffengewalt zu stürzen (»einziger Zweck des Besuchs«, schrieb der britische Radiomoderator Gilbert Harding auf diese Frage; heute würde ihn solcher Leichtsinn teuer zu stehen kommen).
Clinton Richard Dawkins – so lautet also der Name in meiner Geburtsurkunde und meinem Reisepass, und mein Vater hieß Clinton John. Wie es der Zufall will, war er nicht der einzige C. Dawkins, dessen Name in der Times als Vater eines Jungen genannt wurde, der im März 1941 im Eskotene Nursing Home in Nairobi zur Welt gekommen war. Der andere war Reverend Cuthbert Dawkins, ein anglikanischer Missionar und nicht mit uns verwandt. Meine verblüffte Mutter wurde mit Glückwünschen von Bischöfen und Geistlichen aus England überhäuft, die ihr völlig unbekannt waren, aber ihrem gerade geborenen Sohn freundlichst Gottes Segen wünschten. Ob die fehlgeleiteten Segnungen, die eigentlich für Cuthberts Sohn bestimmt waren, auf mich einen positiven Effekt hatten, wissen wir nicht, er wurde jedoch Missionar wie sein Vater und ich wurde Biologe wie meiner. Bis heute sagt meine Mutter im Scherz, ich sei vielleicht der Falsche. Ich selbst dagegen kann voller Freude erklären: Nicht nur die äußerliche Ähnlichkeit mit meinem Vater (siehe die erste Seite des Bildteils) gibt mir die Gewissheit, dass ich kein Wechselbalg bin und nie für die Kirche bestimmt war.
Clinton wurde erstmals zu einem Namen der Familie Dawkins, als mein Urururgroßvater Henry Dawkins (1765–1852) Augusta heiratete, die Tochter des Generals Sir Henry Clinton (1738–1795), der von 1778 bis 1782 Oberbefehlshaber der britischen Streitkräfte war und demnach eine Mitverantwortung dafür trug, dass der amerikanische Unabhängigkeitskrieg verlorenging. Die Umstände der Eheschließung lassen die Tatsache, dass die Familie Dawkins sich diesen Namen zulegte, ein wenig dreist erscheinen. Das folgende Zitat stammt aus einer historischen Darstellung der Great Portland Street, in der General Clinton wohnte.
Im Jahre 1788 brannte seine Tochter in dieser Straße in einer Mietdroschke zusammen mit Mr Dawkins durch, welcher sich der Verfolgung entzog, indem er ein halbes Dutzend andere Mietdroschken an den Ecken der Straße postierte, die zum Portland Place führt. Die Droschken hatten Anweisung, so schnell wie möglich davonzufahren, und zwar jede in eine andere Richtung …1
Am liebsten würde ich behaupten, dieser Schnörkel der Familiengeschichte sei die Anregung für Stephen Leacocks Lord Ronald gewesen, der »sich auf sein Pferd schwang und in alle Richtungen davongaloppierte«. Außerdem stelle ich mir gern vor, ich hätte etwas von Henry Dawkins’ Erfindungsreichtum geerbt, von seinem Feuereifer ganz zu schweigen. Das ist allerdings unwahrscheinlich, stammt doch nur der 32. Teil meines Genoms von ihm. Ein Vierundsechzigstel kommt von General Clinton selbst, und doch ließ ich nie militärische Neigungen erkennen. Tess von den d’Urbervilles und Der Hund von Baskerville sind nicht die einzigen literarischen Werke, in denen erbliche »Rückgriffe« auf entfernte Vorfahren vorkommen, wobei man vergisst, dass sich der Anteil gemeinsamer Gene in jeder Generation halbiert und deshalb exponentiell dahinschwindet – oder dahinschwinden würde, gäbe es nicht die Verwandtenehe, die immer häufiger wird, je weitläufiger das Verwandtschaftsverhältnis ist; letztlich sind wir alle mehr oder weniger weit entfernte Vettern und Basen.
Eine bemerkenswerte Tatsache kann man sich klarmachen, ohne dass man aus dem Sessel aufstehen müsste: Würden wir mit einer Zeitmaschine nur weit genug in die Vergangenheit reisen, so muss jeder, von dem heute überhaupt noch Nachkommen leben, ein Vorfahre aller sein, die heute noch leben. Hat uns die Zeitmaschine weit genug gebracht, so ist jeder, der uns begegnet, entweder ein Vorfahre aller 2015 lebenden Menschen oder niemandes Vorfahre. Mit der bei Mathematikern so beliebten Reductio ad absurdum erkennt man, dass dies für unsere fischförmigen Vorfahren im Devonzeitalter ebenso gelten muss (mein Fisch muss auch dein Fisch sein, denn sonst gelangt man zu der absurden Alternative, dass die Nachkommen deines und meines Fisches über mehr als 300 Millionen Jahre keusch getrennt geblieben sind und sich trotzdem heute noch kreuzen können). Die Frage ist nur, wie weit man sich in die Vergangenheit begeben muss, damit die Argumentation zutrifft. Bis zu unseren Fischvorfahren sicher nicht, aber wie weit? Gehen wir über die genaue Berechnung einmal großzügig hinweg, dann kann ich sagen: Wenn die Queen von William dem Eroberer abstammt, dann gilt das wahrscheinlich auch für jeden anderen (und dass es auf mich – von der einen oder anderen illegitimen Abstammung einmal abgesehen – genauso zutrifft wie für fast jeden mit aufgezeichnetem Stammbaum, weiß ich).
Clinton George Augustus Dawkins (1808–1871), der Sohn von Henry und Augusta, war in der Familie Dawkins einer der wenigen, die tatsächlich den Namen Clinton trugen. Wenn er etwas von der Leidenschaft seines Vaters geerbt hatte, dann hätte er es 1849 fast verloren: Damals wurde Venedig, wo er britischer Konsul war, von den Österreichern beschossen. In meinem Besitz befindet sich eine Kanonenkugel – sie liegt auf einem Sockel, an dem eine Messingplatte mit einer Inschrift befestigt ist. Ich weiß weder, von wem sie stammt, noch, wie wahrheitsgetreu sie ist, aber wozu es auch gut sein mag, hier meine Übersetzung (aus dem Französischen, damals die Sprache der Diplomatie):
Eines Nachts, als er im Bett lag, drang eine Kanonenkugel durch die Bettdecken und ging zwischen seinen Beinen hindurch, fügte ihm aber glücklicherweise nur oberflächliche Verletzungen zu. Zuerst hielt ich dies für eine Lügengeschichte, aber dann erfuhr ich mit Sicherheit, dass sie auf der reinen Wahrheit beruht. Sein Schweizer Kollege begegnete ihm später im Leichenzug für den amerikanischen Konsul, und als er ihn danach fragte, bestätigte er lachend die Tatsachen und erklärte, genau aus diesem Grunde würde er hinken.
Die lebenswichtigen Körperteile meines Vorfahren kamen also mit knapper Not davon, bevor er sie nutzbringend verwenden konnte, und ich bin versucht, meine eigene Existenz auf einen ballistischen Glücksfall zurückzuführen. Ein paar Zentimeter näher an der Gabelung von Shakespeares Rettich, und … Aber in Wirklichkeit hängt meine Existenz und deine und die des Briefträgers an einem noch viel dünneren seidenen Faden. Wir verdanken sie der Tatsache, dass seit Anbeginn des Universums alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort geschehen ist. Der Zwischenfall mit der Kanonenkugel ist nur ein besonders dramatisches Beispiel für ein viel allgemeineres Phänomen. Oder, wie ich es früher einmal formuliert habe: Hätte der zweite Dinosaurier links von dem großen Cycadeenbaum nicht zufällig geniest und wäre ihm deshalb nicht der winzige, spitzmausähnliche Vorfahre aller Säugetiere entwischt, keiner vor uns wäre heute hier. Wir können uns selbst als etwas höchst Unwahrscheinliches betrachten. Und doch sind wir – Triumph des Rückblicks – da.
Clinton (später Sir Clinton) Edward Dawkins (1859 –1905), der Sohn von C. G. A. (»Kanonenkugel«) Clinton, war eines der vielen Mitglieder der Familie Dawkins, die das Balliol College in Oxford besuchten. Er war dort gerade zur richtigen Zeit, um in den Balliol Rhymes unsterblich gemacht zu werden, die erstmals 1881 als Bänkellieder unter dem Titel The Masque of Balliol veröffentlicht wurden. Am berühmtesten ist die Strophe, die den Collegevorsteher Benjamin Jowett verherrlicht; gedichtet wurde sie von H. C. Beeching, dem späteren Superintendenten der Kathedrale von Norwich:
First com I, my name is Jowett.
There’s no knowledge but I know it.
I am Master of this College,
What I don’t know isn’t knowledge. |1|
Weniger witzig ist die Strophe über Clinton Edward Dawkins:
Positivists ever talk in s-
Uch an epic style as Dawkins;
God is naught and Man is all,
Spell him with a capital.|2|
Freidenker waren in viktorianischer Zeit eine Seltenheit, meinen Urgroßonkel Clinton hätte ich gern kennengelernt. (Als Kind traf ich tatsächlich noch zwei seiner jüngeren Schwestern; sie waren hochbetagt, und eine von ihnen hatte zwei Dienstmädchen namens Johnson und Harris – eine Konvention der Vornamengebung, die ich seltsam fand.) Aber was sollen wir von dem »epischen Stil« halten?
Nach meiner Überzeugung zahlte Sir Clinton später dafür, dass mein Großvater, sein Neffe Clinton George Evelyn Dawkins, auf das Balliol gehen konnte, wo er aber kaum etwas anderes tat als zu rudern. Ein (im Bildteil wiedergegebenes) Foto, auf dem mein Großvater auf dem Fluss zur Tat schreitet, lässt auf großartige Weise den Hochsommer im Oxford der edwardianischen Zeit lebendig werden. Es könnte eine Szene aus Zuleika Dobson von Max Beerbohm sein. Die Gäste mit ihren großen Hüten stehen auf dem schwimmenden Bootshaus des Colleges, das bis in die jüngere Vergangenheit von allen Rudermannschaften der Hochschule genutzt wurde. Heute sind leider zweckmäßigere Backsteinbootshäuser am Ufer an seine Stelle getreten. (Ein oder zwei alte Bootshäuser schwimmen heute noch – oder liegen zumindest auf Grund. Als Hausboote wurden sie inmitten von Lappentauchern und Teichhühnern auf den Altwasserarmen und Flüssen rund um Oxford an wässerigen Ruhestätten vertäut.) Die Ähnlichkeit zwischen Großvater und zwei seiner Söhne, meinem Vater und meinem Onkel Colyear, ist nicht zu übersehen. Familienähnlichkeiten faszinieren mich, auch wenn sie sich im Laufe der Generationen schnell verlieren.
Großvater war ein hingebungsvoller Balliol-Anhänger und schaffte es, dort weit über die Zeitspanne hinaus, die einem Studienanfänger normalerweise zugestanden wurde, zu bleiben – nach meiner Vermutung ausschließlich zu dem Zweck, weiterhin rudern zu können. Noch auf seine alten Tage war das College sein Hauptgesprächsthema. Wenn ich ihn besuchte, wollte er immer wieder wissen, ob wir noch den alten edwardianischen Slang benutzten (und immer wieder musste ich ihm erklären, dass das nicht der Fall war: »Mugger« statt »Master« für den Collegevorsteher, »wagger pagger« statt »wastepaper basket« für einen Papierkorb, »Maggers Memogger« für das Martyr’s Memorial – das große, kreuzförmige Denkmal in der Nähe von Balliol erinnert an drei anglikanische Bischöfe, die 1555 in Oxford bei lebendigem Leib verbrannt wurden, weil sie sich zur falschen Spielart des Christentums bekannt hatten).
Eine meiner letzten Erinnerungen an Großvater Dawkins ist, wie ich ihn zu seinem letzten Balliol Gaudy brachte, einem Treffen ehemaliger Collegemitglieder, zu dem jedes Jahr eine andere Altersgruppe eingeladen wird. Er war von alten Kameraden umgeben, die Rollatoren schoben und mit Hörgeräten oder Nasenkneifern ausgerüstet waren; einer von ihnen erkannte ihn und fragte mit genüsslichem Sarkasmus: »Na, Dawkins, ruderst du immer noch für Leander?« Als ich ihn verließ, wirkte er ein wenig verloren unter den Jungs von der alten Truppe. Manche von ihnen hatten wohl schon im Burenkrieg gekämpft und waren deshalb würdige Widmungsempfänger von Hilaire Bellocs berühmtem Gedicht »To the Balliol Men still in Africa«:
Years ago, when I was at Balliol,
Balliol men – and I was one –
Swam together in winter rivers,
Wrestled together under the sun.
And still in the heart of us, Balliol, Balliol,
Loved already, but hardly known,
Welded us each of us into the others:
Called a levy and chose her own.
Here is a House that armours a man
With the eyes of a boy and the heart of a ranger
And a laughing way in the teeth of the world
And a holy hunger and thirst for danger:
Balliol made me, Balliol fed me,
Whatever I had she gave me again:
And the best of Balliol loved and led me.
God be with you, Balliol men.|3|
Mit großer Anstrengung trug ich diese Zeilen 2011 bei der Trauerfeier für meinen Vater vor, und dann noch einmal 2012, als ich auf der Global Atheist Convention in Melbourne einen Nachruf auf Christopher Hitchens hielt. Anstrengend war es, weil mir selbst bei fröhlicheren Gelegenheiten peinlich schnell die Tränen in die Augen steigen, wenn ich Gedichte vorlese, die ich liebe, und gerade diese Zeilen von Belloc gehören dabei zu den schlimmsten Übeltätern.
Nachdem mein Großvater das Balliol College verlassen hatte, machte er wie so viele Angehörige meiner Familie Karriere in der Kolonialverwaltung. In seinem Distrikt in Burma wurde er Waldschützer, er verbrachte viel Zeit in den abgelegensten Winkeln der Tropenholzwälder, wo er die Arbeit der hervorragend ausgebildeten Elefanten-Holzfäller beaufsichtigte. So war er auch 1921 zwischen den Teakholzbäumen unterwegs, als ihn – ich stelle mir gern einen laufenden Boten mit einem gespaltenen Stock vor – die Nachricht von der Geburt seines jüngsten Sohnes Colyear erreichte (der Name erinnert an Lady Juliana Colyear, die Mutter des unternehmungslustigen Henry, der mit Augusta Clinton durchgebrannt war). Großvater war darüber so begeistert, dass er nicht auf irgendein Transportmittel wartete, sondern mit dem Fahrrad die 80 Kilometer zum Krankenbett seiner Ehefrau Enid fuhr. Dort verkündete er voller Stolz, der kleine Junge habe die »Dawkins-Nase«. Den Evolutionspsychologen ist aufgefallen, dass bei Neugeborenen mit besonderem Eifer nach Ähnlichkeiten zu Verwandten väterlicherseits – nicht aber mütterlicherseits – gesucht wird; der Grund ist einfach: Der Vaterschaft kann man sich nicht so sicher sein wie der Mutterschaft.
Colyear war der jüngste und John, mein Vater, der älteste von drei Brüdern. Alle kamen in Burma zur Welt und wurden von vertrauenswürdigen Trägern in Moses-Körbchen, die an Stangen hingen, durch den Dschungel getragen. Und alle folgten später dem Beispiel ihres Vaters und traten in die Kolonialverwaltung ein, allerdings in drei verschiedenen Teilen Afrikas: John in Nyassaland (dem heutigen Malawi), der mittlere Bruder Bill in Sierra Leone und Colyear in Uganda. Bill war nach seinen beiden Großvätern auf den Namen Arthur Francis getauft, wurde aber immer nur Bill gerufen, weil er als Kind an die Eidechse Bill von Lewis Carroll erinnerte. John und Colyear sahen sich in ihren jungen Jahren so ähnlich, dass John einmal auf der Straße aufgehalten und gefragt wurde: »Sind Sie es oder sind Sie der Bruder?« (Diese Geschichte ist wahr, möglicherweise im Gegensatz zu der Legende über W. A. Spooner, der als einziger Leiter meines heutigen Colleges in Oxford einen »Ismus« für sich in Anspruch nehmen kann. Spooner begrüßte einmal einen jungen Mann auf dem Collegehof mit der Frage: »Warten Sie mal, ich kann es mir nie merken – waren Sie das, der im Krieg umgekommen ist, oder Ihr Bruder?«) In ihren späteren Jahren wurden Bill und Colyear sich (und ihrem Vater) immer ähnlicher, John meinem Eindruck nach hingegen weniger. Dass Familienähnlichkeiten in verschiedenen Lebensstadien auftauchen und wieder verschwinden, kommt häufig vor; das ist einer der Gründe, warum ich sie so faszinierend finde. Man vergisst nur allzu leicht, dass Gene ihren Einfluss nicht nur während der Embryonalentwicklung ausüben, sondern auch während des ganzen späteren Lebens.
Eine Schwester gab es nicht, was meine Großeltern sehr bedauerten. Sie hatten vorgehabt, ihre Jüngste Juliana zu nennen, mussten aber nun stattdessen auf ihren adligen Familiennamen zurückgreifen. Alle drei Brüder waren begabt. Colyear erbrachte die besten akademischen Leistungen, Bill war der Sportlichste. Als ich später auf die Schule kam, war ich stolz, dort seinen Namen auf der Ehrentafel zu sehen: Er hielt den Schulrekord im 100-Yards-Lauf – eine Fähigkeit, die ihm zweifellos auch beim Rugby gute Dienste leistete, wo er in der Frühzeit des Zweiten Weltkriegs einen krachenden Touchdown für die Army gegen Großbritannien erzielte. Von Bills athletischer Begabung habe ich nichts, aber ich stelle mir gern vor, dass ich von meinem Vater gelernt habe, wie man über Wissenschaft denkt, und von Onkel Colyear, wie man sie erklärt. Nachdem Colyear aus Uganda zurückgekehrt war, wurde er Dozent in Oxford; dort verehrte man ihn als hervorragenden Dozenten für Statistik, ein Fach, dessen Vermittlung an Biologen als besonders schwierig gilt. Er starb allzu früh; eines meiner Bücher, nämlich Und es entsprang ein Fluss in Eden, habe ich ihm mit folgenden Worten gewidmet:
In Erinnerung an Henry Colyear Dawkins (1921–1992), der am St. John College in Oxford gelehrt hat und ein Meister in der Kunst war, Dinge zu erklären.
Die Brüder starben in umgekehrter Altersreihenfolge. Ich vermisse sie alle schmerzlich. Als Bill, mein Pate und Onkel, 2009 im Alter von 93 Jahren verstarb, hielt ich die Trauerrede.2 Darin versuchte ich einen einfachen Gedanken zu vermitteln: In der britischen Kolonialverwaltung war zwar vieles schlecht, aber die Besten waren sehr gut. Und wie seine beiden Brüder und Dick Kettlewell, von dem noch die Rede sein wird,3 so war auch Bill einer der Besten.
Wenn man sagen kann, dass die Brüder ihrem Vater in die Kolonialverwaltung nachfolgten, dann blieben sie auch von der mütterlichen Seite ihrem Erbe treu. Arthur Smythies, ihr Großvater mütterlicherseits, war in seinem Distrikt in Indien der Leiter der Forstverwaltung; sein Sohn Evelyn leitete später die Forstverwaltung in Nepal. Mein Großvater Dawkins freundete sich mit Evelyn an, als beide in Oxford Forstwissenschaft lehrten, und das führte dazu, dass er Evelyns Schwester Enid, meine Großmutter, kennenlernte und heiratete. Evelyn war der Autor eines vielbeachteten, 1925 erschienenen Buches mit dem Titel India’s Forest Wealth und mehrerer Standardwerke über Philatelie. Seine Frau Olive machte, wie ich zu meinem Bedauern berichten muss, gern Jagd auf Tiger und brachte ein Buch mit dem Titel Tiger Lady heraus. Es gibt ein Bild von ihr, auf dem sie mit Tropenhelm auf einem Tiger steht, während ihr Ehemann ihr stolz auf die Schulter klopft. Die Beschriftung lautet: »Gut gemacht, kleine Frau.« Ich glaube, sie wäre nicht mein Typ gewesen.
Der älteste Sohn von Olive und Evelyn, der schweigsame Cousin ersten Grades meines Vaters, hieß Bertram (»Billy«) Smythies und war ebenfalls in der Forstverwaltung tätig – zuerst in Burma, später in Sarawak. Er schrieb die Standardwerke Birds of Burma und Birds of Borneo. Das zweite wurde zu einer Art Bibel für den (ganz und gar nicht schweigsamen) Reiseschriftsteller Redmond O’Hanlon, der zusammen mit dem Dichter James Fenton eine vergnügte Reise Ins Innere von Borneo unternahm.
Bertrams jüngerer Bruder John Smythies wich von der Familientradition ab: Er wurde ein angesehener Neurowissenschaftler und zu einer Autorität für Schizophrenie und bewusstseinserweiternde Drogen, lebte in Kalifornien und soll dort Aldous Huxley dazu angeregt haben, Meskalin zu nehmen und seine »Pforten der Wahrnehmung« zu läutern. Ihn fragte ich um Rat, ob ich das freundliche Angebot eines Bekannten annehmen solle, der mich während eines LSD-Trips betreuen wollte. Er riet mir ab. Yorick Smythies, ein weiterer Cousin meines Vaters, war ein eifriger Sekretär des Philosophen Wittgenstein.4 Peter Conradi bezeichnet ihn in seiner Biographie der Romanschriftstellerin Iris Murdoch als »heiligen Narren«, der ihr als Anregung für die Gestalt des Hugo Belfounder in ihrem Roman Unter dem Netz diente. Ehrlich gesagt fällt es mir schwer, eine Ähnlichkeit zu erkennen.
Yorick war bestrebt, Busschaffner zu werden, aber, so hielt Iris fest, er war der einzige Bewerber in der Geschichte des Busunternehmens, der bei der theoretischen Prüfung durchfiel … Während seiner einzigen Fahrstunde verließ der Fahrlehrer das Auto, da Yorick immer wieder auf den Gehweg fuhr.5
Nachdem er in der Busfahrerprüfung durchgefallen war und Wittgenstein (wie auch die meisten seiner Schüler) ihm eine Berufslaufbahn in der Philosophie ausgeredet hatte, arbeitete Yorick als Bibliothekar bei der Forstverwaltung in Oxford, was vielleicht seine einzige Verbindung zur Familientradition war. Er hatte exzentrische Gewohnheiten, fand Gefallen an Schnupftabak und dem römischen Katholizismus und endete tragisch.
Als Erster meiner Familie trat offenbar Arthur Smythies, der Großvater der Dawkins- und Smythies-Cousins, in die Dienste des Empire. Seine Vorfahren väterlicherseits waren seit dem Urururururgroßvater (dem Reverend William Smythies, geboren in den 1590er Jahren) über sechs Generationen ohne Unterbrechung und ohne Ausnahme anglikanische Geistliche gewesen. Hätte ich in einem ihrer Jahrhunderte gelebt, es wäre nicht unwahrscheinlich, dass ich ebenfalls Kleriker geworden wäre. Ich habe mich immer für die tiefgreifenden Fragen des Daseins interessiert, jene Fragen, nach deren Beantwortung die Religion (vergeblich) strebt, aber zum Glück lebe ich in einer Zeit, in der man auf solche Fragen nicht mit Übernatürlichem, sondern mit Wissenschaft antwortet. Hinter meinem Interesse für die Biologie standen vorwiegend Fragen nach den Ursprüngen und dem Wesen des Lebendigen, nicht aber die Liebe zur Naturgeschichte wie bei den meisten jungen Biologen, die ich unterrichtet habe. Man kann sogar sagen: Ich haben die Familientradition der eifrigen Beschäftigung im Freien und der Freiland-Naturforschung aufgegeben. In kurzen Erinnerungen, die in einer Anthologie mit autobiographischen Texten von Verhaltensforschern erschienen sind, schrieb ich:
Eigentlich hätte ich ein kindlicher Naturforscher sein müssen. Ich hatte alle Vorteile auf meiner Seite: nicht nur das ideale frühkindliche Umfeld im tropischen Afrika, sondern auch die idealen Gene, die eigentlich dorthin passten. Über Generationen schritten gebräunte Dawkins-Beine in Khakishorts durch die Dschungel des Empire. Wie mein Vater und seine beiden jüngeren Brüder, so kam auch ich gewissermaßen mit dem Tropenhelm auf die Welt.6
Als mein Onkel Colyear mich später zum ersten Mal in Shorts sah (die er selbst, gehalten von zwei Gürteln, regelmäßig zu tragen pflegte), sagte er: »Du liebe Güte, du hast ja richtige Dawkins-Knie.« Weiter schrieb ich über meinen Onkel Colyear, das Schlimmste, was er über einen jungen Mann sagen konnte, sei:
»Der ist nie in seinem Leben in einer Jugendherberge gewesen«
– eine Kritik, die, wie ich leider sagen muss, bis heute auf mich zutrifft. Mein junges Ich ließ anscheinend die Familientraditionen außer Acht.
Von meinen Eltern erfuhr ich viel Ermunterung. Beide kannten alle Wildblumen, die einem auf einer Klippe in Cornwall oder auf einer Alpenwiese begegnen, und mein Vater unterhielt meine Schwester und mich damit, als Zugabe die lateinischen Namen ins Gespräch zu werfen (Kindern gefällt der Klang von Worten, auch wenn sie deren Bedeutung nicht kennen). Kurz nach unserem Umzug nach England beschämte mich mein imposanter Großvater, der mittlerweile aus den Wäldern Burmas in den Ruhestand gewechselt war: Er zeigte auf eine Blaumeise vor dem Fenster und fragte mich, was das für ein Vogel sei. Ich wusste es nicht und stammelte kläglich: »Ist das ein Buchfink?« Großvater war entsetzt. In der Familie Dawkins war solche Unkenntnis das Gleiche, als hätte man noch nie etwas von Shakespeare gehört: »Du liebe Güte, John« – ich habe seine Worte und die treusorgende Entschuldigung meines Vaters noch im Ohr –, »wie ist denn so etwas möglich?«
Aber ich muss meinem jungen Ich Gerechtigkeit widerfahren lassen: Ich hatte erst kurz zuvor meinen Fuß auf englischen Boden gesetzt, und in Ostafrika gibt es weder Blaumeisen noch Buchfinken. Jedenfalls entdeckte ich erst spät das Vergnügen, wilde Tiere zu beobachten, doch ein Freiluftliebhaber wie mein Vater oder mein Großvater wurde ich nie. Stattdessen war ich ein heimlicher Leser. Während der Internatsferien schlich ich mich mit einem Buch nach oben in mein Zimmer, ein schuldbewusster Abtrünniger von frischer Luft und tugendsamer Freiluftaktivität. Auch als ich in der Schule Biologie lernte, fesselten mich Bücher mehr. Die Fragestellungen, zu denen ich mich hingezogen fühlte, hätten Erwachsene als philosophisch bezeichnet. Was ist der Sinn des Lebens? Warum gibt es uns? Wie hat alles angefangen?
Die Familie meiner Mutter stammt aus Cornwall. Ihre Mutter Connie Wearne, die Tochter und Enkeltochter von Ärzten aus Helston (die ich mir als Kind immer wie Dr. Livesey aus Die Schatzinsel vorstellte), war begeisterte Cornish und bezeichnete Engländer als »Ausländer«. Sie bedauerte es, dass sie so spät geboren war und nicht mehr das ausgestorbene Kornische sprechen konnte, aber wie sie mir erzählte, verstanden die alten Fischer in dem Dorf Mullion noch die bretonischen Fischer, die »gekommen sind und sich unsere Krebse unter den Nagel gerissen haben«. Unter den britannischen Sprachen Walisisch (lebend), Bretonisch (sterbend) und Kornisch (ausgestorben) sind das Bretonische und das Kornische Schwestersprachen im Sprachstammbaum. Eine Reihe kornischer Wörter hat im kornischen Dialekt des Englischen überlebt, so zum Beispiel quilkin für den Frosch; meine Großmutter beherrschte den Dialekt. Wir Enkel überredeten sie gern, ein liebenswürdiges Gedicht zu rezitieren, in dem ein Junge »clunked a bully« (einen Zwetschgenkern verschluckte). Einmal nahm ich einen solchen Vortrag sogar auf Band auf, aber zu meinem Bedauern ging die Aufnahme verloren. Erst viel später konnte ich die Worte mit Hilfe von Google wieder ausfindig machen,7 und in meiner Erinnerung höre ich noch heute, wie ihre quiekende Stimme sie aufsagt.
There was an awful pop and towse8 just now down by the hully,9
For that there boy of Ben Trembaa’s, aw went and clunked10 a bully,11
Aw ded’n clunk en fitty,12 for aw sticked right in his uzzle,13
And how to get en out again, I tell ee ’twas a puzzle,
For aw got chucked,14 and gasped, and urged,15 and rolled his eyes, and glazed;
Aw guggled, and aw stank’d16 about as ef aw had gone mazed.17
Ould Mally Gendall was the fust that came to his relief,–
Like Jimmy Eellis ’mong the cats,18 she’s always head and chief;
She scruffed ’n by the cob,19 and then, before aw could say »No,«
She fooched her finger down his throat as fur as it would go,
But aw soon catched en ’tween his teeth, and chawed en all the while,
Till she screeched like a whitneck20 – you could hear her ’most a mile;
And nobody could help the boy, all were in such a fright,
And one said: »Turn a crickmole,21 son; ’tes sure to put ee right;«
And some ran for stillwaters,22 and uncle Tommy Wilkin
Began a randigal23 about a boy that clunked a quilkin;24
Some shaked their heads, and gravely said: »’Twas always clear to them
That boy’d end badly, for aw was a most anointed lem,25
For aw would minchey,26 play at feaps,27 or prall28 a dog or cat,
Or strub29 a nest, unhang a gate, or anything like that.«
Just then Great Jem stroathed30 down the lane, and shouted out so bold:
»You’re like the Ruan Vean men, soase, don’t knaw and waant be told;«
Aw staved right in amongst them, and aw fetched that boy a clout,
Just down below the nuddick,31 and aw scat the bully out;
That there’s the boy that’s standing where the keggas are in blowth:32
»Blest! If aw haven’t got another bully in his mouth!«
Die Evolution der Sprache fasziniert mich: Wie entwickeln sich lokale Varianten wie kornisches Englisch und Geordie zu Dialekten weiter, und wie wird der Abstand unmerklich immer größer, bis daraus gegenseitig unverständliche, aber offensichtlich verwandte Sprachen wie Deutsch und Niederländisch werden? Zur genetischen Evolution besteht eine enge Analogie, die aufschlussreich und irreführend zugleich ist. Entwickeln sich Populationen auseinander und werden zu biologischen Arten, ist die Trennung durch den Zeitpunkt definiert, wenn sie sich untereinander nicht mehr kreuzen können. Ich schlage vor, zwei Dialekten den Status verschiedener Sprachen zuzugestehen, wenn sie sich bis zu einem ebenso entscheidenden Punkt entwickelt haben: Dann gilt es nicht mehr als Beleidigung, sondern als Kompliment, wenn ein Muttersprachler der einen Variante sich bemüht, die andere zu sprechen. Würde ich in Penzance in ein Pub gehen und mich bemühen, den kornischen Dialekt des Englischen zu sprechen, könnte ich mir Probleme einhandeln, denn man würde hören, dass ich mich mit meiner Nachahmung darüber lustig mache. Wenn ich aber nach Deutschland fahre und mich bemühe, Deutsch zu sprechen, sind die Menschen entzückt. Das Deutsche und das Englische hatten genügend Zeit, um sich auseinanderzuentwickeln. Wenn ich recht habe, müsste es – vielleicht in Skandinavien? – Fälle geben, in denen Dialekte gerade im Begriff stehen, zu getrennten Sprachen zu werden. Kürzlich war ich auf einer Vortragsreise in Stockholm zu Gast in einer Fernsehtalkshow, die sowohl in Schweden als auch in Norwegen ausgestrahlt wurde. Der Moderator und auch einige Gäste waren Norweger, und man sagte mir, es spiele keine Rolle, welche der beiden Sprachen gesprochen würde: die Zuschauer diesseits und jenseits der Grenze verstehen einander mühelos. Das Dänische dagegen ist für die meisten Schweden nur schwer verständlich. Nach meiner Theorie würde man einem Schweden vermutlich den Rat erteilen, bei einem Besuch in Norwegen nicht Norwegisch zu sprechen, weil dies als Beleidigung aufgefasst werden könnte. In Dänemark würde ein Schwede sich dagegen vermutlich beliebt machen, wenn er sich bemüht, Dänisch zu sprechen.33
Als mein Urgroßvater Dr. Walter Wearne verstarb, zog seine Witwe aus Helson weg und baute ein Haus, von dem man einen Blick auf die Mullion Cove auf der Westseite der Lizard-Halbinsel hat. Dieses Haus war seither immer im Besitz der Familie. Mit einem angenehmen Klippenspaziergang gelangt man von der Mullion Cove an Strandgrasnelken vorbei nach Poldhu, dem Standort der Funkstation, von der Guglielmo Marconi 1901 die erste transatlantische Funkübertragung sendete. Sie bestand aus dem Buchstaben s des Morsealphabets, der ständig wiederholt wurde. Wie konnte man so stumpfsinnig sein und bei einer derart folgenschweren Gelegenheit nichts Phantasievolleres übertragen als »sssssss«?
Alan Wilfred »Bill« Ladner, mein Großvater mütterlicherseits, stammte ebenfalls aus Cornwall und arbeitete als Funkingenieur bei der Marconi-Gesellschaft. Er kam erst später zu der Firma und erlebte 1901 die Übertragung nicht mit, aber um 1913, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, wurde er derselben Funkstation in Poldhu zugeteilt. Als die Poldhu Wireless Station 1933 schließlich abgerissen wurde, konnte Ethel, die ältere Schwester meiner Großmutter (die für meine Mutter nur »Tante« hieß, obwohl sie nicht ihre einzige Tante war), sich einige große Schieferplatten sichern, die als Instrumententafeln gedient hatten; sie hatten Bohrlöcher, deren Muster ihre frühere Verwendung verrieten – Fossilien einer verflossenen Technik. Die Platten dienen heute als Pflaster im Garten des Familienanwesens in Mullion (siehe Bildteil), als ich ein Junge war, weckten sie in mir häufig die Bewunderung für den ehrbaren Ingenieurberuf meines Großvaters; er war allerdings in Großbritannien weniger angesehen als in anderen Ländern, und damit ist vielleicht ein wenig erklärt, warum mein Land einen so traurigen Abstieg von einer großen Industrienation zu einem würdelosen Lieferanten von (wie wir heute leider wissen, recht zwielichtigen) »Finanzdienstleistungen« erlebt hat.
Bis zu Marconis historischer Funkübertragung hatte man geglaubt, die Entfernung für den Empfang von Funksignalen werde durch die Krümmung der Erde begrenzt. Wie konnte man Wellen, die in gerader Linie wandern, hinter dem Horizont auffangen? Wie sich herausstellte, lautet die Antwort: Die Wellen werden von der Kennelly-Heaviside-Schicht in der oberen Atmosphäre zurückgeworfen (und heute werden Funksignale natürlich von künstlichen Satelliten reflektiert). Ich bin stolz darauf, dass das von meinem Großvater verfasste Buch Short Wave Wireless Communication von den 1930er bis zu den frühen 1950er Jahren mehrere Auflagen erlebte und als Standardwerk zu dem Thema galt; veraltet war es erst ungefähr zu der Zeit, als Transistoren an die Stelle der Vakuumröhren traten.
In der Familie war das Buch wegen seiner Unverständlichkeit berüchtigt; ich habe nur die beiden ersten Seiten gelesen, bin aber entzückt von seiner Klarheit.
Der ideale Sender erzeugt ein elektrisches Signal, welches eine originalgetreue Kopie des vorgegebenen Signals ist, und überträgt dieses an das Verbindungsglied, und zwar in völliger Gleichmäßigkeit sowie auf eine Art und Weise, damit es in anderen Kanälen keine Störungen verursacht. Das ideale Verbindungsglied überträgt die elektrischen Impulse, ohne sie zu verzerren und ohne sie abzuschwächen; das heißt, die Impulse nehmen unterwegs kein »Rauschen« durch äußere elektrische Störungen jedweder Art auf. Der ideale Empfänger nimmt die vom Verbindungsglied weitergeleiteten elektrischen Impulse auf und formt sie originalgetreu in die erforderliche Form für die visuelle oder akustische Beobachtung um … Da es sehr unwahrscheinlich ist, dass man jemals den idealen Kanal entwickeln wird, müssen wir überlegen, in welcher Beziehung wir Kompromisse eingehen wollen.
Es tut mir leid, Großvater, dass ich mich davon abhalten ließ, dein Buch zu lesen, als du noch da warst und darüber sprechen konntest – ich war alt genug, um es zu verstehen, und unternahm dennoch nicht einen Versuch. Und du wurdest durch den Druck der Familie abgehalten – abgehalten, den reichen Wissensschatz preiszugeben, der in deinem klugen Gehirn noch vorhanden gewesen sein muss. »Nein, ich weiß nichts über Funk«, murmeltest du bei jeder Anspielung, und dann fingst du an, nahezu unaufhörlich leichte Opernmelodien vor dich hinzupfeifen. Heute würde ich mich gern mit dir über George Shannon und Informationstheorie unterhalten. Ich würde dir gern zeigen, wie die gleichen Gesetzmäßigkeiten auch die Kommunikation zwischen Bienen, zwischen Vögeln und sogar zwischen den Neuronen im Gehirn bestimmen. Ich wäre begeistert, wenn du mir die Fourier-Transformation beibringen würdest und an Professor Silvanus Thompson zurückdenken könntest, den Autor von Analysis leicht gemacht (»Was ein Dummkopf kann, das kann auch ein anderer«). So viele verpasste Gelegenheiten. Wie konnte ich so kurzsichtig sein? Es tut mir leid, Schatten von Alan Wilfred Ladner, Marconi-Mann und geliebter Großvater.
Dass ich als Teenager Radios baute, lag nicht an meinem Großvater Ladner, sondern an Onkel Colyear. Er schenkte mir ein Buch von F. J. Cramm, und daraus bezog ich den Bauplan für meinen ersten Detektorempfänger (der gerade eben so funktionierte). Es folgte ein Röhrenempfänger mit einer einzigen, leuchtend roten Röhre – er funktionierte etwas besser, ich brauchte aber immer noch einen Kopfhörer anstelle des Lautsprechers. Er war unglaublich schlecht aufgebaut. Ich ordnete die Drähte keineswegs fein säuberlich an, sondern freute mich darüber, dass es ganz gleich war, welchen Weg sie nahmen und wie ich sie an dem hölzernen Chassis befestigte, solange nur jeder Draht an der richtigen Stelle endete. Ich kann nicht sagen, dass ich die einzelnen Drähte extra unordentlich verlegte, aber mit Sicherheit faszinierte mich das Missverhältnis zwischen der Topologie der Drähte, die wichtig war, und ihrer physischen Anordnung, die keine Rolle spielte. Der Unterschied zu einem modernen integrierten Schaltkreis ist verblüffend. Viele Jahre später hielt ich bei der Royal Institution die Weihnachtsvorträge für Kinder, die ungefähr in dem Alter waren, als ich meinen ersten Röhrenempfänger baute. Dazu hatte ich mir von einer Computerfirma das riesig vergrößerte Diagramm eines integrierten Schaltkreises geliehen. Ich hoffte, es erregte bei meinen jungen Zuhörern eine gewisse Ehrfurcht und auch Verwirrung. Wie man in der experimentellen Embryologie nachweisen konnte, folgen wachsende Nervenzellen keinem geordneten Plan, der an einen integrierten Schaltkreis erinnert, sondern sie suchen sich ihre richtigen Zielorgane oft so, wie ich meinen Röhrenempfänger konstruierte.
Aber zurück nach Cornwall und in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Meine Urgroßmutter pflegte die einsamen jungen Ingenieure aus der Funkstation auf der Klippe zum Tee ins Mullion House einzuladen, und dabei lernten sich meine Großeltern kennen. Sie verlobten sich, aber dann brach der Krieg aus. Bill Ladners Qualifikation als Funkingenieur war gefragt, und die Royal Navy schickte ihn als klugen jungen Offizier an die Südspitze des damaligen Ceylon. Er sollte dort eine Funkstation als strategisch wichtigen Stützpunkt im Schiffsroutennetz des Empire aufbauen.
Connie reiste ihm 1915 nach und wohnte in einem örtlichen Pfarrhaus; dort wurden die beiden auch getraut. Meine Mutter Jean Mary Vyvyan Ladner kam 1916 in Colombo zur Welt.
Im Jahr 1919 – der Krieg war vorüber – brachte Bill Ladner seine Familie zurück nach England, allerdings nicht nach Cornwall im äußersten Westen, sondern nach Essex ganz im Osten, wo die Marconi Company in Chelmsford ihren Hauptsitz hatte. Großvater erhielt eine Stelle als Ausbilder für junge Ingenieure am Marconi College, einer Institution, deren Leiter er später wurde. Er galt dort als sehr guter Lehrer. Anfangs wohnte die Familie unmittelbar in Chelmsford, aber später zog sie in der Nähe aufs Land, genauer gesagt in das hübsche Essex-Landhaus Water Hall, ein Anwesen aus dem 16. Jahrhundert in der Nähe des weitläufigen Dorfes Little Baddow.
Little Baddow ist der Schauplatz einer Anekdote über meinen Großvater, die uns meines Erachtens interessante Aufschlüsse über das Wesen des Menschen liefert. Sie spielt viel später, nämlich während des Zweiten Weltkriegs. Großvater war mit dem Fahrrad unterwegs. Ein deutscher Bomber flog über ihn hinweg und warf eine Bombe ab. (Das taten die Bomberbesatzungen beider Seiten manchmal über ländlichen Gebieten, wenn sie ihr Ziel in der Stadt aus irgendeinem Grund nicht gefunden hatten und sich davor fürchteten, mit einer Bombe an Bord zurückzukehren.) Großvater schätzte den Einschlagort der Bombe falsch ein und kam auf den verzweifelten Gedanken, sie könne Water Hall getroffen und sowohl seine Frau als auch seine Tochter getötet haben. Die Panik löste offenbar eine atavistische Rückkehr zu urtümlichen Verhaltensweisen aus: Er sprang vom Rad, warf es in den Straßengraben und lief zu Fuß den ganzen Weg nach Hause. Ich kann mir vorstellen, dass auch ich in einer Extremsituation so reagieren würde.
In Little Baddow, in einem großen Haus namens The Hoppet, setzten sich auch meine Großeltern Dawkins 1934 nach ihrer Rückkehr aus Burma zur Ruhe. Von den Dawkins-Jungen hörten meine Mutter und ihre jüngere Schwester Diana zum ersten Mal durch eine Freundin: Sie tratschte im Stil von Jane Austen atemlos über Neuankömmlinge, die noch zu haben seien. »Im The Hoppet wohnen jetzt drei Brüder! Der dritte ist noch zu jung, der mittlere sieht ganz gut aus, aber der älteste ist völlig verrückt. Der wirft die ganze Zeit Fassreifen in den Sumpf, legt sich dann auf den Bauch und sieht sie sich an.«
Dieses scheinbar exzentrische Verhalten meines Vaters hatte in Wirklichkeit einen ganz und gar rationalen Grund – aber die Motive des Wissenschaftlers wurden hier weder zum ersten noch zum letzten Mal aus Verständnislosigkeit in Frage gestellt. Er erforschte für das Botanische Institut in Oxford die statistische Verteilung der Horste von Tussockgras in Sümpfen. Im Rahmen dieser Tätigkeit musste er die Pflanzen in definierten Quadraten der Sumpflandschaft zählen und bestimmen, und die Standardmethode zur Gewinnung von Stichproben war das Auswerfen von (quadratischen) »Fassreifen«. Sein Interesse für Botanik erwies sich als eine der Eigenschaften, derentwegen meine Mutter sich zu ihm hingezogen fühlte, nachdem die beiden sich kennengelernt hatten.
Johns Liebe zur Botanik war schon früh erwacht, nämlich während der Internatsferien, die er und Bill häufig bei ihren Großeltern Smythies verbrachten. Zu jener Zeit war es durchaus üblich, dass Eltern, die in den Kolonien lebten, ihre Kinder und insbesondere Söhne nach Großbritannien aufs Internat schickten. Auch John und Bill kamen mit sechs beziehungsweise sieben Jahren auf das Internat Chafyn Grove in Salisbury, das auch ich später besuchte. Ihre Eltern blieben noch ein Jahrzehnt oder länger in Burma, und da es Flugreisen noch nicht gab, sahen sie ihre Söhne auch in den Schulferien meist nicht. Die Jungen wurden zwischen den Schuljahren anderswo untergebracht, manchmal in kommerziellen Wohnheimen für Kinder von Kolonialbeamten, manchmal aber auch bei den Großeltern Smythies in Dolton (Devon), wo ihnen häufig auch die Cousins aus der Familie Smythies Gesellschaft leisteten.
Heutzutage wäre man über eine solche langfristige Trennung der Kinder von ihren Eltern geradezu entsetzt, aber damals war sie allgemein üblich; in einer Zeit, in der Fernreisen langwierig, mühsam und teuer waren, nahm man sie als unausweichliche Begleiterscheinung des Empire und des diplomatischen Dienstes hin. Kinderpsychologen könnten den Verdacht haben, dass dies bleibende Schäden anrichtete. Dennoch waren John und Bill am Ende ausgeglichene, umgängliche Menschen, aber andere waren vielleicht nicht so robust und überstanden den frühkindlichen Liebesentzug weniger gut. Ihr Cousin Yorick war, wie ich bereits erwähnt habe, exzentrisch und möglicherweise unglücklich; aber dann ging er nach Harrow, was vermutlich alles erklärt – von dem Druck während seiner Verbindung zu Wittgenstein gar nicht zu reden.
Während der Schulferien bei den Großeltern setzte der alte Arthur Smythies einmal einen Preis für dasjenige seiner Enkelkinder aus, das die beste Sammlung von Wildblumen zusammentrug. John gewann, und die Sammlung aus seiner Kindheit wurde zum Grundstock für ein Herbarium, das ihn auf den Weg zu einer Ausbildung als Botaniker brachte. Wie bereits erwähnt, war die Liebe zu den Wildblumen eine Gemeinsamkeit, die er später mit meiner Mutter Jean teilte. Beide bevorzugten auch abgelegene Orte in der Wildnis und hatten eine Abneigung gegen lautstarke Gesellschaft: Sie mochten keine Partys, ganz im Gegensatz zu Johns Bruder Bill und Jeans Schwester Diana (die später ebenfalls heirateten).
Mit 13 Jahren verließen erst John und dann Bill das Internat Chafyn Grove, und man schickte sie auf das Marlborough College in Wiltshire, eine der bekannteren englischen Public Schools (Privatschulen), die ursprünglich für die Söhne von Geistlichen gegründet worden waren. Der Tagesablauf dort war spartanisch und, wie John Betjeman in seiner Versautobiographie berichtet, grausam. John und Bill litten anscheinend nicht so wie der Dichter – sie hatten sogar ihren Spaß. Was aber aufschlussreich ist: Sechs Jahre später, als Colyear an der Reihe war, schickten seine Eltern ihn an eine freundlichere Schule, nämlich Gresham’s in Norfolk. Soweit ich weiß, wäre Gresham’s auch für John besser gewesen; allerdings gab es im Marlborough den legendären Biologielehrer A. G. (»Tubby«) Lowndes, der ihm vermutlich viele Anregungen gab. Lowndes hatte eine ganze Reihe berühmter Schüler vorzuweisen, darunter die großen Zoologen J. Z. Young und P. B. Medawar sowie mindestens sieben Fellows der Royal Society. Medawar war genauso alt wie mein Vater, und beide gingen später nach Oxford; dort unterrichtete Medawar Zoologie am Magdalen und mein Vater Botanik am Balliol College. Auf meiner Webseite (https://richarddawkins.net/bcd/) habe ich eine historische Episode wiedergegeben, die Niederschrift eines Monologs von Lowndes, der von meinem Vater wörtlich aufgezeichnet wurde und den wahrscheinlich auch Medawar in demselben Klassenzimmer am Marlborough hörte. Für mich ist sie interessant, weil sie gewissermaßen den Kerngedanken über das »egoistische Gen« vorwegnimmt, aber sie beeinflusste mich nicht: Ich entdeckte sie im Notizbuch meines Vaters erst lange nach dem Erscheinen von Das egoistische Gen.
Nachdem mein Vater in Oxford sein Examen gemacht hatte, blieb er dort und strebte einen Postgraduiertenabschluss an. Es war das bereits erwähnte Projekt mit den Grashorsten. Anschließend entschied er sich für eine Laufbahn in der landwirtschaftlichen Abteilung der Kolonialverwaltung. Sie erforderte eine weitere Ausbildung in tropischer Landwirtschaft in Cambridge (wo seine Vermieterin den denkwürdigen Namen Mrs Sparrowhawk trug) und dann – nachdem er sich mit Jean verlobt hatte – am Imperial College of Tropical Agriculture (ICTA) in Trinidad. Im Jahr 1939 erhielt er in Nyassaland (dem heutigen Malawi) eine Stelle als Nachwuchs-Agrarbeamter.
Anmerkungen zum Kapitel
1 Wheatley, H.B. und Cunningham, P.: London Past and Present, Band 1, London 1891, S. 109.
2 Siehe https://richarddawkins.net/bcd/.
3 Und für den ich den Nachruf schrieb; siehe auch hier:https://richarddawkins.net/bcd/.
4http://wab.uib.no/ojs/agora-alws/article/view/1263/977.
5 Conradi, Peter: Iris Murdoch: Ein Leben, übersetzt von Juliane Gräbener-Müller u. Marion Balkenhol, Frankfurt a. M. 2004, S. 479.
6 »Growing up in ethology«, Kapitel 8 in: Drickamer, L. and Dewsbury, D., Hg: Leaders in Animal Behavior, Cambridge 2010.
7 In: Randigal Rhymes, hrsg. von Joseph Thomas, Penzance 1895.
8 Durcheinander.
9 Lager für Lebendköder.
10 Schluckte.
11 Kiesel; meine Großmutter übersetzte es allerdings mit »Zwetschgenkern«, was plausibler ist.
12 Ordnungsgemäß.
13 Kehle.
14 Verschluckt.
15 Kotzte.
16 Stampfte.
17 Verrückt.
18 Lokales Sprichwort.
19 Stirnlocke.
20 Hermelin, Wiesel.
21 Purzelbaum.
22 Aus Pfefferminze destillierte Arznei.
23 Unsinnige Geschichte.
24 Verschluckte einen Frosch.
25 Boshafter Kobold.
26 Pflichtvergessen.
27 Kopf oder Zahl.
28 Einem Tier eine Blechdose o. ä. an den Schwanz binden.
29 Plündern.
30 Forsch ausschreiten.
31 Hinterkopf.
32 Kerbel in Blüte.
33 Ich habe mich bei Professor Björn Melander erkundigt, einem Experten für skandinavische Sprachen. Er stimmt meiner Theorie über »Beleidigung oder Schmeichelei« zu, fügt aber hinzu, dass das jeweilige Umfeld zwangsläufig zusätzliche Komplikationen schafft.
2 Marketenderinnen in Kenia
Johns Versetzung nach Afrika setzte meine Eltern unter Zeitdruck. Am 27. September 1939 wurden sie in der Kirche von Little Baddow getraut. Anschließend reiste John mit dem Schiff nach Kapstadt, und von dort fuhr er mit dem Zug nach Nyassaland. Jean folgte ihm im Mai 1940 mit dem Flugboot Cassiopeia. Ihre dramatische Reise dauerte eine Woche und beinhaltete zahlreiche Landungen zum Nachtanken. Eine solche Zwischenstation war Rom, was bei ihr gewisse Ängste weckte, denn Mussolini stand kurz davor, auf deutscher Seite in den Krieg einzutreten. Hätte er das bereits getan, wären alle Passagiere der Cassiopeia bis zum Kriegsende interniert worden.
Als Jean in Afrika angekommen war, musste John ihr schonend beibringen, dass man ihn zu den King’s African Rifles (KAR) in Kenia einberufen hatte. Das junge Paar konnte in Nyassaland nur einen Monat lang sein Eheleben führen (und wenn ich zurückrechne, muss ich in dieser Zeit gezeugt worden sein), dann mussten sie abreisen. Das Bataillon aus Nyassaland schickte einen Fahrzeugkonvoi nach Kenia, wo die Soldaten ausgebildet werden sollten. John verschaffte sich irgendwie die Genehmigung, dem Konvoi fernzubleiben und selbst zu fahren. Für etwas anderes hatte er aber keine Erlaubnis: seine junge Ehefrau mitzunehmen. Die Frauen der Kolonialbeamten in Nyassaland hatten strikte Anweisung, im Land zu bleiben oder sich nach England oder Südafrika zu begeben, während ihre Männer nach Norden in den Krieg zogen. Soweit meine Mutter weiß, war sie als Einzige ungehorsam. Sie reiste illegal nach Kenia ein – was später zu Problemen führen sollte, über die ich noch berichten werde.
Am 6. Juli 1940 fuhren John, Jean und ihr Diener Ali, der sie treu begleitete und in meinem jungen Leben noch eine große Rolle spielen sollte, mit »Lucy Lockett« los, ihrem alten, klapprigen Ford-Kombi. Sie führten ein gemeinsames Reisetagebuch, aus dem ich im Folgenden zitieren werde. Absichtlich machten sie sich früher auf den Weg als der Konvoi für den Fall, dass sie unterwegs liegen blieben und gerettet werden mussten. Es war eine kluge Entscheidung: Schon auf der ersten Seite des Tagebuchs berichten sie, eine Gruppe von Jungen habe den Wagen anschieben müssen, damit er überhaupt ansprang. Am vierten Tag berichten sie, nachdem sie erfolgreich um ein paar Flaschenkürbisse gefeilscht hatten:
Nach dieser Episode fühlten wir uns sehr fröhlich, insbesondere weil wir den Kampf gewonnen und uns die Kürbisse gesichert hatten. John war so munter, dass er anfuhr, bevor Ali im Wagen war, und die Tür an einem Baum abriss. Das war sehr traurig.
Aber auch das Missgeschick mit der Autotür konnte die jungen Gemüter nicht erschüttern. Vergnügt fuhr das Trio weiter nach Norden, vorüber an Straußenvögeln und Giraffen, den Kilimandscharo am Horizont. Nachts schliefen sie im Laderaum des Wagens, an jedem Lagerplatz entzündeten sie ein Feuer, um die Löwen abzuschrecken, und dann kochten sie köstliche Eintöpfe und Pasteten auf einem behelfsmäßigen Herd, einer jener phantasievollen Erfindungen, an denen mein Vater sein Leben lang Freude hatte. Hin und wieder trafen sie mit dem Konvoi zusammen. Bei einer solchen Gelegenheit …
… verschwand ein großer militärischer Gentleman … mit rotem Hut und goldenen Litzen und Lakaien in einem indischen Laden, nachdem er uns befohlen hatte zu warten, und kam mit einer großen Schokoladentafel wieder heraus. Er gab sie mir und sagte: ›Ein Geschenk für ein kleines Mädchen auf einer großen Reise!‹ Die Schokolade aß John.
Ich frage mich, ob die Schokolade für den genialen Befehlshaber das Mittel war, um diskret darauf hinzuweisen, dass Jean illegal anwesend war?
Als sie sich der kenianischen Grenze näherten,
… waren wir darauf eingestellt, mich unter den Rollen mit dem Bettzeug zu verstecken, und Ali sollte sich oben draufsetzen, wenn die kenianische Grenze auftauchte. Aber die Grenze nahm nie konkrete Form an, und nach einer höchst faszinierenden, großartigen Reise fuhren wir in Nairobi ein, aber wir waren nicht klüger. John brachte mich im Norfolk Hotel unter und fuhr davon, um seinen Dienst anzutreten – zusammen mit Ali, der sich eine Askari-Uniform unter den Nagel gerissen und sich selbst zum Soldaten ernannt hatte.34 Später schnitt er in einer Askari-Fahrschule als Bester ab, womit er die Aufmerksamkeit auf sich zog und John viele Peinlichkeiten bescherte.
Trotz dieses blamablen Triumphes war Ali nie offiziell Soldat, sondern er reiste als inoffizieller Offiziersbursche meines Vaters mit und begleitete ihn überallhin, von einem Ausbildungslager zum nächsten. In einem davon namens Nyeri wurde zufällig gerade Lord Baden-Powell, der Gründer der Pfadfinder, mit militärischen Ehren bestattet. John, der früher selbst Pfadfinder gewesen war, wurde als Sargträger herangezogen und musste neben der Lafette marschieren. Von dieser Begebenheit besitze ich ein Foto (das im Bildteil wiedergegeben ist), und ich muss sagen, er sieht sehr schneidig aus mit seiner KAR-Uniform, den Khakishorts, den langen Strümpfen und dem Hut, dessen zunehmend mitgenommene Überreste er während seines ganzen späteren Lebens trug. Nebenbei bemerkt: Der große Offizier, der (im falschen Schritt) neben ihm marschiert, ist Lord Errol vom »Happy Valley«, der wenig später durch den berüchtigten, bis heute offiziell nicht aufgeklärten Mordfall »White Mischief« ums Leben kam.
Für Jean waren die nächsten drei Jahre eine Zeit der ständigen Wanderschaft: Sie folgte John zu seinen verschiedenen Arbeitsstellen in Uganda und Kenia. In ihren privaten Erinnerungen, die sie viel später für die Familie festhielt, merkte sie an:
John war sehr schlau und fand für mich immer vorübergehende Unterkünfte in der Nähe seiner verschiedenen Arbeitsstellen, während er bei den KAR ausgebildet wurde. Ich erledigte kleine Arbeiten, passte auf die Kinder anderer Leute auf und arbeitete in einigen Vorschulen, manchmal war ich aber auch nur zahlender Gast. Als sie einmal den Befehl bekamen, sich auf den Weg zu machen und Addis Abeba einzunehmen, sagte Johns Vorgesetzter, sie sollten sich besser beeilen, sonst sei Jean Dawkins vor ihnen da!
Zu Jeans vielen freundlichen Gastgebern während dieser Zeit gehörten auch Dr. und Mrs McClean in Uganda, die sie als Kindermädchen für ihre kleine Tochter »Snippet« einstellten.
Die McCleans in Jinja waren freundlich zu mir, und ich blieb Snippet auf den Fersen, wenn sie dieses oder jenes tat. Die Häuser in Jinja lagen alle rund um einen Golfplatz am Seeufer. Nachts spielten Flusspferde auf den Greens, rülpsten, grunzten und verwüsteten auch die Gärten. Es gab Rudel von Krokodilen, die im Wasser faulenzten und sich an den seichten Rändern des Sees unmittelbar unter den Wasserfällen sonnten, wo ich dummerweise zu paddeln pflegte. Die Krokodile waren lustig: Sie sperrten das Maul weit auf, damit ihre kleinen Freunde, die Vögel, ihnen ohne Gefahr die Zähne reinigen konnten!
Das symbiotische Putzverhalten ist heute bei den Fischen in Korallenriffen gut beschrieben. Das Phänomen und die interessanten evolutionstheoretischen Überlegungen dazu habe ich in Das egoistische Gen beschrieben, aber erst als ich sehr viel später die Erinnerungen meiner Mutter las, wurde mir klar, dass eine ähnliche Beziehung auch zwischen Krokodilen und Vögeln besteht. Ich nehme an, dass sie den gleichen Evolutionsvorgängen folgt, die sich am besten in der mathematischen Sprache der Spieltheorie ausdrücken lassen.
Während des Aufenthalts bei den McCleans erlebte meine Mutter die erste ihrer zahlreichen Malariaepisoden. Sie sollten während ihrer neun Jahre in Afrika immer wieder auftreten und waren einer der Gründe, warum meine Eltern sich schließlich entschlossen, nach England zurückzukehren. Sie erinnert sich noch lebhaft daran, wie sie bei einer späteren Gelegenheit – meine Eltern lebten nach dem Krieg in Nyassaland – während ihres Fieberdeliriums die aufgeregte Stimme von Dr. Glynn hörte, der damals leitender Arzt des Krankenhauses von Lilongwe war. Er sagte: »Wenn Sie nicht schnell John Dawkins rufen, ist es vielleicht zu spät.« Ihre spätere Genesung führte sie – wahrscheinlich zu Unrecht – darauf zurück, dass sie die Befürchtungen des Arztes, sie könne sterben, mitgehört hatte und trotzig entschlossen war, ihm das Gegenteil zu beweisen.
Bei einer ihrer ersten angeblichen Erkrankungen im Haus der McCleans, bei denen der Verdacht auf Malaria bestand, erwies sich jedoch eine andere Diagnose als richtig:
Der Arzt war ein lebhafter, fröhlicher Bursche, und eines Tages sagte er: »Sie wissen doch, was Ihr Problem ist, oder?« Darauf erwiderte ich: »Malaria?«, und er sagte: »Sie sind schwanger, meine Liebe!« Das war ein Schock, aber wir waren begeistert. Rückblickend betrachtet, war es in einer solchen unberechenbaren, heimatlosen Situation natürlich falsch von uns. Aber wenn wir klug und vernünftig und auf Sicherheit bedacht gewesen wären, hätten wir unseren Richard nicht! Nun denn! Wir kamen gut damit klar. Ich fing an, Babykleider zu nähen, und natürlich waren wir glücklich. Das Glück verließ uns die ganze Zeit nicht. Heute ist mir klar, dass es für Richard später schwierig gewesen sein muss, auf der ganzen Welt herumgezerrt zu werden, und vielleicht war es auch beunruhigend. In einer Liste hielten wir fest, wie viele Male sein kleiner Koffer in den ersten Jahren gepackt wurde. Viele Nächte verbrachten wir in kenianischen und ugandischen Eisenbahnzügen. Überall waren neue Gesichter, und seine ersten Jahre müssen von mitleiderregender Unsicherheit geprägt gewesen sein.
Die Liste, die sie damals aufstellte, habe ich gefunden: Sie verzeichnet meine Ortswechsel in den Jahren 1941 und 1942. Jean schrieb sie in ein Notizbuch, das »Blaue Buch«, das heute sehr mitgenommen ist; darin hielt sie auch einige meiner kindlichen Aussprüche und später die meiner Schwester Sarah fest. Der einzige Ort in der Liste, an den ich mich erinnern kann – vermutlich weil wir dort zweimal waren –, ist das Grazebrook’s Cottage in Mbagathi nicht weit von Nairobi. Wir waren dort bei Mrs Walter, ihrer im Krieg verwitweten Schwiegertochter Ruby und ihren kleinen Enkeln zu Gast.
In den Erinnerungen meiner Mutter heißt es weiter:
Kenia, Uganda und Tanganjika waren voller Erinnerungen, viele davon sehr glücklich und wunderschön. Aber auch voller Sorgen und Befürchtungen und Ängste und Einsamkeit, wenn John längere Zeit weg war und es keine Nachrichten von ihm gab. Briefe kamen nur in großen Abständen und dann häufig in Schüben und mit sehr alten Daten. Ich war oft furchtsam und einsam und stets ängstlich, aber wir hatten viele gute Freunde, und darüber war ich glücklich. Am wichtigsten waren die Walters in Mbagathi, die Richard und mich vollständig adoptierten.
Ich war auch dort, als das Telegramm kam und uns mitteilte, dass [Mrs Walters Sohn] John, der gerade erst auf Urlaub zu Hause gewesen war, nicht mehr lebte. Mrs Walter hatte das alles zuvor im Ersten Weltkrieg schon mit ihrem Mann durchgemacht, als John noch ein Baby war. Es war sehr, sehr schlimm.
Also konzentrierten wir uns auf den jungen William Walter und später, posthum, auf Johnny. Für Richard waren sie eine Zeitlang wie Brüder, und Mrs Walter war die Oma. Sie war eine bemerkenswerte, großartige Frau, und sie blieb immer geschäftig und positiv. Sie konzentrierte sich darauf, den Soldaten, die Urlaub hatten, schöne Ferien zu bereiten, und ich wurde öfter nach Nairobi geschickt, um Gruppen von Soldaten, Seeleuten und Luftwaffenangehörigen mit Juliana hin und her zu transportieren. Juliana war kein sehr zuverlässiges Transportmittel. Sie hatte zwei Kraftstofftanks, sie startete mit Benzin, und wenn man Glück hatte, wechselte sie anschließend zu Paraffinöl. Einmal überlebte ich die rund 20 Meilen nach Hause nur mit Glück. Ein ungeheuer dicker Marinekoch – wie ich schnell erkannte, war er sturzbetrunken –, den ich vom New Stanley Hotel abgeholt hatte, schlief quer über dem Sitz ein und lehnte sich so heftig gegen mich, dass ich das Auto kaum noch lenken konnte. Bewegen konnte ich ihn auch nicht. Es war sehr schwierig.
Ich glaube, diesen Männern hat es im Walter-Haushalt wirklich gefallen. Sie spielten mit den Kindern und erledigten viele kleine Hausmeistertätigkeiten für Mrs Walter. Die behandelte sie wie Söhne und setzte ihnen tolle Mahlzeiten vor. Es war für uns alle ein richtiges Zuhause.
Richard und ich bauten in Mbagathi eine neue Lehmhütte, einen großartigen Nachbau eines der beiden Rondavels35 mit einem geraden Stück dazwischen. Sie war sehr hübsch.
Die beiden Hütten mit dem gemeinsamen Dach aufzubauen dauerte nur ungefähr eine Woche. Sie bilden wohl meine früheste Erinnerung.
Mrs Walter hatte damals ein Stück Land gekauft. Eines Tages – sie rodete gerade zusammen mit einem Afrikaner das Gebüsch – gab es eine riesige Explosion; eine Mine aus dem Ersten Weltkrieg (so nahmen wir an) hatte dem armen Mann die Rückseite eines Unterschenkels sauber abgetrennt. Mrs Walter war eine sehr große, kräftige Person; sie hob ihn in ihren uralten Lieferwagen und brachte ihn nach Hause. Wir stützten ihn und deckten ihn zu, dann fuhr sie ihn nach Nairobi. Er war nach wie vor guter Dinge und plapperte die ganze Zeit. Wir mochten gar nicht glauben, wie ungeheuer tapfer er war!
Man vergisst nur allzu leicht, dass der Erste Weltkrieg bis weit ins mittlere und südliche Afrika hineingereicht hatte. Tanganjika war damals (zusammen mit Ruanda und Burundi) Deutsch-Ostafrika, und in der Region wurde gekämpft; auf dem Tanganjikasee fanden sogar Seeschlachten zwischen deutschen Schiffen auf der einen Seite und denen Großbritanniens und Belgiens auf der anderen statt (die Westküste des Sees gehörte zu Belgisch-Kongo). In ihrem wahrhaft großartigen Roman Red Strangers, einer epischen Saga über das Leben der Kikuyu, beschreibt Elspeth Huxley den Krieg aus Sicht eines Einheimischen: Für ihn ist er eine rätselhafte, nicht fassbare Verirrung der Weißen, in die Afrikaner auf entsetzliche Weise hineingezogen wurden. Der Krieg war aber nicht nur entsetzlich, sondern auch völlig sinnlos, weil die Sieger am Ende keine Rinder oder Ziegen der Verlierer nach Hause treiben konnten.
Aber nicht alle Schrecken jener Zeit hatten mit aktuellen oder vergangenen Kriegen zu tun.
Manchmal wurde ich auf Rubys Pferd – es hieß Bonnie – mit einer Nachricht zur Nachbarfarm des Ehepaars Lennox Browns geschickt. Als ich zum ersten Mal dorthin kam, führte mich der Page in den großen Salon, dann rief er den Memsahib. Der Raum war dunkel – die Vorhänge waren zum Schutz vor der sengenden Sonne zugezogen, und als ich wartete, wurde mir plötzlich klar, dass ich nicht allein war. Eine riesige Löwin lag in ganzer Länge ausgestreckt auf einem Sofa und riss das Maul auf! Ich war wie gelähmt. Als Mrs Lennox Browns hereinkam, gab sie dem Tier einen Klaps und schob es vom Sofa. Ich gab meine Nachricht ab und ging.