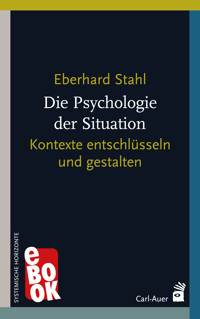
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Systemische Horizonte
- Sprache: Deutsch
Aus dem Vorwort von Friedemann Schulz von Thun: "Eberhard Stahls Buch lässt sich sowohl mit alltagspraktischer wie mit professioneller Brille lesen. Nach eigener Erfahrung scheint es mir in jedem Fall unvermeidlich, dass Sie nach der Lektüre klüger sind als vorher – und womöglich ein interessanteres Leben vor sich haben." Die Macht der Situation Wenn wir miteinander reden, gehen wir – meist unbewusst – von vielen Vorannahmen aus. Sie entscheiden, welches Verhalten wir für angemessen und welche Sätze wir für sagbar halten. Diese Vorannahmen erscheinen uns meist als "naturgegeben" – und sie sind es nie. Sie entstehen "im Auge des Betrachters" und sind geprägt durch dessen jeweiliges Verständnis des Kontextes. Eberhard Stahl beschreibt vier Dimensionen, die hier eine wichtige Rolle spielen: die Kultur des Ortes, die Dramaturgie des Anlasses, das Repertoire der Beteiligten und die Logik des Themas. Der Autor erläutert zunächst, wie wir unser Kontextverständnis in diesen vier Dimensionen entwickeln und wie es – meist unbewusst – unser Denken und Handeln prägt. Im Anschluss daran wird untersucht, wie wir uns im Gespräch wechselseitig über unsere Vorannahmen informieren und dabei – eher unterschwellig – miteinander über das "richtige" Kontextverständnis verhandeln oder streiten. Zahlreiche Illustrationen und viele Beispiele und Übungsfälle aus den Bereichen Familie, Wirtschaft, Politik und Sport verdeutlichen, wie diese Perspektiven helfen, in der Praxis besser zu beobachten und zu gestalten. Das Buch lehrt, problematische Vorannahmen differenziert zu analysieren und im Konfliktfall vermittelnd eingreifen zu können. Das versetzt uns in die Lage, manipulative Kontextualisierungen zu erkennen und emanzipatorisch gegenzusteuern. Der Autor: Eberhard Stahl, Dipl.-Psych., Psychologischer Psychotherapeut und Co-Geschäftsführer von elbdialog GbR; als Dozent, Mediator und Teamentwickler für Unternehmen und öffentliche Institutionen tätig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 691
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Systemische Horizonte – Theorie der Praxis
Herausgeber: Bernhard Pörksen
»Irritation ist kostbar.«
Niklas Luhmann
Die wilden Jahre des Konstruktivismus und der Systemtheorie sind vorbei. Inzwischen ist das konstruktivistische und systemische Denken auf dem Weg zum etablierten Paradigma und zur normal science. Die Provokationen von einst sind die Gewissheiten von heute. Und lange schon hat die Phase der praktischen Nutzbarmachung begonnen, der strategischen Anwendung in der Organisationsberatung und im Management, in der Therapie und in der Politik, in der Pädagogik und der Didaktik. Kurzum: Es droht das epistemologische Biedermeier. Eine Außenseiterphilosophie wird zur Mode – mit allen kognitiven Folgekosten, die eine Popularisierung und praxistaugliche Umarbeitung unvermeidlich mit sich bringt.
In dieser Situation ambivalenter Erfolge kommt der Reihe Systemische Horizonte – Theorie der Praxis eine doppelte Aufgabe zu: Sie soll die Theoriearbeit vorantreiben – und die Welt der Praxis durch ein gleichermaßen strenges und wildes Denken herausfordern. Hier wird der Wechsel der Perspektiven und Beobachtungsweisen als ein Denkstil vorgeschlagen, der Kreativität begünstigt.
Es gilt, die eigene Intelligenz an den Schnittstellen und in den Zwischenwelten zu erproben: zwischen Wissenschaft und Anwendung, zwischen Geistes- und Naturwissenschaft, zwischen Philosophie und Neurobiologie. Ausgangspunkt der experimentellen Erkundungen und essayistischen Streifzüge, der kanonischen Texte und leichthändig formulierten Dialoge ist die Einsicht: Theorie braucht man dann, wenn sie überflüssig geworden zu sein scheint – als Anlass zum Neu- und Andersdenken, als Horizonterweiterung und inspirierende Irritation, die dabei hilft, eigene Gewissheiten und letzte Wahrheiten, große und kleine Ideologien so lange zu drehen und zu wenden, bis sie unscharfe Ränder bekommen – und man mehr sieht als zuvor.
Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen
Eberhard Stahl
Die Psychologie der Situation
Kontexte entschlüsseln und gestalten
Mit einem Vorwort von Friedemann Schulz von Thun
2024
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Dr. h. c. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Dresden)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Tom Levold (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer † (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Dallgow-Döberitz)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Themenreihe »Systemische Horizonte«
hrsg. von Bernhard Pörksen
Reihengestaltung: Uwe Göbel
Umschlaggestaltung: B. Charlotte Ulrich
Redaktion: Anja Bachert
Satz: Drißner-Design u. DTP, Meßstetten
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Erste Auflage, 2024
ISBN 978-3-8497-0520-6 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8474-4 (ePUB)
© 2024 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/
Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax +49 6221 6438-22
Inhalt
Vorwort
Ein Dialog
Einleitung
1 Wahrnehmen, Denken, Sprechen: Grundbegriffe
1.1 Wahrnehmung: Schemata und Konzepte
1.2 Kommunikation: Äußerungen und Bedeutungen
2 Wer redet, wählt: Selektion und Angemessenheit
2.1 Das Problem der Selektion
2.2 Das Kriterium der Angemessenheit
3 Die Kontextermittlung: Wissen, was los ist
3.1 Das Kontextmodell
3.2 Faktorenspezifische Konzepte
3.3 Das persönliche Situationsverständnis
3.4 Der gemeinsame Nenner
4 Der Ort: Territorium und Kultur
4.1 Kollektiv
4.2 Feld
4.3 Organisation
5 Der Anlass: Interaktionsformat und Dramaturgie
5.1 Ereignis
5.2 Episode
5.3 Sequenz
6 Die Beteiligten: Konstellation und Repertoire
6.1 Sprecherin
6.2 Zuhörerin
6.3 Beziehung
7 Das Thema: Konfiguration und Logik
7.1 Gegenstand und Sachverhalt
7.2 Deutungsrahmen
7.3 Bezugsgröße
8 Die Kontextdefinition
9 Die Kontextordnung
9.1 Verhaltensvorgaben
9.2 Denkvorgaben
9.3 Der kommunikative Haushalt der Situation
10 Die Kontextvermittlung: Kontextualisierungshinweise
10.1 Sprachliche Kontextualisierungshinweise
10.2 Registerbezogene Kontextualisierungshinweise
11 Die Kontextverhandlung: Das Kontextualisierungsspiel
11.1 Spielmaterial
11.2 Eröffnungszug und Resonanz
11.3 Gegenzug und weiterer Spielverlauf
11.4 Deutungshoheit
12 Spielverläufe
12.1 Spielverläufe bei Vorliegen eines gemeinsamen Nenners
12.2 Spielverläufe bei Fehlen eines gemeinsamen Nenners
13 Abschluss
Anmerkungen
Glossar
Verzeichnis der Fallbeispiele
Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
Literatur
Über den Autor
Vorwort
Wie gelingt eine gute Kommunikation im privaten, beruflichen und politischen Leben? Die Quintessenz meiner Überlegungen zu dieser Frage lautet: Deine Kommunikation ist gut, wenn sie stimmig ist. Und stimmig ist sie, wenn sie in Übereinstimmung mit dir selbst und in Übereinstimmung mit dem ist, was der Situation gerecht wird. In Übereinstimmung mit dir selbst, also mit deinen Bedürfnissen, Werten und Zielen, mit deinem ganzen Wesen und deiner »inneren Wahrheit« – und in Übereinstimmung mit dem, was die Situation dir abverlangt, was dem Kontext angemessen ist, in den Worten von Viktor Frankl: »Jede Situation ist ein Ruf, auf den wir zu horchen, dem wir zu gehorchen haben.«
Diese Stimmigkeitslehre fordert in der Selbstreflexion und in der Beratung zu einer zweifachen Arbeit heraus: erstens, meine »innere Wahrheit« herauszufinden und spruchreif zu machen – und zweitens, die »Wahrheit der Situation« und ihren »Ruf« zu ergründen. Aber wie kann ich den Geboten der Situation auf die Spur kommen, und wie kann ich mich kontextgerecht verhalten? Das ist das Thema in diesem Buch, und Eberhard Stahl macht es zu einem wahrhaft großen Thema! »It’s the context, stupid!« – so könnte sein Titel auch lauten –, und genau das ist seine Quintessenz.
Und hier wird es jetzt spannend. Wir erfahren, dass unser Situationsverständnis sehr stark darüber bestimmt, was wir in jedweder zwischenmenschlichen Begegnung für angemessen und richtig halten und was als unangemessen und »daneben« gelten muss. Wir erfahren weiter, dass unser Situationsverständnis von starker intuitiver Plausibilität getragen ist, aber nicht selten voller impliziter Selbstverständlichkeiten ist, die bei näherer Betrachtung keineswegs selbstverständlich sind – und dass unser Gegenüber mit ganz anderen, ihm ebenfalls als selbstverständlich erscheinenden Annahmen das Feld der Begegnung betritt. Wenn wir also keinen richtig guten Draht zueinander bekommen, dann liegt das häufig nicht daran, dass mit unterschiedlichen Persönlichkeiten Welten aufeinanderprallen, sondern daran, dass unerkannte Vorannahmen über den Charakter und die Herausforderung der Situation aneinandergeraten. Und wir erkennen, je länger wir in diesem Buch lesen, in welch starkem Maße wir den Kontext nicht bloß als etwas Gegebenes vorfinden, sondern selbst an seiner Konstruktion beteiligt sind. Ist der Ruf, der mich situativ erreicht, vielleicht ein Echo von etwas, was ich selbst hineingegeben habe? Und wäre dann die Annahme, mein Gegenüber müsste doch »natürlicherweise« denselben Ruf hören, eine »egozentrische Illusion«, wie Eberhard Stahl das nennt? Der »gemeinsame Nenner« will dann erst noch als fehlend erkannt und wenn möglich neu geschaffen sein. Irgendwann wird es noch spannender – wenn wir z. B. lernen, dass nicht immer ein gemeinsamer Nenner, so wohltuend er sich auch anfühlen mag, hilfreich ist, um eine günstige Lösung zu finden.
Um das ganze Thema systematisch zu erhellen, legt Eberhard Stahl ein Kontextmodell vor, das es in sich hat: 4 Dimensionen mit je 3 Faktoren – das sind schon einmal 12 Felder, die wir als Leserinnen und Leser zu durchlaufen haben, mit zahlreichen weiteren Kategorien und Unterteilungen. Und mit einer Terminologie, die anspruchsvoll und eigenartig ist. Da ist von faktorenspezifischen Konzepten die Rede, wir lernen Etikette, Definitionen, Skripte und Register voneinander zu unterscheiden – ebenfalls Sequenzen, Episoden und Ereignisse; wir denken uns ein in Kategorien wie Kriteriumspräsuppositionen, Relationspräsuppositionen, Reziprozitätsautomatismus und Präsuppositionsprotest – und lernen, auf einem Kontextofon zu spielen, um selektiv faktorenspezifische Konzepte aufzurufen. Das ist in manchen Passagen keine leichte Lektüre, machen Sie sich darauf gefasst, dass Ihnen kognitive Schwerarbeit bevorsteht – einerseits!
Aber bevor ich auf »andererseits« komme, möchte ich doch sagen, dass sich die Schwerarbeit lohnt! Nach und nach wird unser Blick schärfer und wir sehen genauer, wie das Miteinander und Gegeneinander auf dieser Welt funktioniert – funktional und dysfunktional. Anspruchsvoll ist dieses Lehrbuch auch insofern, als es einen interdisziplinären Ansatz verfolgt, den es in dieser Form bisher nicht gegeben hat. Eberhard Stahl zieht die Anthropologie, die Soziologie, die Psychologie, die Linguistik, die Philosophie, die Politikwissenschaften zurate, um die Kontextualisierung in unserem Leben multiperspektivisch zu ergründen.
Ein anspruchsvolles akademisches Lehrbuch also – einerseits. Und nun endlich andererseits auch ein Buch aus der Praxis und für die Praxis! Eberhard Stahl ist seit Jahren und Jahrzehnten nicht nur als Kommunikationstrainer unterwegs, sondern auch und nicht zuletzt als Klärungshelfer in Konflikten und schwierigen Teamentwicklungen. Hieraus und aus der aufmerksamen Beobachtung des Weltgeschehens erwächst ein wahrer Erfahrungsschatz, aus dem er regelmäßig Beispiele und umgangssprachliche Wendungen entnimmt, um den abstrakten Gedankengang zu erläutern. Das ganze Buch lebt von einem eleganten Hin und Her zwischen Abstraktion und Konkretisierung. Und die Lebensbeispiele haben es ebenfalls in sich. Sie rekrutieren sich, zum Teil geradezu köstlich in ihrer Menschlich-Allzumenschlichkeit und didaktisch immer treffsicher, aus sehr diversen Lebensbereichen: Heiligabend in der Familie, Brötchenkauf beim Bäcker, Streit über einen Finderlohn, zweifelhafter Flirt im ICE, neue Mitarbeiterin im Unternehmen des Vaters, Kriminalität von Flüchtlingen, Empfang beim Bundespräsidenten, Streit über die Impfpflicht, Blumengeschenk für die Kanzlerin, Transformation einer Beziehung zwischen Mutter und Tochter – um nur die Bandbreite von insgesamt 73 Beispielen anzudeuten. Unter der Hand erwartet uns als Leser eine kleine Lebenskunde – sowohl über zwischenmenschliche Beziehungen wie auch über gesellschaftliche Konstellationen. Und unter der Hand erweitern wir unser kommunikatives Repertoire – beherrschen Sie zum Beispiel die Kunst der »rückwirkenden Umdeutung«?
Insofern ist dieses Buch für alle ein Gewinn, die privat, professionell und politisch mit anderen Menschen eine gute Verständigung anstreben, auch wenn die Situation nicht einfach ist. Aber geradezu obligatorisch ist es für professionelle Mediatorinnen und Klärungshelfer. Sie können hier fähig werden, ein Gespür für die vermeintlichen und zum Teil unbewussten Selbstverständlichkeiten zu entwickeln, die dem Handeln und Sprechen eines Menschen zugrunde liegen und die mit den impliziten Selbstverständlichkeiten des Gegenübers nicht harmonieren. Erst einmal ein Gespür – und dann die Fähigkeit, diese ans Licht zu heben, zu thematisieren und bei Bedarf zur Verhandlung zu verhelfen. Die Kunst des aktiven Zuhörens erhält hier eine bereichernde Komponente: Wir können zwischen einer seelischen Empathie und einer kontextbezogenen Empathie unterscheiden. Die seelische Empathie ergründet und verbalisiert, wie es dem Menschen ums Herz ist – die kontextbezogene Empathie ermittelt und spiegelt, von welchen impliziten Voraussetzungen und Annahmen er wie selbstverständlich ausgeht. Eberhard Stahl demonstriert diese Art der Klärungshilfe an vielen Stellen eindrucksvoll in wörtlicher Rede.
So lässt sich Eberhard Stahls Buch also sowohl mit alltagspraktischer wie mit professioneller Brille lesen. Nach eigener Erfahrung scheint es mir in jedem Fall unvermeidlich, dass Sie nach der Lektüre klüger sind als vorher – und womöglich ein interessanteres Leben vor sich haben.
Friedemann Schulz von Thun
Hamburg, im November 2023
Ein Dialog
»Lass uns unsere Beziehung einmal als Spiel betrachten. Auch wenn sie nicht nur ein Spiel ist, gibt es doch eine gewisse Ähnlichkeit. Und nur so kann ich es erklären.«
»In Ordnung«, sagte ich.
»Ein Spiel braucht Regeln, oder?«
»Ich glaube schon.«
»Beim Baseball und auch beim Fußball hat man ein dickes Buch mit allen möglichen detaillierten Vorschriften, die die Spieler und Schiedsrichter auswendig kennen müssen. Andernfalls funktioniert das Spiel nicht. So ist es doch, nicht wahr?«
»Genau.« …
»Was ich damit sagen will, ist, dass wir noch nie richtig über die Regeln unseres Spiels gesprochen haben. Stimmt’s?« …
»Nein, soweit ich weiß, haben wir das nicht.«
»Aber in der Praxis spielen wir unser Spiel anhand eines mutmaßlichen Regelwerks. Richtig?«
»Wenn du es sagst.«
»Darum geht es mir … Ich spiele das Spiel nach den mir bekannten Regeln, und du spielst es nach den Regeln, die du kennst. Intuitiv respektieren wir dabei unsere gegenseitigen Regeln. Und solange diese Regeln nicht kollidieren und kein Chaos entsteht, verläuft das Spiel reibungslos. So ist es doch?« …
»Wahrscheinlich. Grundsätzlich respektieren wir die jeweiligen Regeln des anderen.« …
»Aber wenn all das – Vertrauen, Respekt und Höflichkeit – nicht mehr gut funktioniert, unsere Regeln einander widersprechen und das Spiel nicht mehr reibungslos abläuft, müssen wir es unterbrechen, um gemeinsam neue Regeln zu erstellen. Oder wir müssen das Spiel beenden und vom Feld gehen. Und die Frage, wofür wir uns entscheiden, ist von großer Bedeutung.«
Haruki Murakami:Die Ermordung des Commendatore. Band 2: Eine Metapher wandelt sich (Murakami 2018, S. 64 f.).I
I Mit freundlicher Genehmigung des DuMont Buchverlages.
Einleitung
Manni Öttersfeld ist einer der Helden meiner Kindheit.1 Als ich im Alter von zehn Jahren die erste Klasse eines autoritär geleiteten Jungengymnasiums besuchte, war er Schüler der Oberstufe. Um ihn rankte sich die folgende Legende:
Beispiel 1: Angenehm – Öttersfeld!
Der für seine cholerischen Ausbrüche bekannte Mathelehrer »Kimme« Kimmenberg inszeniert in der Obersekunda (Klasse 11) eine seiner gefürchteten Klausurrückgaben. Dazu schreitet er durch die Stuhlreihen und trägt dabei den Stapel mit Klassenarbeitsheften vor sich her. Obenauf liegen die Einsen, ganz unten die Sechsen. Er hält jeweils am Pult des Eigentümers des oben liegenden Heftes an und legt das Heft mit einem verbalen (»Mehr Glück als Verstand!«) oder nonverbalen (Kopfschütteln) Kommentar auf dessen Tisch. Zum Schluss der Inszenierung hält er noch ein Heft in der Hand. Es ist das sichtlich ungepflegte und zerknitterte Heft von Manni Öttersfeld. Kimmenberg baut sich vor dessen Pult auf, knallt das Arbeitsheft vor ihn auf den Tisch und brüllt mit rotem Kopf: »Faulpelz!« Es ist totenstill. Manni Öttersfeld erhebt sich mit auf den Tisch gestützten Händen, neigt den Kopf zur Seite, lächelt freundlich und sagt: »Angenehm, Öttersfeld!« Dann setzte er sich wieder hin. Es ist wiederum totenstill. »Kimme« Kimmenberg erbleicht und dreht ab.
Die Gewitztheit des Manni Öttersfeld erschien mir damals als mindestens ebenso bewundernswert wie seine Kaltblütigkeit. Dass er sich traute, die Attacke des gefürchteten Lehrers zu parieren, war das eine. Das andere war, dass er wusste, wie. Mit ein paar Worten verwandelte er die Demütigung in eine Selbstbehauptung, das Drama in eine Farce. Das erschien mir als ein großartiger und unbegreiflicher Zaubertrick.
Seitdem sind fünfzig Jahre vergangen. In der Zwischenzeit habe ich Psychologie studiert und anschließend als Psychotherapeut, Eheberater, Konfliktmoderator, Teamentwickler und Psychologielehrer Erfahrungen gesammelt. Wenn ich heute auf diese Situation blicke, habe ich das Gefühl, den Zaubertrick zu verstehen: Manni Öttersfeld manipulierte das Situationsverständnis der Beteiligten und veränderte dadurch die Gesprächsgrundlage. Wie ein raffinierter Kulissenschieber im Theater veränderte er durch eine »rückwirkende Umdeutung des Interaktionsformats« das Bühnenbild derart, dass ein ganz anderes Stück zur Aufführung gelangte, als sein Gegner beabsichtigte. Plötzlich und allein durch die Entgegnung »Angenehm, Öttersfeld!« erschien der Angreifer mit seiner Attacke nicht länger, wie von ihm geplant, als tobender Racheengel im Rahmen einer »einseitigen Zurechtweisung«, sondern – zack! – gegen seinen Willen als sich selbst bezichtigender Trottel im Rahmen einer »wechselseitigen Vorstellung«. Durch die kunstvolle Verdrehung des Situationsverständnisses mittels zweier Worte wurde der Kimmenberg’sche Speer zum Bumerang.
Die zentrale Bedeutung unseres meist unbewussten Situationsverständnisses für den Verlauf und das Erleben unserer Gespräche, für das Gelingen, Schlingern, Kippen, Scheitern und Wiederaufleben von Kommunikation, hat mich über die Jahre beruflich und privat fortlaufend fasziniert. Wir alle erleben unsere alltäglichen Gespräche ja stets eingebettet in einen situativen Rahmen. Wir begegnen einander nicht im luftleeren Raum, sondern an konkreten Orten, bei konkreten Anlässen, mit konkreten Beteiligten, die über konkrete Themen sprechen. Wie selbstverständlich gehen wir meistens davon aus, dass sich diese konkreten Situationen allen Beteiligten genauso darstellen wie uns. Wir halten es für ausgemacht, dass unsere situationsbezogenen Vorannahmen hinsichtlich des Orts, des Anlasses, der Besetzung und des Themas des Miteinanders alternativlos sind und deshalb von allen vernünftigen Menschen geteilt werden müssen. Aus diesem vermeintlich »selbstverständlichen« Situationsverständnis leiten wir Vorschriften für angemessenes Denken, Sprechen und Verhalten ab, die uns ihrerseits wiederum als gegeben, »natürlich« und »normal« erscheinen. Indem wir ihnen folgen, werden wir selbst zu Kulissenschieber:innen, denn durch unser Verhalten lassen wir genau jene Situationen lebendig werden, in denen wir uns zu befinden glauben: Wer über eine Bemerkung lacht, lässt sie als Witz erscheinen und wer sich über sie empört, inszeniert sie als Beleidigung. Wir erwarten, dass auch unsere Gegenüber sich an die für »natürlich« und »allgemeingültig« gehaltenen Normen halten. Tun sie das nicht, erklären wir sie schnell für dumm, gestört oder böswillig und behandeln sie entsprechend. Dadurch werden Beziehungen vergiftet. Dass andere vielleicht von anderen situationsbezogenen Vorannahmen ausgehen, dadurch ein anderes Situationsverständnis entwickeln, deshalb anderen Normen folgen und schließlich anderes für angemessen halten, kommt uns selten in den Sinn. Und selbst wenn wir diese Möglichkeit einmal einräumen, fällt es uns häufig schwer, die unserem Befremden zugrunde liegenden Unterschiede im Situationsverständnis sichtbar, unsere Vorannahmen besprechbar und unterschiedliche Sichtweisen überbrückbar zu machen.
Die Entwicklung unseres Situationsverständnisses in Gesprächen ist das Thema dieses Buches. Es will Antworten auf die folgenden Fragen geben:
Wie entstehen unsere persönlichen Vorannahmen zum situativen Kontext unserer Gespräche? (
Kap. 1
–
3
)
Wie fügen sich diese Einzelteile zu einem zusammenhängenden Situationsverständnis? (
Kap. 4
–
7
)
Wie lenkt unser Situationsverständnis unser Verhalten und unsere Erwartungen an das Verhalten anderer im Gespräch? (
Kap. 8
–
9
)
Wie lassen wir im Gespräch unser eigenes Situationsverständnis wirksam werden und wie beeinflusst uns das der anderen? (
Kap. 10
)
Wie stimmen wir unser Situationsverständnis mit dem unserer Gesprächspartner:innen so ab, dass ein »gemeinsamer Nenner« entsteht? (
Kap. 11
)
Wie können wir die Beteiligten unterstützen, wenn sie allein nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen bzw. in Sackgassen feststecken? (
Kap. 12
).
Die Antworten auf diese Fragen beschreiben den Prozess des Kontextualisierens von Kommunikation. In diesem Prozess geben wir unseren Gesprächen ihren Rahmen, auch wenn es uns häufig so vorkommt, als würden wir diesen Rahmen »schlüsselfertig« vorfinden. Vom Gelingen dieses Prozesses hängt das Gelingen unserer Gespräche wesentlich ab. In diesem Prozess spielen kognitive und kommunikative Aspekte eine Rolle: Im Rahmen der »Kontextermittlung« entwickeln wir als Einzelne unser Situationsverständnis, indem wir unsere kontextbezogenen Wahrnehmungen ordnen und zusammenfügen. Im Rahmen der »Kontextvermittlung« lassen wir einander wissen, von welchem Situationsverständnis wir jeweils ausgehen. Im Verlauf der »Kontextverhandlung« arbeiten wir an einem gemeinsamen Situationsverständnis. Der Begriff »Kontextualisierung« umfasst alle drei Aspekte und ihr Wechselspiel.2
Natürlich bin ich nicht der Erste, der sich Fragen zum Verhältnis von Kommunikation und Situationsverständnis stellt. Viele, viele Kolleg:innen aus (mindestens) Philosophie, Linguistik, Soziologie, Ethnologie und Psychologie haben darüber nachgedacht, geforscht und geschrieben.3 Ich versuche in diesem Buch, den mir bekannten Teil des vorliegenden Wissens zum Prozess des Kontextualisierens so zu ordnen und zu ergänzen, dass sich ein übersichtliches Gesamtkonzept und ein praxistauglicher Handwerkskoffer für jene ergeben, die alltäglich an der Gestaltung dieses Prozesses beteiligt sind. Mein Konzept stelle ich der Einfachheit halber wie ein Geschichtenerzähler vor – Schritt für Schritt, als wäre es »aus einem Guss«, »auf meinem Mist gewachsen« und »das einzig wahre«. Ich verbanne den Großteil der Hinweise auf die Vordenker:innen und die zugrunde liegenden Studien, Theorien und Fachdiskussionen in die Anmerkungen und damit ans Ende des Buches, um nicht von vornherein mit zu vielen Details zu verwirren. Sie können das Buch dementsprechend mindestens auf zwei verschiedene Weisen lesen: »naiv«, d. h. als »Konzept an sich«, ohne Berücksichtigung der Anmerkungen und damit des fachlichen Diskurses, oder »kritisch«, d. h. als »ein mögliches Konzept unter vielen anderen denkbaren«, unter Berücksichtigung der Anmerkungen.
Ich stelle mir vor, dass die folgenden Seiten für Sie als Leser:in interessant und nützlich sein könnten, wenn Sie …
als professionelle:r Berater:in in den Bereichen Psychotherapie, Coaching, Mediation, Teamentwicklung und Moderation tätig sind. Das Buch will vor allem Ihre Treffsicherheit bei der Diagnose von Störungen im Prozess des Kontextualisierens erhöhen. Zusätzlich sollte auch Ihr Handwerkskoffer nach der Lektüre noch differenzierter bestückt sein als vorher. Vielleicht beobachten Sie, dass Ihnen – beispielsweise bei den kommunikationspsychologischen Standardinterventionen »aktives Zuhören« und »Doppeln« – häufiger pointierte Formulierungen gelingen, die kontextbezogene Vorannahmen differenziert beleuchten und dadurch Ihren Klient:innen die Augen öffnen und ein neues Situationsverständnis erschließen. Zu Ihrer leichteren Orientierung sind Interventionsempfehlungen im Text durch einen gerahmten Kasten extra kenntlich gemacht.
als Fachkolleg:in aus dem psychologischen, soziologischen, linguistischen, ethnologischen oder einem anderen Feld einen geordneten Überblick über jene Kontextualisierungsphänomene erwarten, die in unseren Fachsprachen häufig als »kommunikatives Framing« bezeichnet werden und in unseren Wissenschaften zwar mit viel Verstand und faszinierenden Resultaten, leider aber mit wenig Kohärenz untersucht werden.
»nur« als täglich und lebenslang betroffener Mensch Interesse am Thema haben. Dann wäre es der Anspruch dieses Buches, dass Sie ein vertieftes Verständnis für die Dynamik von Gesprächen, erweiterte Kompetenzen bei der Verständigung mit anderen und eine gewachsene Kritikfähigkeit mit Blick auf manipulative Kulissenschieber:innen gewinnen.
Ich habe viele Beispiele und Bilder in den Text eingebaut. Sie haben mir beim Schreiben geholfen, angesichts der Komplexität und Abstraktheit der vielen gleichzeitig wirksamen und miteinander wechselwirkenden Bestandteile im Prozess des Kontextualisierens den Überblick zu gewinnen und zu behalten. Ich hoffe, dass sie Ihnen nun auch das Lesen erleichtern.
Als Autor komme ich um die Wahl eines im Text verwendeten generischen Genus nicht herum, wenn ich auf den (in dieser Einleitung verwendeten) Doppelpunkt und andere das Lesen verkomplizierende Konstruktionen verzichten möchte. Angesichts unübersehbarer Hinweise auf die diskriminierenden Auswirkungen jeder einseitigen Verwendung eines generischen Genus benutze ich in den folgenden Kapiteln abwechselnd das generische Maskulinum und das generische Femininum.
Nun also beginnt die Aufklärungsarbeit in Sachen »Manni Öttersfeld«.
1 Wahrnehmen, Denken, Sprechen: Grundbegriffe
Zu Beginn unserer Expedition möchte ich Sie zum morgendlichen Brötchenholen mitnehmen, um die Verwendung einiger zentraler Begriffe rund ums »Wahrnehmen«, »Denken« und »Sprechen« in diesem Buch zu erläutern:
Beispiel 2: Zwei Mohn, zwei Roggen, ein Laugen!
Wenn ich morgens zum Bäcker gehe, um Brötchen zu holen, höre und sehe ich unterwegs vieles: Die Straße ist nass, wahrscheinlich hat es geregnet. An der Bushaltestelle stehen drei Menschen, der Bus ist anscheinend noch nicht gekommen. Ein Vogel fliegt vorbei, aha, die Stare sind aus dem Winterquartier zurück. Die Kirchturmuhr schlägt einmal – schon Viertel nach sieben. Die Fußgängerampel ist rot – besser stehen bleiben!
Auf dem Weg zur Bäckerei zeige ich eine Vielzahl von Verhaltensweisen: Ich gehe, ich schaue rechts und links, ich halte inne, ich stolpere über einen Stein, ich weiche einer unbekannten entgegenkommenden Person aus, ich grüße den Nachbarn Fassunke auf der anderen Straßenseite und übersehe den Nachbarn Passerath, der an mir vorbei geht.
Als ich in der gerammelt vollen Bäckerei endlich an der Reihe bin, fragt mich der Verkäufer: »Wie viele Brötchen dürfen es denn sein?« Ich antworte knapp: »Fünf: zwei Mohn, zwei Roggen, ein Laugen!« Daraufhin murmelt der Verkäufer leise: »Vor Danke kommt Bitte«. Dann nimmt er zwei Mohnbrötchen, zwei Roggenbrötchen und ein Laugenbrötchen, steckt sie in eine Tüte und reicht sie mir mit den Worten: »Eile mit Weile!«.
Mit meiner Brötchentüte stelle ich mich schließlich in die Schlange an der Kasse und denke über meine Pläne für den Tag nach. Bis mich der Kunde hinter mir mit einem Grinsen im Gesicht anspricht: »Die junge Frau an der Kasse, die sie gerade fixieren, ist übrigens meine Schwester. Die ist glücklich verheiratet. Machen Sie sich mal keine Hoffnungen!« Ich bin erst verwirrt, dann genervt – kann man hier nicht mal unschuldig vor sich hinträumen?
In diesem Beispiel ereignen sich eine Reihe alltäglicher und dennoch erstaunlicher Vorgänge, ohne die es die in diesem Buch beschriebenen Phänomene nicht geben könnte: Menschen nehmen etwas wahr, verbinden Bedeutungen mit dem Wahrgenommenen und geben einander etwas zu verstehen. Ohne diese Vorgänge wäre die Entwicklung eines gemeinsamen Situationsverständnisses undenkbar. Weil sie grundlegend für unser Thema sind, machen wir anhand des Beispiels zwei kleine Exkurse. Wir beginnen mit einem kognitionspsychologischen Exkurs, bei dem es darum geht, zentrale Begriffe rund um das Phänomen der Wahrnehmung zu klären. Darauf folgt ein sozialpsychologischer Exkurs, bei dem zentrale Begriffe rund um das Phänomen der Kommunikation geklärt werden. Alle genannten Begriffe finden Sie auch am Ende des Buches im Glossar zum Nachschlagen.
1.1 Wahrnehmung: Schemata und Konzepte
Auf meinem morgendlichen Spaziergang und anschließend in der Bäckerei nehme ich verschiedene Dinge, Sachverhalte und Vorgänge wahr: die nasse Straße, den Star, die Bushaltestelle mit drei Menschen, das Schlagen der Kirchturmuhr, die Bemerkungen des Bäckers etc. Dazu muss ich im Meer der mich ständig umgebenden Reize Ordnung schaffen, indem ich Muster erkenne und bedeutsame Einheiten herausfische.
Kognitive Schemata
Unser Wissen um »bedeutsame Einheiten« entwickeln wir alle im Lauf unseres Lebens in Form von Wahrnehmungs-, Ordnungs-, Denk- und Handlungsmustern. Wir nennen sie »kognitive Schemata«. Mittels solcher Schemata betten wir gleichzeitig oder nacheinander auftretende Reize in einen sinnstiftenden Zusammenhang ein.4 Beispielsweise erkennen Sie als Leser gerade in der Verteilung von schwarzen und weißen Bildanteilen auf dieser Seite des Buches unterschiedliche »Buchstaben«. Als Leser aus Deutschland ordnen Sie diese Zeichen dabei einer von 60 Buchstabenkategorien zu (das 26-teilige Alphabet ergänzt um 3 Umlaute und das »ß«, jeweils in Groß- und Kleinschreibung). Zusätzlich wissen Sie, dass einige andere Elemente (!?%$#123) nicht zur Kategorie »Buchstabe« gehören, sondern »Satzzeichen«, »Symbole« und »Zahlen« sind. Ohne Identifikation der Zeichengestalten und Anwendung der Kategorisierungsschemata »Alphabet«, »Groß- und Kleinschreibung« und »Buchstaben – Zahlen – Satzzeichen – Symbole« wären Sie gar nicht in der Lage, diesen Text zu entziffern. Damit Sie ihn lesen können, braucht es noch die Identifikation von »Zeilen«- und darin von »Wort«-Gestalten, die Sie verschiedenen Wortarten (Substantiv, Verb, Adjektiv …) und grammatikalischen Kategorien (Subjekt, Prädikat, Objekt …) zuordnen können und mit denen Sie eine Definition verbinden. Nur durch die Verwendung all dieser kognitiven Schemata entsteht aus der Verteilung von Bildanteilen Sinn. Und so bliebe allgemein ohne die Strukturierungshilfe kognitiver Schemata unsere Wahrnehmung chaotisch, unser Denken haltlos und unser Handeln unkoordiniert. Kognitive Schemata erschaffen, steuern und begrenzen unsere Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsfähigkeit. Das bedeutet auch, dass wir nur das wahrnehmen können, was wir anhand unserer Schemata zu identifizieren vermögen. Alles andere bleibt für uns unsichtbar. In diesem Sinne ist jedes Erkennen ein »Wiedererkennen«.5 Wir unterscheiden:
Wahrnehmungsschemata (Gestalten):
Wenn Sie sich nach einem Stromausfall im Dunkeln durch ihre Wohnung bewegen, werden Sie zunächst langsam vorgehen, weil Ihr Wahrnehmungsapparat unter den ungünstigen Bedingungen eine Zeit lang braucht, um anhand der sich bietenden Grau- und Schwarztöne Umrisse zu erkennen und »Gestalten« heraus zu präparieren.
6
Sobald das gelingt, wird der Raum zur strukturierten Landschaft, in der begrenzte Ganzheiten vor-, hinter- und nebeneinander stehen, sodass Sie sich nun tastend vorwagen können. (Wenn Sie Ihren eigenen Wahrnehmungsapparat einmal bei der Gestaltbildung beobachten wollen, schauen Sie einfach an einem bewölkten Tag für ein paar Minuten in den Himmel – Sie werden unwillkürlich anfangen, im Wolkenmeer Gesichter, Tiere, Gegenstände etc. zu »entdecken«.) Die Gestaltwahrnehmung führt nicht nur dazu, dass wir gleichzeitig stattfindende Wahrnehmungen zu »Dingen« integrieren. Auch aufeinanderfolgende Wahrnehmungen integrieren wir zu »Verläufen«. So erscheinen uns Töne, die nacheinander in zeitlicher Nähe erklingen als »Melodie«; aufeinanderfolgende Zustände nehmen wir als »Bewegung« oder »Vorgang« wahr.
Ordnungsschemata (Kategorien):
Sicherer werden Sie, sobald Sie meinen, die Gestalten identifizieren zu können und nun wissen, dass der linke Schatten Ihr »Fernseher« ist und nicht Ihre »Stehlampe«. Jetzt können Sie sich vorsichtig zum nächsten Schatten, dem »Klavier« vortasten. So geht es weiter bis zur »Kellertür«, hinter der Sie auf der »Treppenstufe« die Umrisse einer aufrechtstehenden Stange als »Taschenlampe« erkennen. Die Zuordnung der Gestalten zu Kategorien nehmen Sie anhand bestimmter zur Kategorie gehörender Schlüsselreize vor: Stehlampen sind eher hoch als breit, bei Fernsehern ist es gerade umgekehrt. Die Gesamtheit der Reize, anhand derer sie eine Kategorie identifizieren, nennen wir deren »Register«. Häufig reichen schon einige Registeraspekte aus, um eine Gestalt einer Kategorie zuzuordnen. Gleichzeitig wissen Sie, welche Gestalten zur übergeordneten Kategorie der »Einrichtungsgegenstände« und welche zu den »Raumkomponenten« gehören. Mithilfe von Ordnungsschemata identifizieren wir sowohl Dinge wie auch Verläufe.
7
Gegenstandsschemata (Definitionen):
Dass Sie überhaupt nach der »Taschenlampe« suchen, verdankt sich Ihrer persönlichen Definition der Kategorie »Taschenlampe«, Ihrem Gegenstandsverständnis.
8
Sie gehen vielleicht davon aus, dass es sich dabei um eine »batteriebetriebene punktförmige Lichtquelle« handelt, die »vor allem in der Dunkelheit (bei Nacht, unter Tage, in unbeleuchteten geschlossenen Räumen) ausreichende Beleuchtung für eine erste Orientierung bietet und bei uns in der Regel Ihren Platz auf der obersten Stufe der Kellertreppe hat.« Definitionen machen aus Dingen »Gegenstände« und aus Zusammenhängen »Sachverhalte«. Sie informieren uns über Eigenschaften, Konstruktionsprinzipien und Funktionsweisen der kategorisierten Gestalten.
Handlungsschemata (Skripte):
Sobald Sie die Taschenlampe sehen, wird in Ihrem Kopf eine Gebrauchsanweisung wach: »Lampe so in die Hand nehmen, dass der Scheinwerfer vom Körper weg zeigt, mit dem Daumen nach dem Schalter suchen, diesen bewegen, bis die Lampe ihren Betrieb aufnimmt, anschließend die Hand so führen, dass der Lichtkegel den gewünschten Bildausschnitt erhellt. Sobald die Lichtverhältnisse es erlauben, Taschenlampe wieder ausschalten, um Batterie zu sparen, und an den Ausgangsort zurücklegen, damit sie beim nächsten Stromausfall sicher gefunden werden kann.« Skripte sagen uns, wie mit den definierten kategorisierten Wahrnehmungsgestalten, also den Gegenständen und Sachverhalten, angemessen umzugehen ist.
9
Konzepte
Gestalten, Kategorien, Definitionen und Skripte entwickeln sich in unserem kognitiven System netzwerkartig rund um alle Wahrnehmungsgegenstände im Verbund und wirken wechselseitig aufeinander ein. Wird eines der beteiligten kognitiven Schemata verändert, wirkt sich das meistens auch auf die damit verbundenen aus. Die Gesamtheit der mit einem Ding, Vorgang oder Ereignis verbundenen Schemata nennen wir sein »Konzept«.10 Sobald wir eine Wahrnehmung mit einem Konzept in Verbindung bringen, aktivieren wir alle damit verbundenen Gestalten, Kategorien, Definitionen und Skripte, die bei der Behandlung des Gegenstandes oder Sachverhaltes wie unsichtbare und nicht weiter hinterfragte Vorannahmen zum Einsatz kommen: »Herr Fassunke ist mein Nachbar, den ich zu grüßen habe, solange zwischen uns keine Verstimmung herrscht. Ein Star ist ein Zugvogel, der in unseren Breitengraden in den Monaten März bis September zu beobachten ist. Eine Bushaltestelle ist ein Ort, an dem sich vor dem Eintreffen eines Busses kleinere Ansammlungen von wartenden Fahrgästen aufhalten. Der Bäcker ist ein Handwerker, der Brot herstellt und es verkauft. Wenn wir miteinander sprechen, dann im Rahmen einer Bestellung.« Wenn Sie beim Spaziergang im Sonnenschein auf der Straße ein Blinken sehen, erkennen Sie beim Näherkommen ein daumennagelgroßes, kreisrundes, leuchtendes Etwas (Gestalt), das Sie nicht als »Unterlegscheibe« oder »Kronkorken«, sondern als »Münze« einordnen (Kategorie). Münzen gelten Ihnen als »wertvoll« (Definition), während Kronkorken in Ihrer Definition »wertlos« sind. Sie heben die Münze deshalb auf, während Sie einen Kronkorken hätten liegen lassen (Skript), und erkennen, dass es sich um eine »2-Euro-Münze aus dem Vatikan« (Kategorie) handelt. Sie wissen, dass der Vatikan ein »Zwergstaat« ist und Münzen aus sogenannten Zwergstaaten als selten und daher besonders wertvoll gelten (Definition), und beschließen, die Münze einzustecken und damit nicht ins Geschäft, sondern zum Münzhändler zu gehen (Skript). Hätten Sie ein anderes Konzept von Kronkorken (»Sammlerobjekte, die gelegentlich für Preise über 20 € ersteigert werden«) oder von sich selbst (»Kronkorkensammler«), hätten Sie sich auch nach einem Kronkorken gebückt.
Adaptation
Unsere Schemata und die aus ihnen gebildeten Konzepte bilden und verändern wir im Lauf unseres Lebens – wir adaptieren sie. Um die Veränderung dieser kognitiven Werkzeuge zu beschreiben, greifen wir auf das begriffliche Repertoire des französischen Biologen und Psychologen Jean Piaget (1992) zurück, der die Entwicklung kognitiver Strukturen bei Kindern untersucht hat: Nehmen wir als einfaches Beispiel ein »Kreis-Dreieck«-Kategorisierungsschema11: Ein Kind ordnet alle geometrischen Formen, die es wahrnimmt, einer von zwei ihm bekannten geometrischen Kategorien zu: Kreise oder Dreiecke. Das Kategorisierungsschema wirkt sich natürlich unmittelbar auf die Wahrnehmung aus: Das Kind sieht überall Dreiecke und Kreise und es übersieht leicht anders Geformtes. Wenn es nun unausweichlich mit einer Vierecksgestalt konfrontiert wird, erweist sich das Kreis-Dreieck-Schema als unzulänglich, da keine der beiden Kategorien der unbekannten Gestalt entspricht. In diesem Fall gerät die kognitive Struktur des Kindes unter Anpassungsdruck. Die Anpassung kann auf drei verschiedene Arten und Weisen geschehen:
Verleugnung:
Der Anpassungsdruck wird einfach ignoriert (das Kind »übersieht« das Viereck): Was nicht sein kann, das nicht sein darf! Verleugnen ist eine sehr effiziente, weil aufwandsarme Anpassungsstrategie, die sich vor allem dann bewährt, wenn irritierende Erfahrungen als vorübergehende Einzelereignisse auftreten. Ihr Risiko: Unbekanntes bleibt unerkannt.
Assimilation:
Das Problem wird mit dem vorhandenen Schema bearbeitet, gewissermaßen als Sonderfall des schon Bekannten (das Kind zeichnet in das Viereck eine Diagonale hinein und identifiziert das Viereck nun als »Doppeldreieck«). Assimilation hat den Vorteil, dass ein bestehendes Schema nicht verändert werden muss. Ihr Risiko: Die Assimilation kann das Wahrgenommene bis zur Unkenntlichkeit entstellen, was zwangsläufig zu Scheinlösungen führen muss – wer nur einen Hammer hat, dem erscheint bekanntlich jedes Problem als Nagel.
Akkommodation:
Das Schema wird so verändert, dass es den neuen Eindrücken gerecht werden kann (das Kind ergänzt sein Schema um die Kategorie »Viereck«). Akkommodation kann aufwändig sein und mit Verwirrung und Orientierungslosigkeit einhergehen; langfristig führt sie bei beständig auftretenden Irritationen aber zu einer verbesserten Kompatibilität von Schema und Umwelt.
Die Entwicklung und Festigung kognitiver Schemata und Konzepte vollzieht sich mittels Verleugnung, Assimilation und Akkommodation im Zusammenspiel von biologischen Gegebenheiten, psychischen Prozessen und Anforderungen aus der physikalischen und sozialen Umwelt: So hat sich das vorherrschende Männer- und Frauenbild, also Definitionen innerhalb der Kategorien »Mann« bzw. »Frau«, in Deutschland innerhalb der letzten hundert Jahre stark verändert und damit auch die Erwartungen daran, wie Männer und Frauen sich zu verhalten haben und wie mit ihnen angemessen umzugehen ist. Die entsprechenden Skripte wurden umgeschrieben. Auch die Kategorisierung von Menschen nach ihrem Geschlecht, die in unserer Gesellschaft bis vor wenigen Jahren wie selbstverständlich im binären »Mann-Frau«-Schema vorgenommen wurde, ist Veränderungen unterworfen.12
Konzepte filtern und fokussieren unsere Wahrnehmung. Sie entscheiden, von welchen Unterscheidungen wir uns leiten lassen und welche wir vernachlässigen. Sie rücken manche Aspekte des Wahrgenommenen in den Vordergrund und andere in den Hintergrund.13 Wegen dieser Wirkung lassen sie sich mit Brillen oder Rahmen vergleichen. Die Frage, durch welche Konzeptbrille wir gerade schauen bzw. im Rahmen welcher Gestalten, Kategorien, Definitionen oder Skripte wir uns gerade bewegen, wirkt sich erheblich darauf aus, wie und was wir suchen, was wir finden, wie wir über das Gefundene nachdenken und sprechen und was wir damit anfangen können. Wir können die Welt und damit auch den Kontext unserer Gespräche nur in den Grenzen unserer Konzepte erkennen – wie eine Leitplanke geben sie Orientierung und Begrenzung in einem. Der kognitive Prozess der »Kontextermittlung« wird durch unsere einschlägigen Konzepte kanalisiert. Und wir müssen damit leben, dass unsere Konzepte beständig unter Anpassungsdruck geraten – nicht zuletzt dadurch, dass wir mit anderen Menschen reden und uns mit deren Konzepten auseinandersetzen müssen. So scheint der Bäcker in seinem Konzept der Kunden-Bäcker-Beziehung ein Skript zu verwenden, das hinsichtlich des angemessenen Tons für Bestellungen anders aussieht als meines (»Vor Danke kommt Bitte«).
1.2 Kommunikation: Äußerungen und Bedeutungen
Nachdem wir nun geklärt haben, wie wir zu unseren kontextbezogenen Wahrnehmungen kommen, wenden wir uns als nächstes der Frage zu, was eigentlich gemeint ist, wenn wir über »Kommunikation« sprechen.14
Signale
Die Beobachtungen, die ich auf meinem Morgenspaziergang mache (nasse Straße, drei Menschen an der Haltestelle, ein Vogel, rote Ampel), kann ich für sich stehen lassen oder ihnen eine Bedeutung beimessen. Wenn ich sie als Hinweis auf etwas über sie Hinausgehendes begreife, werden sie mir zu Indizien, die ein Signal aussenden. Ob eine Beobachtung ein Indiz ist und ein Signal aussendet – das kann zwischen mir und einem anderen Beobachter allerdings strittig sein: »Die drei Leute an der Bushaltestelle waren nur Bauarbeiter, deren Anwesenheit nichts über die Ankunft des Busses aussagt, und der Vogel war eine Amsel, aus deren Anwesenheit sich keine Information über die Jahreszeit ergibt – hör doch mit der Kaffeesatzleserei auf!«
Bedeutungen
Die nasse Straße könnte ich als Hinweis auf einen Feuerwehreinsatz, einen Wasserrohrbruch, einen Regenschauer oder den Einsatz der Straßenreinigung verstehen. Ich entscheide mich für »Regenschauer«. Die Gesamtheit der Vorstellungsinhalte (Kognitionen), die ich mit einem Signal (oder einem Signalbündel bzw. einer Signalfolge) verbinde, soll dessen »Bedeutung(en)« oder »Botschaft(en)« heißen.
Codes
Signale vermitteln ihre Bedeutung nur dem, der sie versteht. Man muss unser Uhrzeitsystem mit seiner Zählweise von täglich zweimal zwölf Stunden und stündlich vier Viertelstunden kennen, um den einen Glockenschlag als Zeitangabe (»Viertel nach«) deuten zu können. Alle Signalsysteme, mittels derer Bedeutungen übermittelt werden, sollen hier »Codes« heißen. Es gibt Codes unterschiedlichster Signalarten: Symbole (z. B. männliche und weibliche Silhouetten auf Restaurant-WCs), Zahlen (z. B. in mathematischen Formeln), Wörter (in den Sprachen dieser Welt), nonverbales Verhalten (Gesten, Gesichtsausdrücke, Augenkontakt), paraverbales Verhalten (Sprachmelodie und Sprechrhythmus), Verhaltensweisen (einen bestimmten Satz sagen, ein bestimmtes Thema wählen, eine bestimmte Tätigkeit ausführen), situative Konfigurationen (ein bestimmter Raum, ein bestimmter Teilnehmerkreis, eine bestimmte Sitzordnung, eine bestimmte Tageszeit) sowie Ausstattungsmerkmale (z. B. eine bestimmte Kleidung oder Möblierung). Ein Signal kann auch mehrere Codes gleichzeitig bedienen: Das Läuten der Kirchenglocken kann im Rahmen der Codes »Uhrzeit« (»Viertel nach sieben«), »Liturgische Information« (»Beerdigung«) oder »Katastrophenwarnung« (»Sturmflut«) gedeutet werden.
Semantik
Die Bedeutung eines Signals innerhalb eines Codes kann zwischen mir und einem anderen Beobachter strittig sein: »Dass die Kirchturmuhr einmal geschlagen hat, zeigt lediglich, wie stürmisch es heute ist, und dass die Fußgängerampel immer noch auf Rot steht, zeigt leider, dass sie seit dem Auftreten des Defekts vor drei Wochen noch nicht repariert worden ist.« Die Zuordnungsvorschriften von Bedeutungen zu Signalen innerhalb eines Codes nennen wir dessen »Semantik«.
Handlungen
Auf dem Weg zur Bäckerei verhalte ich mich: Ich gehe, ich schaue rechts und links, ich halte inne, ich stolpere über einen Stein, ich weiche einer unbekannten entgegenkommenden Person aus, ich grüße den Nachbarn Fassunke auf der anderen Straßenseite und grüße nicht den Nachbarn Passerath, der an mir vorbei geht. Manche dieser Verhaltensweisen führe ich willkürlich, mit Absicht, aus – dann soll von »Handlungen« die Rede sein. Ob mein Verhalten eine Handlung ist oder nicht, kann zwischen mir und einem Beobachter allerdings strittig sein: »Du bist ja absichtlich gestolpert!« – »Das stimmt doch gar nicht!«
Interaktion
Wenn meine Handlungen sich auf andere Menschen beziehen (wie z. B. beim Ausweichen angesichts einer entgegenkommenden Person oder beim Grüßen) nennen wir sie »soziale Handlungen«. Wenn zwei Menschen soziale Handlungen aufeinander beziehen (wie z. B. zwei Nachbarn, die einander grüßen), sprechen wir von »Interaktion«. Ob eine Handlung sozial ist oder nicht bzw. ob sie Teil einer Interaktion ist, kann wiederum strittig sein: »Du hast Herrn Passerath absichtlich übersehen!« – »Wie kommst du auf so einen Quatsch?«
Äußerungen: Symptome und Mitteilungen
Wenn ich an der roten Fußgängerampel stehen bleibe, auch wenn gerade kein Auto zu sehen ist, könnte man das als Hinweis darauf deuten, dass ich die Straßenverkehrsordnung in Deutschland nicht nur kenne, sondern auch buchstabengetreu befolge. Wer mein Verhalten auf diese Weise als bedeutungsvolles Signal deutet, das (innerhalb eines verhaltensbezogenen Codes) eine Botschaft transportiert, interpretiert es als »Äußerung«. Meine Äußerungen lassen sich als unbeabsichtigte »Symptome« begreifen, durch die ich ungewollt über etwas informiere oder als gewollte »Mitteilungen«, durch die ich anderen mit Absicht etwas zu verstehen geben will: »Du gehst, ohne es zu merken, relativ schnell, das zeigt als Symptom, dass du in Eile bist. Deinem Nachbarn gibst du absichtlich durchs Übersehen zu verstehen, dass du von seinen lauten Feierlichkeiten um Mitternacht genervt bist.« Sobald wir davon ausgehen, dass Menschen ihre Verhaltensweisen wechselseitig als bedeutungshaltige Äußerungen meinen und/oder interpretieren, mit denen sich Botschaften verbinden, sprechen wir von »Kommunikation«.15 Ob ein Verhalten eine Äußerung ist, ob sie als Symptom oder als Mitteilung zu verstehen ist und welche Botschaften gegebenenfalls damit verbunden sind – darüber lässt sich natürlich wieder streiten: »Blödsinn – ich gehe immer so schnell und den Nachbarn habe ich wie gesagt einfach nicht gesehen.«
Funktionen von Äußerungen
Meine Äußerung rund um die Wortansammlung »Fünf: zwei Mohn, zwei Roggen, ein Laugen!« deutet der Verkäufer anscheinend unter Berücksichtigung verschiedener Codes vierfach: Zunächst interpretiert er zu meiner Überraschung (1) das Ausbleiben des Höflichkeitspartikels »bitte« (also ein Signal im Code »Wortwahl/Satzkonstruktion«) als Hinweis auf mein Beziehungsverständnis – so war es gar nicht gemeint. Er fühlt sich nicht richtig behandelt und lässt mich durch seinen gemurmelten Kommentar (»Vor Danke kommt Bitte«) wissen, welche Art der Ansprache ihm angemessener erschienen wäre. Anschließend interpretiert er (2) den Inhalt meiner sprachlichen Äußerung (also Signale im Code »deutsche Sprache«) wie erwartet in meinem Sinn als Beschreibung der gewünschten Backwaren. Wiederum in meinem Sinn deutet er dann (3) die Form meiner Aussage (also ein Signal im Code »Handlungsformat«) als Bestellung bzw. Aufforderung, der er nachkommt. Und schließlich versteht er (4) zu meiner Überraschung die Länge und Geschwindigkeit meiner Aussage (also Signale in den Codes »Wortwahl« und »Sprechtempo«, vielleicht zusätzliche Hinweise in den Codes »Prosodie«, »Atemfrequenz« und »Blickrichtung«) als symptomatischen Hinweis darauf, dass er es mit einem gehetzten Kunden zu tun hat (»Eile mit Weile«). Seine Deutungen teilt er mir nicht explizit mit, sondern ich erschließe sie aus seinen entsprechenden Reaktionen, die ich wiederum als deutbare Äußerungen interpretiere. Die vierfache Deutung meiner Äußerung durch den Verkäufer ist kein Zufall; in ihr spiegelt sich die Tatsache, dass Kommunikation stets vier Funktionen gleichzeitig übernimmt (s. Tab. 1: Die vier Funktionen von Kommunikation16):
1)
Kontextualisierung:
Im Rahmen der »Kontextualisierungsfunktion« von Kommunikation lassen sich Äußerungen immer auch als Träger von Vorannahmen begreifen, die das Situationsverständnis des Senders spiegeln und als »Inszenierungsversuch« im Rahmen der »Kontextvermittlung« wirksam werden lassen (»Wir sind offensichtlich in einer ›Bäckerei‹ in ›Deutschland‹, in der wir als ›Kunde‹ und ›Dienstleister‹ eine ›Bestellung‹ abwickeln, wobei ›Brötchen‹ als ›Ware‹ anscheinend in ›Einzelstücken‹ verkäuflich und die Sorten ›Laugen‹, ›Mohn‹ und ›Roggen‹ klar unterscheidbar sind«).
2)
Darstellung:
Im Rahmen der »Darstellungsfunktion« von Kommunikation lassen sich Äußerungen als Aussagen verstehen, die über Sachverhalte zum expliziten Thema informieren (»Die Bestellung umfasst fünf Brötchen insgesamt, davon je zwei der Sorten ›Roggen‹ und ›Mohn‹ und eines der Sorte ›Laugen‹«).
3)
Handlung:
Im Rahmen der »Handlungsfunktion« von Kommunikation können Äußerungen als Appelle verstanden werden, die einem bestimmten Zweck dienen (»Der Kunde möchte, dass ich die bestellte Ware vollständig, umgehend und kommentarlos eintüte«).
4)
Ausdruck:
Im Rahmen der »Ausdrucksfunktion« von Kommunikation lassen sich Äußerungen als symptomatische Selbstoffenbarungen deuten, die unmittelbar über das Innenleben des Sprechenden informieren (»Der Kunde ist hungrig, schlecht gelaunt und unter Zeitdruck«).
17
Funktion
Botschaft
Gegenstand
Kontextualisierung
Vorannahme
Situation
Darstellung
Aussage
Thema
Handlung
Appell
Zweck
Ausdruck
Selbstoffenbarung
Sender
Tab.1: Die vier Funktionen von Kommunikation
Im Rahmen der Kontextualisierungsfunktion übermitteln wir Vorannahmen zur Situation. Im Rahmen der Darstellungsfunktion machen wir Aussagen zum Thema. Im Rahmen der Handlungsfunktion senden wir zweckdienliche Appelle. Im Rahmen der Ausdrucksfunktion übermitteln wir symptomatische Selbstoffenbarungen.
Da jede Äußerung stets auf allen vier Ebenen und mithin sowohl als Vorannahme wie auch als Aussage, Appell oder Selbstoffenbarung deutbar ist, kann der Verkäufer immer mindestens vier Arten von Botschaften aus jeder von mir getätigten Äußerung herausdeuten und entsprechend reagieren.
Grundsätzlich hat der Empfänger eine Wahl- und Deutungsfreiheit hinsichtlich der Äußerungen des Senders: Auf welche der vier Funktionen er besonderes Gewicht legt und wie er die empfangenen Äußerungen deutet, bleibt ihm weitgehend überlassen.
Kommunikationspflichtigkeit
Die Deutung meines Vor-mich-hin-Träumens in der Warteschlange durch den Bruder der Kassiererin verweist noch einmal auf eine Grundbedingung des Miteinanders: Jedes Verhalten, das ein Mensch in Gegenwart eines anderen zeigt, kann von Beobachtern als Äußerung (Symptom oder Mitteilung) (miss-)verstanden werden. In diesem Sinne steht alles, was wir in Anwesenheit anderer tun und lassen, unter dem Vorbehalt, als Kommunikation gelten zu können. Es reicht im Zweifelsfall ein Beobachter, der ein Verhalten als kommunikativ deutet, um es dazu werden zu lassen. Deshalb sind wir in Anwesenheit anderer immer auch damit beschäftigt, deren potenzielle Deutungen unseres Verhaltens ins Kalkül zu ziehen und unser Verhalten daran auszurichten, wodurch wir zwangsläufig unseren Teil dazu beitragen, tatsächlich in Kommunikation einzusteigen. Diese potenzielle »Kommunikationspflichtigkeit« allen Verhaltens in Anwesenheit anderer kann wegen der damit verbundenen kontinuierlichen Selbstaufmerksamkeit als anstrengend und belastend erlebt werden und lässt Alleinsein manchmal als echte Erholung erscheinen.18
Wenn wir nun im weiteren Verlauf unserer Expedition die Begriffe »Gespräch«, »Austausch« und »Reden« benutzen, dann meinen wir damit »Kommunikation im weiteren Sinne« – also Verhaltensweisen und Interaktionen, in denen und durch die aus der Sicht von Beobachtern Äußerungen getätigt und interpretiert werden. Dieser Austausch kann genauso gut wortsprachlich erfolgen wie in jedem anderen funktionierenden Code.19
Tatsächlich verläuft Kommunikation meistens in mehreren Codes parallel: Ich mache eine Aussage (»Fünf!)«, wähle dazu ein Sprechtempo, eine Sprechmelodie und einen Sprechrhythmus, entscheide mich für einen Gesichtsausdruck, für bestimmte Gestik und Mimik, tue das an einem gewählten Ort, zu einer gewählten Zeit, gegenüber einem gewählten anderen und lasse all das in einer gewählten Kostümierung und einem bestimmten räumlichen Arrangement geschehen. Dadurch wird es möglich, komplexe Äußerungen auszutauschen, die viele Signale gleichzeitig transportieren und als ganzes Bündel von Botschaften ausdeutbar sind. Und es eröffnet sich die Option, vielschichtig zu kommunizieren: Eine Botschaft kann die andere ergänzen, kommentieren, umdeuten oder konterkarieren. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Bedeutung des Gesagten (also der Aussage) von der Bedeutung des Sagens (also dem Akt des Aussprechens dieser Aussage) abweicht: Der Satz »Danke, ich bin satt!« bedeutet im Code »deutsche Sprache«, dass »Ich« keinen Hunger mehr hat. Das Aussprechen dieses Satzes kann aber im Code »höfliches Sprechen« bedeuten »Ich habe großen Hunger und würde gerne noch nachdrücklicher zum Essen eingeladen werden.«20
Schließlich kann es jederzeit vorkommen, dass die Beteiligten uneins darüber sind, ob überhaupt kommuniziert wird und welchen Stellenwert bzw. welche Bedeutungen die vermeintlichen Äußerungen haben. Der Status eines Verhaltens als »Kommunikation« und seine Bedeutungen sind niemals einfach gegeben, sondern entstehen immer durch die Zuschreibung der Beteiligten. Das macht es einmal möglich, Mitteilungen zu machen, ohne sich zu ihnen zu bekennen (»Tut mir leid, dass ich Sie übersehen habe, Herr Passerath – war keine Absicht!«) und umgekehrt Verhalten als Mitteilung zu deklarieren, das gar nicht als solche gedacht war (»Natürlich haben Sie mich absichtlich übersehen, mein Lieber! Tun Sie nicht so scheinheilig!«). Es ist jederzeit möglich, Bedeutungen zu unterstellen oder zu bestreiten. Kommunikation ist aufgrund der Vielfalt ihrer Funktionen und Codes und der beinahe unendlichen Deutbarkeit ihrer Signale ein komplexes Spiel.
2 Wer redet, wählt: Selektion und Angemessenheit
In diesem Kapitel betrachten wir Kommunikation als ein Selektionsproblem und fragen: Wie schaffen wir es, aus der Unendlichkeit möglicher Gesprächsbeiträge jene auszuwählen, die wir schlussendlich veröffentlichen? Dazu lernen wir in Abschnitt 2.1 vier psychologisch wirksame Kriterien kennen, die uns bei der Auswahl unserer Mitteilungen leiten. Im Abschnitt 2.2 wird eines dieser vier Kriterien genauer unter die Lupe genommen – die Angemessenheit.
2.1 Das Problem der Selektion
Spräche ein Durchschnittsmensch zeitlebens täglich lediglich 100 Sätze, dann würde er an seinem 70. Geburtstag auf gut 2,5 Millionen gesprochener Sätze zurückblicken. Das ist allerdings gar nichts im Vergleich zu der Anzahl aller nicht gesprochenen Sätze – sie ist unendlich groß. Und wenn diese Unendlichkeit gesteigert werden könnte, dann dadurch, dass jeder denkbare Satz natürlich auf viele verschiedene Weisen hätte geäußert werden können – laut oder leise, ernst oder humorvoll, auf Hochdeutsch oder Platt, respektvoll oder von oben herab und … und … und …
Im Alltag erleben wir die Unendlichkeit unserer kommunikativen Optionen nur selten als lähmende Überforderung. Andernfalls bräuchten wir ja vor und nach jeder Äußerung lange meditative Pausen und ein flüssiges Gespräch wäre undenkbar. Unser unkomplizierter Gesprächsalltag spricht dafür, dass wir über schnell und effektiv arbeitende Filter verfügen, die uns bei der Selektion unserer Mitteilungen im Gespräch leiten und dafür sorgen, dass uns der Großteil unserer Optionen noch nicht einmal bewusst wird.21 Wir gehen im Folgenden davon aus, dass jede von uns über vier derartige Filter verfügt, die anhand eines Beispiels erläutert werden sollen:
Beispiel 3: Ein Notfall?
Stellen Sie sich vor, Sie suchen die Praxis Ihrer Hausärztin auf, um sich wegen einer starken Erkältung mit leichtem Fieber krankschreiben zu lassen. Sie fühlen sich nach einer schlechten Nacht zerschlagen und Ihnen dröhnt der Kopf. Die Arzthelferin begrüßt Sie mit den Worten: »Ich hoffe, Sie haben viel Zeit mitgebracht! Leider ist die Praxis heute wirklich gerammelt voll – oder handelt es sich bei Ihnen um einen Notfall?« Ihnen gehen vier Antwortmöglichkeiten durch den Kopf: a) »Nein, ein Notfall ist es wahrscheinlich nicht, ich habe wohl einfach einen starken Infekt«, b) »Mann, ist das nervig! Mir ist hundeelend – und Sie können mir nichts Besseres als einen Platz in der Warteschlange anbieten? Das darf doch wohl nicht wahr sein!«, c) »Ich weiß ja, dass Sie tun, was Sie können! Ich habe Fieber, aber das macht ja wohl noch keinen Notfall. Wäre es vielleicht möglich, dass ich in der Zwischenzeit ein bisschen nach draußen gehe, um nicht das ganze Wartezimmer anzustecken, und Sie mich auf dem Handy anrufen, kurz bevor ich dran wäre?« und d) »Ich verstehe Sie ganz schlecht. Ich glaube, ich hatte einen Hörsturz auf dem rechten Ohr! Ob das wohl gefährlich ist?«
Wie werden Sie antworten?
Vermutlich werden Sie bei der Wahl Ihrer Antwort vier Kriterien berücksichtigen (s. Abb. 1: Vier Kriterien der Wahl)22:
Wahrheit
Welche Äußerungen stünden im Einklang mit Ihren Beobachtungen und Erlebnissen und könnten damit den Stempel »wahr« erhalten? Alle anderen wären mehr oder minder unzutreffend bzw. gelogen. Dieses Kriterium bezieht sich auf die Wahrnehmungen der Sprechenden und ist der Darstellungsfunktion von Kommunikation geschuldet. Sie würden vielleicht antworten: »Nein, ein Notfall ist es wahrscheinlich nicht, ich habe wohl einfach einen starken Infekt.«
Echtheit
Welche Äußerungen entsprächen Ihrer inneren Verfasstheit als Mensch und Ihrer aktuellen Stimmung und könnten damit den Stempel »authentisch« erhalten? Alle anderen wären mehr oder minder aufgesetzt bzw. verlogen. Dieses Kriterium bezieht sich auf die relativ stabilen Persönlichkeitseigenschaften und die mehr oder minder wechselhaften Stimmungen der Sprechenden und ist der Ausdrucksfunktion von Kommunikation geschuldet. Sie würden vielleicht antworten: »Mann, ist das nervig! Mir ist hundeelend – und Sie können mir nichts Besseres als einen Platz in der Warteschlange anbieten? Das darf doch wohl nicht wahr sein!«
Angemessenheit
Welche Äußerungen passen in den Rahmen der Situation und könnten damit den Stempel »angemessen« erhalten? Alle anderen wären mehr oder minder unangemessen bzw. »daneben«. Dieses Kriterium bezieht sich auf die Vorannahmen der Sprechenden hinsichtlich der geltenden Regeln in »Situationen wie diesen«. Es ist der Kontextualisierungsfunktion von Kommunikation geschuldet. Sie würden vielleicht antworten: »Ich weiß ja, dass Sie tun, was Sie können! Ich habe Fieber, aber das macht ja wohl noch keinen Notfall. Wäre es vielleicht möglich, dass ich in der Zwischenzeit ein bisschen nach draußen gehe, um nicht das ganze Wartezimmer anzustecken, und Sie mich auf dem Handy anrufen, kurz bevor ich dran wäre?«
Nützlichkeit
Welche Äußerungen würden die von Ihnen gewünschte Wirkung erzielen und könnten damit den Stempel »effektiv« erhalten? Alle anderen wären weniger zielführend oder sogar kontraproduktiv. Dieses Kriterium bezieht sich auf die Ziele der Sprechenden und ist der Appellfunktion von Kommunikation geschuldet. Sie würden vielleicht »mogeln« und antworten: »Ich verstehe Sie ganz schlecht, ich glaube, ich hatte einen Hörsturz auf dem rechten Ohr! Ob das wohl gefährlich ist?«
Abb.1: Vier Kriterien der Wahl
Die Sprecherin wählt die ihr passend erscheinende Äußerung unter Berücksichtigung der vier Kriterien Wahrheit (Symbol: Schwurhand), Authentizität (Herz), Angemessenheit (Rahmen) und Nutzen (Zielpfeil).
Im Idealfall wirken die vier Kriterien Wahrheit, Authentizität, Angemessenheit und Nützlichkeit wie ineinandergelegte Filter, die dafür sorgen, dass am Ende des Filtervorganges die eine sinnvolle (wahre, authentische, angemessene und nützliche) Äußerung übrigbleibt, die dann unmittelbar passend oder stimmig erscheint: »Das will, das muss gesagt sein – und zwar genau so!« Viel häufiger wird allerdings der Fall eintreten, dass es keine Variante gibt, die alle vier Bedingungen perfekt erfüllt, sodass abgewogen werden muss, wie die Kriterien zu gewichten sind: Soll eine behandelnde Ärztin der Patientin bei einer schwerwiegenden Diagnose die volle Wahrheit mitteilen, auch wenn zu befürchten ist, dass die schlechte Nachricht eine ungünstige Wirkung erzeugt? Soll eine Beschenkte ihr Desinteresse am Geschenk authentisch ausdrücken, obwohl das als unhöflich erlebt werden kann und die Schenkende gekränkt wäre? Soll eine Autofahrerin bei der Verkehrskontrolle die Frage nach ihrem Alkoholkonsum wahrheitsgemäß beantworten, obwohl sie das die Fahrerlaubnis kosten könnte? Sobald die vier Kriterien als konkurrierend erscheinen und es unmöglich wird, eine als konsistent erlebte Äußerung zu identifizieren, ist der innere oder zwischenmenschliche Friede bedroht.
Die Entwicklung stimmiger Äußerungen in diesem Spannungsfeld ist eine Aufgabe, die wir alle lebenslang immer wieder zu meistern haben. Ihre Bewältigung setzt im Zweifelsfall voraus, dass ich mir als Sprecherin meines Wissens, meiner eigenen Verfasstheit, meines Kontextverständnisses und meiner Ziele bewusst werde. Diese vier Faktoren stehen deshalb im Zentrum professioneller Kommunikationsberatung. Wir widmen uns bei der Erkundung des kommunikativen Kontextes von nun ab vorwiegend der Frage nach der »Angemessenheit« unseres Kommunikationsverhaltens.
2.2 Das Kriterium der Angemessenheit
Beispiel 4: Die Unverschämtheit
Es ist Elternsprechtag im Gymnasium. Die Deutsch- und Philosophielehrerin Sabine Lummer empfängt als Klassenlehrerin der 6c die Eltern ihrer Schülerinnen und Schüler zu Einzelgesprächen im Klassenzimmer. Sie öffnet die Tür des Zimmers und begrüßt den nächsten Wartenden mit freundlichen Worten und einer ausgestreckten Hand. Es handelt sich um Herrn Mansour, den Vater ihres Schülers Hafis. Herr Mansour nickt freundlich und ergreift Frau Lummers ihm entgegengestreckte Hand nicht. »Dass der Vater meines syrischen Schülers meine zur Begrüßung ausgestreckte Hand nicht ergreift, ist ja eine mittelalterliche und frauenfeindliche Unverschämtheit«, denkt die deutschstämmige Lehrerin. Sie fühlt sich brüskiert. »Angesichts der Regel, dass Frauen und Männer sich nicht zu berühren haben, sofern sie nicht verheiratet oder nah verwandt sind, ist der Versuch der Lehrerin, meine Hand zu ergreifen, ein intolerabler Übergriff«, denkt der muslimisch geprägte Vater syrischer Herkunft. Er fühlt sich ebenfalls brüskiert. Die Beteiligten haben offensichtlich unterschiedliche Vorstellungen von einer Begrüßung zwischen Männern und Frauen in der Öffentlichkeit. Diese Vorstellungen entstammen unterschiedlichen Kulturen (syrisch-islamisch vs. deutsch-laizistisch). Solange beide das Verhalten der jeweils anderen im Rahmen ihrer Vorstellungen interpretieren, müssen sie deren Verhalten zwangsläufig als verstörend und unangemessen (chauvinistisch, lasziv) erleben.
Der situative Kontext
Kommunikative Handlungen wie das Begrüßungsverhalten von Lehrerin und Vater beim Elternsprechtag können nie einfach nur »an sich« gemeint und verstanden werden. Sie gewinnen ihre Bedeutung immer erst unter Berücksichtigung des Umfeldes, in dem sie getätigt werden. Dieses Umfeld nennen wir den »situativen Kontext«.23 Dieser Kontext einer Äußerung ist allerdings keine unverrückbar feststehende Tatsache, die alle Beteiligten gleichermaßen bindet. Er entsteht vielmehr in den Augen der Betrachterinnen als deren Komposition aus den von ihnen beobachteten und vorausgesetzten Umfeldelementen. Welche der vielfältigen beobachtbaren Gegebenheiten und welche der unendlich vielen möglichen Vorannahmen sie als »kontextrelevant« auswählen, ist ihnen überlassen. Insofern gibt es nicht den einen situativen Kontext, sondern lediglich persönliche Situationsverständnisse. Da die Komposition des Kontextensembles aus Beobachtungen und Vorannahmen allerdings in den allermeisten Fällen unbewusst und routinemäßig geschieht, haben die Beteiligten häufig den Eindruck, sie habe gar nicht stattgefunden bzw. der Kontext mit seinen Beobachtungen und Vorannahmen sei also »schon da gewesen« und existiere »an und für sich«. Tatsächlich ist jedes Situationsverständnis aber eine grundsätzlich auch anders denkbare »Konstruktion« und keine vorgefundene objektive »Essenz«. Es gibt keine objektiven situativen Kontexte. Und so ist die Frage, ob wir uns beim Elternsprechtag in einer Situation befinden, in der eher die Höflichkeitsvorstellungen der Lehrerin oder jene des Vaters zu gelten haben, so nicht zu beantworten. Tatsächlich befinden wir uns hier wie fast immer in einer »interkulturellen Situation«, in der beide Vorstellungen inklusive ihres Spannungsverhältnisses relevant sind.
Angemessenheit
Äußerungen, die in den Kontext passen, entsprechen unseren Vorannahmen und erscheinen uns deshalb als »angemessen«. Alle anderen sind »daneben«. Die meisten Menschen haben in den meisten Lebenssituationen intuitiv nicht nur ein klares Situationsverständnis, sondern ein damit einhergehendes Empfinden dafür, was »in Situationen wie dieser« angemessen ist, »was geht« und »was nicht geht«. Sie verfügen zusätzlich zum Situationsverständnis über ein situationsspezifisches Regelwissen, das ihnen sagt, welche Denk- und Verhaltensweisen und im Besonderen welche Äußerungen (für sie selbst und andere) im wahrgenommenen Kontext denkbar und akzeptabel sein könnten und welche (bei ihnen selbst und bei anderen) auf Befremden oder Ablehnung stoßen würden. Sie wissen beispielsweise, dass man (zumindest in deutschen Kleinstädten) Nachbarinnen auf der Straße grüßt, Stare als Frühlingsboten deuten kann, in der Bäckerei Brötchen und nicht Gemüse verlangt, die Bäckerin respektvoll behandelt und mit verheirateten Menschen in Anwesenheit von Zeuginnen nicht flirtet. Dieses Wissen prägt ihre »Lebenswelt«.24 Mit diesem Wissen ausgestattet, können sie unfallfrei Brötchen einkaufen. Sie gehen davon aus, dass man (zumindest in deutschen Praxen) beim Ärztinnenbesuch die eigenen Symptome wahrheitsgemäß schildern, die eigene Emotionalität kontrollieren und Wartezeiten akzeptieren sollte. Damit sind sie ärztinnenbesuchstauglich. Sie meinen zu wissen, wie sich Frauen und Männer in der Öffentlichkeit zu begrüßen haben und wie nicht. Damit sind sie in der Lage, einander z. B. beim Elternsprechtag respektvoll zu begegnen – immer vorausgesetzt, sie treffen auf Menschen mit ähnlichem Kontextverständnis.
Sozialisation
Die Regeln für die Konstruktion von Kontexten (»Situationsverständnis«) und für situativ angemessenes Verhalten (»Angemessenheitsverständnis«) sind uns zum allergrößten Teil nicht per genetischem Erbe in die Wiege gelegt worden, sondern werden im Lauf des Lebens erworben. Den Prozess, in dem wir uns dieses Wissen aneignen, nennen wir »Sozialisation« und den Teil dieses Prozesses, der während der Kindheit erfolgt, nennen wir »primäre Sozialisation«.25 Das während der primären Sozialisation erworbene Kontextwissen geht uns »in Fleisch und Blut« über, weil wir es in einer Lebensphase erwerben, in der unsere Reflexionsfähigkeit noch nicht vollständig entwickelt ist. Entsprechend unreflektiert setzen wir es im Alltag ein, es erscheint uns »natürlich« und »normal«.26
Kontexte zu erkennen, sie voneinander zu unterscheiden und sich in ihnen angemessen bewegen zu können, sind grundlegende Kompetenzen, die wir brauchen, um im täglichen Miteinander bestehen zu können. Im Lauf unserer Sozialisation werden wir zu Experten der »Kontextermittlung«, wir lernen viele Situationstypen zu unterscheiden und mit jedem Situationstyp lernen wir, eine Reihe von Regeln zu verbinden. So weiß ich, dass ich meine Nachbarin zu grüßen habe – aber nur bei der ersten Begegnung beim selben Anlass. Wenn wir uns beispielsweise als »Gäste auf einer Gartenparty« begegnen, sollte ich sie nicht jedes Mal grüßen, wenn sich unsere Wege kreuzen – das wäre zu viel des Guten. Ich weiß auch, welche Art der Begrüßung für uns bei einer »Begegnung auf der Straße« passend sein könnte und welche nicht.
Menschen, die im gleichen Umfeld sozialisiert worden sind, gehen bei der Kontextermittlung ähnlich vor: Sie konstruieren ähnliche Kontexte, entwickeln ähnliche Angemessenheitsvorstellungen und haben es deshalb besonders leicht, verträglich miteinander umzugehen. Man könnte sagen, sie leben in ähnlichen »Lebenswelten«, weil sie die gleiche »Kosmologie« voraussetzen.27
Spätestens wenn wir kulturelle Grenzen überschreiten, geraten unsere Vorstellungen von dem, »was geht«, unter Druck. Die Gewissheit, mit der das eigene Situationsverständnis für »alternativlos« gehalten und vermeintlich angemessenes Verhalten als »selbstverständlich« eingefordert wird, bröckelt. Der Moment, in dem das in der individuellen Biografie eines Menschen zum ersten Mal passiert, ist für diesen meistens ebenso irritierend wie befreiend: Wenn ich die Sphäre meiner primären Sozialisation, mein »Nest«, verlasse, muss ich erkennen, dass viele meiner Gewissheiten über den Charakter von Situationen und angemessenes Verhalten wie Eis in der Sonne schmelzen. Gleichzeitig erlebe ich, dass viele der mich einengenden Angemessenheitserwartungen meines familiären Umfeldes wie gelöste Fesseln abfallen: Ich verliere an Sicherheit und gewinne an Freiheit. Ich gerate bei meinen »Kontextermittlungen« häufiger als früher in Unsicherheit mit mir selbst und in Streit mit anderen darüber, in welchem Kontext wir uns bewegen und wie man sich dort angemessen verhalten könnte. Die scheinbare Selbstverständlichkeit meines kindlichen Situations- und Angemessenheitsverständnisses ist in jedem Fall dahin.28
3 Die Kontextermittlung: Wissen, was los ist
In diesem Kapitel untersuchen wir genauer, wie Menschen ihr Situationsverständnis entwickeln. Wir gehen davon aus, dass sie dazu zwei Dinge brauchen: Ein »Kontextmodell«, das ihnen wie ein Bauplan sagt, welche Faktoren eine Situation grundsätzlich aufweist (3.1 Das Kontextmodell) und eine Sammlung »faktorenspezifischer Konzepte«, aus der sie die konkret passenden Bauteile auswählen können (3.2 Faktorenspezifische Konzepte). Das Modell gibt ihrer Wahrnehmung wie ein Formular »Pflichtfelder« vor, die sie mit entsprechenden Konzepten »ausfüllen«. Auf diese Weise entwickeln sie ihr »persönliches Situationsverständnis« (3.3 Das persönliche Situationsverständnis). Wenn die persönlichen Situationsverständnisse der Beteiligten sich einander annähern, entsteht jener gemeinsame Nenner, der ein unfallfreies Miteinander ermöglicht (3.4 Der gemeinsame Nenner).
3.1 Das Kontextmodell
Wissen Sie, was eine Situation ist? Natürlich! Denn Sie orientieren Ihr Gesprächsverhalten Zeit Ihres Lebens daran, was die Situation erfordert. Können Sie erklären, was eine Situation ist, was sie ausmacht, wie sie funktioniert? Jetzt wird es wahrscheinlich schwieriger. Diese Schwierigkeit ist der Tatsache geschuldet, dass Ihr Wissen über Wesen und Logik von Situationen eher im impliziten (prozeduralen) als im expliziten (deklarativen) Gedächtnis gespeichert ist. In Sachen Situationsanalyse sind wir eher »Könner« als »Wissende«.29 Wir können eine Situation rasch analysieren, ohne zu wissen, was wir da eigentlich tun. Darin ähnelt unser Wissen über Situationen dem über unsere Muttersprache: Korrekt sprechen kann auch der, der noch nie ein Grammatikbuch studiert hat. Grammatisches Wissen zu erwerben, wird deshalb von vielen Schülern nicht nur als mühselig erlebt, sondern auch als überflüssig. Es wird erst dann unverzichtbar, wenn es gilt, eine Fremdsprache zu lehren oder systematisch zu lernen: Jetzt müssen wir die Prinzipien unseres Sprechens klären, erklären und verstehen. Genauso braucht es explizites Wissen über unser Situationsverständnis so lange nicht, wie unsere kontextbezogenen





























