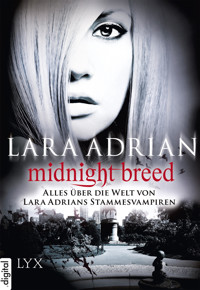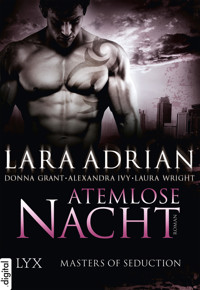9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ritter Serie
- Sprache: Deutsch
England, 12. Jahrhundert: In seiner Kindheit musste Gunnar Rutledge mit ansehen, wie sein Vater und seine Mutter ermordet wurden. Seither kennt er keinen anderen Gedanken, als den Tod seiner Eltern zu rächen und den Schuldigen, Baron Luther d'Bussy, zur Rechenschaft zu ziehen. Um den Baron zu einem Duell zu zwingen, entführt er dessen Tochter, die schöne Raina. Doch Gunnar hätte niemals damit gerechnet, dass er sich in die Tochter seines ärgsten Feindes verlieben könnte ...
Der erste Band der Romantic History-Reihe von Bestseller-Autorin Lara Adrian alias Tina St. John
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
LARA ADRIAN SCHREIBT
ALS TINA ST. JOHN
DIE RACHE DES RITTERS
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Susanne Kregeloh
Prolog
England, 1140
Die Erde erbebte nicht länger unter dem Donnern der Pferdehufe, und auch das Klirren der Waffen war verstummt. Die Luft war erfüllt vom Rauch, der aus den schwelenden Ruinen der Burg hoch oben auf dem Hügel und dem geplünderten Dorf zu dessen Füßen aufstieg. Das Werk der Zerstörung war vollbracht, der Feind wieder abgezogen. Denn es war nicht die Burg gewesen, die zu fordern er gekommen war.
Ein leichter Wind erhob sich und wehte über das mit Leichen bedeckte Schlachtfeld, strich wie eine Geisterhand über die Gemetzelten bis dorthin, wo der Junge lag – verwundet, mit dem Gesicht auf dem Boden. Der Wind zersauste sein dunkles Haar und lockte ihn zurück ins Bewusstsein, als er seine verletzte, blutende Wange streichelte.
»Mutter?«, murmelte der Junge, obwohl er wusste, dass sie tot war. Dass sie vor seinen Augen abgeschlachtet worden war, von Baron Luther d’Bussy, einem der ruchlosesten Warlords König Stephens. Weil sie sich geweigert hatte, seine Hure zu werden. Sich geweigert hatte, das Bett des Mannes zu teilen, der ihren Gatten drei Tage zuvor bei einem Turnier getötet hatte.
Der Junge schluchzte, als er daran dachte, keuchend rang er nach Atem und musste würgen, als er Wynbrookes Erde in seinem Mund fühlte, die sich mit dem metallenen Geschmack seines Blutes mischte.
Knapp außerhalb seiner Reichweite lag der Siegelring seines Vaters, das Andenken, das seine Mutter weinend ihrem toten Gatten vom Finger gezogen hatte, nachdem man ihn feierlich aufgebahrt hatte. Trotz des Lärms der Belagerung, der die Steinwände der kleinen Kapelle an jenem Morgen hatte erbeben lassen, war ihre Stimme gut zu hören gewesen.
»Verwahre ihn gut, Gunnar«, hatte sie gesagt und ihm den Ring in die Hand gedrückt, »und erinnere dich an den Mut deines Vaters … seine Ehrenhaftigkeit. Trage ihn, wenn du erwachsen bist, und lass mich stolz auf dich sein.«
Aber das hatte er nicht geschafft. Zu seiner Schande hatte er stattdessen mit ansehen müssen, wie sie starb. Ein Wachsoldat hatte ihm die Arme auf den Rücken gedreht und ihn festgehalten, als er hilflos und voller Angst um das Leben seiner Mutter gefleht hatte. Er hatte das höhnische Lachen des betrunkenen Barons ertragen. Und die Schläge. Und hatte einen Augenblick später vor Entsetzen geschrien, als d’Bussys Schwert dem Leben seiner Mutter ein Ende gesetzt hatte.
Wie es ihm gelungen war, sich aus dem eisernen Griff seines Bewachers zu befreien, wusste Gunnar nicht mehr. Er erinnerte sich nur noch daran, dass er gerannt war. Aus der Burg, den Hügel hinunter und über das Feld, so schnell er konnte – mit einem Ritter zu Pferde ihm dicht auf den Fersen. Mit schweren Beinen und Lungen, die kurz vor dem Bersten waren, flüchtete er zum Fluss, weil er dachte, er könnte sich in den Dornenbüschen verstecken, die das Ufer säumten. Der Gedanke hatte kaum Gestalt angenommen, als Gunnar über die donnernden Hufschläge hinweg gehört hatte, dass ein Schwert aus der Scheide gezogen wurde. Dann, binnen eines Augenblicks, war die Welt, war das Leben schwarz geworden.
Als seine Sinne begannen, unter dem Schleier aus Schmerz zu erwachen, hörte Gunnar das Ächzen eines Karrenrades und Stimmengemurmel. Es waren die Stimmen von zwei Männern: Der eine war ganz nah, der andere folgte ein Stück weit dahinter. Schritte verhielten neben Gunnars Kopf.
»Komm her, Merrick!«
Gunnar kannte den Mann, der gerufen wurde, erkannte den alten Heiler an seinem humpelnden Gang, als er näher kam. Die Zweige und die Tannennadeln, die den Boden bedeckten, knackten unter seinen Füßen. Der vertraute Geruch nach Kräutern hing in seinen Kleidern.
»Schau dir an, was ich neben diesem unglückseligen Dieb gefunden habe.«
Merrick schnalzte mit der Zunge, seine Stimme klang düster. »Das ist der Siegelring der Rutledges. Der Rubin.«
»Bist du sicher?«
»Aye. Gestern Abend in der Kapelle steckte er noch am Finger des toten Lords. Und falls du vorhast, ihn für dich zu behalten, mein Freund, dann bedenke, welchen Preis dieser junge Bursche zahlen musste, dass er ihn gestohlen –« Merrick holte plötzlich laut Luft. »Jesus!«, stieß er dann hervor und ließ sich auf die Knie fallen. »Der hier vor uns liegt, ist kein Dieb, Mann. Sieh doch genauer hin! Es ist der junge Lord Gunnar!«
Harte Finger tasteten Gunnars geschundenen Rücken ab, zogen den festgeklebten Leinenstoff seiner zerrissenen Tunika von den Wunden. Der alte Mann stieß einen Fluch aus. »Das ist bei Weitem die schlimmste Verwundung, die ich je bei einem Kind gesehen habe.«
»Ist er tot?«
»Nein, aber so gut wie, fürchte ich.« Gunnar hörte das Rascheln von Stoff, dann fühlte er, dass grober Wollstoff über ihn gebreitet wurde. »Halb tot oder nicht, ich werde ihn nicht hier draußen wie ein Tier verrotten lassen. Wenn ich ihn nicht heilen kann, werde ich ihm in seinen letzten Stunden zumindest ein wenig Trost spenden. Komm, hilf mir, ihn hochzuheben.«
Seine Glieder waren taub von dem erlittenen Blutverlust, als Gunnar spürte, dass er hochgehoben wurde. Er hörte die schlurfenden Schritte der Männer im Gras, als sie ihn von der Stelle forttrugen, an der er gelegen hatte. Der süßliche Geruch von schimmeligem Gras stieg ihm in die Nase, ehe er fühlte, dass man ihn bäuchlings auf eine mit Stroh gepolsterte Trage legte. Seine Retter trugen ihn rasch über das Feld auf das Dorf zu.
Jede Furche, in die sie traten, jede Vertiefung ließ ihn vor Schmerz fast ohnmächtig werden, aber sein gebrochenes Herz schlug beständig weiter. Mochte Gott ihm verzeihen, aber er wollte nicht leben. Er hatte sich als Feigling erwiesen; er verdiente es zu sterben. Zu leben bedeutete, jeden Tag aufs Neue seiner Schuld bewusst zu werden, seiner Ehrlosigkeit. Er war zu schwach; er konnte es nicht ertragen. Er betete um Erlösung von seinem Leid, von der Qual seiner Schande. Seine Familie war ausgelöscht, sein Heim zerstört. Welchen Grund gab es für ihn noch, zu leben? Welchen Sinn?
Die Antwort kam rasch, leise zuerst, wie ein dunkles Wispern, das sich um ihn herum erhob, seine Seele mit schwarzen Schatten an die Erde band. Es rief nach ihm, flüsterte ihm zu durchzuhalten; flehte ihn an, zu kämpfen.
Und als der Heiler ihn in seine Hütte trug und sich daran machte, die Wunden zu versorgen, wurde das Wispern lauter und eindringlicher, bis es Gunnars Bewusstsein erfüllte, sein Herz und seine Seele. Es war ein einziges Wort. Ein Mantra. Ein Schwur.
Vergeltung.
1
England, 1153
Der Name Baron Luther d’Bussys war in aller Munde. Seit Wochen hatten Ausrufer die Kunde über das bevorstehende große Turnier bis in den entferntesten Winkel des Landes verbreitet, und die vielen Zelte und Pavillons, die auf der weiten Fläche vor Norworth Castle aufgeschlagen worden waren, waren ein Beleg sowohl für die Eitelkeit des Barons als auch für seine Umsicht. Überall flatterten Wimpel in den Farben der unabhängigen Kriegsherren und der Lords der benachbarten Baronien, die der Einladung gefolgt waren.
In der sich herabsenkenden Dämmerung spazierten Männer, Frauen und Kinder – es mochten gut hundert sein – den breiten Weg entlang, der durch die Zeltstadt führte. Ganz am Ende dieses Weges trugen zwei Männer, bis auf ihre Hosen unbekleidet, zu den Jubelrufen eines kleinen Kreises entzückter Zuschauer einen Faustkampf aus. Überall waren prachtvoll gekleidete, arrogant wirkende Ritter zu sehen. Einige von ihnen wankten betrunken und mit einer Hure im Arm – mancher auch mit zweien – zu ihren Zelten. Jene Teilnehmer allerdings, die es ernst mit diesem Turnier meinten, und die pflichtbewussten Knappen kümmerten sich um die Pferde; andere saßen vor ihren Zelten und polierten ihre Rüstung oder überprüften die Waffen, die am folgenden Tag zum Einsatz kommen sollten.
Inmitten dieses Trubels blieb ein Blitz unbemerkt, der in der Ferne aufzuckte.
Er lief über den dunkler werdenden Himmel und spiegelte sich in einem Augenpaar wider, das nicht auf das geschäftige Treiben am Fuß des Hügels gerichtet war, sondern auf die Burg, die sich auf ihm erhob. Diese Augen blickten so kalt und finster wie der Wald, in dem sich der Mann verbarg, dem sie gehörten. Er kniff die Augen kurz zusammen, als er zu den düsteren Wolken hinaufschaute.
Regen.
Er hatte fast gleichzeitig mit dem Blitzschlag eingesetzt, fiel sanft auf das Blätterdach, unter dem der Mann sich aufhielt, schwoll dann aber zu einem kräftigen Sommerregen an. Die dunklen Wolken bewegten sich rasch auf die Zeltstadt zu. Ein Anflug von Unmut verzog die vollen Lippen, die bis dahin zu einer entschlossenen Linie zusammengepresst gewesen waren. Der heftige Regen würde eine Verzögerung für das morgige Turnier mit sich bringen und damit – schlimmer – eine Verzögerung der Einlösung seines Versprechens.
Gunnar Rutledge fluchte, seine halb geflüsterten Worte wurden von einem lauten Donnergrollen verschluckt. Sein schwarzer Rappe tänzelte nervös, seine Augen waren weit aufgerissen und voller Furcht. Mit einem leisen Murmeln, das eher wie eine Ermahnung als eine Aufmunterung klang, beruhigte Gunnar sein Pferd, klopfte ihm mit rauer, unbeholfener Hand auf den Hals.
Gunnar konnte Angst weder gebrauchen noch hatte er Erfahrung darin, sie zu beschwichtigen. Vor langer Zeit schon hatte er mit seiner eigenen Angst abgeschlossen, hatte sie und jedes andere Gefühl verdrängt, das sich eines Tages als Schwäche erweisen konnte. Er kannte keine fröhlichen Feste und gab sich keinen Träumen hin. Sein Verstand war kühl und nüchtern, sein dreiundzwanzig Jahre alter Körper von harter Arbeit und zahllosen Schlachten so gestählt, dass er nicht aus Fleisch und Knochen zu bestehen schien, sondern eher eine zweite Rüstung und eine Waffe war. Gunnar hatte seine Gefühle aus seinem Inneren verbannt und sich seiner Dämonen entledigt.
Bis auf einen.
Und jetzt hatte dieser Dämon ihn durch das bevorstehende Turnier in seine Höhle eingeladen, hatte Gunnar damit eine Gelegenheit geboten, die perfekter war, als er sie selbst hätte schaffen können. Er fragte sich, ob der Baron je an die Möglichkeit gedacht hatte, dass Gunnar überlebt haben könnte. Saß er da oben in dieser Burg aus Felsgestein und dachte daran – wenn auch nur flüchtig –, dass noch eine Rechnung offen war? Hatte er je die Angst geschmeckt? Hatte er sich je so elend gefühlt wie der Junge, den er vor dreizehn Jahren auf einem Schlachtfeld liegen gelassen hatte?
Bald würde er die Angst zu schmecken bekommen.
Die heilige Kirche sagte, einen Gegner bei einem Turnier zu töten, bedeute ewige Verdammnis. Deshalb wurden die Zweikämpfe mit Schwertern und Lanzen ausgeführt, die stumpf waren – aber trotz allem gefährlich.
Unfälle passierten immer wieder.
Persönliche Schulden wurden beglichen.
Um den Tod seiner Mutter zu vergelten, würde Gunnar Baron d’Bussy vor aller Welt zur Rede stellen. Um seinen Vater zu rächen, würde er auf dem Turnierplatz triumphieren. Der Plan war einfach: den Baron zu besiegen, ihn das Fürchten zu lehren. Ihn um Gnade winseln zu lassen.
Und sie ihm zu verweigern.
Der Gedanke, dass er selbst diesen Tag vielleicht nicht überleben würde, ließ Gunnar in seinem Entschluss nicht einen Moment schwankend werden. Er würde seinen Schwur halten, um jeden Preis.
Während der Regen aus schweren Wolken herunterprasselte, den Turnierplatz in ein Schlammfeld verwandelte und jeden dazu trieb, Schutz in seinem Zelt zu suchen, wendete Gunnar sein Pferd und ritt tiefer in den Wald hinein, um in der Einsamkeit zu versuchen, so viel Geduld aufzubringen, um das Ende des Gewitters abzuwarten.
Eine helle Morgensonne füllte den Himmel, als Raina d’Bussy auf einer gescheckten Stute durch das offene Tor von Norworth ritt und den Burghügel hinuntergaloppierte. Der frische Duft des nächtlichen Regens hing noch in der Luft, aber sie bemerkte es kaum. Raina ritt in einem halsbrecherischen Tempo, ihr Gewand blähte sich hoch bis über die Knie, und das offene Haar wirbelte wie ein wilder, ungebändigter Vorhang um ihre Schultern. Mit einem fröhlichen Lachen beugte sie sich über den Hals des Pferdes, drängte es, immer schneller zu laufen, vorbei am verlassen daliegenden Turnierplatz und über den regennassen Boden. Schlamm spritzte um sie herum auf, wurde von den Hufen des Pferdes hochgeschleudert und besprenkelte ihre nackten Beine und ihr Gesicht.
In hartem Galopp preschte Raina an dem Zeltdorf vorbei und den sanft ansteigenden Hügel hinauf, der Norworth Castle gegenüberlag, in Richtung Wald. Als sie sich dem dichten Unterholz näherte, warf sie einen Blick zurück über die Schulter, um abzuschätzen, wie weit sie von dem Reiter entfernt war, der ihr schnell folgte. Sein weißer Hengst donnerte den Hügel hinauf, Erdbrocken flogen unter seinen schweren Hufen auf. Mit einem aufgeregten kleinen Aufschrei ritt Raina in den Schatten der hohen Bäume.
Sie liebte diese schnellen Rennen, und zum Ärger ihres Vaters und des jungen Ritters, gegen den sie heute angetreten war, wollte sie immer gewinnen. Sie benahm sich gar nicht damenhaft, ganz gewiss nicht. Aber da sie von einem nachsichtigen Vater aufgezogen worden war – ohne Mutter, die dem Dickkopf ihrer Tochter mit Strenge begegnet wäre –, hatte Raina sich ihre eigenen Regeln aufgestellt. Weniger zu geben, als sie konnte, mochte es schicklich sein oder nicht, gehörte nicht dazu.
Ein rascher Ruck an den Zügeln brachte ihr Pferd nahe dem Bach zum Stehen, der die Ziellinie des Rennens markierte. Raina sprang schon aus dem Sattel, als ihr Verfolger neben ihr seinen Hengst zügelte. Sie wirbelte herum und sah den Freund, den sie seit Kindertagen kannte, mit einem unverhohlen selbstzufriedenen Lächeln an.
»Der Sieg gehört mir, Nigel!«, rief sie atemlos und erfüllt vom Hochgefühl des schnellen Ritts und ihres Sieges.
Ihr Lächeln verschwand, als sie seinen Gesichtsausdruck sah. Irgendwo auf der Strecke war das Spielerische, mit dem die beiden ihr Rennen begonnen hatten, verloren gegangen, denn Nigel schaute jetzt finster auf sie herunter. Seine Lippen, umgeben von einem weizenblonden Spitzbart, waren zu einer festen, unduldsamen Linie zusammengepresst. Der kümmerliche kleine Bart, den er sich seit so langer Zeit stehen zu lassen versucht, ist ein enttäuschender Anblick, dachte Raina. Er sieht damit wie ein Kobold mit einem zu spitzen Kinn aus. Wie ein ziemlich ärgerlicher noch dazu.
»Was für einen Anblick du bietest«, tadelte Nigel sie und schüttelte langsam den Kopf. Er stieg vom Pferd, zog seine Handschuhe aus und legte sie über sein Wehrgehenk. Blassblaue Augen musterten Raina vom Scheitel bis zu den Zehenspitzen. »Du hast dein Kleid ruiniert.«
Sie strich sich das zerzauste Haar aus dem Gesicht und schaute auf ihr verblichenes, safranfarbenes Gewand hinunter, das jetzt über und über mit Schlammspritzern bedeckt war. »Es ist mein ältestes Kleid und deshalb nur ein kleiner Tribut an den Sieg.«
Nigel musste lachen und ergriff ihre Hände. »Darum geht es doch nicht«, ermahnte er. »Ladys ruinieren ihre Kleider nicht um eines Rennens willen. Außerdem ist deine Vorliebe für Wettkämpfe … nun, sie ist unschicklich.«
Raina runzelte die Stirn und entzog ihm ihre Hände. In den letzten Monaten hatte Nigel sich verändert. Er nahm jetzt alles immer so schrecklich ernst. Was war mit dem Jungen geschehen, der sie stets zu ihren Eskapaden ermutigt hatte, der sie bejubelt hatte für alles, was sie tat? »Sonst hat es dir Spaß gemacht, dich mit mir zu messen«, sagte sie leise, wobei diese Feststellung eher wie eine Anklage klang, sogar für ihre Ohren.
»Aye, das hat es«, erwiderte Nigel, »solange wir Kinder waren. Du bist kein Kind mehr, Raina, sondern eine erwachsene Frau. Und ich bin ein Mann. Es ist Zeit, dass unsere Spielchen aufhören.« Als Raina mürrisch die Stirn runzelte, kam er näher und hob ihr Kinn mit seiner Rechten. »Wenn es Kapitulation ist, wonach es dich verlangt, dann kapituliere ich. Du hast das Rennen gewonnen, und ich bin besiegt … wie immer, wenn es um dich geht, meine Liebste. Wirst du es übers Herz bringen, meinen verletzten Stolz wieder aufzurichten? Mir etwas gewähren, von dem ich zehren kann, wenn ich nachher auf dem Turnierplatz um deine Liebe kämpfe?«
Er beugte sich vor, um sie zu küssen.
»Nigel, nicht.« Raina zog sich zurück und schlang die Arme um sich, während sie zu dem Bach ging. Seine Versuche in letzter Zeit, sie anzufassen, ließen sie immer unduldsamer werden, aber gleichwohl tolerierte sie seine Avancen ebenso, wie sie sie zurückwies. Raina klammerte sich an den Gedanken, dass Nigel fast ihr ganzes Leben lang ihr engster Freund und Vertrauter gewesen war. Sie hatte schon vor ein paar Jahren bemerkt – und ihr Vater hatte manch eine ernste Mahnung ausgesprochen –, dass Nigel zu einem Mann geworden war – mit all den Begierden eines Mannes. Aber es war schmerzlich zu denken, dass das Erwachsensein das Ende ihrer Freundschaft bedeuten könnte. »Ich verstehe das nicht. Warum muss es immer damit enden?«
Nigel war ihr gefolgt und hinter ihr stehen geblieben. »Du meinst, warum es immer damit enden muss, dass du mich abweist?« Als er heftig ausatmete, klang es wie ein freudloser, entmutigter Seufzer. »Wenn ich das nur wüsste, meine Geliebte.«
Bei diesem zärtlichen Kosewort schloss Raina fest die Augen und schüttelte den Kopf. »Nigel, du musst aufhören, auf diese Weise an mich zu denken. Bitte, um meinetwillen und um deinetwillen, hör auf, in mir mehr zu sehen als die Tochter deines Lords … und deine Freundin.«
Nigels heiseres Lachen sandte Raina einen Schauder den Rücken hinunter. »Ich fürchte, du verlangst zu viel«, sagte er. Dann hörte sie, wie er tief an ihrem Haar einatmete, fühlte seinen Atem auf ihrer Haut, als seine Arme sich um ihre Taille schlossen. »Wie könnte ich anders an dich denken, als an das Mädchen, das ich heiraten werde, die Frau, die mein Bett mit mir teilen und meine Kinder gebären wird?«
Allein der Gedanke daran ließ Raina vor Widerwillen aufkeuchen. Sie versuchte, sich aus seiner Umarmung zu lösen, aber er umschlang sie nur noch fester und zog sie noch näher an sich. »Bei Gott, du bist eine faszinierende Versuchung«, stieß er hervor, und seine Lippen fanden ihren Weg zu ihrem Nacken, wo sie verweilten, ihre Haut mit einem feuchten Kuss berührten.
Raina wand sich in seinen Armen und versuchte, seinen unerwünschten Aufmerksamkeiten zu entkommen. Seine verbalen Annäherungen waren eine Sache, aber niemals zuvor hatte er sich solche Freiheiten herausgenommen! »Nigel, du musst den Verstand verloren haben! Lass mich sofort los!«
Er tat ihre Worte ab, als hätte sie nichts gesagt, und ließ seinen Mund langsam ihren Nacken hinaufwandern. »Willst du, dass ich dich anflehe, Raina? Fürwahr, das werde ich, und ich empfinde keine Scham dabei. Sag mir, was ich tun muss, und ich werde es tun.« Er presste sie heftig an sich, seine Umarmung schloss sich wie ein eisernes Band um ihre Brust.
»Nigel, du tust mir weh! Bitte, lass mich los!«
»Niemals«, schwor er. »Ich werde dich nie loslassen. Lass mich dich lieben, Raina. Werde mein … hier, jetzt. Lass mich dich besitzen, und dein Vater wird nichts gegen unsere Heirat einwenden.«
Während ihr dieser ungeheuerliche Gedanke ins Bewusstsein drang, schloss sich Nigels Hand um ihre Brust. Empört und zornig schlug Raina ihm hart ins Gesicht. Nigel ließ sie sofort los und fuhr mit der Hand an seine Wange, die sich schon zu röten begann.
»Nigel, ich –« Sie wollte sagen, dass es ihr leid täte, fand aber nicht die richtigen Worte.
Völlig überraschend packte Nigel sie an den Unterarmen und riss sie wild an sich.
»Schlag mich nie wieder, Raina«, drohte er mit zusammengebissenen Zähnen, »oder ich verspreche dir, ich werde so zurückschlagen, dass du nie wieder deinen Platz vergessen wirst.«
Sein Gesicht war dem ihren jetzt ganz nah, sein Atem war erhitzt von Wut. In seinen Augen sah sie einen solch heftigen, hemmungslosen Zorn, dass sie verstört zurückfuhr. Nigel stieß ein tiefes, animalisches Knurren aus, ehe er seinen Mund brutal auf ihren presste, sie seine Zähne spürte und Blut schmeckte.
Raina versuchte sich loszureißen, aber er hielt sie fest. Seine Finger bohrten sich in ihre Arme, als er seine Zunge tief in ihren Mund zwang. Sie keuchte über dieses unerwartete Eindringen, Ekel ließ ihren Magen zu einem Knoten werden … Nigels Griff war hart wie Eisen, kalt und erbarmungslos, und zum ersten Mal in ihrem Leben hatte Raina Angst vor ihm.
Hatte ihr Vater das hier gemeint, als er ihr erklärt hatte, dass mit dem Heranreifen des Körpers eine Verderbnis der Gedanken einherging? Hatte er das gemeint, als er sie gewarnt und ihr gesagt hatte, sie solle sich zu ihrem Schutz nicht allein in Nigels Gesellschaft aufhalten? Hätte sie doch nur auf ihn gehört!
Nigel hielt mit einer Hand ihre Hände gepackt, als er hinter sie griff und mit der anderen begann, ihr die Röcke hochzuschieben. Panik umklammerte Rainas Herz mit eisigen Klauen. Nigel würde sie doch nicht mit Gewalt nehmen! Nicht gegen ihren Willen!
Raina wehrte sich, ihr angstvoller Schrei erstickte unter seinem Mund. Sie keuchte jetzt, erschreckt und gefangen in seiner schmerzhaften Umklammerung. Nigel schien ihr angsterfülltes Stöhnen als Ermutigung zu verstehen und presste seine harte Erektion gegen ihren Leib. Sein Mund löste sich schließlich von ihr, und Raina schrie, hoffte, dass jemand sie hörte, betete um Rettung.
Als Antwort auf ihre Gebete ertönte eine tiefe Stimme. »Lasst sofort die Frau los, oder Ihr werdet meine Klinge zwischen Euren Schulterblättern spüren.«
Nigels Griff lockerte sich augenblicklich, und mit einem Knurren ließ er Raina los, dann fuhr er herum, um nach der Ursache dieser Störung zu sehen. Raina zog ihre Röcke herunter und spähte an Nigels Schulter vorbei, um einen Blick auf ihren Retter zu erhaschen.
Ein in Schwarz gekleideter Ritter auf einem mächtigen Streitross starrte Nigel mit tödlicher Entschlossenheit an. Die Drohung in seinen Augen wurde von dem großen, schimmernden Breitschwert bekräftigt, das jetzt auf Nigels Herz gerichtet war. Das Gesicht des Ritters hätte aus Granit gemeißelt sein können, so unbewegt blieben dessen harte Flächen und Winkel, so starr blieben das eckige Kinn, der unnachgiebige Mund.
Dieser Mann sah nicht wie ein strahlender Retter aus, eher wie ein schwarzer Geist, der Teufel persönlich. Aber während Raina dastand und ihn großäugig und wachsam zugleich anstarrte, reagierte Nigel auf die ihm gewohnte arrogante Weise.
»Das hier geht Euch nichts an«, bellte er, »und Ihr wisst nicht, mit wem Ihr es zu tun habt.«
»Ich habe es mit einem Schuft zu tun, der sich mit Gewalt einem Mädchen aufdrängt. Wer Ihr seid, ist unwichtig und interessiert mich nicht.« Der Ritter setzte Nigel die Klinge auf die Brust.
Mit einem spröden Lachen hob Nigel die Hände, zeigte seine offenen Handflächen. Als er jetzt etwas sagte, lag trotz seiner Großmäuligkeit ein Zögern in seiner Stimme. »Diese Situation ist zu meinem Nachteil, Sir. Wenn Ihr mit mir darüber streiten wollt, wie ich meine Angelegenheiten regele, stehe ich Euch gern zur Verfügung, aber wie Ihr seht, bin ich unbewaffnet. Ihr nutzt einen Vorteil ungerechterweise zu Euren Gunsten.«
»So wie Ihr Euren gegenüber der Frau.«
»Ihr wollt mich durchbohren, ohne mir die Möglichkeit zur Verteidigung zu geben?«
»Nein«, entgegnete der Ritter. »Ich will, dass Ihr von dem Mädchen ablasst und dorthin zurückgeht, wo Ihr hergekommen seid.« Er versetzte Nigel mit seinem Schwert einen Stoß. »Und zwar sofort.«
Nigel taumelte rückwärts, fort von der Klinge, und seine Stimme hob sich um eine unglaubliche Oktave. »Für wen haltet Ihr Euch? Ich fordere Euer verdammtes Herz für diese Unverschämtheit!«
Der Ritter schien unbeeindruckt. »Immer ruhig Blut, kleiner Mann.« Dieses Mal war seine Klinge weniger sanft, und Nigel schaute auf seine Brust hinab, wo ein kleiner roter Fleck begann, seine Tunika zu verfärben.
Mit einem zischenden Atemstoß sprang Nigel zu seinem Pferd und stieg in den Sattel. Aber anstatt nach den Zügeln zu greifen, streckte er die Hand nach seiner Waffe aus. Raina schrie auf. Alles, was Nigel zu seiner Verteidigung hatte, war sein Kurzschwert; er war auf sicherem Boden zu seinem Vergnügen ausgeritten und deshalb für einen Kampf nicht gewappnet. Er schwang die kurze Waffe mit einem bösen Grinsen und offensichtlich mit sich selbst zufrieden – trotz der Tatsache, dass sie im Vergleich zu der des Ritters wie ein Kinderspielzeug aussah. Im nächsten Augenblick sprengte Nigel auf den Fremden zu.
Raina hatte die Hände vors Gesicht geschlagen und beobachtete durch die gespreizten Finger, wie die Schwerter aufeinanderprallten, das schrille Schnarren von Metall auf Metall begleitete Nigels obszöne Flüche. Es schien, die Konfrontation hatte gerade erst begonnen, als der dunkle Ritter Nigel mit einer raschen Aufwärtsbewegung des Arms das Schwert aus der Hand schlug und es in einem weiten Bogen zu Boden fiel.
Nigel starrte auf seine leere Hand. Ein Ausdruck von Bestürzung und Überraschung legte sich auf sein Gesicht, bevor er die Augen zusammenkniff und den Ritter ansah. Dann, mit einem markerschütternden Schrei, sprang er aus dem Sattel. Raina schrie ihm zu, es nicht zu tun, aber es war zu spät. Nigel sprang auf den Ritter zu, stürzte sich auf dessen breites Schwert. Beide Männer taumelten in das Dickicht.
Der dunkle Ritter kam als Erster wieder auf die Füße. Er packte Nigel vorn an seiner Tunika und riss ihn mit sich hoch. Nigel schlug mit den Armen um sich, trat und kratzte, doch seiner Technik fehlten auf nahezu jämmerliche Weise die Finesse und die Kraft seines Gegners. Während der Ritter darum kämpfte, Nigel die Arme an den Seiten festzuhalten, krümmte sich Nigel und drosch um sich. Irgendwie gelang es ihm, dem Ritter einen Tritt gegen das Schienbein zu versetzen.
Raina zuckte instinktiv vor Schmerz zusammen, aber der Ritter gab keinen Laut von sich. Er holte mit seinem starken Arm aus und schlug mit der Kraft eines Januarsturms zu. Ein Fluch erstarb auf Nigels Lippen, als die Faust des Fremden ihn am Kinn traf. Er wirbelte auf dem Absatz herum, verdrehte die Augen und fiel dann in sich zusammen wie eine Stoffpuppe.
»Habt Erbarmen!«, keuchte Raina und lief zu Nigel. Sie umfing sein Gesicht, ihre Finger glitten über das Blutrinnsal und die Beule, die unter seinem Auge anzuschwellen begann. Er antwortete nicht, sondern lag reglos da. »Oh Nigel, du Narr! Jetzt bist du tot und hast selbst Schuld daran!«
»Er ist nicht tot«, sagte der Ritter hinter ihr. »Obwohl ich mir nicht erklären kann, warum dieser Gedanke dir solchen Kummer bereitet. Es war doch offensichtlich, dass dieser Hundesohn keine Rücksicht auf dein Wohlergehen nehmen wollte.«
Raina blickte den Besitzer dieser dunklen, samtigen Stimme an. Der Ritter hatte sein Schwert aus dem Farnkraut geholt und stand jetzt an ihrer Seite, seine breiten Schultern und sein großer Körper verdeckten die Sonne, als er sein Schwert in die Scheide zurückschob. Ein Ausdruck, der eher von Ärger als von Besorgnis herzurühren schien, kräuselte seine breite Stirn, während er auf Raina hinunterblickte. Er war attraktiv, ohne Zweifel, ganz in Schwarz, von den windzerzausten schulterlangen Haaren bis zu seiner Tunika, der Bruche und den Stiefeln. Selbst seine Augen waren dunkel.
»Bist du verletzt?«, fragte er, und Raina wurde bewusst, dass er sie vermutlich für verwirrt oder gar einfältig hielt, weil sie so zu ihm hochstarrte.
»Nein«, erwiderte sie rasch, »obwohl mein Stolz verletzt ist, wie ich zugeben muss. Ich war auf die Freundlichkeit eines Fremden angewiesen, um mich vor jemandem zu retten, den ich für meine Freund gehalten habe – mehr als das, manchmal gar für einen Bruder.«
Der Ritter streckte die Hand aus und zeigte mit einer leichten Neigung des Kopfes an, dass sie sie ergreifen solle. »Seine Absichten gegen dich waren eben aber alles andere als brüderlich«, sagte er, während er ihr half, aufzustehen.
Für Raina war es ein solch faszinierendes Gefühl, seine große, warme Hand an ihren Fingerspitzen zu spüren, dass sie seine Worte kaum erfasste. Noch faszinierender waren die Augen dieses Mannes: ein tiefes Braun, so dunkel, dass sie auf den ersten Blick schwarz zu sein schienen. So unergründlich sie für Raina waren, so leicht schien er sowohl ihren eindringlichen Blick als auch ihre Gedanken zu lesen. Raina fühlte sich ertappt und zog ihre Hand zurück, wobei sie im Stillen die Röte verwünschte, die jetzt ihre Wangen überzog.
Das Stirnrunzeln des Ritters vertiefte sich, und er ging an ihr vorbei, dorthin, wo Nigel lag. »Wie alt bist du, Mädchen?«, fragte er, als er sich den reglosen Nigel auf die Schulter lud und ihn dann bäuchlings über den Sattel seines Pferdes legte.
»I-ich bin achtzehn«, stammelte sie und fügte dann stolz hinzu: »Wir haben den Tag meiner Geburt gerade letzte Woche begangen.«
Sie dachte, ihr gerade erreichtes Alter würde sie gewiss erwachsen und erfahren klingen lassen. Er sah jedoch kein bisschen beeindruckt aus, sondern nickte nur grimmig. »Also alt genug, um es besser zu wissen, als allein auszureiten, besonders wenn die Gegend nur so von Turnierteilnehmern wimmelt.«
»Ich war nicht allein«, erwiderte sie hitzig, wobei sie ihm seine Unterstellung übel nahm, ihr mangele es an Verstand.
»Der da war deine Eskorte?« Er wies mit dem Daumen über die Schulter auf Nigels zusammengesackte Gestalt, die von dieser Warte aus ein wenig beruhigendes Bild abgab.
Raina biss sich auf die Lippen, und der Ritter lachte leise. »Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird.«
»Was meint Ihr damit?«
»Männer sind wie Wölfe«, erklärte er, während er nach den Zügeln des Pferdes griff und dann zu Raina trat. »Ich hätte gedacht, dass ein so hübsches Mädchen wie du das beizeiten gelernt hätte.«
Sie war sich ziemlich sicher, dass er es nicht als Kompliment gemeint hatte, aber trotzdem freute es sie, dass er sie hübsch fand. Sie verbarg ihre Reaktion mit einem Heben ihres Kinnes, aber als er auf sie zukam, war sie außerstande, das kleine Zittern der Aufregung ganz zu verbergen, das durch ihre Adern zuckte.
»Haben deine Eltern dir nichts über Männer und Frauen beigebracht? Oder ist es deine Art, die Männer zu betören und dann die Unschuld zu spielen, wenn sie mehr erwarten als einen freundschaftlichen Kuss?«
Wütend holte Raina Luft und richtete sich sehr gerade auf, bis ihr der Rücken schmerzte. »Meine Mutter ist tot«, teilte sie ihm fest mit. »Doch mein Vater hat mich vieles gelehrt. Ich glaube, er würde mich erdrosseln, würde er mich allein in der Begleitung eines Schurken wie Euch sehen.«
»Schurke?« Offensichtlich gekränkt sah er sie an … vielleicht aber auch überrascht; sie konnte es nicht sagen – was sie in diesem Moment aber nicht sehr kümmerte. »Für ein verwahrlostes Ding wie dich ist das aber reichlich hochmütig gedacht«, erwiderte er. Seine Miene war so ironisch wie der Klang seiner Stimme. »Ich meine, dein bedauernswerter Vater dürfte nur allzu geneigt sein, dich in die Arme eines Ritters zu geben, Schurke oder nicht.«
Sie hielt sich nur um Haaresbreite zurück, ihm zu erklären, dass sie Lady Raina sei, Tochter des Barons Luther d’Bussy of Norworth, und dass ihr Vater ihn lieber für seine Frechheit ausgepeitscht sehen würde als verheiratet mit seiner einzigen Erbin. Aber es stimmte, wenn sie sagte, ihr Vater habe sie vieles gelehrt. Sie hatte endlose Lektionen über die Gefahren zu hören bekommen, die mit ihrem Titel verbunden waren, und die Risiken, in gesetzlosen Zeiten die Tochter eines reichen Barons zu sein.
Dieser kühne Ritter glaubte, es fehle ihr an Verstand; nun, sie würde ihm auf der Stelle beweisen, dass er sich irrte. Sollte er sie doch für ein Bauernmädchen halten; das war besser, als sich in die Hände eines möglichen Entführers zu begeben. »Vermutlich wollt Ihr, dass ich Euch für einen Prinzen unter diesen Wölfen halte, nur weil Ihr einem einfachen Bauernmädchen zu Hilfe gekommen seid.«
Eine schwarze Augenbraue wurde sardonisch hochgezogen. »Ich gestehe, dass ich kein Prinz bin, aber meinst du wirklich, ein Wolf würde ein Lamm retten, nur um es dann freizulassen?« Er lächelte träge und enthüllte eine Reihe weißer Zähne. Für einen Moment fragte sich Raina, ob sie an Ort und Stelle von ihm verschlungen würde. Mit flatterndem Herzen und zitternden Knien traute sie sich nicht, sich zu bewegen, als er die Hand ausstreckte und ihr eine Haarsträhne hinter das Ohr strich. Sie hätte in Ohnmacht fallen können, hätte sie nicht an der Flanke ihrer Stute gelehnt. »Schau nicht so weidwund drein«, sagte der Ritter mit einem wissenden Augenzwinkern. »Ich bin aus Geschäftsgründen hier, nicht zum Vergnügen.«
Und dann schlossen sich seine Hände um ihre Taille, sein Griff war warm und fest, der Abdruck eines jeden Fingers war durch ihren Bliaut auf ihrer Haut zu spüren. Raina benutzte seine Schultern als Stütze, als er sie hochhob, als sei sie nicht unhandlicher als ein Federkissen, und sie auf ihre Stute setzte.
Er ging um Nigels Pferd herum und setzte es mit einem leichten Schlag auf den Rücken in Gang. Nigel begann sich zu rühren, als es sich in Bewegung setzte und er durchgeschüttelt wurde, sein Stöhnen drang bis zu Raina, die von ihrer Stute auf ihren dunklen Retter hinunterstarrte und von seinem Blick wie gefangen war.
»Mach dich auf den Weg, kleines Lamm«, befahl ihr der Fremde mit einer Stimme, die Raina an ein Knurren erinnerte, »bevor der Wolf seine Gutmütigkeit zu überdenken beginnt.«
Es war ihr unmöglich, ihre Verwirrung über seine Bemerkung zu verbergen. Sie fühlte eine Flut der Hitze ihre Wangen überziehen, als sie ihr Pferd von ihm fortlenkte. Mit zitternden Händen fasste sie die Zügel fester und begann, zum Waldrand zu reiten, des dunklen Blickes, der ihr folgte, sehr bewusst, als sie Nigels Pferd nachsetzte.
Der Verstand rief ihr zu, zu fliehen, ihr Pferd in einen schnellen Galopp anzutreiben und sich selbst glücklich zu schätzen, dass sie alldem mit kaum mehr als zitternden Nerven und einem flatternden Puls entkommen war. Aber wie schon bei Lots Weib hätte keine Warnung eindringlich genug sein können, Raina davon abzuhalten, einen Blick zurück auf das zu wagen, was ihren Untergang hätte verzaubern können.
Auf ihn.
Sie wandte sich im Sattel um und sah, dass er sie beobachtete, und die wachsende Entfernung zwischen ihnen schien unter der Macht seines Blickes zu schwinden. Selbst als ihre Stute weiter ausgriff und die Entfernung zwischen Raina und dem Fremden wuchs, schien es, als sei er noch nah genug, um ihren rasenden Herzschlag zu hören, das Zittern ihrer Aufregung zu fühlen, die sie erfüllte. Nah genug, um sie zu berühren. Mochte der Himmel ihr beistehen, aber hätte er sie in diesem Moment zurückgerufen, sie wäre seinem Ruf gefolgt.
Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird.
Seine grimmige Bemerkung ging ihr durch den Sinn, versetzte ihre törichten, eigenwilligen Gedanken und ihren Körper in Aufruhr. Mit einem unterdrücken Aufschrei des Erschreckens zwang sie ihre Aufmerksamkeit zurück auf ihr Pferd. Mit klopfendem Herzen und angehaltenem Atem preschte sie an Nigel vorbei, hinaus aus dem Wald und auf die Burg zu – als wäre ihr der Teufel auf den Fersen.
2
Baron Luther d’Bussy war nicht zu übersehen, als er am darauffolgenden Morgen auf seinem alles überragenden Sitz in der Loge des Turnierplatzes saß. Stolz wie ein Pfau und fast ebenso farbenprächtig in seinem kostbaren Seidengewand thronte er über der Zuschauermenge und den Turnierteilnehmern, als sei er der König höchstselbst. Mehr als nur ein paar der Vorübergehenden flüsterten hinter vorgehaltener Hand über die Kühnheit des Barons, auf seinem zur Glatze neigenden Haupt eine Krone aus geflochtenem Gold zu tragen. Mochten die Leute auf diese Zurschaustellung seines Reichtums auch noch so starren, es kümmerte den Baron nicht im Mindesten. Er hatte seine Jugend damit verbracht, den Status zu erlangen, den er jetzt hatte und genoss; nach seiner Art zu denken, hatte er jedes Recht, damit zu protzen.
»Eine beeindruckende Beteiligung, Mylord.«
Der Baron brummte seine Zustimmung und warf einen kurzen Seitenblick auf Nigel; dann wandte er sich ab und nahm einen kräftigen Bissen von dem gebratenen Hammelbein, um das Gespräch nicht fortsetzen zu müssen. Aus Gründen, die er lieber nicht näher untersuchen wollte, ging Nigels Stimme genau genommen der junge Mann an sich dem alten Mann auf die Nerven.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!