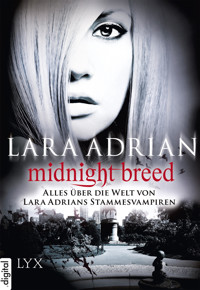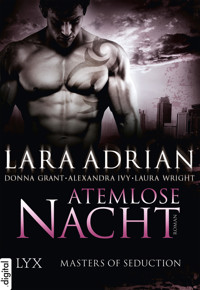9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Midnight Breed
- Sprache: Deutsch
Bei der Tierärztin Tess Culver taucht ein Mann auf, der aus mehreren Schusswunden blutet. Verzweifelt kämpft sie um sein Leben, ohne zu ahnen, dass es sich bei dem gutaussehenden Fremden um einen Vampir handelt. Da schmiedet ein verhängnisvoller Kuss das Schicksal der beiden auf ewig aneinander und macht sie zu Verbündeten im Kampf gegen die Mächte der Finsternis ...
Band 2 der erfolgreichen Vampirsaga "Midnight Breed" von Bestseller-Autorin Lara Adrian!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Roman
Ins Deutsche übertragen vonEsmé Beatenberg und Rene Satzer
Für Cappy und Sue Pratt, mein reisendes PR- und Jubelteam. Danke für eure Liebe, Unterstützung und die vielen guten Zeiten, die wir zusammen hatten. Ich glaube, ich höre schon wieder die Karibik rufen …
1
Dante strich mit dem Daumen über süßes, duftendes Fleisch und verweilte ein wenig bei der Halsschlagader, dort, wo der menschliche Puls am stärksten schlägt. Auch sein eigener Herzschlag beschleunigte sich, glich sich dem Rhythmus ihres Blutes an, das unter der Oberfläche ihrer zarten, weißen Haut dahinströmte. Dante beugte seinen dunklen Kopf hinunter und küsste die empfindliche Stelle, umspielte mit der Zunge das schnelle Flattern ihres Herzschlags.
„Sag mal, du“, murmelte er in die warme Haut, seine Stimme ein tiefes Grollen gegen den dröhnenden Technobeat des Clubs, „bist du eine gute oder eine böse Hexe?“
Die junge Frau räkelte sich auf seinem Schoß, ihre netzbestrumpften Beine pressten sich an seine Oberschenkel, das schwarze Spitzenbustier drückte ihm ihre Brüste unters Kinn. Lasziv spielte sie mit einer Strähne ihrer fuchsienroten Perücke und ließ dann den Finger langsam abwärts wandern, vorbei an dem Tattoo eines keltischen Kreuzes, das auf ihrer Schulter prangte, bis mitten in ihren wogenden Ausschnitt hinein. „Oh, ich bin eine sehr, sehr böse Hexe.“
Dante stieß einen Knurrlaut aus. „Die mag ich am liebsten.“
Er lächelte in ihren betrunkenen Blick und machte sich dabei nicht die Mühe, seine Fangzähne zu verbergen. In diesem Bostoner Tanzclub war er in der Halloween-Nacht nur ein Vampir von vielen, obwohl die meisten anderen nur so taten als ob, Menschen, die sich mit Plastikgebissen, künstlichem Blut und allerlei lächerlichen Kostümen ausstaffiert hatten. Er und einige andere dagegen – eine Handvoll Männer aus den Vampirreservaten, den sogenannten Dunklen Häfen – waren echt.
Dante und die anderen waren Abkömmlinge des Stammes, die nicht viel gemein hatten mit den bleichen Vampiren aus den Gruselromanen, so wie die Menschen sie sich vorstellten. Dantes Rasse, weder untot noch vom Teufel gezeugt, war eine warmblütige Hybride von Homo sapiens und einer todbringenden außerirdischen Spezies. Die Vorväter des Stammes, eine Schar außerirdischer Eroberer, die vor Jahrtausenden auf der Erde Schiffbruch erlitten hatten und schon seit undenklichen Zeiten ausgestorben waren, hatten sich mit Menschenfrauen gepaart und ihren Abkömmlingen den Durst – den Urtrieb nach dem lebensspendenden menschlichen Blut – vererbt.
Diesen außerirdischen Genen hatte der Stamm große Stärken, aber auch vernichtende Schwächen zu verdanken. Nur ihre menschliche Seite, die Eigenschaften, die über die mütterliche Linie vererbt wurden, sorgte dafür, dass die Rasse zivilisiert bleiben und sich an Ordnung und Regeln halten konnte – wie beispielsweise den Ehrenkodex seiner Bruderschaft, des Ordens der Stammeskrieger. Trotzdem konnten Stammesvampire ihrer dunklen, wilden Seite verfallen und zum Rogue mutieren, einer Existenzform, die in einer Sackgasse von Blut und Wahnsinn endete.
Dante verachtete dieses Element seiner Rasse, und als Stammeskrieger war es seine Pflicht, seine Roguebrüder auszulöschen, wo immer er ihnen begegnete. Als Mann, der gerne seinen Vergnügungen nachging, war Dante nicht sicher, was er mehr genoss: eine warme, saftige Frauenvene, auf die er seinen Mund pressen konnte, oder das Gefühl einer titanbeschichteten Stahlklinge in der Hand, wenn seine Waffe sich in die Körper seiner Feinde fraß und sie in Straßendreck verwandelte.
„Darf ich mal anfassen?“ Die pinkhaarige Hexe auf seinem Schoß starrte fasziniert auf Dantes Mund. „Wow, deine Zähne sehen ja so echt aus! Die muss ich einfach mal anfassen.“
„Vorsichtig“, warnte er sie, als sie ihre Finger an seine Lippen hob. „Ich bin bissig.“
„So?“, kicherte sie, ihre Augen wurden größer. „Du siehst mir ganz danach aus, Süßer.“
Dante saugte ihren Finger in seinen Mund und überlegte, was wohl die schnellste Art war, diese Kleine flachzulegen. Er musste Nahrung zu sich nehmen, aber wenn es dabei auch zu einer kleinen Nummer kam, hatte er nie etwas dagegen – als Vorspiel oder gleichzeitig, während er trank, das war ihm einerlei. Gut war es immer.
Gleichzeitig, entschied er jetzt impulsiv, als seine Fangzähne in ihre fleischige Fingerkuppe drangen, gerade als sie den Finger wieder zurückziehen wollte. Sie keuchte, als er an der kleinen Wunde saugte, noch wollte er sie nicht fortlassen. Der Geschmack von Blut, auch wenn es nur die paar winzigen Tropfen waren, erregte ihn und schärfte die Pupillen seiner goldfarbenen Augen zu vertikalen Schlitzen. Heißes Verlangen durchzuckte ihn und sammelte sich in der anschwellenden Beule zwischen seinen Beinen, unter seiner schwarzen Lederhose spannte sich sein Schwanz.
Die junge Frau stöhnte und schloss die Augen, sie räkelte sich katzenartig auf seinem Schoß. Dante ließ ihren Finger los, schloss die Hand um ihren Kopf und zog ihren Hals näher zu sich heran. Eine Quelle in der Öffentlichkeit zu nehmen war eigentlich nicht sein Stil, aber ihm war todlangweilig, jetzt brauchte er einfach Zerstreuung. Außerdem würde es heute Nacht, wo die Stimmung im Club von Gefahr und offener Sinnlichkeit pulsierte, bestimmt niemand bemerken. Was die Kleine auf seinem Schoß anging, so würde sie nur Lust spüren, während er sich von ihr nahm, was er brauchte. Danach würde sie sich an nichts erinnern, er würde vollständig aus ihrem Gedächtnis getilgt sein.
Dante beugte sich vor und zog ihren Kopf in Position, vor Hunger lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Beiläufig warf er noch einen Blick über ihre Schulter und merkte plötzlich, dass er beobachtet wurde. Zwei junge Männer – gewöhnliche Vampire, Bewohner der Vampirreservate, der sogenannten Dunklen Häfen – sahen ihm aus ein paar Metern Entfernung zu. Es waren noch Jugendliche – ohne Zweifel gehörten sie der aktuellen Generation des Stammes an. Sie flüsterten miteinander, hatten ihn klar als Stammeskrieger erkannt und überlegten anscheinend, ob sie es wagen sollten, ihn anzusprechen.
Verpisst euch, dachte Dante in ihre Richtung, öffnete die Lippen und machte sich daran, seiner Blutwirtin die Halsschlagader zu öffnen.
Aber die jungen Vampire ließen sich von seinem abweisenden Blick nicht abwimmeln. Der Größere der beiden, ein blonder Junge in Armeehosen, Motorradstiefeln und schwarzem T-Shirt, kam schon auf ihn zu, im Schlepptau seinen Gefährten, der weite Jeans, hohe Turnschuhe und eine übergroße Lakers-Jacke trug.
„Verdammt.“ Im Grunde hatte Dante nichts dagegen, wenn ihm gelegentlich jemand zusah, aber ein glotzendes Publikum aus nächster Nähe, wenn er Nahrung zu sich nahm, hatte ihm gerade noch gefehlt.
„Was hast du denn?“, jammerte seine Beinahe-Blutwirtin, als er sich von ihr losmachte.
„Nichts, Schätzchen.“ Er legte ihr die Hand flach auf die Stirn und wischte die letzte halbe Stunde aus ihrer Erinnerung. „Geh jetzt zurück zu deinen Freundinnen.“
Folgsam erhob sie sich von seinem Schoß und ging davon, verschmolz mit den durcheinanderwimmelnden Körpern auf der Tanzfläche. Die beiden Vampire aus den Dunklen Häfen würdigten sie kaum eines Blickes, als sie an Dantes Tisch traten.
„Was ist los, Jungs?“ Dante warf ihnen die Begrüßung achtlos entgegen, er hatte wirklich null Interesse an Small Talk.
„Hallo.“ Blondie in der Armeehose schenkte ihm ein Nicken und warf sich in Positur, die muskelbepackten Arme vor der Brust verschränkt. Keine einzige Dermaglyphe war auf dieser jungen Haut zu sehen. Definitiv die aktuelle Generation des Stammes, wahrscheinlich noch keine dreißig. „Entschuldige, wir haben da wohl eben was unterbrochen, aber wir müssen dir einfach sagen, Mann – das war hammermäßig, wie ihr Jungs vor ein paar Monaten die Rogues fertiggemacht habt. Alle reden noch davon. Der Orden jagt in einer einzigen Nacht eine ganze Kolonie von diesen Arschlöchern in die Luft – also, denen habt ihr’s wirklich gegeben, Mann. Wahnsinn.“
„Echt stark“, fügte sein Begleiter hinzu. „Also, und da haben wir uns gefragt … Ich meine, wir haben gehört, dass der Orden neue Rekruten sucht.“
„So, habt ihr das?“
Dante lehnte sich in seinem Stuhl zurück und stieß einen gelangweilten Seufzer aus. Es war nicht das erste Mal, dass er von jungen Vampiren aus den Dunklen Häfen angesprochen wurde, die sich den Kriegern anschließen wollten. Der erfolgreiche Schlag gegen die bisher größte Zusammenrottung von Rogues in einer ehemaligen Nervenheilanstalt im letzten Sommer hatte dem einst geheimen Kader der Stammeskrieger eine Menge ungewollter Aufmerksamkeit eingebracht. Seither, so schien es, wurden sie von den jungen Vampiren wie Stars gehandelt.
Um ehrlich zu sein, es konnte einem tierisch auf die Nerven gehen.
Dante kickte seinen Stuhl vom Tisch weg und stand auf.
„Da bin ich nicht der Richtige“, sagte er zu den beiden hoffnungsvollen Möchtegerns. „Und außerdem erfolgt die Aufnahme in den Orden nur per Einladung. Tut mir leid.“
Er schlenderte davon und fühlte sich fast etwas erleichtert, als sein stumm geschaltetes Handy in seiner Jackentasche zu vibrieren begann. Er fischte es heraus und nahm den Anruf entgegen, er kam von der Zentrale im Hauptquartier der Stammeskrieger.
„Ja?“
„Wie läuft’s denn so?“ Es war Gideon, das Computergenie des Ordens, der in der Zentrale als Dispatcher fungierte. „Irgendwelche Oberflächenaktivität zu melden?“
„Nicht viel los hier. Ziemlich tot momentan.“ Dante ließ seinen Blick über den bevölkerten Club schweifen und bemerkte, dass die beiden jungen Vampire sich anschickten weiterzuziehen, sie gingen mit ein paar kostümierten jungen Frauen auf den Ausgang zu. „Bislang keine Rogues zu sehen. Ist das nicht öde? Ich werde noch verrückt, wenn’s hier nicht bald ein bisschen ordentliche Action gibt, Gid.“
„Kopf hoch, alter Junge“, sagte Gideon, ein Grinsen in der Stimme, „die Nacht ist ja noch jung.“
Dante lachte leise. „Sag Lucan, dass ich ihn schon wieder vor ein paar Möchtegerns gerettet habe, die sich bei uns verpflichten wollten. Weißt du, mir war es viel lieber, als wir noch nicht so prominent waren, als wir noch gefürchtet waren und die Leute Abstand hielten. Kommt Lucan mit der Anwerbung voran? Oder wird unser verehrter Anführer zu sehr von seiner atemberaubenden Stammesgefährtin in Beschlag genommen?“
„Ja und ja“, erwiderte Gideon. „Was die Anwerbung angeht, wir haben einen neuen Kandidaten aus New York reinbekommen, und Nikolai hat bei einigen seiner Kontakte in Detroit vorgefühlt. Wir müssen bald mal ein paar Tests für die Neuen arrangieren – du weißt schon. Sie sollen das Ganze erst mal durchlaufen haben, bevor wir verbindlich zusagen.“
„Du meinst, wir werden ihnen ihren Hintern auf einer Platte servieren und dann schauen, welche von ihnen wiederkommen und um mehr betteln?“
„Wieso, geht das denn auch anders?“
„Bin dabei“, knurrte Dante, als er durch den Club auf die Tür zuging.
Er schlenderte in die Nacht hinaus, ging einer Gruppe von Clubbern aus dem Weg – Menschen in zerschlissenen Kleidern und schauderhafter Gesichtsbemalung, Marke aufgewärmter Tod, die wohl Zombies darstellen sollten. Sein hochsensibles Gehör nahm Hunderte von Geräuschen wahr – den üblichen Verkehrslärm, durchsetzt vom Kreischen und Gelächter betrunkener Halloween-Feiernder, die sich auf den Straßen und Gehsteigen drängten.
Und da war noch etwas anderes.
Etwas, das ihn aufhorchen ließ. Das seinen Kriegerinstinkt blitzartig in Alarmzustand versetzte.
„Muss los“, sagte er zu Gideon am anderen Ende. „Jetzt habe ich doch einen Blutsauger geortet, den hol ich mir. So wie’s aussieht, ist die Nacht noch nicht ganz verloren.“
„Ruf durch, wenn du ihn ausgeräuchert hast.“
„Mach ich. Bis später.“ Dante klappte das Handy zu und steckte es in die Tasche.
Er schlich eine Seitengasse entlang, folgte dem tiefen Grunzen und dem muffigen, wabernden Gestank eines Roguevampirs auf Beutejagd. Wie die anderen Stammeskrieger des Ordens empfand Dante tiefe Verachtung für die Mitglieder seiner Spezies, die zu Rogues geworden waren. Jeder Vampir dürstete nach Blut, jeder musste Nahrung zu sich nehmen, manchmal auch töten, um zu überleben. Aber jeder Einzelne von ihnen wusste auch, dass der Grat zwischen notwendiger Lebenserhaltung und Völlerei nur sehr schmal war, oft ging es dabei lediglich um ein paar Schlucke. Wenn ein Vampir zu viel nahm oder seinem Durst zu oft nachgab, lief er Gefahr, süchtig zu werden. Dann wurde der Hunger zu einem Dauerzustand, den sie Blutgier nannten. Diese Krankheit machte einen zum Rogue, zum gewalttätigen Junkie, der für seinen nächsten Schuss alles tat.
Wild und unvorsichtig wie sie waren, brachten die Rogues auch alle anderen Angehörigen ihrer Rasse in Gefahr, von den Menschen bemerkt und verfolgt zu werden, eine Gefahr, die Dante und der Rest des Ordens nicht gewillt waren zu riskieren. Und seit ein paar Monaten wurde immer deutlicher, dass es inzwischen eine noch größere Bedrohung gab: Die Rogues begannen sich zusammenzurotten und zu organisieren, ihre Anzahl wuchs, und ihre Taktiken richteten sich auf ein bestimmtes Ziel aus: den offenen Krieg. Wenn sie nicht aufgehalten wurden, und zwar bald, dann würde sowohl die Menschheit als auch das Vampirvolk zwischen die Fronten eines höllischen, bluttriefenden Gemetzels geraten, gegen das sich das ärgste Weltuntergangsszenario noch harmlos ausnahm.
Solange die Stammeskrieger sich wie jetzt darauf beschränkten, die neue Kommandozentrale der Rogues aufzuspüren, war ihre Aufgabe einfach. Möglichst jeder einzelne Rogue musste gejagt und zur Strecke gebracht werden. Man musste sie auslöschen wie krankes Ungeziefer, das sie waren – eine Aufgabe, die Dante genoss. Nie fühlte er sich mehr in seinem Element, als wenn er mit der Waffe in der Hand durch die Straßen zog und den Kampf suchte. Er empfand es als das, was ihn am Leben hielt, mehr noch: Er wusste, es war die einzige Art, seine schlimmsten inneren Dämonen in Schach zu halten.
Dante bog um eine Straßenecke, dann schlich er in eine weitere enge Gasse hinein, die zwischen einigen alten Ziegelgebäuden in die Dunkelheit führte. Vor sich hörte er eine Frau aufschreien. Sofort stürzte er los und stürmte dem Geräusch entgegen.
Keine Sekunde zu früh.
Der Rogue hatte die beiden von vorhin angefallen, die zwei jungen Vampire aus den Dunklen Häfen und ihre menschlichen Begleiterinnen. Er sah in seiner Standardmontur der Gothicszene, die er unter einem langen, schwarzen Trenchcoat trug, sehr jung aus. Aber jung oder nicht, er war groß und stark und tobte vor Hunger. Eine der Frauen hielt der Vampir im Blutrausch schon im Todesgriff gepackt und hatte sich in ihrem Hals verbissen, die beiden Möchtegern-Krieger standen hilflos und vor Schreck wie versteinert dabei.
Dante zog den Dolch aus der Scheide an seiner Hüfte und ließ ihn fliegen. Die Klinge traf den Rogue tief zwischen die Schulterblätter. Es war eine Spezialanfertigung aus Stahl und Titan, Letzteres von hochtoxischer Wirkung auf den verseuchten Blutkreislauf und die verkümmernden Organe der Rogues. Ein Kuss dieser tödlichen Klinge, und ein Roguevampir begann in Rekordgeschwindigkeit von innen heraus zu kochen und sich zu zersetzen, bis nur noch eine Handvoll Asche von ihm übrig blieb. Jeder Rogue.
Nur dieser nicht.
Er warf den Kopf herum und warf Dante einen wilden Blick zu, seine Augen glühten bernsteinfarben, als er ihm zwischen blutverschmierten Fangzähnen eine bösartige Warnung zuzischte. Aber sein Körper hielt dem Angriff des Dolches stand, er umklammerte seine Beute nur noch fester. Schlaff pendelte ihr Kopf hin und her, während er sie noch gieriger aussaugte als zuvor.
Was zum Teufel war das?
Dante rannte mit seiner zweiten Waffe auf den trinkenden Vampir zu. Er vergeudete keine Sekunde, dieses Mal zielte er direkt auf den Hals, um ihn glatt durchzuschneiden, und jagte die Klinge tief hinein. Aber bevor Dante die Sache zu Ende bringen konnte, drehte sich der Bastard um und brachte sich mit einem Sprung außer Reichweite. Mit einem schmerzerfüllten Aufbrüllen ließ er sein Opfer los und konzentrierte all seine Wut auf Dante.
„Bringt die Menschen weg!“, rief Dante den beiden jungen Vampiren zu, riss die Frau aus der Kampfbahn und stieß sie in ihre Richtung. „Los! Worauf wartet ihr! Säubert sie, löscht ihre Erinnerungen aus, und dann macht, dass ihr mit ihnen fortkommt!“
Die schreckstarren Jungen kamen zu sich. Sie packten die schreienden Frauen und zogen sie vom Schauplatz des Geschehens, während Dante sich den Kopf zerbrach, wie das möglich war:
Der Roguevampir hatte sich nicht aufgelöst, wie er es eigentlich hätte tun müssen nach der doppelten Dosis Titan, die Dante ihm verpasst hatte. Also war er gar kein Rogue. Obwohl er auf Beutejagd gewesen war und gesoffen hatte wie der schlimmste Blutjunkie, konnte er kein Rogue sein.
Dante starrte in die verzerrte Fratze, registrierte die ausgefahrenen Fangzähne, die geschlitzten Pupillen in den gelb glühenden Augen. Der Mund war verschmiert von einer faulig stinkenden, rosafarbenen Speichelschliere, von deren stechendem Gestank sich Dante fast der Magen umdrehte.
Angewidert wich er zurück. Dieser Vampir konnte höchstens im selben Alter sein wie die beiden Jungs aus den Dunklen Häfen – das war ja nur ein verdammter Teenie! Ohne die pulsierende Wunde, die in seinem Hals klaffte, sonderlich zu beachten, griff der Vampir nach hinten und zog sich Dantes Dolch aus der Schulter. Er knurrte, seine Nasenflügel bebten, als wollte er Dante jeden Moment anfallen.
Aber dann ergriff er die Flucht.
Der Bastard machte eine scharfe Kehrtwendung, sein Trenchcoat flatterte wie ein Segel hinter ihm her, während er auf einem Zickzackkurs tiefer in die City rannte. Dante, der ihn keine Sekunde aus den Augen ließ, blieb ihm hart auf den Fersen. Es war eine wilde Verfolgungsjagd durch unzählige Straßen, durch Hintergassen und ganze Stadtviertel und dann weiter hinaus zu den Hafenanlagen am Stadtrand von Boston, wo leere Fabrikhallen und alte Industrieanlagen am Flussufer aufragten wie stumme Wächter. Aus einem der Gebäude drang pulsierende Musik mit wummernden Bässen, Lichtblitze zuckten durch die Nacht, anscheinend war irgendwo in der Nähe eine Raveparty im Gange.
Ein paar hundert Meter vor ihm rannte der Vampir ein Dock entlang auf ein baufälliges altes Bootshaus zu. Sackgasse. Er schäumte vor Wut, schwang sich herum und ging zum Angriff über, stürmte auf Dante zu, brüllend wie ein Wahnsinniger. Seine ganze Vorderseite war von frischem Blut getränkt, dem der jungen Frau, die er so brutal angefallen hatte. Der Vampir schnappte nach Dante, hackte mit seinen Krallen nach ihm, von den ausgefahrenen Fangzähnen troff der Speichel, die gelben Augen glühten in wilder Bosheit. Und aus dem klaffenden Maul drang wieder dieser seltsame, faulig riechende rosafarbene Schaum.
Dante fühlte, wie die Raserei auch ihn überkam. Kampflust brauste ihm durch die Adern und machte ihn zu einem Geschöpf, das sich von dem, das er bekämpfte, gar nicht so sehr unterschied. Mit einem Knurren warf er den Scheißkerl auf die hölzernen Planken des Docks nieder, rammte ihm ein Knie in die breite Brust und zog seine Malebranche-Zwillingsschwerter. Die geschwungenen Klingen glänzten silbern im Mondlicht, von atemberaubender, tödlicher Schönheit. Auch wenn das Titan sich erneut als nutzlos erweisen sollte – es gab mehr als eine Art, einen Vampir zu töten, ob er ein Rogue war oder nicht. Dante stach mit beiden Klingen zu, erst mit der einen, dann mit der anderen, er riss den fleischigen Hals der Bestie auf und trennte mit einem sauberen Schnitt den Kopf ab.
Dante kickte die Überreste über den Rand des Docks ins Wasser. Der dunkle Fluss würde die Leiche bis zum Morgen verbergen, und wenn das Tageslicht kam, würden die UV-Strahlen den Rest erledigen.
Am Wasser kam eine Brise auf, sie führte den Gestank der Verschmutzung durch die angrenzenden Fabriken mit sich, und … noch etwas anderes. Dante vernahm eine Bewegung in der Nähe, aber erst, als er spürte, wie das Fleisch an seinem Bein aufgerissen wurde, war ihm klar, dass er schon wieder angegriffen wurde. Und wieder traf ihn etwas schmerzhaft, dieses Mal am Rumpf.
Du lieber Himmel.
Irgendwo hinter ihm, oben an der alten Fabrik, stand einer und schoss auf ihn. Die Schüsse klangen gedämpft, kamen aber unverkennbar aus einem Maschinengewehr.
Damit war sein langweiliger Abend unvermittelt ereignisreicher geworden, als ihm lieb war.
Dante ließ sich auf den Boden fallen, wieder pfiff eine Kugel an ihm vorbei und in den Fluss. Er rollte sich eben herum, um hinter dem Bootshaus in Deckung zu gehen, als der Scharfschütze erneut ein paar Salven in die Nacht feuerte. Eine schlug in die Ecke der baufälligen Hütte ein, im Kugelhagel zerstob das alte Holz wie Konfetti. Dante bevorzugte den Kampf mit den Klingen, aber er hatte auch immer eine schwere Pistole vom Kaliber neun Millimeter dabei. Nun zog er sie, aber ihm war klar, dass sie auf diese Entfernung nichts gegen den Scharfschützen ausrichten konnte.
Wieder schlug eine Salve in das Bootshaus ein. Eine Kugel streifte Dantes Wange, als er um die Ecke spähte, um einen Blick auf seinen Angreifer zu erhaschen.
Oh, nicht gut. Gar nicht gut.
Es war nicht bloß einer, es waren vier. Vom Fabrikgelände her kamen die dunklen Gestalten langsam das abschüssige Ufer hinab, alle trugen schwere Maschinengewehre. Die Vampire des Stammes konnten Hunderte von Jahren alt werden, sie konnten schwerste physische Verletzungen überstehen, aber deshalb bestanden sie trotzdem nur aus Fleisch und Knochen. Wenn man sie mit Blei vollpumpte, ihnen die Hauptschlagadern durchschnitt oder, noch schlimmer, ihnen den Kopf abhackte – dann starben sie, genau wie jedes andere Lebewesen.
Aber nicht, ohne diesen Scheißkerlen einen ordentlichen Kampf zu liefern.
Dante blieb nah am Boden und wartete, bis die Ankömmlinge in Schussweite waren. Dann eröffnete er das Feuer, schoss einen ins Knie und traf einen anderen am Kopf. Mit Erleichterung sah er, dass sie alle Rogues waren: Die Titanbeschichtung seiner handgegossenen Kugeln machte kurzen Prozess mit ihnen – sie zersetzten sich sofort.
Die beiden übrig gebliebenen Rogues erwiderten das Feuer, und Dante entkam dem Kugelhagel nur knapp, indem er langsam am Bootshaus entlang außer Schussweite robbte. Verdammt! In Deckung zu gehen bedeutete, seine günstige Angriffsposition aufzugeben. Außerdem war er dort zu weit entfernt, als dass ihm seine besondere Fähigkeit, den Angriffsweg seiner Feinde zu spüren, noch etwas nützte. Er hörte sie näher kommen, als er ein neues Magazin einschob.
Dann Stille.
Er wartete eine Sekunde, horchte in die Dunkelheit.
Etwas, das größer war als eine Kugel, flog auf das Bootshaus zu. Mit einem schweren, metallischen Klirren fiel es auf die Dockplanken nieder und rollte dort aus.
O Gott.
Sie hatten eine verdammte Handgranate nach ihm geworfen.
Dante atmete tief ein und warf sich in den Fluss, nur eine Schrecksekunde, bevor das Ding explodierte und das Bootshaus und das halbe Dock in einer gigantischen Explosion aus Rauch, Flammen und Trümmern in die Luft jagte. Die Druckwelle unter dem schlammigen Wasser war wie ein Urknall, Dante spürte, wie sie ihm den Kopf nach hinten riss und sein Körper sich unter dem unerträglichen Druck aufbäumte. Über ihm regneten Trümmerteile auf die Wasseroberfläche herab, angestrahlt von einem blendend hellen, orangefarbenen Feuerwerk.
Die Welt verschwamm vor seinen Augen, als die Druckwelle ihn hinunterzog. Er begann zu sinken.
Unfähig, sich zu rühren, bewusstlos und blutend, trug ihn der starke Sog der Strömung flussabwärts.
2
„Spezielle Lieferung für Frau Doktor Tess Culver.“
Tess sah von einer Patientenakte auf und lächelte, trotz der späten Stunde und ihrer Müdigkeit. „Irgendwann die Tage werde ich lernen, auch mal Nein zu sagen.“
„Denkst du, du brauchst da noch Übung? Wie wär’s, wenn ich dich mal wieder frage, ob du mich heiraten willst?“
Sie seufzte, schüttelte den Kopf und sah in die hellblauen Augen und das strahlende Grinsen, das allein ihr galt. „Ich meine nicht uns beide, Ben. Und wie war das mit acht Uhr? In fünfzehn Minuten ist Mitternacht, um Himmels willen.“
„Na und? Hast du vielleicht vor, dich in einen Kürbis zu verwandeln?“ Er gab dem Türknauf einen Schubs und schlenderte in den kleinen Büroraum, beugte sich zu ihr herunter und küsste sie auf die Wange. „Tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Diese Dinge laufen eben nicht immer genau nach Plan.“
„Mhm. Also, wo ist er?“
„Hinten im Lieferwagen.“
Tess stand auf, zog einen elastischen Haargummi vom Handgelenk und fasste ihr offenes Haar zu einem Pferdeschwanz zusammen. Ihre üppigen goldbraunen Locken sahen immer etwas zerzaust aus, sogar wenn sie frisch vom Friseur kam. Jetzt, nach sechzehn Stunden Dienst in der Klinik, befand ihr Haar sich in einem Stadium völliger Anarchie. Sie blies sich eine Strähne aus den Augen und ging an ihrem Exfreund vorbei auf den Gang.
„Nora, machst du mir bitte eine Spritze Ketamin-Xylazin fertig? Und bitte bereite den Untersuchungsraum für mich vor – den großen.“
„Wird gemacht“, zwitscherte ihre Assistentin. „Hallo Ben. Fröhliches Halloween.“
Er zwinkerte ihr mit seinem berüchtigten Lächeln zu, von dem beinahe jeder Frau die Knie weich wurden.
„Hübsches Kostüm, Nora. Was bist du denn, ein Schweizermädel? Zöpfchen und Lederhosen stehen dir echt gut.“
„Merci vielmals“, antwortete sie und strahlte ihn an, während sie den Empfangsbereich verließ, um zum Medikamentenschrank zu gehen.
„Und wo ist dein Kostüm, Tess?“
„Ich habe es an.“ Sie ging vor ihm her durch die Zwingerabteilung, vorbei an einem Dutzend Käfigen voll schläfriger Hunde und nervöser Katzen, die sie zwischen ihren Gitterstäben unruhig anstarrten. Tess rollte genervt die Augen. „Mein Kostüm heißt: die Super-Tierärztin, die wahrscheinlich ins Kittchen kommt für das, was sie heute macht.“
„Ich sorge schon dafür, dass du keine Schwierigkeiten kriegst. Bisher gab es doch auch nie welche. Oder?“
„Und was ist mit dir?“ Sie stieß die Tür zum hinteren Lagerraum der kleinen Klinik auf und ging mit ihm hindurch. „Du arbeitest in einer gefährlichen Branche, Ben. Du gehst zu viele Risiken ein.“
„Machst du dir etwa Sorgen um mich, Doc?“
„Natürlich mache ich mir Sorgen um dich. Ich liebe dich. Das weißt du.“
„Ja“, sagte er leicht verstimmt, „wie einen Bruder liebst du mich.“
Die Hintertür der Tierklinik ging auf eine schmale Gasse hinaus, wo selten jemand parkte und außer den paar Obdachlosen, die gelegentlich im Schutz der Rückwand am Flussufer übernachteten, kaum einmal jemand hinkam. Nun parkte dort Bens schwarzer VW-Bus. Tiefes Knurren und Schnüffellaute drangen heraus, und der Kleinbus wippte leicht auf und ab, als ob sich darin etwas Großes hin und her bewegte.
Genau das war natürlich auch der Fall.
„Er ist da drin eingesperrt, nicht?“
„Genau. Keine Angst, außerdem ist er zahm wie ein Kätzchen, das verspreche ich dir.“
Tess warf Ben einen zweifelnden Blick zu, als sie von der betonierten Schwelle stieg und um den Kleinbus herumging. „Will ich wissen, woher du den hast?“
„Eher nicht.“
Seit etwa fünf Jahren befand sich Ben Sullivan auf seinem persönlichen Kreuzzug für den Schutz von misshandelten exotischen Tieren. Seine Rettungsaktionen recherchierte und plante er von Fall zu Fall und ging dabei so geschickt vor, dass sogar ein Agent der Regierung noch etwas von ihm lernen konnte. Hatte er die nötigen Informationen zusammengetragen, dann brach er als Ein-Mann-Überfallkommando bei den jeweiligen Tierhaltern ein, befreite die misshandelten, unterernährten oder gefährdeten und illegal eingeführten Tiere aus der Hand ihrer Peiniger und brachte sie zu offiziell anerkannten Tierreservaten, die für artgerechte Unterbringung angemessen ausgerüstet waren. In Notfällen legte er ab und an einen Boxenstopp bei Tess in der Tierklinik ein, wenn die Wunden und Verletzungen seiner Schützlinge sofort medizinisch behandelt werden mussten.
So hatten sie sich vor zwei Jahren kennengelernt. Ben hatte Tess einen misshandelten Serval mit Darmverschluss gebracht. Er hatte die kleine exotische Katze aus dem Haus eines Drogendealers gerettet, wo sie ein Hundespielzeug zerkaut und verschluckt hatte, das nun operativ entfernt werden musste. Es war eine minutiöse, langwierige Angelegenheit gewesen, aber Ben war die ganze Zeit über dageblieben. Und ehe Tess es sich versah, gingen sie auch schon miteinander aus.
Sie war nicht sicher, wie es gekommen war, dass aus dem Flirt mehr wurde, aber irgendwie war es dann passiert. Auf jeden Fall war Ben über beide Ohren in Tess verliebt. Tess mochte ihn – um ehrlich zu sein, sogar sehr –, aber irgendwie wusste sie, dass sie bei dem momentanen Stadium ihrer Beziehung bleiben würden. Sie waren einfach gute Freunde, die ab und zu miteinander ins Bett gingen. Und auch das war in der letzten Zeit etwas abgekühlt. Auf ihr Betreiben hin.
„Möchtest du die feierliche Enthüllung machen?“, fragte sie ihn.
Er öffnete die Doppeltür und schwang sie vorsichtig auf.
„Mein Gott“, hauchte Tess ehrfürchtig.
Der bengalische Tiger war räudig und ausgezehrt, sein Vorderlauf entstellt von einer offenen, eiternden Wunde, offenbar einer Brandverletzung. Aber so hager er auch war, der Tiger war die majestätischste Erscheinung, die Tess je gesehen hatte. Er starrte die beiden Menschen an, das Maul erschlafft, hechelnd hing die Zunge heraus. Die Pupillen waren vor Angst geweitet, seine Augen fast vollkommen schwarz. Der Tiger knurrte und schlug den Kopf gegen die Stangen von Bens Transportkäfig.
Vorsichtig kam Tess näher. „Ich weiß, du armes Ding. Du hast schon bessere Tage gesehen, nicht wahr?“
Sie runzelte die Stirn, als sie die seltsame, klumpige Verformung seiner Vorderpfoten bemerkte, dort, wo die Zehen waren. „Hat man ihm etwa die Krallen gezogen?“, fragte sie, unfähig, die Verachtung in ihrer Stimme zu verbergen.
„Ja. Und die Fangzähne auch.“
„O Gott. Wenn sie sich schon ein so schönes Tier zulegen, warum verstümmeln sie es dann so grausam?“
„Es geht ja schließlich nicht an, dass das Werbemaskottchen die Kunden oder ihre kleinen Bälger in Fetzen reißt, weißt du?“
Tess starrte ihn an. „Werbemaskottchen? Du meinst doch nicht etwa die Waffenhandlung unten beim …“ Sie brach ab und schüttelte den Kopf. „Egal. Ich will’s gar nicht wissen. Bringen wir das Kätzchen rein, damit ich es mir ansehen kann.“
Ben zog eine passgenaue Rampe aus dem Hinterteil seines Kleinbusses. „Spring rein und nimm die Rückseite des Käfigs. Ich halte vorne, da ist es beim Abladen am schwersten.“
Tess tat wie geheißen und half ihm, den rollbaren Transportkäfig auf den Asphalt zu hieven. Als sie die Hintertür der Klinik erreichten, wartete Nora dort schon auf sie. Beim Anblick der Raubkatze keuchte sie auf und redete dann beruhigend auf den Tiger ein. Dann sah sie Ben bewundernd an.
„O mein Gott, das ist doch Shiva? Ich hab schon seit Jahren gehofft, dass er ausbricht und entkommt. Du hast einfach Shiva geklaut!“
Ben grinste. „Schatzeli, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Das ist bloß ein streunender Kater, der heute Nacht auf meiner Türschwelle aufgetaucht ist. Ich dachte, unser Wunderdoc hier könnte ihn mir ein bisschen zusammenflicken, bevor ich ein gutes Zuhause für ihn finde.“
„O, Ben Sullivan, du bist ganz ein Schlimmer! Und mein Held!“
Tess winkte ihrer verliebten Assistentin. „Nora, könntest du bitte mit mir zusammen an dieser Seite anpacken? Wir müssen ihn über die Schwelle heben.“
Nora kam Tess zu Hilfe, und die drei hoben den Käfig an und hievten ihn in den hinteren Lagerraum der Klinik. Sie rollten den Tiger in den vorbereiteten Untersuchungsraum, der – dank Ben – neuerdings über einen Untersuchungstisch mit hydraulischer Hebevorrichtung verfügte. Das war ein Luxus, den Tess sich allein nie hätte leisten können. Auch wenn sie ihre kleine Stammkundschaft hatte, arbeitete sie nicht gerade im reichsten Teil der Stadt. Sie verlangte zudem weit weniger, als sie selbst in diesem Stadtviertel hätte nehmen können – einfach weil es ihr wichtiger war, ihren Beitrag für eine bessere Welt zu leisten, als Profit zu machen.
Leider teilten ihr Vermieter und ihre Zulieferer diese Haltung nicht. Ihr Schreibtisch bog sich unter der Last von Mahnungen, die sie nicht viel länger würde aufschieben können. Sie würde ihre mageren persönlichen Ersparnisse angreifen müssen, und wenn die erst mal weg waren …
„Betäubungsmittel liegt auf dem Tresen“, unterbrach Nora ihren Gedankengang.
„Danke.“ Tess steckte die aufgezogene und zugestöpselte Spritze in die Tasche ihres weißen Laborkittels und dachte, dass sie sie wahrscheinlich gar nicht brauchen würde, so fügsam und lethargisch, wie ihr Patient war. Außerdem würde sie heute Nacht nur eine schnelle Untersuchung vornehmen und sich ein paar Notizen über den generellen Zustand des Tiers machen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was getan werden musste, damit ein sicherer Transport in sein neues Heim gewährleistet war.
„Meinst du, wir können Shiva oder wie dieser Streuner auch immer heißt, dazu bringen, von allein auf den Tisch zu springen, oder sollen wir gleich den Lift benutzen?“, fragte Tess, während Ben sich an den Schlössern des Käfigs zu schaffen machte.
„Wir können’s versuchen. Komm raus, mein Großer.“
Der Tiger zögerte einen Moment, hielt den Kopf geduckt und sah sich im hell erleuchteten Untersuchungsraum um. Dann, als Ben ihm weiter gut zuredete, kam er tatsächlich aus dem Käfig heraus und ließ sich geschmeidig auf dem Metalltisch nieder. Während Tess leise mit ihm sprach und ihm den riesigen Kopf kraulte, setzte sich das Tier auf der Tischplatte wohlerzogen hin wie eine Sphinx, geduldiger als eine Hauskatze.
„Also“, sagte Nora, „braucht ihr jetzt noch was, oder kann ich gehen?“
Tess schüttelte den Kopf. „Klar, geh du nur. Danke, dass du so spät noch dageblieben bist. Das weiß ich wirklich zu schätzen.“
„Kein Problem. Die Party, zu der ich gehe, kommt sowieso erst nach Mitternacht in die Gänge.“ Nora warf ihre langen blonden Zöpfe über die Schultern. „Also, dann bin ich mal weg. Ich schließe beim Rausgehen ab. Nacht, ihr beiden.“
„Gute Nacht“, antworteten sie unisono.
„Sie ist ein prima Mädchen“, sagte Ben, nachdem Nora gegangen war.
„Nora ist die Beste“, stimmte Tess ihm zu, kraulte Shiva und tastete in seinem dicken Fell nach Hautverletzungen, Knoten oder anderen Auffälligkeiten. „Und sie ist kein Mädchen mehr, Ben, sie ist einundzwanzig und fängt demnächst ihr Studium der Veterinärmedizin an, sobald sie mit ihrem letzten Semester am College fertig ist. Sie wird eine wunderbare Tierärztin abgeben.“
„Keine ist so gut wie du. Du hast das magische Händchen, Doc.“
Tess nahm das Kompliment mit einem Achselzucken entgegen, aber es war schon etwas Wahres daran. Sie bezweifelte, dass Ben wusste, wie recht er hatte. Tess verstand es selbst kaum, und was sie verstand, hätte sie am liebsten verdrängt. Verschämt verschränkte sie die Arme und verbarg ihre Hände vor seinem Blick.
„Du musst auch nicht dableiben, Ben. Ich würde Shi…“ Sie räusperte sich und zog eine Augenbraue hoch. „Also, ich würde meinen Patienten gerne für heute zur Beobachtung hier behalten. Bis morgen werde ich noch keine Eingriffe an ihm vornehmen, und bevor ich damit anfange, rufe ich dich an und sage dir, was ich gefunden habe.“
„Du schickst mich jetzt schon weg? Ich dachte, ich könnte dich zum Abendessen überreden.“
„Ich habe schon vor Stunden zu Abend gegessen, Ben.“
„Dann eben Frühstück. Bei mir oder bei dir?“
„Ben“, sagte sie und wich ihm aus, als er zu ihr herüberkam und ihre Wange streichelte. Seine Berührung war warm und zart und wohltuend vertraut. „Das haben wir doch schon mehr als einmal besprochen. Ich denke einfach nicht, dass es eine gute Idee ist …“
Er stöhnte leise auf, ein eindeutig zu erregtes Stöhnen, tief und heiser. Es hatte eine Zeit gegeben, in der dieses Stöhnen ihre Selbstbeherrschung in Butter verwandelt hatte, aber nicht heute Nacht. Nie, nie wieder, wenn sie irgendwie ihre persönliche Integrität bewahren wollte. Es kam ihr einfach nicht richtig vor, mit Ben ins Bett zu gehen, weil er etwas von ihr wollte, das sie ihm nicht geben konnte.
„Ich könnte doch dableiben, bis du hier fertig bist“, schlug er vor, versuchte es mit einem Kompromiss. „Mir gefällt die Idee nicht, dass du hier ganz allein bist. Das ist hier nicht gerade die sicherste Gegend.“
„Geht schon klar. Ich mache nur meine Untersuchung fertig, dann erledige ich noch etwas Papierkram und mache den Laden dicht. Kein Problem.“
Ben schmollte, er war drauf und dran, mit Tess Streit anzufangen, bis sie schließlich seufzte und ihm ihren speziellen Blick zuwarf. Sie wusste, dass er den verstand, den hatte er in ihren gemeinsamen zwei Jahren oft zu sehen bekommen. „Na gut“, lenkte er schließlich ein. „Aber bleib nicht zu lange. Und morgen früh rufst du mich gleich an, versprochen?“
„Versprochen.“
„Und du bist dir ganz sicher, dass du allein mit Shiva zurechtkommst?“
Tess sah auf das magere Geschöpf herunter, das ihr prompt die Hand leckte, sobald sie in seine Reichweite kam. „Wir kommen schon klar miteinander.“
„Was hab ich gesagt, Doc? Dein magisches Händchen. Sieht aus, als wäre er dir auch schon verfallen.“ Ben fuhr sich mit den Fingern durch sein goldblondes Haar und sah sie gespielt niedergeschlagen an. „Ich schätze, um dein Herz zu erobern, muss ich mir Fell und Fangzähne wachsen lassen, ist es das?“
Tess lächelte und rollte die Augen. „Geh nach Hause, Ben. Ich ruf dich morgen an.“
3
Tess wurde schlagartig wach.
Mist. Für wie lange war sie eingedöst? Sie saß in ihrem Büro, ihre Wange ruhte auf Shivas Akte, die offen auf dem Schreibtisch lag. Das Letzte, woran sie sich erinnerte, war, dass sie den unterernährten Tiger abgetastet und ihn zurück in seinen Käfig geführt hatte, um dann ihren Befund niederzuschreiben. Das war – sie sah auf ihre Armbanduhr – vor zweieinhalb Stunden gewesen. Es war kurz vor drei Uhr morgens. Um sieben fing sie schon wieder in der Klinik an.
Tess gähnte tief und streckte ihre verkrampften Arme.
Da hatte sie aber Glück gehab sie war aufgewacht, bevor Nora am Morgen zur Arbeit kam. Sonst hätte sie vielleicht was zu hören bekomme
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!