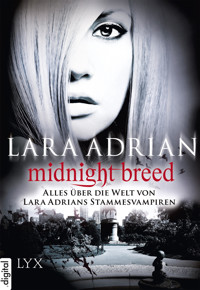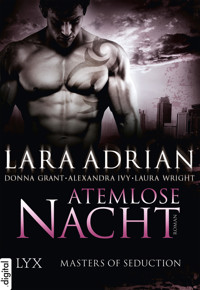9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Midnight Breed
- Sprache: Deutsch
Der Orden der Vampire wird von einem finsteren Widersacher bedroht, der immer mehr an Macht gewinnt. Der Vampir Sterling Chase, der mit den dunklen Abgründen seines Wesens ringt, beschließt, sich zu opfern, um dem gefährlichen Gegner ein für allemal das Handwerk zu legen. Doch seine Pläne werden durchkreuzt, als eine junge Sterbliche zwischen die Fronten des wachsenden Konfliktes gerät. Eine Frau, die ein ungeahntes Geheimnis verbirgt ...
Der zehnte Band der erfolgreichen Vampirsaga "Midnight Breed" von Bestseller-Autorin Lara Adrian!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Titel
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Impressum
LARA ADRIAN
ERWÄHLTE DER EWIGKEIT
Roman
Ins Deutsche übertragen von Katrin Kremmler
Meinen tollen Leserinnen und Online-Communities in den Vereinigten Staaten und anderswo. Ich bin euch so dankbar für euren Enthusiasmus und eure Unterstützung für meine Bücher. Ich hoffe, dieser letzte Teil der Geschichte gefällt euch genauso gut!
Und wie immer danke ich John, dem ich mehr verdanke, als ich in Worten ausdrücken kann.
1
»Die Sprengladungen sind scharf, Lucan. Die Auslöser sind bereit. Auf dein Kommando ist hier alles zu Ende.«
Lucan Thorne stand schweigend im dunklen, schneebedeckten Hof des Bostoner Anwesens, das so lange die Operationsbasis für ihn und seinen kleinen Kader von Waffenbrüdern gewesen war. Über hundert Jahre lang waren sie jede Nacht von hier zu zahllosen Patrouillen aufgebrochen, um für Sicherheit zu sorgen und den brüchigen Frieden aufrechtzuerhalten zwischen den ahnungslosen Menschen, denen die Tagesstunden gehörten, und den Raubtieren, die sich in der Dunkelheit heimlich, manchmal todbringend unter sie mischten.
Lucan und seine Ordenskrieger sorgten schnell und tödlich für Gerechtigkeit und hatten Niederlagen nie gekannt.
Bis heute Nacht.
»Dafür wird Dragos bezahlen«, knurrte er durch die Spitzen seiner hervortretenden Fänge.
Lucans Augen glühten bernsteingelb, als er über den weiten Rasen auf die helle Kalksteinfassade des Herrenhauses im neugotischen Stil starrte. Ein Gewirr von Reifenspuren überzog den Boden, sie stammten von der Verfolgungsjagd mit der Polizei, die am Morgen das hohe Eisentor des Anwesens durchbrochen hatte und vor der Tür des Hauptquartiers mit einem Kugelhagel zu Ende gegangen war. Im Schnee waren noch die Blutspuren zu sehen, wo die Polizei drei Terroristen niedergemäht hatte, die einen Bombenanschlag auf das UN-Gebäude in Boston verübt hatten und dann vom Tatort geflohen waren, verfolgt von einem Dutzend Polizeifahrzeugen und jedem Nachrichtensender der Stadt.
All das – von dem Anschlag auf eine Regierungsinstitution der Menschen zu der von den Medien live übertragenen Verfolgungsjagd der Tatverdächtigen durch die Polizei bis zum gesicherten Gelände des Hauptquartiers – war vom großen Gegenspieler des Ordens inszeniert worden, einem machtbesessenen Vampir namens Dragos.
Er war nicht der erste Stammesvampir, der von einer Welt träumte, in der die menschliche Spezies nur dazu da war, dem Stamm in Angst zu dienen. Aber wo andere vor ihm mit weniger Einsatz versagt hatten, hatte Dragos erstaunliche Geduld und Initiative bewiesen. Fast sein ganzes langes Leben hatte er die Samen seiner Rebellion sorgfältig gesät, sich im Geheimen Anhänger in der Stammesbevölkerung herangezogen und jeden Menschen zu seinem Lakaien gemacht, der ihm bei der Ausführung seiner perversen Ziele dienlich sein konnte.
Lucan und seine Brüder hatten Dragos verfolgt, seit sie vor anderthalb Jahren hinter seine Pläne gekommen waren. Es war ihnen gelungen, ihn zurückzutreiben, jeden seiner Schachzüge zu vereiteln und seine Operation empfindlich zu stören.
Bis heute.
Heute war es der Orden, der zurückgedrängt und in die Flucht getrieben wurde, und Lucan gefiel das ganz und gar nicht.
»Wann kommen sie voraussichtlich im provisorischen Hauptquartier an?«
Die Frage war an Gideon gerichtet, einen der beiden Krieger, die mit Lucan zurückgeblieben waren, um in Boston alles abzuschließen, während der Rest des Hauptquartiers bereits zu einem Zufluchtsort im Norden von Maine unterwegs war. Gideon blickte von seinem kleinen Palmtop auf und sah Lucan über den Rand seiner blau verspiegelten Sonnenbrille an. »Savannah und die anderen Frauen sind jetzt seit fast fünf Stunden unterwegs, also dürften sie in etwa dreißig Minuten vor Ort sein. Niko und die anderen Krieger sind nur ein paar Stunden hinter ihnen.«
Lucan nickte, grimmig, aber erleichtert, dass der abrupte Umzug so gut verlaufen war. Es gab noch diverse Dinge, um die sie sich kümmern mussten, aber vorerst waren alle in Sicherheit, und der Schaden, den Dragos dem Orden hatte zufügen wollen, war auf ein Minimum begrenzt worden.
Neben Lucan bewegte sich etwas. Tegan, der andere Krieger, der mit ihm zurückgeblieben war, kam von seiner letzten Überprüfung des Grundstücks zurück. »Gibt es Probleme?«
»Alles im grünen Bereich.« Tegans Gesicht zeigte keine Emotion, nur grimmige Entschlossenheit. »Die Cops in ihrem Zivilfahrzeug beim Tor sind immer noch in Trance und schlafen. So gründlich, wie ich ihnen die Erinnerungen gelöscht habe, dürften sie wohl erst nächste Woche wieder aufwachen. Und dann werden sie einen mordsmäßigen Kater haben.«
Gideon stieß einen Grunzlaut aus. »Besser, ein paar Cops schlafen als ein öffentliches Blutbad mit Beteiligung jeder Polizeiwache der Innenstadt und der Bundespolizei.«
»Kannst du laut sagen«, sagte Lucan und erinnerte sich an den Schwarm von Cops und Reportern, die am Morgen das Grundstück überflutet hatten. »Wenn das heute eskaliert wäre, wenn einem von den Cops oder FBI-Agenten eingefallen wäre, dass sie sich im Haus umsehen wollen … Scheiße, ich brauche euch beiden sicher nicht zu sagen, wie schnell uns das alles um die Ohren geflogen wäre.«
Tegans Augen blickten ernst in der Dunkelheit. »Schätze, das haben wir Chase zu verdanken.«
»So ist es«, antwortete Lucan. Er war über neunhundert Jahre alt, aber er wusste, den Anblick von Sterling Chase, wie er aus dem Herrenhaus direkt ins Fadenkreuz Dutzender schwer bewaffneter Polizisten und Bundesagenten geschlendert war, würde er für den Rest seines Lebens nicht vergessen. In diesem Augenblick hätte er mehrere Tode sterben können. Wenn nicht durch die adrenalinbefeuerte Panik der bewaffneten Männer, die im Hof versammelt waren, dann durch die halbe Stunde in der prallen Morgensonne.
Aber offensichtlich war das Chase völlig egal gewesen, als er sich von den menschlichen Behörden Handschellen anlegen und wegführen ließ. Indem er sich ergeben, sich persönlich geopfert hatte, hatte er dem Orden kostbare Zeit erkauft. Er hatte die Aufmerksamkeit von dem Herrenhaus und dem, was darunter verborgen war, abgelenkt und Lucan und den anderen die Chance gegeben, das unterirdische Hauptquartier zu sichern und die Evakuierung seiner Bewohner einzuleiten, sobald die Sonne untergegangen war. Nach einer Reihe falscher Entscheidungen und persönlichen Versagens, zuletzt ein misslungener Anschlag auf Dragos, durch den Chases Gesicht ungewollt nationale Schlagzeilen gemacht hatte, war er der Letzte seiner Krieger, von dem Lucan die Rettung erwartet hätte. Was er heute getan hatte, war absolut erstaunlich, praktisch ein Selbstmordkommando.
Allerdings war Sterling Chase schon eine ganze Weile auf einem selbstzerstörerischen Trip. Vielleicht war das seine Art, die Sache ein für alle Mal zu beenden.
Gideon fuhr sich mit der Hand über seinen stacheligen blonden Schopf und fluchte. »Der verdammte Spinner. Ich kann gar nicht glauben, dass er das wirklich getan hat.«
»Das wäre meine Aufgabe gewesen.« Lucan sah von Gideon zu Tegan, dem Krieger, der schon bei der Gründung des Ordens in Europa dabei gewesen war und ihm Jahrhunderte später dabei geholfen hatte, das Hauptquartier in Boston aufzubauen. »Ich bin der Anführer des Ordens. Wenn sich schon jemand opfern musste, um die anderen zu retten, hätte ich es sein sollen.«
Tegan beäugte ihn grimmig. »Was denkst du, wie lange Chase es noch geschafft hätte, gegen seine Blutgier anzukämpfen? Ob er bei den Menschen im Knast sitzt oder frei auf der Straße herumläuft – er ist ein Junkie. Er ist verloren, und er weiß es. Er wusste es, als er heute Morgen aus dieser Tür ging. Er hatte nichts mehr zu verlieren.«
Lucan stieß einen Grunzlaut aus. »Und jetzt sitzt er irgendwo in Polizeigewahrsam, mitten unter Menschen. Er hat uns heute zwar vor der Entdeckung gerettet, aber was, wenn sein Durst ihn überkommt und er die Existenz des Stammes verrät? Dann hätte er mit einem heroischen Moment Jahrhunderte strengster Geheimhaltung zunichtegemacht.«
Tegans Miene war kalt und ernst. »Ich schätze, wir werden ihm eben vertrauen müssen.«
»Vertrauen«, sagte Lucan. »In letzter Zeit hat er oft genug bewiesen, dass man ihm nicht wirklich trauen kann.«
Aber jetzt hatten sie keine andere Wahl. Dragos hatte äußerst effektiv demonstriert, wie weit er in seinem Hass auf den Orden gehen würde. Das Leben von Menschen oder Angehörigen seiner eigenen Spezies bedeutete ihm gar nichts, und heute hatte er gezeigt, dass er bereit war, ihren Machtkampf in der Öffentlichkeit auszutragen. Das war extrem gefährlich, mit unglaublich hohen Risiken verbunden.
Und jetzt war es persönlich geworden. Dragos hatte einen Punkt überschritten, von dem es kein Zurück mehr gab.
Lucan sah zu Gideon hinüber. »Es ist Zeit. Drück auf den Auslöser. Bringen wir’s hinter uns.«
Der Krieger nickte leicht und wandte sich wieder seinem Palmtop zu. »Ach, verdammte Scheiße«, murmelte er, und sein britischer Akzent klang durch. »Na, dann wollen wir mal.«
Seite an Seite standen die drei Stammesvampire in der kalten, dunklen Nacht. Der Himmel über ihnen war klar und wolkenlos, endlose Schwärze, gesprenkelt von Sternen. Alles war ganz still, als hätten Erde und Himmel in diesem Augenblick innegehalten zwischen der Stille einer perfekten Winternacht und dem ersten tiefen Grollen der Explosion, die sich jetzt etwa hundert Meter unter den Füßen der Krieger ausdehnte.
Es schien sich ewig hinzuziehen. Kein bombastisches Spektakel mit Lärm, Feuer und Ascheregen, sondern eine leise und doch gründliche Zerstörung.
»Der Wohntrakt ist versiegelt«, meldete Gideon düster, als der Donner wieder abebbte. Er berührte den Touchscreen seines Palmtops, und eine weitere Reihe von Detonationen drang von tief unter dem schneebedeckten Boden zu ihnen herauf. »Der Waffenraum, die Krankenstation … jetzt sind sie weg.«
Lucan gestattete sich keine nostalgischen Erinnerungen daran, was in dem Labyrinth von Räumen und Korridoren alles passiert war, die Gideon nun mit einem Fingerdruck auf diesem winzigen Computerbildschirm systematisch zum Explodieren brachte. Es hatte über hundert Jahre gedauert, das Hauptquartier zu bauen und zu dem zu machen, was es bis heute gewesen war. Er konnte nicht leugnen, dass er einen kalten Schmerz in seiner Brust spürte, als es jetzt so methodisch zerstört wurde.
»Die Kapelle ist versiegelt«, sagte Gideon nach einem weiteren Druck auf den digitalen Auslöser. »Jetzt ist nur noch das Techniklabor übrig.«
Lucan hörte das kurze Stocken in der tiefen Stimme des Kriegers. Das Techniklabor war Gideons ganzer Stolz gewesen, das Nervenzentrum des Hauptquartiers. Hier hatten sie sich jede Nacht versammelt und die Strategie ihrer Missionen durchgesprochen. Unwillkürlich sah Lucan die Gesichter seiner Brüder vor sich, eine prächtige Truppe von ehrenhaften, mutigen Stammesvampiren, die um den Konferenztisch des Techniklabors versammelt waren, jeder Einzelne von ihnen bereit, für die anderen sein Leben zu riskieren. Einige von ihnen hatten genau das getan. Und andere würden es mit großer Wahrscheinlichkeit noch tun.
Als die leisen unterirdischen Explosionen sich fortsetzten, spürte Lucan, wie sich etwas auf seine Schulter senkte. Er sah zu Tegan hinüber, die große Hand des Kriegers blieb schwer auf ihm liegen, und seine kühlen grünen Augen sahen Lucan in einer unerwarteten Demonstration von Solidarität an, bis der letzte Donner langsam verhallt war.
»Das war’s«, verkündete Gideon. »Es ist vorbei.«
Eine Weile lang sagte keiner von ihnen etwas. Es gab nichts zu sagen im dunklen Schatten des jetzt leer stehenden Herrenhauses mit dem zerstörten Hauptquartier darunter.
Schließlich trat Lucan vor. Seine Fänge bohrten sich in seine Zunge, als er einen letzten Blick auf das Anwesen warf, das für so lange Jahre sein Hauptquartier, das Zuhause seiner Familie gewesen war. Seine Augen glühten bernsteinfarben, transformiert durch seine Wut. Heftig drehte er sich zu seinen beiden Gefährten um, und als er endlich Worte fand, klang seine Stimme barsch und rau vor Entschlossenheit. »Hier sind wir fertig, aber diese Nacht ist nicht das Ende, von gar nichts. Sie ist erst der Anfang. Dragos will Krieg mit dem Orden? Bei Gott, den kann er haben.«
2
In der Arrestzelle im Sheriffbüro von Suffolk County stank es nach Schimmel, Urin und scharfem menschlichen Schweiß, nach Angst und Krankheit. Sterling Chases übersinnlich scharfe Sinne zuckten zurück, als er unter schweren Lidern einen Blick auf die drei Gestalten warf, die in Handschellen mit ihm in der Zelle saßen. Auf der anderen Seite des knapp fünf Quadratmeter großen fensterlosen Raumes trappelte der Junkie auf der Bank gegenüber nervös auf dem abgewetzten weißen Linoleumboden herum. Man hatte ihm die Hände auf den Rücken gefesselt, und seine schmalen Schultern unter dem zerknitterten karierten Flanellhemd waren gekrümmt. Sein Gesicht war ausgezehrt, er hatte dunkle Ringe unter den tiefliegenden Augen, und sein Blick schoss unruhig hin und her, von Wand zu Wand, von der Decke zum Boden, und wieder von vorn. Dabei vermied er es, Chase direkt anzusehen, wie ein panisches, in die Ecke getriebenes Nagetier, dessen Instinkt ihm sagte, dass ein gefährliches Raubtier in seiner Nähe war.
Am anderen Ende der langen Bank saß ein Mann mittleren Alters mit beginnender Glatze, so reglos wie ein Stein. Er schwitzte heftig, die jämmerlich dünne Haarsträhne, die er sich quer über die Glatze gekämmt hatte, hing ihm schlaff in die fettige Stirn. Er murmelte leise vor sich hin, betete in einem fast unhörbaren Flüstern, doch Chase verstand jedes Wort: Er flehte seinen Gott um die Vergebung seiner Sünden an und schacherte mit der Inbrunst eines Mannes, der kurz vor seiner Hinrichtung stand, um Gnade. Keine Stunde früher hatte derselbe Mann lautstark seine Unschuld beteuert und den Cops, die ihn verhaftet hatten, Stein und Bein geschworen, dass er keine Ahnung hatte, wie die Hunderte von Fotos, auf denen er mit nackten Kindern zugange war, auf seinem Computer gelandet waren. Chase konnte es kaum ertragen, dieselbe Luft wie der Pädophile zu atmen, geschweige denn ihn anzusehen. Aber es war der dritte Mann in der Arrestzelle, der bullige Schlägertyp, der vor zehn Minuten angekommen war, frisch verhaftet wegen häuslicher Gewalt, bei dessen Anblick Chase die Zähne zusammenbeißen musste wie ein Schraubstock. Weite Jeans, darüber ein Bierbauch wie der einer Schwangeren, über den sich ein altes graues Sweatshirt mit dem Schriftzug der Patriots spannte. Es war am Schultersaum zerrissen, das rot-weiß-blaue Logo auf der Vorderseite mit Spuren von Schmorbraten und Kartoffelbrei verschmiert. Der Beule auf dem zerschlagenen Nasenrücken und den blutigen Fingernagelspuren, die sich seine linke Gesichtshälfte hinunterzogen, nach zu urteilen, hatte sein weibliches Opfer ihm ordentlich Gegenwehr geleistet. Chases Nasenflügel weiteten sich, er spürte ein Kitzeln im Hals, als sein Blick auf die vier langen, blutigen Kratzer auf der Wange des Mannes einzoomte.
»Das verdammte Miststück hat mir die Nase gebrochen«, sagte der Typ und lehnte sich gegen die weiß glasierte Ziegelwand der Zelle zurück. »Haste Töne? Ich geb ihr einen Klaps, weil sie mir mein Abendessen in den Schoß fallen lässt, sag ihr, sie soll gefälligst aufpassen, wohin sie geht. Und da holt sie aus und scheuert mir eine. Großer Fehler.« Er grunzte und verzog verächtlich den Mund. »Aber so blöd ist sie nicht, dass sie das noch mal versucht. Und die verdammten Bullen, Mann! Hätte wissen sollen, dass sie dem Miststück glauben und nicht mir. Genau wie beim letzten Mal. Ich soll schlucken, dass ein Richter mir mit einem Papier vor der Nase rumwedelt und sagt, ich soll mich von meiner eigenen Frau fernhalten? Darf mein eigenes Haus nicht mehr betreten? Eins geschissen! Und die Alte kann mich mal. Die hab ich schon öfters ins Krankenhaus gebracht. Wenn ich die das nächste Mal sehe, richte ich sie so zu, dass sie nie wieder die Cops auf mich hetzen kann.«
Chase sagte nichts, hörte nur schweigend zu und versuchte, sich nicht zu intensiv auf die hellroten Blutrinnsale zu fixieren, die dem Schläger über Wange und Kiefer rannen. Der Anblick und Geruch von frischem Blut war genug, um das Raubtier in jedem Stammesvampir zu wecken, aber besonders in Chase.
Mit auf die Brust gesenktem Kopf atmete er flach ein, und in der abgestandenen, muffigen Luft des Raumes und dem kupfrigen Geruch geronnener roter Zellen roch er noch etwas anderes, noch Beunruhigenderes, rau und wild, fast schon tollwütig.
Sich selbst.
Seine Mundwinkel zuckten, als er das erkannte, aber es war schwer, diese Ironie zu würdigen, wenn einem durch den Drang nach Nahrung das Zahnfleisch pulsierte. Von dem wilden Durst, der ihn schon länger begleitete, als er zugeben wollte, waren seine Sinne ständig überreizt. Er spürte jede Minute vergehen, sah jedes winzige Zucken seiner rastlosen Zellengenossen. Hörte jedes ängstliche Ein- und Ausatmen, jeden rhythmischen Herzschlag. Er hörte das Blut in den Adern der drei Männer rauschen, die mit ihm in der Zelle waren, nur auf Armeslänge von ihm entfernt.
Bei dem Gedanken bekam er Speichelfluss. Hinter seiner Oberlippe bohrten sich die Spitzen seiner Fänge wie Zwillingsdolche in seine Zunge. Seine Sicht schärfte sich, seine Augen begannen bernsteingelb zu glühen, und seine Pupillen unter den geschlossenen Lidern zogen sich zu schmalen Schlitzen zusammen.
Scheiße. Das war kein guter Ort für ihn, schon gar nicht in diesem Zustand.
Schlechter Ort, schlechte Idee. Und er hatte so gut wie keine Chance, hier rauszukommen.
Nicht dass er sich heute Morgen über so etwas Gedanken gemacht hatte, als er sich auf dem Rasen vor dem Ordenshauptquartier der Polizei gestellt hatte. Sein einziger Gedanke war gewesen, seine Freunde zu schützen. Ihnen Gelegenheit zu geben – sehr wahrscheinlich ihre einzige Chance –, der Entdeckung durch die menschlichen Behörden zu entgehen. Er hatte gehofft, dass sie das Hauptquartier räumen und zu einem sicheren Ort gelangen konnten.
Und so hatte er keinen Widerstand geleistet, als die Cops ihm Handschellen angelegt und ihn auf die Wache gefahren hatten. Bei dem folgenden siebenstündigen Verhör hatte er sich kooperativ gezeigt, den Bostoner Cops und den FBI-Leuten aber nur so viel an Informationen gegeben, dass sie vorerst zufrieden waren und sich auf ihn als den einzigen Verantwortlichen für die Gewaltwelle der letzten Zeit in der Stadt konzentrierten, die vor ein paar Nächten mit einer Schießerei auf der Weihnachtsfeier eines aufstrebenden jungen Politikers im Nobelviertel North Shore begonnen hatte.
Der misslungene Mordanschlag ging auf Chases Konto, aber seine Zielperson war nicht der junge, aufstrebende Senator oder sein Ehrengast, der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, gewesen, wie die Cops und Bundesagenten annahmen. Chase hatte in jener Nacht auf einen Vampir namens Dragos geschossen. Der Orden hatte Dragos seit über einem Jahr gejagt, und plötzlich hatte Chase den Bastard gefunden, wie er sich auf einer gesellschaftlichen Veranstaltung mit einflussreichen Menschen als einer von ihnen ausgab. Chase konnte nur raten, was er im Schilde führte, aber es konnte nichts Gutes sein. Darum hatte er, als er die Gelegenheit zum Handeln sah, nicht gezögert, auf den Mistkerl zu schießen.
Aber er hatte versagt.
Nicht nur, dass es Dragos gelungen war, dem Anschlag zu entkommen, sondern Chase war auch in den folgenden Stunden in den Fokus jedes Medienkanals des Landes geraten. Er war auf der Feier des Senators gesehen worden, und die Augenzeugin hatte der Polizei eine fast schon fotografische Beschreibung von ihm geliefert.
Das plus der Bombenanschlag auf das UN-Gebäude in Boston am nächsten Tag, und die Verfolgungsjagd mit dem Tatverdächtigen – schwer bewaffnete Extremisten aus dem Hinterland, die die Cops direkt zum Anwesen des Ordens geführt hatten –, und die Bostoner Polizei war sicher, dass sie eine bedeutende heimische Terrorzelle ausgehoben hatte.
Eine Fehlannahme, aber vorerst ließ Chase sie gerne in diesem Glauben.
Er hatte die Tagesstunden im Revier verbracht, sich kooperativ gezeigt und den Cops das Gefühl gegeben, dass sie ihn ganz unter Kontrolle hatten. Je länger er dort saß und die volle Verantwortung für die Geschehnisse der letzten Zeit auf sich nahm, ihnen alles erzählte, was sie hören wollten, desto weniger dringend schien es der Polizei, das Anwesen zu durchsuchen. Er hatte getan, was er konnte, um die Aufmerksamkeit von seinen Freunden im Hauptquartier abzulenken. Wenn sie die Zeit nicht klug genutzt und das Hauptquartier geräumt hatten, konnte er nichts mehr für sie tun.
Und was ihn anging, musste er sich auch allmählich auf den Weg machen.
Er hatte Dragos einen Vergeltungsschlag zu liefern – dem Bastard würde noch Hören und Sehen vergehen.
In den letzten Wochen hatte er seine Aktivitäten verstärkt, und nachdem er mit seinem letzten Schlag den Orden fast vor den Menschen enttarnt hätte, graute Chase beim Gedanken, was Dragos als Nächstes tun würde. Nicht zum ersten Mal dachte Chase über den Senator nach, den Dragos in letzter Zeit so umgarnt hatte. Der Mann war in Gefahr, allein schon weil er mit Dragos in Verbindung stand– wenn Dragos ihn nicht schon in seine Dienste genommen hatte, seit Chase ihn zum letzten Mal gesehen hatte.
Und wenn Dragos einen Senator der Vereinigten Staaten zu einem seiner Lakaien gemacht hatte – besonders einen wie Robert Clarence, der durch seine Freundschaft mit seinem alten Mentor von der Universität, dem Vizepräsidenten, persönlichen Zugang zum Weißen Haus hatte? Nicht auszudenken. Die Folgen eines solchen Schachzugs wären irreparabel.
Umso mehr Grund, so bald wie möglich hier herauszukommen. Er musste sich vergewissern, dass Senator Robert Clarence nicht schon von Dragos kontrolliert wurde. Oder noch besser, Dragos finden. Ihn ein für alle Mal ausschalten, wenn nötig im Alleingang. Die Metallhandschellen an seinem Rücken konnten ihn nicht länger festhalten, als er es zuließ. Genauso wenig die verschlossene Zelle und die Cops, die auf dem Korridor vorbeischlenderten und gelegentlich stehen blieben, um ihm durch das kleine Sichtfenster in der Zellentür wütende Blicke zuzuwerfen.
Es war Nacht geworden. Das wusste Chase auch ohne eine Uhr an den nackten Zellenwänden oder ein Fenster mit Blick auf die Straße draußen vor dem Gebäude. Er konnte es in seinen Knochen spüren, bis ganz hinein in sein schwaches und hungerndes Mark. Und mit der Nacht kam sein Hunger wieder, der wilde Durst, der ihn jetzt beherrschte.
Er kämpfte ihn nieder und konzentrierte seine Gedanken auf seinen Vergeltungsschlag gegen Dragos.
Keine leichte Aufgabe, denn der Schlägertyp mit den blutigen Kratzern im Gesicht kam jetzt langsam zu ihm in seine Ecke herüber.
»Verdammte Scheißbullen, was? Denken, sie können uns hier sitzen lassen ohne Wasser und was zu essen, uns aneinanderfesseln wie Tiere.« Er schnaubte verächtlich und ließ sich schwer neben Chase auf die Bank fallen. »Wofür haben sie dich eingelocht?«
Chase antwortete nicht. Es kostete ihn schon genug Anstrengung, das tiefe Knurren zurückzuhalten, das aus seiner ausgedörrten Kehle aufstieg. Er hielt den Kopf gesenkt und die Augen niedergeschlagen, damit der Mann ihr ausgehungertes Glühen nicht sah.
»Was, biste dir zu gut, mit mir zu reden oder was?« Er spürte, dass der Typ ihn taxierte, den Blick über die Trainingshosen und das T-Shirt wandern ließ, die Chase bei seiner Einlieferung getragen hatte – dieselben Sachen, die er in der unterirdischen Krankenstation des Hauptquartiers getragen hatte, bevor er sich losgerissen hatte und nach oben gerannt war, um seine Freunde zu retten. Er war auch barfuß gewesen, aber jetzt trug er schwarze Plastikschlappen, die ihm das Bezirksgefängnis Suffolk ausgegeben hatte.
Obwohl ihm sein blondes Haar tief in die Stirn hing und er den Blick abgewandt hatte, konnte Chase spüren, dass der Mann ihn fixierte. »Sieht aus, als hätte dich auch einer in die Mangel genommen, Kumpel. Dein Bein blutet durch deine Hosen.«
So war es. Chase sah auf den kleinen roten Fleck hinunter, der durch den grauen Stoff auf seinem rechten Oberschenkel sickerte. Schlechtes Zeichen, seine Verletzungen der letzten Nacht verheilten immer noch nicht. Dazu brauchte er Blut.
»Waren das die Bullen oder was, Mann?«
»Oder was«, murmelte Chase, seine Stimme war rau wie Sand. Er sah kurz zu dem Mann auf, bleckte die Oberlippe und ließ die Spitzen seiner Fänge sehen.
»Schei–« Der große Mann riss die Augen auf. »Was ist das denn?«
Erschrocken stolperte er ein paar Schritte zurück und fiel gegen die Zellentür, gerade als sie von zwei uniformierten Beamten geöffnet wurde.
»Zeit für einen Spaziergang, Jungs«, sagte der erste. Er sah sich im Raum um, von dem Pädophilen und dem Junkie, die beide außer ihrem eigenen Elend nichts wahrzunehmen schienen, zu dem Schlägertyp, der seinen Rücken jetzt fest gegen die gegenüberliegende Wand presste und mit offenem Mund schnaufte, als hätte er eben einen Marathon hinter sich. »Gibt’s ein Problem hier?«
Chase hob das Kinn gerade hoch genug, um dem keuchenden Mann auf der anderen Raumseite einen schmalen Blick zuzuwerfen. Dieses Mal hielt er die Lippen geschlossen und dämpfte das bernsteinfarbene Glühen seiner Augen zu einem stumpfen Glitzern. Aber seine Drohung war klar genug, und der riesige, derbe, prügelnde Ehemann wollte es nicht darauf ankommen lassen. »N-nein«, stammelte er und schüttelte hastig den Kopf. »Gar kein Problem hier, Officer. Alles bestens.«
»Gut.« Der Cop betrat die Arrestzelle, während sein Partner die Tür offen hielt. »Alles aufstehen. Mir nach.« Er blieb vor Chase stehen und zeigte mit dem Kinn in die Richtung des Korridors draußen vor der Zelle. »Du zuerst, Arschloch.«
Chase erhob sich von der Bank. Mit seinen fast zwei Metern überragte er den Offizier und die anderen Männer in der Zelle. Obwohl er dank seiner Stammesgene und eines Stoffwechsels, der wie ein Hochleistungsmotor lief, in seinem Leben nie trainiert hatte, ließ sein muskulöser Körper den von zu viel Krafttraining aufgepumpten Cop wie einen Zwerg erscheinen. Als wollte er seine Autorität über Chase behaupten, plusterte der Mann sich auf und drehte Chase in Richtung Tür, die andere Hand auf dem Griff seiner Pistole im Holster.
Chase ging vor ihm hinaus, aber nur, weil es einfacher war, seinen Abgang aus der Halle statt aus der Arrestzelle zu machen.
Hinter ihm erklang die einschmeichelnde, übertrieben höfliche Stimme des Pädophilen.
»Dürfte ich wohl fragen, wohin Sie uns bringen, Officer?«
»Da lang«, sagte der andere Cop und führte die Gruppe vorbei am Empfangsschalter in der Halle und auf einen langen Korridor zu, der in den hinteren Teil des Reviers führte.
Chase stapfte über das ausgetretene Linoleum und wartete auf einen günstigen Augenblick, um aus der Wache zu rasen, bevor die Menschen auch nur merkten, dass er fort war. Es war ein riskanter Schritt, der garantiert jede Menge Fragen aufwarf, aber dummerweise hatte er keine Wahl.
Als er gerade zu seinem Sprint in die Freiheit ansetzen wollte, öffnete sich eine Stahltür am anderen Ende des Korridors. Kalte Nachtluft drang herein, und feiner Dezemberschnee umtanzte die große, schlanke Gestalt einer jungen Frau. Sie war in einen langen Wollmantel mit Kapuze eingehüllt. Welliges, kastanienbraunes Haar klebte an ihren von der Kälte geröteten Wangen und hing ihr in die ruhigen, intelligenten Augen.
Chase erstarrte. Er sah zu, wie sie sich den frischen Schnee von den glänzenden Lederstiefeln stampfte und sich zu einem der Polizeibeamten umdrehte, der sie ins Revier begleitete.
Wow, dachte Chase. Das war die Zeugin von der Weihnachtsfeier des Senators.
Der Cop, der sie hineinbegleitete, registrierte Chases Blick, und sein Gesicht wurde hart. Er warf den beiden Beamten, die die Delinquenten zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt durchs Revier führten, einen finsteren Blick zu und führte Senator Clarences attraktive Assistentin in einen Raum neben dem Korridor und außer Sichtweite.
»Weitergehen«, sagte der Cop, der das Schlusslicht der Gruppe bildete.
Wenn Chase an den Senator herankommen wollte, standen die Chancen offenbar gut, dass Bobby Clarence heute Abend auf der Wache sein würde, zusammen mit seiner hübschen Assistentin.
Neugierig genug, um das herauszufinden, verwarf Chase seine Fluchtpläne. Stattdessen verfiel er mit den anderen in Gleichschritt und ließ sich von den Cops weiter den Korridor hinunterführen, auf den Raum zu, in dem seine Augenzeugin verschwunden war.
3
»Bitte treten Sie ein, Ms Fairchild. Das dürfte nicht lange dauern.« Der Detective, der sie im Revier empfangen hatte, öffnete die Tür zu dem Raum für die Gegenüberstellung der Zeugen und ließ ihr den Vortritt. Drinnen warteten bereits mehrere grimmig blickende Männer in dunklen Anzügen und ein paar uniformierte Polizeibeamte auf sie.
Tavia erkannte die FBI-Agenten, die man ihr in den Stunden nach der Schießerei auf der Weihnachtsfeier des Senators vorgestellt hatte. Sie nickte der Gruppe grüßend zu und trat in den Raum ein.
Es war dunkel wie in einem Kino, die einzige Lichtquelle war die große Glasscheibe mit Blick in den leeren Gegenüberstellungsraum auf der anderen Seite. Neonröhren an der Decke tauchten den Raum in einen grellen weißen Schein, was ihn nicht gerade einladender machte. Über die Rückwand zog sich in zwei Metern Höhe eine Markierungslinie, darüber in regelmäßigen Abständen die Zahlen eins bis fünf.
Der Detective zeigte auf einen von mehreren vinylgepolsterten Stühlen vor dem großen Sichtfenster. »Wir fangen gleich an, Ms Fairchild. Bitte nehmen Sie Platz.«
»Danke, ich stehe lieber«, antwortete sie. »Und bitte, Detective Avery, nennen Sie mich Tavia.«
Er nickte, dann stapfte er in die hintere Ecke hinüber, wo ein Wasserspender und eine Kaffeemaschine standen. »Ich würde Ihnen ja Kaffee anbieten, aber der ist sogar grässlich, wenn er frisch ist, und so spät am Tag ist er schlimmer als Rohöl.« Er stellte einen Papierbecher unter den Wasserspender und zog am Hebel. In dem durchsichtigen Behälter sprudelten einige große Blasen, als der Becher sich füllte. »Spezialität des Hauses«, sagte er, drehte sich zu ihr um und hielt ihr den Becher hin. »Möchten Sie?«
»Nein danke.« Obwohl sie seine Bemühungen, eine entspannte Atmosphäre für sie zu schaffen, zu schätzen wusste, hatte sie kein Interesse an höflichem Geplänkel oder weiteren Verzögerungen. Sie hatte hier einen Job zu erledigen – und einen Laptop voller Termine, Excel-Tabellen und Präsentationen, die sie noch überarbeiten musste, sobald sie nach Hause kam. Normalerweise machte es ihr nichts aus, wenn aus Überstunden eine Nachtschicht wurde. Um ihr Privatleben hatte sie sich ja weiß Gott nicht zu sorgen.
Aber heute Nacht war sie angespannt, spürte die seltsame Mischung aus geistiger Überreizung und physischer Erschöpfung, wie immer nach einer der ausgedehnten Untersuchungen und Behandlungen in der Privatklinik ihres Hausarztes. Sie hatte den größten Teil des Tages bei ihrem Spezialisten verbracht, und obwohl sie nicht begeistert gewesen war, am Abend auch noch einen Zwischenstopp auf dem Polizeirevier einzulegen, wollte sich ein Teil von ihr persönlich davon überzeugen, dass der Mann, der vor einigen Tagen das Feuer auf einen Saal voller Menschen eröffnet hatte und für den heutigen Bombenanschlag in der Innenstadt verantwortlich war, tatsächlich hinter Schloss und Riegel saß, wo er hingehörte.
Tavia ging näher auf das Sichtfenster zu und tippte prüfend mit dem Fingernagel dagegen. »Die muss ziemlich dick sein.«
»Ist sie. Sechs Millimeter dickes Sicherheitsglas.« Avery kam zu ihr herüber und nahm einen Schluck Wasser. »Es ist ein Einwegspiegel. Wir können die auf der anderen Seite sehen, aber die uns nicht, für sie ist es ein Spiegel. Dasselbe gilt für den Ton. Unser Raum hier ist schalldicht, aber wir bekommen den Ton von der anderen Seite über Lautsprecher. Wenn also gleich die bösen Jungs da drüben an der Wand stehen, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, dass sie Sie identifizieren oder sie hören können, was Sie sagen.«
»Ich mache mir keine Sorgen.« Tavia spürte nichts als Entschlossenheit, als sie dem Mann über dem Rand seines Papierbechers in die Augen sah. Dann sah sie sich zu den anderen Beamten und Agenten um. »Könnten wir dann anfangen? Ich wäre so weit.«
»Okay. Gleich werden zwei Beamte eine Gruppe von vier oder fünf Männern nach drüben bringen. Sehen Sie sich die gut an und sagen Sie mir, ob einer von ihnen der Mann sein könnte, den Sie auf der Weihnachtsfeier des Senators gesehen haben.« Der Detective lachte leise und zwinkerte seinen Kollegen zu. »Nach der detaillierten Personenbeschreibung, die Sie uns nach dem Anschlag gegeben haben, dürfte das ein Kinderspiel für Sie sein.«
»Ich tue mein Bestes«, antwortete sie.
Er trank seinen Becher aus und zerdrückte ihn in der Faust. »Normalerweise geben wir keine Informationen über unsere Ermittlungen weiter, aber da der Kerl alles gestanden und sein Recht auf einen Anwalt abgelehnt hat, handelt es sich bei dieser Gegenüberstellung um eine reine Formalität.«
»Er hat gestanden?«
Avery nickte. »Er weiß, dass wir ihn wegen widerrechtlichen Betretens eines Grundstücks und versuchten Mordes drankriegen. Da kann er sich nicht rausreden, das Phantombild nach Ihren Angaben ist absolut eindeutig, und von seiner Flucht hat er noch frische Schussverletzungen.«
»Und das Bombenattentat heute?«, drängte Tavia und sah sich zu den Agenten der Bundespolizei um. »Er hat zugegeben, auch dafür verantwortlich zu sein?«
Einer der FBI-Agenten nickte zustimmend. »Hat nicht einmal versucht, es zu leugnen. Sagt, er hätte das ganze Ding inszeniert.«
»Aber ich dachte, daran waren noch andere beteiligt. Die Verfolgungsjagd mit der Polizei lief den ganzen Tag auf allen Kanälen. Ich habe gehört, alle drei Attentäter wurden auf einem privaten Anwesen von der Polizei erschossen.«
»Das ist korrekt«, bemerkte Avery. »Er hat ausgesagt, die drei Extremisten aus Maine für die praktische Ausführung des Bombenanschlags auf das UN-Gebäude rekrutiert zu haben. Die Hellsten hat er offenbar nicht erwischt, sie haben uns ja direkt zu ihm geführt. Aber er hat keine Gegenwehr geleistet, kam unbewaffnet aus dem Haus und hat sich der Polizei ergeben, sobald sie auf dem Grundstück eintraf.«
»Sie meinen also, er wohnt dort?«, fragte Tavia. Sie hatte Bilder von dem Anwesen mit seinem ausgedehnten Grundstück in den Nachrichten gesehen. Es war fast ein Palast. Der helle dreistöckige Kalksteinbau mit seinen hoch aufragenden Mauern, schwarz lackierten Türen und hohen Spitzbogenfenstern schien eher zum alten Geldadel Neuenglands zu passen als zu einem gewalttätigen Wahnsinnigen mit terroristischen Neigungen.
»Wir konnten den Eigentümer der Immobilie noch nicht ermitteln«, sagte der Detective zu ihr. »Das Anwesen wird seit über hundert Jahren treuhänderisch verwaltet; um an den Grundbucheintrag zu kommen, haben wir mit mindestens zehn Anwaltsfirmen zu tun. Unser Täter behauptet, er wohnt dort seit ein paar Monaten zur Miete, weiß aber nichts über den Eigentümer. Er sagt, es wäre möbliert vermietet worden, ohne Vertrag, und er zahlt die Miete in bar an eine der renommiertesten Anwaltskanzleien in der City.«
»Hat er gesagt, warum er das alles getan hat?«, fragte Tavia. »Wenn er den Anschlag auf den Senator und den Bombenanschlag gestanden hat, hat er Ihnen auch eine Begründung angegeben?«
Detective Avery zuckte mit den Schultern. »Warum tun Verrückte so etwas? Er hatte keine konkrete Begründung dafür. Tatsächlich ist dieser Typ uns fast genauso ein Rätsel wie das Haus, in dem er wohnt.«
»Inwiefern?«
»Wir wissen nicht einmal seinen richtigen Namen. Zu dem, den er uns angegeben hat, existiert keine Sozialversicherungsnummer, auch keine nachweisbaren Beschäftigungsverhältnisse. Kein Führerschein, keine Wagenzulassung, keine Kreditkarten, kein Wählerausweis, gar nichts. Als wäre der Typ ein Geist. Alles, was wir finden konnten, war eine Spende an eine Ehemaligenorganisation der Harvard-Universität unter seinem Namen. Und damit endet die Spur.«
»Nun, das ist immerhin ein Anfang«, antwortete Tavia.
Der Detective stieß ein grunzendes Lachen aus. »Wäre es wohl, wenn diese Information nicht aus den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts wäre. Das ist nicht unser Mann. Beim Schätzen liege ich oft daneben, aber der ist garantiert noch keine neunzig Jahre alt.«
»Nein«, murmelte Tavia und dachte an Senator Clarences Weihnachtsparty zurück, an den Mann, den sie dabei beobachtet hatte, wie er aus der Galerie im ersten Stock des Hauses geschossen hatte. Sie hätte ihn etwa gleich alt geschätzt wie sie, maximal Mitte dreißig. »Vielleicht ein Verwandter von ihm?«
»Vielleicht«, sagte der Detective. Er sah auf, als sich die Tür des anderen Raums öffnete und ein uniformierter Beamter eintrat, der die Verdächtigen anführte. »Okay, es geht los, Tavia. Showtime.«
Sie nickte und trat unwillkürlich einen Schritt von der Scheibe zurück, als der erste Tatverdächtige den Gegenüberstellungsraum betrat.
Er war es – den sie hier auf dem Revier identifizieren sollte.
Sie erkannte ihn sofort, die wie gemeißelt wirkenden Wangenknochen, den angespannten Kiefer und das unversöhnlich gereckte, eckige Kinn. Sein kurzes goldbraunes Haar hing ihm zerzaust in die Stirn, aber nicht tief genug, um seine durchdringenden stahlblauen Augen zu verbergen. Und er war riesig – genauso groß und muskulös wie in ihrer Erinnerung. Unter den kurzen Ärmeln seines weißen T-Shirts wölbten sich seine Bizepsmuskeln, weite, fleckige graue Trainingshosen hingen ihm von den schmalen Hüften und ließen mächtige Oberschenkelmuskeln erahnen.
Wie ein Raubtier kam er in den Raum, und der Trotz, die ungerührte Arroganz, die er ausstrahlte, ließen die Tatsache, dass er ein Häftling mit auf den Rücken gefesselten Händen war, bedeutungslos wirken. Er kam als Erster in den Raum, mit langen Gliedern und einem geschmeidigen Gang, der definitiv etwas Animalisches an sich hatte. Ihr fiel auf, dass er leicht hinkte. Auf seinem rechten Oberschenkel war ein Blutfleck, ein dunkelroter Klecks sickerte in den helleren Stoff seiner Trainingshose. Tavia beobachtete, wie er bei jedem seiner langen Schritte ein wenig größer wurde, als er zum Ende des Gegenüberstellungsraumes durchging.
Sie fröstelte ein wenig in ihrem warmen Wintermantel, und ihr wurde leicht übel. Gott, den Anblick von Blut hatte sie noch nie ertragen können.
Über die Lautsprecher wies einer der Polizeibeamten den Mann an, auf Position vier stehen zu bleiben und sich mit dem Gesicht zum Fenster zu stellen. Er tat es, und als er so dastand, sah er ihr in die Augen. Und zwar direkt.
Erschrecken durchzuckte sie. »Sind Sie sicher, dass sie mich nicht –«
»Ich verspreche Ihnen, Sie sind hier absolut sicher«, versicherte ihr Avery.
Und doch blieben diese sengenden blauen Augen unablässig auf sie gerichtet, sogar nachdem auch der letzte der drei anderen Männer in den Raum geführt worden war und angewiesen wurde, sich mit dem Gesicht zur Scheibe aufzustellen. Diese anderen Männer standen zusammengesunken da und sahen zu Boden oder sie bewegten sich nervös und ihre Blicke irrten ziellos herum, ohne in der riesigen verspiegelten Scheibe etwas anderes zu sehen als ihr eigenes Spiegelbild.
»Sind Sie so weit?«, drängte der Detective neben ihr.
Sie nickte, ließ ihre Augen über die Reihe der übrigen drei Männer wandern, obwohl es gar nicht mehr nötig war. Die anderen sahen ihm überhaupt nicht ähnlich. Sie waren eine wilde Mischung, unterschiedlich gebaut, unterschiedlich groß und auch unterschiedlich alt. Einer war strichdünn, sein strähniges braunes Haar hing ihm schlaff auf die Schultern. Ein anderer war gebaut wie ein Ochse, mit breiten Schultern und einem riesigen Bauch. Er hatte dicke, dunkle Locken, ein bösartiges Gesicht und wütende kleine Augen über seiner roten, geschwollenen Hakennase. Der Dritte war ein unförmiger Mann mit Halbglatze, wohl um die fünfzig, der unter dem hellen Schein des Deckenstrahlers heftig schwitzte.
Und dann war da er… dieser intensive, fast grausam gut aussehende Attentäter, der sie nach wie vor nicht aus den Augen ließ. Tavia war sonst nicht so leicht zu erschüttern, aber diesen Blick konnte sie kaum ertragen – nicht einmal hier, sicher verborgen im abgedunkelten Beobachtungsraum hinter sechs Millimeter dickem Sicherheitsglas und umgeben von einem halben Dutzend bewaffneter Polizeibeamten.
»Das ist er«, stieß sie hervor und zeigte auf Position vier, und obwohl es eigentlich unmöglich war, hätte sie schwören können, dass sein Mundwinkel sich zur Andeutung eines Lächelns kräuselte. »Das ist er, Detective Avery. Das ist der Mann, den ich auf der Weihnachtsfeier gesehen habe.«
Avery tätschelte ihr leicht die Schulter, als die Cops im anderen Raum die Männer jetzt aufforderten, einzeln hervorzutreten. »Ich weiß, ich habe gesagt, dass das eine reine Formalität ist, aber wir müssen sichergehen, dass Sie sich ganz sicher sind, Tavia –«
»Ich bin mir absolut sicher«, antwortete sie knapp, als das Blut in ihren Adern wie eine innere Alarmsirene zu summen begann. Sie sah zurück in den anderen Raum, gerade als Nummer vier seine zwei Schritte nach vorne trat. »Wir können die Gegenüberstellung beenden. Dieser Mann ist der Schütze. Ich würde sein Gesicht überall erkennen.«
»Na gut, in Ordnung, Tavia.« Er lachte leise. »Was habe ich Ihnen gesagt? Wir sind im Handumdrehen fertig. Das haben Sie hervorragend gemacht.«
Sie tat das Lob als unnötig ab und schüttelte milde den Kopf. »Kann ich Ihnen sonst noch behilflich sein, Detective?«
»Äh, nein. Wir brauchen nur noch ein paar Minuten, um hier alles fertig zu machen, und dann können Sie gehen. Wenn Sie möchten, bringe ich Sie gern nach Hause–«
»Vielen Dank, aber das ist nicht nötig.« Als sie das sagte, sah sie plötzlich wieder dem Mann in die Augen, der auf Senator Clarences Weihnachtsfeier beinahe jemanden getötet hätte. Wenn er wirklich auch der Kopf hinter dem Bombenanschlag heute Morgen gewesen war, hatte er auch den Tod von mehreren unschuldigen Menschen zu verantworten. Tavia hielt dem durchdringenden Blick stand und hoffte, dass er durch das Glas das ganze Ausmaß ihrer Verachtung sehen konnte. Nach einem langen Augenblick wandte sie sich abrupt von dem Sichtfenster ab. »Wenn das alles ist, Detective, der Senator hat morgen früh einen wichtigen öffentlichen Auftritt, und ich habe heute Abend noch eine Menge Logistik und andere Arbeit zu erledigen.«
»Tavia Fairchild.«
Als sie das tiefe Knurren hörte, ihren Namen so unerwartet aus dem Mund eines Fremden, blieb sie auf der Stelle wie angewurzelt stehen. Sie brauchte sich nicht zu fragen, wer gesprochen hatte. Seine tiefe Stimme fuhr ihr mit derselben kalten Zielsicherheit durch den Körper wie die Kugeln, die er neulich auf die Menge der Partygäste abgefeuert hatte.
Trotzdem sah Tavia sich schockiert zu dem Detective und den anderen Agenten und Beamten um. »Dieser Raum … Sie hatten doch eben gesagt –«
Avery murmelte hektisch eine Entschuldigung und griff nach einem Wandtelefon neben dem Sichtfenster. Während er in den Hörer sprach, redete der Mann auf Position vier weiter mit ihr und sah sie unverwandt an, als wäre da nichts zwischen ihr und seinem tödlichen Blick.
Er trat einen Schritt vor. »Ihr Boss ist in Gefahr, Tavia. Und auch Sie könnten es sein.«
»Verdammt, kriegt den Bastard sofort unter Kontrolle«, rief einer der Bundesagenten dem Detective am Telefon zu.
Die Beamten im Gegenüberstellungsraum traten hektisch in Aktion. »Nummer vier, schweigen Sie und treten Sie wieder in die Reihe!«
Er ignorierte den Befehl. Trat noch einen weiteren Schritt vor, sogar als der zweite Cop sich ihm von der anderen Raumseite her näherte. »Ich muss ihn finden, Tavia. Er muss wissen, dass Dragos ihn töten wird – oder noch schlimmer. Vielleicht ist es schon zu spät.«
Stumm schüttelte sie den Kopf. Was er sagte, ergab keinen Sinn. Senator Clarence war gesund und munter; sie hatte ihn am Vormittag im Büro gesehen, bevor er zu einem langen Tag voller Besprechungen und Geschäftstermine in die Innenstadt aufgebrochen war.
»Ich weiß nicht, wovon Sie reden«, murmelte sie, obwohl er sie doch eigentlich gar nicht hören konnte. Er sollte sie auch nicht sehen können und tat es trotzdem. »Ich kenne niemanden namens Dragos.«
Jetzt näherten sich ihm die Cops von beiden Seiten, packten ihn je an einem gefesselten Arm und versuchten, ihn zur Wand zurückzuzerren. Er schüttelte sie mühelos ab, seine ganze Aufmerksamkeit völlig auf Tavia gerichtet. »Hören Sie mir zu. Er war auf der Weihnachtsfeier. Einer von den Gästen.«
»Nein«, sagte sie, jetzt ganz sicher, dass er sich irrte. Sie hatte jede einzelne der 148 Einladungen persönlich von Hand geschrieben und adressiert, und solche Einzelheiten vergaß sie nie. Wenn es sein musste, konnte sie jeden Namen aufsagen und sich an jedes Gesicht auf der Gästeliste erinnern. Und unter diesem Namen war keiner da gewesen.
»Dragos war dort, Tavia.« Die Cops im Gegenüberstellungsraum versuchten wieder, ihn zu packen. »Er war dort, ich habe auf ihn geschossen. Ich wünschte nur, ich hätte den Bastard getötet.«
Sie spürte, wie sie langsam den Kopf schüttelte und die Brauen runzelte, als sie den Wahnsinn dessen erfasste, was er sagte. Es hatte nur einen einzigen Verletzten bei der Weihnachtsfeier gegeben, einen von Senator Clarences großzügigsten Wahlkampfsponsoren, ein erfolgreicher Bostoner Geschäftsmann und Wohltäter namens Drake Masters.
»Sie sind verrückt«, flüsterte sie. Doch noch während sie die Worte aussprach, glaubte sie sie selbst nicht ganz. Der Mann, der ihr durch die Scheibe in die Augen sah, obwohl das gar nicht möglich war, wirkte nicht verrückt. Er wirkte gefährlich und intensiv und schien sich dessen, was er sagte, absolut sicher. Er wirkte tödlich, selbst mit hinter dem Rücken gefesselten Händen.
Er sah ihr weiter unverwandt in die Augen. Ihn als Geisteskranken abzutun, wäre einfacher zu akzeptieren gewesen als das eisige Angstgefühl, das sich unter seinem Blick in ihrem Magen ausbreitete. Nein, was immer seine Absichten auf der Weihnachtsfeier des Senators gewesen waren, Wahnsinn steckte nicht dahinter.
Und doch ergab das, was er sagte, keinen Sinn.
»Der Typ ist gestört«, sagte einer der Bundesagenten. »Machen wir hier Schluss und lassen die Zeugin gehen.«
Detective Avery nickte. »Ich möchte mich bei Ihnen dafür entschuldigen, Tavia. Wir wollen Sie nicht länger aufhalten.« Er ging um sie herum zur Tür, sein angespanntes Gesicht zeigte eine Mischung aus Bestürzung und Verärgerung, als er den Arm ausstreckte und sie zur Tür winkte. Die anderen Beamten und Bundesagenten standen ebenfalls langsam auf und machten Anstalten, ihnen zu folgen.
Aus dem Gegenüberstellungsraum hörte Tavia Kampfgeräusche. Sie versuchte, um den Detective herumzuspähen, aber er führte sie bereits vom Sichtfenster fort.
Als sie hinausgehen wollten, wurde draußen kurz angeklopft, und die Tür öffnete sich vor ihnen. Senator Clarence stand in der Halle, Schneeflocken auf dem adrett frisierten Haar und dem dunkelblauen Wollmantel. »Tut mir leid, ich konnte nicht früher. Meine Besprechung mit dem Bürgermeister hat länger gedauert.« Er warf Tavia einen Blick zu, und seine freundliche Miene verdüsterte sich ein wenig. »Gibt es ein Problem? Tavia, ich habe Sie noch nie so blass gesehen. Was ist hier los?«
Bevor sie seine Besorgnis abtun konnte, trat der Senator in den Zeugenraum. »Meine Herren«, murmelte er den anderen Polizeibeamten zur Begrüßung zu.
Als er sich dem Sichtfenster näherte, ertönte dahinter ein tiefes Knurren.
Das Geräusch hatte nichts Menschliches mehr. Es war ein gespenstisches Fauchen, das Tavia das Blut in den Adern gefrieren ließ. Schlagartig war sie in heller Alarmbereitschaft, alle ihre Instinkte riefen ihr eine Warnung zu, dass gleich etwas Schreckliches passieren würde. Sie wirbelte herum. »Senator Clarence, seien Sie vorsich–«
Zu spät.
Das Sichtfenster explodierte.
Glassplitter regneten in alle Richtungen, als etwas Riesiges durch die Öffnung brach und mitten im Beobachtungsraum auf dem Boden landete.
Es war einer der Häftlinge – der dunkelhaarige Schlägertyp im Patriots-Sweatshirt. Er heulte vor Schmerzen, seine Extremitäten waren unnatürlich verdreht, die Haut von Gesicht und Hals vom Aufprall aufgerissen und blutig.
Tavia sah sich erschrocken um.
Wo eben noch das einfach verspiegelte Sicherheitsglas gewesen war, war nur noch Luft.
Und dahinter der riesige, muskulöse Mann, Mordlust in den Augen.
Seine Handschellen hingen ihm nutzlos von den Handgelenken, er hatte sich irgendwie von ihnen befreit. Herr im Himmel, wie stark musste er sein, wenn er nicht nur das schaffte, sondern auch einen ausgewachsenen Mann durch eine Scheibe Sicherheitsglas werfen konnte? Und wie schnell musste er sich bewegen, um das zu tun, bevor die Polizeibeamten im Gegenüberstellungsraum ihn aufhalten konnten?
Kalte blaue Augen sahen an ihr vorbei und fielen wie Laserstrahlen auf Senator Clarence. »Gottverdammter Dragos«, fauchte der Mann voller Wut. »Er hat es schon geschafft, nicht wahr? Sie gehören ihm schon.«
Sein rechter Arm schoss nach vorne wie eine Kobra. Er griff durch die leere Fensteröffnung, packte Senator Clarence am Arm und riss ihn mit einem Ruck nach hinten, sodass der Senator das Gleichgewicht verlor. Er zerrte den liegenden Mann mit einer Hand zu sich heran, schleifte ihn im Handumdrehen durch die Scherben und Trümmer.
Oh Gott. Dieser Mann würde Senator Clarence töten.
»Aufhören!« Tavia bewegte sich, bevor es ihr selbst bewusst wurde. Sie packte die Stahlhandschellen an seinem Handgelenk und zog mit aller Kraft daran. »Nicht!«
Ihr schwacher Versuch, ihn aufzuhalten, brachte ihn kaum aus dem Takt. Aber in diesem Sekundenbruchteil sah er ihr wieder in die Augen. Da war etwas Gespenstisches in diesen Augen … Funken tanzten in ihnen, ein unheiliges Feuer schien in ihnen zu brennen. Etwas, das wie eine scharfe Messerklinge direkt in ihr Innerstes fuhr und gleichzeitig eine dunkle Neugier in ihr weckte, die sie näherlockte.
Ihr Herz raste in ihrer Brust. Ihr Puls hämmerte so laut wie Trommelschläge in ihren Ohren. Zum ersten Mal in ihrem Leben spürte Tavia Fairchild echtes Entsetzen. Sie starrte in diese seltsam hypnotischen Augen und schrie.
4
Sie schrie, aber sie ließ ihn nicht los. Schlanke, aber überraschend starke Finger hielten die Stahlhandschellen an seinem Handgelenk fest, als wären ihre Reflexe auf Kampf eingestellt, ungeachtet der Angst und Panik, die plötzlich überall im Raum vibrierten, in dem gerade das Chaos losgebrochen war.
Tavia Fairchild war hartnäckig, das musste Chase ihr lassen.
Sie hatte schon auf der Weihnachtsfeier des Senators keine Angst vor ihm gezeigt und auch eben nicht, als sie ihm durch die verspiegelte Scheibe in die Augen gesehen und ihn an die Cops und FBI-Agenten im Beobachtungsraum ausgeliefert hatte.
Er konnte es ihr nicht übel nehmen. Sowohl sie als auch die Polizei glaubten, dass sie das Richtige taten, dass sie versuchten, einen gefährlichen Mann – einen geständigen Killer – hinter Schloss und Riegel zu bringen. Ihr menschlicher Verstand konnte die Gefahr nicht erfassen, mit der Chase und der Rest des Ordens es aufnehmen mussten.
Und Tavia Fairchild hatte keine Ahnung, dass ihr Chef ein toter Mann war.
Für Normalsterbliche mochte Senator Robert Clarence unverändert wirken, aber Chases Stammessinne hatten den Lakaien schon gerochen, sobald er den Zeugenraum betreten hatte. Der Mann gehörte jetzt Dragos und gehorchte nur noch seinem Meister. Das sah Chase am stumpfen Glanz seiner Augen und dem völligen Desinteresse an sich selbst oder jeder anderen Person im Raum. Dragos hatte seinen Lakaien auf das Polizeirevier geschickt, und Chase würde ihm den Scheißkerl in Fetzen zurückschicken.
Er wandte den Kopf von Tavia Fairchild ab und riss sich von ihr los. »Wo ist Dragos?« Er schloss die Faust fester um den Arm des Senators und drückte zu, bis er Knochen knacken und brechen spürte. »Los, rede.«
Der Lakai heulte vor Schmerzen.
»Zurückbleiben!«, schrie einer der Cops hinter ihm im Gegenüberstellungsraum. Von drüben war das hektische Scharren von Füßen zu hören, als Bundesagenten und Polizisten herbeieilten, um Tavia vor dem Kampf in Sicherheit zu bringen.
Chase drückte fester zu und zermalmte dem Senator den Unterarm. »Ich finde ihn. Und du wirst mir sagen, wo, du gottverdammter –
Etwas Scharfes fuhr von hinten in seine Schulter. Keine Kugel, sondern zwei feine Metallspitzen, die sich wie Angelhaken tief in sein Fleisch bohrten. Seine Ohren füllten sich mit dem klickenden Stakkato einer Elektroschockpistole, und gleichzeitig wurden ihm fünfzigtausend Volt in den Körper gejagt. Der Stromstoß durchzuckte ihn vom Kopf bis zu den Füßen, jeder Muskel seines Körpers protestierte.
Chase brüllte auf, aber eher vor Wut als vor Schmerzen. Für einen Angehörigen seiner Spezies war der Stromstoß in etwa so schlimm wie ein Bienenstich. Er trat einen Schritt vor, eine Hand immer noch um Senator Clarences Unterarm geklammert, und mit der anderen holte er aus, um ihn besser zu fassen zu bekommen.
»Verdammte Scheiße«, keuchte jemand im Gegenüberstellungsraum. »Wurde der Typ auf Drogen getestet? Was zur Hölle hat der genommen?«
Einer der FBI-Agenten im dunklen Anzug riss seine halb automatische Pistole aus dem Holster. »Verpass dem Scheißkerl noch mal eine Ladung!«, befahl er. »Setzt ihn außer Gefecht, verdammt, oder ich tue es selbst, und zwar endgültig!«
Ein weiterer Stromstoß traf ihn. Dieses Mal bohrten sich die Elektroden in seinen Rücken, und wieder bekam er fünfzigtausend Volt. Die doppelte Ladung wirkte, Chase ließ seine Beute los. Sobald Clarence frei war, wurden er und Tavia von mehreren Cops und Bundespolizisten eilig aus dem Zimmer geführt.
Chase schwang den linken Arm herum und riss die Elektroden ab, die in seiner rechten Schulter steckten. Während der Strom der zweiten Dosis immer noch durch sein zentrales Nervensystem schoss, packte er den Metallrahmen des Sichtfensters und machte einen unbeholfenen Satz auf das Fensterbrett.
Der Bundesagent eröffnete das Feuer, ebenso einer der uniformierten Beamten neben ihm im Zeugenraum.
Kugeln schlugen in Chases Brust und Oberkörper ein. Der Kugelhagel riss ihn nach hinten, er stolperte und sah hinunter auf die Blutflecken, die sich auf seinem ganzen Oberkörper ausbreiteten.
Nicht gut. Überhaupt nicht gut, aber er war ein Stammesvampir, er würde es überleben.
Und da war immer noch eine Chance, Dragos’ Lakaien in die Finger zu bekommen, bevor ihn die Cops aus dem Gebäude brachten …
Während der Bundesagent seine leere Waffe nachlud, pirschte sich einer der verbliebenen Cops im fast leeren Gegenüberstellungsraum nach vorne, seine Dienstpistole auf Chase gerichtet. »Stehen bleiben!« Der Cop war jung, seine Stimme ein wenig unsicher, aber seine Hand zitterte nicht. »Keine Bewegung, Arschloch.«
Aus Chase strömte Blut wie Wasser aus einem Sieb. Es sammelte sich in einer Pfütze um seine Füße und in den Glasscherben, die den Boden übersäten. Er trat einen Schritt zurück, konzentrierte sich und rief seine übernatürliche Geschwindigkeit und Wendigkeit ab, die ihn zu dem machte, was er war. Aber dieses Mal funktionierte es nicht.
Sein Körper war von der Blutgier geschwächt, die ihm seit langen Monaten im Nacken saß. Und er verlor Blut. Zu viel, zu schnell.
Aber immer noch konnte er Dragos’ Lakai irgendwo im Gebäude riechen. Er wusste, der Geistsklave war immer noch in seiner Reichweite, und ein Teil von ihm – der letzte Rest seiner angeschlagenen Ritterlichkeit – sträubte sich gegen den Gedanken, dass eine wehrlose Frau mit einem von Dragos’ seelenlosen Dienern zusammen war.
Er würde den Lakaien töten, bevor er zuließ, dass Tavia Fairchild einer solchen Gefahr ausgesetzt wurde.
Chase fuhr herum, und während ihm schon schwarz vor Augen wurde, suchte er die Tür nach draußen auf den Korridor. Er machte einen langsamen Schritt, schleifte mühsam die Füße über den Boden.
»Scheiße«, murmelte einer der nervösen Cops.
Hinter ihm das scharfe Klicken einer Waffe, und wieder ertönte die dienstlich-nüchterne Stimme des FBI-Agenten. »Noch einen Schritt, und du bist tot, Arschloch.«
Chase hätte nicht stehen bleiben können, selbst wenn man ihn an einen Armeepanzer gekettet hätte.
Er ging einen weiteren Schritt.
Er spürte nur den ersten Schuss. Die anderen durchsiebten seinen Körper, bis der Boden unter ihm nachgab. Er roch Schießpulver und menschliches Adrenalin in der Luft.
Und als seine Beine unter ihm nachgaben und sein Körper schwer auf dem Boden des Gegenüberstellungsraumes aufschlug, roch er den dunklen Geruch seines eigenen Blutes, das sich in alle Richtungen auf dem dreckigen weißen Linoleum ausbreitete.
Der Stammesvampir ließ sich Zeit auf dem kurzen Weg von seiner am Bordstein geparkten chauffierten Limousine zu dem Privatclub, der versteckt am Ende einer schmalen Sackgasse in Chinatown lag. Weder nahm er Bodyguards mit noch sah er sich wachsam in den dunklen, winterlichen Straßen und den tiefen Schatten der Gebäude um, die zu allen Seiten um ihn herum aufragten.
Nicht heute Nacht.
Heute Nacht schlenderte er ohne eine einzige Vorsichtsmaßnahme mitten in das Ordensterritorium im Herzen von Boston. Statt Bodyguards hatte er sich amüsantere Gesellschaft mitgebracht. Die beiden appetitlichen Menschenfrauen hatten Mühe, mit ihm Schritt zu halten, ihre hohen Absätze klapperten hastig über den eisverkrusteten Asphalt. Ihre Namen kannte er nicht und wollte sie auch nicht wissen, sie waren nur Spielzeuge für ihn. Er hatte die Rothaarige mit den langen Beinen und die Blondine mit dem frischen Gesicht, beide noch minderjährig, vor einigen Minuten in der Warteschlange des LaNotte, der derzeit angesagtesten Partyadresse der Stadt, entdeckt und mitgenommen. Kichernd und eifrig trotteten sie hinter ihm her, als er sich dem hünenhaften Stammesvampir unter dem Torbogen näherte, der vor der Stahltür des Privatclubs postiert war. Der Türsteher, ein primitiver Schlägertyp von der Agentur, hieß Taggart; während Dragos’ Zeit im Vorstand dieser unfähigen Organisation hatte er den einen oder anderen dreckigen Job für ihn erledigt. Jetzt schaute er finster und nahm eine drohende Haltung ein, aber dann riss er überrascht die Knopfaugen auf, als er Dragos erkannte.
»Sir«, murmelte Taggart und senkte grüßend den Kopf. Er streckte die Hand nach der Tür aus und öffnete sie, um dem Trio Einlass in den Club zu gewähren. Der Respekt war willkommen, so wie das Gefühl der Freiheit, das er um die Schultern trug wie den Umhang eines Königs, als er durch den Raum voller Stammesvampire und leicht bekleideter menschlicher Männer und Frauen schritt, die die Unterhaltung boten, auf die der Club spezialisiert war. Auf der Bühne in der Raummitte schlang sich gerade eine nackte dunkelhäutige Schönheit mit der geschmeidigen Grazie einer Schlange um eine Stange aus Plexiglas. An den Tischen und auf den Sitzbänken davor sahen Dutzende von Stammesvampiren gebannt zu. Wieder andere genossen in ihren Nischen und privaten Alkoven Dienstleistungen persönlicherer Art durch die Menschen, die in diesem Striplokal der Agentur arbeiteten.
Doch obwohl im Club Blut getrunken und diverse sexuelle Handlungen vorgenommen wurden, war die Atmosphäre von Zurückhaltung bestimmt. Die Stammesgesetze verboten das Töten von Menschen, und für die meisten Vampire, besonders Angehörige der Agentur, war dieses Gesetz unantastbar. Es war so unverletzlich wie das Gesetz der Geheimhaltung, das dem Stamm erlaubt hatte, seit Jahrhunderten unentdeckt unter den Menschen zu leben und sich unbehelligt von ihnen zu nähren.
Für einige aber, wie ihn und den anderen Mann, der jetzt durch den vollen Club auf ihn zukam, um ihn zu begrüßen, galt diese Einschränkung schon lange nicht mehr.
Dragos sah zu, wie sein Leutnant sich näherte. Er war einer von einer Handvoll gleich gesinnter, loyaler Mitglieder von Dragos’ innerem Kreis – der zunehmend kleiner wurde, seit eine Reihe von Pannen und Fehlern ihn gezwungen hatte, die schwächsten Mitglieder der Herde auszumerzen. Aber das alles lag nun hinter ihm. Er blickte nach vorn, dem Sieg entgegen. Er war so nah, dass er ihn praktisch schon mit Händen greifen konnte. »Guten Abend, Vizedirektor Pike.«
»Sir.« Der Agent blickte sich verstohlen um, bevor er Dragos in die Augen sah. »Es ist ein … nun, ein unerwartetes Vergnügen, Sie hier in der Stadt zu sehen.«
»Warum sehen Sie dann aus, als hätten Sie die Hosen gestrichen voll?«, antwortete Dragos und bleckte die Zähne zu einem kurzen Lächeln. Normalerweise bedeutete ein unangekündigter Besuch von ihm, dass Köpfe rollen würden. »Entspannen Sie sich, Pike. Ich bin heute Nacht zu meinem Vergnügen hier, nicht geschäftlich.«
»Also gibt es kein Problem, Sir?«
»Nicht im Geringsten«, antwortete Dragos.
Sein Leutnant fühlte sich trotzdem nicht allzu wohl in seiner Haut. Er sprach mit gesenkter Stimme weiter, zweifellos hatte er Angst, an einem so öffentlichen Ort auf so vertrautem Fuß mit ihm gesehen zu werden. »Aber Sir, halten Sie es wirklich für klug, in die Stadt zu kommen – und ausgerechnet hierher? Der Orden hat erst letzte Woche zwei seiner Krieger in diesen Club geschickt, die nach Ihnen gefragt haben.«
Dragos schüttelte milde den Kopf. »Der Orden kümmert mich nicht, er ist derzeit vollauf mit anderem beschäftigt. Dafür habe ich heute persönlich gesorgt.«
Pike starrte ihn einen Augenblick an. »Die Gerüchte sind also wahr? Das Hauptquartier des Ordens wurde von den Mensch–« Pike sah Dragos’ zwei menschliche Begleiterinnen an und räusperte sich. »Sie wurden von der Bostoner Polizei aufgespürt?«
Dragos grinste. »Sagen wir einfach, unsere braven Ordnungshüter haben einen kleinen Tipp bekommen.«
Der Stammesvampir erwiderte sein Lächeln, sah aber immer wieder unsicher von Dragos zu den beiden Frauen, die sich von beiden Seiten an ihn klammerten. Auf den fragenden Blick seines vorsichtigen Leutnants zuckte Dragos müßig die Schultern. »Reden Sie nur frei heraus, Pike. Ich habe ihnen auf dem Weg hierher so viel Alkohol und Kokain eingeflößt, dass sie sich morgen früh nicht einmal mehr an ihren eigenen Namen erinnern dürften. Wenn ich sie so lange am Leben lasse«, meinte er gedehnt und grinste die jungen Frauen lüstern an, konnte es kaum erwarten, sich ihnen ausführlich zu widmen.
»Wollen Sie damit sagen, dass das heutige Bombenattentat in der Innenstadt und die anschließende Verfolgungsjagd der Tatverdächtigen durch die Polizei –«
»Genau das will ich damit sagen, Pike.« Jetzt wirkte sein Leutnant noch beeindruckter, was Dragos zufrieden zur Kenntnis nahm. »Von der Planung der Explosion und ihrer Ausführung durch die Lakaien, die ich dafür angeworben habe, bis zu der Verfolgungsjagd, die die Behörden direkt zu Lucan Thornes Haustür führte, war alles mein Werk.«
»Wie man hört, ist einer der Krieger in Polizeigewahrsam. Wurde wirklich Sterling Chase verhaftet?«
Dragos nickte. Dass der Krieger sich offenbar freiwillig ergeben hatte, war das einzige Detail, das er bei seinem Offensivschlag gegen den Orden nicht arrangiert oder vorhergesehen hatte. Er war immer noch nicht ganz sicher, was er davon halten sollte, aber er hatte seinen neuesten Lakaien ausgeschickt, um sich die Lage im Gefängnis in der Innenstadt anzusehen. Tatsächlich rechnete er jetzt jederzeit mit einem ausführlichen Bericht des Senators.
»Wie man hört, ist Chase inzwischen fast zum Rogue mutiert«, sagte Pike. »Kommt nicht sonderlich überraschend. So wie er letzte Woche mit dem anderen Krieger hier hereinkam und Sie suchte – ich habe Berichte darüber gesehen, wie viele Agenten er verletzt hat, und er kämpfte wie ein tollwütiger Hund. Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis ihn die Blutgier endgültig besiegt. Schwer zu glauben, dass das derselbe Sterling Chase ist wie noch vor ein paar Jahren. Damals gingen alle davon aus, dass er einmal eine Spitzenposition in der Agentur einnehmen würde.«
Dragos stieß einen Seufzer aus, Agent Pikes nostalgische Erinnerungen langweilten ihn. »Ob der Bastard zum Rogue mutiert oder im Polizeigewahrsam der Menschen stirbt, geht mir komplett am Arsch vorbei, Pike. Ein Krieger weniger, der uns Ärger macht, das ist alles, worauf es mir ankommt.«
»Natürlich, Sir«, antwortete Pike knapp. »Ganz meine Meinung.«