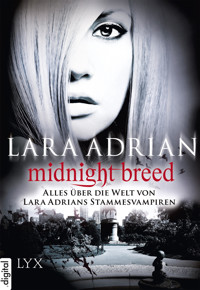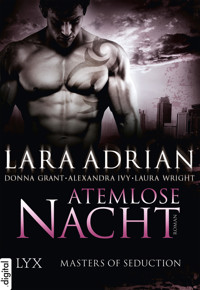9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Midnight Breed
- Sprache: Deutsch
Beim Verlassen eines Nachtclubs wird die Fotografin Gabrielle Maxwell Zeugin eines schrecklichen Verbrechens. Sechs Jugendliche töten einen Mann und saugen ihm das Blut aus. Doch obwohl Gabrielle die grauenhafte Szenerie mit ihrem Fotohandy festgehalten hat, schenkt die Polizei ihr keinen Glauben. Erst der gutaussehende Kommissar Lucan Thorne scheint Gabrielle ernst zu nehmen und verdreht der jungen Frau gehörig den Kopf. Gabrielle ahnt nicht, dass Thorne in Wahrheit ein Vampir ist ...
"Geliebte der Nacht" ist der erste Teil der erfolgreichen Vampirsaga "Midnight Breed" von Bestseller-Autorin Lara Adrian. Ein Muss für alle Romantic Fantasy-Fans!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Roman
Ins Deutsche übertragenvon Beate Wiener
Für John,
der immer an mich geglaubt hat
und dessen Liebe, so hoffe ich, nie schwinden wird.
Prolog
Vor 27 Jahren
Ihr Baby wollte einfach nicht aufhören zu weinen. Schon an der letzten Haltestelle war es unruhig geworden, als der Überlandbus aus Bangor in Portland anhielt, um weitere Fahrgäste aufzunehmen. Jetzt, kurz nach ein Uhr morgens, hatten sie ihr Ziel Boston fast erreicht, und die gut zwei Stunden, die sie versucht hatte, ihr kleines Töchterchen zu beruhigen, raubten ihr, wie ihre Freundinnen in der Schule sagen würden, allmählich den letzten Nerv.
Der Mann, der auf dem Platz neben ihr saß, war wahrscheinlich ebenfalls nicht gerade begeistert.
„Es tut mir wirklich leid“, sagte sie zu ihm gewandt. „Sie weint normalerweise nicht so viel. Das hier ist unsere erste gemeinsame Reise. Ich nehme an, sie hat einfach keine Lust mehr zu fahren.“
Der Mann blinzelte sie langsam an und lächelte, ohne seine Zähne zu zeigen. „Wohin fahren Sie denn?“
„New York City.“
„Ach ja. The Big Apple“, murmelte er. Seine Stimme klang trocken und dumpf. „Haben Sie da Familie oder so?“
Sie schüttelte den Kopf. Das, was sie an Familie hatte, lebte in einer kleinen Stadt in der hintersten Provinz nahe Rangeley und hatte sehr deutlich gemacht, dass sie ab jetzt auf sich allein gestellt war. „Ich fahre wegen eines Jobs dorthin. Ich meine, ich hoffe, einen Job zu finden. Ich möchte Tänzerin werden. Vielleicht am Broadway oder als eine von den Rockettes1.“
„Nun, Sie sind auf jeden Fall hübsch genug dafür.“ Der Mann starrte sie mittlerweile an. Im Bus war es dunkel, aber sie hatte trotzdem das Gefühl, dass seine Augen irgendwie seltsam aussahen. Jetzt zeigte er erneut dieses verkniffene Lächeln. „Mit einem Körper wie Ihrem sollten Sie eigentlich ein großer Star werden.“
Errötend warf sie einen Blick auf ihr weinendes Baby. Ihr Freund in Maine hatte auch immer solche Sachen gesagt. Er hatte eine Menge Sachen gesagt, um sie auf den Rücksitz seines Autos zu bekommen. Nun, er war gar nicht mehr ihr Freund. Nicht seit ihr Junior-Jahr in der Highschool begonnen hatte und ihr Bauch durch sein Kind dick geworden war.
Wenn sie nicht die Schule verlassen hätte, um das Baby zu bekommen, hätte sie in diesem Jahr ihren Abschluss gemacht.
„Hatten Sie heute schon etwas zu essen?“, fragte der Mann, als der Bus langsamer wurde und die Haltestelle von Boston anfuhr.
„Eigentlich nicht.“ Sie schaukelte ihr kleines Mädchen sanft in den Armen, ob es nun etwas nützte oder nicht. Die Kleine war rot im Gesicht, sie fuchtelte mit ihren winzigen Fäusten in der Luft herum und schrie noch immer aus Leibeskräften.
„Was für ein Zufall“, entgegnete der Fremde. „Ich habe auch noch nichts gegessen. Ich könnte was zwischen die Zähne gebrauchen. Möchten Sie mir nicht Gesellschaft leisten?“
„Nein danke, es geht schon. Ich habe ein paar Kekse in der Tasche. Und außerdem glaube ich, das hier ist der letzte Bus, der heute Nacht nach New York fährt; also habe ich nur eben Zeit zum Wickeln und muss dann sofort wieder einsteigen. Aber trotzdem danke.“
Er sagte nichts weiter, sondern sah nur zu, wie sie ihre wenigen Habseligkeiten zusammenpackte, als der Bus in die Parkbucht einfuhr. Dann stand er von seinem Platz auf, um sie durchzulassen.
Als sie aus der Toilette kam, wartete der Mann auf sie.
Ein Gefühl des Zweifels und des Unbehagens durchzuckte sie, als sie ihn dort stehen sah. Als er im Bus neben ihr gesessen hatte, hatte er nicht so groß gewirkt. Und nun, als sie ihn erneut ansah, konnte sie erkennen, dass in seinen Augen definitiv etwas Irres lag. Stand er unter Drogen?
„Was ist los?“
Er lachte in sich hinein. „Ich habe es Ihnen doch gesagt. Ich brauche Nahrung.“
Das war eine seltsame Art, sich auszudrücken.
Voller Unbehagen stellte sie fest, dass sich zu dieser späten Stunde nur wenige andere Leute am Bahnhof befanden. Es begann leicht zu regnen. Die wenigen späten Passanten suchten im Gebäude Schutz. Ihr Bus stand mit laufendem Motor in seiner Parkbucht und wurde bereits wieder beladen. Aber auf dem Weg dorthin würde sie zuerst an dem Mann vorbeimüssen.
Sie zuckte mit den Schultern, zu müde und ungeduldig, um sich damit zu befassen. „Also, wenn Sie Hunger haben, erzählen Sie das McDonald’s. Ich komme zu spät zu meinem Bus …“
„Hör zu, Schlampe.“ Er bewegte sich so schnell, dass sie nicht wusste, wie ihr geschah. In der einen Sekunde stand er noch einen Meter von ihr entfernt, in der nächsten hatte er sie schon mit der Hand an der Kehle gepackt und schnürte ihr die Luft ab. Er schob sie zurück in den Schatten des Bahnhofsgebäudes. Dahin, wo niemand es bemerken würde, wenn sie überfallen und ausgeraubt wurde. Oder Schlimmeres. Sein Mund war ihrem Gesicht so nah, dass sie seinen stinkenden Atem riechen konnte. Sie sah seine scharfen Zähne, als er seine Lippen verächtlich kräuselte und eine furchtbare Drohung ausstieß. „Noch ein einziges Wort, noch ein Zucken, dann kannst du zusehen, wie ich das saftige kleine Herz von deinem Balg esse.“
Ihr Baby, das sie auf ihrem Arm trug, begann zu weinen, aber sie sagte kein Wort.
Sie dachte nicht einmal daran, sich zu bewegen.
Alles, was zählte, war ihr Baby. Es war das Wichtigste, dass es in Sicherheit war. Und so wagte sie es nicht, sich zu rühren, nicht einmal, als sich diese scharfen Zähne auf sie stürzten und hart in ihren Hals bissen.
Sie stand da, vollkommen erstarrt vor Entsetzen, und drückte ihr Baby eng an sich, während der Mann brutal an der blutenden Wunde riss, die er ihr am Hals verpasst hatte. Seine Finger wuchsen förmlich in die Länge, wo er ihren Kopf und ihre Schulter festhielt, und er grub die Fingerspitzen in sie hinein wie die Klauen eines Monsters. Grunzend bohrte er seinen Mund und seine scharfen Zähne tiefer in ihren Körper. Obwohl ihre Augen vor Schreck geweitet waren, begann ihre Umgebung zu verschwimmen, ihre Gedanken überstürzten sich. Dann verdüsterte sich alles um sie herum.
Er würde sie töten. Das Monster war dabei, sie zu töten. Und dann würde es auch ihr Baby töten.
„Nein.“ Sie rang nach Luft, schmeckte aber nichts als Blut. „Du gottverdammter – nein!“
Mit einer verzweifelten, fast übermenschlichen Anstrengung rammte sie krachend ihren Kopf in das Gesicht des Mannes. Als er überrascht knurrte und zurückzuckte, riss sie sich von ihm los. Sie taumelte und wäre beinahe hingefallen, fing sich jedoch im letzten Moment wieder. Ihr schreiendes Kind in einem Arm, den anderen hochreißend, um nach der brennenden Wunde an ihrem Hals zu fühlen, wich sie langsam zurück, weg von dem Monster, das seinen Kopf hob und sie nun mit glühenden, gelben Augen und blutverschmierten Lippen höhnisch angrinste.
„Oh Gott“, stöhnte sie auf. Ihr wurde von dem Anblick übel.
Sie machte noch einen Schritt nach hinten. Dann drehte sie sich um, bereit wegzulaufen, auch wenn es sinnlos war.
Und da sah sie den anderen.
Wilde, bernsteingelbe Augen blickten direkt durch sie hindurch, aber das Fauchen, das zwischen seinen riesigen, schimmernden Vampirzähnen hervordrang, verkündete ihren Tod. Sie war sich sicher, dass er das vollenden würde, was der Erste begonnen hatte, aber nichts passierte. Beide stießen kehlige Worte aus, dann schritt der Neuankömmling an ihr vorbei, ein langes silbernes Messer in der Hand.
Nimm das Kind und geh.
Der Befehl schien aus dem Nirgendwo zu kommen und drang kaum in ihren vernebelten Verstand. Dann ertönte er erneut, diesmal schärfer, und weckte sie aus ihrer Erstarrung. Sie lief davon.
In blinder Panik rannte sie von dem Bahnhof weg, eine nahe gelegene Straße hinunter. Immer tiefer floh sie in die unbekannte Stadt, in die Nacht hinein. Hysterie ergriff sie und ließ jedes Geräusch – selbst den Klang ihrer eigenen Füße – monströs und tödlich wirken.
Und ihr Baby hörte einfach nicht auf zu schreien.
Sie würden entdeckt werden, wenn sie das Baby nicht dazu brachte, still zu sein. Sie musste es zu Bett bringen, in sein Gitterbettchen, wo es hübsch bequem und warm war. Dann würde ihr kleines Mädchen glücklich sein. Dann würde es in Sicherheit sein. Ja, genau das musste sie tun. Das Baby zu Bett bringen, wo die Monster es nicht finden konnten.
Sie selbst war ebenfalls müde, aber sie konnte sich nicht ausruhen. Das war zu gefährlich. Sie musste nach Hause, bevor ihre Mutter herausfand, dass sie schon wieder zu spät war. Zwar war sie benommen und verwirrt, aber sie musste laufen. Also tat sie das. Sie rannte, bis sie umfiel, erschöpft und nicht in der Lage, noch einen einzigen Schritt zu machen.
Als sie einige Zeit später erwachte, hatte sie das Gefühl, dass ihr Verstand in tausend Stücke zerbrach. Sie konnte nicht mehr klar denken, die Realität verzerrte sich zu etwas Schwarzem und Unfassbarem, etwas, das ihr immer weiter entglitt.
Irgendwo in der Ferne hörte sie ein ersticktes Weinen. Es war so ein winziges Geräusch. Sie hob die Hände hoch, um sich die Ohren zuzuhalten, aber sie konnte das hilflose kleine Wimmern noch immer hören.
„Pst“, murmelte sie ins Leere hinein und wiegte sich hin und her. „Sei nun leise, das Baby schläft. Sei leise sei leise sei leise …“
Aber das Weinen ging weiter. Es wollte nicht aufhören, es wollte einfach nicht aufhören. Es zerriss ihr das Herz, als sie auf der schmutzigen Straße saß und mit leerem Blick in die anbrechende Morgendämmerung starrte.
1 Bei den Rockettes handelt es sich um eine berühmte Tanztruppe aus Manhattan, die seit 1925 besteht und bei vielen öffentlichen Ereignissen auftritt. (Anm. d. Übers.)
1
Heute
„Bemerkenswert. Sehen Sie sich nur den Einsatz von Licht und Schatten an …“
„Sehen Sie, wie dieses Bild die Traurigkeit des Ortes andeutet, aber wie es ihm dennoch gelingt, eine Aussicht auf Hoffnung zu vermitteln?“
„… eine der jüngsten Fotografinnen, deren Werk in die neue Sammlung von moderner Kunst des Museums aufgenommen wird.“
Gabrielle Maxwell betrachtete die Gruppe der Ausstellungsbesucher aus der Ferne. Sie hielt sich an einem Glas mit warmem Champagner fest, während schon wieder eine neue Masse gesichtsloser, namenloser Sehr Wichtiger Leute begeistert von den zwei Dutzend Schwarz-Weiß-Fotografien schwärmte, die an den Wänden der Galerie hingen. Sie warf von der anderen Seite des Raumes aus etwas verwundert einen Blick auf die Bilder. Es waren gute Fotos – ein wenig trostlos, da ihr Thema verlassene Mühlen und Hafengelände außerhalb von Boston waren, aber sie verstand nicht so ganz, was alle anderen darin sahen.
Andererseits tat sie das nie. Gabrielle machte die Fotos nur; die Interpretation und auch ihre Beurteilung überließ sie anderen Leuten. Von Natur aus introvertiert, war es ihr unangenehm, sich als Zielscheibe dieser Unmenge an Lob und Aufmerksamkeit wiederzufinden … aber immerhin konnte sie davon ihre Rechnungen bezahlen. Und das sehr gut. Heute Abend konnte darüber hinaus auch ihr Freund Jamie, der Besitzer der hippen kleinen Kunstgalerie in der Newbury Street, davon seine Rechnungen bezahlen. Die Galerie war, zehn Minuten vor Schluss, noch immer vollgestopft mit potenziellen Käuferinnen und Käufern.
Gabrielle war benommen von dem, was auf sie einstürzte: Händeschütteln hier, Begrüßungen da, Küsschen dort, dazu andauernd höflich lächeln. Alle, von den begüterten Ehefrauen aus Back Bay bis hin zu den vielfach gepiercten, tätowierten Anhängern der Gothicszene, versuchten, sich gegenseitig – und sie – mit Analysen ihres Werkes zu beeindrucken. Sie aber sehnte nur noch das Ende der Ausstellung herbei. Die ganze letzte Stunde hatte sie sich am Rande gehalten und über eine Flucht zu einer warmen Dusche und einem weichen Kissen nachgedacht, die beide in ihrer Wohnung im Ostteil der Stadt auf sie warteten.
Allerdings hatte sie einigen Freunden – Jamie, Kendra und Megan – versprochen, nach der Ausstellung mit ihnen essen zu gehen. Als die letzten Besucher ihre Käufe getätigt und die Galerie verlassen hatten, wurde Gabrielle in ein Taxi verfrachtet, bevor sie die Chance hatte, auch nur daran zu denken, die Verabredung abzusagen.
„Was für ein toller Abend!“ Jamies androgyn wirkendes blondes Haar schwang um sein Gesicht, als er sich über die beiden anderen Frauen beugte, um Gabrielles Hand zu ergreifen. „Ich hatte am Wochenende noch nie so viel Betrieb in der Galerie – und die Einnahmen von heute Abend waren unglaublich! Vielen Dank, dass ich dich präsentieren durfte.“
Gabrielle lächelte über die Aufregung ihres Freundes. „Klar. Du brauchst dich nicht bei mir zu bedanken.“
„Es war nicht allzu schlimm für dich, oder?“
„Wie hätte es das sein können, wenn halb Boston ihr zu Füßen lag?“, schwärmte Kendra, bevor Gabrielle selbst antworten konnte. „War das der Gouverneur, mit dem ich dich beim Häppchenessen habe reden sehen?“
Gabrielle nickte. „Er hat mir einen Auftrag für einige Werke für sein Landhaus auf The Vineyard angeboten.“
„Ist ja toll!“
„Ja“, erwiderte Gabrielle ohne großen Enthusiasmus. Sie hatte einen ganzen Stapel Visitenkarten in ihrer Brieftasche – das bedeutete wenigstens ein Jahr ständige Arbeit, falls sie das wollte. Warum war sie also jetzt in Versuchung, das Fenster des Taxis zu öffnen und sie in alle Winde zu zerstreuen?
Sie ließ ihren Blick über die draußen vorbeiziehende Nacht schweifen und sah seltsam distanziert zu, wie Lichter und Leben vorbeiflackerten. Die Straßen wimmelten von Menschen: Paare, die Hand in Hand umherschlenderten, Grüppchen von Freunden, die lachten und redeten – alle hatten sie viel Spaß. Sie aßen an Cafétischen vor In-Bistros oder betrachteten die Auslagen in den Schaufenstern der Geschäfte. Überall, wo sie hinsah, pulsierte die Stadt vor Farben und Leben. Gabrielle nahm all das mit dem Blick der Künstlerin in sich auf und fühlte dennoch gar nichts. Dieser rege Betrieb – auch in ihrem eigenen Leben – schien in einem rasenden Tempo ohne sie abzulaufen. In letzter Zeit hatte sie mehr und mehr den Eindruck, als wäre sie in einem Rad gefangen, das nicht aufhören wollte, sich um sie zu drehen und sie in einen endlosen Kreislauf von vergehender Zeit und Sinnlosigkeit einzuschließen.
„Stimmt irgendwas nicht, Gab?“, fragte Megan, die neben ihr auf dem Rücksitz des Taxis saß. „Du bist so still.“
Gabrielle zuckte mit den Achseln. „Es tut mir leid. Ich bin nur … ich weiß nicht. Müde, nehme ich an.“
„Jemand sollte dieser Frau einen Drink besorgen, und zwar sofort!“, scherzte Kendra, die dunkelhaarige Krankenschwester.
„Nee“, konterte Jamie, verschmitzt und katzenhaft. „Was unsere Gab wirklich braucht, ist ein Mann. Du bist zu ernst, meine Süße. Es ist nicht gesund, wenn du dich von deiner Arbeit dermaßen in Anspruch nehmen lässt. Du solltest ein bisschen Spaß haben! Wann bist du eigentlich das letzte Mal flachgelegt worden?“
Das war schon zu lange her, aber Gabrielle zählte eigentlich nicht mit. Sie hatte nie an fehlenden Verabredungen gelitten, wenn sie welche haben wollte, und Sex – wenn sie einmal welchen hatte – gehörte nicht zu den Dingen, von denen sie besessen war, so wie einige ihrer Freundinnen. Sie war auf diesem Gebiet momentan total aus der Übung – und außerdem überzeugt, dass ein bloßer Orgasmus sie nicht von ihrer inneren Leere und Rastlosigkeit befreien konnte.
„Jamie hat recht, weißt du“, meinte Kendra nun. „Du musst entspannter werden, geh mal ein bisschen aus dir raus.“
„Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen“, fügte Jamie hinzu.
„Oh nein!“, erwiderte Gabrielle und schüttelte den Kopf. „Ich wollte wirklich nicht so lange machen, Leute. Ausstellungen machen mich immer total fertig, und ich …“
„Fahrer?“ Jamie ignorierte sie, glitt an den Rand des Sitzes und klopfte gegen das Plexiglas, das den Taxifahrer von seinen Fahrgästen trennte. „Planänderung. Wir haben entschieden, dass wir in Feierlaune sind, also streichen Sie das Restaurant. Wir wollen dahin, wo all die angesagten Leute sind.“
„Wenn Sie Tanzclubs mögen, da hat gerade am Nordende der Stadt ein neuer aufgemacht“, meinte der Fahrer kaugummikauend. „Ich hab die ganze Woche schon Fahrgäste dahin gefahren. Sogar heute Abend schon zwei. Das ist ein Nobel-Nachtschuppen namens La Notte.“
„Ooh, La Not-te“, schnurrte Jamie, warf einen spielerischen Blick über die Schulter und zog eine Augenbraue geziert hoch. „Klingt für mich absolut fantastisch, Mädels. Lasst uns hinfahren!“
Das La Notte war in einem viktorianischen Gebäude untergebracht, das lange als St. Johns Trinity Parish Church fungiert hatte. Als jedoch vor Kurzem bekannt geworden war, dass die Bostoner Erzdiözese wegen zahlreicher priesterlicher Sexskandale Schmiergelder gezahlt hatte, wurden Dutzende solcher Einrichtungen überall in der Stadt geschlossen. Als sich Gabrielle und die anderen ihren Weg in den überfüllten Club bahnten, hallte synthetische Trance- und Technomusik in den Dachsparren wider und dröhnte aus riesigen Lautsprechern, die einen Rahmen um die DJ-Box in dem Balkon über dem Altar bildeten. Stroboskoplicht leuchtete auf einem Trio aus gewölbten Buntglasfenstern auf; die pulsierenden Lichtstrahlen durchschnitten die dünne Wolke aus Rauch, die in der Luft hing, und stampften zu dem hektischen Takt eines scheinbar endlosen Songs. Auf der Tanzfläche – und auf jedem Quadratmeter von La Nottes Hauptsaal und der Empore über ihnen – tanzten Menschen, wanden sich in einer gedankenlosen Sinnlichkeit.
„Heilige Scheiße!“, schrie Kendra, um die Musik zu übertönen, hob die Arme und tanzte sich durch die dichte Menschenmenge. „Was für eine Location, was? Ist ja irre hier!“
Sie waren nicht einmal an dem ersten Knäuel von Clubgästen vorbei, als sich bereits ein großer, schlanker Kerl auf die attraktive Brünette stürzte, sich zu ihr herunterbeugte und ihr etwas ins Ohr sagte. Kendra lachte kehlig auf und nickte ihm strahlend zu.
„Der Typ will tanzen“, kicherte sie und gab Gabrielle ihre Handtasche. „Wie könnte ich ihn abweisen?“
„Hier entlang“, meinte Jamie und zeigte zu einem kleinen, leeren Tisch in der Nähe der Bar, während Kendra mit dem Mann abzog.
Die drei setzten sich und Jamie bestellte eine Runde Getränke. Gabrielle suchte die Tanzfläche nach Kendra ab, aber sie war von der Menschenmenge verschluckt worden. Trotz des Gedränges hatte Gabrielle plötzlich das Gefühl, dass sie und die beiden anderen mitten im Rampenlicht saßen. Als ob sie allein durch ihre Anwesenheit in diesem Club unter irgendeiner Beobachtung standen. Es war verrückt, so etwas zu denken. Vielleicht hatte sie zu viel gearbeitet, zu viel Zeit allein zu Hause verbracht, wenn allein die Tatsache, unter Menschen zu sein, ihr ein solches Gefühl von Befangenheit, ja Paranoia gab.
„Auf Gab!“, rief Jamie aus, um die dröhnende Musik zu übertönen, und hob sein Martiniglas zum Gruß.
Auch Megan hob ihres in die Höhe und prostete Gabrielle zu. „Herzlichen Glückwunsch zu einer großartigen Ausstellung heute Abend!“
„Danke, Leute.“
Als sie an dem neongelben Gebräu nippte, kehrte Gabrielles Gefühl, beobachtet zu werden, zurück. Oder besser, es verstärkte sich. Sie spürte, wie ein Starren quer durch den abgedunkelten Raum nach ihr griff. Als sie über den Rand ihres Martiniglases hinwegblickte, erhaschte sie das Glitzern eines Stroboskoplichtes, das auf eine schwarze Sonnenbrille traf.
Eine Sonnenbrille, die einen Blick verbarg, der jedoch unverkennbar durch die Menge hindurch auf sie gerichtet war.
Die schnellen Blitze des Stroboskoplichtes warfen einen harten Schatten auf die starren Gesichtszüge des Mannes, aber Gabrielles Augen erfassten ihn mit einem Blick. Volles schwarzes Haar fiel locker um eine breite, intelligente Stirn und schmale, kantige Wangen. Sein Kiefer war stark, streng. Er hatte volle Lippen, sein Mund war sinnlich, sogar wenn er zu dieser zynischen, fast grausamen Linie verzogen war.
Gabrielle wandte nervös den Blick wieder ab, während eine Hitzewelle ihren Körper durchströmte. Das Bild seines Gesichts blieb in ihrem Kopf hängen, dort eingebrannt in diesem einen Augenblick, so wie eine Fotografie. Sie stellte ihren Drink ab und riskierte einen weiteren schnellen Blick zu der Stelle, an der der Mann stand. Aber er war verschwunden.
Ein lautes Krachen ertönte am anderen Ende der Bar und zog augenblicklich Gabrielles Aufmerksamkeit auf sich. Sie blickte über ihre Schulter. Von einem der überfüllten Tische tropfte Alkohol auf den Boden, vergossen aus mehreren zerbrochenen Gläsern, mit denen die schwarz lackierte Oberfläche des Tisches übersät war. Fünf Typen in schwarzem Leder und mit Sonnenbrillen stritten mit einem anderen Mann in geripptem Dead Kennedys-Trägerhemd und zerrissenen, ausgeblichenen Jeans. Einer der Ledertypen hatte den Arm um eine betrunken aussehende Platinblonde geschlungen, die den Jeanstyp zu kennen schien. Vielleicht ihr Freund? Er griff nach dem Arm des Mädchens, aber sie schlug seine Hand weg und neigte den Kopf, damit einer der Ledertypen ihren Hals küssen konnte. Sie starrte ihren wütenden Freund herausfordernd an, während sie mit dem langen braunen Haar des Kerls spielte, der an ihrer Kehle klebte.
„Wie erbärmlich“, meinte Megan und drehte sich wieder um, als die Situation an der Bar eskalierte.
„In der Tat“, sagte Jamie, leerte seinen Martini und winkte einen Kellner herbei, um eine weitere Runde zu bestellen. „Offensichtlich hat die Mama dieser Kleinen vergessen, ihr beizubringen, dass es schlechter Stil ist, nicht mit demselben Kerl zu gehen, mit dem man gekommen ist.“
Gabrielle sah noch einen Moment lang zu, lange genug, um zu sehen, wie ein zweiter Ledertyp näher an das Mädchen herantrat und sich auf seinen erschlafften Mund stürzte. Die Blonde akzeptierte beide gleichzeitig – sie hob ihre Hände, um den dunklen Kopf an ihrem Hals und den hellen, der an ihrem Gesicht saugte, zu liebkosen, als wolle er sie bei lebendigem Leib auffressen. Der Typ in Jeans warf dem Mädchen einige Obszönitäten an den Kopf, dann drehte er sich um und bahnte sich mit Gewalt einen Weg durch die gaffende Menge.
„Dieser Ort macht mir Angst“, gestand Gabrielle, als sie sah, wie einige Clubbesucher am anderen Ende des langen Marmortisches ungeniert koksten.
Die beiden anderen schienen sie durch das treibende Stampfen der Musik nicht zu hören und Gabrielles Unbehagen auch nicht zu teilen.
Irgendetwas stimmte hier nicht, und Gabrielle konnte sich des Gefühls nicht erwehren, dass die Nacht noch ein böses Ende nehmen würde. Jamie und Megan begannen sich über lokale Bands zu unterhalten. So blieb Gabrielle sich selbst überlassen. Sie trank ihren Martini aus und wartete auf der anderen Seite des kleinen Tisches auf eine Gelegenheit, die beiden anderen zu unterbrechen, um sich verabschieden zu können.
Obwohl mitten in einem Club unter so vielen Leuten, war sie dennoch allein. Sie ließ ihren Blick über das Meer von sich auf und ab bewegenden Köpfen und wogenden Körpern schweifen, heimlich auf der Suche nach den durch eine Sonnenbrille verborgenen Augen, die sie vorher beobachtet hatten. Gehörte er zu den Schlägertypen, die noch immer auf der anderen Seite der Bar Ärger machten? Er war angezogen wie sie und strahlte zweifellos die gleiche düstere Gefährlichkeit aus.
Wer auch immer er war, Gabrielle konnte momentan keine Spur von ihm entdecken.
Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Dann fuhr sie heftig zusammen, als sich ein Paar Hände von hinten auf ihre Schultern legte.
„Hier seid ihr! Ich habe überall nach euch gesucht, Leute!“ Kendra, die gleichzeitig atemlos und aufgedreht klang, beugte sich über den Tisch. „Kommt schon. Ich habe auf der anderen Seite des Clubs einen Tisch für uns. Brent und ein paar von seinen Freunden wollen mit uns feiern.“
„Cool!“
Jamie war bereits aufgestanden und wollte losgehen. Megan nahm ihren Martini in eine Hand, den von Kendra und ihre Handtaschen in die andere. Als Gabrielle keine Anstalten machte mitzukommen, hielt Megan inne.
„Kommst du?“
„Nein.“ Gabrielle stand auf und hängte sich den Riemen ihrer Handtasche über die Schulter. „Macht ihr ruhig weiter. Viel Spaß! Ich bin völlig fertig. Ich glaube, ich nehme mir einfach ein Taxi und fahre nach Hause.“
Kendra machte einen Schmollmund wie ein kleines Mädchen. „Gab, du kannst nicht gehen!“
„Soll ich dich begleiten?“, bot Megan großzügig an, obwohl Gabrielle sah, dass sie bei den anderen bleiben wollte.
„Nein, ist schon gut. Feiert schön, aber seid vorsichtig, okay?“
„Bist du sicher, dass du nicht bleiben willst? Nur für einen einzigen Drink?“
„Nee. Ich muss wirklich gehen und ein bisschen Luft schnappen.“
„Dann mach, was du willst“, tat Kendra gespielt böse. Sie machte einen Schritt nach vorn und küsste Gabrielle schnell auf die Wange. Gabrielle konnte ihre Wodkafahne riechen und noch einen anderen, undefinierbaren Geruch. Irgendetwas Moschusartiges, seltsam Metallisches.
„Du bist eine Spielverderberin, Gabby, aber ich hab dich trotzdem lieb.“
Mit einem Augenzwinkern hakte Kendra sich bei Jamie und Megan unter und zog sie dann spielerisch auf die tanzende Menschenmenge zu.
„Ruf mich morgen an“, formte Jamie mit den Lippen in Gabrielles Richtung, während das Trio allmählich von der Menge verschluckt wurde.
Gabrielle machte sich sofort auf den Weg zur Tür, begierig, den Club so schnell wie möglich zu verlassen. Je länger sie dort gewesen war, desto lauter war ihr die Musik vorgekommen, hatte in ihrem Kopf gedröhnt und ihr das Denken und die Konzentration auf ihre Umgebung beinahe unmöglich gemacht. Menschen drängten sich von allen Seiten gegen sie, als sie versuchte, zwischen ihnen hindurchzugelangen, drückten sie gegen die tanzenden, mit den Armen rudernden, sich drehenden Körper. Sie wurde angerempelt und gestoßen, von unsichtbaren Händen in der Dunkelheit angefasst und betatscht, bis sie schließlich in die Eingangshalle des Clubs stolperte und dann durch die schwere Doppeltür ins Freie gelangte.
Die Nacht war kühl und dunkel. Sie holte tief Luft, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen und den Lärm, den Rauch und die beunruhigende Atmosphäre vom La Notte abzuschütteln. Die Musik war hier noch immer dröhnend laut, das Stroboskoplicht blitzte immer noch wie kleine Explosionen hinter den großen Buntglasfenstern über ihr auf, aber Gabrielle kam wieder ein wenig zu sich, nun, da sie draußen war.
Nur wenige Menschen waren auf der Straße. Einige gingen auf dem Bürgersteig unter ihr vorbei, andere stiegen die Treppe hinauf und betraten den Club. Niemand achtete auf sie, als sie zum Straßenrand hinuntereilte, um auf ein Taxi zu warten. Schon entdeckte sie einen gelben Wagen, der in ihre Richtung fuhr, und streckte ihre Hand aus, um ihn anzuhalten.
„Taxi!“
Als sich das leere Taxi seinen Weg durch den nächtlichen Verkehr gesucht hatte und neben ihr hielt, flogen die Türen des Nachtclubs krachend auf.
„He, Mann! Was zum Teufel …“ Hinter Gabrielle erklang eine männliche Stimme und stieg eine Oktave an, um dann eine Tonlage knapp unterhalb von Angst zu liegen. „Wenn du mich noch ein einziges Mal anfasst …“
„Was ist dann, zum Teufel?“, höhnte eine andere Stimme, die tief und unheilvoll klang. Mehrstimmiges belustigtes Gelächter ertönte.
„Ja, sag es uns, du kleines Stück Scheiße. Was passiert dann?“
Während ihre Finger den Türgriff des Taxis packten, drehte sich Gabrielle um, halb beunruhigt, halb voller Angst vor dem, was sie sehen würde. Und wirklich: Es war die Gang aus der Bar, die Rocker, oder was auch immer sie waren, in schwarzem Leder und mit Sonnenbrillen. Diese sechs umkreisten den Jeanstyp wie ein Rudel Wölfe; abwechselnd schlugen sie nach ihm, spielten mit ihm wie mit einem Beutetier.
Der Junge holte zum Schlag gegen einen von ihnen aus, verfehlte ihn – und die Situation eskalierte augenblicklich.
Auf einmal kam die kämpfende Gruppe lautstark auf Gabrielle, die am Straßenrand stand, zu. Die Angreifer schleuderten den Jungen gegen die Motorhaube des Taxis und schlugen ihm ins Gesicht. Blut spritzte aus seiner Nase und seinem Mund, einige der Blutstropfen trafen Gabrielle. Sie trat einen Schritt zurück, geschockt, entsetzt. Der Junge suchte nach Halt, wollte fliehen, aber seine Angreifer ließen nicht von ihm ab und verprügelten ihn mit kaum vorstellbarer Brutalität.
„Verschwindet von meinem gottverdammten Auto!“, brüllte der Taxifahrer durch das offene Fenster. „Verdammt! Macht das woanders, kapiert?“
Einer der Schläger wandte dem Taxifahrer das Gesicht zu, lächelte ein schreckliches Lächeln und schlug dann mit seiner großen Faust gegen die Windschutzscheibe, sodass das Glas in eine Million winziger Kristalle zersplitterte. Gabrielle sah, wie der Fahrer sich bekreuzigte, sein Mund bewegte sich lautlos in einem stummen Gebet. Knirschend legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr mit quietschenden Reifen ruckartig los; der Junge rutschte von der Motorhaube und stürzte zu Boden.
„Warten Sie!“, schrie Gabrielle, aber es war zu spät.
Wie sollte sie nun nach Hause kommen, wie von diesem grauenvollen Ort fliehen? Starr vor Angst sah sie, wie das Taxi davonraste, sah seine roten Schlusslichter in der Dunkelheit verschwinden.
Die sechs Männer kannten unterdessen kein Erbarmen mit ihrem Opfer, prügelten es bis zur Besinnungslosigkeit – und bemerkten in ihrer Raserei Gabrielle nicht.
Die drehte sich um und rannte die Stufen zum Eingang vom La Notte wieder hinauf, während sie in ihrer Handtasche nach ihrem Mobiltelefon suchte. Endlich fand sie es und klappte es auf. Sie wählte die Notrufnummer, während sie die Türen des Clubs aufriss und in die Eingangshalle stolperte. Panik stieg in ihr auf. In dem ganzen Lärm, den die Musik und die Stimmen verursachten, aber auch durch das laute Hämmern ihres Herzens, hörte Gabrielle nur ein Rauschen am anderen Ende der Leitung. Sie nahm das Handy von ihrem Ohr …
Keine Verbindung.
„Scheiße!“
Erneut versuchte sie den Notruf zu wählen, aber sie hatte kein Glück.
Gabrielle lief auf den Hauptbereich des Clubs zu und schrie verzweifelt in den Lärm hinein.
„Irgendjemand – bitte helft mir! Ich brauche Hilfe!“
Niemand schien sie zu hören. Sie klopfte Leuten auf die Schulter, zog an Ärmeln und riss am Arm eines tätowierten, militärisch aussehenden Typen, aber niemand schenkte ihr irgendwelche Aufmerksamkeit. Sie sahen sie nicht einmal an, sondern tanzten und redeten einfach weiter, so als ob sie gar nicht existierte.
War dies ein Traum? Ein Albtraum vielmehr, in dem sie als Einzige wusste, was draußen geschah?
Gabrielle gab es auf und machte sich stattdessen auf die Suche nach ihren Freunden. Als sie durch den dunklen Club lief, drückte sie immer wieder die Taste für die Wahlwiederholung, in der Hoffnung auf eine Verbindung. Aber sie bekam einfach keine, und bald wurde ihr klar, dass sie Jamie und die anderen in der dichten Menschenmenge niemals finden würde.
Verzweifelt bahnte sie sich ihren Weg zurück zum Ausgang des Clubs. Vielleicht konnte sie einen Autofahrer anhalten, einen Polizisten finden, irgendetwas!
Eisige Nachtluft schlug ihr ins Gesicht, als sie die schweren Türen aufdrückte und nach draußen trat. Sie stürmte die ersten Treppenstufen hinunter, nun keuchend, unsicher, was sie erwartete – eine Frau allein gegen sechs Schläger, die wahrscheinlich unter Drogen standen. Aber sie konnte sie nicht sehen.
Sie waren verschwunden.
Eine Gruppe von jungen Clubbesuchern stieg die Stufen hinauf. Einer von ihnen spielte Luftgitarre, seine Freunde redeten davon, später in dieser Nacht noch auf eine Party zu gehen.
„Hey“, sagte Gabrielle, halb in der Erwartung, dass sie einfach an ihr vorbeigehen würden. Sie hielten inne und lächelten sie an, selbst wenn sie mit ihren achtundzwanzig Jahren wahrscheinlich ein Jahrzehnt älter war als jeder von ihnen.
Der Typ an der Spitze nickte ihr zu. „Was ist los?“
„Hat einer von euch …“ Sie zögerte, nicht sicher, ob sie erleichtert sein sollte, dass dies offensichtlich doch kein Traum war. „Habt ihr zufällig die Schlägerei gesehen, die hier draußen vor ein paar Minuten stattgefunden hat?“
„Eine Schlägerei? Super!“, sagte der mit der Luftgitarre.
„Nee, Mann“, antwortete ein anderer. „Wir sind gerade erst hergekommen. Wir haben nix gesehen.“
Sie gingen an ihr vorbei, stiegen die restlichen Stufen hinauf, während Gabrielle sprachlos zusah und sich fragte, ob sie den Verstand verlor. Sie ging zum Straßenrand hinunter, wo das zerbrochene Glas von der Windschutzscheibe noch immer über die Straße verstreut lag. Da war Blut auf dem Asphalt zu sehen, aber der Junge und seine Angreifer waren verschwunden.
Gabrielle stand im Schein einer Straßenlaterne da und rieb sich die Arme, um das Kältegefühl darin zu vertreiben. Sie drehte sich um, blickte die Straße in beide Richtungen hinunter, auf der Suche nach irgendeinem Anzeichen für die Gewalt, deren Zeugin sie vor nur wenigen Minuten geworden war.
Nichts.
Aber dann … hörte sie es.
Das Geräusch kam aus einer schmalen Gasse auf ihrer rechten Seite. Gesäumt von einer schulterhohen Betonwand, die den Schall verstärkte, drang aus dem finsteren Weg ein schwaches, tierähnliches Grunzen bis zur Straße. Gabrielle konnte das seltsame Geräusch nicht einordnen. Sie konnte sich dieses ekelhafte Schmatzen, das ihr das Blut in den Adern gefrieren und jede Faser ihres Körpers vor Angst vibrieren ließ, nicht erklären.
Ihre Füße bewegten sich. Nicht weg von der Quelle dieser verstörenden Geräusche, sondern darauf zu. Ihr Mobiltelefon lag wie ein Backstein in ihrer Hand. Sie hielt die Luft an. Ihr war gar nicht bewusst, dass sie das Atmen vergessen hatte, bis sie ein paar Schritte in die Gasse gemacht hatte und ihr Blick auf die Gestalten vor ihr fiel.
Die Schlägertypen in Leder und mit den Sonnenbrillen.
Sie hatten sich auf ihre Hände und Knie niedergelassen, zogen und zerrten an etwas. In dem schwachen Licht, das von der Straße hereindrang, erhaschte Gabrielle einen flüchtigen Blick auf ein zerfetztes Stück Stoff, das in der Nähe einer Blutlache lag. Es war das Trägerhemd des Jeanstyps, zerrissen und fleckig.
Gabrielles Finger, der über der Wahlwiederholungstaste ihres Handys schwebte, senkte sich stumm auf den winzigen Knopf. Am anderen Ende war ein leises Tuten zu hören, und dann unterbrach die Stimme des Diensthabenden dröhnend die Stille der Nacht.
„Sie haben den Notruf gewählt. Worin besteht Ihr Notfall?“
Einer der Schläger hatte die Stimme auch gehört und drehte sich ruckartig zu Gabrielle um. Wilde, hasserfüllte Augen durchbohrten sie wie Dolche und ließen sie wie angewurzelt an Ort und Stelle verharren. Sein Gesicht war blutig, glitschig von geronnenem Blut. Und seine Zähne – sie waren scharf wie die eines Tieres. Nein, eigentlich waren es keine Zähne, sondern Fänge, die er entblößte, als er seinen Mund öffnete und ein schrecklich klingendes Wort in einer fremden Sprache fauchte.
„Sie haben den Notruf gewählt“, sagte der Polizeidienstleiter erneut. „Bitte nennen Sie die Art des Notfalls.“
Gabrielle konnte nicht sprechen. Vor lauter Entsetzen konnte sie kaum atmen. Zwar gelang es ihr, das Handy an ihren Mund zu heben, doch kam kein Laut über ihre Lippen. Die Chance war vertan.
Da ihr dies selbst völlig klar war, tat Gabrielle das einzig Vernünftige in dieser Situation. Mit zitternden Fingern drehte sie das Handy in Richtung der Schläger und drückte den Auslöser der Handy-Kamera. Ein kleiner Blitz erhellte die Gasse.
Nun drehten sich alle zu ihr um und schützten ihre mit Sonnenbrillen bedeckten Augen.
Oh Gott. Vielleicht hatte sie trotzdem noch eine Chance, dieser höllischen Nacht zu entkommen. Gabrielle drückte die Fototaste wieder und wieder und wieder … die ganze Zeit über, während sie aus der Gasse auf die Straße zurückwich. Sie hörte murmelnde Stimmen, geknurrte Flüche, sich bewegende Füße auf dem Asphalt, aber sie wagte es nicht, sich umzudrehen. Nicht einmal, als das scharfe Zischen von Stahl hinter ihr erklang, gefolgt von grässlichen Schreien der Qual und der Wut.
Gabrielle rannte in die Nacht hinaus, getragen von dem Adrenalin und der Angst in ihrem Blut, und hielt nicht an, bis sie ein Taxi erreichte, das auf der Commercial Street stand. Sie sprang hinein und knallte die Tür zu, keuchend und halb verrückt vor Angst.
„Fahren Sie mich zur nächsten Polizeiwache!“
Der Taxifahrer legte einen Arm um die Rückseite der Sitzlehne und drehte sich zu ihr um. Er runzelte die Stirn. „Sind Sie in Ordnung, Lady?“
„Ja“, antwortete sie automatisch. Und dann: „Nein. Ich muss etwas melden, einen …“
Mein Gott. Was wollte sie denn eigentlich melden? Einen kannibalischen Futterstreit bei einem Rudel tollwütiger Rocker? Oder die einzige mögliche andere Erklärung, die kein bisschen glaubwürdiger war?
Gabrielles Augen begegneten dem besorgten Blick des Fahrers. „Bitte beeilen Sie sich. Ich bin soeben Zeugin eines Mordes geworden.“
2
Vampire.
Die Nacht war voll davon. Er hatte in dem Club mehr als ein Dutzend von ihnen gezählt. Die meisten waren durch die halb bekleidete, wogende Menschenmenge gegangen und hatten die Frauen ausgesucht – und verführt –, die in jener Nacht ihren Durst stillen würden. Das war ein symbiotisches Arrangement, das dem Stamm mehr als zwei Jahrtausende gute Dienste geleistet hatte – ein friedliches Zusammenleben, das nur durch die Fähigkeit der Vampire, die Erinnerungen der Menschen zu löschen, von denen sie sich nährten, gelingen konnte. Bevor die Sonne aufging, würde eine Menge Blut vergossen werden, aber am nächsten Morgen würde der Stamm zu seinen Dunklen Häfen in und bei der Stadt zurückgekehrt sein, und die Menschen, von denen sie in dieser Nacht gekostet hatten, würden nichts davon wissen.
Aber das war in der Gasse vor dem Nachtclub nicht der Fall.
Für die sechs blutrünstigen Raubtiere hier würde dieser unrechtmäßige Mord, der gegen den Kodex des Stammes verstieß, der letzte sein. In ihrem Hunger waren sie leichtsinnig geworden; sie hatten nicht bemerkt, dass sie beobachtet wurden. Weder als er sie in dem Club überwacht noch als er sie nach draußen verfolgt und vom Sims eines Fensters im zweiten Stock der zweckentfremdeten Kirche aus beobachtet hatte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!