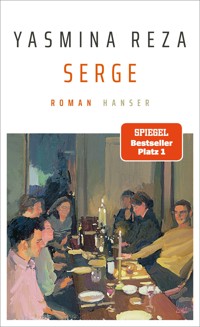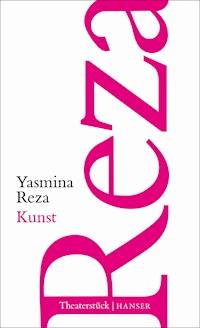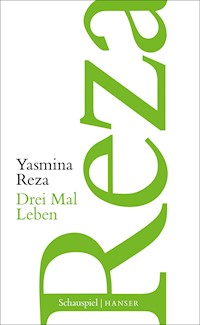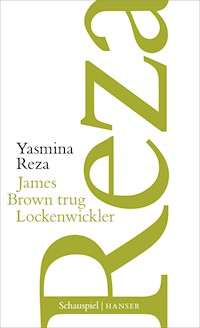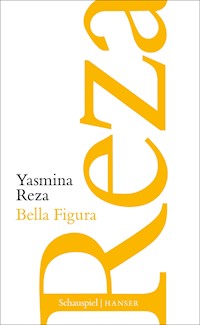Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nur Yasmina Reza schreibt so lakonisch und klug über die Kippmomente der Existenz
Seit Jahren beobachtet Yasmina Reza Strafprozesse. Es sind Geschichten, die man mit angehaltenem Atem liest. Ein Mann ermordet die vierköpfige Familie seines Schwagers und legt die Leichenteile seiner Frau zu Füßen. Eine Frau klagt wegen Vergewaltigung und schreibt dem Täter danach glühende Liebesbriefe. Lakonisch und beinahe zärtlich porträtiert Reza die Menschen. Es geht nicht um Schuld oder Unschuld, sondern um den Moment, in dem ein Leben aus der Normalität kippt. Ebenso knapp und eindrucksvoll erzählt sie von persönlichen Begegnungen mit guten Freunden oder in der Familie. Reza zeigt „die Rückseite des Lebens, in seiner Unvollkommenheit, aber auch Heiterkeit“. Ein Meisterwerk voller Tragik, Komik und Empathie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über das Buch
Nur Yasmina Reza schreibt so lakonisch und klug über die Kippmomente der ExistenzSeit Jahren beobachtet Yasmina Reza Strafprozesse. Es sind Geschichten, die man mit angehaltenem Atem liest. Ein Mann ermordet die vierköpfige Familie seines Schwagers und legt die Leichenteile seiner Frau zu Füßen. Eine Frau klagt wegen Vergewaltigung und schreibt dem Täter danach glühende Liebesbriefe. Lakonisch und beinahe zärtlich porträtiert Reza die Menschen. Es geht nicht um Schuld oder Unschuld, sondern um den Moment, in dem ein Leben aus der Normalität kippt. Ebenso knapp und eindrucksvoll erzählt sie von persönlichen Begegnungen mit guten Freunden oder in der Familie. Reza zeigt »die Rückseite des Lebens, in seiner Unvollkommenheit, aber auch Heiterkeit«. Ein Meisterwerk voller Tragik, Komik und Empathie.
Yasmina Reza
Die Rückseite des Lebens
Aus dem Französischen von Claudia Hamm
Hanser
Für Pascale Robert-Diard
und Stéphane Durand-Souffland,
meine Freunde und Lehrmeister
Letzte Schatten
Wenn ich in Venedig bin, fotografiere ich Alte von hinten. Ich meine alte Paare.
Ich habe solche Leute nirgends sonst gesehen. Nirgendwo auf der Welt habe ich solche langsamen, stummen, gedrungenen Gespanne gesehen. Ihre Schritte mischen sich in das Glucksen und Aneinanderschlagen der Boote. Ich kann mit Gewissheit sagen, dass sie schon immer dort gelebt haben. Sie schlurfen mit gesenkten Köpfen aneinandergeklebt durch die leeren Gassen, sie kennen die Gemäuer und Stufen, wissen, wo sie abbiegen und in einem Schatten verschwinden müssen. Manchmal hat sich der Mann bei der Frau eingehakt, manchmal die Frau beim Mann. Die meisten meiner Fotos sind in der Dämmerung oder im Dunkeln aufgenommen. Um diese Zeit sehe ich sie in uralten Pelzmänteln, an den Schultern und auch sonst viel zu großen Nerzen oder, im Fall der Männer, nicht weniger spektakulär weiten, aus der Mode gekommenen Lodenmänteln mit Riegeln im Rücken dahinziehen. Sie tragen Filzhüte, die Frauen rundliche Häkelmützen, die über die Ohren reichen und ihre Köpfe aufblähen.
Wenn sie einmal gestorben sind, werden ihre prächtigen Kleider in ein Boot geworfen, auf einem Flohmarkt auf Bügeln feilgeboten oder zerschreddert werden. Aber ich werde sie noch gesehen haben, die letzten Schatten in diesem Wasserlabyrinth.
Die Rückseite des Lebens
Édith Scaravetti hat ihren Mann Laurent Baca nachts mit einer Kugel aus einer 22er Long Rifle in die Schläfe umgebracht.
Eine ganze Weile lang kann ich ihr Gesicht nicht erkennen, obwohl der Gerichtssaal klein ist und meine Sitzbank nicht weit entfernt. Das schwarze Haar zurückgebunden, der untersetzte Körper wie eingefroren, starrt sie auf einen Punkt knapp vor ihren Schuhen.
Sie arbeitete in einem häuslichen Pflegedienst, er dealte mit Drogen und installierte schwarz Haushaltsgeräte. Sie lebten in einem Häuschen, das einmal Édiths Großvater gehört hat.
Eines Morgens erzählt sie den Kindern, Laurent schlafe auf dem Wohnzimmersofa. Sie fährt sie zur Schule, dann versteckt sie die Leiche auf der Terrasse unter der Laube. Ein paar Tage später schleift sie sie, weiß Gott wie, ans Ende des Gartens, gräbt ein Loch und verscharrt sie darin.
Sie lässt fast eine Woche vergehen, bis sie ihren Mann vermisst meldet.
Sie behauptet, er sei ohne Handy für ein »Go Fast« nach Italien gefahren.
Zwei Wochen lang spielen die Kinder im Garten. Zumindest bis zu den Fliegen. Denn irgendwann verwandelt sich das Grab in eine Pestgrube, mit fetten, riesigen Fliegen.
Édith gräbt ihn aus und zerrt ihn auf den Dachboden.
Dafür muss sie durch eine Deckenluke im Zimmer des Jüngsten.
Édith schleift die verwesende Leiche des Vaters mit den Fliegen und Würmern in einem Müllsack ins Kinderzimmer.
Sie steigt wieder hinunter in die Garage, sie wirft den Betonmischer an, sie klettert mit dem Beton wieder hinauf. Da er nicht ausreicht, steigt sie noch einmal hinunter, sie klettert wieder hinauf, sie baut eine Verschalung, sie füllt sie mit der Masse, sie wartet, bis der Beton getrocknet ist, sie verputzt sie.
Klein und schmächtig, wie sie in der Box steht, traut man ihr all diese Handlungen kaum zu.
Der Familie des Vermissten und den drei Kindern erklärt sie weiter, Laurent sei wegen eines Geschäfts unterwegs.
Als ihre Schwiegermutter sie fragt, was sie sich zu Weihnachten wünscht, antwortet sie: »Dass Laurent zurückkommt.«
Sie lügt drei Monate lang, dann knickt sie bei einer Hausdurchsuchung ein.
Es ist ein seltsamer Prozess.
Kaum Leute, ein fast ausschließlich weiblich besetztes Gericht, eine reg- und lange Zeit wortlose Angeklagte. Die Psychologin macht ihre Aussage in Bermudashorts und Lackschuhen. Der Ballistik-Experte erscheint mit einem Schädel in einer Proxi-Plastiktüte.
Das Gesicht des Toten wallt im Spiegel eines bewegten Gewässers.
Den einen zufolge von morgens bis abends Alkohol, Joints oder gar Koks, Pedanterie, Schläge. Laut den anderen, etwa seiner Mutter, »ein Goldschatz«. Ein unabhängigerer Zeuge: »Er war ein guter Kerl mit einem Problem. Jetzt kommt langsam der Mann zum Vorschein, der ständig mit einer angelegten Knarre herumlief.«
Seine Kinder liebten ihn. Seine Frau ging ein.
Das Leben eines Paars ist undurchschaubar. Ein soziales Gefüge, das seine Realität bewusst verschweigt oder verbiegt.
Mit zwölf wird Édith auf einem Campingplatz vergewaltigt. Vor Laurent hat sie nie jemandem davon erzählt. In dem Alter, in dem Mädchen ausgehen und ihren Spaß haben, kümmert sie sich um einen Großvater, der an Alzheimer erkrankt ist, damit ihre Mutter sich ein neues Leben aufbauen kann. Ihr Vater ist Kraftfahrer und immer unterwegs. Er ist verschlossen und genauso wortkarg. »In einem LKW singt man vielleicht oder hört Nachrichten, ansonsten ist man allein.«
Édith gewöhnt sich an dieses glanzlose, ausgedörrte Leben.
»Sie hat aufgegeben«, sagt die Psychologin in Shorts.
Laurent Baca holt sie aus dieser Vereinsamung. Sie lieben sich. Er ist genauso labil. Eine Zeitlang sind sie glücklich. Bis das Unglück und alle möglichen Verletzungen wieder hochkommen. Bis sie ein immer schwerer werdendes Leben stemmen muss: das Haus, die Einkäufe, die Kinder, den tyrannischen Mann, den Alkohol, zudringliche Freunde.
Sie hat sich mit Laurents Schwester angefreundet. Sie hätte ihr alles erzählen können.
Aber wenn man sein Ich in der Gewissheit ausgebildet hat, dass niemand einem helfen kann, erzählt man niemandem etwas. Außerdem: »Schwer, jemandem etwas zu sagen, das man sich selbst nicht eingestehen will.«
Eines Tages lernt Édith einen Mann kennen, er ist bei der Feuerwehr und ebenfalls einsam. Sie beginnen eine Art Flirt. Sie treffen sich heimlich draußen, an verschiedenen Orten, sie reden miteinander. Über nichts wirklich Persönliches. Dem Gericht, das ihn fragt, was er für sie gewesen sei, antwortet der Mann mit starkem Toulouser Akzent: »Ich war ihr Lichtblick.«
Ob das seine Formulierung sei oder ihre?
»Na ja, ich war wirklich ihr Lichtblick.«
»Worüber haben Sie sich unterhalten?«
»Über dies und das.«
»Und sonst?«
»Äh, wir haben eben über dies und das geredet.«
»Über dies und das.«
»Ja, genau.«
In Verhandlungen sagen Leute oft, sie hätten »über dies und das« geredet. Sie treffen sich im Nirgendwo und sagen einander Dinge, deren Substanz sich sofort in Luft auflöst. Keine Vorwürfe, kein Kummer. Die Rückseite des Lebens. Man leistet sich Gesellschaft, man verbringt Zeit miteinander. Es ist leicht. Dies und das heißt nur: da sein, und das nicht einmal zum Reden.
Toulouse · März 2018 · Schwurgericht des Departements Haute-Garonne
Spaziergang am kalten Ufer der Spree
Eines Abends im Winter 2021 liefen wir in Berlin zu zweit die Spree entlang.
Es war der Tag vor einer Wiederaufnahme von Kunst am Berliner Ensemble, wir waren losgezogen, um uns das Plakat anzuschauen. Wie immer hatte ich mich bei ihm untergehakt. Zum Reden blieb er stehen, ging dann langsam weiter, humpelte ab und zu. Es war kalt. Ich sagte: »Rainer, können wir ein bisschen schneller gehen?«
»Mit meinem Knie geht das nicht so einfach, ich bin halt nicht mehr so jung.«
»Ach, kommen Sie!«
»Immerhin einundachtzig, Yasmina.«
Auf einmal war es nicht mehr derselbe Spaziergang. Durch welchen üblen Streich war Rainer, den ich meiner Erinnerung nach als fast Gleichaltrigen kennengelernt hatte, mit seiner Kippe und seinem ledernen Männerhandtäschchen, plötzlich einundachtzig geworden, eine absurde, erschreckende Zahl. Genau das passiert Leuten, die weit weg voneinander wohnen. Sie altern im Verborgenen, und wenn sie sich ein- oder zweimal im Jahr sehen, machen sie sich schön und geben sich jung. Man sieht nichts kommen. Und macht es selbst genauso. Und ist deshalb nicht gefasst auf einen Schlag wie den im eisigen Wind an der Spree. Meinen Arm unter seinem, wurde ich plötzlich seiner Zerbrechlichkeit gewahr. Des Hinkens, das nun Altern hieß. Dieser Zahl, die nun ausbleibende Zukunft bedeutete. Das Alter stand uns plötzlich beiden bevor. Denn jedem Augenblick des einen entspricht einer des anderen, wir alle bewegen uns in derselben Zeit, so wie die zwei Seiten von Borges’ Münze, die über Bord in den Ozean geworfen wird.
Rainer Witzenbacher war mein erster Agent im Ausland gewesen, und von allen, die ich noch anderswo hatte, ist er der einzige, den ich bis heute behalten habe. Uns verbindet ein Leben in Arbeit und Freundschaft. Ein Leben des Schlenderns durch deutschsprachige Städte, der Beklommenheit nebeneinander in dunklen Theatersälen, der Auseinandersetzungen (er ist stur) und der Momente großer Freude.
Leute, die sich nur hin und wieder sehen, geben sich Mühe, einander nicht zu enttäuschen. In Der Gott des Gemetzels erzählt eine Frau von einem Mann, der ihr einmal gefallen hat. Bis zu dem Moment, da er leider mit einer Männerhandtasche auftaucht. Sein Anhängsel setzt der Anziehung augenblicklich ein Ende. Als ich in Zürich ankam, um die (großartige) Inszenierung des Stücks von Jürgen Gosch anzusehen, sagte Rainer in den Gängen des Flughafens zu mir: »Und, fällt Ihnen nichts auf?«
»Sie haben abgenommen?«
»Nein.«
»Der Bart ist anders?«
»Nein, kein bisschen.«
»… Ich finde, Sie sehen gut aus. Aber ich weiß nicht, was Sie meinen.«
»Sehen Sie nicht, dass ich keine Tasche mehr dabeihabe? … Wegen Ihnen benutze ich sie nicht mehr. Aber ich leide. Ich weiß nicht mehr, wo ich mein Brillenetui hinstecken soll, mein Portemonnaie, die Taschentücher. Wo soll ich jetzt meine Schlüssel hintun?«
Einundachtzig, das hieß, eines nicht allzu fernen Tages würde unsere Beziehung auf die eine oder andere Weise enden, so wie natürlich alles zu grauem, bedeutungslosem Staub wird. Diese Ecke von Berlin an der Spree neben dem BE, in der ich auch später wieder gewesen bin und sogar mit ihm und sogar im Frühling, umgeben von Leuten, die Tango getanzt haben, bleibt für mich mit diesem nächtlichen Spaziergang verbunden, bei dem sich mir auf entsetzliche Weise die Zeit in Erinnerung rief.
»Verzweiflung«
Am 3. August 2021 hat Dalila in der Metrolinie 13 Richtung Châtillon ein kleines Gemetzel angerichtet.
Sie hat einem jungen schwarzen Lieferanten ein Messer in den Brustkorb gerammt und ihn mit rassistischen Beleidigungen überschüttet, hat einem weißen Koch, der sich dazwischenwarf, die Hand aufgeschlitzt und einer sechsundsiebzig Jahre alten Frau, die das Pech hatte, gerade dort zu sitzen, das Knie zerschnitten.
In die Box tritt mit kindlicher Lebhaftigkeit ein kleiner, kratzbürstiger, schnurrbärtiger Würfel. Verkniffener Mund, mattdunkler Teint, schwarzes Kraushaar, schwarzer Rollkragen.
Die Vorsitzende Richterin: »Finden Sie es normal, mit einem Springmesser durch die Gegend zu laufen?«
»Ich habe es dabei, seit mir mein Scooter geklaut wurde und ich mich nicht verteidigen konnte.«
Die Stimme, die diesem vierschrötigen Körper entweicht, ist erstaunlich sanft und wohlartikuliert. Zu dem Zeitpunkt, da Dalila vor Gericht steht, ist sie bereits seit achtzehn Monaten im Gefängnis in Fresnes inhaftiert.
»Und wie läuft es im Gefängnis?«
»Gut.«
Auf der anderen Seite des Zeugenstands, ihr gegenüber, sitzen auf den Klappsitzen an der Seite Herr Dansoko und Herr Esposito, die beiden Verletzten, die sie angezeigt haben.
Dalila Ezzitouni war mit Kopfhörern auf den Ohren singend einen Metrogang entlanggeschlendert. Als Kouré Dansoko, der gerade mit seinem Cousin telefonierte, an ihr vorbeilief, drehte er sich nach ihr um.
Dieser Blick hat Dalila nicht gefallen.
»Ich habe ein Lied gesungen, vielleicht ein bisschen laut. Aus meiner Sicht hat er mich irgendwie komisch angeschaut. Ich hatte den Eindruck, dass er mich runterputzt. Ich bin da ziemlich empfindlich. Wenn mich jemand mit hochgezogenen Augenbrauen anstarrt, denke ich, dass er sich über mich aufregt.«
Kouré Dansoko ist der Meinung, er habe sie nicht komisch angeschaut, die Videoaufnahmen bestätigen das.
Die beiden steigen in dasselbe Abteil. Die Aufnahmen zeigen, dass sie ihm nachläuft, ihn angeht, Streit sucht.
»Er hat seine Maske unter der Nase getragen. Ich habe ihm gesagt, er soll sie richtig aufsetzen. Er hat gesagt, er würde seine Maske lassen, wo sie ist. Da bin ich ausgeflippt.«
»Bei seiner Vernehmung hat Laurent Esposito ausgesagt, Sie seien in Rage gewesen und hätten Monsieur Dansoko wirklich erstechen wollen.«
»Er hat sich auf das Messer geworfen, und danach, ja, da ist es ein bisschen aus dem Ruder gelaufen.«
»Sie hätten zu ihm gesagt: ›Setz deine Maske auf, Drecksneger, du steckst uns noch alle an!‹«
»Ich war genervt. Ich habe durch die Coronakrise meine Arbeit und meine Wohnung verloren.«
»Sie hätten zu ihm gesagt: ›Dreckiger Schwarzer, Hurensohn, ich will, dass du die Wut kriegst, und dann bring ich dich um.‹ Monsieur Dansoko ist weiter ruhig geblieben, Monsieur Esposito meint, er sei beeindruckt gewesen von der außerordentlichen Freundlichkeit von Monsieur Dansoko, der Sie kein einziges Mal beleidigt hat.«
Die Vorsitzende Richterin betont, wie mutig es von Laurent Esposito gewesen sei, sich dazwischengeworfen zu haben. Und der berichtet im Zeugenstand, er habe das Messer zuerst gar nicht gesehen. Als er sie am Boden festgehalten habe, um sie zu bändigen, habe Dalila auf Kouré Dansoko eingeschlagen und geschrien: »Ich bring dich um, ich bring dich um, dreckiger Affe!«
»Madame, sind Sie Rassistin?«
»Nein, ich glaube nicht. Nein … Wenn es ein Weißer gewesen wäre, hätte ich gesagt dreckiger Weißer.«
»Sind Sie sich da sicher, Madame? … Bei Ihrer ersten Anhörung haben Sie zugegeben, ›ein kleines bisschen rassistisch‹ zu sein, und haben das offenbar darauf zurückgeführt, dass Sie mehrmals Ihre Stelle verloren haben.«
»Alle Jobs, die ich in den Kaufhäusern hatte, beim BHV, beim Carrefour …, das war immer mit Migranten …, jedes Mal habe ich sie verloren.«
»Wegen der Migranten?«
»Ich habe immer Probleme mit denen gehabt, immer nur Ärger.«
»Sie sagen Migranten, aber es könnten auch Franzosen gewesen sein.«
»Ja.«
»Ihre Mutter ist Marokkanerin und Ihr Vater Algerier, Sie selbst sind in Frankreich geboren. Hätten Sie oder Ihre Eltern nicht genauso die Opfer eines solchen Angriffs sein können?
»Ja. Ich sitze irgendwie im selben Boot.«
»In welcher Situation waren Sie, als das passiert ist?«
»Ich hatte in einem Restaurant im 14ten eine Stelle gefunden und mir ein Hotelzimmer an der Porte de Clichy genommen, ich habe ein bisschen Geld verdient, aber das ist nicht so geblieben.«
»Warum?«
»Der Restaurantchef hat meine Probezeit beendet. Ich musste wieder von null anfangen.«
»Sie sind achtundzwanzig. Haben Sie immer gearbeitet?«
»Ja. Zimmermädchen im Holiday Inn, Teammitarbeiterin bei McDonald’s, Verkaufsberaterin bei Zara, Angestellte im Carrefour Market, Servicekraft in einem Restaurant … Ich habe auch im BHV gearbeitet.«
»Und Ihre Kindheit?«
»Viel Gewalt von meiner Mutter. Ich wurde geschlagen. Ich habe dumme Sachen gemacht. Meine Mutter war Alkoholikerin. Jetzt ist sie Lagerarbeiterin.«
»Und Ihr Vater?«
»Ist weg.«
»Ist Ihre Mutter hier im Saal?«
Dalila schaut die Reihen durch und verneint.
»Als ich meiner Mutter gesagt habe, dass ich auf Mädchen stehe, war das nicht leicht. In der Schule haben sie sich über mich lustig gemacht. Ich war dick. Ich war … Aber ich war nicht gemein.«
»Und der Rassismus?«
»Das ist vor allem Wut.«
»In Ihrer Akte steht, Sie seien viermal wegen gewalttätiger Handlungen verurteilt worden. In einer Unterbringung hätten Sie das Fahrrad der Chefin zertrümmert.«
»Ich habe sehr viel Wut und Gewalt in mir.«
»Haben Sie getrunken?«
»Ich habe viel gekifft. Und ein bisschen gekokst. Das Kokain … ich war echt verloren, das hat meine Verzweiflung erst richtig rausgebracht. Jetzt im Gefängnis nehme ich nichts. Ich rauche nur Zigaretten.
»Sind Sie in Behandlung?«
»Ja. Ich habe Medikamente. Ein Antidepressivum und Beruhigungsmittel.«
Plötzlich Lärm im kleinen Verhandlungssaal. Von hinten hört man eine Stimme: »Ich bin die Mutter. Hier, ich bin die Mutter.«
Sie ist überraschend doch noch gekommen. Sie hat Stil, blaue Augen, ist groß und trotz der vom Alkohol aufgedunsenen Züge schön. Sie trägt eine lange rosa Weste und wirkt fast jünger als ihre Tochter. In welchem Alter hat sie sie bekommen?
Die Richterin: »Setzen Sie sich, Madame.«
Sie setzt sich in die erste Reihe neben die Box. Als die Anwältin der beiden Kläger neuntausend Euro Schmerzensgeld plus Zinsen fordert, ruft sie: »Meine Tochter ist obdachlos!«
»Madame, Sie haben kein Rederecht!«
Der junge Staatsanwalt ist dran.
Im donnernden (der bescheidenen Größe des Saals völlig unangemessenen) Brustton der Überzeugung und Empörung erinnert er an die besondere Schwere der fremdenfeindlichen, rassistischen Gewalt, über die hier zu urteilen sei. »Dreckiger Affe!«, ruft er. »Was die Werte angeht, aber auch grundsätzlich die Menschlichkeit: dreckiger Affe! Das ist wirklich eine Schande! Ich hätte nicht geglaubt, dass man 2023 in Frankreich so etwas noch hören würde! Da kann man nur entsetzt sein!«
Es folgt eine Hymne auf die Herren Dansoko und Esposito, diese Helden des Alltags, die im Gegensatz zu der erbärmlichen Rassistin in der Box ein beeindruckendes Vorbild abgäben.
»Aber sie ist doch selbst Maghrebinerin!«, schreit die Mutter von ihrer Bank aus.
»Madame, verlassen Sie bitte den Saal«, sagt die Vorsitzende Richterin, »Sie haben offensichtlich nicht verstanden, was ein Gericht ist.«
Zwei Polizeibeamte führen sie zum Ausgang. Der Staatsanwalt fährt fort. Dalila hört ihm zu und verzieht dabei den Mund zu einem Flunsch. »Es ist offensichtlich, dass Monsieur Dansoko mit allen Mitteln versucht hat, eine Konfrontation zu vermeiden, während ihm von der anderen Seite eine Kriegsrhetorik entgegenschlug. Dabei ist zu bedenken, dass Madame Ezzitouni ihr Möglichstes getan hat, um in dem Gemenge eine Lücke zu finden und auf einen Mann einzustechen, von dem Monsieur Esposito sagt, er sei der netteste Mensch, der ihm je begegnet sei, denn er antworte niemals mit Aggression. Im Gegenteil, während er verletzt ist, entschuldigt er sich noch, dass er eine blutende Wunde am Brustkorb hat, er entschuldigt sich bei den Mitreisenden, dass er eine Verspätung verursacht hat! Das sind die Leute, die man im 21. Jahrhundert dreckige Schwarze nennt!«
Er fordert fünf Jahre Haft.
Dalilas Anwalt beginnt damit, dass er die Schwere der Taten ja nicht bestreite und noch weniger die rassistischen Bemerkungen. Ja, er sei sich bewusst, dass das alles sehr schlimm sei. Und wie! Er braucht gut fünf Minuten, um der Tugend seinen Tribut zu zollen und den Anwesenden im Saal zu versichern, dass er nie auf die Idee käme, die entsetzlichen Vergehen seiner Mandantin verharmlosen zu wollen.
Schließlich macht er einen kleinen Abstecher in die Kindheit: die Mutter, die Schläge, das Heim, die Mutter, die Schläge … »Nicht jeder hat einen solchen Werdegang. Was wären wir selbst, wenn wir so eine Geschichte gehabt hätten?« Er fasst sich kurz. Es gibt nur diese Aufzählung: die Mutter, das Heim, die Schläge … Wörter, die unbemerkt vorüberschwimmen. Die wie tote Bäume an einem Zugfenster vorbeirauschen. Es folgen ein paar Überlegungen zum Recht darauf, ein besserer Mensch zu werden. Er hat keine Zeit. Die Leute im Saal warten auf den nächsten Fall. Und auf den übernächsten.
Im kleinen Raum des Strafgerichts holt man nicht aus.
Man hat keine Zeit, zurückzublicken und die Geschichte von Dalilas dunklem, zerklüftetem Gesicht genauer zu ergründen.
Paris · Januar 2023 · Strafgericht · 10. Kammer
Auf der Palme
Alles ist wirr.
Sie sagt, er sei gewalttätig, er trinke. Er, sie sei krankhaft eifersüchtig, sie sitze ihm ständig im Nacken. Sie sind seit einem Jahr zusammen. Er ist kaufmännischer Angestellter in einem Software-Unternehmen.
Angeklagt ist er.
Sie sehe ich gar nicht. Sie ist vielleicht im Saal, aber ich weiß nicht, wer es ist.
Er trägt ein bordeauxrotes, gepunktetes Hemd. Auf seinem Klappsitz an der Seite hockt er ostentativ dem Gericht zugewandt, mit dem Rücken zum Publikum.
Er ist spät heimgekommen. Sie wirft ihm das vor. Sie liegt im Bett. »Als ich nach Hause komme, bin ich völlig entspannt. Sie tut alles Mögliche, um mich auf die Palme zu bringen.«
»Warum wollen Sie sie aus dem Bett holen?«
»Weil sie mich auf die Palme bringt.«
»Was bedeutet dieser Ausdruck, den Sie schon die ganze Verhandlung über benutzen?«
»Sie nervt mich, sie regt mich auf. Selbst wenn ich ganz ruhig bin, sagt sie, ich sei nicht normal. Ich hatte ein bisschen gekokst, ja, aber ich habe alles getan, um die Situation zu beruhigen. Sie können sich das auf der Aufnahme anhören, die sie gemacht hat. Sie sagt, sie ruft meine Mutter an. Da kriege ich wirklich Lust, dass sie ihre Sachen packt. Ich frage sie, ob ich ihr dabei helfen soll. Sie sagt, sie geht, wann sie will.
»Sie ziehen sie aus dem Bett. Ist das nicht Gewalt, Monsieur, wenn man an jemandem zieht?«
»Das kommt bei allen Paaren vor.«
»Sie haben ein Feuerzeug an die Wand geworfen.«
»Ja.«
»Sie sagt, Sie haben sie aus dem Bett gezerrt und in den Flur geworfen.«
»Nein. Nicht geworfen. Ich habe sie in den Flur gelegt. Sie hat Jura studiert, sie weiß, welche Wörter sie benutzen muss.«
Er gibt zu, sie beleidigt zu haben, aber leugnet jede körperliche Gewalt. Am Ende wirft er ihre Tasche aus dem Fenster, damit sie verschwindet.
Sie geht zur Polizei und erstattet Anzeige. Die Polizei taucht bei ihm auf.
»Wenn man Ihnen zuhört, hat man den Eindruck, dass Sie für nichts irgendetwas können. Wenn die Polizisten ihre Arbeit erledigen, sagen Sie, sie seien aggressiv. Wenn Sie sie grob behandeln, sagen Sie, sie bringe Sie auf die Palme. Das ist eine ziemlich seltsame Haltung.«
»Wie soll ich mich denn sonst verhalten?«
Die Anwältin der jungen Frau erhebt schwere Vorwürfe gegen den Beschuldigten. Die Staatsanwältin ist differenzierter. Sie fordert auch nicht viel für ihn.
Sein Verteidiger sagt, er sehe keinerlei Problem in der Haltung seines Mandanten, die seiner Meinung nach auch gar keine Haltung sei. Er sagt, der ganze Fall basiere ausschließlich auf der festen Annahme, die Aussagen des Opfers entsprächen der Wahrheit. Des Opfers, wohlgemerkt, nicht der Klägerin. Weshalb sein Mandant jedes Mal als Täter dastehe. Er weist auf die Schwierigkeit dieser Wortwahl für einen Anwalt hin. Eine weitere Schwierigkeit sei die Behauptung, das alles sei Gewalt. Der Mann habe ein Feuerzeug geworfen und mit den Händen gegen die Wand geschlagen. Dabei habe er sich selbst an den Handgelenken verletzt. Er fragt, ob Beleidigungen und mangelnde Nettigkeit in einer Liebesbeziehung zum Register der Gewalt gehörten. Wenn ja, habe man ein Problem. Er sagt, das Beste, was diesem Paar passiert sei, sei ihre Trennung gewesen. Weitere Einmischungen von außen seien nicht nötig.
Er schließt mit folgenden Worten: »Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich mache. Ich habe den Eindruck, gegen den Strom all derer zu schwimmen, die in diesen Fall eingeschaltet wurden. Häusliche Gewalt ist eine wirklich schwierige Angelegenheit geworden. Vor einigen Jahren hat sie sich noch im Dunklen abgespielt, inzwischen ist es das Gegenteil, jetzt wird so viel Licht darauf geworfen, dass man geblendet ist und die Realität nicht mehr sieht.«
Paris · November 2022 · Strafgericht · 10. Kammer
Nella strada
Früher Abend. Richtung Rialto. Auf dem Weg treffe ich Benigno Brolese.
Ein Glück, denn es gibt viel zu besprechen. Benigno ist der Architekt, der gerade die Renovierungsarbeiten in meiner Wohnung in Venedig betreut. Wir haben uns angefreundet, aber zurzeit belasten die Probleme mit dem Abschluss der Arbeiten unsere sonst unbeschwerte Beziehung.