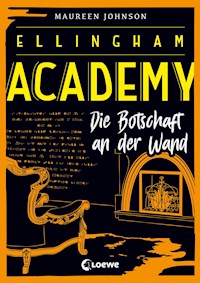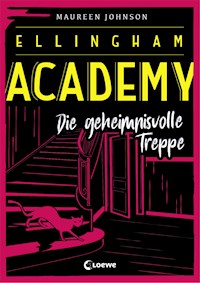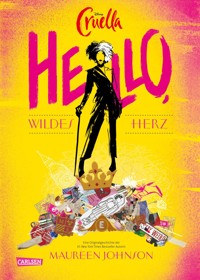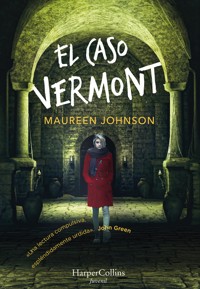10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Schatten von London-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wenn das Grauen in den Straßen von London lauert ...
Nachdem Rory den Jack-the-Ripper-Doppelgänger in einem finalen Kampf vernichtet hat, ist sie selbst zu einem menschlichen Terminus geworden. Sie hat nun die zweifelhafte Gabe, Geister durch bloße Berührung eliminieren zu können. Genau das macht sie unendlich wertvoll für die Shades – die Internationale Sondereinheit von Geisterjägern. Denn eine neue Serie von mysterösen Mordfällen versetzt ganz London in Angst und Schrecken. Und diese neuen Fälle sind tatsächlich noch wahnsinniger als die Ripper-Morde. Rory erkennt schnell: Wahnsinnige Zeiten verlangen wahnsinnige Lösungen. Aber wird sie die Shades von ihren Methoden überzeugen können?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2015
Sammlungen
Ähnliche
Foto: © Heather Weston
DIEAUTORIN
Maureen Johnson kam während eines Schneesturms in Philadelphia zur Welt. Als Einzelkind blieb ihr nichts anderes übrig, als ihre Zeit mit Lesen und Schreiben totzuschlagen, deshalb fasste sie schnell den Entschluss, Schriftstellerin zu werden. Sie studierte Theatrical Dramaturgy und Writing an der Columbia University und schrieb 2004 ihren ersten Roman für Jugendliche. Weitere folgten. Die Autorin lebt in New York, ist oft auf Lesereise in Großbritannien, verbringt aber bewiesenermaßen die meiste Zeit auf Twitter.
Von Maureen Johnson ist bei cbt bisher erschienen:
Die Schatten von London (Band 1)
Maureen Johnson
Die Schatten von London
In Memoriam
Aus dem Englischenvon Dagmar Schmitz
Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House
1. Auflage
Deutsche Erstausgabe Juli 2015
© 2013 by Maureen Johnson
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»The Madness Underneath«
bei G.P. Putnam’s Sons, a division of Penguin Young Readers Group, New York.
© 2015 für die deutschsprachige Ausgabe by cbt Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem Englischen von Dagmar Schmitz
Lektorat: Kerstin Kipker
Umschlaggestaltung: init | Kommunikationsdesign, Bad Oeynhausen
unter Verwendung eines Motivs von Thinkstock / iStock (Neil German, Dadzoola, wavipicture, Maisna, Anna Sirotina)
MG ∙ Herstellung: kw
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-16127-9
www.cbt-buecher.de
Für meinen Freund, den echten Alexander Newman, der sich auch von einer Kleinigkeit wie zwölf Schlaganfällen nicht unterkriegen lässt. Wenn ich erwachsen bin, möchte ich so sein wie du.
(Vielleicht ohne die zwölf Schlaganfälle? Na ja, du weißt schon …)
The Royal Gunpowder PubArtillery Lane, East London11. November10:15 Uhr
CHARLIE STRONG hatte gern Leute um sich – andernfalls würde er nicht schon seit einundzwanzig Jahren ein Pub betreiben –, aber morgens wollte er seine Ruhe haben. Um diese Zeit gestattete Charlie sich die einzige Zigarette des Tages. Langsam und genussvoll zog er an seiner Silk Cut und lauschte zufrieden dem leisen Knistern von verglühendem Papier und Tabak nach. Wenn kein Gast im Pub war, musste er zum Rauchen auch nicht nach draußen gehen. Eine Tasse Tee, ein Sandwich mit gebratenem Speck und eine Zigarette danach. Was wollte man mehr.
Er machte den Fernseher an. Der wurde im Royal Gunpowder nur aus zwei Gründen eingeschaltet: wenn Liverpool spielte oder wenn Morning with Michael and Alice lief – ein Morgenmagazin von gnadenloser Munterkeit. Charlie liebte es, die Sendung anzuschauen, während er sich auf den Tag vorbereitete – besonders der kulinarische Beitrag, in dem meist etwas Leckeres zubereitet wurde, hatte es ihm angetan. Aus irgendeinem Grund schmeckte ihm sein Schinkenspeck-Sandwich dann noch besser. Während er aufmerksam die Zubereitung eines Schmorhuhns verfolgte, kam sein Barmann Sam mit einem Kasten Wasser aus dem Keller herauf. Er stellte ihn auf der Theke ab und wandte sich wortlos wieder seiner Arbeit zu, hob die Stühle von den Tischen und stellte sie auf den Boden. Sams Anwesenheit störte Charlie morgens nicht. Sein Angestellter redete nicht viel und war froh und dankbar, überhaupt Arbeit zu haben, was er auch deutlich durchblicken ließ.
»Sieht gut aus, das Hühnchen«, sagte Charlie und deutete auf den Fernseher.
Sam hielt kurz inne und blickte hoch.
»Ich mag Hühnchen lieber gebraten«, erwiderte er.
»Das viele gebratene Zeug bringt dich eines Tages noch um.«
»Sagt der Mann mit dem Schinkenspeck-Sandwich.«
Charlie grinste. »An Schinken gibt es doch nun wirklich nichts auszusetzen.«
Sam schüttelte nur gutmütig den Kopf und fuhr fort, die Stühle von den Tischen zu heben. »Meinst du, dass heute Abend wieder so viele Ripper-Freaks kommen werden?«, fragte er.
»Ich will’s hoffen. Gestern haben wir fast dreitausend Pfund eingenommen. Übrigens sind fast alle Chips weggegangen. Holst du aus dem Keller Nachschub hoch? Von den Gesalzenen und …« – er bückte sich unter die Theke und überprüfte die Vorräte – »›Cheese and Onion‹. Und wenn du schon mal unten bist, dann bring auch gleich noch Erdnüsse und Flips mit. Die mögen sie auch. Flips für die Ausgeflippten.«
Wortlos unterbrach Sam seine Tätigkeit und ging erneut in den Keller hinunter. Charlie richtete den Blick wieder auf den Fernseher, wo das Hühnchen soeben die kritische letzte Phase des richtigen Schmorens durchlief, um schließlich goldbraun aus dem Ofen hervorgezogen zu werden. Es folgte ein Bericht über ein Musikfestival, das am Wochenende in London stattfand. Obwohl Charlie diesen Beitrag bei Weitem nicht so interessant fand wie die Zubereitung des Schmorhuhns, wandte er den Blick nicht vom Fernseher; er wollte seine Zigarette in Ruhe zu Ende genießen. Erst als er sie bis zum Filter aufgeraucht hatte, drückte er sie aus und machte sich an die Arbeit.
Er hatte gerade begonnen, die Tafel auszuwischen, um das neue Tagesmenü daraufzuschreiben, als er von unten das Geräusch von zersplitterndem Glas hörte. Er öffnete die Kellertür.
»Verdammt, Sam, was …«
»Charlie! Komm doch mal runter!«
»Was ist denn los?«, rief Charlie zurück.
Sam gab keine Antwort.
Hustend und leise vor sich hin fluchend stieg Charlie die Kellertreppe hinab. Die Stufen waren eng und steil und der Keller vollgestopft mit Dingen, mit denen er eigentlich lieber nichts zu tun haben wollte: kaputte Stühle und Tische, schwere Getränkekästen, Kartons mit Gläsern – Ersatz für die, die täglich zu Bruch gingen oder von den Gästen heimlich eingesteckt wurden.
»Sam?«
»Hier drin!«
Sams Stimme drang durch den kleinen Vorraum, der zum eigentlichen Keller führte. Charlie zog beim Eintreten automatisch den Kopf ein. Die Decke war so niedrig, dass er sich daran schon mehr als einmal heftig gestoßen hatte.
Sam kauerte zwischen zwei Regalen an der Wand und starrte auf die Scherben von zwei zerbrochenen Pint-Gläsern und auf ein grob mit Kreide auf den Boden gezeichnetes X.
»Was treibst du denn da, Sam?«
»Ich war das nicht«, antwortete Sam. »Vorhin lagen da keine Scherben und da war auch kein X zu sehen.«
»Alles in Ordnung mit dir?«
»Vor ein paar Minuten war beides noch nicht da, ehrlich.«
Das verhieß nichts Gutes. Die Gläser konnten schließlich nicht von allein aus dem Regal gefallen sein – sie lagen mitten im Raum. Und das X sah ziemlich zittrig aus, so als ob der Schreiber die Kreide kaum habe halten können. Im fahlgrünen Neonlicht der Kellerbeleuchtung wirkte zwar jeder krank, aber Sam sah im Moment besonders schlecht aus. Alle Farbe war aus seinem Gesicht gewichen, er zitterte am ganzen Körper und schwitzte gleichzeitig aus allen Poren.
Vielleicht hatte es ja unausweichlich so kommen müssen. Charlie hatte das Risiko immer gekannt, es war sozusagen Bestandteil ihres Arbeitsvertrages gewesen. Ihm selbst war es gelungen, von seiner Sucht loszukommen, und deswegen war er davon überzeugt, dass andere es ebenfalls schaffen konnten. Und genau dieses Vertrauen galt es nun auszustrahlen.
»Sam, wenn du wieder Drogen genommen hast …«, begann Charlie vorsichtig.
»Hab ich nicht!«
»Aber falls doch, kannst du es mir ruhig sagen.«
»Ich schwöre dir, ich hab nichts genommen«, beteuerte Sam.
»Kein Grund, sich zu schämen, Sam. Ich weiß, es ist nicht leicht, clean zu bleiben.«
»Ich hab nichts genommen, verdammt, und das da ist nicht mein Werk!«
Der wütende Nachdruck, mit dem Sam die Worte hervorstieß, machte Charlie ein wenig Angst. Dabei war er eigentlich kein Mann, der sich so schnell einschüchtern ließ. Er hatte in seinem Leben schon so manchen Kampf ausgefochten, viele Rückschläge eingesteckt und eine Scheidung durchgestanden. Und er widerstand täglich aufs Neue seinem ärgsten Feind, dem Alkohol. Doch irgendetwas in diesem Raum, irgendetwas am Anblick des zitternd vor der Wand kauernden Sam und des primitiven Kreide-X und der auf dem Kellerboden verstreuten Scherben – irgendetwas daran machte ihm Angst.
Es hatte wenig Sinn nachzuschauen, ob außer ihnen noch jemand im Keller war. Seit dem Auftauchen des Rippers war jeder Laden in der Gegend verbarrikadiert wie eine Festung. Auch das Royal Gunpowder.
Charlie beugte sich vor und tastete mit den Händen den kalten Steinboden ab.
»Lass uns hier erst mal sauber machen«, schlug er vor, während er versuchte, das Kreide-X mit bloßen Händen wegzuwischen. In Fällen wie diesen behielt man am besten die Nerven, benahm sich so normal wie möglich und besprach die Sache in aller Ruhe. »Und dann gehen wir nach oben und bereden alles bei einer Tasse Tee.«
Sam entfernte sich mit ein paar zögernden Schritten von der Wand.
»Gut so. Wir machen hier schnell Ordnung und dann genehmigen wir uns einen schönen starken Tee …«
Charlie fuhr fort, die Überreste des X zu entfernen. Den Hammer sah er nicht.
Der Hammer diente dazu, Kisten zu öffnen, klemmende Zapf-Ventile wieder zum Laufen zu bringen und wacklige Regale zu reparieren. Im Augenblick schwebte er allerdings über Charlies Kopf – so, als wolle er zielen.
»Nein!«, schrie Sam.
Charlie wandte den Kopf und sah den Hammer auf sich zukommen. Beim ersten Mal blieb Charlie noch stehen. Er gab einen gurgelnden Laut von sich. Auch nach dem zweiten und dritten Schlag stand er noch. Hilflos um sich schlagend, versuchte er, die Angriffe abzuwehren. Der vierte Schlag war tödlich. Ein grauenhaftes Knacken war zu hören. Charlie stürzte der Länge nach hin und bewegte sich nicht mehr.
Der Hammer fiel polternd zu Boden.
Der Riss im Boden
Das Tuch flog weit aus dem Gemach,
Ihr gelber Spiegel klirrend brach,
»Der Fluch, er ist gekommen«, sprach
Die Lady von Shalott.
Alfred Lord Tennyson»The Lady of Shalott«
1
In Wexford, dem Internat, auf dem ich gewesen bin, bevor mir diese Sache zugestoßen ist, gehörte Hockey für mich zum täglichen Pflichtprogramm. Da ich keine Ahnung von den Spielregeln hatte, stellte man mich in dick gepolsterter Schutzausrüstung als Keeper ins Tor. Dort konnte ich den anderen Spielerinnen dabei zuschauen, wie sie Schläger schwingend übers Spielfeld rannten und hin und wieder einen kleinen, sehr harten Ball in meine Richtung schmetterten – dem ich jedes Mal auszuweichen versuchte. Da es im Tor nicht darum geht, dem Ball auszuweichen, brüllte Claudia mir regelmäßig vom Spielfeldrand zu: »Nein, Aurora! Nicht wegducken!« Was ich aber ignorierte. Ich verlasse mich ganz gern auf meinen Instinkt. Und der befiehlt mir, mich wegzuducken, sobald etwas auf mich zugeflogen kommt.
Ich hätte nie gedacht, dass mir das Hockeytraining einmal von Nutzen sein könnte. Bis ich mit der Therapie anfing.
»Nun?«, sagte Julia.
Julia war meine Therapeutin. Eine kleine, zierliche Schottin mit kurzen, kunstvoll zerstrubbelten weißblonden Haaren. Obwohl sie vermutlich um die fünfzig war, hatte sie kaum Falten im Gesicht. Sie war ausgesprochen höflich und sprachgewandt und so unglaublich professionell, dass es mir Juckreiz verursachte. Nicht ein einziges Mal schlug sie die Beine übereinander oder veränderte ihre Sitzposition. Egal, ob es stürmte oder schneite, sie saß die Sache in ihrem ergonomischen Sessel mit der ruhigen Gelassenheit eines tibetanischen Mönchs aus.
Die Uhr in Julias Praxis stand außerhalb meines Blickfelds auf einem Bücherregal hinter dem Patientensessel. Allerdings konnte ich ihr Spiegelbild im Fenster sehen und beobachten, wie die Zeit rückwärts lief. Ich hatte es geschafft, geschlagene fünfundvierzig Minuten über meine Großmutter zu reden – mein neuer Rekord. Jetzt war mir die Lust am Reden vergangen und eine erdrückende Stille senkte sich über den Raum. Hinter Julias sich niemals runzelnder Stirn arbeitete es. Mir war klar, dass sie mich ebenso aufmerksam beobachtete wie ich sie, immerhin hatte ich schon ein paar Stunden unter ihren wachsamen Blicken verbracht.
Inzwischen hatte ich auch ihre Beziehung zu dieser Uhr durchschaut. Wenn Julia ihre Augen kaum wahrnehmbar nach links wandern ließ – selbstverständlich ohne dabei den Kopf zu bewegen –, hatte sie sowohl die Uhr als auch mich im Blick. Dann musste ich auf der Hut sein. Sobald Julia auf die Uhr sah, bedeutete das, dass sie jeden Moment etwas sagen würde.
Tick. Tack.
Achtung! Julia hatte sich bewegt. Der Puck flog sozusagen direkt auf mich zu. Zeit, sich wegzuducken.
»Wissen Sie, Rory …«
Volle Deckung!
»… die Begegnung mit dem Tod ist für jeden von uns eine sehr einschneidende Erfahrung. Wollen Sie vielleicht versuchen, mir von Ihrer zu erzählen? Wie war das für Sie?«
Ich musste mich zusammenreißen. Es würde keinen guten Eindruck machen, wenn ich als Antwort auf diese Frage aufgeregt vom Sessel aufsprang, weil das so ziemlich die krasseste Geschichte überhauptwar. Aber zum Glück habe ich noch eine andere, wirklich gute »Begegnung mit dem Tod«-Geschichte in petto.
Es gelang mir, durch grüblerisches Kopfnicken eine volle Minute Gesprächszeit zu schinden. Nachdenklichkeit vorzutäuschen ist schwierig, weil sie sich nicht durch Bewegung oder Gesten ausdrücken lässt. Außerdem vermutete ich, dass meine Denker-Miene Ähnlichkeit mit meinem »Ich muss mich gleich übergeben«-Gesicht hatte.
»Es war damals bei Mrs Haverty. Ich war etwa zehn. Mrs Haverty wohnte in Magnolia Hall, einer uralten Südstaatenvilla aus der Zeit vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. Mit Säulen und Holzfensterläden und mindestens hundert Magnolienbäumen ringsum. Haben Sie den Film Vom Winde verweht gesehen?«
»Ist schon eine ganze Weile her.«
»Magnolia Hall sieht aus wie das Herrenhaus in Vom Winde verweht. Ich glaube, es steht schon seit 1860. Jedenfalls ist es eine echte Touristenattraktion und wird oft in Hochglanzmagazinen abgebildet. Aber Mrs Haverty bekommt man so gut wie nie zu sehen. Sie ist unfassbar alt. Vielleicht wurde sie sogar 1860 geboren.«
»Eine ältere Frau in einer historischen Villa also«, sagte Julia.
»Genau. Damals war ich bei den Pfadfinderinnen. Obwohl, ich war eine absolut schlechte Pfadfinderin. Ich bekam nie irgendwelche Abzeichen und konnte mir nicht mal meine Truppennummer merken. Aber einmal im Jahr wurde auf Magnolia Hall ein gigantisches Picknick nur für Pfadfinderinnen veranstaltet. Es fand auf Mrs Havertys Anwesen statt, weil sie anscheinend auch mal bei der Truppe war, damals zu Zeiten des Urknalls …«
Julia musterte mich forschend. Vielleicht hätte ich mir die letzte Bemerkung verkneifen sollen. Ich hatte die Geschichte schon so oft erzählt, dass ich sie ständig weiter ausfeilte. Wenn ich sie bei unseren Familientreffen bei meiner Großmutter oder im Big Jim’s aus dem Hut zaubere, sind jedenfalls alle ganz begeistert.
Ich versuchte, mich ein bisschen zu bremsen. »Mrs Haverty ließ immer ein großes Barbecue vorbereiten und Eis und Getränke, so viel man wollte, und es gab eine gigantische Rutsche und eine Hüpfburg. Wir fieberten diesem Tag alle entgegen. Eigentlich war ich nur deshalb Pfadfinderin geworden, um bei diesem Picknick dabei sein zu können. Ich war etwa zehn in dem Sommer … ähm, sorry, ich glaube, das sagte ich schon …«
»Das macht nichts.«
»Okay. Es war wahnsinnig heiß. Louisiana-mäßig heiß. Über vierzig Grad im Schatten.«
»Es war also heiß«, resümierte Julia.
»Genau. Die Sache war die, dass Mrs Haverty niemals aus dem Haus ging und auch nie jemanden hineinließ. Für uns war sie eine Art Phantom oder Fabelwesen und wir fragten uns ständig, ob sie nicht hinter irgendeinem Vorhang stand und uns belauerte. Nach dem Picknick überbrachte ihr unsere Leiterin jedes Mal ein Banner mit selbst gemalten Bildern und den Unterschriften aller Pfadfinderinnen. Keine Ahnung, ob sie dazu von Mrs Haverty ins Haus gebeten wurde oder ob sie unser Geschenk einfach auf der Veranda ablegte und wieder verschwand. Jedenfalls wurden für die Dauer des Picknicks auch immer mobile Toilettenhäuschen aufgestellt. Aber in diesem besagten Sommer wurde bei der Toilettenhäuschen-Firma gestreikt, und wir befürchteten schon, dass das Picknick deswegen ausfallen musste. Schließlich erklärte sich Mrs Haverty tatsächlich dazu bereit, uns ihre Gästetoilette im Erdgeschoss benutzen zu lassen. Das war eine echte Sensation! Weil es so eine große Sache war, wurde uns auf der Busfahrt nach Magnolia Hall ganz genau eingeschärft, wie wir uns zu verhalten hatten. Es durfte immer nur ein Mädchen ins Haus, nie mehrere gleichzeitig. Kein Rennen. Kein Rufen. Wir sollten nur schnell und leise auf die Toilette gehen und sofort wieder nach draußen verschwinden. Wir waren alle schrecklich aufgeregt, weil wir ins Haus hineindurften, und ich zerbrach mir den Kopf, wie ich es anstellen sollte, als Erste pinkeln zu gehen. Ich hätte mein Leben dafür gegeben. Deshalb leerte ich auf der Busfahrt eine große Flasche Wasser und achtete darauf, dass unsere Leiterin, Mrs Fletcher, es auch mitbekam. Sie meinte irgendwann, ich solle mein Wasser nicht so verschwenden. Aber ich hatte ja meinen Plan.«
Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber wenn ich Geschichten von früher erzähle, fühle ich mich augenblicklich zurückversetzt und habe wieder genau vor Augen, wie unser Bus gemächlich unter dem Blätterdach der langen, baumbestandenen Zufahrt entlangzuckelte. Neben mir saß Jenny Savile. Sie roch nach Erdnussbutter und nervte mich, weil sie in einem fort Schnalzgeräusche mit der Zunge machte. Meine Freundin Erin hatte ihre Kopfhörer aufgesetzt und döste vor sich hin. Die anderen schauten fasziniert aus dem Fenster und beobachteten, wie die Hüpfburg auseinandergefaltet und aufgepumpt wurde. Nur ich war in Alarmbereitschaft und blickte angespannt nach vorn, um als Erste einen Blick auf die Säulen und die weitläufige Veranda zu erhaschen. Ich war in einer Mission unterwegs. Ich würde die Erste sein, die jemals in Magnolia Hall pinkeln war.
»Mrs Fletcher behielt mich genau im Auge«, fuhr ich fort. »Mir eilte ein gewisser Ruf voraus – nicht als Anführerin oder als die Schlechteste oder die Hübscheste. Ich galt als eigensinnig, als eine, die ständig auf dumme Ideen kam, Sonderwünsche hatte oder sich herumzankte und erst Ruhe gab, wenn sie ihren Willen durchgesetzt hatte. Als Mrs Fletcher mich literweise Wasser trinken und danach unruhig auf dem Sitz herumrutschen sah, wird ihr wohl klar gewesen sein, dass ich erst Ruhe geben würde, wenn ich in Magnolia Hall aufs Klo gegangen war.«
Julia konnte nicht verhindern, dass sich der Hauch eines Lächelns auf ihre Lippen stahl. Offenbar war ihr mein Eigensinn auch schon aufgefallen.
»Als der Bus anhielt, sagte Mrs Fletcher: ›Komm mit, Rory.‹ Sie klang ziemlich wütend. Ich weiß noch, dass ihr Tonfall mir Angst machte.«
»Er machte Ihnen Angst?«
»Ja, weil die Pfadfinderleiterinnen eigentlich nie böse auf uns wurden. Außer unseren Eltern und vielleicht noch unseren Lehrern schimpfte niemand mit uns.«
»Und hat Sie das von Ihrem Vorhaben abgehalten?«
»Nein«, erwiderte ich. »Ich musste doch total dringend.«
»Ich würde Sie gern etwas fragen«, sagte Julia. »Warum, glauben Sie, haben Sie sich so verhalten? Wieso war es Ihnen so wichtig, als Erste dort auf die Toilette zu gehen?«
Für mich lag meine Motivation so klar auf der Hand, dass ich zunächst gar nicht wusste, wie ich es ihr erklären sollte. Ich hatte aus dem gleichen Grund als Erste dort aufs Klo gehen wollen, wie andere auf Berggipfel klettern oder bis zum Meeresgrund tauchen. Weil es absolutes Neuland war, das zuvor noch nie jemand betreten hatte. Weil die Erste sein nun mal bedeutete … die Erste zu sein.
»Das Haus hatte noch nie irgendjemand von innen gesehen«, erklärte ich.
»Aber es war doch bloß die Toilette. Und Sie haben selbst gesagt, dass Ihnen Ihr eigenwilliges Verhalten durchaus bewusst war. Dass Ihnen ständig neue Ideen kamen.«
»Dumme Ideen«, korrigierte ich.
Julia nickte unmerklich und notierte etwas auf ihrem Block. Ich hatte ihr Einblick in meine Persönlichkeit gegeben. Das gefiel mir ganz und gar nicht. Ich konzentrierte mich wieder auf die Geschichte. Ich weiß noch genau, wie heiß es damals war. Hitze – also echte Hitze – hatte ich in England noch nie erlebt. Die Sommerhitze in Louisiana hat einen ganz eigenen Charakter, sie ist schwer, klebrig und erdrückend wie eine schwitzige Umarmung. Sie durchdringt einen bis ins Mark. In Magnolia Hall gab es keine Klimaanlage, deswegen war es im Inneren der Villa so heiß wie in einem Backofen, der seit hundert Jahren nicht abgestellt worden war. Vielleicht war die Hitze auch durch eine Explosion im Bürgerkrieg entstanden und das Haus war seitdem nie wieder gelüftet worden. Gut möglich, dass sich die Luft in der Villa schon seit 1860 staute.
Ich kann mich noch genau an meinen ersten Schritt über die Türschwelle erinnern und an die stickige, staubige Hitze, die mir entgegenschlug. An die Stille. Ich sehe die Eingangshalle mit den Familienporträts wieder vor mir, den Tisch mit der Marmorplatte, auf dem eine Vase mit vertrockneten Azaleen stand, und die alten Zeitungen, die sich in der Ecke daneben stapelten. Die Toilette befand sich in einem fensterlosen Raum unter der Treppe. Mrs Fletcher musste die anderen Pfadfinderinnen beim Verlassen des Busses beaufsichtigen und aufpassen, dass Melissa Murphy ihre Adrenalinspritze einsteckte – für den Fall, dass sie von einer Biene gestochen wurde. Deswegen hatte sie mich alleine gehen lassen, nicht ohne mich noch einmal ermahnt zu haben, bloß nichts anzufassen und sofort wieder herauszukommen, wenn ich fertig war.
»Ich war ganz allein im Haus«, sagte ich. »Der erste Mensch, der jemals diese Villa betreten hatte – zumindest der erste Mensch, den ich kannte –, deshalb konnte ich nicht widerstehen und habe mich ein bisschen umgesehen. Ich habe nicht spioniert, sondern nur ganz kurz einen Blick in die Zimmer geworfen, deren Türen offen standen. Und dann sah ich im Wohnzimmer einen Hund stehen, einen großen Golden Retriever. Ich bin ein absoluter Hundenarr. Also ging ich hin und habe ihn gestreichelt. Mrs Haverty habe ich nicht kommen hören. Als ich mich umdrehte, stand sie plötzlich vor mir. Vermutlich hatte ich damit gerechnet, dass sie einen Reifrock anhaben und von Spinnweben überzogen sein würde, aber sie trug sportliche Seniorenkleidung, eine knielange, rosa-karierte Hose und ein dazu passendes T-Shirt. Sie war unglaublich blass und ihre Waden waren von so vielen blauen Adern durchzogen, dass sie mich an eine Landkarte erinnerten. Ich war starr vor Schreck. Ich dachte, ich sei so gut wie tot, weil sie mich erwischt hatte. Aber sie lächelte mich nur freundlich an und sagte: ›Das ist Big Bobby. War er nicht wunderschön?‹ Ich fragte: ›Wieso war?‹ Worauf sie antwortete: ›Oh, er ist ausgestopft, Liebes. Bobby ist seit vier Jahren tot. Er hat immer in diesem Zimmer geschlafen, deshalb steht er jetzt hier‹.«
Es dauerte eine Weile, bis Julia kapiert hatte, dass die Geschichte zu Ende war.
»Sie haben einen toten Hund gestreichelt und es nicht gemerkt?«
»Er war wirklich toll ausgestopft«, erklärte ich. »Ich habe schon einige schlimme Tierpräparate gesehen. Aber der Hund war erstklassige Arbeit, darauf wäre jeder hereingefallen.«
Einer der in England so raren Sonnenstrahlen fiel durchs Fenster und beleuchtete Julias Gesicht. Sie sah mich lange und forschend an. Ihr Blick durchdrang mich nicht, sondern blieb in meinem Innern stecken, wanderte neugierig umher und kniff und zwickte mich überall.
»Wissen Sie, Rory«, sagte sie, »das ist jetzt unsere sechste Stunde und wir haben noch nie über den eigentlichen Grund gesprochen, warum Sie zu mir in die Therapie kommen.«
Immer, wenn sie so etwas sagte, bekam ich stechende Schmerzen im Bauch. Dabei war meine Wunde beinah verheilt. Der Verband war weg und darunter war eine lange rot glühende Narbe zum Vorschein gekommen. Fieberhaft suchte ich nach etwas, das dem Gespräch eine andere Wendung geben könnte, aber Julia hob vorausahnend die Hand. Sie durchschaute mich. Ich schwieg und entdeckte dabei im Fenster mein wahres Denker-Gesicht. Es wirkte ziemlich gequält. Ich nagte unentwegt an meiner Unterlippe und zwischen meinen Brauen hatte sich eine steile Falte gebildet.
»Kann ich Sie etwas fragen?«, durchbrach ich schließlich das Schweigen.
»Selbstverständlich.«
»Darf es mir gut gehen?«
»Aber natürlich. Das ist doch unser Ziel. Aber es ist auch erlaubt, sich einmal nicht gut zu fühlen. Sie hatten immerhin ein sehr traumatisches Erlebnis.«
»Kann man ein Trauma nicht überwinden?«
»Doch, wenn man Hilfe bekommt, schon.«
»Und ohne Hilfe kommt man nie darüber hinweg?«
»Doch, natürlich, aber …«
»Ich meine ja bloß«, beharrte ich, »ist es nicht möglich, dass es mir tatsächlich gut geht?«
»Geht es Ihnen denn gut, Rory?«
»Ich möchte wieder ins Internat zurück.«
»Sie möchten dorthin zurückkehren?« Ihr Tonfall schraubte sich in inquisitorische Höhen und ihr schottischer Akzent brach durch.
Wexford. Es war, als hätte plötzlich jemand mit einem Ruck ein Kulissenbild heruntersausen lassen und mich dorthin zurückversetzt. Ich sah Hawthorne vor mir, das Mädchenwohnheim, ein großes Backsteinhaus mit unglaublich hohen Fenstern – ein Relikt aus viktorianischer Zeit. Über dem Eingangsportal war das Wort »Frauen« in den Stein gemeißelt. Ich sah Jazza und mich in unserem Zimmer, in unseren Betten liegend und in der Dunkelheit vor dem Einschlafen miteinander plaudernd, während ich an die hohe Zimmerdecke starrte und die Schatten beobachtete, die im Licht der Straßenlaternen durchs Fenster fielen, und auf die Geräusche lauschte, die von Londons Straßen in unser Zimmer drangen. Ich hörte das leise Klappern und Pfeifen der Heizkörper, wenn sie ihre letzte Wärme abgaben.
Kurz blitzte die Erinnerung an den Nachmittag auf, an dem Jerome und ich in einem der winzigen Arbeitszimmer in der Bibliothek heftig geknutscht hatten. Und dann hatte ich plötzlich ein ganz anderes Bild vor Augen: Ich sah mich in Goodwin’s Court in dem Apartment mit Stephen, Callum und Boo …
»Für heute ist unsere Zeit um.« Julias Augen huschten zur Uhr. »Wir können am Freitag ausführlicher darüber sprechen.«
Ich riss meinen Mantel von der Sessellehne und schlüpfte hastig hinein, während Julia die Tür öffnete und in den Flur hinausspähte. Überrascht drehte sie sich zu mir um.
»Sie sind heute ohne Begleitung gekommen? Wie schön. Das freut mich für Sie.«
Meine Eltern hatten mir heute erlaubt, alleine zur Therapiestunde zu gehen. So sah in meinem jetzigen Leben die Definition von aufregend aus.
»Wir machen Fortschritte, Rory«, meinte Julia. »Ich finde, wir sind auf einem guten Weg.«
Sie log. Vermutlich lügt jeder hin und wieder mal. Ich bildete da keine Ausnahme.
»Ja«, log ich zurück und zog mir die Handschuhe an. »Das finde ich auch.«
2
Noch sehr viel mehr von diesen Sitzungen würde ich nicht ertragen können.
Normalerweise ist es kein Problem für mich, mein Gegenüber vollzuquatschen. Reden ist sozusagen mein Ding. Hätte ich es in Wexford als Sportart wählen können, hätte ich es mit Sicherheit innerhalb kürzester Zeit zur Teamkapitänin gebracht. Aber Sport ist nun einmal in der Regel mit Rennen, Hüpfen oder Armwedeln verbunden.
Dreimal die Woche wurde ich zum Reden zu Julia geschickt. Und jedes Mal musste ich vermeiden, etwas zu sagen. Zumindest konnte ich mit ihr nicht darüber sprechen, was wirklich passiert war.
Sollte ich meiner Therapeutin vielleicht erzählen, dass mir ein Geist das Messer in den Bauch gestoßen hat?
Oder dass ich Geister sehen kann, seitdem ich beim Abendessen fast an einem Stück Fleisch erstickt wäre?
Wer so etwas erzählt, wird auf der Stelle in eine Gummizelle gesteckt und sein ganzes Leben lang nie wieder auch nur in die Nähe einer Schere gelassen. Und es würde die Sache bloß schlimmer machen, wenn ich ihr verraten würde, dass ich Freunde bei der Londoner Geisterpolizei habe, einer kleinen, streng geheimen Sondereinheit – den »Shades« –, ich aber nicht darüber sprechen darf, weil mich ein Mann vom Geheimdienst gezwungen hat, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben. Meine Therapeutin würde die Diagnose »paranoide Wahnvorstellungen« ganz oben auf die ellenlange Liste meiner Störungen setzen und mich offiziell für verrückt erklären. Damit wäre die Sache endgültig für mich gelaufen.
Der Himmel hing wie ein grauer Zementblock über mir und ich hatte keinen Schirm dabei, um mich vor der dunklen Regenwolke, die sich eindeutig in meine Richtung bewegte, zu schützen. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit meiner neu gewonnenen Freiheit anfangen sollte. Mir fiel ein Coffeeshop ins Auge und ich beschloss, mir dort einen Kaffee zu holen und dann nach Hause zu gehen. Das war eine gute, völlig normale Sache. Das würde ich machen und dann vielleicht … vielleicht noch etwas anderes.
Es ist merkwürdig, wenn man nach langer Zeit das erste Mal wieder unter Leuten ist. Man fühlt sich wie ein Tourist. Ich beobachtete die Menschen um mich herum, die an ihren Laptops saßen und lasen und sich Notizen machten. Ganz kurz spielte ich mit dem Gedanken, dem Typen, der meinen Latte macciato zubereitete, zuzurufen: »Ich bin das Mädchen, das vom Ripper niedergestochen wurde.« Ich könnte zum Beweis mein T-Shirt hochziehen und ihm meine Narbe zeigen, die sich als lange, flammend rote Linie über meinen Oberkörper zog. So etwas konnte man schließlich nicht vortäuschen. Okay, ein Maskenbildner vielleicht schon. Außerdem hatten Leute, die in Coffeeshops ihr T-Shirt lüpften, gewöhnlich andere Probleme und waren wahrscheinlich keine besonders gern gesehenen Gäste. Ich nahm meinen Kaffee und ging eilig wieder nach draußen, ehe mir noch mehr komische Ideen kamen.
Gott, wie ich mich danach sehnte, mit jemandem zu reden.
Ich kann ja nur für mich sprechen, aber sobald mir etwas widerfährt – egal ob gut oder schlecht –, dann will ich es jemandem erzählen, weil ich erst dann wirklich das Gefühl habe, dass es wahr ist. Wenn man nicht darüber redet, ist es beinahe so, als wäre es gar nicht passiert. Es tat mir buchstäblich weh, Stunde um Stunde dazusitzen und nicht darüber sprechen zu dürfen. Meine Narbe pochte, unbewusst hatte ich wahrscheinlich die ganze Zeit die Bauchmuskeln angespannt. Wenn ich nachts nicht schlafen konnte, war ich manchmal versucht, bei einem dieser anonymen Sorgentelefone anzurufen und meine Geschichte irgendeinem Unbekannten zu erzählen. Ich tat es nur deshalb nicht, weil ich genau wusste, was dann passieren würde. Man würde mir zuhören und mir anschließend ans Herz legen, psychiatrische Hilfe anzunehmen. Meine Geschichte war einfach zu verrückt.
Die »offizielle« Version lautete:
Ein Mann versetzt London in Angst und Schrecken, indem er die Morde von Jack the Ripper nachahmt. Er bringt auf bestialische Weise vier Menschen um, eines seiner Opfer ermordet er ausgerechnet auf dem kleinen Platz vor dem Mädchenwohnheim meines Internats. Als ich mich in dieser Nacht heimlich ins Wohnheim zurückschleiche, laufe ich dem Kerl über den Weg. Daraufhin will er mich als Augenzeugin aus dem Weg räumen und nimmt mich als sein fünftes und letztes Mordopfer ins Visier. In der Nacht des letzten Ripper-Mordes dringt er in mein Wohnheim ein und sticht mir ein Messer in den Bauch. Ich überlebe nur deshalb, weil die Polizei einen Hinweis erhält und rechtzeitig die Schule stürmt. Verdächtiger ergreift die Flucht … Polizei nimmt Verfolgung auf … Verdächtiger springt in die Themse und ertrinkt.
Die wahre Geschichte:
Der Ripper war der Geist eines ehemaligen Mitarbeiters der Shades. Er nahm mich ins Visier, weil er wusste, dass ich Geister sehen konnte. Aber eigentlich ging es ihm nur darum, einen Terminus zu erbeuten, ein Gerät, mit dem die Shades Geister bekämpften. Im Grunde waren die Termini (es gab ursprünglich drei davon) Diamanten. Sobald Strom durch diese Diamanten hindurchfloss, löste das einen Impuls aus, der für Geister tödlich war. Stephen hatte jeden der drei Diamanten mit Draht umwickelt und in ein leeres Handygehäuse gesteckt, wo sie über den Akku mit Strom versorgt wurden. Ich hatte besagte Nacht nur deshalb überlebt, weil Jo – die ebenfalls ein Geist war – mir den Terminus aus der Hand gerissen und den Ripper damit ausgelöscht hatte – und damit gleichzeitig auch sich selbst.
Die Einzigen, die die wahre Geschichte kannten, waren Stephen, Callum und Boo, zu denen ich aber keinen Kontakt mehr aufnehmen durfte. Dazu hatte ich mich verpflichten müssen, bevor ich London verließ. Ein Mitarbeiter der Regierung hatte mich tatsächlich eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben lassen. Und man hatte dafür gesorgt, dass ich meine Freunde nicht mehr erreichen konnte. Noch während ich bewusstlos im Krankenhaus lag, waren alle Daten aus meinem Handy gelöscht worden.
Ich solle den Mund halten und einfach so weitermachen wie bisher, wurde mir gesagt.
Jetzt wohnte ich hier in Bristol bei meinen Eltern und hockte die ganze Zeit in dem Haus, das sie für die Dauer ihres Aufenthalts angemietet hatten. Es war ein hübsches kleines Haus auf einem Hügel mit Blick über die Stadt und mit einer Einrichtung wie aus dem Katalog, absolut nichtssagend und unpersönlich. Weiß getünchte Wände und neutrale Farben, ideal, um sich zu erholen. Keine Geister. Keine Explosionen. Ich guckte Fernsehen und schaute dem Regen zu oder surfte im Internet und schlief sehr viel. Mein Leben hier war ohne jedes Ziel, was mir nur recht war. Aufregung hatte ich mehr als genug gehabt. Von jetzt an umfing mich gepflegte Langeweile, ich musste nur noch das mit dem Vergessen hinkriegen. Die Sache einfach auf sich beruhen lassen.
Ich spazierte am Flussufer entlang. Der Nebel umhüllte mich wie ein zartes Gespinst und drang durch meine Haare und Kleidung. Es war feucht und kühl und irgendwie angenehm beruhigend. Heute musste ich gar nichts tun, außer Gehen. Ich konnte immer weiter am Fluss entlanggehen, bis ich in eine andere Stadt kam. Oder ans Meer. Dann könnte ich vielleicht nach Hause schwimmen.
Ich war so tief in Gedanken versunken, dass ich beinah an ihm vorbeigegangen wäre, aber irgendetwas am Schnitt seines Anzugs ließ mich stutzen. Ich kenne mich mit Anzügen nicht besonders gut aus, aber dieser war irgendwie merkwürdig. Er war graubraun und hatte einen schmalen Jackenaufschlag und einen merkwürdigen Kragen. Der Mann trug eine Hornbrille und sehr kurz geschnittenes Haar, aber seine Koteletten waren beinah viereckig. Es waren alles nur winzig kleine Abweichungen, aber genau die sagten mir, dass etwas nicht stimmte.
Er war ein Geist.
Meine »Gabe«, Geister zu sehen, verdankte ich zwei Grundvoraussetzungen: Ich brachte die angeborene Veranlagung dazu mit und ich hatte in der Pubertät ein Nahtoderlebnis gehabt. Das hatte nichts mit Magie oder übersinnlichen Kräften zu tun. Es war, wie Stephen es ausdrückte, »die Fähigkeit, Verstorbene, die nach ihrem Tod auf einer Ebene weiterleben, die von anderen Menschen gewöhnlich nicht wahrgenommen wird, sehen zu können und mit ihnen zu kommunizieren. Bei einem Geist handelt es sich somit um die Manifestation der Erinnerung des Verstorbenen, vielleicht sogar um seine eigene Selbstwahrnehmung.« Stephen redete wirklich so.
Das hieß schlicht und ergreifend, dass manche Menschen mit ihrem Tod nicht völlig aus der Welt verschwinden. Etwas geht schief beim Sterbeprozess, so ähnlich wie wenn man vergeblich versucht, einen Computer herunterzufahren und stattdessen in eine Endlosschleife gerät. Diese Pechvögel stecken auf einer Daseinsebene fest, die sich mit unserer überschneidet. Die meisten von ihnen sind schwach und kaum fähig, mit uns in Kontakt zu treten. Manche sind etwas stärker. Und wenn man Glück hat, so wie ich, kann man sie sehen, mit ihnen reden und sie berühren.
Deshalb ärgerten mich die Fernsehserien zum Thema Geisterjagd so sehr (ich habe wirklich sehrviel Fernsehen geschaut in Bristol). Sie waren absolut realitätsfremd und komplett frei erfunden. Leute mit Nachtsichtkameras und merkwürdigen Messgeräten an den Helmen schlichen sich in Häuser, stellten Kameras auf und schalteten das Licht aus. (Als ob es Geistern nicht total egal wäre, ob es hell oder stockfinster ist.) Dann tasteten sie sich durch die Dunkelheit und raunten: »ZEIGT EUCH, IHR GEISTER.« Das ist ungefähr so, als ob mitten in einer Stadt ein Reisebus anhält, aus dem Touristen mit komischen Hüten herausströmen, die ihre Kameras zücken und rufen: »Tanzt für uns, ihr Eingeborenen! Wir möchten euch filmen!« Natürlich passiert rein gar nichts. Im Hintergrund war meist irgendwann ein unheimliches Geräusch zu hören, ein knarzender Fußboden oder eine klappernde Tür. Das Geräusch wurde millionenfach verstärkt und dann wurde behauptet, man habe den Beweis für die Existenz von Geistern geliefert. Totaler Quatsch.
Ich strich einige Minuten lang um den Mann herum und beäugte ihn verstohlen aus verschiedenen Blickwinkeln, nur um sicher zu sein. Ich fragte mich, wie groß wohl die Wahrscheinlichkeit war, dass ich gleich beim ersten Mal, wenn ich alleine durch Bristol spazierte, auf einen Geist treffen würde. Wie es aussah, sehr groß. Tatsächlich lag sie bei einhundert Prozent. Im Grunde war es einleuchtend, dass ich ausgerechnet hier auf einen Geist stieß. Ich befand mich an einem Flussufer und wie Stephen mir erklärt hatte, sind Wasserwege aufs Engste mit dem Tod verknüpft. In Flüssen sinken Schiffe – oder Menschen springen hinein und ertrinken. Flüsse und Geister passen also gut zusammen.
ENDE DER LESEPROBE