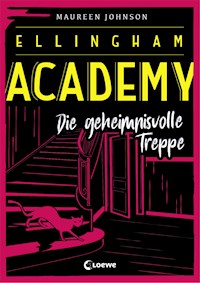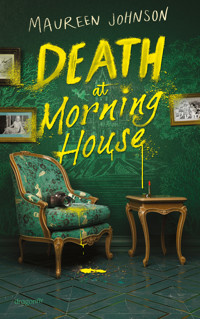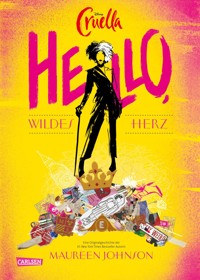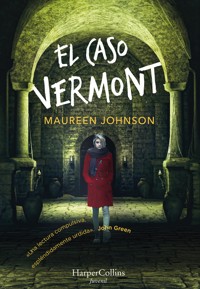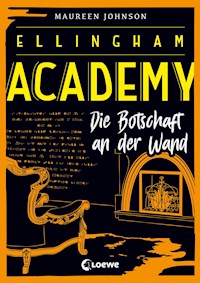
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ellingham Academy
- Sprache: Deutsch
Der große Showdown an der Ellingham Academy! Drei Todesfälle in der Gegenwart, drei Morde in der Vergangenheit und bei allen besteht eine Verbindung zu Milliardär Albert Ellingham und seiner exklusiven Schule. Als sich die Beweise verdichten, ist es für Stevie Bell an der Zeit, endlich das zu tun, wofür sie an die Ellingham Academy gekommen ist: den größten Kriminalfall des Jahrhunderts aufklären – und einen Mörder überführen. Stevie hat den Entführer von Alice gefunden. Doch noch sind nicht alle Fragen beantwortet. Lebt Alice Ellingham noch? Und wie hängt ihr Verschwinden mit den Todesfällen in der Gegenwart zusammen? Als sich ein weiterer Unfall ereignet, soll das Internat evakuiert werden. Aber Stevie ist sich sicher: Dieses Rätsel kann sie nur am Schauplatz des Verbrechens lösen. Gemeinsam mit ihren Freunden versteckt sie sich in der Schule. Was jedoch niemand ahnt: Dort sind sie nicht nur einem heftigen Schneesturm ausgeliefert, sondern auch einem Mörder, der keine Skrupel kennt … Die Botschaft an der Wand ist das große Finaleder Ellingham Academy-Trilogie. Im grandiosen Abschluss der Mystery-Reihe führt Maureen Johnson gekonnt alle Fäden aus der Vergangenheit und Gegenwart zusammen und liefert ein Finale, das allen Krimi-Fans ab 13 Jahren den Atem rauben wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
15. Dezember 1932
1 – Nackt und kreideweiß …
Februar 1936
2 – »Ich muss mir …
3 – Burlington war eine …
4. April 1936
4 – Das Hauptquartier des …
5 – Es gab Dunkelheit …
4. April 1936
6 – Mach dir einen …
7 – Am nächsten Morgen …
20. April 1936
8 – Als Stevie zurück …
9 – »Puh«, brach Hunter …
September 1936
10 – Es war nicht …
11 – »Okay, Leute.« David …
18. Februar 1937 New York City
12 – »Wacht auf, wacht …
13 – Es funktionierte nicht …
24. Februar 1937
14 – Stevie versuchte nachzuvollziehen …
15 – Das ganze Haus …
25. Februar 1937
16 – Stevie kam sich …
17 – »Weißt du, was …
13. April 1937
18 – Nicht, dass man …
19 – Während eines Schneesturms …
13. April 1937
20 – In ein Loch …
21 – »Ähhhhhhm«, machte David …
22 – »Hey«, sagte Germaine …
10. November 1938
23 – Das Treffen musste …
24 – Wie reagiert man …
25 – »Puh.« Stevie atmete …
26 – Der Ballsaal der …
27 – »Wie kann man …
28 – Der Frühling kam …
Danksagung
Für Dan Sinker, von dem ich so viel übers Machen,Bewältigen, über Punk, Disneyland und Tacos gelernt habe.Wir sehen uns im Haunted Mansion, Kumpel.
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATIONFOTOGRAFISCHE DOKUMENTATION EINES BRIEFSEINGEGANGEN AUF DEM ELLINGHAM-ANWESENAM 8. APRIL 1936
SEHT MAL, EIN RÄTSEL! DAS ERFORDERT GESCHICK!
NEHMEN WIR DIE PISTOLEODER LIEBER DEN STRICK?
MESSER SIND SCHARF UND GLÄNZEN FEIN
GIFT WIRKT LANGSAM,DAS DARF NICHT SEIN
EIN STURZ KOMMT PLÖTZLICH,ERTRINKEN IST NASSMIT SEILEN MACHT NICHT NURTAUZIEHEN SPASS
EIN LOCH IM KOPF,EIN LODERNDER BRANDEIN AUTO RAST UNGEBREMSTGEGEN DIE WAND
EINE BOMBE MACHT LÄRMGANZ OHNE GEZIER
BÖSE BUBEN BESTRAFENIST UNS EIN PLÄSIER!
WIE SOLLEN WIR’S TUN?SO VIELE ARTEN
DERWEIL BLEIBT DIR WOHL NURZU WARTEN.HAHA.
MIT FREUNDLICHEN GRÜSSEN,EIN WAHRHAFTIGER LÜGNER
15. Dezember 1932
Es schneite jetzt seit Stunden. Die Flocken wehten an den Fenstern vorbei, landeten auf den Simsen und formten dort winzige Landschaften, die die Berge am Horizont nachzubilden schienen. Albert Ellingham saß in einem dick gepolsterten, mit pflaumenblauem Samt bezogenen Sessel. Vor ihm auf dem Tisch stand eine Uhr aus grünem Marmor. Abgesehen von ihrem munteren Ticken und dem Knistern des Feuers im Kamin war alles still. Der Schnee wirkte wie ein Schalldämpfer.
»So langsam müssten wir aber doch wirklich etwas gehört haben«, sagte er.
Der Satz richtete sich an Leonard Holmes Nair, der sich ihm gegenüber mit einer Felldecke gemütlich auf dem Sofa ausgestreckt hatte und einen französischen Roman las. Leo war Maler, Lebemann und ein Freund der Familie. Es war jetzt zwei Wochen her, dass ihre kleine Reisegruppe sich in dieser Privatklinik in den Alpen einquartiert hatte. Seitdem hatten sie in aller Ruhe dem Schneetreiben zugesehen, Glühwein getrunken, gelesen und gewartet… auf ein Ereignis, das sich schließlich mitten in der Nacht angekündigt hatte. Sofort waren Schwestern und Ärzte zur Stelle gewesen und hatten die werdende Mutter in ein luxuriöses Kreißzimmer gebracht. Als einer der reichsten Männer in Amerika war man in der glücklichen Lage, eine komplette Schweizer Klinik für die Geburt seines Kindes reservieren zu können.
»Diese mysteriösen Vorgänge der Natur brauchen nun mal ihre Zeit«, antwortete Leo, ohne aufzuschauen.
»Aber sie sind jetzt seit fast neun Stunden da oben.«
»Albert, hör auf, ständig auf die Uhr zu sehen. Du brauchst einen Drink.«
Albert stand auf und schob die Hände in die Taschen. Rastlos schlenderte er erst zu einem der Fenster, dann zum nächsten und wieder zurück. Der Ausblick war wirklich traumhaft – nichts als Schnee und Berge und die spitzen Dächer der kleinen Bauernhäuser im Tal.
»Einen Drink«, wiederholte Leo. »Klingel danach. Mit diesem – Klingelding. Klingeldingel. Wo war das denn noch gleich?«
Albert ging zum Kamin und zog an einer seidenen Kordel mit einer Goldkugel am Ende. Irgendwo in der Ferne hörte man leise ein Glöckchen läuten. Kurz darauf öffnete sich die Flügeltür und eine junge Frau kam herein. Sie trug ein blaues Wollkleid mit einer gestärkten Schwesternschürze darüber und eine weiße Haube auf dem Kopf.
»Ja bitte, Herr Ellingham?«, fragte sie.
»Gibt es schon etwas Neues?«, erkundigte er sich.
»Leider nicht, Herr Ellingham.«
»Wir brauchen Glühwein«, schaltete Leo sich ein und erklärte sodann in fließendem Deutsch: »Er braucht etwas zu essen. Wurst und Brot. Käse.«
»Selbstverständlich, Herr Nair. Ich bringe Ihnen sofort etwas, einen Moment bitte.«
Die Schwester verließ rückwärts das Zimmer und zog die Tür hinter sich zu.
»Vielleicht ist etwas schiefgegangen«, gab Albert zu bedenken.
»Albert…«
»Ich gehe jetzt nach oben.«
»Albert«, appellierte Leo erneut an ihn. »Ich habe strikte Anweisung, dich aufzuhalten, wenn du so was auch nur versuchst. Nun lassen meine Ringkampfkünste sicherlich zu wünschen übrig, aber ich bin immer noch größer als du und kann mich unglaublich schwer machen. Wie wär’s, wenn wir das Radio einschalten? Oder hast du Lust auf ein Brettspiel?«
Letzterem war Albert Ellingham normalerweise nie abgeneigt, diesmal jedoch konnte er sich nicht einmal dazu durchringen und tigerte weiter auf und ab, bis die Schwester mit einem Tablett zurückkehrte. Darauf standen zwei Gläser rubinroten Glühweins und ein paar Teller mit Wurst, Brot und Käse.
»Setz dich und iss«, kommandierte Leo.
Doch Albert gehorchte nicht, sondern deutete auf die Uhr aus grünem Mamor.
»Diese Uhr«, erklärte er, »habe ich neulich in Zürich gekauft. Sie ist antik. Stammt aus dem achtzehnten Jahrhundert. Der Händler sagte, sie sei ein Geschenk von Marie Antoinette an eine adlige Freundin gewesen.«
Er stützte beide Hände auf den Tisch und starrte so eindringlich auf die Uhr hinunter, als erwartete er, dass sie anfing zu sprechen und ihm höchstpersönlich Aufschluss über ihre edle Herkunft gab.
»Das mag reiner Unfug sein«, redete er weiter und hob die Uhr hoch. »Aber für einen derart stolzen Preis kann man wohl auch erstklassigen Unfug verlangen. Außerdem hat sie ein reizendes kleines Geheimnis – eine versteckte Schublade. Hier, auf der Unterseite. Man muss die Uhr bloß auf den Kopf stellen, dann sieht man eine kleine Vertiefung, und wenn man draufdrückt…«
Oben regte sich etwas. Hastige Schritte. Stimmen. Ein schmerzerfülltes Wimmern. Albert setzte die Uhr abrupt wieder ab.
»Klingt, als hätte die Wirkung des Morphiums nachgelassen«, sagte Leo mit einem Blick zur Decke. »Ojeoje.«
Das Wimmern schwoll an – zu den gequälten Schreien einer Frau, die in den Wehen lag.
Albert und Leo verließen das gemütliche Studierzimmer und positionierten sich am Fuß der Treppe in der wesentlich kälteren Eingangshalle.
»Wie grauenhaft«, befand Leo mit einem besorgten Blick die dunklen Stufen hoch. »Man sollte doch meinen, es müsste einen besseren Weg geben, neues Leben in die Welt zu bringen.«
Irgendwann brachen die Geräusche ab und ein paar Sekunden lang herrschte Stille. Dann erhob sich Babygeschrei. Albert rannte die Treppe hoch, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, und wäre in seiner Hast beinahe auf dem Zwischenabsatz ausgerutscht. Im oberen Flur erwartete ihn bereits eine junge Krankenschwester an der Tür des Kreißzimmers.
»Einen Moment noch, Herr Ellingham.« Sie lächelte. »Erst muss die Nabelschnur durchtrennt werden.«
»Sagen Sie schon«, drängte er atemlos.
»Es ist ein Mädchen, Herr Ellingham.«
»Ein Mädchen«, wiederholte Albert und fuhr zu seinem Freund herum.
»Ja«, sagte Leo, »ich hab’s gehört.«
»Ein Mädchen. Dachte ich’s mir doch, dass es ein Mädchen wird. Ich hab’s von Anfang an gewusst. Ein kleines Mädchen! Ich werde ihr das schönste Puppenhaus der Welt kaufen, Leo. So groß, dass selbst du darin wohnen könntest!«
Endlich öffnete sich die Tür und Albert zwängte sich an der Schwester vorbei. Im Zimmer war es dunkel – die Vorhänge waren zugezogen, um die Kälte draußen zu halten. Und es roch nach Leben – Blut und Schweiß –, vermischt mit beißendem Desinfektionsmittel. Der Arzt hängte gerade eine Atemmaske zurück an einen Wandhaken und drehte das Gas zu. Eine Schwester leerte eine weiße Emailleschüssel mit rosarotem Wasser ins Waschbecken. Ihre Kollegin zog das durchnässte Bettzeug ab, während eine Dritte bereits mit trockenem Ersatz bereitstand. Mit einem Ruck schüttelte sie die Decke auf und ließ sie auf die im Bett liegende Frau niedersinken. Geschäftig eilten die Schwestern hin und her, öffneten Vorhänge und tauschten Operationstabletts gegen Blumenvasen aus. Es war ein anmutiges, wohl einstudiertes Ballett und schon nach wenigen Minuten verströmte der Raum den Charme eines gemütlichen Hotelzimmers. Nicht umsonst war dies eine der besten Privatkliniken der Welt.
Alberts Blick richtete sich auf seine Frau Iris. Sie hielt ein Baby im Arm, das in eine gelbe Decke gehüllt war. Er war so übervoll an Gefühlen, dass der Raum um ihn sich zu verzerren schien; die Deckenbalken bogen sich zu ihm herunter, bereit, ihn aufzufangen, falls er auf dem Weg zu ihr und dem Kind stürzte.
»Sie ist wunderschön«, sagte Albert. »Außergewöhnlich. Sie ist…« Seine Stimme versagte.
Das Baby war rosig, hatte die Fäuste geballt, die Augen geschlossen und gluckste leise vor sich hin. Es war das pure Leben.
»Sie ist unsere Tochter«, flüsterte Iris.
»Darf ich sie mal halten?«, ertönte eine Stimme hinter ihnen und Albert und Iris wandten sich der Frau im Bett zu. Ihr Gesicht war gerötet und schweißbedeckt.
»Aber ja!« Iris ging zu ihr. »Natürlich, Liebes, natürlich.«
Iris legte das Baby sanft in Flora Robinsons Arme. Flora war geschwächt und stand noch immer unter dem Einfluss des Morphiums. Ihr blondes Haar klebte ihr in der Stirn. Die Schwestern zogen die Bettdecke höher und steckten sie um das Baby fest, während Flora ungläubig auf das winzige Menschlein hinabblinzelte, das sie geboren hatte.
»Mein Gott«, staunte sie. »Hab das wirklich ich zustande gebracht?«
»Ja, und du hast dich ganz hervorragend geschlagen«, erwiderte Iris und strich ihrer Freundin das feuchte Haar zurück. »Liebes, du warst großartig. Absolut großartig.«
»Kann sie noch einen Moment bei mir bleiben?«, bat Flora. »Bitte?«
»Das ist eine gute Idee«, schaltete sich eine der Schwestern ein. »Dass Sie die Kleine im Arm halten. Sie wird bald trinken wollen. Wenn Sie vielleicht noch einmal hinausgehen könnten, Herr und Frau Ellingham? Nur ganz kurz.«
Iris und Albert zogen sich zurück. Leo war wieder unten, also hatten sie den Flur für sich.
»Über den Vater hat sie immer noch nichts gesagt, oder?«, raunte Albert. »Ich dachte, vielleicht würde sie es ja während…«
»Nein«, flüsterte Iris.
»Macht nichts. Macht überhaupt nichts. Wir werden schon mit ihm fertig, sollte er sich jemals melden.«
Die Schwester trat zu ihnen nach draußen, in der Hand ein Klemmbrett mit einem offiziell aussehenden Formular.
»Entschuldigen Sie«, sagte sie. »Haben Sie schon einen Namen für das Kind?«
Albert sah Iris an, die ihm zunickte.
»Alice«, antwortete Albert. »Sie heißt Alice Madeline Ellingham. Und sie wird das glücklichste kleine Mädchen auf der ganzen Welt sein.«
AUSZUG AUS DERWAHRHAFTIGE LÜGNER: MORD AN DER ELLINGHAM ACADEMY VON DR. IRENE FENTON
Kein einziges Mal seit der Entführung seiner Frau und seiner Tochter und dem Mord an Dolores Epstein unterbrach Albert Ellingham seine Suche. Weder der Prozess gegen Anton Vorachek noch dessen Ermordung vor dem Gerichtsgebäude konnten ihn davon abhalten, obwohl es damals den Anschein machte, als wäre mit Vorachek der einzige Mensch gestorben, der Alice’ Aufenthaltsort kannte. Irgendjemand musste irgendetwas wissen. Albert Ellingham scheute keine Kosten und Mühen. Er trat in Radiosendungen auf. Sprach mit Politikern. Er ließ nichts unversucht, wenn es schien, als könnte jemand auch nur den geringsten Hinweis darauf haben, wo seine Tochter war.
Am 1. November 1938 suchten Polizei und FBI Lake Champlain nach Albert Ellingham und George Marsh ab. Die beiden hatten einen nachmittäglichen Segeltörn mit Alberts Jacht, der Wonderland, unternommen. Kurz vor Sonnenuntergang hatte eine gewaltige Explosion die abendliche Stille zerrissen. Die ansässigen Fischer sprangen sofort in ihre Boote. Als sie die Unglücksstelle erreichten, fanden sie nur noch Trümmer der Jacht – verkohltes Holz, angesengte Polster, kleine Messingteile, Seilstücke. Doch sie stießen auch auf etwas weit Verstörenderes: menschliche Überreste, die offenbar in die Luft geschleudert worden waren und sich im selben traurigen Zustand befanden wie das Boot. Weder Albert Ellinghams noch George Marshs Leiche sollte je vollständig geborgen werden. Allerdings fand man genügend Einzelteile, um die Gewissheit zu haben, dass beide Männer tot waren.
Ermittlungen wurden eingeleitet. Jeder hatte seine eigene Theorie über den Tod eines der reichsten und einflussreichsten Männer Amerikas, doch am Ende wurde niemand verurteilt. Die plausibelste Erklärung schien es zu sein, dass eine Bande von Anarchisten Albert Ellingham auf dem Gewissen hatte; und tatsächlich bekannten sich gleich drei verschiedene Splittergruppen der Tat schuldig. Alice’ Fall geriet nach Albert Ellinghams Tod weitgehend in Vergessenheit. Es gab keine väterliche Stimme mehr, die ihren Namen am Leben hielt, keinen Industriemagnaten, der mit saftigen Belohnungen winkte und sich die Finger wund telefonierte. Im Jahr darauf brach in Europa der Krieg aus und die herzzerreißende Geschichte der Familie auf dem Berg verblasste im Angesicht einer ungleich schlimmeren Tragödie.
Dutzende von Frauen, die sich als Alice Ellingham ausgaben, traten im Laufe der Jahre an die Öffentlichkeit. Manche konnten gleich zu Anfang als Hochstaplerinnen entlarvt werden – sei es durch das falsche Alter oder nicht übereinstimmende körperliche Merkmale. Alle, die dieses erste Aussiebverfahren bestanden hatten, wurden zu Robert Mackenzie vorgelassen, Alberts Privatsekretär. Mackenzie stellte gründlichste Untersuchungen an und jedes Mal erwiesen sich die Behauptungen als frei erfunden.
Erst in den vergangenen Jahren begann das Interesse an dem Fall wieder anzusteigen – nicht nur an der Frage, was aus Alice geworden war, sondern auch an ihrer Entführung und jenem verhängnisvollen Tag auf dem Lake Champlain. Fortschritte auf dem Feld der DNA-Analyse und moderne Ermittlungstechniken könnten die Lösung nun abermals in greifbare Nähe rücken.
Gut möglich, dass Alice Ellingham doch noch gefunden wird.
DOZENTIN STIRBT BEI BRANDBurlington News Online4. November
Gestern Abend ist Dr. Irene Fenton, Dozentin an der University of Vermont, bei einem Feuer in ihrem Wohnhaus in der Pearl Street ums Leben gekommen. Dr. Fenton gehörte seit zweiundzwanzig Jahren der Fakultät für Geschichte an und hat in dieser Zeit mehrere Bücher veröffentlicht. Zu ihren Werken zählt unter anderem Der Wahrhaftige Lügner: Mord an der Ellingham Academy. Vermutlich brach der Brand gegen neun Uhr in ihrer Küche aus.
Dr. Fentons Neffe, der bei ihr lebte, hat lediglich leichte Verletzungen davongetragen. […]
1
Nackt und kreideweiß lagen die Knochen auf dem Tisch. Die Augenhöhlen starrten ins Leere und der Mund war zu einem lässigen Grinsen verzogen, als wollte er sagen: »Jepp, ich bin’s. Ihr fragt euch sicher, wie ich hier gelandet bin, was? Ist ’ne witzige Geschichte, das könnt ihr mir glauben …«
»Wie ihr seht, fehlt Mr Nelson der Mittelhandknochen des rechten Daumens. Als er noch am Leben war, hatte er natürlich –«
»Eine Frage«, unterbrach sie Mudge, noch bevor sein Arm ganz erhoben war. »Wie ist der Typ eigentlich zum Skelett geworden? Ich meine, warum ist er hier? Hat er gewusst, dass er mal an einer Schule landen würde?«
Pix, oder genauer: Dr. Nell Pixwell – Anatomielehrerin, forensische Anthropologin und Hauslehrerin von Minerva –, schwieg einen Moment. Ihre und Mr Nelsons Hände lagen locker ineinander, als hätte sie ihm soeben schüchtern einen Tanz auf einem großen Ball versprochen.
»Unser Mr Nelson«, erklärte sie dann, »wurde der Schule bei ihrer Eröffnung gestiftet, ich glaube, von einem Freund Albert Ellinghams, der Verbindungen nach Harvard hatte. Dass Leichen zu Anschauungszwecken genutzt werden, kann auf ganz unterschiedliche Arten zustande kommen. Manche Menschen spenden ihren Körper zum Beispiel der Wissenschaft. Könnte auch hier so gewesen sein, aber da hab ich so meine Zweifel. Den Materialien und Techniken nach zu urteilen, mit denen seine Gelenke rekonstruiert wurden, würde ich vermuten, dass Mr Nelson aus dem späten achtzehnten Jahrhundert stammt. Damals herrschten in Bezug auf so was noch etwas lockerere Sitten. Oft hat man auf die Leichen von Gefängnisinsassen zurückgegriffen. Mr Nelson hier scheint wohlgenährt gewesen zu sein. Er war groß und hatte noch sämtliche Zähne, was für die damalige Zeit ziemlich ungewöhnlich ist. Keinerlei gebrochene Knochen. Mein Tipp ist – aber das ist wirklich nur geraten –«
»Grabräuber?«, fiel Mudge ihr eifrig ins Wort. »Glauben Sie, er wurde ausgebuddelt?«
Mudge, der fast zwei Meter groß und Stevie Bells Laborpartner war, hatte eine Vorliebe für Death Metal und lila Schlangenaugenkontaktlinsen. Seinen schwarzen Hoodie zierten sicher rund fünfzig Disney-Anstecker, von denen einige überaus seltene Sammlerstücke waren, wie er Stevie nur zu gern erklärte, wenn sie im Dienste der Bildung mal wieder Kuhaugen und andere unaussprechliche Dinge sezierten. Mudge war der größte Disney-Fan der Welt und träumte davon, irgendwann als Animatronik-Entwickler dort zu arbeiten. Da lag es nur nahe, dass er an der Ellingham Academy gelandet war, an der man Leute wie Mudge verstand und willkommen hieß.
»Zumindest war so was zu der Zeit keine Seltenheit«, antwortete Pix. »In der Wissenschaft bestand ein großer Bedarf an Studienobjekten. Darum gab es damals professionelle Leichendiebe, die Tote ausgegraben und an Medizinstudenten verkauft haben. Und wenn Mr Nelson schon damals in Harvard als Anatomiemodell gedient hat, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er ein gestohlener Leichnam war. Dabei fällt mir ein, dass ich ihn dringend mal auf Kur schicken muss. Er braucht einen neuen Mittelhandknochen und außerdem muss hier, zwischen Haken-, Dreiecks- und Kopfbein, unbedingt mal der Draht geflickt werden. Das Leben ist hart, selbst für die Toten.«
Ein kleines Grinsen huschte über ihr Gesicht, bevor sie schlagartig wieder ernst wurde und sich über den Flaum auf ihrem Kopf rieb.
»Äh ja, so viel also zum Thema Mittelhand«, fuhr sie fort. »Dann wollen wir uns mal noch ein paar andere Knochen anschauen …«
Stevie war klar, warum Pix so schnell das Thema gewechselt hatte. Die Ellingham Academy war kein Ort mehr, an dem man Witze über den Tod reißen konnte.
Als Stevie nach der Stunde das Gebäude verließ, versetzte ihr die eisige Luft eine regelrechte Ohrfeige. Der Vermonter Wald hatte seinen spektakulären rotgoldenen Mantel so jäh abgeschüttelt, dass es wirkte, als hätten die Bäume einen Massenstriptease veranstaltet.
Sie gähnte. Gott, war sie müde.
Draußen wartete Nate Fisher auf sie. Mit krummem Rücken hockte er auf einer Bank und scrollte auf seinem Handy herum. Da es nun langsam kälter wurde, konnte er sich fröhlich – oder was bei Nate eben als fröhlich durchging – in übergroße Pullover, schlabbrige Cordhosen und endlos lange Schals hüllen, bis er ein wandelnder Haufen aus Natur- und Kunstfasern war.
»Wo warst du denn?«, lautete seine Begrüßung.
Er drückte ihr einen Becher Kaffee und einen Ahornsirup-Donut in die Hand. Zumindest ging Stevie stark davon aus, dass der Donut mit Ahornsirup war, da konnte man sich in Vermont relativ sicher sein. Sie nahm einen großen Schluck Kaffee und biss in den Donut, bevor sie antwortete: »Ich musste nachdenken. Darum bin ich vor dem Unterricht noch ein bisschen herumgelaufen.«
»Die Klamotten hattest du gestern schon an.«
Stevie blickte verwirrt an sich hinunter auf ihre schwarzen Chucks, die ausgeleierte Jogginghose, das ebenso ausgeleierte Sweatshirt und ihren dünnen roten Lackregenmantel.
»Hab drin geschlafen«, erklärte sie, begleitet von einem Regen aus Donutkrümeln.
»Du hast seit zwei Tagen nicht mehr mit uns zusammen gegessen und die meiste Zeit hab ich keine Ahnung, wo du dich herumtreibst.«
Das stimmte. Sie war ewig nicht mehr mit den anderen im Speisesaal gewesen und hatte ihren Hunger, der sie meistens mitten in der Nacht überkam, stattdessen mithilfe der Minerva-Frühstücksvorräte gestillt. Dann stand sie im Dunkeln an der Küchentheke, wo sie kauend die Hand unter den Froot-Loops-Spender hielt und die nächste Portion hineinrieseln ließ. Am Tag zuvor, meinte sie sich vage zu erinnern, hatte sie sich irgendwo eine Banane organisiert und sie auf dem Boden der Bibliothek hockend vertilgt, verborgen hinter hohen Regalen. In letzter Zeit hatte sie Menschen, Gespräche und sogar ihr Handy bewusst gemieden und sich nahezu komplett in die Welt ihrer Gedanken zurückgezogen, denn davon gab es jede Menge und sie mussten dringend geordnet werden.
Grund für dieses rastlose Einsiedlerdasein waren drei Vorkommnisse.
Erstens hatte David Eastman, ihr Vielleicht-Freund, sich in Burlington zusammenschlagen lassen. Mit voller Absicht – er hatte sogar jemanden dafür bezahlt. Anschließend hatte er ein Video der Aktion ins Internet gestellt und war spurlos verschwunden. David war der Sohn von Senator Edward King, der Stevie die Rückkehr an die Ellingham Academy ermöglicht hatte, und zwar unter der Voraussetzung, dass sie David im Zaum hielt.
Das war mal gründlich in die Hose gegangen.
Zweitens war in derselben Nacht Stevies Mentorin, Dr. Irene Fenton, bei einem Hausbrand ums Leben gekommen. Nicht dass Stevie und Fenton – wie sie am liebsten genannt wurde – sich sonderlich nahegestanden hatten, aber ein Schock war es natürlich trotzdem gewesen. Das einzig Gute war, dass der Brand sich nicht hier, sondern in Burlington ereignet hatte und Fenton in den Nachrichten lediglich als Dozentin der University of Vermont beschrieben wurde. Was bedeutete, dass die Sache nicht mit der Ellingham in Verbindung gebracht wurde, denn einen weiteren Todesfall würde die Schule wohl kaum überstehen. In einer Welt, in der alles ausschließlich und unweigerlich schiefzugehen schien, musste Stevie diese Tatsache wohl als einen der wenigen positiven Aspekte ihres verwirrenden neuen Lebens werten. Was eine grauenhaft egoistische Sichtweise war, das war ihr klar, aber sie musste pragmatisch bleiben. Wer Verbrechen aufklären wollte, durfte sich den Verstand nicht von Emotionen vernebeln lassen.
Und als wäre das alles nicht schon genug zu verarbeiten …
»Meinst du nicht, wir sollten uns mal unterhalten?«, fragte Nate. »Über das, was hier alles passiert ist? Darüber, wie es jetzt weitergehen soll?«
Gute Frage. Wie sollte es jetzt eigentlich weitergehen?
»Komm«, sagte sie knapp.
Sie machte auf dem Absatz kehrt und marschierte los, weg vom Gebäude, weg von den Leuten, weg von den zahllosen Kameras an Bäumen und Laternenmasten. Zum einen, um sicherzugehen, dass sie nicht belauscht wurden, und zum anderen, damit niemand sah, wie hemmungslos sie diesen Donut verschlingen würde. Sie hatte einen Mordshunger.
»If happf gepfafft«, nuschelte sie mit vollem Mund.
»Du hast gepafft? Seit wann rauchst du denn?«
Stevie schluckte den riesigen Donutbissen hinunter.
»Ich hab’s geschafft«, wiederholte sie. »Ich hab den Ellingham-Fall aufgeklärt.«
»Ich weiß«, sagte er. »Genau darüber müssen wir ja reden. Darüber und über das Feuer und tausend andere Sachen. Oh Mann, Stevie.«
»Es passt alles ins Bild«, erklärte sie, während sie langsam weiterging. »George Marsh, dieser Mann vom FBI, der die Ellinghams eigentlich hätte beschützen sollen … der den Grundriss des Hauses kannte, die Gewohnheiten der Familie, sämtliche Abläufe … der wusste, wann das Geld kam … der hätte mit Leichtigkeit eine Entführung arrangieren können. Willst du wissen, wie genau es sich abgespielt hat?«
Sie packte Nate locker am Arm und dirigierte ihn in Richtung der Villa, die das Herzstück des Schulgeländes bildete. In den Dreißigerjahren hatte darin Albert Ellingham mit seiner Familie gewohnt. Heute beherbergte sie die Schulverwaltung und wurde oft für Feste und andere Veranstaltungen genutzt. Wie ferngesteuert ging Stevie auf ein Tor in der Mauer zu und öffnete es. Dahinter lag der sogenannte versunkene Garten, dessen Bezeichnung von einem künstlich angelegten See herrührte, der Iris Ellingham einst als übergroßes Schwimmbecken gedient hatte. Nach dem Verschwinden seiner Tochter hatte Albert Ellingham das Wasser abpumpen lassen, weil jemand ihm weisgemacht hatte, auf dem Grund läge ihre Leiche. Zwar hatte sich diese Behauptung nicht bewahrheitet, aber den See ließ er trotzdem nie wieder befüllen. Alles, was übrig blieb, war eine riesige, grasüberwucherte Grube mit einem seltsamen kleinen Hügel in der Mitte, der einst eine Insel gewesen war. Auf dieser Insel befand sich ein runder Bau mit einem kuppelförmigen Glasdach – das Observatorium. Dort hatte Dottie Epstein ihr Schicksal ereilt, genau wie, mehrere Jahrzehnte später und ein Stück darunter, Hayes Major.
»Also« – Stevie zeigte auf die Insel – »Dottie Epstein sitzt im Observatorium und liest ganz in Ruhe ihren Sherlock Holmes. Plötzlich taucht ein Mann auf. George Marsh. Beide haben nicht miteinander gerechnet. Und von allen Schülerinnen der Ellingham musste Marsh ausgerechnet auf die cleverste treffen, diejenige mit einem Onkel bei der New Yorker Polizei. Dottie kennt Marsh und damit ist sein ganzer schöner Plan ruiniert. Dottie ahnt, dass etwas Schlimmes passieren wird, also hinterlässt sie eine Markierung in ihrem Buch, bemüht sich, so deutlich wie möglich zu machen, wen sie vor sich hat. Und dann stirbt sie. Aber am Ende gelingt es ihr tatsächlich, ihren Mörder auffliegen zu lassen. Und wenn wir jetzt mal kurz vorspulen …«
Stevie wandte sich zur Villa um, zu der Steinterrasse und den Glastüren, hinter denen Albert Ellinghams Arbeitszimmer lag.
»Die nächsten zwei Jahre versucht Albert Ellingham verzweifelt, seine Tochter zu finden, und plötzlich … plötzlich hilft irgendetwas seinem Gedächtnis auf die Sprünge. Er denkt an Dottie Epstein und die Markierung in dem Buch. Er holt die Aufnahme hervor, die er von ihr gemacht hat – das wissen wir, weil die Drahtspule an seinem Todestag auf seinem Schreibtisch gelegen hat –, und hört sie sich noch einmal an. Ihm wird klar, dass Dottie George Marsh erkannt haben muss. Er fragt sich …«
Stevie sah Albert Ellingham praktisch vor sich, wie er in seinem Arbeitszimmer auf und ab tigerte, über das Leopardenfell, von Ledersessel zu Ledersessel, wie er auf die grüne Marmoruhr auf dem Kaminsims starrte und darüber nachgrübelte, ob der Schluss, zu dem er soeben gekommen war, tatsächlich stimmen konnte.
»Er schreibt ein Rätsel, vielleicht, um sich selbst auf die Probe zu stellen, um zu überprüfen, ob er ernsthaft daran glaubt. Wo sucht man den, der nie wirklich ist da? Auf der Treppe, nicht Stufe, das ist doch klar! Was passiert auf einer Treppe ohne Stufen?, fragt er sich. Man rutscht ab und kommt zu Fall. Und wer hat ständig mit Fällen zu tun? Ein Ermittler. Wer ist nie wirklich da? Der Mann, den man angeheuert hat, um ein Verbrechen aufzudecken, der einem nie von der Seite weicht. Derjenige, an den man nie denkt, den man kaum noch bemerkt …«
»Stevie …«
»Und dann, am selben Nachmittag, geht er mit George Marsh segeln und das Boot explodiert. Alle sind davon ausgegangen, dass da die Anarchisten dahintersteckten, weil die schließlich schon mal versucht hatten, Ellingham zu ermorden, und es ja auch hieß, sie hätten sich seine Tochter geholt. Aber das ist Quatsch. Für diese Explosion war einer der beiden verantwortlich. Entweder ist George Marsh klar geworden, dass er geliefert war, und er hat keinen anderen Ausweg gesehen, als Ellingham und sich in die Luft zu jagen, oder Albert Ellingham hat ihn mit der Wahrheit konfrontiert und es selbst getan. So oder so war die Geschichte an der Stelle zu Ende. Und der Wahrhaftige Lügner kann Alice auf keinen Fall entführt haben, weil ich nämlich weiß, dass dieser Brief von zwei Ellingham-Schülern verfasst wurde und wahrscheinlich bloß als Scherz gemeint war. Die Sache ist einfach komplett aus dem Ruder gelaufen. Der Brief war nur ein Spaß, die Entführung ist missglückt und auf einmal gab es lauter Tote …«
»Stevie«, versuchte Nate, seine Freundin zurück in die Gegenwart zu holen, auf die kalte, matschige Rasenfläche.
»Fenton«, redete Stevie unbeirrt weiter, »war davon überzeugt, dass es in Albert Ellinghams Testament einen Nachtrag gibt, in dem der Person, die Alice findet, sein Vermögen zugesichert wird. Ist ziemlich verrückt, was für richtige Aluhutträger, aber Fenton hat fest daran geglaubt. Hat sogar beteuert, sie hätte Beweise, auch wenn ich nie welche zu sehen gekriegt habe. Und sie war total paranoid – hat alles nur auf Papier aufbewahrt, Akten in alten Pizzakartons versteckt und so. Sie hatte sogar eine echte Verschwörungstheoretiker-Wand. Sie meinte, sie wäre da was ganz Großem auf der Spur. Als ich sie angerufen habe, um ihr zu erzählen, was ich herausgefunden habe, hat sie gesagt, sie könnte gerade nicht und irgendwas von wegen ›Die Kleine ist …‹. Und dann ist ihr Haus abgebrannt.«
Nate rieb sich resigniert über den Kopf.
»Besteht denn wirklich gar keine Chance, dass das alles nur ein Unfall war?«, fragte er. »Bitte, sag mir, dass es eine gibt.«
»Was denkst denn du?«, erwiderte Stevie leise.
»Was ich denke?« Nate setzte sich auf eine der Steinbänke am Rand des versunkenen Gartens.
Stevie ließ sich neben ihn fallen und die Kälte drang durch ihre Kleider.
»Ich hab keine Ahnung, was ich denken soll. Eigentlich glaube ich nicht an Verschwörungstheorien, weil Menschen für gewöhnlich einfach viel zu unorganisiert sind, um irgend so ein riesiges, verzwickten Komplott fehlerfrei über die Bühne zu bringen. Aber ich glaube auch, dass man, wenn zur selben Zeit am selben Ort eine Menge seltsames Zeug passiert, davon ausgehen kann, dass dazwischen eine Verbindung besteht. Erst stirbt Hayes bei dem Videodreh über den Ellingham-Fall. Dann Ellie, nachdem du dahintergekommen bist, dass sie das Drehbuch zu Hayes’ Serie geschrieben hat. Und jetzt erwischt es auch noch die Frau, der du bei den Recherchen zum Ellingham-Fall geholfen hast, und zwar genau dann, als du ihr erzählen wolltest, dass du den Kriminalfall des Jahrhunderts aufgeklärt hast. Das waren alles schreckliche Unfälle, oder meinetwegen auch nicht, aber was anderes fällt mir dazu nicht mehr ein und ich muss mir meine Energie für den nächsten Nervenzusammenbruch aufsparen. Hilft das?«
»Nein«, sagte Stevie mit einem Blick auf den grau-rosa Himmel.
»Wie wär’s denn, wenn – nein, lass mich bitte ausreden –, wenn du der Polizei alles erzählst, was du weißt, und dann die Finger von der Sache lässt?«
»Aber ich weiß ja nichts«, entgegnete sie. »Das ist doch das Problem. Dafür müsste ich erst mal mehr in Erfahrung bringen. Was ist, wenn das alles wirklich zusammenhängt? Und das muss es schließlich, oder? Iris und Dottie und Alice, Hayes und Ellie und Fenton.«
»Muss es?«
»Lass mich mal eben nachdenken.« Stevie fuhr sich mit der Hand durch das kurze blonde Haar, bis es ihr in alle Richtungen vom Kopf abstand. Seit ihrer Ankunft an der Ellingham Academy Anfang September war sie nicht mehr beim Friseur gewesen. Einmal, um zwei Uhr morgens vor dem Badezimmerspiegel, hatte sie selbst zur Schere gegriffen, aber leider dabei ein wenig ihre künstlerische Vision aus den Augen verloren. Daher trug sie nun einen rausgewachsenen Mopp, der über der einen Braue länger war als über der anderen und sich ständig aufrichtete wie der Kamm eines erschrockenen Kakadus. Ihre Fingernägel waren bis zum Nagelbett abgekaut, und obwohl die Schule einen Wäscheservice anbot, trug sie fast jeden Tag denselben ungewaschenen Kapuzenpullover. Ihr Körper schien ihr immer mehr zu entgleiten.
»Und wie lautet jetzt der Plan? Willst du weiter hier herumschleichen, nichts essen und mit keinem reden?«
»Nein«, erwiderte sie. »Ich muss was unternehmen. Aber ich brauche mehr Informationen.«
»Okay.« Nate gab sich geschlagen. »Und wo kriegst du Informationen her, die weder gefährlich noch falsch sind?«
Stevie kaute nachdenklich auf ihrer Unterlippe. Gute Frage.
»Hier bei uns in der Gegenwart«, merkte Nate an, »führt Janelle übrigens heute einen Testlauf mit ihrer Maschine vor. Sie macht sich ein bisschen Sorgen, dass du nicht kommst.«
Natürlich. Während Stevie sich auf den verschlungenen Seitenpfaden ihres Gehirns herumgetrieben hatte, war das wirkliche Leben weitergegangen. Janelle Franklin, ihre beste Freundin und Zimmernachbarin, hatte fast ihre gesamte Zeit an dieser Schule damit verbracht, eine Rube-Goldberg-Maschine für einen Wettbewerb zu bauen. Klar, dass sie da ihre engsten Freunde beim Testlauf dabeihaben wollte. So drang gerade noch durch den Dunst in Stevies Kopf: Heute Abend, acht Uhr. Maschine angucken.
»Klar komme ich«, sagte sie. »Natürlich. Aber jetzt muss ich erst mal weiter nachdenken.«
»Vielleicht musst du eher mal nach Hause und eine Runde schlafen oder duschen oder so was? Ich bin mir echt nicht sicher, ob mit dir alles okay ist.«
»Du hast recht!« Ihr Kopf ruckte hoch. »Mit mir ist nicht alles okay.«
»Hä?«
»Ich brauche Hilfe«, erklärte sie lächelnd. »Und zwar von jemandem, der überzeugt ist, dass Reden hilft.«
Februar 1936
»Es ist noch nicht angekommen, Liebes«, sagte Leonard Holmes Nair und wischte seinen Pinsel an einem Lappen ab. »Wir müssen uns noch etwas gedulden.«
Iris saß vor ihm in einem Korbsessel, der normalerweise für besseres Wetter gedacht war. Sie zitterte in ihrem weißen Mohairmantel, aber nicht vor Kälte, wie Leo vermutete. Für Mitte Februar war es relativ mild, gerade warm genug, dass er beschlossen hatte, draußen an seinem Gemälde von der Familie und dem Haus zu arbeiten. Schüler eilten von Gebäude zu Gebäude, die Arme voller Bücher, und ihr Geplauder zerschnitt die kristallene Bergstille. Ein solcher Palast – ein Wunderwerk der Architektur und Landschaftsplanung, ein Zeugnis höchster Ingenieurskunst und menschlicher Willenskraft –, alles nur für eine Schule? Leonards Ansicht nach war das, als würde man ein erlesenes Festmahl zubereiten, nur um es dann vor die Tür zu kippen und zuzusehen, wie sich die Waschbären darüber hermachten.
»Ein bisschen musst du doch wohl noch übrig haben.« Iris rutschte unruhig auf ihrem Sessel hin und her. »Du hast immer was.«
»Sieh dich lieber vor. Wir wollen schließlich nicht, dass der Schnee dich irgendwann vollends im Griff hat.«
»Danke für die Moralpredigt, Leo. Und jetzt rück schon was raus.«
Leo griff seufzend in seine Jackentasche und förderte ein Emailledöschen in Form eines Schuhs zutage. Dann schöpfte er mit dem Fingernagel eine winzige Prise weißes Pulver direkt in Iris’ ausgestreckte Hand.
»Das ist aber wirklich alles, bis ich eine neue Lieferung bekomme«, sagte er. »Den besten Stoff gibt es nun mal in Deutschland und bis der hier ist, dauert es seine Zeit.«
Iris drehte den Kopf zur Seite und schniefte das Pulver gierig auf. Als sie sich ihm wieder zuwandte, war ihr Lächeln wesentlich strahlender als zuvor.
»Schon viel besser«, seufzte sie.
»Ich hätte dich nie damit in Berührung bringen sollen.« Leo ließ die Dose zurück in seine Tasche fallen. »Hin und wieder mal ein bisschen ist ja in Ordnung. Aber wenn man sich zu sehr daran gewöhnt, übernimmt das Zeug die Oberhand. Hab ich alles schon miterlebt.«
»Wenigstens vertreibt es die Langeweile«, erwiderte Iris, während sie den Kindern zusah. »Womit soll man sich denn auch sonst die Zeit vertreiben, seit wir anscheinend ein Waisenhaus führen?«
»Das besprichst du wohl besser mit deinem Mann.«
»Da könnte ich genauso gut eine Diskussion mit dem Berg anfangen. Wenn Albert sich etwas in den Kopf gesetzt hat …«
»… dann kauft er es sich. Was für ein schreckliches Los. Glaub mir, es gibt eine Menge Leute, die liebend gern mit dir tauschen würden. Da draußen spielt sich nämlich gerade eine klitzekleine landesweite Krise ab.«
»Ich weiß«, fauchte sie. »Und schon allein deswegen sollten wir zurück nach New York. Da könnte ich eine Suppenküche eröffnen und tausend Menschen pro Tag verköstigen. Und was machen wir? Dreißig Kindern das Einmaleins beibringen? Die Hälfte davon sind sowieso nur die Bälger unserer Freunde. Wenn ihre Eltern sie so dringend loswerden wollen, täte es jedes x-beliebige Internat genauso gut.«
»Wenn ich das deinem Mann klarmachen könnte, würde ich es tun«, seufzte Leo. »Aber ich bin eben nur der Hofmaler.«
»Ein alter Esel bist du.«
»Das auch. Aber immerhin dein alter Esel. Und jetzt halt mal kurz still, deine Kieferpartie kommt gerade außerordentlich gut zur Geltung.«
Iris gehorchte, aber nach einem Moment sackte sie ein wenig in sich zusammen. Die entspannende Wirkung des Pulvers hatte eingesetzt und machte ihre perfekte Haltung zunichte.
»Hör mal«, sagte sie, »ich kenne ja deine Meinung zu dem Thema, aber … Alice wird immer größer. Es wäre gut, wenn sie irgendwann …«
»Davon willst du doch nicht ernsthaft schon wieder anfangen«, fiel er ihr ins Wort, während er mit dem Pinsel auf seine Palette tupfte und einen Hauch leuchtendes Blau ins Grau mischte. Wenn Iris sich nicht mehr konzentrieren wollte, widmete er sich eben dem Übergang zwischen Fels und Himmel. »Du hast gerade so etwas Schönes von mir bekommen und so dankst du mir dafür?«
»Ich weiß ja, mein Lieber, ich weiß. Aber …«
»Wenn Flora gewollt hätte, dass ihr erfahrt, wer der Vater ist, meinst du nicht, dann hätte sie es euch gesagt? Außerdem habe ich wirklich keine Ahnung.«
»Wenn sie es jemandem verraten würde, dann dir.«
»Stell meine Freundschaft nicht zu sehr auf die Probe«, mahnte Leo. »Bitte mich nicht um etwas, was ich einfach nicht für dich tun kann.«
»Mir reicht’s für heute«, verkündete Iris und holte ihr silbernes Zigarettenetui aus der Tasche. »Ich gehe rein und nehme ein heißes Bad.«
Sie stand auf, zog ihren Mantel zu und stolzierte über den Rasen zum Eingang der Villa.
Leo hatte ihr das Pulver ursprünglich gegeben, um ihr über die Langeweile hinwegzuhelfen – nur hin und wieder dieselbe geringe Dosis, die er auch nahm. In letzter Zeit allerdings hatte er eine Veränderung in ihrem Verhalten bemerkt: Sie war launisch, ungeduldig und geheimniskrämerisch. Ganz offensichtlich hatte sie irgendwo eine weitere Quelle aufgetan, schnupfte jetzt mehr und wurde unruhig, wenn sie auf dem Trockenen saß. Sie war auf dem besten Weg, süchtig zu werden. Ihr Mann ahnte von alldem natürlich nichts und genau das machte einen großen Teil des Problems aus. Albert regierte vergnügt sein Königreich, während Iris immer stärker ins Trudeln geriet, weil sie nichts hatte, um ihren lebhaften Geist zu beschäftigen.
Vielleicht sollten sie zusammen zurück nach New York fahren, Flora, Iris, Alice und er. Das war das einzig Vernünftige. Sie an einen Ort bringen, der ihr Ablenkung bot, und zu einem guten Arzt auf der Fifth Avenue, der sich um genau diese Art von Problemen kümmerte.
Albert würde nicht begeistert sein. Er ertrug es nicht, von Iris und Alice getrennt zu sein, schon eine einzige Nacht war ihm zu viel. Seine Hingabe an die beiden war bewundernswert. Die meisten Männer in Alberts Position hatten Dutzende Affären und in jeder Stadt eine andere Geliebte. Albert dagegen wirkte treu, was vermutlich bedeutete, dass er nur eine hatte. Vielleicht ja in Burlington.
Leo betrachtete die Szenerie vor sich, das düster daliegende Haus mit dem dahinter aufragenden Felsenvorhang. Die spätnachmittägliche Sonne tauchte alles in einen hellen Lavendelton, die nackten Bäume zeichneten sich dunkel vor dem Horizont ab, wie die freigelegten Nervenbahnen riesiger Lebewesen. Leo setzte den Pinsel auf die Leinwand und wich gleich darauf wieder zurück. Die drei Figuren auf dem Gemälde starrten ihn erwartungsvoll an. Etwas stimmte nicht, irgendwas an diesem Motiv ergab keinen Sinn.
Allgemein grassierte ja der Irrglaube, dass Reichtum die Menschen satt und zufrieden machte. Dabei traf in den allermeisten Fällen das genaue Gegenteil zu. In vielen rief er einen Hunger hervor, der sich durch nichts stillen ließ, was man auch aß. Irgendwo tat sich immer ein neues Loch auf, das gestopft werden wollte. Das alles wurde Leo nun schlagartig klar, hier im Licht des ersterbenden Sonnenuntergangs. Er erkannte es in den Gesichtern seiner Motive, an der Farbe des Horizonts. Einen Moment lang studierte er seine Palette, konzentrierte sich auf das Preußischblau und die Möglichkeiten, daraus einen Himmel von verheerender Wirkung zu erschaffen.
»Mr Holmes Nair?«
Zwei Schüler hatten sich ihm genähert, während er in seine Gedanken versunken war, ein Junge und ein Mädchen. Der Junge war schön – mit so goldenem Haar, dass jeder Dichter darüber ins Schwärmen geraten würde. Das Lächeln des Mädchens dagegen schien eine gefährliche Frage zu stellen. Was Leo außerdem auffiel, war die Lebendigkeit, die sie beide ausstrahlten. Ihre geröteten Wangen hoben sich leuchtend vor der Umgebung ab. Leo registrierte winzige Schweißspuren in ihren Gesichtern, ihre zerknitterten Kleider, das zerwühlte Haar.
Sie hatten etwas Verbotenes angestellt und es war ihnen vollkommen egal, dass man es ihnen ansah.
»Sie sind doch Leonard Holmes Nair, oder?«, fragte der Junge.
»Stimmt«, antwortete Leo.
»Ich hab letztes Jahr Ihre Ausstellung in New York gesehen, Orpheus Eins. Hat mir gefallen, sogar noch besser als Herkules.«
Der Junge hatte Geschmack.
»Du interessierst dich für Kunst?«, fragte Leo.
»Ich bin Dichter.«
Im Großen und Ganzen war Leo Dichtern gegenüber durchaus positiv eingestellt, aber man durfte sie auf gar keinen Fall von ihrer Arbeit erzählen lassen, wenn man vorhatte, weiterhin mit Genuss Lyrik zu lesen.
»Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich eine Fotografie von Ihnen mache?«
»Nein, schon in Ordnung«, seufzte Leo.
Während der Junge seine Kamera hob, musterte Leo seine Begleiterin. Der Junge war hübsch; das Mädchen war interessant. In ihren Augen glitzerte eine ungezähmte Intelligenz. Sie hielt ein Buch vor die Brust gepresst, auf eine Art, die vermuten ließ, dass darin etwas stand, was ihr sehr wichtig war und vermutlich gegen die eine oder andere Ellingham-Regel verstieß. Sein geschultes Malerauge und sein verdorbener Geist sagten ihm, dass es von diesen beiden wohl das Mädchen war, vor dem man sich in Acht nehmen musste. Wenn es hier an der Ellingham Academy Schüler wie diese gab, dann war das Experiment möglicherweise doch kein völliger Fehlschlag.
»Und du, bist du auch Dichterin?«, erkundigte Leo sich höflich.
»Eindeutig nein«, antwortete sie. »Aber es gibt schon Gedichte, die ich mag. Die von Dorothy Parker zum Beispiel.«
»Das freut mich zu hören. Dorothy ist nämlich eine liebe Freundin von mir.«
Der Junge fummelte an seiner Kamera herum. Wenn Cecil Beaton oder Man Ray nach dem richtigen Winkel suchten, war das eine Sache, aber dieser Knirps begann Leo langsam auf die Nerven zu gehen, Kunstgeschmack hin oder her. Das Mädchen schien seine Ungeduld zu spüren.
»Jetzt mach schon, Eddie«, forderte sie ihn auf.
Der Junge gehorchte sofort.
»Ich will nicht unhöflich sein«, sagte Leo, der sich nie darum scherte, ob man ihn für unhöflich hielt, »aber ich würde gern das letzte Licht noch ausnutzen.«
»Komm, Eddie, wir müssen zurück.« Das Mädchen lächelte Leo zu. »Vielen Dank, Mr Nair.«
Dann gingen die beiden, der Junge in die eine Richtung, das Mädchen in die andere. Eine Weile blickte Leo dem Mädchen nach, das auf das kleine Gebäude namens Minerva zueilte. Er machte sich eine geistige Notiz, Dorothy von ihr zu erzählen, verlegte das Zettelchen jedoch umgehend auf irgendeinem vollgestellten Tischchen in seinem Kopf. Mit seinem Öltuch in der Hand massierte er sich die Nasenwurzel. Seine Vision der Villa mitsamt ihren Geheimnissen war ihm abhandengekommen. Der Moment war verstrichen.
»Jetzt ist Cocktailstunde«, sagte er sich. »Genug für heute.«
2
»Ich muss mir etwas von der Seele reden«, log Stevie.
Sie saß vor einem massiven Schreibtisch, der den Großteil des Raumes einnahm. Es war einer der schönsten in der ganzen Villa. Ursprünglich hatte er Iris Ellingham als Ankleidezimmer gedient. Die silbergraue Tapete an den Wänden war noch original erhalten und passte zur aktuellen Farbe des Himmels. Anstelle eines Schminktischs jedoch standen hier nun Büromöbel.
Stevie bemühte sich, den Mann hinter dem Schreibtisch – den mit dem graublonden Haarwust und der modischen Brille, dem Iron-Man-Shirt und dem schmal geschnittenen Blazer – nicht direkt anzusehen, und konzentrierte sich deshalb auf den gerahmten Druck an der Wand zwischen den beiden Fenstern. Sie kannte dieses Bild gut. Es war eine illustrierte Karte der Ellingham Academy, die allen Infobroschüren über die Schule beilag. Auch als Poster konnte man sie kaufen. Sie war einfach eins von diesen allgegenwärtigen Dingen, über die man nie genauer nachdachte, und eher künstlerisch als maßstabsgetreu. Die Gebäude zum Beispiel waren riesig und bis ins kleinste Detail ausgestaltet. Stevie hatte gehört, die Karte sei von einer ehemaligen Schülerin gezeichnet worden, die später Kinderbuchillustratorin geworden war. Dies war die für die Außenwelt bestimmte Illusion der Ellingham Academy – freundlich und wie aus dem Bilderbuch.
»Freut mich, dass du dafür zu mir gekommen bist«, entgegnete Charles.
Das glaubte Stevie ihm sofort. Charles legte nämlich großen Wert darauf, lustig und relaxt herüberzukommen, was man bereits aus den Stickern und Zetteln an seiner Tür schließen konnte, auf denen Sprüche wie »DER KLÜGERE HINTERFRAGT«, »WISSENSCHAFT HEISST WISSENSCHAFT, WEIL SIE WISSEN SCHAFFT« oder »ICH BIN NICHT VERRÜCKT, MEINE REALITÄT IST NUR ANDERS ALS DEINE« standen. Das größte Schild von allen war genau in die Mitte gepinnt. »REDEN HILFT!« prangte handschriftlich darauf. Iris Ellinghams Fensterbretter wurden heute von Funko Pop!-Figuren bevölkert, die sich den Platz mit gerahmten Fotos von, wie Stevie annahm, Charles’ Rudermannschaften aus Cambridge und Harvard teilten. Denn von der Fassade des gut gelaunten Kummerkastenonkels durfte man sich keinesfalls täuschen lassen. Charles war hochgebildet, so wie alle Ellingham-Lehrer, die sich, strotzend vor Eliteuniabschlüssen, akademischen Auszeichnungen und Berufserfahrung, aufmachten, um hier oben zu unterrichten.
Das Problem war nur: Stevie hatte gar nicht vor, über ihre Gefühle zu reden. Manchen Leuten fiel es leicht, ihr Innerstes für jeden, der des Weges kam, nach außen zu kehren. Stevie dagegen würde lieber eine Handvoll Bienen zum Frühstück verspeisen, als jemandem mitzuteilen, wie sie sich fühlte. Meistens wollte sie das ja nicht mal selbst wissen. Und darum musste sie es jetzt irgendwie hinkriegen, offen und verletzlich zu wirken, ohne dabei wahre Emotionen preiszugeben, denn das war echt ekelhaft. Stevie weinte nicht und erst recht nicht vor Lehrern.
»Ich versuche immer noch, das Ganze zu … verarbeiten«, sagte sie.
Charles nickte. Verarbeiten war ein gutes Wort für jemanden, der solchen Psychokram liebte, gleichzeitig jedoch nüchtern genug, um in Stevie keinen Würgereiz hervorzurufen.
»Stevie.« Er schüttelte den Kopf. »Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Das war ein trauriges Jahr für uns alle. Und du hattest besonders viele Berührungspunkte mit diesen ganzen Ereignissen. Du hast dich bisher wirklich tapfer geschlagen, obwohl das niemand von dir erwartet, vergiss das bitte nicht. Es gibt keinen Grund, gute Miene zum bösen Spiel zu machen.«
Beinahe wäre er mit diesen Worten zu ihr durchgedrungen. Stevie hatte es tatsächlich satt, immer die Tapfere zu geben. Es war so anstrengend. Unter ihrer Haut kribbelte die Angst wie ein Alien, das jeden Moment aus ihr herausplatzen könnte.
Plötzlich zog ein lautes Ticken ihre Aufmerksamkeit auf sich. Sie wandte sich zum Kaminsims um, auf dem eine große Uhr stand. Diese Uhr hatte früher ihren Platz in Albert Ellinghams Arbeitszimmer gehabt. Es war ein besonders schönes und sichtlich wertvolles Stück, kieferngrün mit goldener Äderung. Es hieß, Marie Antoinette persönlich habe diese Uhr einst einer befreundeten Adligen geschenkt. Ob das bloß ein Märchen war? Oder, wie so vieles hier, unglaublich, aber wahr?
Nachdem Charles gut eingestimmt war, wurde es Zeit, dass Stevie an das gelangte, was sie wirklich wollte – Informationen.
»Darf ich Sie was fragen?«, fing sie an.
»Selbstverständlich.«
Sie starrte auf die grüne Uhr, deren grazile, uralte Zeiger noch immer einwandfrei über das Zifferblatt wanderten. »Es geht um Albert Ellingham«, sagte sie.
»Na, über den weißt du höchstwahrscheinlich mehr als ich.«
»Ich hab da was über sein Testament gehört. Angeblich steht dadrin, wenn irgendjemand Alice findet, kriegt diese Person Ellinghams ganzes Geld. Oder jedenfalls einen ziemlich dicken Batzen davon. So eine Art Finderlohn. Und sollte sie nicht gefunden werden, bekommt die Schule das Geld. Ich dachte erst, das wäre bloß ein Gerücht … aber Dr. Fenton hat es wohl geglaubt. Sie als Schulleiter müssten doch über so was Bescheid wissen. Und hieß es nicht auch letztens, die Schule würde bald mehr Mittel zur Verfügung haben?«
Charles lehnte sich in seinem Bürostuhl zurück und verschränkte die Hände hinter dem Kopf.
»Weißt du, ich will ja nicht schlecht von irgendjemandem reden«, begann er, »schon gar nicht, wenn dieser Jemand erst vor Kurzem auf tragische Weise ums Leben gekommen ist, aber wie sich herausgestellt hat, hatte Dr. Fenton so einige Probleme, über die wir uns nicht vollends im Klaren gewesen sind.«
»Sie war Alkoholikerin. Doch das heißt ja nicht, dass sie falschlag.«
»Nein«, räumte er ein. »Aber meines Wissens steht im Testament nichts von so einer Belohnung. Es gibt allerdings eine Summe, die an Alice selbst gegangen wäre, wenn sie noch leben würde. Die wird bald freigegeben. Daher konnten wir schon mal den Kunstschuppen bauen und ein paar weitere neue Gebäude werden auch noch dazukommen.«
Und zack, lösten sich Fentons Theorien in Rauch auf.
Genau wie ihr Haus.
»Darf ich dich jetzt auch was fragen?«, fuhr Charles fort. »David Eastman ist nach Burlington gefahren und nicht zurückgekehrt. Eigentlich will ich dich da ungern mit reinziehen, du hast schließlich schon genug mitgemacht. Aber Davids Vater …«
»… ist Senator King.«
»Dachte ich mir schon, dass du Bescheid weißt.« Er nickte ernst. »Normalerweise versuchen wir das hier so gut wie möglich geheim zu halten – aus Sicherheitsgründen. Beim Sohn eines Senators sind nun mal gewisse Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Und dieser spezielle Senator …«
»… ist ein Monster«, ergänzte Stevie.
»Nun ja, jedenfalls vertritt er sehr kontroverse politische Thesen, denen wir nicht alle zustimmen. Aber du hast es eigentlich treffender ausgedrückt.«
Stevie und Charles grinsten sich verschwörerisch zu.
»Ich will ganz offen zu dir sein, Stevie. Ich weiß, dass Senator King dafür gesorgt hat, dass du an die Schule zurückkehren konntest. Und vermutlich hast du dich dabei nicht sonderlich wohlgefühlt.«
»Er saß bei uns im Wohnzimmer.«
»Bist du eng mit David befreundet?«, fragte er.
»Äh …«
Stevie hatte noch alles vor Augen, jeden Moment. Ihren ersten Kuss. David und sie in ihrem Zimmer auf dem Fußboden. Sie beide allein im Tunnel. Seine Locken unter ihren Fingern. Sein Körper, drahtig und stark und warm und …
»Wir wohnen halt im selben Haus«, sagte sie dann.
»Und du hast keine Ahnung, wo er ist?«
»Nein«, antwortete sie. Und das war die Wahrheit. Sie hatte tatsächlich keine Ahnung. Er hatte auf keine ihrer Nachrichten reagiert. »David ist … nicht so mitteilungsbedürftig.«
»Um ehrlich zu sein, Stevie, wir stecken ziemlich in der Bredouille. Wenn es jetzt auch nur noch den kleinsten Zwischenfall gibt, weiß ich nicht, wie wir die Schule am Laufen halten sollen. Falls David sich doch irgendwann meldet, würdest du mir dann Bescheid geben?«
Das war eine berechtigte und vernünftige Bitte. Stevie nickte.
»Danke«, sagte er. »Wusstest du übrigens, dass Dr. Fenton einen Neffen hatte? Er studiert in Burlington und hat mit ihr zusammengewohnt.«
»Hunter.« Stevie nickte.
»Tja, er hat jetzt leider kein Zuhause mehr. Und da Dr. Fenton der Ellingham Academy so lange eng verbunden war, hat die Verwaltung beschlossen, dass er fürs Erste hier wohnen darf. Bei euch in Minerva sind ja nun ein paar Zimmer frei …«
Das stimmte. Jetzt, da die Hälfte seiner Bewohner verschwunden oder tot war, kam ihr das nächtliche Knacken und Knarzen des halb leeren Hauses noch unheimlicher vor.
»Zur Uni kann er auch von hier aus fahren. Wir hatten einfach das Gefühl, das wäre das Mindeste, was wir für ihn tun können. Und ich glaube, er interessiert sich genauso sehr für die Schule wie seine Tante.«
»Wann kommt er denn?«
»Morgen, sobald er aus dem Krankenhaus entlassen wird. Es geht ihm gut, aber sie haben ihn eine Weile zur Beobachtung dabehalten und damit die Polizei ihn befragen konnte. Er hat bei dem Brand alles verloren, darum wollen wir von der Schule versuchen, ihn wenigstens mit dem Grundlegendsten zu versorgen. Leider hatte ich wegen der Sache mit David noch keine Zeit, selbst nach Burlington zu fahren, doch wenn du möchtest, könnte ich dir eine Genehmigung ausstellen, sodass du ein paar Sachen für ihn einkaufen kannst. Vermutlich kannst du sowieso viel besser beurteilen, was ihm gefallen würde, als so ein alter Knacker wie ich.«
Er klappte seine Brieftasche auf, zog eine Kreditkarte heraus und reichte sie Stevie.
»Er braucht auf jeden Fall eine neue Jacke, Winterstiefel, dann noch einige andere warme Klamotten, Socken, Hausschuhe … Wäre gut, wenn du möglichst unter tausend Dollar bleiben könntest. Ich lasse dich von einem der Wachleute zu L.L.Bean fahren und dann könntest du ein Stündchen durch die Stadt bummeln. Meinst du, so ein kleiner Ausflug würde dir vielleicht guttun?«
»Definitiv«, sagte Stevie.
Was für eine unerwartete, aber überaus willkommene Entwicklung. Vielleicht war es ja doch nicht so schlecht, sich hin und wieder ein wenig zu öffnen.
Sobald Stevie wieder nach draußen trat, zog sie ihr Handy aus der Tasche und schrieb:
Komme nach Burlington. Können wir uns treffen?
Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten.
Wann und wo?
Zeit, sich ein paar wirkliche Informationen zu beschaffen, dachte Stevie zufrieden.
3
Burlington war eine kleine Stadt auf einem Hügel am Ufer des Lake Champlain, der Vermont vom Staat New York trennte. Der malerische, lang gezogene See erstreckte sich bis nach Kanada hinein und bei schönem Wetter konnte man darauf segeln. Hier hatte Albert Ellingham seinen schicksalhaften letzten Bootsausflug unternommen. Burlington selbst war lange Zeit relativ schlicht und von Industrie geprägt gewesen; in den vergangenen Jahren jedoch durchwehte die Stadt ein eher künstlerisches Flair. Ateliers, Yogastudios und allerlei esoterisch angehauchte Läden wurden eröffnet. Außerdem spielte der Wintersport eine entscheidende Rolle, was sich besonders in der riesigen L.L.Bean-Filiale mit ihrer reichen Auswahl an Schneeschuhen und Skistöcken, dick gefütterten Jacken, Skiern und Stiefeln bemerkbar machte, die allesamt zu rufen schienen: »Vermont! Ihr glaubt gar nicht, wie krass kalt es hier werden kann!«
Stevie wurde vor dem Laden abgesetzt, in der Hand die Kreditkarte, die Charles ihr vor einer Stunde überreicht hatte. Es war mehr als seltsam, für einen Typen shoppen zu gehen, den sie kaum kannte. Hunter war supernett, da gab es nichts zu meckern. Er war blond und sommersprossig, studierte Ökologie und interessierte sich tatsächlich für den Ellingham-Fall. Wenn auch vielleicht nicht ganz so brennend wie Stevie oder seine Tante. Außerdem hatte er Stevie erlaubt, in Fentons Unterlagen herumzuschnüffeln. Viel hatte Stevie dabei zwar nicht entdeckt, aber zumindest war sie dadurch auf die Sache mit der Drahttonaufnahme gekommen.
Und nun war das alles in Flammen aufgegangen. Fentons gesamte Arbeit, was immer sie dabei ausgegraben und zusammengetragen hatte.