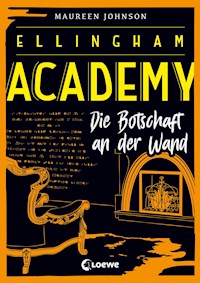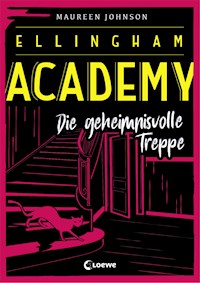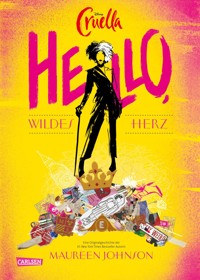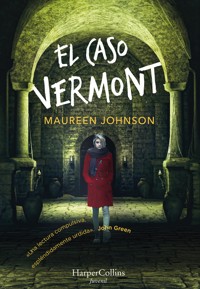Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
"Ein kunstvoller und komplexer Roman, den man unbedingt lesen sollte!" John Green, Autor von Das Schicksal ist ein mieser Verräter Willkommen in der Ellingham Academy! Versteckt in den Bergen Vermonts ist die Privatschule der ideale Ort für die begabtesten Schüler des Landes – Bestsellerautoren, YouTube-Stars, Künstler, Erfinder. Doch das Internat umgibt eine tragische Geschichte. Vor mehr als 80 Jahren wurden Frau und Tochter des Schulgründers entführt. Genau deshalb wird Stevie Bell an der Akademie aufgenommen: Sie soll die bisher ungeklärte Ellingham-Affäre lösen. Und schon bald erhält sie eine mysteriöse Botschaft, die einen Mord ankündigt. Als ein Schüler kurz darauf tot aufgefunden wird, ist Stevie überzeugt, dass es einen Zusammenhang zwischen diesem Todesfall und den Verbrechen aus der Vergangenheit gibt. Stevie Bell ist großer Fan von Sherlock Holmes und Agatha Christie. Aber noch viel mehr begeistern sie reale Kriminalfälle – wie die bisher ungelöste Ellingham-Affäre. Als Schülerin der exklusiven Ellingham Academy kann sie endlich selbst am Schauplatz der legendären Entführung ermitteln. Doch als ein Mitschüler ums Leben kommt, muss Stevie nicht nur das Verbrechen von damals aufklären. Vor atmosphärischer Internatskulisse erzählt Bestsellerautorin Maureen Johnson eine spannende Geschichte von Mord und Mystery, die vor Charme, Witz und zarter Romantik sprüht. Ein moderner Kriminalroman für Mädchen ab 13 Jahren. Was geschah mit Alice? ist der erste Band der Ellingham Academy-Trilogie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Für alle, die schon immer davon geträumt haben, eine Leiche in der Bibliothek zu finden
Einleitung
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
FOTOGRAFISCHE DOKUMENTATION EINES BRIEFS
EINGEGANGEN AUF DEM ELLINGHAM-ANWESENAM 8. APRIL1936
13. April 1936, 18:00 Uhr
Du weißt, ich kann dich nicht gehen lassen …
Das Schicksal hatte Dottie ein Jahr zuvor ereilt, und zwar in Gestalt des Schulleiters, der sie in sein Büro bestellte.
Es war nicht das erste Mal.
Dottie Epstein wurde aus keinem der üblichen Gründe zur Schulleitung zitiert – streiten, schummeln, schlechte Zensuren, schwänzen. Dotties Vorladungen dort waren wesentlich komplizierteren Ursachen geschuldet: Weil sie auf eigene Faust chemische Experimente durchgeführt hatte, weil sie das Wissen des Lehrers über nicht euklidische Geometrie infrage gestellt hatte oder weil sie im Unterricht Bücher las, mit der Begründung, es habe dort nichts Neues zu lernen gegeben, darum habe sie ihre Zeit lieber mit etwas Sinnvollem verbringen wollen.
»Dolores«, tadelte sie dann Mr Phillips, der Schulleiter. »Du kannst nicht immer so tun, als wärst du cleverer als alle anderen.«
»Aber das bin ich nun mal«, antwortete sie. Nicht weil sie arrogant war, sondern weil es stimmte.
Diesmal jedoch wusste Dottie nicht, was man ihr vorzuwerfen hatte. Gut, sie war in die Bibliothek eingebrochen, um nach einem Buch zu suchen, aber sie war sich ziemlich sicher, dass es niemand bemerkt hatte. Dottie hatte jeden Winkel dieser Schule ausgekundschaftet, jedes Schloss geknackt, in jede Besenkammer gespäht, jeden Schrank, jede dunkle Nische. Nicht aus böswilliger Absicht. Normalerweise tat sie das alles nur, um etwas zu finden, oder einfach, um zu sehen, ob es möglich war.
Als sie das Büro betrat, saß Mr Phillips hinter seinem wuchtigen Schreibtisch. Doch es war noch jemand im Raum – ein Mann mit grau meliertem Haar und einem eleganten anthrazitfarbenen Anzug. Er saß seitlich des Schulleiters, gebadet in Sonnenstrahlen, die durch den Lamellenvorhang vor dem Fenster hereinfielen. Er sah aus, als wäre er beim Film. Was er ja auch war, auf gewisse Weise.
»Dolores«, sagte Mr Phillips. »Das hier ist Mr Albert Ellingham. Weißt du, wer Mr Ellingham ist?«
Natürlich wusste sie das. Jeder wusste das. Albert Ellingham war der Besitzer der American Steel Company, der New York Evening News und des Fantastic-Pictures-Filmstudios. Er schwamm in Geld. Tatsächlich würde man sich nicht wundern, sein Abbild auf einem Dollarschein zu finden.
»Mr Ellingham hat eine wunderbare Nachricht für dich. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen.«
»Setz dich doch, Dolores«, meldete sich jetzt Mr Ellingham zu Wort und deutete auf den leeren Stuhl vor Mr Phillips’ Schreibtisch.
Dottie nahm Platz und der berühmte Mr Ellingham beugte sich zu ihr vor, stützte die Ellenbogen auf die Knie und faltete seine großen, sonnengebräunten Hände. Dottie war noch nie im März jemandem mit sonnengebräunter Haut begegnet. Dies war, mehr als alles andere, ein Indiz für Mr Ellinghams Reichtum. Er hätte sich die Sonne selbst kaufen können.
»Ich habe schon viel von dir gehört, Dolores«, fuhr er nun fort. »Mr Phillips hat mir berichtet, wie klug du bist. Mit vierzehn Jahren schon in der elften Klasse! Du hast dir selbst Latein und Griechisch beigebracht, ja? Fertigst eigene Übersetzungen an?«
Dottie nickte schüchtern.
»Wird dir die Schule da nicht manchmal ein bisschen langweilig?«, fragte er.
Dottie warf dem Schulleiter einen nervösen Blick zu, doch der lächelte und nickte ermutigend. »Manchmal schon«, gab Dottie zu. »Aber daran ist nicht die Schule schuld.«
Woraufhin die beiden Männer schmunzelten und Dottie sich ein wenig entspannte. Nicht komplett, aber immerhin ein wenig.
»Ich habe eine Schule gegründet, Dolores«, eröffnete Mr Ellingham ihr nun. »Eine neue Schule, an der besondere Menschen wie du in ihrem eigenen Tempo lernen können, auf ihre eigene Art, ganz so wie es für sie am besten ist. Für mich ist Lernen wie ein Spiel, ein wunderbares Spiel.«
Mr Phillips sah einen Moment auf seine Schreibtischunterlage hinunter. Die meisten seiner Berufsgenossen würden Lernen wohl nicht als Spiel bezeichnen, aber niemand käme auf die Idee, dem großen Albert Ellingham zu widersprechen. Wenn er sagte, Lernen sei ein Spiel, dann war es eins. Wenn er sagte, Lernen sei ein rollschuhfahrender Elefant in einem grünen Tutu, dann müssten sie ihm ebenfalls zustimmen. Wenn man nur genug Macht und Geld hatte, dann konnte man Worten neue Bedeutungen zuschreiben.
»Ich habe dreißig Schüler unterschiedlichster Herkunft für meine Schule ausgewählt und ich würde mich freuen, dich dazuzählen zu dürfen«, redete Mr Ellingham weiter. »Du könntest deine Lernweise völlig frei gestalten und würdest mit allem versorgt, was du dafür benötigst. Na, was hältst du davon?«
Dottie hielt eine ganze Menge davon. Aber sie sah auch ein ebenso offenkundiges wie unlösbares Problem.
»Meine Eltern haben kein Geld«, sagte sie schlicht.
»Geld sollte niemals eine Bedingung für Bildung sein«, entgegnete Mr Ellingham freundlich. »Meine Schule ist kostenlos. Du wärst sozusagen mein Gast, wenn du meine Einladung annimmst.«
Das klang alles zu gut, um wahr zu sein – aber das war es. Albert Ellingham schickte ihr ein Zugticket und fünfzig Dollar Taschengeld. Ein paar Monate später war Dottie Epstein, die noch nie in ihrem Leben New York verlassen hatte, auf dem Weg in die Berge von Vermont und von mehr Bäumen umgeben, als sie je zuvor gesehen hatte.
Vor der Schule erhob sich ein riesiger Springbrunnen, der Dottie an den aus dem Central Park erinnerte. Die roten Backsteingebäude wirkten wie einem Roman entsprungen. Ihr Zimmer in Haus Minerva war groß, aber gemütlich und hatte einen eigenen Kamin (kalt war es hier oben). Es gab Bücher, so viele schöne Bücher, und man konnte sich nehmen, welche man wollte, lesen, wonach einem der Sinn stand, ganz ohne Leihgebühren. Die Lehrer waren nett. Es gab ein richtiges Labor für die Naturwissenschaften. Der Botanikunterricht fand im Gewächshaus statt. Tanzen brachte ihnen eine Frau namens Madame Scottie bei, die den ganzen Tag im Gymnastikanzug und in wehende Tücher gehüllt herumlief und Unmengen riesiger Armreife trug.
Mr Ellingham lebte mit seiner Frau Iris und seiner dreijährigen Tochter Alice direkt auf dem Schulgelände. Manchmal fuhren am Wochenende teure Wagen vor, aus denen Leute in prachtvollen Kleidern stiegen. Dottie erkannte mindestens zwei Filmstars, einen Politiker und eine berühmte Sängerin. An solchen Wochenenden spielten Jazzbands aus Burlington und New York und aus der Villa drang bis in die späte Nacht Musik zu den Wohnhäusern herüber. Manchmal flanierten Mr Ellinghams Gäste draußen umher und die Strasssteinchen an ihren Kleidern blitzten im Mondschein. Nicht einmal in New York war Dottie Berühmtheiten so nahe gekommen.
Das Personal räumte nach diesen Partys geflissentlich auf, doch das Grundstück war so weitläufig und voller Verstecke, dass die Gäste dennoch überall Spuren hinterließen. Ein vergessener Champagnerkelch hier, ein satinbezogener Schuh dort. Massenweise Zigarettenstummel, Federn, Perlen und andere Hinterlassenschaften der Reichen und Schönen. Dottie liebte es, all diese wundersamen Dinge einzusammeln, und fügte sie ihrem Museum, wie sie es nannte, hinzu. Ihr Lieblingsstück war ein silbernes Feuerzeug. Sie zündete es an und freute sich über die geschmeidige Mechanik. Natürlich hatte sie vor, das Feuerzeug als Fundsache abzugeben – sie wollte es nur noch ein kleines bisschen länger behalten.
Da die Ellingham-Schüler völlig frei arbeiten, lernen und umherstreifen durften, verbrachte Dottie einen Großteil ihrer Zeit allein. Vermont war anders als New York; hier kletterte man keine Feuerleitern hinunter oder an Regenrinnen hoch. Stattdessen machte Dottie sich mit dem Anwesen vertraut, erforschte es bis zum äußersten Rand. Auf diese Weise stieß sie im Herbst, kurz nach ihrer Ankunft an der Ellingham Academy, auf den Tunnel. Sie war ein wenig durch den Wald spaziert. Dottie kannte nichts, was diesem dichten Baldachin aus Blättern und der tiefen, nur von gelegentlichem Rascheln unterbrochenen Stille auch nur im Entferntesten gleichkam. Dann, auf einmal, hatte sie etwas Vertrautes gehört – das Geräusch von etwas Metallenem unter ihren Füßen. Sie erkannte den hohlen Laut sofort. Als würde man auf eine Kellerschachtabdeckung treten.
Dottie öffnete die Klappe, unter der eine saubere Betontreppe zum Vorschein kam, die in die Tiefe führte. Kurz darauf fand sie sich in einem dunklen Backsteintunnel wieder, trocken und gut instand gehalten. Ihre Neugier war geweckt. Sie zündete das Silberfeuerzeug an und folgte dem Tunnel bis zu einer schweren Tür mit einer kleinen Schiebeluke auf Augenhöhe. Solche Luken kannte sie – die gab es in New York überall. An den Eingängen zu illegalen Kneipen.
Die Tür war nicht verschlossen. Nichts an diesem Tunnel wirkte abweisend; er schien nur darauf zu warten, erforscht zu werden. Hinter der Tür lag ein etwa einen Quadratmeter großer Raum mit hoher Decke. An den Wänden reihten sich Regale voller Weinflaschen und anderer alkoholischer Getränke. Dottie sah sich die reich verzierten Etiketten auf dem dunklen Glas genauer an. Die Aufschriften waren französisch, deutsch, russisch, spanisch, griechisch … eine wahre Alkoholbibliothek.
Eine Leiter führte die Wand hinauf. Dottie kletterte sie hoch und öffnete die Klappe am oberen Ende. Sie gelangte in einen runden Raum mit einer Glaskuppel als Dach. Auf dem Boden lagen Felle und Kissen, außerdem sah Dottie mehrere Aschenbecher und ein paar Champagnergläser. Sie stellte sich auf die Bank, die ringsherum verlief, und erkannte, dass sie sich auf einer kleinen Insel in der Mitte des künstlich angelegten Sees hinter der Ellingham-Villa befand.
Ein Geheimversteck! Das fantastischste Geheimversteck der Welt. Hierher würde sie zum Lesen kommen, beschloss sie. Und so verbrachte Dottie Epstein eine Menge Zeit in der Glaskuppel, zusammengerollt unter einem der Felle, neben sich einen Stapel Bücher. Sie wurde nie erwischt und selbst wenn Mr Ellingham davon erfahren würde, da war sich Dottie sicher, hätte er bestimmt nichts dagegen. Er war ein so netter Mann und noch dazu verstand er durchaus Spaß.
Was sollte schon dabei sein?
An jenem Tag im April lag ein eigentümlicher Nebel über dem Gelände, der zwischen die Bäume schlich und ganz Ellingham in einen milchigen Schleier hüllte. Dottie beschloss, dass dies genau das richtige Wetter für einen guten Detektivroman war. Sherlock Holmes wäre perfekt. Sie hatte längst alle Sherlock-Holmes-Geschichten verschlungen, aber es gab kaum etwas Besseres, als Bücher noch einmal zu lesen, und der Dunst draußen erinnerte sie an das neblige London in den Erzählungen.
Inzwischen wusste sie, zu welchen Zeiten sie sich am besten in die kleine Glaskuppel schleichen konnte. Jetzt, am späten Montagnachmittag, würde niemand aus der Villa dort sein. Mr Ellingham war schon morgens weggefahren und Mrs Ellingham gegen Mittag. Dottie holte sich den Sherlock-Holmes-Sammelband aus der Schulbibliothek und machte sich auf den Weg zu ihrem Versteck.
Beim Blick aus der Glaskuppel an diesem Tag hatte sie das Gefühl, sich mitten in einer Wolke zu befinden. Dottie legte sich auf den Boden, zog sich ein Fell bis über die Schultern und schlug ihr Buch auf. Kurz darauf wanderte sie im Geiste durch die Straßen von London und die Jagd ging los, wie Sherlock sagen würde!
Dottie war so in die Geschichte vertieft, dass das Geräusch von direkt unter ihr sie hochschrecken ließ. Jemand war in der Alkoholkammer und kletterte die Leiter hinauf. Jemand war hier. Dottie, die keine Möglichkeit zu entkommen hatte, zog sich das schwere Fell über den Kopf, wich bis an die Wand zurück und versuchte, dort mit einem Haufen Kissen zu verschmelzen.
Sie hörte, wie die Luke sich knarrend öffnete, dann das Krachen, als die Klappe auf den Steinboden schlug. Jemand hievte sich in die Kuppel und blieb keinen halben Meter neben ihrem Gesicht stehen. Sie betete, dass die Person nicht auf sie trat, und rollte sich noch enger zusammen.
Die Person machte einen Schritt von ihr weg und stellte etwas auf den Boden. Dottie nutzte die Gelegenheit, um den Rand des Fells ein Stückchen zu heben, und erhaschte einen Blick auf eine behandschuhte Hand, die Gegenstände aus einem Sack hervorholte und auf den Boden legte. Sie riskierte ein weiteres Stückchen, um mehr zu sehen. Eine Taschenlampe. Ein Fernglas. Ein Seil. Und irgendetwas Glänzendes.
Das Glänzende waren Handschellen, die kannte sie von ihrem Onkel, der Polizist war.
Taschenlampe, Fernglas, Seil, Handschellen?
Eine Welle von Adrenalin brandete durch ihren Körper und ließ ihren Herzschlag beschleunigen. Irgendetwas stimmte hier nicht. Sie zog das Fell zurück über ihren Kopf und kauerte sich nieder, das Gesicht so fest auf den Boden gepresst, dass ihre Nase wehtat. Die Person räumte noch ein paar Minuten weiter. Dann herrschte plötzlich Stille. War sie wieder allein? Sie hätte doch hören müssen, wenn die Person zurück durch die Luke direkt neben ihrem Kopf geklettert wäre.
Ihr eigener Atem schlug ihr heiß ins Gesicht. Sie hatte keine Ahnung, was hier vor sich ging, aber ihr war regelrecht schwindelig vor Angst. Lautlos begann sie zu zählen. Als sie bei fünfhundert angelangt war und noch immer nichts gehört hatte, beschloss sie, einen weiteren Blick zu wagen, und hob den Rand des Fells. Nur einen Fingerbreit. Dann noch einen.
Niemand zu sehen. Sie hob das Fell noch etwas höher. Nichts. Sie wollte sich gerade aufsetzen, als …
»Hallo«, ertönte eine Stimme.
Dottie spürte, wie ihr Herz gegen den Boden hämmerte.
»Keine Angst«, sagte die Stimme. »Du kannst jetzt rauskommen.«
Es hatte keinen Zweck, sich noch länger zu verstecken. Und so kroch Dottie, das Buch fest an die Brust gedrückt, unter ihrem Fell hervor. Sie sah den Neuankömmling an, dann die Sachen auf dem Boden.
»Das ist alles für das Spiel«, erklärte die Person.
Spiel? Natürlich. Die Ellinghams liebten Spiele. Sie luden sich ständig Gäste dazu ein – dann wurden ausgedehnte Schnitzeljagden und Rätselrallyes veranstaltet. Außerdem versorgte Mr Ellingham die Schülerunterkünfte stets mit Brettspielen und kam sogar manchmal selbst auf eine Partie Monopoly vorbei. Taschenlampe. Seil. Fernglas. Handschellen. Gut möglich, dass es um ein Spiel ging. Bei Monopoly gab es schließlich auch die seltsamsten Spielfiguren.
»Was denn für ein Spiel?«, fragte Dottie.
»Das ist kompliziert«, antwortete die Person. »Aber es wird ein Heidenspaß. Ich muss mich verstecken. Bist du auch hier, um dich zu verstecken?«
»Nur zum Lesen«, erwiderte Dottie. Sie hob das Buch und versuchte, ihre Hände vom Zittern abzuhalten.
»Sherlock Holmes?«, las die Person vom Einband ab. »Ich liebe Sherlock Holmes. Welche Geschichte liest du gerade?«
»Eine Studie in Scharlachrot.«
»Die ist gut. Lies ruhig weiter. Lass dich von mir nicht stören.« Der Besucher nahm eine Zigarette aus der Tasche, zündete sie an und beobachtete Dottie rauchend.
Dottie kannte die Person. Gut möglich, dass es hier um die Vorbereitungen für eines von Ellinghams ausgeklügelten Spielen ging. Aber Dottie war in New York aufgewachsen und hatte dort genug von der Welt gesehen, um zu spüren, wenn etwas faul war. Die Blicke. Der Tonfall. Ihr Onkel, der Polizist, sagte immer zu ihr: »Hör auf deinen Instinkt, Dottie. Wenn du bei irgendwas oder irgendwem ein ungutes Gefühl hast, mach, dass du wegkommst. Mach, dass du wegkommst, und hol mich.«
Dotties Instinkt sagte ihr unmissverständlich, dass sie hier wegmusste. Aber nicht überstürzt. Sie musste sich ganz normal geben. Also schlug sie ihr Buch wieder auf und versuchte, sich auf die Worte vor ihr zu konzentrieren. Sie hatte immer einen kleinen Bleistiftstummel im Ärmel, um sich jederzeit Notizen machen zu können. Als die Person einen Blick aus der Kuppel warf, schob sie den Stummel in einer fließenden, über die Zeit perfektionierten Bewegung hinunter in ihre Hand und unterstrich hastig einen Satz auf der Seite. Es war nicht viel, aber es war immerhin eine Möglichkeit, eine Botschaft zu hinterlassen. Vielleicht würde sie ja jemand verstehen, falls …
Niemand würde ihre Botschaft verstehen und das »falls« war zu grauenvoll, um auch nur darüber nachzudenken.
Sie schob den Bleistift zurück in ihren Ärmel und gab es auf, so zu tun, als würde sie lesen. Die Buchstaben verschwammen vor ihren Augen. Sie zitterte am ganzen Körper.
»Ich muss jetzt das Buch zurück in die Bibliothek bringen«, sagte sie. »Keine Sorge, ich verrate keinem was. Ich kann es nicht ausstehen, wenn andere petzen.«
Die Person lächelte, aber es war ein eigenartiges Lächeln. Aufgesetzt. Eine Spur zu sehr in die Breite gezogen.
Mit einem Mal wurde Dottie bewusst, dass sie sich in der Mitte eines Sees befand, irgendwo weit oben in den Bergen. Im Geiste spielte sie alle möglichen Szenarien durch und sie wusste, was in den nächsten Sekunden passieren würde. Ihr Herzschlag verlangsamte sich. Die Zeit geriet ins Stocken. Sie hatte viele Geschichten gelesen, in denen der Tod so präsent war wie eine der Hauptfiguren – nahezu greifbar. Und plötzlich schien er sich hier mit ihr im Raum zu befinden, ein lautloser Besucher.
»Ich muss gehen«, sagte sie mit belegter Stimme. Sie machte einen Schritt auf die Luke zu, doch die Person bewegte sich in dieselbe Richtung. Sie waren wie Figuren auf einem Schachbrett, während das Spiel sich seinem unentrinnbaren Ende zuneigte.
»Du weißt, ich kann dich nicht gehen lassen«, sagte die Person. »Ich wünschte, ich könnte es.«
»Ich bin gut darin, Geheimnisse zu bewahren. Ehrlich!«, beteuerte Dottie verzweifelt. Sie umklammerte ihren Sherlock Holmes. Ihr konnte nichts Schlimmes passieren, solange sie ihren Sherlock Holmes hatte. Sherlock würde sie beschützen.
»Bitte«, flehte sie.
»Tut mir wirklich leid«, sagte der Besucher und es klang, als bedauerte er es aufrichtig.
Es war noch genau ein Spielzug übrig und Dottie wusste, dass sie verloren hatte. Aber wenn auf dem Spielbrett nichts anderes mehr möglich war, tat man eben, was man tun musste. Sie stürzte zur Luke. Sie hatte keine Zeit, um nach der Leiter zu greifen – sie ließ das Buch fallen und hechtete in die dunkle Öffnung. Blind grapschte sie um sich. Ihre Finger rutschten über die Sprossen, doch sie bekam keine zu fassen. Sie fiel. Der Boden empfing sie mit grausamer Endgültigkeit.
Als sie landete, blitzte ein letztes Mal ihr Bewusstsein auf. Sie verspürte einen beinahe süßen Schmerz und dann etwas Warmes, das sich um sie ausbreitete. Die Person kam hinter ihr die Leiter herunter. Dottie versuchte, sich zu bewegen, davonzukriechen, doch es war zwecklos.
»Ich wünschte, du wärst nicht hergekommen«, sagte die Person. »Von ganzem Herzen.«
Als die Dunkelheit nach Dottie griff, tat sie es rasch und unerbittlich.
AUSZUG AUSMORD IN DEN BERGEN: DIE ELLINGHAM-AFFÄRE
Die Ellingham Academy lag am Hang eines Bergs, dessen offizieller Name Mount Morgan lautete. Allerdings nannte ihn niemand so. In der Gegend war er nur als Axtberg oder Großes Hackebeil bekannt, wegen seines Gipfels, dessen Form ihm Ähnlichkeit mit ebenjenen Werkzeugen verlieh.
Anders als die umliegenden Berge, die Skifahrer und Touristen anlockten, war der Axtberg weitgehend naturbelassen und von dichtem Wald bedeckt. Nur hin und wieder verirrten sich Wanderer hierher, Eigenbrötler, Vogelbeobachter oder einfach Leute, die Bergbäche mochten und gern durch endlose Wälder streiften.1928, als Albert Ellingham in die Gegend kam, mieden die Menschen das Hackebeil. Keine Straßen, nicht einmal die schmalsten Pfade, führten hinauf. Der Wald war zu undurchdringlich, der Fluss zu tief. Zu oft gab es Steinschläge. Der Berg war zu fremd, zu unberechenbar.
Der Legende zufolge war Albert Ellingham durch ein Versehen auf diesen Ort gestoßen, als er auf dem Weg zu seinem Jachtklub in Burlington war. Wie man es bewerkstelligte, im Jahr1928rein versehentlich auf einem unbesiedelten Berg zu landen, blieb ungeklärt, Ellingham jedoch war es gelungen und er verkündete, den perfekten Ort gefunden zu haben. Er hatte sich schon lange mit dem Gedanken getragen, eine Schule zu gründen, an der nach seinen persönlichen Prinzipien und Idealen unterrichtet wurde – eine Schule, an der man Lernen als Spiel betrachtete, an der sich reiche und arme Schüler mischten und alle auf ihre eigene Art lernten. Die Luft hier oben war sauber, das Vogelgezwitscher lieblich. Hier gab es nichts, was die Schüler von ihren Zielen ablenken würde.
Ellingham erstand ein riesiges Grundstück zum Dreifachen des Angebotspreises. Es dauerte mehrere Jahre, bis er genug Platz freigesprengt hatte, um die Schule zu errichten. Schneisen wurden in den Wald geschlagen. Die Telefongesellschaft verlegte Leitungen und stellte ein paar Telefonzellen entlang des Wegs auf. Langsam, aber sicher wurde das Hackebeil mittels einer provisorischen, unbefestigten Straße, ein paar Kabeln und einer Flut aus Menschen und Vorräten mit dem Rest der Welt verbunden.
Doch die Ellingham Academy, als die die Institution später Bekanntheit erlangen sollte, war mehr als bloß eine Schule. Mitten auf dem Gelände stand das Wohnhaus der Ellinghams – und auch das war nicht bloß ein Wohnhaus. Es war die prachtvollste Villa in ganz Vermont und stand den größten Gebäuden von Burlington und Montpelier in nichts nach.
Albert Ellingham wollte im Zentrum seines eigenen Experiments leben, seiner Wiege des Wissens. Überall auf dem Gelände standen Statuen. Dazwischen verliefen kreuz und quer Pfade, scheinbar völlig willkürlich. Es hielt sich das Gerücht, Ellingham sei einer seiner Katzen gefolgt und habe den Weg, den sie lief, pflastern lassen, weil er der Meinung war, dass Katzen es nun mal am besten wüssten. An dem Gerücht war nichts dran, aber Ellingham freute sich so sehr darüber, dass schon bald ein neues Gerücht aufkam, demzufolge er das erste selbst in die Welt gesetzt haben sollte.
Dann gab es die Tunnel, die Fensterattrappen, die Türen ins Nirgendwo … all die kleinen architektonischen Spielereien, die Albert Ellingham über alles liebte und die seine Partys so berühmt-berüchtigt machten. Es heißt, dass nicht mal er selbst alle Geheimgänge und verborgenen Orte kannte, sondern lediglich den zahlreichen Architekten aufgetragen hatte, ein paar nette Überraschungen einzubauen. Kurz gesagt, das Ganze war eine fantastische Idylle und wäre es womöglich heute noch, wenn nicht an jenem nebligen Apriltag im Jahr1936der Wahrhaftige Lügner zugeschlagen hätte.
Schulen konnten für vieles bekannt sein: akademische Errungenschaften, berühmte Absolventen oder Sportmannschaften.
Wofür sie nicht bekannt sein sollten, war Mord.
1 – »Das mit den …
1
»Das mit den Elchen ist ja wohl gelogen«, bemerkte Stevie Bell.
Ihre Mutter drehte sich zu ihr um und sah aus wie so oft – ein bisschen müde und aus elterlichem Pflichtgefühl bemüht, sich mit dem auseinanderzusetzen, was Stevie zu sagen hatte.
»Was?«, fragte sie.
Stevie deutete aus dem Busfenster. »Da.« Draußen zog ein Straßenschild mit dem Wort »Elche« vorbei. »Das ist schon das fünfte, seit wir losgefahren sind. Ganz schön viele Versprechungen. Für ganz schön wenig Elch.«
»Stevie …«
»Außerdem haben sie Steinschläge versprochen. Wo sind denn meine Steinschläge, hm?«
»Stevie …«
»Ich halte nun mal große Stücke auf ehrliche Reklame«, fügte Stevie hinzu.
Darauf folgte eine lange Pause. Stevie und ihre Eltern hatten schon mehr als eine Diskussion über das Wesen von Wahrheit und Fakten geführt, die an jedem anderen Tag vermutlich mit einem handfesten Streit geendet hätte. Aber nicht heute. Heute schienen sie sich alle in stillschweigendem Einvernehmen dazu zu entschließen, die Sache auf sich beruhen zu lassen.
Schließlich ging man nicht alle Tage von zu Hause weg aufs Internat.
»Ich finde es nicht gut, dass wir nicht bis aufs Schulgelände fahren dürfen«, beschwerte sich ihr Vater zum ungefähr achten Mal an diesem Morgen. Das Ellingham-Infomaterial hatte in diesem Punkt keinen Raum für Zweifel gelassen: VERSUCHEN SIE NICHT, DIE SCHÜLER MIT DEM EIGENEN WAGEN ZUR SCHULE ZU BRINGEN. BEI ZUWIDERHANDELN WERDEN SIE AUFGEFORDERT, IHR KIND AM TOR ABZUSETZEN. KEINE AUSNAHMEN.
An dieser Vorschrift war rein gar nichts Verwerfliches und die Begründung wurde direkt mitgeliefert: Das Schulgelände bot schlicht keinen Platz für viele Autos. Es gab nur eine einzige Zufahrtsstraße und keine Parkmöglichkeiten. Um zur Schule zu gelangen oder sie zu verlassen, nahm man den Ellingham-Bus. Stevies Eltern hatten diese Tatsache mit einem Stirnrunzeln quittiert, als wäre jeder Ort, an den man nicht selbst fahren konnte, von vornherein verdächtig und ein Angriff auf die gottgegebene Freiheit des amerikanischen Autofahrers.
Aber Regeln waren nun mal Regeln und so saßen die Bells nun in diesem Bus – einem äußerst komfortablen Exemplar mit nur einem Dutzend Sitze, getönten Scheiben und einem Videobildschirm, auf dem jedoch nichts zu sehen war als das schwache Spiegelbild der Landschaft vor den Fenstern. Am Steuer saß ein älterer Herr mit silbergrauem Haar. Er hatte noch kein Wort gesprochen, seit er sie vor fünfzehn Minuten am Rastplatz abgeholt hatte, und selbst da hatte er nur von sich gegeben: »Stephanie Bell?« und »Setzen Sie sich, wohin Sie wollen. Sie sind die Einzigen.« Zwar hatte Stevie schon davon gehört, dass die Bewohner Vermonts extrem wortkarg sein und Auswärtige als Flachländler bezeichnen sollten, aber sie fand die Einsilbigkeit des Fahrers trotzdem unheimlich.
»Hör mal«, sagte ihre Mom jetzt leise, »für den Fall, dass du es dir anders überlegst …«
Stevie umklammerte ihre Armlehne. »Ich habe nicht vor, mir jetzt noch irgendwas anders zu überlegen. Wir sind da. Na ja, fast.«
»Ich meine ja nur …«, setzte ihre Mutter erneut an, tat ihre Meinung dann aber doch nicht kund. Die nächste Standarddiskussion. Der heutige Morgen bot eine Mischung aus den Greatest Hits, aber wenig Neues.
Stevie sah wieder aus dem Fenster, wo das mystisch blaue Bergpanorama zunehmend Bäumen und schroffen Felswänden wich, während sich die Straße den Berg hinaufwand. In ihren Ohren ploppte es, als sie langsam an Höhe gewannen und der Fernstraße weg von Burlington und immer tiefer in die Wildnis folgten. Stevie, die die Unterhaltung als beendet betrachtete, griff nach ihren Ohrhörern. Gerade als sie einen Podcast ausgewählt hatte und »Play« drücken wollte, legte ihre Mutter ihr die Hand auf den Arm.
»Vielleicht ist das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für deine Krimis«, bemerkte sie.
»True Crime. Das sind echte Kriminalfälle«, rutschte es Stevie heraus, bevor sie sich bremsen konnte. Der Hinweis ließ sie wie eine Besserwisserin wirken. Und außerdem: kein Streit. Kein Streit.
Stevie zog das Kabel wieder aus ihrem Handy und rollte es zusammen.
»Hast du noch mal was von deiner Freundin gehört?«, fragte ihre Mom jetzt. »Jazelle?«
»Janelle«, korrigierte Stevie. »Sie hat mir von unterwegs zum Flughafen geschrieben.«
»Das ist ja schön. Es wird dir guttun, ein paar Freunde zu haben.«
Sei brav, Stevie. Sag nicht, dass du längst Freunde hast. Du hast haufenweise Freunde. Wen interessiert’s, ob du die meisten bloß aus Online-Krimiforen kennst? Ihre Eltern kapierten einfach nicht, dass man auch Freunde außerhalb der Schule haben konnte. Das war kein bisschen seltsam, im Internet fand man sogar am leichtesten Leute, die zu einem passten. Und außerdem hatte sie auch in der Schule Freunde, nur eben nicht nach dem gängigen Modell, das offenbar zwingend Übernachtungspartys, Schminksessions und Ausflüge ins Einkaufszentrum vorsah.
Aber das spielte jetzt keine Rolle mehr. Die Zukunft lag vor ihr in den nebligen Bergen.
»Wofür interessiert sich Janelle noch mal?«, fragte ihre Mutter.
»Technik«, antwortete Stevie. »Sie baut gern Maschinen und alle möglichen Apparate.«
Argwöhnisches Schweigen.
»Und dieser Nate schreibt?«, fragte ihre Mutter dann.
»Und dieser Nate schreibt«, bestätigte Stevie.
Nate und Janelle waren die zwei anderen Neulinge in Stevies Wohnheim. Über die Schüler aus den älteren Jahrgängen erfuhr man nichts. Auch diese Informationen kreisten schon seit einigen Wochen über dem Esstisch im Hause Bell – Janelle Franklin kam aus Chicago. Sie war die nationale Schülersprecherin für »Growing Stems«, ein Programm, das junge Menschen ermutigte, sich in den Bereichen Naturwissenschaft, Technik und Mathematik zu engagieren. Stevie war bereits vollkommen im Bilde über Janelle: Sie wusste, dass Janelle mit sechs Jahren dabei erwischt worden war, wie sie (erfolgreich) den kaputten Toaster reparierte. Sie kannte ihre Hobbys: basteln und erfinden, löten und schweißen und ihre Pinterest-Seiten zu den Themen Organisationstechniken, Mädchen mit Brille, Jugendbücher, Kaffee, Katzen und so ziemlich jeder TV-Serie.
Stevie und Janelle schrieben sich regelmäßig. Was schon mal gut war. Freundin Nummer eins.
Der zweite Neue in Haus Minerva war Nate Fisher. Er schrieb weniger und antwortete nie auf Nachrichten, aber auch über ihn hatte Stevie einiges in Erfahrung gebracht. Nate hatte mit gerade mal vierzehn ein Buch mit dem Titel Die Mondhell-Chroniken herausgebracht – ein siebenhundertseitiges Fantasy-Epos, das er innerhalb von wenigen Monaten geschrieben hatte und das zuerst online und kurz darauf in gedruckter Form erschienen war. Es hieß, Mondhell Band zwei sei gerade in Arbeit.
Alle beide passten genau ins Schema der Ellingham Academy.
»Das scheinen zwei sehr interessante junge Leute zu sein«, befand ihr Dad. »Genau wie du. Wir sind stolz auf dich. Das weißt du.«
Stevie las zwischen den Zeilen die eigentliche Bedeutung dieser Aussage: Sosehr wir dich lieben, wir können uns absolut nicht erklären, warum diese Schule ausgerechnet dich angenommen hat, du seltsames Kind.
Der ganze Sommer war so gewesen, ein steter Wechsel zwischen geäußertem Stolz und nicht geäußerter Skepsis, untermalt von der permanenten Verwirrung darüber, wie es überhaupt so weit gekommen war. Zuerst hatten Stevies Eltern gar nichts von ihrer Bewerbung an der Ellingham gewusst. Diese Art Schule kam für Leute wie die Bells für gewöhnlich nicht infrage. Fast ein Jahrhundert lang hatte das Institut kreative Genies, Querdenker und Wegbereiter großer Neuerungen hervorgebracht. Dabei gab es keine Bewerbungsformulare, keine Liste mit Anforderungen und keinerlei Instruktionen, die über »Wenn du dich an der Ellingham Academy bewerben möchtest, melde dich« hinausgingen.
Das war alles.
So ein einfacher Satz, der doch jeden Musterschüler in den Wahnsinn treiben musste. Was wollten sie? Wonach suchten sie? Das Ganze hatte etwas von einem Rätsel aus einem Märchen oder Kinderbuch – einer Aufgabe, die einem der Zauberer stellte, bevor man die geheimnisvolle Kammer betreten durfte. Zu einer Bewerbung gehörten strikte Anforderungen, die man erfüllen musste – Zeugnisse, Aufsätze und Empfehlungsschreiben. Nicht an der Ellingham. Man musste einfach an die Tür klopfen. Auf eine ganz bestimmte, korrekte Art und Weise, über die einem niemand näher Auskunft gab. Man musste sich bloß melden – wo auch immer. Sie suchten nach dem gewissen Etwas. Und wenn sie das in einem sahen, hatte man die Chance, zu einem der fünfzig Schüler zu werden, die jedes Jahr aufgenommen wurden. Die Schule umfasste lediglich zwei Jahrgänge, die elfte und zwölfte Stufe der Highschool. Es gab keine Schulgebühren. Sobald man es einmal hineingeschafft hatte, war alles gratis.
Der Bus wechselte auf die rechte Spur und hielt an einem Rastplatz, an dem eine weitere Familie zustieg. Ein Mädchen und seine Eltern, die allesamt auf ihre Handys starrten. Das Mädchen war auffallend zierlich und hatte langes, dunkles Haar.
»Die hat aber schöne Haare«, bemerkte Stevies Mutter.
Obwohl sich die Äußerung scheinbar auf jemand anders bezog, war sie in Wirklichkeit ein Kommentar zu Stevies Haar, das diese sich im Frühjahr in einem Moment der Selbstfindung vor dem Badezimmerspiegel abgeschnitten hatte. Ihre Mutter war beim Anblick der blonden Strähnen im Waschbecken in Tränen ausgebrochen und hatte Stevie zwecks Schadensbegrenzung schnurstracks zum Friseur geschleift. Ihre Haare waren in den letzten Monaten ein großer Streitpunkt gewesen, was sogar so weit ging, dass Stevies Eltern ihr zur Strafe verbieten wollten, an die Ellingham zu gehen – aber am Ende hatten sie doch klein beigegeben. Ihre Mutter hatte sehr an Stevies langem Haar gehangen, was mit ein Grund dafür gewesen war, warum Stevie es loswerden wollte. Hauptsächlich jedoch hatte sie einfach gedacht, dass es kurz besser aussehen würde.
Was auch stimmte. Der Pixieschnitt stand ihr gut und war wunderbar pflegeleicht. Als sie sich die Haare färbte, gab es neue Probleme: erst pink, dann blau, dann pink und blau. Inzwischen waren sie wieder mittelblond, aber weiterhin kurz.
Das Gepäck des anderen Mädchens wurde in den Kofferraum des Busses geladen, dann stieg die Familie ein. Alle drei waren dunkelhaarig und wirkten klug, mit großen, von Brillen gerahmten Augen. Ein bisschen erinnerten sie an eine Eulenfamilie. Nach ein paar höflich gemurmelten Grüßen setzte sich das Mädchen mit seinen Eltern hinter die Bells. Stevie erkannte das Mädchen von den Fotos der neuen Schüler auf der Ellingham-Webseite wieder, konnte sich jedoch nicht an den Namen erinnern.
Ihre Mom stieß ihr den Ellenbogen in die Seite, was Stevie zu ignorieren versuchte. Das Mädchen guckte schon wieder auf sein Handy.
»Stevie.«
Stevie atmete langsam durch die Nase ein. Sie würde sich über ihre Mom hinweglehnen müssen, um mit dem Mädchen, das eine Reihe hinter ihnen auf der anderen Seite des Gangs saß, zu reden. Gar nicht peinlich. Aber ihr blieb wohl nichts anderes übrig.
»Hi«, sagte Stevie.
Das Mädchen sah hoch. »Hi?«
»Ich bin Stevie Bell.«
Das Mädchen blinzelte langsam, während es die Information abspeicherte. »Germaine Batt.«
Sonst sagte sie nichts. Überzeugt davon, genug Einsatz gezeigt zu haben, wollte Stevie sich gerade wieder zurücklehnen, als ihre Mom ihr den nächsten Stoß versetzte.
»Du musst dir Freunde suchen«, flüsterte sie.
Es gab wenige Wörter, die in Kombination gruseliger wirkten als Freunde und suchen. Dieser Befehl, sich mit jemandem anzufreunden, ließ Stevie kalte Schauder über den Rücken laufen. Sie sehnte sich nach einem Steinschlag. Denn sie wusste genau, was passieren würde, wenn sie keine Konversation machte. Dann würden ihre Eltern das übernehmen – und wenn ihre Eltern einmal damit anfingen, waren die Folgen nicht abzusehen.
»Wohnst du weit weg von hier?«, fragte Stevie.
»Nein«, antwortete Germaine und sah kurz von ihrem Handy hoch.
»Wir kommen aus Pittsburgh.«
»Ah«, sagte Germaine.
Stevie lehnte sich abermals zurück, warf ihrer Mutter einen Blick zu und zuckte mit den Schultern. Sie konnte Germaine schließlich nicht zwingen, sich mit ihr zu unterhalten. Ihre Mutter warf einen »Na ja, immerhin hast du es versucht«-Blick zurück. Bonuspunkte für ihren Einsatz.
Es ruckelte, als der Bus den Highway verließ und auf eine schmale, buckeligere Straße abbog, die von Läden und Farmen sowie Wegweisern zu Skigebieten, Glasbläsereien und Ahornsirupständen gesäumt war. Nach und nach verschwanden die Gebäude, bis draußen hauptsächlich Ackerland mit nichts als alten roten Pick-ups und dem einen oder anderen Pferd zu sehen war.
Es ging höher und höher, immer Richtung Wald.
Plötzlich bog der Bus scharf in eine Öffnung zwischen den Bäumen ein. Stevie wurde zur Seite gegen ihre Mutter geschleudert. Am Straßenrand erhaschte sie einen kurzen Blick auf ein niedriges braunes Schild mit goldener Schrift: der Eingang zur Ellingham Academy. Er war so unauffällig, dass man hätte meinen können, die Schule wolle lieber unentdeckt bleiben.
Die Straße war kaum mehr als Straße zu bezeichnen. Selbst von einem Feldweg zu sprechen wäre noch zu großzügig gewesen. Zuerst führte der Weg steil bergab, bis hinunter zu einem der Flüsse, die das Schulgelände begrenzten. Am tiefsten Punkt befand sich etwas, was man mit sehr viel Fantasie wohl eine Art Brücke nennen konnte, gebaut aus Holz, Seilen und guter Hoffnung. Die Geländer an den Seiten waren etwa kniehoch und die ganze Konstruktion sah aus, als würde sie keinem Windstoß standhalten.
Der Bus pflügte darüber. Die Brücke schaukelte heftig und brachte Stevies Sitz zum Beben.
Anschließend ging es wieder bergauf, in einem Winkel, der normalerweise Skiliften und startenden Flugzeugen vorbehalten war. Nichts würde diesen Bus aufhalten. Der Schatten der Bäume tauchte den Pfad in Dämmerlicht. Zweige kratzten an der Karosserie wie Hunderte Fingernägel. Der Motor ächzte, während der Bus sich den nun immer schmaler werdenden Weg hochkämpfte. Stevie wusste, dass sie keinen Grund zur Sorge hatte. Es war unwahrscheinlich, dass er ausgerechnet auf dieser Fahrt, mit ihr und ihren Eltern an Bord, kapitulieren und rückwärts den Berg hinunterrasen würde, blind und wild und ungebremst in Richtung des Flusses und eines süßen, kalten, schäumenden Todes … aber man konnte nie wissen.
Langsam ließ die Steigung nach, die Bäume wichen einem ebeneren Pfad und gaben schließlich den Blick auf grüne Rasenflächen frei. Der Bus näherte sich einem Tor, das von zwei Statuen auf Sockeln bewacht wurde – geflügelten Kreaturen mit lächelnden Gesichtern und blicklosen Augen, Schwänzen und vier Pfoten.
»Was für merkwürdige Engel«, bemerkte ihre Mutter und reckte den Hals.
»Das sind keine Engel«, entgegnete Stevie. »Sondern Sphinxe. Das sind mythische Wesen, die einem ein Rätsel stellen, bevor man einen Ort betreten darf. Wenn man es falsch löst, fressen sie einen. Wie in der Ödipus-Sage. Das Rätsel der Sphinx. Das da sind Sphinxe.«
Wieder bedachte ihre Mutter sie mit einem typischen Blick. Wir haben uns eine Tochter gewünscht, die gerne ausgeht, mit ihren Freundinnen Shoppingbummel unternimmt und auf den Abschlussball hinfiebert, und stattdessen haben wir dieses seltsame, etwas unheimliche Exemplar bekommen – gut, wir lieben es trotzdem, aber wovon redet es da bloß schon wieder?
Manchmal taten Stevie ihre Eltern leid. Ihre Vorstellung von interessant war so jämmerlich beschränkt. Sie waren schlicht nicht in der Lage dazu, so viel Spaß zu haben wie sie.
Germaine spähte mit großen, schimmernden Augen zu ihr herüber. Ihre Miene war so undurchdringlich wie die der Sphinxe.
Plötzlich befielen Stevie Zweifel. Es konnte doch nicht sein, dass sie tatsächlich hier angenommen worden war. Der Brief musste an der falschen Adresse, bei der falschen Stevie gelandet sein. Das alles war eine Verwechslung, ein Witz, ein kosmischer Irrtum. Nichts davon konnte real sein.
Aber jetzt war es zu spät, selbst wenn sich all ihre Befürchtungen bewahrheiten sollten. Sie hatten die Ellingham Academy erreicht.
2 – Als Erstes fiel …
2
Als Erstes fiel Stevies Blick auf die kreisförmige Rasenfläche mit dem Springbrunnen in der Mitte. Im herabregnenden Wasser stand eine Neptun-Statue, die jeden Neuankömmling zu begrüßen schien. Das Rondell war von einem Baumgürtel umschlossen, durch dessen Lücken Teile einer Backsteinfassade lugten. Am gegenüberliegenden Ende thronte wie der Gastgeber des Ganzen das Haupthaus – eine herrschaftliche Villa in exzentrisch-gotischem Stil, mit Dutzenden von Lanzettfenstern, einem von vier Spitzbögen gerahmten Portal und vielen kleinen Türmchen.
Stevie verschlug es für einen Moment die Sprache. Sie hatte schon unzählige Fotos des Ellingham-Anwesens gesehen, kannte die Gebäude aus jedem Winkel, bis hin zu den Grundrissen. Doch jetzt tatsächlich hier zu sein, in der frischen, dünnen Bergluft, mit dem Plätschern des Neptunbrunnens im Ohr und der Sonne im Gesicht … ihr wurde beinahe schwindelig.
Der Fahrer hievte Stevies Gepäck aus dem Kofferraum des Busses, inklusive dreier Taschen voller Lebensmittel, ohne die ihre Eltern sie nicht hätten gehen lassen. Sie waren peinlich schwer, vollgestopft mit Erdnussbutter-Jumbobechern, Instant-Eistee und Unmengen Duschgel, Kosmetikartikeln und anderem Kram, der gerade im Angebot gewesen war.
»Sollten wir ihm ein Trinkgeld geben?«, fragte ihre Mutter leise, als alles ausgeladen war.
»Nein«, antwortete Stevie voller Überzeugung, obwohl sie keine Ahnung hatte, ob man dem Schulbusfahrer Trinkgeld gab oder nicht. Dazu war ihr während ihrer Recherchen nichts begegnet.
»Alles okay?«, fragte ihr Dad.
»Klar«, antwortete sie und stützte sich Halt suchend auf ihren Koffer. »Es ist einfach … so schön hier.«
»Es hat was«, pflichtete er ihr bei. »Das kann man nicht abstreiten.«
Ein großer Golfwagen fuhr um das Rondell und hielt neben ihnen. Ein Mann begrüßte sie. Er war jünger als der Busfahrer, vielleicht Mitte dreißig, ein kerniger, muskulöser Typ in abgewetzten Cargoshorts und einem Ellingham-Poloshirt. Genau die Art von glatter Persönlichkeit, in deren Gegenwart ihre Eltern sich, wie Stevie wusste, entspannten, also entspannte sie sich auch.
»Stephanie Bell?«, fragte er.
»Stevie«, korrigierte sie.
»Ich bin Mark Parsons«, stellte er sich vor. »Grundstücksverwalter. Du bist in Haus Minerva. Schönes Haus.«
Die Bells wurden mitsamt Stevies Gepäck auf den Golfwagen verfrachtet. Germaine und ihre Familie stiegen in einen weiteren, der kurz darauf in die entgegengesetzte Richtung davonfuhr.
»Nach Minerva wollen alle«, fügte Mark hinzu, als sie außer Hörweite waren. »Das ist das beste Haus.«
Das Gelände war voller gepflasterter Pfade, die sich durch die Baumgruppen schlängelten. Eine Weile fuhren sie im Schatten der mächtigen Bäume dahin und Stevie und ihre Eltern betrachteten sprachlos vor Staunen die Schulgebäude. Es gab große, stattliche, aus Stein und roten Ziegeln mit gotischen Bögen und Türmchen, die ihnen etwas von ihrer Strenge nahmen. Manche waren imposant in ihrer Schlichtheit, während andere so dick in Efeu eingeschnürt waren, dass sie wie Geschenke an einen Waldgott aussahen. Das hier hatte nichts mit Stevies vorheriger Highschool gemein. Das hier wirkte tatsächlich wie eine Wiege des Wissens.
Griechische und römische Statuen aus kaltem weißen Marmor standen hinter Bäumen versteckt oder einsam in der Mitte von Lichtungen.
»Da hat aber jemand das Gartencenter geplündert«, kommentierte ihr Dad.
»Nein, nein«, entgegnete Mark, während er den Wagen an einer Gruppe von Steinköpfen vorbeilenkte, deren Mienen trotz der leeren Augen konzentriert und entschlossen wirkten, wodurch sie an ein Komitee vor einer wichtigen Entscheidung erinnerten. »Die sind alle echt. Hier steht ein ganzes Vermögen in Form von Statuen rum.«
Für Stevies Geschmack waren es beinahe schon zu viele. Irgendjemand hätte Albert Ellingham mal beiseitenehmen und ihm klarmachen sollen, dass er einen Gang runterschalten sollte. Aber wenn man reich und berühmt genug ist, dachte Stevie, kann man mit seiner einsamen Bergresidenz wahrscheinlich machen, was man will.
Der Golfwagen hielt vor einem niedrigen, ehrwürdigen Haus aus rotem und goldfarbenem Backstein. Es schien aus mehreren Teilen zu bestehen – der rechte, größere, Flügel fing wie ein normales Wohnhaus an, verlängerte sich jedoch nach links zu einer Art Anbau, der von einem Turm gekrönt wurde. Das gesamte Gebäude war von einem Mantel aus wildem Wein überwuchert, der teilweise die Flachrelief-Gesichter direkt unterhalb der Dachkante und oberhalb der Fenster verdeckte. Die Tür war leuchtend blau angestrichen und stand sperrangelweit offen, wie um frische Luft und Fliegen gleichermaßen willkommen zu heißen.
Stevie und ihre Eltern betraten eine Art Gemeinschaftsraum. Der Boden war aus Stein und um den ausladenden Kamin waren Schaukelstühle gruppiert. Drinnen war es kühl und schummrig und roch nach Holz und verloschenen Feuern. Die rote Textiltapete wirkte etwas beengend und an der Wand hing ein Elchschädel, um dessen Geweih eine Lichterkette geschlungen war. Es gab einen Hängesessel vor dem Kamin, zahlreiche Sitzkissen auf dem Boden, ein durchgesessenes, aber extrem gemütlich aussehendes dunkelrotes Sofa und einen massiven Holztisch, der den größten Teil des Raums einnahm. Auf dem Tisch stand ein Angelkasten und darum verstreut lag etwas, was an Perlen oder anderes Bastelmaterial erinnerte. Neben der Tür ragten acht große Holzstifte aus der Wand, jeder etwa zwanzig Zentimeter lang und damit zu groß für Kleiderhaken. Stevie strich mit dem Zeigefinger über einen davon, wie um zu fragen: Wozu seid ihr denn gut?
»Hallo!«
Stevie drehte sich um und sah eine Frau mit einem Kaffeebecher in der Hand aus dem kleinen Küchenbereich auf sie zukommen. Ihr Kopf war bis auf wenige Millimeter rotblonden Flaums kahl geschoren und sie war von zierlicher Statur, wenn auch gleichzeitig muskulös und braun gebrannt. Ihre Arme waren komplett mit eleganten Blumentattoos bedeckt. Sie trug ein locker sitzendes T-Shirt mit der Aufschrift »Keep Calm and Carry on Digging« und dazu Shorts, unter denen ein Paar kräftige, unrasierte Beine zum Vorschein kam.
»Stephanie?«, fragte die Frau.
»Stevie«, korrigierte Stevie wieder.
»Dr. Nell Pixwell«, stellte die Frau sich vor und reichte ihnen nacheinander die Hand. »Aber alle nennen mich nur Pix. Ich bin die Hauslehrerin hier in Minerva.«
Stevie warf einen genaueren Blick auf die Sachen neben dem Angelkasten. Jetzt erkannte sie, dass es gar keine Bastelutensilien waren – sondern Zähne. Unmengen von Zähnen. Über den ganzen Tisch verteilt. Stevie konnte nicht sagen, ob sie echt waren oder nicht, und sie war sich auch nicht sicher, ob es eine Rolle spielte. Ein Tisch voller Zähne war ein Tisch voller Zähne.
»Sind Sie gut hergekommen?«, erkundigte sich Pix, die rasch die Zähne in die Fächer der Kiste sortierte. (Klick machte ein Zahn auf dem Kunststoff. Klick.) »Entschuldigung, ich war gerade noch mit etwas beschäftigt. Sie sind mit Abstand die Ersten …« (Klick machte ein Backenzahn.) »Kann ich jemandem einen Kaffee anbieten?«
Sie führte die Bells in die winzige Küche, wo sie alle mit Kaffeebechern versorgte und Stevies Eltern den Ablauf der Mahlzeiten erklärte. Das Frühstück fand in den Wohnhäusern statt, während alle anderen Mahlzeiten im großen Speisesaal eingenommen wurden. Abgesehen davon konnten die Schüler jederzeit herkommen, um sich selbst Essen zu machen, und es gab einen Online-Lebensmittelversand. Als sie zurück in den Gemeinschaftsraum gingen, schien Stevies Mutter beschlossen zu haben, nicht länger um den heißen Brei herumzureden.
»Sind das da Zähne?«, fragte sie.
»Ja«, sagte Pix.
Da es nicht so schien, als hätte sie vor, ihre Antwort auszuführen, mischte Stevie sich ein. »Dr. Pixwell ist Spezialistin für Bioarchäologie«, erklärte sie. »Sie ist oft zu Ausgrabungen in Ägypten.«
»Stimmt«, sagte Pix. »Hast du meinen Lebenslauf auf der Schulwebseite gelesen?«
»Nein«, erwiderte Stevie. »Die Zähne, Ihr T-Shirt, Sie haben ein Horusauge aufs Handgelenk tätowiert, die Kamillenteepackung in der Küche hat ein arabisches Etikett und Sie haben einen Bräunungsrand auf der Stirn, der vermutlich von einer Kopfbedeckung stammt. War nur mal so geraten.«
»Ganz schön beeindruckend.« Pix nickte anerkennend. Eine Weile sagte niemand etwas. Eine Fliege summte um Stevies Kopf herum.
»Stevie hält sich für Sherlock Holmes«, verkündete ihr Vater schließlich. Er machte gern solche Bemerkungen, die auf den ersten Blick wie Witze klangen und womöglich auf irgendeine Art auch nett gemeint waren, aber gleichzeitig einen Hauch von Missgunst erahnen ließen.
»Wer wäre nicht gern Sherlock Holmes?«, entgegnete Pix und sah ihm lächelnd in die Augen. »Ich habe mehr Agatha Christie gelesen, als ich noch jünger war, weil sie viel über Archäologie geschrieben hat. Aber jeder liebt doch Sherlock. Wie wär’s mit einem kleinen Rundgang?«
Und in diesem Moment, mit dieser einen Antwort, hatte Pix Stevies immerwährende Loyalität gewonnen.
Die sechs Schülerzimmer lagen links vom Minerva-Gemeinschaftsraum: drei im unteren Flur, drei im oberen. Im ersten Stock gab es ein gemeinsames Bad, dessen Wandfliesen noch original aus dem Baujahr stammen mussten, weil heute niemand mehr irgendetwas in dieser Farbe herstellte. Wenn Stevie ihr einen Namen hätte geben müssen, hätte sie sie als »grantiger Lachs« bezeichnet.
Am Ende des Flurs führte eine große Tür in den Turm.
»Das hier ist etwas speziell«, erklärte Pix, als sie darauf zuging. »Minerva hat den Ellinghams anfangs als Gästehaus gedient, darum gibt es ein paar Besonderheiten, die es von den anderen Schülerunterkünften unterscheidet …«
Sie öffnete die Tür, hinter der ein prunkvolles Badezimmer lag, rund und mit hoher Decke. Der Fußboden war mit schimmernden silbergrauen Kacheln gefliest. Genau in der Mitte stand eine große, klauenfüßige Badewanne. Zwei hohe Buntglasfenster, die stilisierte Blumen und Ranken zeigten, tauchten den Raum in regenbogenbuntes Licht.
»Dieses Zimmer ist besonders in Prüfungsphasen beliebt«, sagte Pix. »Die Schüler lernen gern in der Badewanne, vor allem, wenn es kalt ist. Ansonsten wird es kaum genutzt, weil es leider ein kleines Spinnenproblem gibt. Gut, dann zeige ich dir jetzt am besten mal, wo du schläfst, Stevie.«
Stevie beschloss, die Spinneninfo schnell zu verdrängen, und folgte Pix zu ihrem neuen Zimmer, Minerva Zwei. Minerva Zwei roch nach ungelüftetem Raum, frischer Farbe und Möbelpolitur. Jemand hatte eins der beiden Schiebefenster geöffnet, die zur Vorderseite des Gebäudes hinausgingen, doch es bewegte sich kaum ein Lüftchen. Die Wände waren cremefarben gestrichen und auf einer Seite hob sich ein schwarzer Kamin von dem hellen Hintergrund ab.
Während sie alle zusammen Stevies Sachen ins Zimmer brachten, drehte sich das Gespräch um Themen wie den besten Standort für das Bett, ob wohl jemand zum Fenster hereinklettern konnte und ab wie viel Uhr herrschte abends noch mal Ausgangssperre? Pix beantwortete geduldig alle Fragen (die Fenster ließen sich nur von innen öffnen und waren zudem mit Schlössern gesichert und die Ausgangssperre begann an Wochentagen abends um zehn und am Wochenende um elf, was alles elektronisch mittels Chipkarten und von Pix persönlich kontrolliert wurde).
Ihre Mutter wollte gerade anfangen, Stevies Taschen auszupacken, als Pix ihre Eltern zu einem Rundgang über das Schulgelände einlud und Stevie damit einen Moment Ruhe verschaffte. Draußen zwitscherten die Vögel und die sachte Brise trug hin und wieder ferne Stimmen ins Zimmer. Minerva Zwei gab ein gedämpftes Knarren von sich, als Stevie durch den Raum ging. Sie strich mit den Fingerspitzen über die Wände und ertastete ihre seltsame Textur – sie waren mit unzähligen Lagen Farbe überzogen, von denen jede einzelne die Spuren der vorherigen Bewohner verdeckte. Stevie hatte erst vor Kurzem in einer Dokumentation gesehen, wie Kriminalermittler einzelne Farbschichten von einer Wand abgeschält hatten, bis darunter eine jahrzehntealte Inschrift zum Vorschein kam. Seitdem brannte sie darauf, irgendwann einmal selbst eine Wand mit einem Dampfstrahler zu bearbeiten, um zu sehen, ob sich unter dem Anstrich etwas verbarg.
Diese Wände hatten vermutlich jede Menge Geschichten zu erzählen.
13. April 1936, 18:45 Uhr
Der Nebel war an diesem Tag überraschend aufgezogen – morgens war es noch klar und sonnig gewesen, doch um kurz nach sechzehn Uhr hatte sich plötzlich ein Schleier aus blaugrauem Dunst über das Land gelegt. Das war es, woran sich die meisten Leute später erinnerten: den Nebel. Als schließlich der Abend hereinbrach, war alles in schimmerndes Dämmerlicht gehüllt und man konnte kaum mehr als ein paar Meter weit sehen. In dieser dicken Suppe bewegte sich der Rolls-Royce Phantom langsam die tückische Zufahrt hinauf und kam in dem Rondell auf halbem Weg zur Villa zum Stehen. Der Wagen hielt immer an dieser Stelle. Albert Ellingham ging gern das letzte Stück zu Fuß und ließ den Blick über sein kleines Bergkönigreich schweifen. Er öffnete die hintere Tür, bevor das Auto ganz zum Stehen gekommen war. Sein Sekretär, Robert Mackenzie, wartete ein paar Sekunden ab, bevor er ebenfalls ausstieg.
»Sie müssen nach Philadelphia«, sagte Robert zu Ellinghams Rücken.
»Niemand muss nach Philadelphia, Robert.«
»Sie müssen. Und außerdem sollten wir mindestens zwei Tage für das New Yorker Büro einplanen.«
Die letzte Busladung Männer, die mit den finalen Bauarbeiten beschäftigt waren, fuhr an ihnen vorbei, auf dem Weg zurück nach Burlington und in die vielen umliegenden Dörfer. Der Bus wurde kurz langsamer, um den Insassen Gelegenheit zu geben, ihrem Arbeitgeber zu winken.
»Gute Arbeit!«, rief Albert Ellingham ihnen zu. »Bis morgen!«
Kurz bevor sie die Villa erreichten, öffnete der Butler die Tür und die beiden Männer betraten die herrschaftliche Eingangshalle. Jedes Mal wenn Ellingham nach Hause kam, freute er sich über das Spiel des Lichts, das von einem Stück Kristall zum anderen sprang, eingefärbt von bunten Jugendstilfenstern im Wert eines wohlangelegten Vermögens.
»Abend, Montgomery«, sagte Ellingham. Seine dröhnende Stimme hallte in der offenen Halle wider.
»Guten Abend, Sir«, erwiderte der Butler, bereit, die Hüte und Mäntel der Männer entgegenzunehmen. »Guten Abend, Mr Mackenzie. Ich hoffe, die Autofahrt war nicht zu mühsam in diesem Nebel.«
»Hat eine Ewigkeit gedauert«, antwortete Ellingham. »Und Robert hat mir die ganze Fahrt über mit seinen Terminen in den Ohren gelegen.«
»Bitte sagen Sie Mr Ellingham, dass er nach Philadelphia muss«, wandte sich Robert an den Butler, während er ihm seinen Hut reichte.
»Mr Mackenzie hat mich gebeten, Ihnen zu übermitteln –«
»Ich habe einen Mordshunger, Montgomery«, seufzte Ellingham. »Was ist für heute Abend vorgesehen?«
»Als Vorspeise Selleriecremesuppe, Sir, dann Seezungenfilet in Sauce Amandine, gefolgt von Hammelbraten mit Erbsenpüree, Spargel à la Hollandaise und Kartoffeln Lyoner Art und zum Dessert ein kaltes Zitronensoufflé.«
»Klingt doch ganz passabel. Bitte so bald wie möglich, ich habe richtig Appetit. Wie viele Kostgänger sind noch hier?«
»Miss Robinson und Mr Nair, obwohl die beiden schon den ganzen Tag unpässlich waren, darum denke ich, die Runde wird sich auf Mrs Ellingham, Mr Mackenzie und Sie selbst beschränken, Sir.«
»Gut. Dann holen Sie sie her. Essen wir.«
»Mrs Ellingham ist noch nicht wieder zu Hause, Sir. Sie und Miss Alice sind heute Mittag zu einem Ausflug mit dem Auto aufgebrochen.«
»Und sie sind noch nicht wieder zurück?«
»Ich nehme an, dass der Nebel sie aufgehalten hat, Sir.«
»Schicken Sie ein paar Männer mit Lampen zum Ende der Zufahrt, damit sie ihr den Weg leuchten. Und sagen Sie ihr, sobald sie zurück ist, dass es Abendessen gibt. Lassen Sie sie nicht mal den Mantel ablegen, sondern führen Sie sie direkt ins Speisezimmer.«
»Sehr wohl, Sir.«
»Kommen Sie, Robert«, wandte Ellingham sich dann an seinen Sekretär und marschierte los. »Wir gehen so lange in mein Arbeitszimmer und spielen Karten. Und sparen Sie sich den Protest. Es gibt nichts Ernsteres im Leben als ein Spiel.«
Der Sekretär reagierte mit professionellem Schweigen. Spiele waren ein nicht verhandelbarer Teil seines Arbeitsvertrags und »Es gibt nichts Ernsteres im Leben als ein Spiel« war eine von Ellinghams vielen Parolen. Darum hatten die Schüler unbeschränkten Zugang zu Brettspielen und das ganz neue Monopoly war verpflichtend für Schüler, Gäste und Personal. Jeder musste mindestens eine Partie pro Woche spielen und seit Neustem wurden sogar monatliche Turniere abgehalten. So lebte es sich in der Welt von Albert Ellingham.
Robert nahm die aktuelle Post vom Tablett und ging mit geübtem Blick den Stapel durch. Einige Briefe legte er direkt zurück, den Rest klemmte er sich unter den Arm.
»Philadelphia«, sagte er abermals. Es war nun mal seine Aufgabe, den großen Albert Ellingham auf Kurs zu halten. Und Robert war gut in seinem Job.
»Na schön, na schön. Setzen Sie den Termin fest. Ah …« Ellingham nahm ein Telegramm von seinem Schreibtisch. Die Rückseiten dieser Zettelchen benutzte er am liebsten für seine Notizen. »Ich habe heute Morgen mit einem neuen Rätsel angefangen. Sagen Sie mir, was Sie davon halten.«
»Lautet die Lösung ›Philadelphia‹?«
»Robert«, entgegnete Ellingham streng. »Mein Rätsel. Diesmal ist es wirklich gut, finde ich. Hören Sie: Was dient auf zwei Seiten zugleich und macht Verstecken leicht? Es kann vor Blicken schützen, doch ebenso dem Feinde nützen? Na? Was denken Sie?«
Robert ließ seufzend den Poststapel sinken, um nachzudenken. »Dient auf zwei Seiten zugleich«, murmelte er. »Ein Doppelagent. Ein Verräter. Der einen dem Feind ausliefert.«
Ellingham lächelte und bedeutete seinem Sekretär weiterzuraten.
»Aber«, fuhr Robert fort, »es ist ja kein Jemand. Sondern ein Etwas. Also ein Gegenstand, der einem Schutz bieten kann …«
Es klopfte an der Tür und Ellingham eilte selbst hin.
»Es ist eine Tür!«, rief er dann, während er selbige öffnete, hinter der sein aschfahler Butler zum Vorschein kam. »Eine Tür!«
»Sir …«, begann Montgomery.
»Einen Moment. Verstehen Sie, Robert? Eine Tür kann von beiden Seiten benutzt werden …«
»Sie kann einem Schutz bieten, aber auch anderen verraten, wohin man gegangen ist«, sagte Robert. »Verstehe. Ja …«
»Sir!« Montgomerys ungewohnt drängender Tonfall ließ die beiden Männer aufhorchen.
»Was gibt es denn, Montgomery?«, fragte Ellingham.
»Sie haben einen Anruf, Sir«, antwortete Montgomery. »Sie müssen sofort mitkommen. Ans Personaltelefon. Im Hauswirtschaftsraum. Bitte, Sir, Sie müssen sich beeilen.«
Das alles war so untypisch für Montgomery, dass Ellingham ohne ein weiteres Wort gehorchte. Er folgte dem Butler und nahm den Telefonhörer entgegen.
»Wir haben Ihre Frau und Ihre Tochter«, sagte eine Stimme.
3 – Stevie Bell hatte …
3
Stevie Bell hatte einen einzigen bescheidenen Wunsch: Sie wollte einmal in ihrem Leben eine Leiche finden.
Natürlich wollte sie niemanden ermorden – nichts lag ihr ferner. Sie wollte lediglich diejenige sein, die herausfand, wie die Leiche zu einer geworden war. Sie wollte Plastikbeutel mit der Aufschrift »Beweismittel« und einen von diesen Papier-Overalls, wie die Leute von der Spurensicherung sie trugen. Sie wollte in einem Vernehmungsraum sitzen. Sie wollte einen echten Kriminalfall aufklären.
Was alles schön und gut war und vermutlich etwas, wovon eine Menge Leute träumten, wenn sie es denn zugeben würden. Aber an ihrer alten Highschool hatte sie nie das Gefühl gehabt, diesen Wunsch aussprechen zu dürfen. Ihre alte Highschool war okay gewesen – für eine Highschool. Sie war keine schlechte Schule gewesen, kein feindseliges Umfeld. Sondern genauso, wie man sich eine Highschool vorstellte: Linoleumflure und summende Leuchtstoffröhren, warmer Cafeteria-Mief zu früh am Morgen, seltene Sternstunden, im Keim erstickt von endloser Langeweile, alles überlagert von der permanenten Sehnsucht, woanders zu sein. Und obwohl Stevie an ihrer Schule Freunde gehabt hatte, konnten auch die ihre Liebe zur Kriminologie nie wirklich nachvollziehen. Also hatte sie einen leidenschaftlichen Aufsatz geschrieben, ihr Innerstes in die Tastatur gehämmert, und das Ganze mehr oder weniger im Scherz abgeschickt. Nie im Leben würde sie an der Ellingham angenommen werden.
Doch der Ellingham gefiel ihr Aufsatz. Und jetzt saß Stevie in diesem Zimmer.
Die Möbel waren aus Holz und überraschend groß. Es gab eine breite Kommode, die bei der kleinsten Berührung wackelte, und selbst die Politur konnte die vielen Kratzer auf der Oberfläche nicht verbergen. Teils waren es bloß die üblichen Gebrauchsspuren, andere dagegen bildeten klar erkennbare Wörter oder Initialen. Stevie zog die Schubladen auf und zu ihrem Erstaunen lag bereits etwas darin: eine karierte Flanelldecke, eine dicke Fleecejacke mit dem Wappen der Ellingham Academy auf der Brust, eine militärisch anmutende Taschenlampe mit einer neuen Packung Batterien, ein blauer Bademantel und etwas, das an zwei Tennisschläger mit seltsamen Schnallen erinnerte. Letztere musste Stevie aus der Schublade nehmen und eine Weile genauer untersuchen, bevor sie zu dem Schluss kam, dass es sich vermutlich um Schneeschuhe handelte und die seltsamen Wandzapfen im Gemeinschaftsraum die dazugehörigen Aufhängemöglichkeiten waren.
Stevie war klar gewesen, dass es in Vermont im Winter kalt wurde, aber diese Dinger schienen eher auf einen Survivaltrip hinzudeuten.
Sie fing an, ihre Koffer und Taschen zu öffnen. Als Erstes zog sie ihr altes graues Bettzeug heraus, die gestreifte Tagesdecke, die sie hatte, seit sie zehn war, und zwei von den nicht ganz so schlimm vergilbten Kissen aus dem Wandschrank. In der hellen Vermont-Sonne betrachtet, erschienen ihr die Sachen plötzlich ganz schön – trist. Natürlich hatte sie auch ein paar neue Errungenschaften dabei, wie zum Beispiel den empfohlenen tragbaren Duschkorb und die Flipflops fürs Badezimmer, aber die machten ihr Zimmer auch nicht unbedingt gemütlicher.
Egal. In ihrer Fantasie würde ihr Zimmer so oder so wie Sherlock Holmes’ Wohnung in der Baker Street aussehen – ein bisschen schäbig, aber dennoch elegant.
Sie griff nach ihren Ohrhörern, um endlich ihren Podcast weiterzuhören. Der aktuelle handelte von H. H. Holmes, dem Chicagoer Serienkiller: »… entdeckte man die vielen Räume in Holmes’ Horrorhotel: die Gaskammer, das Galgenzimmer, den schalldichten Folterkeller …«
Eine ihrer Umzugskisten hatte Stevie mit Sternchen markiert und diese öffnete sie nun. Sie enthielt ihre Lebensgrundlage: ihre Detektivromane. (Oder zumindest eine mit größter Sorgfalt erstellte Auswahl.) Stevie räumte die paar Dutzend Bücher in genau der Reihenfolge ins Regal, in der sie sie sehen musste.
»… bis hin zu der Rutsche, die direkt ins Krematorium im Keller führte, wo er die Leichen …«
Ganz nach oben kamen Sherlock Holmes und Wilkie Collins. Die nächsten beiden Regalbretter nahm Agatha Christie ein, gefolgt von Josephine Tey und Dorothy L. Sayers. Stevie arbeitete sich weiter vor bis zu den aktuellen Autoren und schließlich ihren Büchern über Forensik und Kriminalpsychologie. Dann trat sie einen Schritt zurück, um ihr Werk zu begutachten, und sortierte noch ein wenig vor sich hin, bis alles perfekt war. Wo ihre Bücher waren, da war auch sie.
Wenn erst mal die Bücher ihren Platz hatten, würde alles andere schon folgen. Jetzt konnte sie den Rest des Zimmers in Angriff nehmen.
»… Säure, ein Giftarsenal, eine Streckbank …«
Über alltägliche Notwendigkeiten wie zum Beispiel Kleidung machte Stevie sich weniger Gedanken. Sie interessierte sich nicht für Klamotten und hatte sowieso nie viel Geld übrig, um sich welche zu kaufen, darum beschränkte sich ihre Garderobe größtenteils auf Jeans und schlichte T-Shirts. Das Einzige, was sie sich wünschte, war ein grober Seemannspullover, weil der Detektiv ihrer Lieblings-Skandinavienkrimis immer einen trug. Und sie bevorzugte eine stabile Umhängetasche, ganz ähnlich wie die ihrer liebsten britischen TV-Ermittlerin.
Ein Kleidungsstück jedoch liebte sie über alles: einen roten Lackregenmantel, original aus den Siebzigern, den sie ganz hinten im Kleiderschrank ihrer Großmutter gefunden hatte. Er passte Stevie wie angegossen und sie hatte ihn mit Buttons von ihren Lieblingsbands, – podcasts und – büchern verziert. Der Mantel hatte tiefe Taschen und einen breiten Gürtel, und wenn sie ihn trug, fühlte sie sich stark, für alles gewappnet – und extrem gut vor Regen geschützt. Selbst ihre Mutter hatte der Regenmantel überzeugt. (»Endlich mal ein bisschen Farbe.«)
Stevie hängte den Mantel in den Schrank. Als sie die Tür geschlossen hatte und sich umdrehte, sah sie den Zombie.
Stevie hatte schon oft gelesen, dass Schauspieler in Wirklichkeit noch viel umwerfender aussahen als auf dem Bildschirm. Genau das traf auf den Typen zu, der jetzt in Stevies Zimmertür stand. Er trug ein weißes Leinenhemd zu leuchtend blauen Shorts und sah aus wie eine wandelnde Abercrombie-&-Fitch-Werbeanzeige.