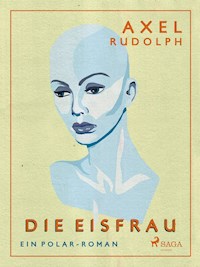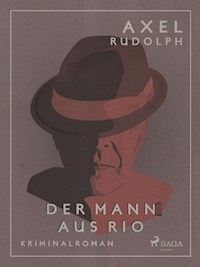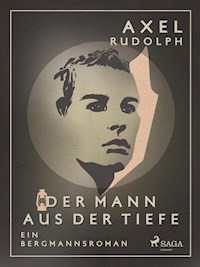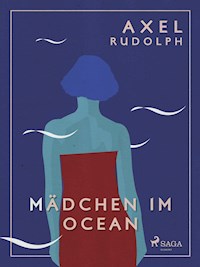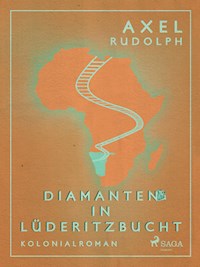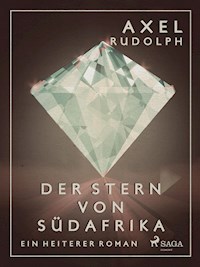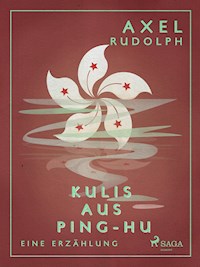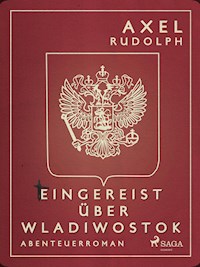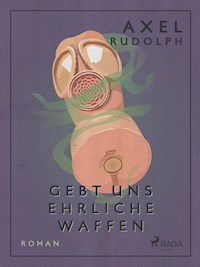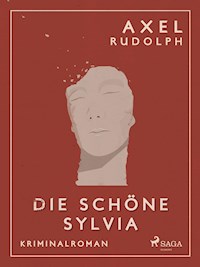
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein mitreißendes Gegenüberstellen von Intrigen und Gefühlen!Die erfolgreiche Bildhauerin Valerie Gauda hat sich die letzten Wochen nur in ihrem Atelier eingeschlossen, jedoch nicht nur für ihre Arbeit, sondern auch mit Gerhard Lenneberg. Doch die Beziehung zwischen den beiden birgt viele Unsicherheiten für Valerie, die sie aus dem Weg räumen möchte. Ähnlich geht es ihren beiden Töchtern Sylvia und Helen. Sylvia muss eine Lösung für ihre Schulden finden und verwickelt sich bei diesem Vorhaben in einem Konflikt, bei dem ebenfalls diverse Männer eine Rolle spielen. Und dabei verletzt sie auch noch ungewollt die Gefühle ihre Schwester. Sie alle müssen lernen sich für ihre Liebe und das was sie wollen einzusetzen und begeben sich dabei in gefährliche Machenschaften!-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Axel Rudolph
Die schöne Sylvia
Kriminalroman
SAGA Egmont
Die schöne Sylvia - Kriminalroman
Copyright © 1937, 2018 Axel Rudolph und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711445266
1. Ebook-Auflage, 2018
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
1.
Gerhard Lennebergs breite Hand fährt verhalten liebkosend und leicht über das glatt gescheitelte Frauenhaar. Valerie Gauda aber starrt noch immer selbstvergessen auf die Marmordoppelbüste, vor der sie stehen. Ist das wirklich wahr, daß sie dieses Bildwerk mit ihren Händen geschaffen hat? Sind diese beiden wundervollen Mädchenköpfe dort wirklich und wahrhaftig ihr Werk, ein in Stein gemeißeltes Stück ihrer Seele ?
„Ich kann es noch nicht fassen, Gerhard. Professor Nefgen war heute vormittag hier. Weißt du, was er sagte? Es sei …“
„Ein Meisterwerk!“ Gerhard Lenneberg nickt. „Das sagte er auch zu mir. Ich traf ihn vorhin.“
„Auch zu dir hat er das gesagt!“ Valerie Gaudas Augen glänzen erregt. Sie freut sich über dieses Wort des berühmten Bildhauers, das so ehrenvoll ist, daß sie selbst es nicht laut auszusprechen wagt. Lenneberg findet, daß sie sehr überarbeitet aussieht, und nimmt sanft ihre Hand.
„Er sagte noch mehr.“
„Was?“ Die Künstlerin ist begierig, das Urteil eines Berufenen zu hören. „Was hat er noch gesagt?“
„Er zitierte Goethe: Ihr werdet nie von Herz zu Herzen sprechen, wenn es euch nicht von Herzen geht!“
Die Tür des Ateliers knarrt. Frau Valerie wendet langsam, den Blick von dem Marmorbild zur Tür. Aber sie sieht das gleiche Bild, nur daß die steinernen Züge Farbe und Bewegung bekommen haben und zwei lebendige Mädchenköpfe sind, die ihr entgegenlachen.
„Sie sollten Mutter endlich dazu überreden, sich hinzulegen, Herr Lenneberg! Sie treibt ja Raubbau an ihrer Gesundheit!“ — Das ist Sylvia Gauda, die ältere, einundzwanzig Jahre alt, hellblond, schön und strahlend wie ein Frühlingstag. Helen, die Zwanzigjährige, ein wenig eckig, lang aufgeschossen und schmal, ist vor der Marmorbüste stehengeblieben. Auf ihrem feinen, nachdenklichen Gesicht liegt ein stiller Ernst.
„Ich glaube, es ist beste Arbeit, Mutter!“
„Ja, geradezu unglaublich, wie sie das gemacht hat!“ schwatzt Sylvia fröhlich. „Ohne Sitzung, Herr Lenneberg, denken Sie nur, ohne eine einzige Sitzung hat Mutter das geschaffen! Diese gottbegnadete Künstlerin läßt sich einfach eines Tages einen Marmorblock kommen, schließt sich ein und meißelt munter drauf los! Wenn wir anklopfen, dreht sie vor unserer Nase einfach den Schlüssel herum. Und dann — gestern abend — wankt sie auf einmal ins Eßzimmer und sagt nur: ‚Ich bin fertig!‘“
„Du mußt jetzt ruhen, Valerie.“ Lenneberg schiebt seine Hand unter den Arm der am Fenstersims lehnenden Frau und führt sie aus dem Atelier. Im Hinausgehen wendet Valerie Gauda sich um und blickt noch einmal nach der Marmorbüste. Ihre Lippen formen lautlos und ungläubig ein Wort: „Meisterwerk?“
„Mutter hat sich diesmal wirklich selbst übertroffen.“ Sylvia tänzelt um die Büste herum und betrachtet sie kritisch von allen Seiten. „Geschmeichelt hat sie uns zwar nicht gerade dargestellt. Kann man nicht sagen. Wenigstens mich nicht! Was meinst du, Helen? Seh’ ich wirklich so aus? So, mit dem verschwommenen Zug um den Mund? Und du mit den harten Augen! Also besonders schön hat Mutter uns nicht verewigt. Aber eine großartige Sache bleibt’s deshalb doch.“
Helen hat stille, große Augen. „Hast du gesehen, Sylvia, wie schön Mutter war, als sie dort am Fenster stand und ihr Werk betrachtete?“
„Mutter ist immer schön.“ Sylvia zieht einen Spiegel aus ihrem Täschchen und stellt mit Befriedigung fest, daß das Kunstwerk der Natur an Lieblichkeit und Reiz das Marmorbild noch übertrifft. „Wenn Mutter nachher nach mir fragt, Kindchen, so sag’ ihr, daß ich mit Herbert Rohde verabredet bin.“
„Du kommst wieder nicht zum Abendbrot?“
„Kein Gedanke! Herbert erwartet mich Punkt neun im Kaiserhof, und ich muß mich doch erst umziehen.“
„Herbert …?“
„Wer denn sonst? Du nimmst mir das doch nicht übel, Kindchen? Beim Tennisspiel gehört er ja dafür dir.“
Jetzt ist Abwehr in Helens Augen. „Du wählst deine Worte sonderbar, Sylvia.“
Ihre Schwester lacht obenhin. „Im Ernst, mein Kindchen: Wenn es dir unangenehm ist, gebe ich die Freundschaft mit ihm natürlich auf. Du brauchst mir’s nur zu sagen.“
„Wie kommst du darauf?“
„Na, na! Nur nicht gleich so strenge Augen, liebes Kind! Sei ehrlich! Ein bißchen, ein ganz kleines bißchen hast du doch für Herbert Rohde übrig gehabt?“
Helens Gesicht bleibt kalt. Aber ein Mißklang schwingt leise in der Stimme. „Du machst merkwürdige Witze, Sylvia. Deine Freundschaft mit Herbert Rohde berührt oder beunruhigt mich in keiner Weise.“
„Dann um so besser. Au revoir, mein Lieb!“
„Sylvia!“
Der vorwurfsvolle Ton läßt Sylvia stehenbleiben und sich umwenden. „Was ist denn? Ach ja, du wolltest etwas mit mir besprechen! Hat das nicht Zeit bis morgen? Du hörst doch, daß ich um neun …“
„Das hat heute vormittag ein Bote für dich abgegeben.“ Helen hat rasch einen offenen Briefumschlag hervorgezogen und reicht ihn der Schwester, Sylvias Augen blinzeln leicht, als sie den Aufdruck liest: „Bendler & Croy, Damenmoden“. Etwas hastig greift sie nach dem Brief.
„Wohl wieder eine Offerte.“
„Sylvia! — Willst du nicht mit mir darüber sprechen?“
Sylvias Augen gehen von dem Briefumschlag in ihrer Hand zu der Schwester. Ihr Gesicht färbt sich langsam rot. „Weißt du etwa, was da drin steht?“
„Der Brief war offen, wie du siehst.“
„Eine unglaubliche Art von Bendler & Croy! Aber trotzdem ist es nicht sehr taktvoll von dir, einen an mich gerichteten Brief zu lesen.“
„Komm’, setz’ dich mal hierher!“ Helen legt den Arm schwesterlich um Sylvias Schultern und drückt sie in den einzigen Lehnsessel des Ateliers. „Laß uns lieber vernünftig beraten, statt uns gegenseitig Vorwürfe zu machen.“
Sylvia mault noch ein wenig. „Meinetwegen, Helen. Aber nicht jetzt. Ich muß Punkt neun im Kaiserhof sein!“
„Herbert Rohde wird warten, auch wenn du etwas später kommst,“ gibt Helen ruhig zurück. „In dem Brief wirst du aufgefordert, endlich deine Rechnung bei Bendler & Croy zu begleichen. Zwölfhundert Mark! Sylvia, woher willst du soviel Geld nehmen?“
„Ach, Bendler & Croy werden mir schon noch Zeit lassen!“
„Kaum. Die Firma schreibt, daß du sie immer vertröstet und trotz deiner Versicherungen seit einem halben Jahr noch keinen Pfennig abgezahlt hast, und daß sie, wenn du nicht binnen acht Tagen die Rechnung begleichst, andere Schritte — und so weiter! Zwölfhundert Mark für Kleider! Du verdienst in der Bank ganze 150 Mark im Monat, Sylvia! Was in aller Welt hast du dir gedacht, als du diese schrecklichen Schulden machtest?“
„Es ist so aufgelaufen,“ sagt Sylvia kleinlaut. „Ich wußte gar nicht, daß es so viel war. Vielleicht wird Mutter …“
Helen unterbricht den Satz durch eine entschiedene Handbewegung. „Mutter darf kein Wort davon erfahren. Sie sorgt sich so schon genug. Du weißt doch ganz genau, wie es bei uns steht. Mutter hat kein Vermögen. Was ihre Kunst einbringt, und mehr als das, verschlingt unser Haushalt, Soll sich etwa Mutter am Munde absparen, was du leichtsinniges Huhn verschwendet hast?“
„Ja, was soll dann …? Mit Vorwürfen schaffst du die Sache auch nicht aus der Welt, Helen.“
Helen hat eine kleine, tiefe Falte auf der Stirn. „Die Rechnung muß bezahlt werden,“ sagt sie schließlich. „Du mußt unter allen Umständen bis auf weiteres von deinem Gehalt monatlich fünfzig Mark dafür hergeben. Ich werde jeden Monat hundert beisteuern.“
„Du, Helen?“
„Ja, aber nur, damit Mutter nichts erfährt,“ sagt Helen rasch, als wollte sie allen Dank von vornherein abwehren. „Es fällt mir schwer genug, aber es muß sein.“
Sylvia sitzt mit gesenktem Kopf und beißt sich auf die Lippen. Helen verdient beim Rundfunk knapp dreihundert Mark im Monat. Davon gibt sie hundertfünfzig zum gemeinsamen Haushalt. Wenn sie jetzt noch hundert Mark zur Bezahlung der Schuld beisteuern will, so bedeutet das für Helen Verzicht auf alle kleinen Vergnügungen und Annehmlichkeiten. Auch den Regenmantel, von dem sie seit langem schwärmt, wird sie sich nicht kaufen können. Sylvia hat im Grunde ein weiches, viel zu weiches Herz. Sie muß sich bezwingen, um nicht vor Rührung nasse Augen zu bekommen. Aber andererseits ist da auch ein Gefühl der Abwehr in ihr. Helen, obwohl zwei Jahre jünger, hat etwas Ernstes, Schulmeisterliches an sich. Wenn sie jetzt hilft, werden die Ermahnungen und Vorwürfe kein Ende nehmen. Man steht sozusagen unter Kuratel und darf nicht mal dagegen aufmucken.
„ Also ich werde morgen zu Bendler & Croy gehen und mit den Leuten sprechen,“ sagte Helens ruhige Stimme. „Hoffentlich sind sie mit den Ratenzahlungen, die ich vorschlagen werde, einverstanden. Die erste Rate von hundertfünfzig Mark werde ich gleich mitnehmen. Du gibst mir dann am Letzten, wenn du dein Gehalt bekommst, fünfzig Mark wieder.“
Sylvia hebt mit einem Ruck den Kopf. „Warte noch einen Tag damit, Helen! Ich … will versuchen, die Sache selbst zu deichseln.“
„Unsinn, Sylvia. Woher willst du das Geld nehmen?“
„Ich werde vielleicht …“ Ein grübelnder Zug steht in Sylvias Gesicht. „Überlaß das mir, Helen! Ich … habe eine Aussicht … jedenfalls eine Hoffnung. Vielleicht geht’s nicht. Dann komm’ ich zu dir. Aber einen Tag warte bitte noch, ehe du zu Bendler & Croy gehst!“
Helen schließt einen Atemzug lang die Augen unld hat ein kleines wehes Gefühl im Herzen. Sie meint natürlich Herbert Rohde. Er ist der Sohn reicher Eltern. Die „Hoffnung“, von der Sylvia spricht …, so weit ist es schon zwischen den beiden. Die Verlobung steht also bevor.
„Nun gut.“ Helen schluckt tapfer die Tränen, die in ihr aufsteigen wollen, herunter und sieht die schöne Schwester mild an. „Wenn du meinst, dann warten wir noch einen Tag. Aber nicht länger, Sylvia. Ich will nicht, daß Mutter eines Tages so ein Brief in die Hände fällt.“
„Danke, Helen. Ich sag’ dir morgen abend Bescheid.“ Sylvias Gesicht ist ernster als gewöhnlich. Es steht sogar etwas Gequältes darin, das die schönen Züge ein wenig verzerrt. Sorgenvoll blickt Helen der Schwester nach, und wieder will das wehe Empfinden in ihr aufsteigen. Arme Sylvia! So weit hat dich dein Leichtsinn und dein Luxusbedürfnis also glücklich gebracht! Und Herbert Rohde? Helen merkt plötzlich, daß ihr schmerzhaftes Gefühl viel mehr dem jungen Freund gilt als der Schwester. Armer Herbert, du sollst das Mädchen, das du liebst, durch Schuldenbezahlen an dich fesseln! Es hätte alles anders sein können.
*
Drüben im Erkerzimmer sitzen Frau Valerie und Gerhard Lenneberg sich gegenüber. Sich hinzulegen, hat Valerie Gauda entschieden abgelehnt, aber sie hat lächelnd geduldet, daß Lenneberg, ihr eine Decke um die Knie gelegt und dem Mädchen Auftrag gegeben hat, etwas Tee mit Portwein zu bringen. Tee mit Portwein ist Gerhard Lennebergs Allheilmittel.
„Ich mußte arbeiten,“ sagt Valerie Gauda leise. „Wenn ich nicht gearbeitet hätte, wäre ich verrückt geworden. Das waren für mich gute und schöne Tage im Atelier, kein Gedanke an etwas anderes, keine Sorgen, nichts, gar nichts als das Bild, das sich unter meinen Händen formte.“
„Ja.“ Die Hand des Mannes streicht behutsam ihre langen, überschlanken Finger. „Aber nun mußt du dich ordentlich ausruhen und auch dabei an nichts anderes denken.“
Kopfschütteln. „Nein, jetzt, wo die Arbeit beendet ist, kommen alle Gedanken wieder. Ich muß sogar einiges mit dir besprechen. Deine Schwester war vorige Woche bei mir.“
„Margrete? Davon weiß ich ja gar nichts!“
„Das war wohl auch so die Absicht. Aber wir haben keine Geheimnisse voreinander, gelt? Wir können ruhig darüber sprechen.“
Lenneberg runzelt ein wenig die Stirn. „War sie unfreundlich zu dir?“
„Freundlich, Gerhard, etwas zu freundlich. Volle drei Stunden ist sie bei mir geblieben.“
Die Falten auf Lennebergs Stirn bleiben. Margrete ist eine brave vernünftige Frau. Sehr vernünftig sogar. In den zehn Jahren, die sie nun schon seinen Haushalt führt, hat es nie eine ernste Meinungsverschiedenheit zwischen den Geschwistern Lenneberg gegeben, außer — — —
„Margrete ist gegen meine Verbindung mit dir, Valerie,“ sagt er, ruhig in ihre forschenden Augen schauend. „Du darfst ihr das nicht übelnehmen. Zehn Jahre hat sie meinen Haushalt geführt. Menschlich verständlich, daß sie sich gegen den Gedanken wehrt, ihren Platz einer anderen einzuräumen! Außerdem neigt sie ein bißchen dazu, mich zu benuttern, obwohl ja nun so etwa fünfunddreißig Jahre vergangen sind, seit ich die ersten langen Hosen trug. Die Grete vergißt nie, daß sie vier Jahre älter ist als der kleine Bruder.“
„Hast du mit ihr davon gesprochen, daß du —,“ ein zartes Rot steigt in ihr Gesicht, — „ich meine: Kennt sie deine Pläne für die Zukunft?“
„Ich habe ihr gesagt, daß ich dich liebe,“ erwidert Gerhard Lenneberg schlicht. Valerie Gauda nickt gedankenvoll.
„Dann versteh’ ich deine Schwester um so besser. Gerhard, ich bin eine alte Frau,“
„Erlaube mal, Vali! Du bist nach dem Kalender zehn Jahre jünger als ich, nach deinem Aussehen sogar mindestens zwanzig Jahre!“
Frau Valerie lächelt nachsichtig über die kleine Huldigung, die wohl nicht ganz ernst gemeint ist, die sie jedenfalls nicht ernstnehmen darf. „Du brauchst eine Frau, Gerhard, darin hast du recht. Aber ich bin nicht die richtige für dich. Was du brauchst, ist eine schon durch alle Äußerlichkeiten für sich einnehmende junge und schöne Frau.“
Lenneberg lacht kurz und unwillig. „Sieh mal an! Das hat dir bestimmt meine teure Schwester eingeredet.“
„Ist dein Spott wirklich ganz echt, Gerhard?“ Sie sieht ihm forschend in die Augen. „Bist du nicht in deinen geheimsten Gedanken einig mit deiner Schwester? Bitte, laß mich ausreden! Wenn es so ist, wenn du deine eigentlichen Wünsche unterdrückst, vielleicht, weil du mich gern hast und mir nicht weh tun willst, vielleicht auch aus Pflichtgefühl, weil du nun einmal vom Heiraten gesprochen hast, — dann gib es auf! Wirf allen Zwang von dir! Ich werde dir keinen Vorwurf machen, nicht einmal traurig sein. Du weißt, daß ich dich um Bedenkzeit gebeten habe. Ich brauche sie nicht mehr, Gerhard. Mit meinem ‚Nein‘ hast du deine ganze Handlungsfreiheit wieder.“
„Aber, Valerie!“ Lenneberg schüttelt den Kopf. „Was soll das alles? Du hast dich übernommen bei deiner Arbeit. Ich nehme dein Nein jetzt nicht an!“
„Ach, Gerhard!“ Valerie Gaudas Lippen zucken gequält. „Ich bin ganz ruhig. Was mich quälte, als ich den Gedanken zuerst faßte, das hab ich im Atelier gelassen. Die Arbeit half mir darüber hinweg. Jetzt kann ich schon ganz ruhig und mit klarem Kopf darüber sprechen. Und ich muß Klarheit schaffen. Willst du mir, bitte, ruhig zuhören?“
„Gern, Valerie. Aber ich begreife nicht, was…“
Eine müde Handbewegung! „Vor vier Wochen hast du mich gefragt, ob ich deine Frau werden will, Gerhard. Wir kennen uns lange genug, um zu wissen, daß wir uns verstehen und miteinander leben können. Aber ich fürchte, du hast dich übereilt mit deinem Entschluß. Nein, sprich noch nicht, Lieber! Du hast versprochen, mir ruhig zuzuhören. — Was willst du mit einer Witwe mit zwei erwachsenen Töchtern, Gerhard? Du bist eine bekannte Persönlichkeit im deutschen Wirtschaftsleben. Gerhard Lenneberg und sein Haus brauchen eine Frau, die er mit Stolz zeigen kann.“
Nun unterbricht Lenneberg sie doch. Sein Lächeln ist fast ironisch. „Und du meinst, das könnte ich nicht, wenn Valerie Gauda meine Frau wäre?“
„Ich bin nicht so klein, daß ich mich für wertlos halte. Ich schätze mich selbst sogar sehr hoch ein. Aber ich denke mir als Schmuck, als Krönung sozusagen deines Heims eine Frau, die Jugend, Schönheit, Eleganz und Geschmack in sich vereint. Sei ganz aufrichtig, Gerhard, hast du nicht selber so gedacht, wenn du dir deine zukünftige Frau vorstelltest?“
Lenneberg verbeugt sich leicht. „Ich tue es noch, liebe Valerie,“ sagt er ernst. „Mein sehnlicher Wunsch, unsere Freundschaft in eine Ehe umzuwandeln, ist der beste Beweis dafür.“
Grübelnd, forschend hängen ihre Augen an seinen Zügen. „Und du hast nie an jemand anderen gedacht? An jemand, — ganz in meiner Nähe?“
„Wie soll ich das verstehen, Valerie?“
„Mein Gedanke ist nicht erst von heute, Gerhard. Oft genug, wenn du hier bei uns warst, hab ich mich im stillen gefragt, wie es kommt, daß du so achtlos an der Jugend vorbeigehst, die neben mir blüht. Anfangs, als wir Freunde wurden, habe ich geglaubt, daß du …“
„Nun, daß ich …?“
„… in mir die Mutter derjenigen sähest, der dein Herz und deine Sehnsucht gehört.“
„Valerie — nein!“
„Es wäre doch so natürlich, Gerhard. Sylvia hat alle Eigenschaften, die deine zukünftige Frau braucht. Und sie ist jung. Ich dachte wirklich manchmal, daß sie es sei, die … Und als du ihr die Stellung in der Bank des Geheimrat Herkrath verschafftest, schien es mir fast sicher. Darum erschrak ich so sehr, als du mich fragtest, ob ich deine Frau werden wolle.“
Lennebergs Stirn hat sich gefurcht. „Es wäre dir also recht, wenn ich Sylvia heiraten wollte?“
„Laß jetzt einmal mich aus dem Spiel, Gerhard!“
„Im Gegenteil, auf dich kommt es an in diesem Spiel, das mir sehr ernst ist. Soll ich wirklich glauben, daß die Fäden, die das Leben zwischen uns gesponnen hat, das stille, herrliche Wissen: wir gehören zueinander, — von deiner Seite nichts war als die freundschaftliche Zuneigung einer Mutter zu dem willkommenen Schwiegersohn?“
„Gerhard, so darfst du nicht reden!“ Valerie Gauda atmet schwer. Dann steht sie langsam auf von dem niederen Sessel. Hoch und rank steht sie vor dem Mann. „Ich liebe dich, Gerhard Lenneberg. Aber das darf nicht binden. Wenn du Sylvia liebst, wenn es dir gelingt, ihr Gefühl für dich zu wecken, so trete ich gern und froh zurück und — bin auch glücklich. Ja, Gerhard! Ich könnte es nicht ertragen, meinem Kinde vielleicht im Wege gestanden zu haben — oder dir selbst.“ Ihre Stimme wird leiser, ein wenig krampfhaft verschränkt sie die schlanken, schmalen Finger. „Glaub mir, Gerhard, es soll kein Schatten zwischen uns fallen, wie du dich auch entscheidest. Wenn du die Jugend wählst — werde de ich sagen: Du hast recht daran getan.“ — Gerhard Lenneberg schweigt und sieht eine Weile stumm in ihr mühsam beherrschtes Gesicht. Plötzlich aber beginnt er zu lachen, frei und herzlich, ein übermütiges Jungenlachen, das niemand von dem würdevollen, ruhigen Leiter der Lenneberg-Werke erwarten würde. „Das hat also die gute Margrete dir eingeredet, — Sylvia! Ich weiß: Meine liebe Schwester möchte mich gern mit einem schönen jungen Mädchen verkuppeln, mit einem halben Kind, das man mit einem Auto, schönen Kleidern und dergleichen zufriedenstellt, während meine brave Schwester die eigentliche Herrin im Hause bleiben könnte!“
„Nein, Gerhard, deine Schwester …“
„Kannst du leugnen, daß sie dir die Gedanken an eine Verbindung zwischen Sylvia und mir in den Kopf gesetzt hat? Siehst du, du kannst es nicht. Aber daß du, — du, Valerie Gauda, dich mit so törichten Hirngespinsten hast quälen können, das geht über meinen Horizont. Sehe ich wirklich aus wie ein schüchterner Jüngling oder wie ein ganz gerissener Kunde, der der Mutter den Hof macht, um die Tochter zu gewinnen?“
„Ich bitte dich, Gerhard, — es ist zu ernst, um …“
„Gut, Vali, du sollst eine ernste Antwort auf deine Frage haben.“ Lennebergs Gesicht wird ruhig und beherrscht. Ein stiller, guter Ausdruck ist in seinen Augen. „Ich habe nie an Sylvia oder an sonst jemand gedacht. Denn ich liebe dich, Vali. Dich! Nicht dein jüngeres Abbild.“
„Aber deine Schwester meinte …“
„Margrete hat mir oft genug das verlockende Bild einer jungen, schönen künftigen Frau Lenneberg vorgemalt. Sie ist gegen meine Verbindung mit dir. Darum hat sie dir diesen Floh ins Ohr gesetzt. Zürnen will ich ihr nicht darum, denn ich verstehe ihre Beweggründe. Doch sie wird sich damit abfinden müssen, daß ich meinen eigenen Weg gehe. Zwischen uns beide, Vali, soll sich niemand drängen, deine Tochter nicht und meine Schwester auch nicht.“
Sekundenlang kämpfen noch Zweifel in Valerie Gaudas Zügen. Fragend hängt ihr Blick an dem ruhigen offenen Gesicht Lennebergs. Dann legt sie plötzlich die Arme mit einem ganz leisen Jubelruf um seinen Hals und legt den Kopf ganz fest an seine Schulter.
„Darf ich das als die Antwort betrachten?“
Valerie Gauda hebt den Kopf. Da ist wieder das Unschlüssige, Ängstliche, Zurückweichende in ihren Augen. „Laß mir Zeit, Gerhard! Bedenkzeit, wie du es versprochen hast.“
„Immer noch nicht beruhigt? Soll ich Margrete …“
„Es ist nicht darum,“ unterbricht sie ihn rasch. „Du weißt doch, Bedenkzeit hatte ich schon von dir erbeten, bevor deine Schwester mich aufsuchte. Es ist etwas anderes, Gerhard! Die Kinder!“
„Sylvia und Helen sind erwachsen.“
Da ist ein mütterliches Lächeln in Valerie Gaudas Zügen, ein tiefes, rätselhaftes Lächeln. „Für mich werden sie immer Kinder bleiben. Sie brauchen mich noch. Helen, nun ja, die hat das ernste ruhige Wesen ihres Vaters. Um die ist mir nicht bang. Aber Sylvia ist mein liebes Sorgenkind! Weißt du, Gerhard, sie ist noch wenig gefestigt für das Leben.“
„Jugend ist immer ein wenig leichtsinnig. Wir waren wohl nicht anders, Valerie. Jetzt hat Sylvia ihre geregelte Arbeit, da wird sie gewiß auch vernünftiger werden.“
„Sie braucht eine leitende Hand,“ sagt Valerie Gauda nachdenklich. „Solange sie nicht einen Mann hat, ist es meine Pflicht, immer ganz für sie dazusein — als Mutter!“
„Gut. Ich werde mithelfen, daß Sylvia unter die Haube kommt. Ich lasse mich als Heiratsvermittler ohne Provision und Vorschuß nieder und führe euch eine Auswahl idealer Gatten vor. Es wird nicht schwerfallen …“
„Nun spottest du wieder, Gerhard. Verstehst du nicht, daß ich Rücksicht auf die Kinder zu nehmen habe! Ich muß an sie denken, bevor ich einen entscheidenden Schritt tue.“
„Ich brauche dich auch, Vali,“ sagt der Mann leise.
Ihre Hand streicht einen Augenblick liebkosend über seine breite Stirn. „Wir haben uns lieb, Gerhard. Genügt das nicht — vorläufig?“
Gerhard Lenneberg schaut in ihre großen, ehrlichen Augen und fühlt ein stilles Geborgensein. In ihrem Blick ist ein Widerschein des großen, zeitlosen Gefühls, vor dem alle verlangende Ungeduld sich beschämt verkriecht. „Du hast recht,“ sagt er einfach. „Das ist die Hauptsache. Ich warte.“
2.
Es ist doch viel schwerer, als sie gedacht hat. Sylvia Gauda dreht nervös an ihrem Kelchglas und wirft von der Seite verstohlene Blicke auf das Gesicht ihres Freundes. Hernando Las Feras wendet ihr sein Profil zu, sein klassisches Profil: Hochgewölbte Stirn, kühn geschwungene Nase, energisch modelliertes Kinn. Darunter sitzt eine tadellos gebundene weiße Schleife im weißen Frackausschnitt. Ein Kavalier, ein Gentleman, wie er auszusehen hat. Es ist wirklich nicht leicht, Hernando Las Feras zu beichten, was doch gebeichtet werden muß.
Sylvia hat trotz ihrer Jugend schon ihre Erfahrungen gemacht mit der Männerwelt. Ihre Schönheit hat manchen gelockt. Von Zudringlichkeit aber ist sie bisher verschont geblieben. Sie kennt die schüchternen oder tolpatschig draufgängerischen, die wohlerzogen zurückhaltenden und die harmlos ein wenig „angebenden“ Jungens ihrer Kreise. Weil sie der übrigen Männerwelt meist zu oberflächlich ist, hat Sylvia bisher — wie es ihrer eigenen Art entsprach — eigentlich nur harmlose Jungen, die gern als große Herren und gewiegte Lebemänner gelten wollten, wirklich kennengelernt. Bei Hernando Las Feras ist alles ganz anders.
Gerade die Offenheit, mit der er gleich zu Anfang von seinen Verhältnissen gesprochen hat, obenhin, wie ein Mann, der sich seines Wertes bewußt ist, auch wenn er keine Hunderttausende zur Verfügung hat, und der doch mit einer gewissen Ängstlichkeit bestrebt ist, keine falschen Ansichten über seine Verhältnisse aufkommen zu lassen — gerade das hat sie nur noch mehr für ihn eingenommen.
Seine Mutter ist eine geborene Fürstin Dolgoruki gewesen. Andere hätten vielleicht versucht, damit Eindruck zu machen, aber Feras hat es nur einmal leichthin erwähnt, mit einem nachsichtigen Lächeln, das über Adelsstolz und äußeren Glanz erhaben schien. Immer ist sein Gesichtsausdruck beherrscht, vornehm verhalten, überlegen. Nur einmal hat Sylvia Gauda dieses Gesicht dunkel gesehen vor Haß. Das war auch hier im Kaiserhof, sogar an demselben Tisch. Ein Herr war da eingetreten und hatte sich breit und aufdringlich an einen der kleinen Tische dicht unter dem Podium des Kabaretts gesetzt, ein Mann, dem der Abendanzug am Leibe saß wie ein unbequemer Panzer, ein Mann mit einem gemeinen, widerlich groben Gesicht.
„Wenn dieser — Herr da nicht wäre, könnten wir glücklich sein,“ hat Las Feras dann gesagt, und seine aristokratisch lange Hand hat sich auf dem Tischtuch geballt.
„Der da drüben?“ Sylvia hat überrascht den Mann angesehen und wiedererkannt. „Das ist merkwürdig. Der war neulich bei uns in der Bank. Ich mußte ihn beim Chef, bei Geheimrat Herkrath persönlich, melden. Er heißt … wart’ mal … es war ein russischer Name.“
„Er ist auch Russe. Es gab eine Zeit, da war er der Hausverwalter meiner Mutter.“
„Aber du sagst, wenn er nicht wäre …?“
Da hat Las Feras ihr zögernd die Geschichte erzählt:
„Seine Mutter war nach dem Tode ihres Mannes, kurz vor dem Kriege, in ihre russische Heimat zurückgekehrt. Beim Ausbruch der Revolution lag sie krank auf ihrem Landgut im Kaukasus. Alles wurde ihr von den Roten genommen, das Palais in Petersburg, das Landhaus, die Güter im Gouvernement Twer. Aber ihre Juwelen, besonders das kostbare Diadem, das noch aus der Zeit des Zarenbefreiers stammte, konnte sie in Sicherheit bringen. Selbst eine halbe Gefangene, hatte sie in den Tagen höchster Not die Juwelen dem Hausverwalter Jussow anvertraut, der sie außer Landes bringen sollte.
Da Ilina Feodorowna Dolgoruki durch ihre Heirat mit Las Feras portugiesische Staatsangehörige geworden war, hatte das große Blutbad sie verschont. Mit Hilfe der portugiesischen und englischen Gesandtschaft erhielt sie endlich die Erlaubnis, Rußland zu verlassen. Den Tod im Herzen, kam sie in Paris an, und wenige Monate später starb sie dort. Auch Jussow tauchte eines Tages in Paris auf, behauptete aber, von den Juwelen nichts zu wissen. Er habe zwar gewisse Wertstücke in Verwahrung, aber die seien ihm von dem Grafen Nebridow, einem Nachbarn der Fürstin Dolgoruki, anvertraut worden. Alle Versuche, ihn zur Herausgabe der Kostbarkeiten zu bewegen, blieben erfolglos. Jussow blieb bei seiner Behauptung und weigerte sich entschieden, die Sachen herauszugeben. Graf Nebridow aber konnte nicht mehr sprechen. Er schlief längst in irgendeinem Grab im fernen Rußland.