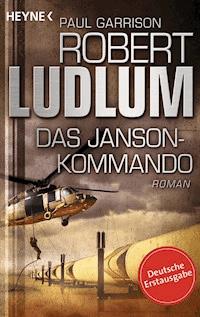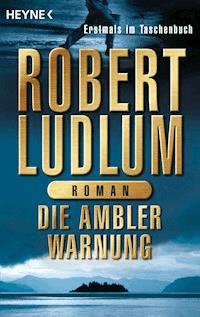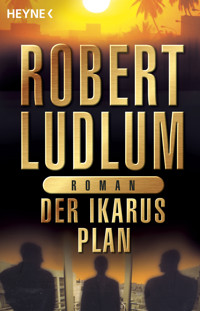5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie ist schön, geheimnisvoll – und tödlich
Seit Amaya Bajaratt mit ansehen musste, wie ihre Familie getötet wurde, hegt sie einen tiefen Hass gegen jede staatliche Autorität. Sie wird eine der besten Attentäterinnen der Welt. Ihre Ziele: der Präsident der Vereinigten Staaten und führende Staatsoberhäupter der westlichen Welt. Dabei erhält sie Unterstützung durch eine mächtige Geheimgesellschaft namens Scorpio, die von einer unkartierten Karibikinsel aus ihre Fäden zieht. Nur ein ehemaliger US-Spion kann den teuflischen Plan durchkreuzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 858
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Robert Ludlum
Die Scorpio-Illusion
Roman
Aus dem Englischen von Hans Heinrich Wellmann
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Das Buch
Amaya Bajaratt ist schön, geheimnisvoll – und tödlich. Seit sie mitansehen musste, wie spanische Soldaten ihre baskische Familie auslöschten, hegt sie einen tiefen Hass gegen jedwede staatliche Autorität. Sie wird eine der besten Attentäterinnen der Welt. Ihre Ziele: Der Präsident der Vereinigten Staaten und führende Staatsoberhäupter der westlichen Welt. Dabei erhält sie Unterstützung durch eine mächtige Geheimgesellschaft namens Scorpio, die von einer unkartierten Karibikinsel aus ihre Fäden zieht und selbst höchste Kreise der US-Regierung unterwandert hat.
Im verzweifelten Versuch, die Terroristin aufzuspüren, wendet sich der US-Geheimdienst an Tyrell Hawthorne. Der ehemalige Navy-Agent kennt die gefährlichen Gewässer wie kein zweiter. Es kommt zu einem tödlichen Wettlauf.
Der Autor
Robert Ludlum (1927 – 2001) zählt zu den erfolgreichsten Autoren der Welt, seine Thriller faszinieren seit vierzig Jahren ein Millionenpublikum. Seine beispiellose Schriftstellerkarriere nahm im Jahre 1971 seinen Anfang, als sein Debütroman sozusagen aus dem Stand Platz Eins der Bestsellerliste erreichte. Dieser Erfolg erlaubte es Ludlum, sich fortan nur noch dem Schreiben zu widmen. Inzwischen wurden viele seiner Romane, allen voran die Bestseller um den Agenten Jason Bourne, erfolgreich verfilmt. Allein im deutschsprachigen Raum wurden über 7 Millionen seiner Bücher verkauft.
Am Ende des Buches finden Sie ein ausführliches Werkverzeichnis aller im Wilhelm Heyne Verlag erschienenen Ludlum-Romane.
Die Originalausgabe THESCORPIOILLUSION
erschien 1993 bei Doubleday, New York
Vollständige deutsche Taschenbuchausgabe 06/2012
Copyright © 1993 by Robert Ludlum
Copyright © 2012 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,
unter Verwendung eines Motivs von © Shutterstock
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-08027-3
www.heyne.de
Für Jeffrey, Shannon und James
PROLOG
Askalon, Israel, 2 Uhr 47
Dichter Regen durchschnitt die Nacht wie mit silbernen Messern. Der dunkle Himmel bezog sich mit noch dunkleren Massen wirbelnder schwarzer Wolken, als sich die beiden miteinander vertäuten Schlauchboote, schutzlos der Dünung des Meeres und dem peitschenden Wind ausgesetzt, der Küste näherten.
Die Mitglieder des Stoßtrupps waren völlig durchnässt. Schweiß und Regen hatten Streifen in ihre geschwärzten Gesichter gezogen; mit zusammengekniffenen Augen versuchten sie angestrengt, den Strand in der Dunkelheit auszumachen. Die Einheit bestand aus acht Palästinensern aus dem Beka´a-Tal und einer Frau, die selber keine Palästinenserin war, sich aber ihrer Sache angeschlossen hatte, da diese untrennbar mit dem verbunden war, wozu sie sich vor Jahren bekannt hatte: Muerte a toda autoridad! Sie war die Frau des Führers der Einheit.
»Nur noch wenige Minuten!«, rief der große Mann, als er sich neben der Frau niederkniete. Seine Waffen waren wie die der anderen mit Riemen am dunklen Tarnanzug festgebunden; auf dem Rücken trug er einen schwarzen wasserdichten Rucksack mit Sprengstoff. »Denk daran, den Anker zwischen den Booten auszuwerfen, wenn wir an Land gehen. Das ist wichtig.«
»Ich verstehe, mein Gemahl. Aber es wäre mir lieber, wenn ich mitkommen könnte…«
»Damit wir hier nicht mehr wegkommen, um weiterzukämpfen?«, fragte er. »Die Hochspannungsleitungen sind keine drei Kilometer von der Küste entfernt; sie versorgen Tel Aviv mit Strom, und wenn wir sie erst in die Luft gejagt haben, wird die Hölle los sein. Wir besorgen uns ein Fahrzeug und sind in einer Stunde wieder zurück. Aber unsere Ausrüstung muss hierbleiben.«
»Ich verstehe.«
»Wirklich? Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet? Der größte Teil, wenn nicht ganz Tel Aviv ohne Licht!– Und natürlich Askalon. Perfekt… Und du, mein Augenstern, warst es, die den wunden Punkt ausfindig gemacht hat, das ideale Ziel.«
»Ich habe nur einen Vorschlag gemacht.« Ihre Hand streichelte seine Wange. »Komm bald zurück, Geliebter.«
»Zweifle nicht daran, meine Amaya der Feuer… Wir sind nahe genug dran… Jetzt!« Der Führer der Einheit gab den Männern auf beiden Booten ein Zeichen. Alle ließen sich in die schwere Brandung gleiten und hielten die Waffen hoch über dem Kopf, während sie sich gegen die Wellen stemmten und durch den weichen Sand zum Strand vorrückten. Sobald sie ihn erreicht hatten, ließ der Führer seine Taschenlampe einmal kurz aufleuchten, um anzuzeigen, dass die gesamte Einheit sich auf feindlichem Boden befand– bereit, die Aktion zu beginnen. Die Frau warf den schweren Anker zwischen den beiden Booten aus, die einträchtig den Bewegungen der Wellen folgten. Sie hielt das Funkgerät einsatzbereit an Ohr und Mund; sie würde es nur im Notfall benutzen, da die Juden den Funkverkehr an der Küste überwachten.
Dann, plötzlich, mit einer schrecklichen Endgültigkeit, zerbarsten alle Träume des Ruhms in den Salven eines Maschinengewehrfeuers, das von beiden Seiten auf die Einheit niederging. Es war ein Massaker. Soldaten rannten über den Strand, feuerten ihre Waffen in die zuckenden Körper der Askalon-Brigade ab, zerfetzten Schädel, verschonten keinen der Palästinenser. Keine Gefangenen! Nur Tote!
Die Frau im Schlauchboot handelte rasch trotz ihres Schmerzes, trotz des Schocks, der sie lähmte. Nur von dem Impuls bestimmt zu überleben, stieß sie ihr langes Messer an mehreren Stellen in die PVC-Haut der Boote, ergriff eine wasserdichte Tasche, die Waffen und gefälschte Papiere enthielt, und sprang in die Wellen. Gegen die Brandung und die Unterströmung ankämpfend, hielt sie, nach Süden vordringend, einen Abstand von fünfzig Metern zur Küste ein, ehe sie quer zu den Wellen an den Strand schwamm. Sie sah fast nichts in dem dichten Regen, als sie das seichte Wasser erreicht hatte und zurück zum Kampfplatz kroch. Dann hörte sie die israelischen Soldaten, die auf Hebräisch Rufe austauschten. Jede Faser ihres Körpers erstarrte in kalter Wut.
»Wir hätten Gefangene machen sollen.«
»Wozu? Damit sie später unsere Kinder töten, wie meine beiden Söhne, die sie im Schulbus abgeschlachtet haben?«
»Man wird uns einen Vorwurf daraus machen– sie sind alle tot.«
»Genau wie meine Mutter und mein Vater. Die Schweine haben sie in einem Weinberg niedergeschossen, zwei alte Leute, mitten unter den Reben.«
»Mögen sie in der Hölle schmoren! Die Hisb Allah hat meinen Bruder zu Tode gefoltert!«
»Nehmt ihre Waffen und schießt ein bisschen in die Gegend… ein paar Streifschüsse an Armen und Beinen werden uns nicht umbringen!«
»Jacob hat recht. Sie haben zurückgeschossen. Wir hätten alle getötet werden können.«
»Einer von uns sollte in die Siedlung laufen und Verstärkung anfordern!«
»Wo sind ihre Boote?«
»Die sind doch längst weg, auf Nimmerwiedersehen. Wahrscheinlich waren es Dutzende! Grund genug, die zu töten, die wir gesehen haben!«
»Beeil dich, Jacob! Wir dürfen der verdammten liberalen Presse keinen Stoff liefern!«
»Warte! Dieser hier lebt noch!«
»Lass ihn sterben. Nehmt ihnen die Waffen ab und schießt die Magazine leer.«
Das Stakkato der Schüsse drang durch die Nacht und den Regen. Dann warfen die Soldaten die Gewehre des Stoßtrupps neben die Leichen und eilten zurück in die seegrasüberspülten Dünen. Streichhölzer und Feuerzeuge flammten hinter vorgehaltenen Händen auf. Das Massaker war vorbei; das Vertuschungsmanöver hatte begonnen.
Die Frau kroch in dem seichten Wasser vorsichtig weiter. Das Gewehrfeuer klang noch in ihren Ohren nach, gab dem Hass, der sie erfüllte, neue Nahrung– dem Hass und dem Gefühl des Verlustes. Sie hatten den Mann getötet, den sie liebte, den einzigen Mann auf Erden, den sie als gleichwertig anerkennen konnte; denn kein anderer besaß ihre Kraft, ihre Entschlossenheit. Er war tot, und es würde nie wieder jemanden wie ihn geben, wie diesen göttlichen Anführer mit seinen brennenden Augen, dessen Stimme die Menschen zum Weinen und Lachen bewegen konnte. Und sie war stets neben ihm gewesen, hatte ihn geleitet, hatte ihn bewundert. Die Welt der Gewalt würde nie wieder ein solches Paar sehen.
Sie hörte ein Stöhnen, einen leisen Aufschrei, der durch das Geräusch des Regens und der Brandung drang. Ein Körper rollte den Strandhang hinunter und blieb wenige Meter vor ihr liegen. Schnell kroch sie auf den regungslosen Körper zu und griff nach ihm; er lag mit dem Gesicht nach unten im Sand. Sie drehte ihn um, und der Regen rann über die von Blut verkrusteten Züge. Es war ihr Mann, mit durchschnittener Kehle und zertrümmertem Schädel. Sie hielt ihn fest umschlungen. Er öffnete noch einmal die Augen, dann schloss er sie für immer.
Die Frau blickte nach oben in die Dünen zu den in der Dunkelheit glühenden Zigaretten. Mit dem Geld in ihrer Tasche und den falschen Papieren würde sie sich durch das verhasste Israel schlagen, eine Spur von Tod und Vernichtung hinter sich lassend. Sie würde zum Beka’a-Tal zurückkehren, um vor den Hohen Rat zu treten. Sie wusste genau, was sie zu tun hatte: Muerte a toda autoridad!
Beka’a-Tal, Libanon, 12 Uhr 17
Das Flüchtlingscamp lag unter der glühenden Mittagssonne, eine Enklave von Vertriebenen, von denen viele durch Ereignisse, die sie weder zu verantworten hatten noch beeinflussen konnten, zutiefst erniedrigt worden waren. Ihr Schritt war langsam und schleppend, ihre Gesichter starr, und in ihren dunklen, niedergeschlagenen Augen lag eine Verzweiflung, die von dem Schmerz verblassender Erinnerungen kündete, von Bildern, die nie wieder Wirklichkeit gewinnen würden. Andere hingegen waren aufsässig; sie trotzten der Erniedrigung, dachten nicht daran, den Status quo zu akzeptieren. Es waren die Mudschahidin, die Kämpfer Allahs, die Rächer Gottes. Sie bewegten sich, ihre Waffen stets griffbereit über die Schulter geschnallt, mit schnellen Schritten, voller Entschlossenheit. Aufmerksam spähten sie um sich, ständig auf der Hut; ihre Augen waren von Hass erfüllt.
Vier Tage waren seit dem Massaker von Askalon vergangen. Die in eine grüne Khaki-Uniform gekleidete Frau verließ ihre aus drei Zimmern bestehende Hütte; »Haus« wäre dafür eine falsche Bezeichnung gewesen. Die Tür war mit schwarzem Tuch verhängt, der Farbe des Todes. Die Passanten blieben stehen, um sie anzuschauen, hoben die Augen zum Himmel und murmelten Gebete für den Verstorbenen. Von Zeit zu Zeit stieg ein klagender Schrei auf, die Bitte an Allah, den Toten zu rächen. Denn dies war die Wohnung des Führers der Askalon-Brigade; und die Frau, die jetzt über die staubige Straße schritt, war seine Frau gewesen. Auch sie gehörte zu den großen Mudschahidin in diesem Tal der Erniedrigung und der Rebellion. Sie und ihr Mann waren Symbole der Hoffnung für eine fast verlorene Sache.
Als sie die in der prallen Sonne liegende Straße hinunterging, machte die Menge ihr Platz. Viele berührten sie sacht, fast andächtig, murmelten Gebete, bis einer »Baj, Baj, Baj…Baj« zu rufen begann– ein Ruf, der wie eine Beschwörung klang und in den bald alle anderen einfielen.
Die Frau beachtete keinen von ihnen. Sie ging geradewegs auf ein aus Holz errichtetes, barackenähnliches Gemeindehaus am Ende der Straße zu, in dem die Mitglieder des Hohen Rats des Beka’a-Tals sie erwarteten. Sie trat ein; ein Wächter schloss die Tür hinter ihr, und sie stand neun an einem langen Tisch sitzenden Männern gegenüber. Eine kurze Begrüßung, knappe Beileidsbekundungen. Der Vorsitzende des Komitees, ein älterer Araber, der den Stuhl in der Mitte eingenommen hatte, sagte:
»Deine Nachricht hat uns erreicht. Sie hat uns nicht überrascht.«
»Dein Vorhaben«, sagte ein Mann in mittleren Jahren, der eine der vielen Uniformen der Mudschahidin trug, »kann für dich den Tod bedeuten. Ich hoffe, du weißt das.«
»Und wenn. Umso schneller werde ich wieder mit meinem Mann vereint sein.«
»Ich wusste nicht, dass du dich zu unserem Glauben bekennst«, sagte ein anderer.
»Das ist unerheblich. Ich bitte euch nur, mich finanziell zu unterstützen. Ich glaube, dass ich mir im Laufe der Jahre diese Unterstützung verdient habe.«
»Zweifellos«, stimmte ein anderer zu. »Du bist uns mit deinem Mann, möge er mit Allah in seinen Gärten ruhen, eine große Hilfe gewesen. Doch ich sehe eine Schwierigkeit…«
»Ich werde allein vorgehen– nur von denen unterstützt, die mich begleiten–, um Rache für Askalon zu nehmen. Eine außerplanmäßige Einsatztruppe, die allein sich selbst verantwortlich sein wird. Ist deine ›Schwierigkeit‹ damit ausgeräumt?«
»Wenn du das kannst«, erwiderte ein anderer Führer.
»Ich habe bereits bewiesen, dass ich es kann. Muss ich euch an das erinnern, was ich geleistet habe?«
»Nein, das ist nicht nötig«, sagte der Vorsitzende. »Du hast unsere Feinde immer wieder so rettungslos in die Irre geführt, dass befreundete Regierungen für Taten bestraft wurden, von denen sie überhaupt nichts wussten.«
»Wenn nötig, werde ich diese Praxis fortsetzen. Überall gibt es Feinde und Verräter, selbst unter euren ›befreundeten‹ Regierungen. Alle Regierungen sind korrupt.«
»Du traust niemandem, was?«, fragte der Araber in mittleren Jahren.
»Das weise ich entschieden zurück. Ich habe einen von euch geheiratet. Ich habe euch sein Leben gegeben.«
»Ich bitte um Entschuldigung.«
»Das solltest du auch. Eure Antwort, bitte.«
»Du bekommst, was du brauchst«, sagte der Vorsitzende des Komitees. »Stimme dich mit Bahrein ab, wie du es früher getan hast.«
»Danke.«
»Wenn du in den Vereinigten Staaten bist, wirst du mit einer anderen Organisation zusammenarbeiten. Sie werden dich beobachten, dich prüfen, und wenn sie überzeugt sind, dass du keine Bedrohung für sie darstellst, werden sie mit dir Kontakt aufnehmen. Dann wirst du eine von ihnen sein.«
»Wer sind sie?«
»Sie sind nur wenigen bekannt. Sie selber nennen sich Scorpios, die Skorpione.«
1
Sonnenuntergang. Die ramponierte Jolle– der Hauptmast durch einen eingeschlagenen Blitz zertrümmert, die Segel von den Stürmen der offenen See zerfetzt– fuhr in die stille Bucht einer der zahllosen Inseln der Kleinen Antillen ein. Während der letzten drei Tage, bevor die Windstille eintrat, hatte über diesem Abschnitt des Karibischen Meeres nicht nur ein Hurrikan von der Stärke des berüchtigten Hugo, sondern sechzehn Stunden später auch ein tropischer Sturm gewütet, dessen Blitze tausend Palmen in Brand gesteckt und die hunderttausend Bewohner der Inselkette veranlasst hatten, sämtliche Götter um Beistand anzuflehen.
Das Haus auf dieser Insel hatte jedoch beide Katastrophen überstanden. Es war aus festem Stein und Stahl errichtet und stand im Abhang des hohen Berges an der Nordseite, uneinnehmbar, unzerstörbar, eine Festung. Dass die stark beschädigte Jolle überhaupt bis in diese von Felsen umgebene Bucht und an diesen kleinen Strand gelangt war, war ein Wunder– aber ein Wunder, welches sich für das schwarze Hausmädchen in weißer Schürze, das jetzt die Stufen zum Strand hinunterlief und vier Schüsse aus einer Pistole abfeuerte, als tödlich erweisen sollte.
»Ganja!«, rief sie. »Wir wollen hier keine lausigen ganja haben. Verschwindet!«
Die einsame Gestalt, die an Deck des Bootes kniete, war eine etwa fünfunddreißigjährige Frau. Ihr Gesicht war hager; ihre langen Haare strähnig und ungekämmt, Shorts und Büstenhalter ausgeblichen und verschlissen… und ihre Augen blickten rätselhaft kalt, als sie das mächtige Gewehr auf das Dollbord legte und durch das Zielfernrohr sah. Sie drückte ab. Der laute Knall erschütterte die Stille der Inselbucht, hallte von den Felsen und den dahinterliegenden Bergen wider. Im gleichen Augenblick fiel das Hausmädchen mit dem Gesicht nach unten in die sanft auf den Strand schlagenden Wellen.
»Da wird geschossen. Ich hab ein Gewehr gehört!« Ein junger Mann mit bloßem Oberkörper, über 1,85 Meter groß und siebzehn Jahre alt, stürzte aus der unter Deck liegenden Kajüte. Er war muskulös und sah gut aus mit seinen klar geschnittenen, fast klassisch römischen Gesichtszügen. »Was ist los? Was hast du gemacht?«
»Was getan werden musste. Nicht mehr und nicht weniger«, sagte die Frau ruhig. »Spring ins Wasser und zieh uns an Land. Es ist noch hell genug.«
Er rührte sich nicht, starrte unverwandt auf die weiß beschürzte Gestalt am Strand, während er mit den Händen über seine abgeschnittenen Jeans strich. »Mein Gott, sie ist nur ein Hausmädchen!«, rief er. Sein Englisch hatte einen italienischen Akzent. »Du bist ein Ungeheuer!«
»So ist es nun mal, mein Junge. Bin ich es nicht auch im Bett? Und war ich es nicht, als ich die drei Männer erschoss, die dir einen Strick über den Kopf gezogen hatten und dich von der Kaimauer stoßen wollten, um dich für den Mord an dem suprèmo zu hängen?«
»Ich habe ihn nicht getötet. Das habe ich dir schon hundertmal gesagt!«
»Aber sie glaubten, dass du es warst. Und das hat genügt.«
»Ich wollte zur Polizei gehen. Du hast mich daran gehindert!«
»Einfaltspinsel! Glaubst du, dass du je vor ein Gericht gestellt worden wärest? Nie. Du wärest auf der Straße erschossen worden wie ein räudiger Hund, denn der suprèmo, so korrupt wie er war, stand bei den Hafenarbeitern hoch im Ansehen. Sie haben schließlich auch von ihm profitiert.«
»Ich habe mich mit ihm gestritten, das war alles! Dann bin ich weggegangen und hab Wein getrunken.«
»Und das reichlich! Als man dich auf der Straße fand, hattest du deine Sinne nicht mehr beisammen. Du bist erst wieder zu dir gekommen, als du mit einem Strick um den Hals an der Kaimauer standest… Und wie viele Wochen habe ich dich versteckt, bin mit dir von einem Ort zum anderen gezogen, während die Kerle aus dem Hafenviertel hinter dir her waren, um dich umzulegen?«
»Ich habe nie verstanden, warum du so gut zu mir warst.«
»Ich hatte meine Gründe… Ich habe sie noch immer.«
»Gott ist mein Zeuge, Cabi«, sagte der junge Mann, immer noch die Leiche auf dem Strand anstarrend. »Ich schulde dir mein Leben; aber ich habe nie… nie gedacht, dass so etwas passieren würde.«
»Möchtest du lieber nach Italien zurückkehren, nach Portici zu deiner Familie, den sicheren Tod vor Augen?«
»Nein, nein, natürlich nicht, Signora Cabrini.«
»Dann willkommen in unserer Welt, mein kleiner Liebling«, sagte die Frau. »Und glaube mir, du wirst Verlangen haben nach allem, was du von mir bekommst. Du bist ein Schatz; ich kann dir gar nicht sagen, was für ein Schatz du bist… Zieh das Boot an Land, mein süßer Nico… Sofort!«
Der junge Mann tat, wie ihm befohlen war.
Deuxième bureau, Paris
»Das ist sie«, sagte der Mann hinter dem Schreibtisch in dem abgedunkelten Büro. An die rechte Wand war eine detailgetreue Karte der Karibik projiziert, einschließlich der Kleinen Antillen. Ein flackernder blauer Punkt markierte die Insel Saba. »Wir können annehmen, dass sie durch die Anegada-Passage zwischen Dog Island und Virgin Gorda gesegelt ist– das war die einzige Möglichkeit, den Sturm zu überstehen. Wenn sie ihn überstanden hat.«
»Vielleicht hat sie’s nicht«, sagte ein Untergebener, der vor dem Schreibtisch saß und die Karte anschaute. »Das würde uns das Leben leichter machen.«
»Ohne Frage.« Der Leiter des Deuxième zündete sich eine Zigarette an. »Aber bei dieser reißenden Wölfin, die die schlimmsten Tage von Beirut überlebt hat, brauche ich unwiderlegbare Beweise, bevor ich die Jagd abblase.«
»Ich kenne die Gewässer dort«, sagte ein zweiter Mann, der links neben dem Schreibtisch stand. »Ich war während der Kubakrise auf Martinique stationiert, und ich weiß, wie tückisch die Winde dort sein können. Nach allem, was ich über den Sturm erfahren habe, kann sie ihn nicht überlebt haben– nicht mit dem Boot, das sie hatte.«
»Und ich glaube, dass sie es geschafft hat«, sagte der Chef des Deuxième scharf. »Ich kann es mir nicht erlauben, Vermutungen anzustellen. Ich kenne die Gewässer nur von den Karten, aber ich sehe hier Dutzende von kleinen Buchten, in denen sie Zuflucht gefunden haben könnte. Ich habe sie mir genau angesehen.«
»Nein, Henri. Bei diesen Inseln wechseln die Winde von einer Minute zur anderen ihre Richtung. Wenn eine Insel bewohnt ist, dann ist sie auch als solche markiert. Ich kenne diese Inseln. Sie auf der Karte anzuschauen ist etwas anderes, als sie auf der Suche nach einem sowjetischen U-Boot einzeln abzufahren. Ich sage Ihnen, sie hat es nicht geschafft.«
»Ich hoffe, dass Sie recht haben, Ardisonne. Auf dieser Welt ist für Amaya Bajaratt kein Platz.«
Central Intelligence Agency, Langley, Virginia
In dem weiß gekalkten, unterirdischen Kommunikationszentrum der CIA war ein abgeschlossener Raum einer Einheit von zwölf Analytikern vorbehalten, neun Männern und drei Frauen, die jeweils in drei Schichten rund um die Uhr arbeiteten. Es waren Spezialisten, die mehrere Sprachen beherrschten und den internationalen Funkverkehr abhörten, darunter zwei der erfahrensten Kryptographen der Agency. Sie alle waren verpflichtet worden, ihre Tätigkeit niemandem zu offenbaren, selbst den eigenen Ehepartnern nicht.
Ein etwa fünfundvierzigjähriger Mann im offenen Hemd schob seinen gepolsterten Drehstuhl zurück und blickte seine Kollegen an, eine Frau und zwei andere Männer. Es war fast vier Uhr morgens, die Hälfte der Nachtschicht vorüber. »Vielleicht ist da etwas für uns«, sagte er, sich an alle wendend.
»Was?«, fragte die Frau. »Soweit es mich betrifft, ist heute nichts los.«
»Spuck es aus, Ron«, sagte der Mann, der dem Sprecher am nächsten saß. »Radio Bagdad macht mich ganz dusselig mit dem Unsinn, den die da verzapfen.«
»Versuch es mit Bahrein statt Bagdad«, sagte Ron und nahm ein von seinem Rechner ausgedrucktes Blatt aus dem Ablagekorb.
»Was ist mit Bahrein?« Der dritte Mann sah von seinem Kontrollpult auf.
»Unsere Quelle in Manamah meldet, dass eine halbe Million, in US-Dollar, auf ein Nummernkonto in Zürich überwiesen worden ist, bestimmt für…«
»Eine halbe Million?«, unterbrach der zweite Mann. »Für das reiche Bahrein ist das doch nur Schneckenschiss.«
»Ich habe euch noch nicht gesagt, für wen das Geld bestimmt ist und wie es überwiesen wird. Die Bank von Abu Dhabi an die Crédit Suisse in Zürich…«
»Das ist die Beka’a-Tal-Verbindung«, sagte die Frau sofort. »Bestimmungsort?«
»Die Karibik, genauer Bestimmungsort unbekannt.«
»Finde ihn!«
»Im Augenblick ist das unmöglich.«
»Warum?«, fragte der dritte Mann. »Hast du keine Bestätigung bekommen?«
»Ich habe eine Bestätigung– die denkbar schlechteste. Unser Informant wurde getötet– eine Stunde nachdem er Kontakt mit unserem Verbindungsmann in der Botschaft aufgenommen hatte, einem Protokollbeamten, der jetzt auf schnellstem Weg abgezogen wird.«
»Das Beka’a-Tal«, sagte die Frau ruhig. »Die Karibik. Bajaratt.«
»Ich schicke ein Fax an O’Ryan. Wir brauchen seine Hilfe.«
»Wenn es heute eine halbe Million sind«, sagte der dritte Mann, »können es morgen, sobald sich die Verbindung bewährt hat, fünf sein.«
»Ich kannte unseren Mann in Bahrein«, sagte die Frau leise. »Er war ein netter Kerl mit einer reizenden Frau und Kindern– verdammte Scheiße. Bajaratt!«
MI-6, London
»Unser Außenposten in Dominica ist nach Norden geflogen und bestätigt die Information, die wir von den Franzosen erhalten haben.« Der Direktor der Auslandsabteilung des britischen Geheimdienstes näherte sich einem quadratischen Tisch in der Mitte des Konferenzraums. Auf dem Tisch lag ein großer, dicker Band, einer von den Hunderten, die in den Bücherregalen an den Wänden des Raumes standen und detaillierte Karten von allen Gegenden der Welt enthielten. Der Band auf dem Tisch trug in goldgeprägten Buchstaben die Aufschrift The Caribbean– Windward and Leeward Islands. The Antilles. British and U. S. Virgin Territories.»Könnten Sie mir bitte die Anegada-Passage heraussuchen«, bat er seinen Untergebenen.
»Natürlich.« Der andere Mann im Kartenraum trat schnell an den Tisch, als er die Verlegenheit seines Vorgesetzten bemerkte, dessen rechte Hand so verkrüppelt war, dass er sie nicht gebrauchen konnte. Er durchblätterte die schweren Glanzpapierseiten und schlug die entsprechende Karte auf. »Hier ist sie… Großer Gott, niemand hätte bei diesem Sturm so weit kommen können, nicht in einem so kleinen Boot.«
»Vielleicht hat sie es auch nicht geschafft.«
»Was geschafft?«
»Dorthin zu gelangen.«
»Von Basse-Terre zur Anegada in den drei Tagen? Kann ich mir nicht vorstellen. Sie hätte mehr als die Hälfte der Zeit auf offener See kreuzen müssen.«
»Deswegen habe ich Sie hergebeten. Sie kennen die Gegend ziemlich gut, nicht wahr? Sie waren dort stationiert.«
»Wenn es einen Mann gibt, der sich in diesem Teil der Karibik auskennt, dürfte ich es ein. Ich war neun Jahre dort, Stützpunkt Tortola, und habe die ganze verdammte Region abgeklappert– ein recht angenehmes Leben übrigens. Ich stehe immer noch mit einigen alten Freunden in Verbindung. Sie alle dachten, ich sei ein reicher Nichtstuer, der es sich leisten kann, mit seinem Flugzeug von einer Insel zur nächsten zu fliegen.«
»Ja, ich habe Ihre Akten gelesen. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet.«
»Der Kalte Krieg war auf meiner Seite, und ich war vierzehn Jahre jünger– obwohl schon damals kein junger Mann mehr. Heute würde ich mich über diesen Gewässern nicht mehr in eine Maschine setzen.«
»Ich verstehe«, sagte der Direktor und beugte sich über die Karte. »Nach Ihrer Expertenmeinung hat sie also nicht überleben können.«
»Können ist zu absolut. Sagen wir, es ist höchst unwahrscheinlich, fast unmöglich.«
»Das glaubt auch Ihr Kollege im Deuxième.«
»Ardisonne?«
»Sie kennen ihn?«
»Deckname Richelieu. Ja, natürlich. Guter Mann, wenn auch ein bisschen rechthaberisch. Hat von Martinique aus operiert.«
»Er ist felsenfest davon überzeugt, dass sie auf offener See untergegangen ist.«
»In diesem Fall mag er wirklich recht haben. Aber da Sie mich schon mal hergebeten haben– darf ich ein, zwei Fragen stellen?«
»Schießen Sie los, Cooke.«
»Diese Bajaratt ist offensichtlich so etwas wie eine Legende im Beka’a-Tal; aber obwohl ich in den letzten Jahren immer wieder diese Listen durchgegangen bin, kann ich mich nicht erinnern, jemals ihren Namen gelesen zu haben. Wie kommt das?«
»Weil es nicht ihr eigener Name ist, jedenfalls nicht der Bajaratt-Teil«, erwiderte der Leiter von MI-6. »Es ist der Name, den sie sich vor Jahren selbst gegeben hat– der Name, hinter dem sie ihr Geheimnis sicher versteckt glaubt. Denn sie nimmt an, dass niemand weiß, woher sie kommt und wer sie wirklich ist. Wir können die Möglichkeit nicht ausschließen, dass jemand sich als Maulwurf bei uns einschleicht; außerdem ist anzunehmen, dass sie eines Tages für größere Sachen eingesetzt wird, deshalb haben wir diese Information geheim gehalten.«
»Ach so, ich verstehe. Wenn Sie ihren wirklichen Namen kennen, können Sie ihre Vergangenheit rekonstruieren, sich ein Bild von ihrer Persönlichkeit machen und sogar in gewissem Maße voraussagen, was sie tun wird. Aber wer ist sie denn nun eigentlich, was ist sie?«
»Eine der gefährlichsten Terroristinnen, die es heute gibt.«
»Araberin?«
»Nein.«
»Israeli?«
»Nein. Sie sollten Ihre Spekulationen nicht zu weit treiben.«
»Unsinn. Der Mossad hat ein breites Spektrum von Aktivitäten… Aber würden Sie bitte meine Frage beantworten. Vergessen Sie nicht– ich habe den größten Teil meiner Dienstzeit auf der anderen Seite der Erde verbracht. Warum also ist diese Frau so ungeheuer gefährlich?«
»Sie ist käuflich.«
»Sie ist was…?«
»Sie geht überallhin, wo Unruhe herrscht, wo eine Rebellion, ein Aufstand vorbereitet wird, und bietet ihre Dienste dem an, der am meisten zahlt– mit bemerkenswerten Ergebnissen, wie ich hinzufügen darf.«
»Entschuldigen Sie, aber das klingt bescheuert. Eine alleinstehende Frau begibt sich an einen Unruheherd und bietet ihre Dienste an? Wie macht sie das, liest sie die Anzeigen in der Zeitung?«
»Das braucht sie nicht, Geoff«, erwiderte der Leiter von MI-6. Er kehrte an den Konferenztisch zurück und setzte sich etwas ungeschickt auf den Stuhl, den er mit seiner linken Hand zu sich hinzog. »Sie ist gründlich vertraut mit allem, was Destabilisierung betrifft. Weltweit. Sie kennt die Stärken und Schwächen der kriegführenden Parteien, kennt ihre Führer und weiß, wo sie zu erreichen sind. Sie ist weder moralisch noch politisch an irgendetwas gebunden. Ihr Beruf ist der Tod. So einfach ist das.«
»Ich finde nicht, dass das einfach ist.«
»Das Ergebnis ist es. Natürlich nicht der Anfang– das, was sie zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Setzen Sie sich, Geoffrey. Ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen, die wir uns Stück um Stück zusammengetragen haben.« Der Direktor öffnete einen großen Umschlag, dem er drei Fotos entnahm, Vergrößerungen von Schnappschüssen.
Das Gesicht auf jeder Aufnahme war deutlich zu erkennen. »Das ist Amaya Bajaratt.«
»Das sind drei verschiedene Frauen!«, rief Geoffrey Cooke.
»Welche ist sie?«, fragte der Direktor. »Oder sind alle drei dieselbe Person?«
»Ich sehe, was Sie meinen…«, sagte der Beamte nachdenklich. »Das Haar ist bei jeder anders– blond, schwarz und brünett, nehme ich an. Kurz, lang und mittellang. Aber die Gesichtszüge unterscheiden sich… wenn auch nicht stark. Dennoch sind sie unterschiedlich.«
»Plastikteile in Fleischtönen? Wachs? Beherrschung der Gesichtsmuskeln? Alles nicht schwer zu bewerkstelligen.«
»Eine Spektrographie würde es vermutlich erweisen. Jedenfalls hinsichtlich der Aufsätze, ob aus Plastik oder Wachs.«
»Sollte man glauben, aber unsere Fachleute behaupten, dass es chemische Verbindungen gibt, die spektrographisch nicht zu erfassen sind. Selbst Brechungen von hellem Licht können täuschen. Das heißt natürlich, dass sie es nicht wissen und nicht riskieren wollen, etwas Falsches zu sagen.«
»Also gut«, sagte Cooke. »Vermutlich ist sie zumindest eine der Frauen. Aber wie können Sie das mit Sicherheit wissen?«
»Es ist eine Frage des Vertrauens, nehme ich an.«
»Des Vertrauens?«
»Wir und die Franzosen haben viel Geld für diese Fotos bezahlt– aus einem Geheimfonds, auf den wir schon seit Jahren zurückgreifen. Niemandem ist daran gelegen, von dieser wichtigen Geldquelle abgeschnitten zu werden, indem er uns eine Fälschung unterjubelt. Sie sind alle felsenfest überzeugt, die Bajaratt auf dem Film zu haben.«
»Aber wohin ist sie gesegelt? Von Basse-Terre zur Anegada, wenn es Anegada war, sind es mehr als zweihundert Kilometer– und das bei zwei heftigen Stürmen. Und warum die Anegada-Passage?«
»Weil die Jolle vor der Küste von Marigot gesichtet wurde. Sie konnte wegen der Felsen nicht in die Bucht einlaufen, und der kleine Hafen war vom Sturm völlig zerstört worden.«
»Von wem gesichtet?«
»Von Fischern, die die Hotels auf Anguilla beliefern. Außerdem ist ihre Aussage von unserem Mann in Dominica bestätigt worden.« Als er Cookes fragenden Ausdruck sah, fuhr der Direktor fort: »Unser Mann flog, Anweisungen aus Paris folgend, nach Basse-Terre und versicherte, dass eine Frau etwa im Alter der Bajaratt zusammen mit einem großen, muskulösen jungen Mann ein Boot gechartert hat. Einem sehr jungen Mann. Das stimmt mit Informationen aus Paris überein, dass eine Frau ihres Alters und ihrer Beschreibung, vermutlich mit einem falschen Pass, in Gesellschaft eines solchen Jünglings von Marseille auf die Insel Guadeloupe geflogen ist, die, wie Sie wissen, aus zwei Inseln besteht, Grande- und Basse-Terre.«
»Wieso hat der Zoll in Marseille den Jungen und die Frau miteinander in Verbindung gebracht?«
»Er sprach kein Französisch. Sie sagte, er sei ein entfernter Verwandter aus Lettland, dessen sie sich angenommen habe, als seine Eltern starben.«
»Verdammt unwahrscheinlich.«
»Aber völlig glaubwürdig für unsere Freunde in Frankreich. Denen ist sowieso alles egal, was sich nördlich der Rhône abspielt.«
»Aber warum sollte sie mit einem Teenager reisen?«
»Fragen Sie mich nicht. Ich habe keine blasse Ahnung.«
»Und noch einmal: Wohin ist sie gesegelt?«
»Ein noch größeres Rätsel. Sie ist eine erfahrene Seglerin und wäre normalerweise vor Anker gegangen, bevor das Unwetter losbrach– vor allem, da die Jolle ein Funkgerät an Bord hatte und im ganzen Gebiet in vier Sprachen Sturmwarnungen ausgegeben wurden.«
»Falls sie nicht ein Rendezvous hatte, das sie unbedingt einhalten wollte.«
»Das ist natürlich die einzig plausible Erklärung. Aber auf das Risiko hin, dabei ihr Leben zu verlieren?«
»Ebenfalls unwahrscheinlich«, räumte Cooke ein. »Es sei denn, es gibt Umstände, von denen wir nichts wissen… Fahren Sie fort; Sie haben anscheinend eine Antwort gefunden.«
»Nur teilweise, fürchte ich. Gehen wir einmal davon aus, dass niemand als Terrorist geboren wird, sondern erst durch bestimmte Ereignisse dazu gemacht wird. Außerdem gibt es verlässliche Berichte, nach denen sie zwar mehrere Sprachen spricht, aber auch in einer gehört wurde, die kein Mensch verstehen konnte…«
»Das kann von den europäischen Sprachen nur Baskisch gewesen sein«, unterbrach Cooke.
»Genau. Wir haben eine Undercover-Einheit in die Provinzen Vizcaya und Alva geschickt, um zu sehen, ob sich da etwas ausgraben lässt, und sind auf einen Zwischenfall gestoßen, der sich vor einigen Jahren in einem kleinen, von aufständischen Basken bewohnten Dorf in den westlichen Pyrenäen ereignet hat. Eine dieser grauenvollen Geschichten, die in Legenden fortleben, von einer Generation zur nächsten.«
»So etwas wie My Lai oder Bai Jar?«, fragte Cooke. »Ein Massen-Massaker?«
»Noch schlimmer. Bei einem Überfall auf das Dorf wurde die gesamte erwachsene Bevölkerung von einer marodierenden Einheit hingerichtet– wobei unter erwachsen alle zu verstehen sind, die zwölf Jahre oder älter waren. Die jüngeren Kinder wurden gezwungen, dem Gemetzel zuzuschauen, und dann schutzlos in den Bergen zurückgelassen.«
»Die Bajaratt war eines dieser Kinder?«
»Ich will versuchen, es Ihnen zu erklären. Die Basken, die in diesen Bergen leben, sind sehr isoliert. Es ist Brauch bei ihnen, dass sie ihre Aufzeichnungen unter Zypressen an der äußersten Nordgrenze ihres Gebiets vergraben. Zu unserer Einheit gehörte ein Anthropologe, der sich auf die Bergstämme der Pyrenäen spezialisiert hat und ihre Sprache beherrscht. Er fand die Aufzeichnungen. Die letzten Seiten waren von einem jungen Mädchen geschrieben worden, das die Schreckenstaten schilderte– unter anderem die Enthauptung seiner Eltern, wobei die Henker ihre Bajonette an den Felsen wetzten, bevor sie vor den Augen des Mädchens den Vater und die Mutter töteten.«
»Wie grauenvoll! Und dieses Mädchen ist die Bajaratt?«
»Sie unterschrieb als Amaya el Baj… Yovamanaree, was im Baskischen dem spanischen jovena mujer entspricht, einer jungen Frau. Danach folgt ein Satz in perfektem Spanisch: Muerte a toda autoridad.«
»Tod jeder Obrigkeit«, übersetzte Cooke. »Das ist alles?«
»Nein, es gibt da noch zwei Dinge. Sie fügte eine letzte Bemerkung hinzu– ein Kind von zehn Jahren, stellen Sie sich das vor! Sie schrieb: Shirharrá Baj.«
»Was zum Teufel soll das heißen?«
»Grob übersetzt eine junge Frau, die bald empfängnisbereit ist, aber nie ein Kind in die Welt setzen wird.«
»Sicher makaber, aber unter den Umständen durchaus zu verstehen.«
»Die Legenden der Bergstämme berichten von einer Kindfrau, die die anderen Kinder des Dorfes aus den Bergen führte, an Dutzenden von Patrouillen vorbei. Sie tötete sogar Soldaten mit deren eigenen Bajonetten, nachdem sie sie in ausgeklügelte Fallen gelockt hatte.«
»Ein Mädchen von zehn… Es ist unglaublich!« Geoffrey Cooke runzelte die Stirn. »Sie sagten, es gäbe noch zwei Dinge. Was ist das zweite?«
»Das letzte Beweisstück, das ihre Identität für uns bestätigte. Unter den vergrabenen Aufzeichnungen befanden sich auch Familien-Stammbäume– einige isolierte Stämme der Basken leben in der ständigen Furcht vor Inzucht; das ist der Grund, weshalb so viele junge Männer und Frauen ins Ausland geschickt werden. Jedenfalls gab es eine Familie ›Aquirre, erstes Kind eine auf den Namen Amaya getaufte Tochter‹, ein geläufiger Name. Der Nachname war ausgekratzt– wütend ausgekratzt wie von einem zornigen Kind– und durch den Namen Bajaratt ersetzt worden.«
»Mein Gott, warum? Haben Sie es herausgefunden?«
»Ja. Unsere Jungs brachten es schließlich von unseren Kollegen in Madrid in Erfahrung– nicht ohne damit zu drohen, ihnen unsere dringend benötigte Hilfe zu entziehen, wenn sie nicht bestimmte geheime Unterlagen über die Kämpfe gegen die Basken für sie öffneten. Sie haben das Wort ›makaber‹ benutzt, ohne zu wissen, wie angebracht es ist. Wir fanden den Namen Bajaratt. Ein Unteroffizier– Mutter Spanierin, Vater an der Grenze lebender Franzose, was den Namen erklärt–, der an dem Massaker an den Dorfbewohnern beteiligt war. Kurz gesagt, er war der Soldat, der Amaya Aquirres Mutter getötet hat. Sie nahm den Namen an, der für sie alles an Grauen in sich barg, das sie durchgemacht hatte– sie würde es nie vergessen, solange sie lebte. Sie würde eine Mörderin werden wie der Mann, der vor ihren Augen das Bajonett durch den Hals ihrer Mutter gezogen hatte.«
»Eine perverse Vorstellung«, sagte Cooke kaum hörbar. »Aber nachvollziehbar. Ein Kind nimmt die Gestalt eines Ungeheuers an, lebt seine Rachefantasien dadurch aus, dass es sich mit ihm identifiziert. Das hat Ähnlichkeiten mit dem Stockholm-Syndrom, bei dem brutal behandelte Gefangene sich mit ihren Wärtern identifizieren. Wie muss sich so etwas erst auf ein Kind auswirken… Amaya Aquirre ist also Amaya Bajaratt. Doch obwohl sie ihren wirklichen Nachnamen verleugnet, hatte sie offensichtlich Schwierigkeiten, den Namen Bajaratt voll auszuschreiben.«
»Wir haben einen Psychiater konsultiert, der sich mit seelischen Störungen im Kindesalter beschäftigt«, sagte der Leiter von MI-6. »Er sagte uns, dass ein junges Mädchen von zehn Jahren weiter entwickelt sei als ein Junge gleichen Alters– und angesichts meiner zahlreichen Enkelkinder muss ich ihm widerwillig zustimmen. Er fügte hinzu, dass ein Mädchen dieses Alters, das einer derartigen Stresssituation ausgesetzt sei, dazu neige, nur einen Teil ihrer Persönlichkeit preiszugeben.«
»Ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstehe.«
»Er nannte es das Testosteron-Syndrom. Ein Junge würde unter ähnlichen Umständen ›Tod jeder Obrigkeit‹ schreiben und mit seinem vollen Namen unterzeichnen, während ein Mädchen sich anders verhält. Sie muss ihren Feind überlisten, sie kann ihn nicht durch Körperkraft überwinden… Sie kann nur einen Teil ihrer selbst ins Spiel bringen.«
»Das leuchtet mir ein«, sagte Cooke und nickte. »Aber mein Gott– im Boden vergrabene Aufzeichnungen, Zypressen und blutige Initiationsriten, Massenhinrichtungen, enthauptete Menschen… Und das alles hat ein zehnjähriges Kind durchgemacht! Wir müssen es hier mit einer hochgradigen Psychopathin zu tun haben! Sie hat nur den einen Wunsch, Köpfe rollen zu sehen– wie es mit ihren Eltern geschehen ist.«
»Muerte a toda autoridad«, sagte der Leiter von MI-6. »Die Köpfe der Obrigkeit– überall.«
»Ja, ich verstehe den Satz…«
»Ich fürchte, Sie verstehen die Tragweite nicht ganz.«
»Bitte?«
»In den letzten Jahren hat die Bajaratt mit dem Führer einer besonders radikalen Palästinensergruppe im Beka’a-Tal zusammengelebt und sich fanatisch seiner Sache angeschlossen. Offensichtlich hat sie ihn im letzten Frühling geheiratet. Er wurde vor neun Wochen bei einem Überfall am Strand von Askalon, südlich von Tel Aviv, getötet.«
»Ja, ja. Ich erinnere mich, darüber gelesen zu haben«, sagte Cooke. »Bis auf den letzten Mann niedergemacht, keine Gefangenen.«
»Erinnern Sie sich auch an die Verlautbarung, die von den restlichen Mitgliedern der Gruppe, namentlich ihrer neuen Führerin, weltweit veröffentlicht wurde?«
»Irgendwas über Waffen, oder?«
»Genau. Es hieß dort, dass die israelischen Waffen, durch welche die ›Freiheitskämpfer‹ getötet wurden, aus Amerika, England und Frankreich stammten und dass die ihres Landes beraubten Menschen nie den Bestien vergeben würden, die diese Waffen geliefert hätten.«
»Wir hören dauernd solchen Blödsinn. Was soll’s?«
»Amaya Bajaratt, die ihrem Namen den nom de guerre›Die nie Verzeihende‹ hinzugefügt hat, hat dem Hohen Rat im Beka’a-Tal eine Nachricht zukommen lassen, die Ihre Freunde oder Exfreunde im Mossad glücklicherweise abgefangen haben. Die Bajaratt und ihre Genossen haben demnach ihr Leben der Aufgabe geweiht, ›die Köpfe der vier großen Bestien‹ abzuschlagen. Sie selbst wird der ›Blitzstrahl‹ sein, der das Zeichen gibt.«
»Was für ein Zeichen?«
»Soweit der Mossad herausgefunden hat, wird es das Zeichen für die von ihr gedungenen Killer in London, Paris und Jerusalem sein, zuzuschlagen. Die Israelis glauben, es sei in dem Teil der Nachricht impliziert, der lautet: ›Wenn die abscheulichste dieser Bestien jenseits des großen Meeres stirbt, müssen die anderen ihr folgen.‹«
»Die abscheulichste…? Jenseits des… Mein Gott, Amerika?«
»Ja, Cooke. Amaya Bajaratt ist ausgezogen, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu ermorden. Das ist ihr ›Zeichen‹.«
»Aber das ist grotesk!«
»Nach allem, was wir von ihr wissen, keineswegs. Professionell hat sie noch nie versagt. Sie ist ein pathologisches Genie, und dies ist ihre Rache an der ›brutalen‹ Obrigkeit– verstärkt durch ein zutiefst persönliches Motiv, den Tod ihres Mannes. Wir müssen sie aufhalten, Geoffrey. Das ist der Grund, weshalb das Foreign Office, mit voller Billigung unserer Organisation, sich entschlossen hat, Sie unverzüglich an Ihren früheren Posten in der Karibik zurückzuversetzen. Wie Sie selbst gesagt haben, gibt es keinen, der sich dort besser auskennt.«
»Hören Sie! Sie reden mit einem vierundsechzig Jahre alten Mann, der kurz vor seiner Pensionierung steht.«
»Sie haben immer noch Kontakte auf den Inseln. Wo sie nicht mehr bestehen, werden wir Ihnen ein Entree verschaffen. Offen gesagt, wir sind der Überzeugung, dass Sie schneller vorankommen werden als jeder andere. Wir müssen sie finden und außer Landes schaffen.«
»Sind Sie schon mal auf die Idee gekommen, alter Junge, dass sie, selbst wenn ich noch heute abfliegen würde, bereits Gott weiß wo sein kann? Das ist doch… Entschuldigen Sie, aber mir fällt immer noch kein anderes Wort ein als bescheuert.«
»Was den ersten Teil Ihrer Bemerkungen betrifft«, sagte der Direktor und lächelte, »so glauben weder die Franzosen noch wir, dass sie ihren momentanen Aufenthaltsort in den nächsten Tagen verlassen wird. Nicht vor Ablauf mindestens einer Woche.«
»Haben Ihre Kristallkugeln Ihnen das gesagt?«
»Nein, unser gesunder Menschenverstand. Was sie sich vorgenommen hat, erfordert sorgfältige Planung; sie muss auf menschliche, finanzielle und technische Ressourcen zurückgreifen, zu denen auch ein Flugzeug gehört. Sie ist vielleicht eine Psychopathin, aber sie ist nicht dumm. Sie wird die nötigen Vorbereitungen nicht auf dem amerikanischen Festland treffen.«
»Und wo könnte sie das besser als an einem Ort, der den unmittelbaren Nachforschungen der Bundesbehörden entzogen ist«, räumte Cooke widerwillig ein, »doch wiederum nahe genug, um Zugang zu sämtlichen Festlandressourcen zu behalten.«
»So sehen wir das auch«, sagte der Leiter von MI-6.
»Ich frage mich, warum sie dem Beka’a-Rat bloß diese Nachricht hat zukommen lassen.«
»Ihre Götterdämmerung vielleicht. Sie braucht das Gefühl, bewundert zu werden, mit ihren Taten in die Geschichte einzugehen. Psychologisch vollkommen verständlich.«
»Nun ja. Und Sie meinen, die Aufgabe, vor die Sie mich da stellen, sei einfach unwiderstehlich, was?«
»Das hatte ich gehofft.«
»Sie haben mich gut darauf vorbereitet, nicht wahr? Ausgehend von der Beschreibung einer rätselhaften Persönlichkeit über ein grauenvolles, doch faszinierendes Dossier bis zur akuten Krisensituation. Immer die richtigen Knöpfe gedrückt.«
»Hätten Sie’s anders gemacht?«
»Nein. Sie sind ein Profi und würden nicht auf diesem Stuhl sitzen, wenn Sie es nicht wären.« Cooke stand auf und sah seinen Vorgesetzten an. »Also schön, Sie können mit mir rechnen. Aber ich würde gern einen Vorschlag machen.«
»Nur zu, alter Freund.«
»Ich war nicht ganz offen Ihnen gegenüber. Ich habe gesagt, dass ich noch immer Kontakt zu einigen alten Freunden habe und damit so etwas wie eine lockere Verbindung angedeutet. Das stimmt auch mehr oder weniger, aber es ist nicht alles. Tatsächlich habe ich in den letzten Jahren fast jeden Urlaub auf den Inseln verbracht– man kehrt immer wieder zurück, wenn man einmal dort gewesen ist, wissen Sie. Und natürlich«, fuhr er fort, »kommen frühere Kollegen und neue Bekannte mit ähnlichem beruflichem Hintergrund zusammen und tauschen alte Erinnerungen aus.«
»Natürlich.«
»Also, vor zwei Jahren bin ich einem Amerikaner begegnet, der die Inseln besser kennt, als ich sie jemals kennen werde. Er besitzt zwei Yachten, die er in mehreren Häfen von Charlotte Amalie bis Antigua verchartert. Er kennt jede Bucht und jeden Meeresarm der Inselkette; es ist sein Beruf.«
»Das sind ausgezeichnete Referenzen, Geoffrey, aber kaum…«
»Bitte«, unterbrach Cooke. »Ich bin noch nicht fertig. Um Ihren Einwänden entgegenzukommen– er ist ein ehemaliger Offizier des Geheimdienstes der U. S. Navy. Noch relativ jung, Anfang bis Mitte vierzig, schätze ich. Ich weiß nicht, warum er den Dienst quittiert hat. Ich vermute jedoch, dass die Umstände nicht sehr angenehm waren. Dennoch könnte er bei dieser Sache sehr hilfreich sein.«
Der Leiter von MI-6 beugte sich über den Tisch, die steife rechte Hand mit der linken umfassend, und sagte: »Sein Name ist Tyrell Nathaniel Hawthorne der Dritte. Er ist der Sohn eines Professors für amerikanische Literatur an der University of Oregon. Die Umstände seiner Entlassung aus der Marine waren tatsächlich alles andere als angenehm. Ja, er könnte eine enorme Hilfe sein; aber niemand von unseren Freunden in Washington hat ihn bewegen können, wieder für sie zu arbeiten. Sie haben ständig versucht, ihn umzustimmen, aber vergeblich. Er hat wenig Achtung vor diesen Leuten, da er der Überzeugung ist, dass sie den Unterschied zwischen der Wahrheit und einer Lüge nicht kennen. Er hat ihnen gesagt, dass sie sich zum Teufel scheren sollen.«
»Du meine Güte!«, rief Geoffrey Cooke. »Sie wussten von meinen Ferien auf den Inseln, Sie wussten von Anfang an davon. Sie wussten sogar von meiner Bekanntschaft mit Hawthorne.«
»Ein dreitägiger Segeltörn durch die Leewards, zusammen mit Ihrem Freund Ardisonne, Deckname Richelieu.«
»Sie alter Gauner.«
»Aber, aber, Cooke, Sie gehen zu weit. Übrigens, der ehemalige Lieutenant Commander Hawthorne ist auf dem Weg zum Yachthafen in Britisch Gorda, wo er Probleme mit seinem Motor bekommen dürfte. Ihre Maschine nach Anguilla fliegt um fünf Uhr ab, Zeit genug zum Packen. Von dort werden Sie und Ihr Freund Ardisonne eine kleine Privatmaschine nach Virgin Gorda nehmen.« Der Leiter von MI-6 bedachte sein Gegenüber mit einem strahlenden Lächeln. »Freuen Sie sich auf ein nettes Wiedersehen.«
State Department, Washington, D. C.
Um den Tisch im Konferenzsaal saßen der Außen- und der Verteidigungsminister, die Direktoren der Central Intelligence Agency und des Federal Bureau of Investigation, die Chefs des Geheimdienstes der Army und der Navy und der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff. Links neben ihnen hatten die jeweiligen Adjutanten Platz genommen, alles hochrangige, von den Sicherheitsdiensten sorgfältig überprüfte Offiziere. Den Vorsitz führte der Außenminister. Er eröffnete das Gespräch.
»Sie sind alle im Besitz derselben Informationen wie ich; ich kann mich also kurzfassen. Einige von Ihnen sind vielleicht der Meinung, dass wir übertrieben reagieren, und bis zum heutigen Morgen bin ich auch dieser Meinung gewesen. Eine allein operierende Terroristin, die von dem Wahn besessen ist, den Präsidenten zu ermorden, um dadurch das Signal zur Ermordung der politischen Führer Großbritanniens, Frankreichs und Israels zu geben– eine absurde Vorstellung, wie es scheint. Aber heute Morgen um sechs erhielt ich einen Anruf von unserem Direktor der CIA, der mich um elf Uhr nochmals anrief. Da begann ich, meine Meinung zu ändern. Würden Sie bitte berichten, Mr. Gillette?«
»Gern, Mr. Secretary«, sagte der untersetzte DCI. »Gestern wurde unser Informant in Bahrein, der die finanziellen Transaktionen aus dem Beka’a-Tal überwacht hat, getötet– eine Stunde nachdem er unseren Undercover-Agenten davon unterricht hatte, dass eine halbe Million Dollar an die Crédit Suisse in Zürich überwiesen worden waren. Der Betrag war nicht übermäßig hoch, aber als unser V-Mann in Zürich versuchte, mit seinem eigenen Informanten bei der Bank Verbindung aufzunehmen, konnte er ihn nicht erreichen. Als er es später noch einmal versuchte– anonym natürlich, er gab sich als alter Freund aus–, wurde ihm gesagt, dass der Mann aus geschäftlichen Gründen nach London geflogen sei. Als er einige Stunden später in seine Wohnung zurückkehrte, fand er eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter vor. Sie war von seinem Informanten, der bestimmt nicht in London war, denn er bat, ziemlich aufgeregt, unseren Mann, ihn in einem Café in Dudendorf, einer kleinen Stadt etwa zwanzig Meilen von Zürich, zu treffen. Unser V-Mann fuhr sofort hin, aber sein Informant war nicht da.«
»Was halten Sie davon?«, fragte der Chef des Army-Geheimdienstes.
»Er wurde aus dem Verkehr gezogen, um zu vertuschen, welchen Weg das Geld genommen hat«, antwortete ein stämmiger Mann mit gelichteten roten Haaren, der links neben dem Direktor der Central Intelligence Agency, dem DCI, saß. »Das ist eine– freilich noch unbestätigte– Vermutung.«
»Die sich worauf gründet?«, fragte der Verteidigungsminister.
»Auf Logik«, erwiderte der Adjutant des DCI. »Zunächst wird der Mann in Bahrein getötet, weil er die ursprüngliche Information weitergegeben hat; dann erfindet der Mann in Zürich die Reise nach London, damit er unseren V-Mann in Dudendorf treffen kann. Die Beka’a-Leute kommen dahinter und versuchen die Spur zu vertuschen.«
»Und alles wegen einer sechsstelligen Überweisung?«, fragte der Chef des Geheimdienstes der Navy.
»Die Höhe des Betrages hat nichts zu bedeuten«, sagte der Adjutant des DCI. »Es geht darum, wer der Empfänger ist und wo er sich aufhält. Das ist es, was sie verbergen wollen. Außerdem kann sich die Höhe des Betrages verhundertfachen, sobald sich der Überweisungsweg als unbedenklich erwiesen hat.«
»Bajaratt«, sagte der Außenminister. »Sie hat sich also auf den Weg gemacht… In Ordnung, wir wissen, wie wir vorzugehen haben. Maximale Sicherheit ist die Parole. Wir, die wir hier am Tisch sitzen, und nur wir, werden die von unseren Abteilungen gesammelten Informationen untereinander austauschen. Kennzeichnen Sie ab sofort jede Mitteilung, die über Ihr Faxgerät läuft, als streng vertraulich; alle Telefongespräche zwischen uns werden nur noch auf abhörsicheren Leitungen geführt. Nichts darf nach außen dringen, sofern es nicht von mir oder dem DCI abgesegnet ist. Selbst Gerüchte über eine solche Operation können eine Verwirrung anrichten, die uns gefährlich werden kann.« Ein Summen war zu hören; es kam von dem roten Telefonapparat vor dem Außenminister. Er hob den Hörer ab. »Ja?… Es ist für Sie«, sagte er mit einem Blick auf den Leiter des CIA. Gillette stand von seinem Stuhl auf und trat an das Kopfende des Tisches. Er nahm den Hörer und meldete sich.
»Ich verstehe«, sagte er nach einer Minute konzentrierter Aufmerksamkeit. Er legte den Hörer auf und sah seinen Adjutanten an. »Da haben Sie Ihre Bestätigung, O’Ryan. Unser Mann in Zürich wurde auf dem Platzspitz gefunden, mit zwei Kugeln im Kopf.«
»Die sorgen dafür, dass die Schlampe nicht mit dem Arsch auf Grundeis geht«, sagte der CIA-Mann namens O’Ryan.
2
Der große, unrasierte Mann in weißen Shorts und einem schwarzen T-Shirt, die Haut von der Tropensonne tief gebräunt, ging über die Brücke und betrat den Anlegesteg. Am Ende der hölzernen Planken blieb er stehen, um auf die beiden Männer zu warten, die in einem Ruderboot auf ihn zukamen. Als sie anlegten, sagte er:
»Was zum Teufel soll das heißen? Mein Motor verliert Öl!Ich habe ihn bei Gegenwind benutzt, und er lief einwandfrei.«
»Hör mal, Kumpel«, erwiderte ein britischer Mechaniker und ergriff das Seil, das Tyrell Hawthorne ihm zugeworfen hatte. »Mir ist es scheißegal, wie dein Motor läuft. Du hast keinen Tropfen Öl mehr in der Kurbelwelle; das verschmutzt jetzt alles unseren hübschen kleinen Hafen hier. Wenn du wieder auslaufen willst, kannst du da draußen deinen Motor anwerfen, so oft du willst. Aber hier habe ich die Verantwortung, und melden muss ich dich dann auch.«
»Ist ja schon gut«, sagte Hawthorne und streckte dem Mann die Hand entgegen, um ihm auf den Laufsteg zu helfen. »Woran kann’s denn liegen?«
»Kaputte Dichtungen und zwei defekte Zylinder, Tye.« Der Mechaniker drehte sich um und legte ein zweites Seil um den Poller. Dann half er seinem Begleiter, auf den Steg zu klettern. »Wie oft habe ich dir gesagt, dass du deinen Motor bei längeren Törns zwischendurch arbeiten lassen musst. Die Dinger trocknen in dieser verdammten Hitze aus. Hab ich dir das nicht schon zwanzigmal gesagt?«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!