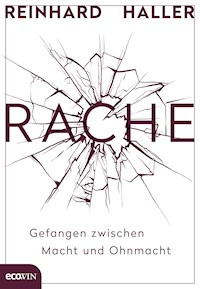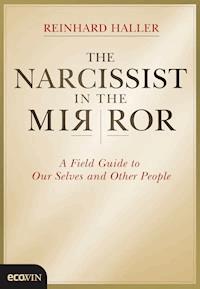Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Reinhard Haller versteht es seine Fälle so gut und mit soviel Nähe zu erzählen, dass man den Sog des Verwerflichen spürt und zugleich mit soviel Distanz, dass man sich nicht schuldig fühlen braucht." (FAZ) Die Seele als das weite Land und das Leck in ihr, das sich nicht schließen will, ehe das Verbrechen gegangen ist. Dieses Buch lässt niemanden los, der es einmal zur Hand genommen hat. Aus der Leidenschaft für den Beruf des Gerichtspsychiaters geboren, erzählt es von Dingen, die oft aus dem Leid selbst stammen und solches von neuem schaffen: von den Motiven und Impulsen kleiner wie großer Verbrechen rund um den Erdball, von der Persönlichkeit derer, die sie begehen. Es versucht, die Sprache des Verbrechens zu übersetzen, die Motivation der Täter verstehbar zu machen, Verschattetes zu erhellen und überindividuelle Zusammenhänge aufzuzeigen. Der Leser begibt sich mit dem Verbrecher auf eine Reise in das weite Land der Seele und in innere Welten, die diesem oft selbst verborgen bleiben. In der Analyse entstehen Bilder, die Abscheu, aber auch Mitleid hervorrufen, bisweilen eigenes Vertrautsein, viel mehr jedoch völliges Befremden, ja sogar Angst und Grauen auslösen. Und dennoch - man vergesse dies nicht - ist die Seele des Verbrechers nichts anderes als ein oft unbewusstes, zugespitztes Abbild der Psyche des Menschen schlechthin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reinhard Haller • Die Seele des Verbrechers
Reinhard Haller
Die Seele desVerbrechers
Motive • Impulse • Lebensbilder
Residenz Verlag
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2006 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:978-3-7017-4264-6
ISBN Printausgabe:978-3-7017-3037-7
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1 Der plötzliche Vernichtungsrausch – „Overkill“
2 Zu Tode beleidigt – Überreaktionen auf Kränkungen
3 Die Mutter aller Gewalttaten – der Affekt
4 Was sind Verbrechen und wer sind die Verbrecher?
5 Lust am Feuer und Lust durch das Feuer – Pyromanie
6 Stehlen als Krankheit – Kleptomanie
7 Das spielerische Verbrechen
8 Die vielen Gesichter der Sexualität – sexualisierte Störungen
9 Aggression und Perversion – sexuelle Gewalt
10 Der Übeltäter Nummer 1 – Alkohol
11 Zum Verbrecher geboren oder geworden?
12 Die Raserei im Kopf – Amoklauf
13 Lust am Töten – Serienkiller
14 Jack Unterweger – der eiskalte Narzisst
15 Von der Dosis hängt es ab – Psychologie des Giftmordes
16 Das Liebste auf der Welt – Mord aus Liebe oder Selbstliebe
17 Wie gefährlich sind Menschen mit psychischen Störungen?
18 Franz Fuchs – das gekränkte Genie
19 Und die Opfer?
Epilog
Glossar
Weiterführende Literatur
Sachregister
Prolog
Mein Beruf ist der des Gerichtspsychiaters. Diese Vorstellung mag gemischte Gefühle aufkommen lassen, da die Tätigkeit des forensischen Psychiaters sich mit dem Zusammentreffen von zwei gleichermaßen bedrückenden Bereichen beschäftigt, nämlich jenem des psychisch gestörten oder kranken und jenem des kriminell gewordenen Menschen. Unzweifelhaft ruft die Aura des Gerichtspsychiaters bei den meisten Menschen ein gewisses Unbehagen hervor: Bei den Beschuldigten, weil sie Angst vor psychiatrischer Stigmatisierung haben oder sich nicht genügend verstanden fühlen; in der Öffentlichkeit, weil Psychiater durch ihre analysierende und psychologisch verstehende Haltung scheinbar alles entschuldigen; bei den Prozessparteien und dem Gericht, weil Sachverständige oft die Fragen nach Normalität und Gestörtheit, nach Gesundem und Krankem nicht mit wissenschaftlicher Exaktheit und eindeutiger Zuordnung beantworten können. Niemand anderer hat das berufliche Dilemma des forensischen Psychiaters, zwischen den Machtblöcken Justiz und Medizin agierend, so trefflich beschrieben und die handwerklich-methodologischen Probleme der psychiatrischen Begutachtung so schonungslos aufgezeigt wie Robert Musil in seinem Mann ohne Eigenschaften.
Gerichtspsychiater zu sein ist aber gleichzeitig ein ungeheures Privileg. Wer kann denn sonst an großen Kriminalfällen derart direkt teilnehmen? Wer hat die Chance, die tiefsten Hintergründe eines Verbrechens, weit über den rein kriminalistischen Bereich hinaus, zu analysieren? Wer hat die Möglichkeit, mit dem Verbrecher eine Reise in das weite Land der Psyche und in innere Welten, die diesem oft selbst unbekannt sind, zu machen? Wenn mich Bekannte oder Freunde wegen meines Berufes und der schwierigen Aufgaben bedauern, weise ich sie darauf hin, dass ich, das Hobby gleichsam zum Beruf erkoren, nichts anderes mache als sie: den Thriller im Fernsehen, der sich meist mit fatalen Kombinationen von spektakulärer Straftat und psychisch abnormem Täter beschäftigt, erlebe ich in den Stunden der Exploration live.
Meine Vorstellungen von Verbrechern waren früher recht einfach: Menschen, die aus Charakter- oder Willensschwäche, aus Unbesonnenheit oder Nachlässigkeit, oft sogar aus bösem Willen die Gesetze übertreten hatten und deswegen bestraft gehören. Aus der Distanz einer weitgehend intakten Welt ließen sich Bilder vom arbeitsscheuen Betrüger, vom hinterhältigen Feuerteufel, vom skrupellosen Perversling oder vom kalten Mörder unschwer aufrechterhalten. Verbrecher waren so, wie sie in den Medien beschrieben und in Romanen gezeichnet werden, allfällige psychologische Betrachtensweisen beschränkten sich auf das Gestörte, Krankhafte und Abnorme. Dennoch gab es schon früh Zweifel, ob das alles wirklich so einfach ist. Ich erinnere mich, wie über die Idylle meiner Kindheit die Meldung von einem Raubmord in unserer Gegend hereinbrach. Auf den festgenommenen Täter wurden alle Formen von Angst, Aggression und Abwehr projiziert, das Bedürfnis nach Rache artete in einen von infantilem Eifer getriebenen Wettbewerb auf der Suche nach immer grausameren Bestrafungen aus. Meine Mutter, eine durch und durch wohlwollende und gütige Frau, holte uns damals unvermittelt auf den Boden einer anderen Sichtweise, indem sie sagte: „Der Täter ist ein armer Mensch, mir tut der Mann unheimlich Leid …“
In meinem Beruf als Psychiater wich die frühere Voreingenommenheit in der Begegnung mit psychisch kranken und gestörten Menschen einer analysierenden, verstehen wollenden, auf Hilfe und Heilung ausgerichteten Haltung. Auf der Suche nach immer neuen psychischen Phänomenen und getrieben vom Verlangen, für alle möglichen abweichenden Verhaltensweisen Erklärungen zu finden, bin ich dann – wohl nicht ganz zufällig – beim Spezialgebiet der Gerichtspsychiatrie gelandet. Hier öffnete sich für mich das Tor zu einer neuen Welt, zu jener des Verbrechens. Schon bald gelangte ich damals zur Erkenntnis, dass Verbrecher ganz normale Menschen sind, Menschen wie du und ich, Menschen mit oft gar nicht besonderen Lebenswegen, aber einem ganz besonderen Schicksal. Bei den Fragen nach den Motiven des Verbrechens und in der Analyse der Persönlichkeiten der Straftäter wurde mir immer mehr bewusst, dass unter bestimmten Bedingungen wahrscheinlich die meisten Menschen zum Verbrecher werden können, dass Verbrechen nicht immer etwas mit psychosozialer Störung oder psychopathischem Charakter zu tun haben muss und dass jeder Verbrecher auch sehr viele gesunde Anteile hat. Es gibt nicht den Verbrecher oder das Motiv, vielmehr stellen sich die meisten Straftaten als unselige Endstrecke eines längerfristigen psychischen Prozesses, einer ungünstigen Lebensgeschichte oder einer Reihe von belastenden Umgebungsfaktoren dar. Verbrecher sind oft ganz durchschnittliche Menschen, obwohl jeder sein eigenes äußeres und inneres Profil hat. Verbrecher sind jedenfalls sehr oft gute Psychologen. Je größer und spektakulärer die Straftat, desto umfassendere psychologische Kenntnisse stecken dahinter. Jeder Verbrecher war mir somit ein Stück weit auch Lehrmeister.
Verbrechen zu analysieren erfordert immer, Geschichten zu erzählen. Jedes Verbrechen hat seine Geschichte, und jede psychiatrische Expertise ist eine Geschichte. Manche werden Sie erschauern lassen, einige finden Sie banal, andere übersteigen Ihre Fantasie und Ihre Vorstellung vom Bösen, wieder andere werden Mitleid hervorrufen. Nur über die Geschichte ist die Psyche des Verbrechers zu erfassen, nicht über reine Statistik und nicht allein über wissenschaftliche Erklärungsmodelle. Ein psychiatrisches Gutachten ist eine Biografie, ein Kriminalroman, ein Thriller, ein Zeitdokument. Wenn es gelingt, ist es ein kleines Kunstwerk, ein in sich geschlossenes Ganzes, eine stimmige Erklärung. In einem Werk über die Psyche des Verbrechers muss vieles weggelassen werden, jedes der angeführten Beispiele würde die Grenzen eines Buches sprengen. Zusammenfassende Verkürzungen und erklärende Vereinfachungen sind unabdingbar.
Manche Verbrecher sind scheinbar zufällig in das Böse verstrickt worden oder durch widrige Umstände auf den verhängnisvollen Weg geraten. Andere haben ihre böse Tat kalt berechnend geplant und nichts dem Zufall überlassen. Manche wurden durch ihre schwere psychische Abnormität zum Spielball des Bösen, andere ließ ihre Krankheit zum Kriminellen werden. Viele haben aus einer hoch aufgeheizten affektiven Situation die Grenze zum Kriminellen überschritten, andere haben dies bewusst und mit voller Absicht getan. Das Verbrechen spielt alle Möglichkeiten menschlichen Verhaltens, die Ursache der Kriminalität lässt keine eindimensionalen Erklärungen zu.
Sind Verbrechen für uns so bedrückend und faszinierend zugleich, weil der Mensch als „universell kriminelles Wesen“ wie dies Sigmund Freud ausdrückt, auch in sich verbrecherische Anteile hat, die ihm vielleicht gar nicht bewusst sind, oder weil das auf den Verbrecher projizierte Strafbedürfnis eigene Schuldgefühle erleichtert? Hat der Serienmörder Ted Bundy tatsächlich Recht, wenn er meint: „Wenn irgendwelche Leute in mir ein Monster sehen, dann ist das etwas, dem sie sich in sich selber stellen müssen“, und ist es richtig, wenn Tiefenpsychologen die Lust am Entsetzen als etwas Urmenschliches bezeichnen? Legt der Verbrecher in uns tatsächlich auf abwendige Weise eine verschattete Dimension, einen schlummernden Abgrund unserer Seele frei? Oder werden wir einfach vom Interesse des Ermittlers, von der Neugier des Kriminologen oder vom Wunsch, das Böse auszurotten, getrieben?
Die Psychologie des Verbrechens ist ebenso komplex und letztlich unerforschlich wie die Psychologie des menschlichen Verhaltens schlechthin. Auch wenn alle Möglichkeiten beachtet, die Einflussfaktoren gewichtet und der Einmaligkeit jeder Straftat Rechnung getragen wird, kommen wir zur Erkenntnis: Die Psyche des Verbrechers ist nichts anderes als ein oft unbewusstes, zugespitztes Abbild der Psyche des Menschen schlechthin.
Der Gerichtspsychiater soll das Wissen seines Faches und die Ergebnisse seiner Untersuchungen dem Gericht in einer allgemein verständlichen Sprache darlegen. Er soll es verstehen, komplexe Zusammenhänge einfach darzulegen, Fachausdrücke zu vermeiden oder zu erklären und wissenschaftliche Theoretisierungen pragmatisch zu vereinfachen. Der forensische Psychiater muss sich aber vor allem bewusst sein – und dies auch eingestehen –, dass er vieles über die Psyche des Menschen nicht weiß. Der Organismus der Seele kann von keinem Menschen, auch nicht vom besten Psychologen oder Psychiater, erfasst und erklärt werden. Der in der Beurteilung des psychischen Hintergrunds von Verbrechen tätige Psychiater soll sagen, was er klar feststellen und beurteilen kann, er soll aber gleichermaßen jene Bereiche offen lassen, in denen es keine gesicherte Erkenntnis gibt. Diesen Ansprüchen soll auch dieses Buch gerecht werden: Jede Straftat ist einzigartig und in vielen Bereichen nicht mit anderen zu vergleichen, kein Motivbündel ist gleich wie das andere, kein Täter lässt sich einer allgemein gültigen Typologisierung unterordnen. Immer bleiben verschiedene Möglichkeiten offen und zahlreiche Fragen unbeantwortet. Den Leserinnen und Lesern dieses Buches bleibt daher eine wichtige Arbeit nicht erspart: Sie sollen sich aus den kriminologischen Fakten und den strafrechtlichen Beurteilungen, den psychologischen Analysen und den wissenschaftlichen Erklärungen, aus dem Vergleich mit anderen Fällen und dem eigenen Nachfühlen ein Bild machen. Ein Bild, das erschreckend und faszinierend sein kann, ein Bild, das Mitleid oder Abscheu erzeugt, das eigenes Vertrautsein oder völliges Befremden, oft auch Angst und Grauen auslöst, ein Bild, das immer unvollkommen sein wird. Der Gesetzgeber trägt diesen Unzulänglichkeiten dadurch Rechnung, dass er auch die psychische Letztbeurteilung dem Gericht überträgt. Laien- und Berufsrichter haben darüber zu entscheiden, ob ein Mensch schuld- bzw. zurechnungsunfähig war, ob er anders handeln hätte können oder ob er trotz krankhafter psychischer Einflüsse in seinen Entscheidungen tatsächlich frei war.
Genau diese Situation will auch das vorliegende Buch herstellen: Ein psychiatrischer Fachmann erzählt Ihnen anhand von mehr oder minder spektakulären Verbrechen die Geschichte der daran beteiligten Personen, insbesondere der Täter, manchmal auch jene der Opfer. Er erörtert seine psychologischen Analysen und bietet einen Hintergrund zu wissenschaftlichen Theorien über Verbrechensentstehung, psychiatrischer Krankheitslehre und Persönlichkeitstheorien. Er versucht, die Sprache des Verbrechens zu übersetzen, die Motivation des Täters verstehbar zu machen, neben den bewussten Motiven auch verschattete Verbrechensursachen zu erhellen und überindividuelle Zusammenhänge aufzuzeigen. Die Beurteilung nimmt aber der kriminalpsychiatrische Gehilfe – nichts anderes ist der Sachverständige – nicht vor. Das ist Ihre Aufgabe, verehrte Leserin, verehrter Leser – das Hohe Gericht sind Sie!
Die Fallbeispiele in diesem Buch wurden, soweit sie nicht von allgemeinem öffentlichem Interesse und durch die mediale Berichterstattung bekannt sind, überarbeitet und in Bezug auf Personalien, zeitliche Daten und Orte anonymisiert.
Die prinzipiellen Sachverhalte und die psychiatrischen Beurteilungen entsprechen jedoch den realen Gegebenheiten des jeweiligen Einzelfalles. Bei den großen Fällen (Jack Unterweger, Franz Fuchs) wurden keine Fakten, die nicht bereits durch den Strafprozess öffentlich geworden sind, verwendet.
KAPITEL 1
DER PLÖTZLICHE VERNICHTUNGSRAUSCH – „OVERKILL“
Die Flucht nach vorne
Am 22.8.1997 hatte Marcel A. ein Gefühl wie an jedem Freitagabend. Froh, die Wochenarbeit hinter sich zu haben, verließ er sein Elternhaus, konkret das Haus seines Vaters, mit welchem er seit dem Tod der Mutter allein lebte. Marcel A. konnte sich an seine Mutter nur noch wenig erinnern: eine große, blonde Frau mit frohem Gesichtsausdruck und warmer Stimme. Seine früheste Erinnerung bezog sich auf eine Situation, als die Mutter eine große alte Stubenuhr öffnete, um sie aufzuziehen. Marcel begann panisch zu schreien, das nackte Ziffernblatt vermittelte Kälte und signalisierte furchtbares Unheil. Er wusste damals nicht, was Tod bedeutet, doch als er sich später immer und immer wieder in seinen Zustand vor der geöffneten Uhr versetzte, die damalige Situation neuerlich miterleben musste und sein Empfinden zu rekonstruieren versuchte, wusste er, dies war damals die Botschaft des Todes gewesen. Die Mutter hat ihn damals aufgenommen, ihm die Tränen abgewischt und ihn mit warmen Worten entängstigt. Spätere Erinnerungen an die Mutter hat er nicht. Sie sei krank geworden und bald gestorben.
Das Bild der Mutter verblasste mit dieser einen Ausnahme hinter jenem der Oma, der Mutter des Vaters. Diese nahm ihren Sohn und den kleinen Halbwaisen zu sich und versuchte, selbst bereits längst verwitwet, dem Buben wirklich Mutter zu sein. Sie erzog ihn mit Herzensgüte und Fürsorge. Der Bub war der Inhalt ihres Lebens, er sagte zu ihr „Mama“ und empfand ihre Liebe als die der Mutter. Als er einmal von anderen Kindern wegen seiner alten Oma, die gar nicht die richtige Mutter sei, gehänselt wurde, verließ er das Haus über Tage nicht mehr und wich keine Minute von Omas Seite. In der dritten Volksschulklasse vermerkten die Erzieher bei dem ansonsten ernst und introvertiert wirkenden Heranwachsenden einen Wutanfall, in welchem er blindlings auf einen Mitschüler einschlug und nur mit Mühe von dem bereits am Boden liegenden Opfer weggezogen werden konnte. Dieser habe ihn gefragt, ob dieser „Grufty“, den er „Mama“ nenne, seine Uroma oder seine Ururgroßmutter sei.
Marcel A. wollte also am Freitagabend die nahe gelegene Stadt aufsuchen. Dort wollte er sich mit Kollegen treffen, das eine oder andere Bier trinken, vielleicht einen Joint rauchen, vielleicht die Disco besuchen. Der Freitagabend war Lohn für die überstandene Woche. Seinem Vater, der sich nie sonderlich um ihn gekümmert hatte, hinterließ er keine Nachricht. Der Vater meinte, sein Sohn sei erwachsen und brauche keine Vorschriften. Marcel fragte sich, ob er dies als besonderes Vertrauen oder als mangelndes Interesse werten sollte. Die beiden sprachen nicht viel miteinander.
Marcel A. ging, ohne im Geringsten zu ahnen, dass sein Leben in drei Stunden ein grundsätzlich anderes sein werde, zur Posthaltestelle und wartete auf den Bus. Ein Kollege, Robert M., den er aus der Discoszene eher oberflächlich kannte, fuhr mit seinem Pkw vorbei und lud ihn ein mitzufahren. Robert erzählte ihm im Laufe des Abends von finanziellen Problemen und von seinem früheren Chef, einem Gastwirt, der ihm immer noch drei Monatsgehälter schulde und ihm den Lohn vorenthalte. All seine Vorsprachen, Schreiben und Interventionen hätten nichts gefruchtet. Er sei nun fest entschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und sich den gerechten Lohn zu holen. Ob ihm Marcel dabei nicht helfen würde? Er müsse nichts tun, nur ein wenig aufpassen, es sei eine todsichere und zudem gerechte Sache. Er könne sich leicht ein Zubrot verdienen.
Marcel A. war die Sache unangenehm, er wollte damit nichts zu tun haben, wollte als bisher völlig unbescholtene Person in keine Straftat verwickelt werden, fühlte sich gegenüber Robert aber irgendwie verpflichtet. Dieser hatte ihn nicht zum ersten Mal mitfahren lassen. Zudem wusste Robert einiges von ihm. Gemeinsam hatten sie schon Cannabis geraucht und Ecstasy-Tabletten ausgetauscht, auch an diesem Abend wurde schon ein Joint gezogen. Marcel hörte aus Roberts Worten einen bedrohlichen Unterton hervor. Er hatte den Eindruck, Robert setze ihn unter Druck und behalte sich vor, das gemeinsame Geheimnis auszuplaudern. Außerdem, die Sache war ja sicher und nicht ein wirkliches Verbrechen, Robert wollte sich nur den vorenthaltenen Lohn holen.
So fuhren die beiden zu einer Telefonzelle und riefen beim ehemaligen Chef von Robert an. Sie wussten, dass dieser an diesem Tag das Gasthaus geschlossen hatte und mit seiner Frau allein zu Hause war. Marcel musste mit verstellter Stimme sagen, im Wochenendhaus des Chefs – ihm gehöre doch jenes in einer 30 Kilometer entfernten Siedlung? – sei eingebrochen worden, er habe dies beim Vorbeispazieren gesehen. Robert und Marcel warteten im Auto, bis sie den Gastwirt mit seiner Gattin im Pkw in Richtung Wochenendhaus vorbeifahren sahen. Dann handelten sie rasch, fuhren zum Gasthaus „Krone“, brachen durch eine Hintertür ein, durchwühlten das Büro, nahmen eine Handkasse an sich. In diesem Moment hörten sie, dass noch jemand im Haus war. Vom oberen Stock kam eine alte Frau – es war die Schwiegermutter des Chefs, die einige Tage auf Besuch weilte – mit einem Nachtmantel bekleidet über die Stiege, erblickte die beiden und fragte: „Was ist hier los, was wollt ihr hier?“ Robert stürzte sich auf die Frau, packte sie am Hals, warf sie nach hinten und rief: „Schnell weg …!“ Marcel zögerte, sah die am Boden liegende, wimmernde Frau, sah ihr angstvolles Gesicht, ihre großen Augen, sah, wie sie aufstehen wollte und nicht konnte, wie sie immer wieder zusammensackte. Später stellte sich heraus, dass sie beim Sturz einen Schenkelhalsbruch erlitten hatte. Marcel A. zauderte, er schien nicht weglaufen zu können, er näherte sich der Frau, unklar, ob helfen wollend oder in feindseliger Absicht. Die alte Frau sagte, während er sich zu ihr niederbeugte: „Ihr Verbrecher …!“ Dann lief alles sehr schnell ab. Im Polizeiprotokoll heißt es wörtlich: „Marcel A. stürzte sich auf die am Boden liegende, hilflose Frau, legte seine Hände um ihren Hals, würgte und schüttelte sie, schlug ihren Hinterkopf mehrmals mit großer Wucht gegen den Boden, sodass sie, wie die Obduktion ergab, mehrere Brüche des Schädelknochens erlitt. Der Tod trat durch kräftiges Würgen ein, welches so heftig war, dass beim Opfer massivste Stauungsblutungen nicht nur in den Augen, sondern im ganzen Kopfbereich festgestellt werden konnten …“
Robert M., der ob des ungemein brutalen Vorgehens seines Kollegen entsetzt war, schrie diesen an: „Was machst du da?!“ Dann verließen beide unter Mitnahme der Beute fluchtartig das Haus, fuhren mit ihrem Auto überhastet weg, verursachten einen Verkehrsunfall und konnten bald gestellt werden.
Analyse
Wie ist dieses Verhalten, durch welches ein junger Mann scheinbar ohne jeden Grund und ohne Notwendigkeit zum Raubmörder geworden ist, zu erklären? War es das kopflose Reagieren eines zufällig in eine Kriminaltat verwickelten Anfängers, war es der Wunsch, dem Kollegen zu helfen, ja zu beweisen, dass er noch entschlossener und kaltblütiger vorgehen könne, war es die Angst, entdeckt zu werden?
Marcel A. war bei der Einvernahme erschüttert, fassungslos ob seines eigenen Tuns, konnte zum Teil nicht sprechen, brach in heftiges Weinen aus, war sofort geständig. Er habe die Nerven verloren und völlig durchgedreht, es habe in ihm abgeschaltet, er sei gar nicht er selbst gewesen. Er könne sich nur an den Gesichtsausdruck, den flehenden Blick der Frau, an ihre Angst und Hilflosigkeit erinnern, dann setze sein Gedächtnis aus. Diesen Blick, die Todesangst der Frau und ihre „unwürdige Lage“ habe er nicht verkraftet. Er habe das nicht mehr sehen können, er habe sich gewünscht, nicht hier zu sein, habe sich wegen des Mitmachens verflucht, habe sich weit weg gewünscht und habe alles ungeschehen machen wollen. Es seien ihm so viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Was wohl seine Mutter dazu sagen würde, Gedanken, dass er jetzt ins Gefängnis müsse, dass sich der Vater schäme, dass die Zukunft verpfuscht sei. Es sei dann, so ergab die weitere Exploration, ein Gedanke ganz in den Vordergrund getreten: jener an seine Oma. Jetzt habe er gewusst, an wen ihn die alte Frau erinnerte, er habe die Oma in ihrer Güte und Fürsorge, die Oma, die er immer schützen wollte, auf die er stolz war, die ihm Mutter gewesen sei, gesehen, in einer verzweifelten Lage, für die er verantwortlich war. Der Blick der Oma habe Bände gesprochen, habe ihm Vorwürfe gemacht, ihn angeklagt, ihn verzweifelt angefleht, der Blick sei für ihn unerträglich gewesen. Er habe nur noch einen Gedanken gehabt: das nicht mehr sehen zu müssen, weit weg zu sein, das alles zu beenden. Marcel begann bei diesen Ausführungen heftig zu weinen. Das Bild des brutalen, gewissenlos agierenden Mörders wandelte sich für die vernehmenden Beamten in das eines hilflosen, weichen und verzweifelten, trostlosen Kindes.
In der Kriminalpsychologie wird ein derartiges Verhalten, diese unvermutet und unvermittelt durchbrechende Aggressivität, dieser Vernichtungsrausch als „Overkill“ bezeichnet. Besonders bei emotional unreifen, in ihrer Gesamtpersönlichkeit wenig ausgeformten Tätern wurde dieser unerklärliche Aggressionsrausch, der bei manchen Tötungsdelikten gesehen wird, mit dem Zwang zur „Flucht nach vorne“ erklärt. Wissenschaftlich wird dann von einem Overkill-Syndrom gesprochen, wenn es bei einem nicht von vornherein beabsichtigten Tötungsdelikt nach der ersten Auseinandersetzung mit dem Opfer zu einer kurzen Handlungszäsur kommt, in welcher der Täter plötzlich mit der eigenen Tat, mit der eigenen, eigentlich nicht gewollten Kriminalität konfrontiert wird, die er mit seiner Wertvorstellung nicht in Einklang bringen kann und die er bei sich selbst abwehren möchte. Genau diese Ausgangsstimmung haben wir bei Marcel A. Er ist kein typischer Verbrecher, er ist weder gemütskalt noch dissozial, er ist zufällig und eigentlich widerwillig in etwas hineingeraten, was seiner Persönlichkeit widersprochen hat.
Er hat eine Grenze überschritten und dabei innerlich etwas angesprochen, was in seinem Leben unbewusst eine große Rolle gespielt hat, nämlich sein Verhältnis zur Großmutter, die für ihn die wirkliche Muttergestalt war. Schon früher hat er es nicht ertragen, wenn das Bild der gütigen Oma von jemandem befleckt wurde, wenn man die für sein emotionales Leben so wichtige Person in Frage gestellt hat oder wenn man ihm die Großmutter und damit all das, was für ein Kind Mutterliebe bedeutet, entreißen wollte. Die plötzliche Erkenntnis, dass er mit der unbekannten alten Frau jemanden wie seine Großmutter getroffen hat und nun hilflos hier liegen sieht, gab dann offenbar erst den Anlass zur Fortsetzung der aggressiven Handlungen, welche dann überschießend im Sinne eines „Overkill“ vorgenommen wurde.
Overkill-Täter können es kaum verkraften, nach den ersten Aggressionen mit ihren Auswirkungen in Gestalt des von ihnen angegriffenen oder entführten Opfers konfrontiert zu werden. Wenn nicht äußere Faktoren eingreifen, die mächtiger sind als das Ausweichen vor der eigenen, nicht akzeptierten Tat, kommt es in manchen Fällen offenbar mit einer Zwangsläufigkeit zu einer überschießenden „Flucht nach vorne“. Nach verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen wird dabei in den meisten Fällen das Opfer erwürgt. Dies ist jedoch nicht – wie das in der Regel geschieht – eine Handlung, die die eigene Straftat vor allem vor der Umwelt verbergen und eine Entdeckung durch die Polizei verhindern soll, sondern das Schreien des Opfers stellt eben eine solche für den/die Täter/in unerträgliche Konfrontation dar, die es mit allen Mitteln zu unterdrücken gilt.
Das tödliche Entsetzen
Ein ähnlicher Fall, der die Öffentlichkeit als äußerst grausame Form der Kindestötung erschüttert hat, ist jener des Konrad T. Dieser war arbeitslos, die Ehe befand sich in einer konflikthaften Situation, die aus einer so genannten „besseren Familie“ stammende Frau war unzufrieden, suchte sich eine eigene Arbeit, wandte sich von ihrem Mann zunehmend ab, drohte aber noch nicht mit Scheidung. Während der sich häufenden Streitigkeiten hielt sie ihrem Mann, welcher zunehmend depressiv wurde und auch etwas dem Alkohol zusprach, seine Schwächen vor. So kränkte sie ihn am Morgen des Tattages mit der Feststellung, dass er ein völliger Versager sei, der nicht einmal seine Kinder ernähren könne. Konrad T., welcher insbesondere zu seinem jüngeren Sohn eine sehr gute, gefühlsenge Beziehung hatte, war schwer gekränkt, trank während des ganzen Vormittags und entschloss sich, nach dem Weggehen der Gattin, nun viel Geld zu beschaffen. Er rief mit verstellter Stimme bei der Familie eines Kindergartenkollegen seines Sohnes, des 5-jährigen Tobias, an und bestellte diese für den Nachmittag zur Vorbesprechung eines Kinderfestes zum Jugendheim. Der Bub wurde dort, zehn Minuten zu früh, von seiner Mutter ahnungslos abgestellt und daraufhin von Konrad T. in sein Auto gelockt und entführt. Er fuhr mit ihm zu einem kleinen Wochenendhaus, rief von dort aus die Eltern des kleinen Tobias an und forderte diese mit ausländischem Akzent auf, 100.000 DM herzurichten, wenn sie das Kind nochmals sehen wollten. Es folgten weitere Anrufe des rasch in Panik verfallenden Entführers, welche schließlich zu seiner Verhaftung führten. Als die Polizei ihn zwanzig Stunden nach der Entführung festnahm, war Tobias bereits tot. Nach Mitteilung des Täters habe der Junge am Abend geweint, habe nach seiner Mutter verlangt und nach Hause gedrängt, habe weglaufen wollen und immer verzweifelter zu schreien begonnen. Konrad T. habe ihn festgehalten, im Freien auf den Rücken geworfen, habe das sich wehrende Kind ins Haus getragen, habe dem schreienden Jungen einen Polster auf das Gesicht gepresst und ihn, als dieser mit Händen und Füßen um sich schlug, mit der anderen Hand unter dem Polster erwürgt. Das leblose Kind habe er auf eine Pritsche in den Keller gelegt und zugedeckt. Konrad T. war während des Tatzeitraumes, wie sich berechnen ließ, mittelstark alkoholisiert. Unmittelbar vor der Festnahme habe er versucht, sich mit einer Rasierklinge die Halsgefäße aufzuschneiden.
Analyse
Die psychiatrische Untersuchung brachte dann Folgendes zu Tage: Konrad T. stammt aus einer Familie, in welcher nach seinen Aussagen alle getrunken hätten, so der Vater, mehrere Onkel, ein älterer Bruder und auch die Mutter. Er kam als eheliches Kind zur Welt und wuchs unter sieben Geschwistern in der Risikoposition des Zweitjüngsten auf. Von Risikoposition ist deshalb zu sprechen, weil viele Untersuchungen ergeben haben, dass nicht die so genannten Eck- und Sandwichpositionen innerhalb der Geschwisterreihe in einer gewissen Weise die Anlage zu abweichendem Verhalten in sich bergen, sondern vor allem die Stellung des Zweitjüngsten. Dies kann man vereinfacht ausgedrückt damit in Verbindung bringen, dass jedes Kind durch die Geburt eines jüngeren Geschwisterteils seine „Starposition“ verliert, was eine schwere Kränkungsreaktion hervorruft. Diese narzisstische Krise wird erst dadurch wieder gutgemacht, dass auch der neue Star in der Familie durch die Geburt eines weiteren Kindes entthront wird. Beim Zweitjüngsten ist dieser innere Wiedergutmachungsprozess naturgemäß nicht möglich. Eine Rolle kann auch spielen, dass die Zweitjüngsten emotional vielleicht vernachlässigt werden. Sie werden scheinbar von den älteren Geschwistern genügend versorgt oder finden ihre Befriedigung im Mithelfen bei der Erziehung der Jüngeren. Diese Haltungen beruhen aber oft auf Fehlmeinungen der Eltern und täuschen über die unerfüllten emotionalen Bedürfnisse der Kinder hinweg.
Konrad T. litt in der Kindheit an Asthma, für das keine körperliche Ursache gefunden werden konnte. Nach psychosomatischem Verständnis wird Asthma oft als Ausdruck mangelnder emotionaler Versorgung, als verkörperlichter Dauerschrei nach Liebe, die für ein Kind von so großer Wichtigkeit ist, verstanden. Konrad T. hat sich in Kindheit und Jugend äußerlich normal entwickelt, hat während dieser Lebensphasen sonst keine schwerwiegenderen Verhaltensstörungen gezeigt und blieb zeit seines bisherigen Lebens von schwereren Krankheiten verschont. Nennenswerte Unfälle, insbesondere Schädel-Hirn-Traumen, hat er ebenso wenig mitgemacht wie sonstige das Gehirn in Mitleidenschaft ziehende körperliche Erkrankungen. Erwähnenswert ist allerdings ein Selbstmordversuch, den er vor zwei Jahren im Zusammenhang mit den aufkommenden ehelichen Spannungszuständen und der schon damals gegebenen Überschuldungssituation verübt hat. Zudem führte er aus, dass er in der Kindheit nicht nur unter den Alkoholproblemen der Eltern und der aggressiv-unberechenbaren Wesensart seines Vaters gelitten habe, sondern dass er vom 7. bis zum 12. Lebensjahr auch Opfer sexuellen Missbrauchs durch einen Saufkumpanen seines Vaters geworden sei.
Konrad T. war also in der Entwicklungsphase erheblichen emotionalen Belastungen und Vernachlässigungen ausgesetzt, wodurch sich seine Selbstunsicherheit, seine Verstimmungszustände, aber insbesondere auch die während der Tat zum Vorschein kommende Gefühlsabstumpfung und Gefühllosigkeit erklären lassen. Es ist bekannt, dass Kinder, die unter vernachlässigenden und grausamen Milieufaktoren aufwachsen, oft nur dadurch überleben können, dass sie eigene Gefühlsempfindungen unterdrücken und abtöten. Diese wurden im alltäglichen Leben jedoch wenig manifest, sodass Konrad T. sich bislang noch nie in nervenärztlicher bzw. psychotherapeutischer Behandlung befunden oder die Hilfe einer psychosozialen Beratungsstelle in Anspruch genommen hatte. Er versuchte, mit seinen Problemen allein fertig zu werden, etwas, das er nicht geschafft hat und was so oft zu einer wesentlichen Ursache von Verbrechen wird.
In der Pflichtschule erbrachte Konrad T. mäßige Leistungen, begann danach eine Elektrikerlehre, gab diese nach zwei Jahren wegen Problemen mit seinem Vorgesetzten auf und arbeitete in der Folge als Hilfsarbeiter in verschiedenen Firmen. Durch die Eheschließung mit einer aus einer gehobenen sozialen Schicht stammenden Frau, welche nach Eintritt einer damals nicht geplanten Schwangerschaft erfolgte, geriet Konrad T. in eine emotional schwierige Situation. Einerseits hatte er zu seiner Gattin eine recht gute Beziehung, fand bei ihr das Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit und auch sozialer Anerkennung, andererseits sah er sich wegen seiner Herkunft aus einer in der sozialen Schichtung niedriger angesiedelten Familie vermehrter kritischer Betrachtung und erhöhtem Erwartungsdruck sowie anfangs auch einer gewissen Ablehnung, insbesondere von Seiten seines Schwiegervaters, ausgesetzt. Aus der Angst, seine Rolle als Vater und Familienernährer nicht befriedigend zu erfüllen, und seinem permanenten Streben, jegliche Probleme und Konflikte aus dem Ehe- und Familienleben fernzuhalten, ist wohl zu erklären, weshalb er mit seiner Frau nie über äußere und innere Belastungssituationen gesprochen hat und mit den aufkommenden finanziellen Schwierigkeiten ebenso allein fertig werden wollte wie mit einer gewissen emotionalen Isolierung.
Die von Konrad T. nach außen gespielte Rolle und das von ihm lange Zeit vermittelte Ehe- und Familienbild standen in Widerspruch zu den verdeckten, großteils nicht angesprochenen inneren Konflikten, zu den Minderwertigkeitsgefühlen und Selbstwertzweifeln und zu den wachsenden innerfamiliären Spannungszuständen. Er traute sich nicht, mit seiner Frau, deren Familie und auch den Kindern über seine beruflichen Probleme, über den neuerlichen Verlust des Arbeitsplatzes und seine finanziellen Nöte zu sprechen. Er vermittelte stets den Eindruck, die Probleme im Griff zu haben und seinen finanziellen Verpflichtungen als Familienoberhaupt nachkommen zu können. Er nahm mehrere Kredite auf, täuschte zu Hause auch in den Phasen der Arbeitslosigkeit vor, zur Arbeit zu gehen, trieb sich dann oft stundenlang in Parks oder in Kneipen herum. Er suchte Trost im Alkohol und entwickelte immer mehr ein ausgesprochenes Problemtrinken, das zu zunehmenden Zerwürfnissen mit seiner Frau und zu deren Verselbstständigungsstrebungen beitrug. Er lebte jahrelang in quälendem Zwiespalt zwischen der nach außen dargetanen Rolle, welche den Erwartungen seiner Umgebung entsprechen sollte, und den unerträglich werdenden inneren Gegebenheiten, zu denen Versagensängste, Verstimmungszustände und Isolationsgefühle gehörten.
Einen tiefen Einblick in seine Persönlichkeit gaben die durchgeführten testpsychologischen Untersuchungen. Es fanden sich bei ihm Hinweise auf grobe Störungen der Emotionalität und Affektivität, auf massive Gefühlsverdrängungen und fehlendes Einfühlungsvermögen, auf überhöhte Ängste und Unfähigkeit, mit Aggressionen umzugehen, auf Minderwertigkeitsgefühle, Selbstwertzweifel, Verschlossenheit, Kontaktangst und Selbstunsicherheit, aber auch auf Geltungssüchtigkeit und einen überempfindlich-reizbaren Charakter sowie vor allem auf mangelnde Impulskontrolle. Konrad T. war laut Tests ein verschlossen-misstrauischer, wenig erlebnisfähiger, im sozialen Kontakt nicht sehr gewandter Mann mit negativer Grundbefindlichkeit, der Konflikten auszuweichen versuchte und Enttäuschungserlebnisse eher schwer verarbeitete. In Problemsituationen reagiert er – laut Tests – eher spontan, affektiv und unbeholfen, handelt nicht überlegt und vorausschauend und neigt unter Belastungsdruck zu ungewöhnlichen Reaktionen. Bei auftretenden Problemen hat er das Gefühl, eigenverantwortlich zu sein, und sucht auf einzelgängerische Weise nach möglichen Auswegen, wobei er spontanen Einfällen folgt. Jahrelange Frustrationen, wenn auch nur geringerer Intensität, haben ebenso zu einem gewissen Aggressionsstau beigetragen wie seine Unfähigkeit, Konflikte anzusprechen, eigenes Versagen zuzugeben und auch negative Emotionen nach außen zuzulassen. Seine Verschlossenheit führte zusammen mit einer intellektuell eher einfachen Strukturierung zu einem unreflektierten, insgesamt doch naiven Tatverhalten. Eigene emotionale Belastungen in der Kindheit und wahrscheinliche sexuelle Traumatisierungen erklären seine Gemütskälte, wie sie im letzten Akt der Tat zum Ausdruck kam. Wie sich auch in der testpsychologischen Untersuchung eindrucksvoll zeigte, neigt Konrad T. unter Belastungsdruck zu emotionalen und ungewöhnlichen Reaktionen, wobei er vom eigenen Problem affektiv sehr eingenommen ist und unbeholfen, unüberlegt und nicht vorausschauend handelt.
Die bei Konrad T. vorliegenden, durch testpsychologische Verfahren abgesicherten Persönlichkeitsstörungen waren neben anlagemäßigen Faktoren auf schädigende bzw. traumatisierende Einflüsse während seiner Entwicklung zurückzuführen. Aus unzähligen wissenschaftlichen Untersuchungen ist bekannt, dass die Familie in den ersten Lebensjahren des Kindes neben der Norm-, Transfer-, Vorbild- und Platzierungsfunktion auch jene einer Sozialinstanz hat, in der soziale Fähigkeiten wie Frustrationstoleranz oder Bedürfnisaufschub eingeübt werden, wodurch ihr Einfluss sowohl auf die Entstehung als auch den Verlauf von Persönlichkeitsstörung und verbrecherischem Verhalten von großer Wichtigkeit ist. Besonders prägend ist dabei die affektive Einstellung der Eltern, wobei die Bedeutung des Vaters als Identifikationsobjekt mit zunehmendem Alter wächst.
Zweifelsohne waren die familiären Verhältnisse des Konrad T., insbesondere seine Beziehung zum Vater, nicht ideal. Neben anlagemäßigen nachteiligen Faktoren kam den Auswirkungen unberechenbar-aggressiver Verhaltensweisen auf seine kindliche Entwicklung ein hoher Schädigungsgrad zu. Durch den sexuellen Missbrauch in einer wichtigen Phase des Heranreifens lag ein schwer traumatisierender Belastungsfaktor über mehrere Jahre seiner Kindheit vor, welcher gleichsam eine Vervielfachung der übrigen Milieuschäden bedeutete. Die schädlichen Auswirkungen sexuellen Missbrauchs, welche bei etwa 20% aller Verbrecher zu erheben sind, auf emotionale Entwicklung, Persönlichkeitsbildung, sexuelle Identität und psychische Gesundheit sind jedenfalls nicht zu unterschätzen. Auch ist zu bedenken, dass äußerlich extrem grausam und gefühlsarm anmutende Verbrechen an Kindern oft eine Wiederinszenierung der kindlichen Situation mit verteilten Täter-Opfer-Rollen darstellen. Der Täter macht gleichsam einen Teil seiner eigenen Traumatisierungen dadurch gut, dass er jetzt plötzlich in der Rolle des Mächtigen lebt und jemand anderer die unerträgliche Angst des hilflosen Opfers erdulden muss.
Die beschriebenen Entwicklungsdefizite und Verzögerungen in der Persönlichkeitsausformung machen zwar die Motivation der Entführung, welche insgesamt wie das Verbrechen eines unreif-jugendlichen Täters anmutet, transparenter, nicht aber jene des Tötungsvorganges. Dieser ist wiederum durch das „Overkill“-Phänomen, welches in diesem Fall durch die Parallelität zwischen Opfer und eigenem Kind ausgelöst worden ist, erklärbar. Der bis dahin nicht vorbestrafte, eigentlich anständig lebende, durch die sozialen Umstände und das drohende Zerbrechen der Familie verzweifelte Mann hat sich auf etwas eingelassen, das ihm eigentlich zutiefst wesensfremd war. Er hat den rechten Weg, aus dem er viel Identität schöpfte, verlassen und ein wenig durchdachtes, eher stümperhaft geplantes, vordergründig motiviertes Verbrechen verübt. Dieses mutet bei genauer Analyse wie ein so genannter „sozialer Selbstmord“ an, d.h. der Betroffene setzt wie beim Russischen Roulett alles auf eine Karte: Entweder er gewinnt und beendet dadurch seine soziale Misere, oder er hat sich als Verbrecher und Häftling endgültig ins soziale Aus katapultiert.
Die Tötungshandlung hat aber eine ganz andere psychische Wurzel als die Entführung. In Konrad T. wurde durch das Schreien des Kindes eine wichtige Gefühlsschicht angesprochen, nämlich die emotionale Erinnerung an seinen eigenen Sohn. Es war ihm unerträglich, dass er diesen gleichsam verraten und sein Liebstes und Wichtigstes, nämlich ein Kind, in sein Verbrechen einbezogen hatte. Das Schreien des Kindes ernüchterte ihn, er wollte jetzt alles rückgängig und ungeschehen machen, er wollte wenigstens wieder in sein jämmerliches Leben zurückkehren, er wollte nicht auch noch Verbrecher sein. Er hat das Schreien zum Verstummen gebracht …
In der Zusammenschau all dieser Befunde und Analysen wird die Tat des Konrad T. trotz ihrer forensisch-psychiatrischen und kriminologischen Einmaligkeit und Unbegreifbarkeit aus psychodynamischer Sicht ein Stück weit verstehbarer, sodass sich die einzelnen Aspekte hinsichtlich des Motivations- und Tatgefüges zu einem Ganzen zusammenfassen lassen: Der Täter wies erhebliche Persönlichkeitsstörungen auf, die nicht nur anlagebedingt, sondern Folge belastend-traumatisierender Schädigungen in der kindlichen Entwicklung sind. Er hat in einer für die Persönlichkeitsentwicklung entscheidenden Phase emotionale Kälte, Aggressivität und psychische Traumatisierung kennen gelernt. In seiner späteren Rolle als Ehemann und Vater hat er gleichsam eine doppelte Rolle gespielt und zwei Anteile gelebt: Hinter oder neben jenem des fürsorglichen, fleißigen und bemühten Familienoberhauptes stand auch jener mit überspitztem Wunsch nach Zuwendung, Anerkennung und akzeptierter Rollenerfüllung, der Schwächen, Versagen und Verschulden nicht zuließ. Frustrationen und Kränkungserlebnisse haben bei dem emotional eher unreifen, manchmal impulsiv, unüberlegt und augenblicksverhaftend handelnden Mann, der zudem durch chronischen Alkoholmissbrauch enthemmt war, innerlich zu einem bemerkenswerten Aggressionsstau geführt. Aus dem Zusammenspiel all dieser Faktoren rekrutieren sich die wesentlichen äußeren und inneren Tatvektoren: gefühlsmäßige Kälte in bestimmten Lebenssituationen, eigene Erfahrungen mit Hilflosigkeit und Aggression, die auf ein ebenso hilfloses Opfer projiziert werden, Störungen der Impulskontrolle, Aggressionsstau und Flucht nach vorne in einer ausweglos erscheinenden Situation.
Die vernichtende Selbsterkenntnis
Überreaktionen im Sinne eines „Overkill“ werden nicht selten bei Jugendlichen, die mehr oder weniger zufällig Partner eines erwachsenen Homosexuellen werden, gesehen. Die plötzliche Konfrontation mit einer bisher verdrängten, nicht eingestandenen latenten Homosexualität kann zu überschießenden Aggressionshandlungen, ja sogar zu völlig unerwarteten Tötungsdelikten führen.
Nicht zu verwechseln sind solche Aggressions- und Tötungshandlungen mit den Taten jener homosexuellen Strichjungen, welche in der Regel an keinen uneingestandenen homosexuellen Tendenzen leiden, sondern die Situation des sich als homosexuell erklärenden Opfers ausnützen und dieses berauben. Oft ist es in der Begutachtung nicht einfach, diese beiden Formen auseinander zu halten, wie das folgende Beispiel zeigt.
Helmut M. war ein 18-jähriger Absolvent einer höheren Schule. Er hatte bei einem Discobesuch einen 50-jährigen Geschäftsmann kennen gelernt, war mit diesem ins Gespräch gekommen und ließ sich überreden, mit ihm nach Hause zu gehen. Beim Gespräch auf dem Balkon des Wohnhauses des allein stehenden Mannes habe sich dieser ihm homosexuell genähert, es sei zu gegenseitigen Berührungen gekommen. Als sich der Mann an Helmut M. oral befriedigen wollte, habe er einen in der Nähe liegenden Holzprügel erfasst und mit großer Wucht auf den Geschäftsmann eingeschlagen. Dieser erlitt mehrere Schädelbrüche, an deren Folgen er innerhalb von Minuten verstarb. Helmut M. verstaute die Leiche im Auto des Opfers, fuhr damit zu einem Fluss und warf sie dort in die Fluten. Das Verbrechen konnte erst Wochen später nach Zeugenaussagen und anhand von DNA-Analysen geklärt werden. Helmut M., der die Tat erst nach längerem Leugnen zugab, führte aus, dass ihn bei den homosexuellen Annäherungen ein furchtbarer Ekel erfasst und er dann die Nerven verloren habe. Er habe sich gegen die Übergriffe zur Wehr setzen wollen und sei dabei in einen aggressiven Ausnahmezustand geraten; er könne sein Verhalten selbst nicht begreifen. Da er dem Opfer die Geldtasche wegnahm, gingen die Ermittler vorerst von einem Gelegenheits-Raubmord aus. Erst durch die psychiatrische Untersuchung kamen zusätzliche Fakten zu Tage, die schließlich zur Annahme eines „Overkill“ bei latenter Homosexualität des Täters führten.
Analyse
Helmut M. stammte aus einer mit psychischen Behinderungen, Geisteskrankheiten, Sucht und Selbstmord erblich nicht vorbelasteten Familie. Laut Mitteilung der Mutter sei die Schwangerschaft normal verlaufen, die Geburt habe sich hingezogen, sodass eine „Zangenentbindung“ erforderlich wurde. Das Kind habe jedoch keine Geburtsschäden aufgewiesen und sich völlig normal entwickelt. Möglicherweise hat Helmut M. aber eine so genannte minimale cerebrale Dysfunktion erlitten. Dabei handelt es sich um eine Schädigung des Gehirns durch geringfügige Verletzungen oder Blutungen, die zwar zu keinen Lähmungen, Anfällen oder sonstigen schwereren Störungen führen, wohl aber das Hemmungsvermögen beeinträchtigen und so das Kontrollvermögen in belastenden Situationen herabsetzen. Dies wird bei später straffällig gewordenen Menschen häufig festgestellt. Nicht selten besteht dann in der Kindheit ein hyperkinetisches Syndrom, auf das frühe Delinquenz folgt.
In der sozialen Entwicklung des Helmut M. war das Fehlen einer Vatergestalt ein erhebliches Defizit. Obwohl der Großvater, eine im Ort sehr angesehene, offensichtlich starke Persönlichkeit, dessen Rolle übernommen und für ihn eine väterliche Figur dargestellt habe, litt Helmut M. unter diesem Defizit und verkraftete den Mangel einer das Realitätsprinzip verkörpernden Gestalt nicht wirklich. Die Beziehung zur Mutter kann wohl als ambivalent bezeichnet werden. Diese hat Helmut M. als fürsorglich, zum Teil verwöhnend, jedoch auch als streng und unnachgiebig erlebt. Dass sie ihn wegen Lernproblemen und oppositionell-aufsässigem Verhalten in ein Internat steckte, hat er ihr wohl nicht so recht verziehen. Auf dieses Kränkungserlebnis reagierte er mit Rückzug, oppositionellem Verhalten, aber auch mit einer gewissen emotionalen Abschottung. Die Überstellung ins Internat, in welchem er erstmals auffallendes Interesse für männliche Mitschüler erfuhr und auch homosexuell getönte Beziehungen knüpfte, bedeutete für ihn eine Entwurzelung, die dortige Zeit hat er in keiner so guten Erinnerung. Als besonders kränkend erlebte er die konsequente Haltung der Mutter und die Tatsache, dass er seinen Willen auch durch heftiges Agieren nicht durchsetzen konnte. Die schulischen Leistungen des Helmut M. waren durchschnittlich, er musste während der Pflichtschulzeit nie wiederholen, hat dann die Mittelschule gemacht und den Abschluss mit Mühe geschafft. Im Verlauf der Exploration wies er darauf hin, dass er in der Schule nur das gelernt habe, was ihn interessierte, während er sich in den von ihm abgelehnten Fächern verweigert habe.
Über seine sexuellen Erfahrungen wollte er nicht so recht sprechen, er ließ offen, ob er schon homo- oder heterosexuelle Kontakte gehabt hat. Eine Freundschaft mit einem etwa gleichaltrigen Mädchen deutete er an. Von seiner Mutter wurden diesbezüglich allerdings gegenteilige Angaben gemacht, d.h. sie habe ihren Sohn als gehemmt erlebt und glaube nicht, dass er tatsächlich Mädchenfreundschaften aufgenommen und gepflogen habe. Als sie ihn einmal gefragt habe, ob er sich mehr zum eigenen Geschlecht hingezogen fühle, habe er entrüstet abgewehrt. Im Übrigen aber sei das Sexualthema während der Erziehung fast nie zur Sprache gekommen. Die testpsychologische Untersuchung brachte u.a. allerdings klare Hinweise auf eine vorliegende, offensichtlich nach außen nie gelebte und auch nicht eingestandene Homosexualität. Unter Berücksichtigung der testpsychologischen Ergebnisse, die Hinweise für eine ausgeprägte sexuelle Orientierungsstörung lieferten, und seiner mangelhaften, unklaren Angaben konnte geschlossen werden, dass Helmut M. in Fragen der Sexualität wenig offen war und seine Schwierigkeiten zu überspielen versuchte. Die von ihm verübte brutale Tötungshandlung kam für die gesamte Umgebung völlig unerwartet. Angehörige und Bekannte betonten, dass sie ihm dies nie zugetraut hätten und dass wohl „tiefer liegende“ psychische Probleme vorliegen müssten.
Bei der Betrachtung der Persönlichkeitsstruktur und des sexuellen Bereichs bei Helmut M. ergab sich zunächst das Problem, dass es sich um einen Jugendlichen handelte, dessen persönlichkeitsspezifischer Reifungsprozess noch nicht abgeschlossen war und der noch keine endgültige Identität erlangt hatte. Eine weitere Schwierigkeit lag darin, dass der Täter rein äußerlich auch im psychischen Bereich keinen auffallenden Eindruck machte. Im Laufe der Exploration zeigte sich, dass er im affektiven Bereich deutlich blockierte, Emotionen abspaltete, wenig Mitschwingungsfähigkeit im Gefühlsbereich aufwies, sich analysierenden Betrachtungsweisen entzog und ausgesprochen glatt und wenig fassbar wirkte.
Neben auffallenden Rationalisierungen und Bagatellisierungen, die Helmut M. bei den Befragungen durchgehend zeigte, imponierten bei ihm ausgeprägte Intellektualisierungstendenzen. Die Intellektualisierung ist ein von Anna Freud (1936) beschriebener Abwehrmechanismus, der zusammen mit einer asketischen Einstellung der Abwehr verstärkter aggressiver und sexueller Impulse dient. Triebkonflikte waren bei Helmut M. infolge der nicht eingestandenen und nicht gelebten Homosexualität ganz eindeutig vorhanden, wie dies auch in der testpsychologischen Untersuchung zum Ausdruck kam. Die Intellektualisierung hatte bei ihm die Funktion, eine Distanz zu abgewehrten homosexuellen Tendenzen in der Interaktion mit anderen Menschen aufrechtzuerhalten. Sie diente seiner gefühlsmäßigen Abwehr und verhinderte echte Empathie und tatsächliche Betroffenheit.
Aus der Anamnese ergaben sich Hinweise auf die Entstehung dieser Persönlichkeitsabweichungen. Zu nennen sind neben dispositionellen Faktoren das Fehlen einer Vaterfigur, der Verlust des „Ersatzvaters“ durch den Tod des Großvaters, die von ihm als „Abschiebung“ erlebte Überstellung in ein Internat vom 11. bis zum 14. Lebensjahr und wohl auch sexuelle Frustrationserlebnisse, die sich aus seiner nicht eingestandenen Homosexualität, seiner eingeschränkten Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und seinen tief verwurzelten Minderwertigkeitsgefühlen ergaben.
Auffallenderweise zeigten die psychologischen Tests bei Helmut M. massive Angstzeichen. Er litt unter so genannten Phobien, d.h. krankhaften Angstzuständen, und Versagensgefühlen, unter einer angstneurotischen Entwicklung, ja sogar unter massiver „Angst vor der Angst“. Tiefenpsychologisch betrachtet, resultierte diese Angst einerseits aus neurotischen Minderwertigkeitsgefühlen, andererseits aus sexuellen Konfliktsituationen, die sich aus der latenten Homosexualität und den weitgehend fehlenden sexuellen Erfahrungen ergaben. Helmut M. wehrte auch nach den Ergebnissen der testpsychologischen Untersuchungen alle sexuellen Impulse ab. Die verdrängten sexuellen Probleme hatten Angst zur Folge, sodass man also von Sexualängsten sprechen kann. Dazu passen die selbstunsichere Persönlichkeit und die mangelnde Beziehungsfähigkeit, die in den Tests ebenfalls zum Ausdruck kamen.
Durch die direkte sexuelle Annäherung wurde Helmut M. hochgradig irritiert. Er war zwischen Wollen und Nichtdürfen, zwischen Neugierde und Hemmung, zwischen Verlangen und Abwehr hin- und hergerissen, es war ihm, nachdem er den anfänglichen Annäherungen ein Stück weit nachgegeben hatte, nun plötzlich und unausweichlich klar: Ich bin homosexuell. Diese Erkenntnis löste bei ihm Panik, Fluchttendenzen und den Wunsch, alles rückgängig zu machen und die frühere Ordnung wiederherzustellen, aus. Wir haben somit wieder jene Haltung und jene innere Ausgangslage, die die Art und die Heftigkeit eines der wichtigsten Phänomene bei Aggressionshandlungen, des „Overkill“, erklärt.
KAPITEL 2
ZU TODE BELEIDIGT – ÜBERREAKTIONEN AUF KRÄNKUNGEN
Lob oder Leben
Herr Friedrich E. war unzweifelhaft eine starke Persönlichkeit. Seine schnelle Auffassungsgabe, der scharf analysierende Verstand und das ungemein rasche Denken standen im Kontrast zu seiner bedachtsamen, geradezu künstlich verlangsamt wirkenden Sprechweise. Er konnte Menschen und Situationen blitzschnell einschätzen, er erfasste sofort das Wesentliche, er brachte die Dinge unerbittlich auf den Punkt. Es war nicht leicht, mit ihm zu tun zu haben. Obwohl schmächtig von Gestalt, flößte er allen Gesprächspartnern, auch den wortgewandtesten, Unbehagen ein. Jeder, auch der Selbstbewussteste, hatte das Gefühl, als Kandidat vor einem überlegenen, unerbittlichen Prüfer zu sitzen, auch überzeugendste Argumente wirkten ihm gegenüber irgendwie schwach. Friedrich E. war weder unberechenbar noch ungerecht, keinesfalls launisch oder parteiisch, es war das Fehlen von Gefühlsäußerung, das bewusst unterbleibende emotionale Mitschwingen, das den Umgang mit ihm so schwierig machte. Manchmal war Friedrich E. leicht ironisch, nicht humorvoll, manchmal reagierte er – was ihm aber nur selten passierte – zynisch. Er wusste, dass Zynismus die Aggression des Intellektuellen ist. Er gab sich nicht preis, er wollte sich nicht entblößen, er zeigte nie eine Schwäche. Man erzählte sich, dass ihn Stubenfliegen ärgerten. Er gehörte, wiewohl kontrolliert und sanft, nicht zu denen, die keiner Fliege etwas zu Leide taten, im Gegenteil, wenn sich eine Fliege in seinem Zimmer fand, dann war er irritiert und fand erst wieder Ruhe, wenn er sie erschlagen hatte. Dies nahm ihm niemand übel, man tat es als Macke ab.
Herr Friedrich E., ein leitender Beamter, zeigte sich gegenüber seinen Mitarbeitern verantwortungsbewusst. Er forderte hohen Leistungseinsatz und schien alle, die diesen Anspruch, besonders den intellektuellen, nicht erfüllten, zu missachten. Das Mitarbeiterklima in seinem Bereich galt als kühl, Skandale gab es aber nie. Herr Friedrich E. hatte den Laden, so sagte man, sicher im Griff. Er hatte einen einzigen Fehler, der ihm nicht einmal bewusst war, den viele auch nicht als solchen betrachten, der für ihn aber tödlich sein sollte: Er konnte nicht loben. Nie erhielt ein Mitarbeiter positive Rückmeldungen, nie gab es Belobigungen oder Förderungen, nie ein aufmunterndes Wort oder eine freundliche Geste, es war alles korrekt. Nicht zu tadeln, habe Herr Friedrich E. angeblich gesagt, sei schon Lobes genug.
Ob er dies wohl auch gedacht hat, als er an einem heißen Mittag das Bürohaus verließ um, so wie seit Jahren, im gegenüberliegenden Café eine Kleinigkeit zu essen, einen Kaffee zu trinken und die Zeitung zu lesen? Wir wissen es nicht, wir konnten ihn nicht fragen, er hat dieses Geheimnis mit in den unverhofften Tod genommen. Vor dem Haus wartete ein ehemaliger Mitarbeiter, der 19-jährige Thomas K., welcher die Abteilung vor einem halben Jahr unter nicht harmonisch wirkenden Bedingungen verlassen hatte. Er trat mit einem Revolver in der ausgestreckten Hand auf Herrn Friedrich E. zu, hielt ihm diesen wenige Sekunden vor das Gesicht und drückte mit den Worten: „Jetzt hast du’s!“ ab. Der Schuss durchschlug die Brille, durchdrang Auge, Schädelknochen und Gehirn und blieb im Hinterhaupt stecken. Herr Friedrich E. war auf der Stelle tot. Sein Mörder flüchtete, fuhr mit dem Auto über die Grenze und wurde Tage später im Ausland verhaftet.
Thomas K. nannte als Mordmotiv ständige Benachteiligungen und Schikanen von Seiten seines ehemaligen Vorgesetzten. Dieser habe an seiner Arbeit immer herumgenörgelt, habe ihn nicht gemocht, habe ihn wiederholt bloßgestellt, habe seine Leistungen nicht geschätzt, habe ihm oft Arbeiten, die weit unter seinen Fähigkeiten und seiner Qualifikation gelegen seien, zugewiesen – und habe ihn nie, in drei Jahren kein einziges Mal, gelobt. Dies habe ihn psychisch fertig gemacht, er habe stets an die vielen kleinen Kränkungen, die wie schmerzhafte Stiche in sein Gemüt gewesen seien, denken müssen, sei selbst in der Freizeit, beim Sport oder beim Discobesuch immer wieder auf diese Thematik zurückgefallen. Er habe gegrübelt und gegrübelt, sei in der Nacht stundenlang wach gelegen, habe nur über diese eine Sache nachgedacht, sei nervös und uninteressiert geworden, habe viel mehr als sonst geraucht. Er habe festgestellt, dass seine Hände zitterten, sein Magen rebellierte und er einen ständigen Druck in der Brust spürte. Er habe sich überlegt, wie er eine Lösung finden könne. Seinen Eltern, die ohnehin viel zu besorgt seien, habe er nichts von seinen Schwierigkeiten erzählen wollen, es sei für ihn wichtig gewesen, sie nicht mit seinen Problemen zu belasten, er wollte ihnen keine Sorgen machen. Seine Freunde hätten sich nicht für das Thema interessiert, die Arbeitskollegen hätten gesagt, es sei nicht so schlimm, der Chef sei halt so. Tatsächlich konnten die Kripo-Beamten keine schweren Konfliktsituationen ermitteln, es habe von Seiten des Ermordeten nie grobe Ungerechtigkeiten oder besondere Benachteiligungen gegeben. Vielleicht habe er Thomas weniger gemocht, gelobt habe er andere Mitarbeiter aber auch nie. Thomas habe sich mit der Art des Chefs wohl schwer getan und deswegen die Konsequenzen gezogen.
Thomas K. wechselte die Stelle, fand aber seinen inneren Frieden nicht. Er kam von dem Gedanken an die Benachteiligungen, an die Kränkungen und an das ihm vorenthaltene Lob nicht los. Er versuchte verzweifelt, einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu setzen und den Blick nach vorne zu richten, es gelang ihm nicht. Dies stürzte ihn in noch tiefere Verzweiflung. Er sagte sich, der Chef habe seine Karriere und sein Leben zerstört. Dessen Ungerechtigkeiten und Schikanen müssten viel schwerer gewesen sein, als er sich ursprünglich vorgestellt habe, sonst würden sie ihn ja nicht in die Zukunft, wahrscheinlich sein ganzes Leben lang verfolgen. So habe er beschlossen, lieber gar nicht als unter diesen Bedingungen weiterzuleben. Er habe an Suizid gedacht, habe Möglichkeiten überlegt, wie er es dem Chef heimzahlen könnte, habe mit dem Gedanken gespielt, ihm maskiert aufzulauern und ihn zusammenzuschlagen, sein Haus in Brand zu setzen oder ihn mit nächtlichen Anrufen zu terrorisieren. Oft habe er Briefe an den Chef geschrieben, in welchen er alle Ungerechtigkeiten schilderte, habe die Schreiben aber nie abgeschickt. Da er kein Feigling sei, sei er zum Entschluss gekommen, die Angelegenheit „von Angesicht zu Angesicht“ zu regeln. Er habe dem Chef noch einmal in die harten Augen blicken, ihm das ganze angetane Unrecht widerspiegeln und ihn dann zur Verantwortung ziehen wollen. Er habe gewusst, dass dies ein Verbrechen sei, sich dann aber gesagt, der Chef habe an ihm ein viel schlimmeres verübt. Wenn jemand sich in ihn hineinfühlen und erfassen könnte, was er mitgemacht habe, müsste man ihm zugestehen, dass er gerecht gehandelt habe. Er habe geplant, nach der Tat weit weg zu fahren und sich an einem einsamen Platz das Leben zu nehmen, sodass sein Leichnam am besten nie gefunden würde.
Thomas K. wirkte bei den Untersuchungsgesprächen verzweifelt, schien aber weniger wegen der Tat und der Haft als wegen noch nicht bewältigter Ungerechtigkeiten von Seiten seines ehemaligen Vorgesetzten zu leiden. Immer wieder kam er auf dieses Thema zurück, der Vorgesetzte wuchs in seinen Ausführungen zu einem kaltherzigen, bedrohlichen Monster, zu einem herrischen und gefühllosen Übermenschen, zu einer gefühlsmäßig nicht erreichbaren, kalten und strafenden Vatergestalt.
Analyse
Die Exploration ergab, dass Thomas K. zu seinem leiblichen Vater, welcher vor Jahren verstorben war, ein sehr enges Verhältnis gehabt hatte. Dieser war sein Vorbild, sein Kamerad und Freund gewesen, die beiden hatten sehr viel Zeit miteinander verbracht. Der Vater hatte ihm vieles gezeigt, unter anderem den Umgang mit Waffen. Thomas K. hatte als Kind das ständige Bestreben, die Erwartungen des Vater zu erfüllen, diesem keine Sorgen zu bereiten und ihn zufrieden und glücklich zu sehen. Der Vater sei für ihn der Maßstab aller Dinge gewesen, er habe es nicht ausgehalten, wenn dieser nicht mit ihm gesprochen, ihn nicht beachtet oder ihm kein Lob gegeben habe. Nach dem Krebstod des Vaters sei er depressiv und orientierungslos geworden.
Die Untersuchungen von Thomas K. erbrachten keine krankhaften Befunde. Die Intelligenz war überdurchschnittlich, mit Alkohol oder Drogen hatte er nie Probleme gehabt, Zeichen einer psychischen Erkrankung wurden bei ihm nie manifest. In der testpsychologischen Untersuchung fanden sich Hinweise auf innere Verunsicherung, mangelndes Selbstwertgefühl, abgeblockte Gefühle, verdeckte Minderwertigkeitskomplexe, auf eine pedantisch-genaue Charakterstruktur und auf psychosomatische Erlebnisverarbeitung. Lediglich im Hirnstrombild zeigten sich geringe Abnormitäten, die auf eine minimale Hirnverletzung hindeuten könnten. Solche Befunde findet man häufig bei Personen, die bei der Selbstkontrolle und der Beherrschung von aggressiven Impulsen Probleme haben.
Der Fall zeigt, welch prägenden Einfluss das emotionale Verhältnis der Kinder zu den Eltern hat, wie mangelnde Zuwendung und Liebesentzug Ängste auslösen können, die auch im Erwachsenenalter noch wirksam sind, und wie sehr die Mutter- oder Vater-Beziehung später auf andere Personen übertragen wird. Die Rolle des Chefs entspricht jener des Vaters, des Oberhauptes, der dominierenden Bezugsperson. Die Erwartungen und Gefühle, die ihm entgegengebracht werden, sind jenen des Kindes gegenüber seinem gleichgeschlechtlichen Elternteil sehr ähnlich. Zu geringe Anerkennung und Zuwendung von Seiten des Chefs ließen bei Thomas K. alte Befürchtungen und Ängste vor Liebesentzug wieder aufleben, in neurotischer Weise wehrte er sich dagegen und steigerte sich in einen depressiven, verzweifelten Zustand. Der Verlust seines Vaters, welchen er nie richtig aufgearbeitet hat, mag seine verzweifelte, suizidale Haltung erklären. Die Verdrängung des Traumas und die fehlende Trauerarbeit sind für die Heftigkeit des protrahierten, das heißt verzögerten Affekts verantwortlich. Thomas K. konnte in seiner inneren Not nicht mehr weiterleben, er übte durch die Tötung seines Chefs nicht nur Rache, sondern bestrafte sich auch selbst. Die Tat war letztlich ein sozialer Selbstmord.
Der Fall des Thomas K. lehrt aber auch, dass Aggressionstaten wie die meisten Kriminalhandlungen immer viele Ursachen und Wurzeln haben. Eine große Rolle spielen Prägungen und Traumen in der frühen Kindheit, ferner die Gefühlsbeziehung zu Vater und Mutter, aber auch bestimmte Persönlichkeitszüge – in diesem Fall jene des Selbstwertzweifels, der Minderwertigkeitsgefühle, der überhöhten Liebesbedürftigkeit und des Schwernehmerischen – sind von großer Wichtigkeit. Leichte Schädigungen des Gehirnorgans oder Drogeneinfluss mindern die Fähigkeit zur Selbstkontrolle, vor allem in sehr belastenden Situationen. Gerade bei aggressiven Impulsdaten geht oft ein innerer Konflikt, welcher zu einer allmählichen Zermürbung der Widerstandskräfte führt, voraus. So fügt sich ein Baustein auf den anderen, bis das komplette Gebilde eines schweren Verbrechens entsteht. Entscheidende Auslöser sind sehr oft Beleidigungen und Kränkungserlebnisse.
Der bedrohliche Dritte
Wie es durch das Zusammenspiel zweier problematischer, unreifer Charaktere – deren gestörtes Beziehungsmuster wie der Schlüssel zum Schloss passt –, das Fortwirken früherer Traumatisierungen und Prägungen sowie eine Beleidigung von außen zu einem geradezu schicksalhaft ablaufenden, an eine griechische Tragödie erinnernden Verbrechen kommen kann, erzählt uns die Geschichte von Tina, Gerald und Oliver.
Die 17-jährige Tina, Friseurlehrling, hatte sich in den 22-jährigen Gerald, einen Werkzeugmacher, verliebt. Während Gerald schon mehrere Beziehungen hinter sich hatte, war es für Tina die erste große Liebe. Oliver, 22-jährig und von Beruf EDV-Fachmann, war ein gemeinsamer Bekannter, der oft mit den beiden zusammen war und wohl ein Auge auf Tina geworfen hatte. Als er von deren neuer Bindung erfuhr, ließ er im Bekanntenkreis die Bemerkung fallen: „Die Schlampe kann wohl jeder haben.“ Dies kam Tina und Gerald zu Ohren. Sie beschlossen, Oliver in die im 12. Stock eines Hochhauses gelegene Wohnung von Gerald zu locken und ihm – wie sie später sagten – einen Denkzettel zu verpassen. Nach Olivers Eintreffen schloss Tina die Wohnungstür ab, Gerald stellte ihn zur Rede. Gemeinsam mit seiner Freundin, die Oliver festzuhalten versuchte, griff er Oliver an, schlug auf ihn ein und würgte ihn bis zur Leblosigkeit. Den Leichnam wickelten die beiden in einen Teppich, schafften ihn aus der Wohnung, verstauten ihn im Kofferraum von Geralds Pkw und warfen das Bündel in einen Fluss.
Analyse
Das Vorgehen von Gerald und Tina wirkt berechnend, kaltherzig und völlig uneinfühlbar. Für jeden war es unbegreiflich, wie eine verhältnismäßig geringfügige Beleidigung Motiv für so ein grauenhaftes Verbrechen gewesen sein konnte. Um das Verhalten von Gerald und Tina zu verstehen, ist es erforderlich, einerseits das Zusammenspiel ihrer Charaktere, also ihre Zweierbeziehung, und andererseits ihr Verhältnis zum Opfer, also die Dreierbeziehung, zu analysieren und die psychodynamische Entwicklung zur Tat hin näher zu beschreiben.
Vorerst erscheint von Wichtigkeit, dass Gerald innerhalb der Partnerschaft mit Tina eindeutig der dominierende, der starke, der bestimmende und der Sicherheit verleihende Teil war. Der kontaktfreudige, extravertierte, sozial angepasste, unkompliziert und unbeschwert wirkende junge Mann gab seiner Freundin nicht nur das Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und auch Attraktivität, sondern war für sie nach den ihren Lebenslauf prägenden negativen Erfahrungen und emotionalen Vernachlässigungen eine Person, der sie allmähliche Offenheit und zunehmend Vertrauen entgegenbringen konnte. Gerald erfuhr als Erster und Einziger von ihrem intimsten Geheimnis, einem sexuellen Missbrauch in der Kindheit, und ging mit diesem Wissen verantwortungsvoll um. Der sich ansonsten leicht in oberflächliche Beziehungen und sexuelle Abenteuer verstrickende Bursch verhielt sich Tina gegenüber zurückhaltend, verständnisvoll abwartend und behutsam verhalten. Er trat nie mit sexuellen Forderungen an sie heran und war sehr bemüht, keine Grenzüberschreitungen vorzunehmen, die bei Tina traumatisierend wirken bzw. möglicherweise ihren wunden Punkt treffen könnten.
In dieser Rolle war Gerald aber wohl etwas überfordert, zumal sich hinter seinem äußeren Bild erhebliche Persönlichkeitsprobleme finden ließen, wie dies durch die testpsychologische Untersuchung belegt wurde: In seinem Inneren litt er unter Minderwertigkeitsgefühlen, persönlicher Unsicherheit, mangelndem Lebens- und Realitätsbezug sowie erheblicher Affektstauung. Der seine Freundin beeindruckenden Sicherheit und geordneten Außenorientierung stand im Prinzip ein unsicheres, unklares, richtungsarmes und affektiv gestautes Innenleben gegenüber. Aus dieser Konstellation wird nicht nur der nach außen hin schwer erkennbare Affektstau begreiflich, sondern es zeigen sich auch Geralds Probleme in der Selbstkontrolle, im Steuerungsvermögen und im Umgang mit Frustrationen bzw. Aggressionen im weitesten Sinne. Es ist somit bezüglich Geralds Rolle im psychologischen Gefüge des Tatgeschehens festzuhalten, dass es sich um einen nach außen hin stark, lebenstüchtig und nicht irritierbar wirkenden, kommunikationsfreudigen, innerlich aber um einen verschlossenen, unsicheren, affektgestauten Menschen handelte, der die ihm in der Entwicklung und auch in der intellektuellen Ausstattung unterlegene, deutlich jüngere Tina sehr beeindruckt und auch positiv beeinflusst hat.