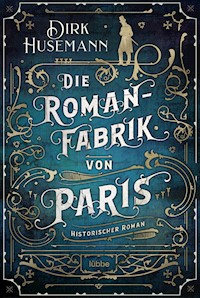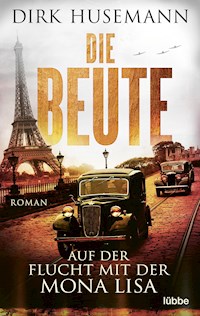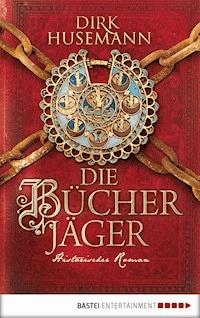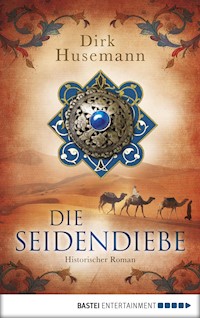
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie rauben den wertvollsten Schatz Chinas. Um zu entkommen, bleibt ihnen nur eins: die Flucht über die Seidenstraße ...
Byzanz, A.D. 552: Im Auftrag des Kaisers reisen die Spione Taurus und Olympiodorus ins ferne Asien, um das Geheimnis der Seidenproduktion zu lüften. Tatsächlich gelingt es ihnen, Seidenraupen zu stehlen und in hohlen Wanderstäben zu verstecken. Als buddhistische Mönche verkleidet, versuchen sie, die Beute unbeschadet nach Byzanz zu bringen - achttausend Meilen die Seidenstraße entlang. Doch das Wissen um den kostbaren Stoff hält ganze Völker am Leben, deren Herrscher in Windeseile die Verfolgung aufnehmen. Bald hängt das Leben der beiden Byzantiner und ihrer geheimnisvollen Begleiterin Helian Cui am seidenen Faden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Teil 1 DAS HAAR DER GÖTTER
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Teil 2 DIE VIERUNDZWANZIG KÖNIGREICHE
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Teil 3 DIE BLUT SCHWITZENDEN PFERDE
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Epilog
Nachwort
Danksagung
Dirk Husemann
DIE SEIDENDIEBE
Historischer Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Lena SchäferKartenillustration: © Markus Weber, Guter Punkt München | ThinkstockTitelillustration: © iStockphoto/ fotofritz16; © iStockphoto/André Maslennikov; © 2006 TASCHEN GmbH; © shutterstock/Vladimir Wrangel; © shutterstock; © shutterstock/Eniko Balogh; © shutterstock/Dennis van de Water; © shutterstock/KaspriUmschlaggestaltung: Kirstin OsenauE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-2344-3
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
Teil 1DAS HAAR DER GÖTTER
Juli 552 n.Chr.
Kapitel 1
Das Hühnerorakel verkündete Unheil. Umringt von einer Horde halbnackter Seefahrer scharrten zwölf schwarze Hennen über die Planken der Poseidonia. Die Köpfe der Vögel ruckten aufmerksam in alle Richtungen. Nur die Brotkrumen, die man ihnen hingeworfen hatte, ignorierten sie mit der Verachtung ptolemäischer Prinzessinnen.
Die Mannschaft sonderte ein Schweigen ab, das jedem Totenschiff zur Ehre gereicht hätte. Nicht einer der Seefahrer scheuerte sich die ledrige Haut, knackte mit den Fingerknöcheln oder knirschte mit den Zähnen. Alle Blicke waren auf die Glucken gerichtet, die sich jedoch nicht beeindrucken ließen. Gemächlich stolzierten sie an dem üppig ausgelegten Futter vorüber, ohne einen einzigen Brocken aufzupicken.
Ein dürrer Mann mit Stoppelhaar stieß sich vom Dollbord ab, zerbrach den Kreis des Orakels und den des Schweigens. Sein Gesicht war bleich wie Gischt, als er der Mannschaft zurief, sie solle die verfluchten Hühner endlich wieder in die Käfige sperren. Doch niemand rührte sich, um dem Befehl nachzukommen.
Stattdessen trat ein stämmiger Kerl mit stechendem Blick nach vorn und fasste den Dürren am Arm. »Kapitän, das Unglück hat sich an unseren Kiel geheftet. Wir dürfen nicht auslaufen.« Er deutete auf die Vögel. »Die Hühner sprechen die Sprache der Götter. Lässt du den Anker lichten, wird sich das Meer gegen uns erheben. Schwarze Wogen werden uns verschlingen und unsere entseelten Körper an die Strände speien.«
Der Kapitän wischte die Hand des Seemanns beiseite. »Still, Ruderknecht! Denkst du, ich weiß nicht, was es bedeutet, wenn die Hennen das Futter verschmähen? Hätte ich das Kommando, ich würde das Schiff bis zum Isisfest vor Anker liegen lassen, und wenn es mich einen Arm kosten würde.«
»So lass uns verschwinden! Dieser Taurus wird ein anderes Schiff auftreiben für seine unglückselige Fahrt in den Osten. Schau dich um! Der Hafen ist voller Seeleute, die Kuriere aus Byzanz für einen halben Solidus bis ans Ende der Welt fahren würden.«
»Aber nicht bis in den Hades.« Eine tiefe Stimme donnerte vom Anleger her über die Köpfe der Mannschaft hinweg, als käme sie geradewegs vom Olymp herab.
Ein Mann war dort aufgetaucht, gekleidet in das tiefe Blau und Rot der byzantinischen Emissäre, der Gesandten des Kaisers. Zwar wiesen ihn auch die Streifen auf seiner bis zu den Waden fallenden Tunika als Kaiserlichen aus, doch war seine Weste persischer Herkunft. Er mochte an die vierzig Jahre zählen. Sein langer schwarzer Bart war mit Ringen behangen und ebenso mit Olivenöl zum Glänzen gebracht worden wie das lange Haar, das den Kopf des Hochgewachsenen schmückte. Was ihn jedoch am stärksten von den Menschen im Hafen abhob, war ein schwarzes Stirnband, von dem Fransen herabhingen – ein Mandili, wie die Kreter es trugen.
»Taurus!« Der Kapitän beugte das Haupt. »Kommt an Bord. Die Poseidonia steht Euch zur Verfügung.«
»Was nutzt mir ein Schiff ohne Mannschaft, Triarch? So wenig wie ein Haus ohne Sklaven, nicht wahr?«
Die Seeleute, die endlich wieder zum Leben erwachten, durchbohrten Taurus mit Blicken. Fingerknöchel knackten, und von Salzluft zerfressene Zähne knirschten wie Wracks auf einer Sandbank.
Der Kapitän strich sich über den Bürstenschnitt und schielte zu seinen Männern hinüber. »Kein Haus, ein Palast soll die Poseidonia für Euch sein. Wer braucht schon Sklaven, wenn Fürsten ihm zu Diensten sind? Bitte, kommt an Bord, Taurus!«
Dieser deutete mit einem beringten Finger auf die Hühner. »Euer sogenannter Palast ist ein Hühnerstall. Soll ich unterwegs Eier ausbrüten?«
»Das ist das Hühnerorakel unseres Schiffes. Die Tiere wollen nicht fressen. Das bedeutet Unheil. Deshalb sind die Männer so nervös.«
»Das Hühnerorakel? Nun, wenn die Tiere nicht fressen wollen und das ein Problem ist, so kann ich Euch weiterhelfen.« Mit einem Satz sprang Taurus an Bord und packte mit flinken Fingern eine träge Henne. Der Vogel protestierte gackernd. »Habt Ihr schon daran gedacht, dass Eure Hühner nicht fressen, weil sie durstig sind?« Ohne eine Antwort abzuwarten, warf Taurus die Henne in hohem Bogen ins Hafenbecken.
Die Mannschaft stürzte nach Steuerbord, einige brüllten vor Wut, andere riefen dem rasch versinkenden Huhn Kommandos zu, die das verzweifelte Tier jedoch weder verstand noch befolgte. Wild schlug es mit den Flügeln und erreichte damit, dass das Hafenwasser umso schneller in sein Gefieder eindrang.
Als einer der Ruderknechte über Bord sprang, um die Henne zu retten, war es bereits zu spät. Der Vogel war ertrunken. Wie schwarzer Tang hing er in der Hand des Mannes.
»Und jetzt an die Ruder, ihr Hühnerhelden!« Taurus’ Stimme übertönte die aufgebrachte Mannschaft. »Sonst lernt das übrige Federvieh auch noch schwimmen. Und ihr dazu! Besser, ihr kocht aus euren Glucken ein Suppenorakel, damit sie den Gesandten des Kaisers nicht noch einmal von wichtigen Geschäften abhalten. Beim feurigen Pfuhl, der mit Schwefel brennt! Wo steckt mein Begleiter?« Mit einer Geste der Verachtung wischte sich Taurus eine Hühnerfeder von der Schulter.
Flüche auf Ägyptisch drangen vom Pier herüber, wo der Ruderknecht gerade aufgetaucht war. Wasser tropfte von seinem Körper herab und vermischte sich mit den Tränen, die ihm über das Gesicht rannen, als er das Schiff wieder betrat. In seinen Händen lag schlapp der Kadaver der ertrunkenen Henne, den er Taurus entgegenstreckte.
»Diese Henne«, hob er an, »habe ich selbst aus Delphi geholt, als sie noch ein Küken war. Sie war, wie ihre Schwestern, ein Liebling der Pythia, des delphischen Orakels höchstselbst. Vor meinen Augen hat die Seherin die Tiere nach dem Willen des Apoll gesegnet, dem Sohn des Osiris. So ein Huhn wirft man nicht einfach über Bord.« Die letzten Worte erinnerten an das Knurren eines Hundes.
Langsam wandte sich der Byzantiner dem Ägypter zu. »Eine Tragödie. Doch deine Kümmernis hat gerade erst begonnen.«
Kleine Wogen schwappten gegen das Schiff und ließen es schaukeln.
Taurus blickte den Ruderknecht finster an. »Das Orakel von Delphi ist vor mehr als hundertfünfzig Jahren von Kaiser Theodosius verboten worden. Ich habe bereits davon gehört, dass die alten Riten dort im Geheimen noch immer abgehalten werden. Solltest du also tatsächlich in Delphi gewesen sein und an einem Götzendienst teilgenommen haben, so hast du damit gegen das Gesetz verstoßen und gehörst bestraft – und zwar härter als deine teuflischen Hühner. Denn die sind immerhin nicht so dumm, dem Bruder des Kaisers ungefragt ein Verbrechen zu gestehen. Und jetzt an die Arbeit, bevor ich die Hafenwache rufen lasse!«
Der Ägypter ließ den Hühnerkadaver sinken. Einen Augenblick lang zögerte er, dann warf er das triefende Bündel zurück ins Hafenbecken.
»Seht!«, rief in diesem Augenblick der Kapitän. »Die Hühner fressen. Die Götter meinen es gut mit uns.«
Tatsächlich pickten die Hennen etwas von den Planken auf. Doch was zwischen den Schnäbeln verschwand, war nicht das Futter der Seeleute. Die Vögel fraßen Würmer und Schnecken, die sich auf den Schiffsplanken wanden. Eine der Glucken hielt triumphierend eine fette Nacktschnecke im Schnabel und machte sich mit ihrer Beute davon, um sie ungestört verschlingen zu können. Berauscht von ihrem Fang wäre sie beinahe gegen die Beine eines Mannes gerannt, der am Achterdeck lehnte. Seine Kleidung war ebenso kostbar und prunkvoll wie die des Taurus. Seinen Kopf zierte dünnes helles Haar, seine jugendliche Gestalt war wohlgenährt und von einem ausschweifenden Leben im Überfluss gezeichnet. Gerade schüttete er das letzte Gewürm aus einem Holzeimer auf das Deck.
Taurus legte dem Kapitän eine mächtige Hand auf die Schulter. »Die Götter, Triarch? Wenn die Götter Euch meinen Neffen Lazarus Iulius Olympiodorus zu Hilfe schicken, so müssen sie Teufel sein.«
Wenig später glitt die Poseidonia durch die Dünung des Kaspischen Meeres. Die Ruderzüge der Besatzung übertrugen sich auf den Rumpf des Schiffes und brachten das Holz zum Vibrieren. Von Osten her wehte den Männern ein heißer Wind entgegen, der sie ebenso zum Schwitzen brachte wie die Tatsache, dass er das Setzen der Segel verhinderte. Nur von der Muskelkraft ihrer fünfzig Ruderer angetrieben, schoss die Dromone in Richtung Asien.
Die beiden Byzantiner standen am Bug, wo der Vordersteven die Wellen teilte. Taurus hatte sich ein Tuch aus Seide um den Kopf geschlungen, um das sorgfältig gepflegte Haar zu schützen. Der Stoff zeigte den byzantinischen Greifen, ein Ornament, das allerorten Schrecken hervorrief und Taurus Respekt einbrachte. Nur hier nicht. Kreischend schwebte ein Dutzend Möwen über dem Deck und schien das Bild des mythischen Artgenossen auf dem Tuch zu verhöhnen.
Taurus taxierte die Vögel mit unheilvollem Blick. »Das Land der Barbaren«, sagte er. »Selbst die Möwen sind hier wild und dumm. Wenn wir doch schon wieder in der Kaiserstadt wären.« Er kniff die Augen zusammen. Der Horizont war eine ungebrochene Linie zwischen dem tiefen Blau des Wassers und dem nur geringfügig helleren Blau des Himmels. Taurus seufzte.
»Um genau zu sein«, hob sein Begleiter an, »befinden wir uns in einem von Byzanz abhängigen Gebiet. Erst am jenseitigen Ufer beginnt die Fremde. Der Kaiser selbst ist demnach Herr dieses kleinen Meeres und«, er blickte nach oben, »damit auch dieser Möwen.« Olympiodorus hatte die Arme um den Leib geschlungen, um zu verhindern, dass der Wind an seinen Kleidern riss. Seine Hände waren rot angelaufen, so als hätten sie zu lange in warmem Wasser gelegen.
»Herr der Möwen!« Taurus schürzte die Lippen. »Wenn wir wieder in Byzanz sind, kannst du meinem Bruder diesen Titel zu Füßen legen. Beim feurigen Pfuhl, ich bin sicher, er wird ihn originell finden.«
Olympiodorus stieß ein meckerndes Lachen aus, das Taurus an das Klappern von Blechnäpfen erinnerte. In den dreiundzwanzig Jahren, die er seinen Neffen nun kannte, hatte er viele Menschen bei diesem Laut zusammenzucken sehen. Auch ihm selbst stellten sich noch immer die Haare auf den massigen Unterarmen auf, wenn Olympiodorus lachte. Genau so würden Käfer lachen, wenn sie es könnten, dachte Taurus.
»Vielleicht können sie es«, sagte er laut. Olympiodorus warf ihm einen fragenden Blick zu, aber Taurus schüttelte den Kopf. »Was hast du ausgeheckt, um die Hühner zum Fressen zu bewegen?«, fragte er. »Nie zuvor habe ich Hühner Schnecken fressen sehen. Sie waren unersättlich wie Löwen.«
»Wenn der Hunger die Speise nicht würzt, dann muss der Koch nachhelfen. Ich habe Schnecken und Würmer, die in jenem Eimer wohl als Fischköder auf ihr Ende warteten, mit Salz bestreut. Ein Faktor, zwei Resultate.« Olympiodorus hielt ebenso viele Finger in die Höhe. »Erstens scheint die salzige Kost den gefiederten Gästen gut geschmeckt zu haben, jedenfalls besser als das harte Brot, das der Ägypter ausgestreut hatte – vermutlich hatte er es aus einem Pharaonengrab gestohlen. Zweitens allerdings werden die Hühner an der Würze verenden, denn Salz in einer solchen Menge ist reines Gift für ein Hühnerhirn. Glaub mir, mein Freund, die schwarzen Hennen dieses Schiffes werden bald im finsteren Fluss der Unterwelt treiben.«
Taurus hoffte, dass diese Prophezeiung erst eintrat, wenn sie wieder an Land waren – außer Reichweite der Seeleute. Was jedoch zählte, war, dass diese abergläubischen Tölpel mit dem Schiff abgelegt hatten. Dank des Einfallsreichtums seines Neffen.
»Wenn du bitte darauf achtgeben würdest, mich auf der Reise nicht mit einer deiner Schnecken zu verwechseln«, sagte er, während über ihnen noch immer die Möwen lärmten.
»Den Weg nach Serinda werden wir ohnehin kaum schneller als Kriechtiere zurücklegen«, erwiderte Olympiodorus. »Die Nordroute! Unbekanntes Gebiet ohne Karawanenstraßen, eine Strecke frei von Handelsposten, dafür voller armer Wilder, die schon für dein Kopftuch ihre Mütter erschlagen würden. Hättest du nur die Südroute gewählt! Wir könnten bald schon das Tarimbecken sehen und uns von einer Karawane nach Osten bringen lassen.«
Taurus überließ es dem Wind, seinem Begleiter zu antworten. Zu oft schon hatten sie den Plan erörtert.
Der Kaiser, das gesamte Reich, brauchte Seide aus Serinda. Von jenem legendären Land im Osten floss der kostbare Stoff seit Jahrhunderten die alten Handelswege entlang nach Westen. Mehrere Tausend Kamele, viele Hundert Schiffe und ein Heer von Händlern trugen die Seidenballen bis an den Bosporus. Dort war der Hunger nach dem glänzenden Gewebe unstillbar. Frauen wie Männer hüllten sich in das kostbare Tuch, die Wände der Patrizierhäuser zierten Seidenbahnen, und auch das einfache Volk gierte nach Seide. Denn der Wert der Ballen diktierte die Preise im gesamten Reich, sogar die von Brot und Milch. Kaiser Justinian hatte seinen Palast bis in den hintersten Winkel mit dem Stoff auslegen lassen, um seinen Füßen zu schmeicheln.
Andere Völker standen der byzantinischen Seidensucht in nichts nach. Alanen, Gepiden, Ostgoten, Vandalen, Langobarden und Ägypter verzehrten sich nach dem Gewebe, das sie Engelswolle oder Haar der Götter nannten. Doch nur Byzanz konnte es liefern. Seide war das Blut, das durch die Adern des Reiches floss und den Koloss am Bosporus am Leben erhielt.
Doch nun hatte dieses Herz aufgehört zu schlagen. Um von seiner Quelle im Lande Serinda nach Byzanz zu gelangen, mussten die kostbaren Ballen durch feindliche Länder reisen. Eines davon war Persien, ein Riesenreich, regiert von einem Trinker. König Khosrau war unberechenbar, ein unbarmherziger Feind Kaiser Justinians und ein Kriegstreiber aus Tradition – immerhin hatten seine Vorgänger die Welt des Mittelmeeres tausend Jahre lang in Angst und Schrecken versetzt.
Als der Konflikt zwischen Persien und Byzanz vor acht Monaten wieder einmal aufgeflammt war, hatte Khosrau alle Handelsstraßen sperren lassen. Statt seinen Truppen zu befehlen, gegen den Feind anzurennen, nahm er diesem einfach die Lebensgrundlage. Ohne Seide war Byzanz nichts weiter als ein Bettler, der von den Almosen Persiens zehren sollte. Doch Justinian war noch nicht bereit, Khosrau die Füße zu küssen.
Seide musste her, wollte das Reich am Bosporus, der einzig legitime Erbe Roms, nicht zu einem Vasallen der Perser verkümmern. Da jedoch der Warenstrom aus dem Osten in den persischen Zollämtern versickerte, blieb den Byzantinern nur eins: Sie selbst mussten Seide herstellen. Die Frage war nur, wie.
Schon seit Jahrhunderten beherrschten die Handwerker der Hauptstadt die Kunst, aus Seidenfäden delikate Gespinste zu weben. Auch das Färben von Seide gelang den Meistern der Zunft fast so gut wie ihren Vorbildern in den Ländern des Ostens. Doch nie war es gelungen, die Fäden selbst herzustellen oder gar zu spinnen.
Nicht dass Byzanz es unterlassen hätte, zu experimentieren. Ein Aufgebot an Gelehrten, Handwerkern und Priestern hatte versucht, das Geheimnis der Seide zu lüften. In ihren Werkstätten und Laboratorien war es zugegangen wie bei jenen Verrückten, die seit Menschengedenken versuchten, Gold zu erzeugen: Herden von Wollschafen, Pflanzen exotischster Herkunft und ein Heer von Sklaven waren darin verschwunden. Herausgekommen waren schließlich Forscher mit leeren Händen und halbseidenen Ausflüchten. Als Justinian einen Schlussstrich zog, hatten die Experimente die Reichskasse ein Viertel der Steuereinnahmen und viele Forscher den Kopf gekostet. Seide aber konnte noch immer niemand herstellen.
Doch Justinian gab nicht auf. Er ließ die Hafenstädte Kleinasiens nach Reisenden durchkämmen, die das Land der Serer kannten – ein aussichtsloses Unterfangen. Keine der Handelskarawanen legte jemals die volle Strecke von Serinda bis nach Byzanz zurück. Stattdessen war die gewaltige Route, die Asien mit Europa verband, ein Tau, das aus Hunderten kurzer Stücke geknüpft war. Jeder Kaufmann reiste stets nur einen kleinen Teil dieses Strangs entlang, lud an einem Punkt Waren auf seine Kamele, um sie ein Stück weiter wieder abzuladen und umzukehren. Kaum jemand aus dem Land der Serer hatte jemals die Gestade des Mittelmeeres gesehen. Ebenso wenig war in Tyros, Merw oder Damaskus ein Reisender aufzutreiben, der die Steppen Serindas kannte, geschweige denn jene geheimen Höhlen, in denen die Serer der Legende nach ihre Seide gewannen.
Kein Reisender, sondern eine alte Schrift ließ in Byzanz schließlich Hoffnung keimen. Eine Gesandtschaft aus Ägypten war an den byzantinischen Hof gekommen, als die Verzweiflung und der Zorn Justinians ihren Höhepunkt erreicht hatten. Als Geschenk legten die Ägypter dem Kaiser einen brüchigen Papyrus zu Füßen. Wie jedermann in Europa und Africa wussten auch die Herrscher am Nil von der Besessenheit des byzantinischen Kaisers, das Geheimnis der Seide entschlüsseln zu wollen. Deshalb überreichten sie ihm statt einer Schiffsladung Damast, Perlen und Gewändern aus dem Fell des Wüstenfuchses nur eine unscheinbare und beinahe verblasste Schrift. Fünfhundert Jahre, so die ägyptischen Gesandten, sollte der Text alt sein und aus der Feder des berühmten römischen Naturkundlers Plinius stammen. Nur dem Wüstenklima Ägyptens sei es zu verdanken, dass der Papyrus noch erhalten sei.
Dass die Ägypter sich damit auf geradezu unverschämte Weise als die von der Natur auserkorenen Hüter alten Wissens bezeichneten, kümmerte Justinian wenig. Er hatte nur Augen für die Schrift des Plinius, die versprach, ihm über den Abgrund eines halben Jahrtausends hinweg das Geheimnis der Seide zuzuflüstern.
Doch Plinius erwies sich als Spitzbube. Wie der Text verriet, war sein Verfasser niemals im Osten gewesen und hatte weder Serinda noch die Meister der Seidenproduktion gekannt. Wo der Quell seines Wissens gesprudelt hatte, verschwieg der Römer. Es mochte ein Reisebericht oder die Fantasie eines betrunkenen Veteranen gewesen sein, das Spottlied eines Kindes oder die Fabulierlust einer Hetäre auf dem Lotterbett. Und doch blieb Justinian keine Wahl, als den alten Worten Glauben zu schenken.
Seide, so schrieb Plinius, wachse auf Bäumen. Deren Holz und Laub seien von weißer Farbe, deshalb sei der Name dieses absonderlichen Gewächses »Schäumende Medusa«. Ihre Farbe verdankten die Medusen einer Art Wolle, die auf ihnen wachse. Dreimal im Jahr würden die Serer die Bäume mit Wasser besprengen und die nassen Fasern abkämmen. Aus dieser Ernte werde Seide hergestellt, schloss Plinius seinen Bericht.
Das war alles.
Die Gelehrten des Kaiserhofs verkrochen sich in Studierstuben und versammelten sich in Vortragssälen, Soldaten schwärmten aus und brachten Schösslinge aus allen Teilen des Reiches nach Byzanz. Justinian ließ das aramäische Viertel der Stadt räumen, um dort Bäume pflanzen zu können. Jeder, der die Hintergründe des Treibens nicht kannte, erklärte den Kaiser für verrückt. Seine politischen Gegner im Senat frohlockten. Schon machten Namen wie »Bäumemelker« und »Wurzelkaiser« die Runde. Dankbar griffen Redner die Thematik auf und schleuderten Schmähungen von den Tribünen, in denen das »morsche Holz des Reiches« und die »gefällten Stämme der alten Herrscher« eine Rolle spielten. Auch für die Potenz des Kaisers fanden sich vielfältige Vergleiche aus dem Pflanzenreich.
Gedüngt mit Spott, wuchs mitten in der Hauptstadt ein Forst heran, der mit Gelehrten so bevölkert war wie ein Wald mit Rotwild. Die Schäumende Medusa aber zeigte sich nicht.
Die Reichskasse leerte sich zusehends, der Druck aus dem Senat wuchs. »Krieg!«, riefen die Senatoren, und ihre Forderung hallte lauter und lauter aus dem Senatsgebäude am Augustaion. Das Echo auf den Märkten und in den Mietskasernen der Stadt verstärkte die Forderung tausendfach. Justinian aber stellte sich taub. Ein Waffengang gegen Persien war ohne Geld zum Scheitern verurteilt.
Doch als der Kaiser eines Abends die Fensteröffnungen des Palasts mit Brettern verrammeln ließ, um die Rufe der Menge auszusperren, trat sein Neffe Olympiodorus, der Sohn seines jüngsten Bruders, an ihn heran und flüsterte dem Herrscher der Welt etwas ins Ohr.
Kapitel 2
Spinnen!« Taurus’ Hand donnerte auf die Landkarte. Vor Schreck verschüttete Garnisonskommandant Marcellus etwas von dem schlechten Wein. Ein roter Fleck breitete sich auf dem Netz aus Linien und Kreuzen aus. »Bei den sieben Höllen, Kommandant! Wir suchen Spinnen, keine Perser.«
Olympiodorus räusperte sich. »Was mein Begleiter sagen will, ist, dass wir nach Serinda reisen, um friedlich Handel zu treiben. Euer Angebot, uns Söldner an die Seite zu stellen, ist ehrenhaft, und wir danken Euch dafür. Aber Ihr könnt Euch Eure Soldaten in den Anus stecken.«
Der Kommandant goss sich aus einer tönernen Kanne neuen Wein ein. Seine Hände zitterten.
Taurus blickte voller Verachtung auf das Gefäß. Konnte er erwarten, dass der letzte Außenposten des Reiches ihm mit Silbergeschirr aufwartete? Wohl kaum. Aber selbst hier, am Südostufer des Kaspischen Meeres, musste es doch Menschen mit Verstand geben. Rom, dachte er, wird sich nie ändern. Ganz gleich, ob die Hauptstadt am Tiber liegt, an der Mosel oder am Bosporus. Rom wird für alle Probleme der Welt stets dieselben Lösungen parat haben: Geld und Krieg.
»Aber Ihr seid Verwandte des Kaisers. Wenn Euch unterwegs etwas zustößt, werde ich zur Verantwortung gezogen«, wandte der Kommandant ein.
Taurus’ Hand klatschte erneut auf die nasse Karte. »Den Sarkophag meines Großvaters gegen eine koptische Holzkiste: Wenn wir mit einem Aufgebot von einhundert Mann nach Serinda ziehen, werden die Perser an uns kleben wie Fliegen an Pferdemist. Und ich ziehe es vor, nicht wie Mist behandelt zu werden.«
Olympiodorus nahm einen Holzbecher und füllte ihn bis zum Rand mit Wein. Dann trank er ihn in einem Zug leer. »Widerlich! Vergib mir, Bacchus!«, grunzte er und schenkte sich nach. »Hört zu, Marcellus! Das Reich braucht Seide.«
Der Kommandant nickte.
»Der Kaiser und wir beide sind die Einzigen, die wissen, wie die Serer Seide herstellen.«
»Wir glauben, es zu wissen«, warf Taurus ein.
Doch sein Neffe ließ sich nicht beirren. »Die Seidenfäden entstehen auf Bäumen, wo Spinnen sie herstellen. Genauso wie unsere Spinnen, wenn sie ihre Netze weben. Nur dass die Tiere in Serinda Rohseide aus den Drüsen schießen. Begreift Ihr? Wir werden die Spinnen von den Serern kaufen und nach Byzanz bringen, wo sie für uns Seide machen sollen. Keine Perser, keine Schlachten, kein Aufsehen.« Er zog die Augenbrauen in die Höhe. »Einfach, nicht wahr?«
Kommandant Marcellus schüttelte den Kopf. »Trotzdem ist die Reise nach Serinda weit, und die Wege sind voller Gefahren. Falls Ihr überhaupt den richtigen Weg findet. Sonst reist Ihr für nichts quer durch Asien.«
Taurus grinste. »Falls die Serer uns die Spinnen überhaupt überlassen. Sonst reisen wir für nichts quer durch Asien.«
»Falls wir die Spinnen überhaupt lebendig bis an den Bosporus bringen können. Sonst reisen wir für nichts quer durch Asien«, pflichtete Olympiodorus ihnen bei.
»Falls du mit deiner Spinnen-Idee überhaupt richtig liegst. Sonst …«, brummte Taurus.
Marcellus errötete bis zu den Spitzen seiner schütteren Haare. Er wandte den Byzantinern den Rücken zu und blickte aus dem Fenster. Unter der Villa des Tribuns plätscherte das Hafenwasser an die Molen. In Abaskan, dem östlichsten Außenposten des Oströmischen Reichs, herrschte die Ruhe der Grenzlande. In Marcellus tobte dagegen ein Sturm. »Warum habt Ihr mich dann überhaupt aufgesucht?«
»Gewiss nicht wegen Eures Weins, Kommandant«, antwortete Taurus. »Hört genau zu!«
Der alte Steppenreiter, zu dem Marcellus die beiden Byzantiner geführt hatte, lachte mit den Möwen. Er saß auf dem Rand einer gemauerten Kameltränke und reparierte ein Seil aus Hanffasern. Über seinem Kaftan trug er einen knielangen Mantel aus Filz. Auch seine Mütze war aus Filz, und sein grauer Bart so verschlungen, dass er dem Gewebe von Mütze und Mantel ähnelte. Wind und Sonne hatten seine Haut gegerbt und das Antlitz mit tiefen Furchen überzogen. Aus seinen Ohren wuchs das Haar der alten Männer.
»Wie steht es? Willigst du ein, Wusun?« Kommandant Marcellus hatte sich mit Taurus vor dem Alten aufgebaut.
Olympiodorus stand etwas abseits bei den Kamelen und pflückte den Tieren etwas aus dem Fell, das er untersuchte und in den Sand warf, nur um sofort wieder nach neuen Funden zu fischen.
»Ich habe schon Leute mit den verrücktesten Ideen durch Steppen, Berge und Wüsten geführt«, sagte der Alte. »Aber für ein Nest voller Spinnen bis nach Serinda zu reiten, das ist der Gipfel der Torheit. Na, jedenfalls bringt ihr mich zum Lachen. Der Tag begann ernst genug.« Er zeigte ihnen das Seil, das in zwei Hälften gerissen war.
Taurus schob Marcellus zur Seite und ließ einen Faden mit Münzen in die schwielige Hand des Kameltreibers gleiten. Dann hielt er ihm einen weiteren Faden vor die Nase. »Der erste Faden für den Weg nach Osten, der zweite für den zurück nach Westen. Sollten deine Dienste so wertvoll sein, wie Kommandant Marcellus behauptet, wird man dich so reich belohnen, dass du nie wieder Fremde durch dein Land wirst führen müssen.«
Wusun lachte und entblößte einen fast zahnlosen Schlund, in dem eine bleiche Zunge zuckte. »Nie wieder mit Kamelen durch das Land ziehen?«, fragte er in gebrochenem Griechisch. »Nein, mein Freund. Ich werde ihnen neue Glocken kaufen und gutes Futter, damit sie noch viele Male mit mir auf die Reise gehen können.« Er hustete.
Taurus fragte sich, ob der Alte das Geld nicht besser in die eigene Gesundheit investieren sollte. Doch die Steppenreiter, denen er bislang begegnet war, hatten alle wie das Gras gewirkt, über das sie hinwegritten: leblos und verbrannt auf den ersten Blick, aber bei näherem Hinsehen zäh und ausdauernd. Taurus strich sich über das frisch geölte Haar.
Olympiodorus trat zu ihnen. »Diese Kamele sind voller Zecken und Flöhe. Ich muss wohl nicht aufzählen, wo wir uns überall kratzen werden, wenn wir zwei Wochen auf ihnen geritten sind.«
»Zwei Wochen?« Der alte Wusun schnaubte. »Ihr glaubt wohl, Kamele könnten fliegen.«
»Wie weit ist es bis ins Land der Serer?«, fragte Taurus.
Wusun wiegte den Kopf auf seinem faltigen Hals. »Hängt davon ab.«
Taurus streckte ihm zwei weitere Fäden voller Münzen entgegen, und der Steppenreiter griff zu. »Das hilft gegen die Zecken. Aber die Strecke bis nach Serinda macht ihr mit Geld nicht kürzer. Ich bringe euch in drei Monaten dorthin und in weiteren drei Monaten wieder zurück.«
Olympiodorus verzog das Gesicht und machte einen bedrohlichen Schritt auf den Kameltreiber zu, doch Taurus hielt ihn zurück. Der Alte gefiel ihm. »Schlag ein!«, sagte er und hielt dem Führer die ausgestreckte Hand entgegen.
Doch der Steppenreiter lachte nur. »Nein, nein, Byzantiner! So geht das hier nicht. In diesem Land zeigst du mir die offene Hand, wenn du mir drohst. Aber Wusun ist schlau. Wusun weiß, was du sagen willst. Deshalb zieht Wusun auch nicht den Dolch und schneidet dir die Kehle durch.«
»Bisher hatte ich auch noch keinen Grund anzunehmen, dass du ein Halsabschneider bist«, brummte Taurus.
»Schweig, und hör zu, wenn ich spreche. Willst du einen Handel geltend machen in dieser vertrockneten Weltgegend, spuck auf die Füße deines Handelsfreundes.«
Taurus inspizierte die gewickelten Lederriemen um Wusuns Füße und Waden, um den Wahrheitsgehalt dieser Behauptung zu ermessen. An dessen Fußkleidern aber hatten die Zeit und die Steppe bereits so stark genagt, dass Speichelspuren nicht auszumachen waren. Während Taurus noch überlegte, ob Wusun ihm einen Bären aufbinden wollte, traf etwas seinen linken Stiefel. Der Alte hatte das Geschäft besiegelt.
Noch am selben Abend stellte Wusun in der Stadt sein Talent als Führer unter Beweis. Der Steppenreiter kannte nicht nur den Verlauf des Oxus und des Tienschan-Gebirges so genau wie die Linien auf seinen Handflächen. Er wusste überdies, welche Karawanserei in Abaskan die besten Seile, Decken und Lampen verkaufte und wo man das saftigste Fleisch und den trockensten Zunder erstand. Bassus, der Hammelschlächter, Theon, der Hehler, Grifo, der Sklavenhändler – jeder, der etwas zu verkaufen hatte, rief Wusun einen Gruß oder einen Fluch hinterher.
Besonders laut keiften die Huren, sobald der Steppenreiter in Sicht kam. Während das Trio durch die engen Gassen strich und Taurus’ runde Schultern an den Hauswänden entlangschliffen, hörte er immer wieder das Pfeifen und Kichern von Weibern, die der Alte mit einem Zuruf auf Sogdisch zum Schweigen brachte. Könnte er doch nur mehr von dieser Sprache verstehen! Den Flügel eines byzantinischen Greifen hätte Taurus dafür gegeben.
Leise schaukelten die Laternen im kühlen Wind. Je dunkler es wurde, umso mehr Leben rührte sich in der Stadt. Die Händler schlugen die schweren Planen ihrer Stände zurück, die sie in der Mittagshitze darüber ausgebreitet hatten. Darunter kam gleichermaßen Gewöhnliches wie Absonderliches zum Vorschein. Die Auslage des Gemmenschleifers erinnerte Taurus noch an die Juwelenläden von Byzanz, doch für die Nasenprothesen aus Bronzeblech oder Alabaster fehlte ihm jeder Vergleich. Olympiodorus zeigte hierhin und dorthin, bald erregt, bald belustigt. Die Stunden verflogen mit dem letzten Licht, und Taurus fragte sich, wie exotisch die Länder sein mochten, in die zu reisen sie beabsichtigten, wenn schon die erste Station ihrer Reise mit einem solchen Gemenge aus Schrullen und Haarsträubereien aufwartete.
Unter seinem Stiefel aus Fohlenleder knirschte etwas. Taurus sah zu Boden und sah Glassplitter, die den Schein der Öllampen reflektierten. Er machte Olympiodorus darauf aufmerksam. »Hier steht die Welt kopf. Der Tribun unserer Garnison muss seinen mistigen Wein aus Irdenware trinken. Und zwei Straßen weiter werfen sie die kostbarsten Gefäße aus den Fenstern.«
Wusun hob eine der Scherben auf. Der Glasstaub ließ seine Fingerkuppen glitzern. »Was ist das?« fragte er.
»Es ist Gold, das jemand auf die Straße geworfen hat«, sagte Taurus.
Wusun schickte sich an, seine Finger in den Mund zu stecken. Doch Taurus packte seinen Arm und zog ihn mit sich fort.
Olympiodorus lachte. »Es ist die Schönheit, die von innen kommen soll, mein Guter, nicht der Reichtum. Besser, wir finden etwas Bekömmlicheres zu essen.«
Die Taverne Zum Hyrkanischen Schwein lockte sie mit bunten Fresken an der Fassade, die ankündigten, welche Freuden den Gast im Innern erwarteten. Dort bat der wulstlippige Wirt die Neuankömmlinge, sich auf die Teppiche um das Feuer zu setzen. Auf niedrigen Schemeln richtete er Dampfbrot, Rosinen und Wein an.
Olympiodorus starrte auf das Essen und packte den Wirt am Kittel. »Sehen wir aus wie Bettler? Bring uns das hyrkanische Schwein, nach dem du deinen Schuppen benannt hast. Oder bist du damit etwa selbst gemeint?«
Der Wirt zog sich unter Verbeugungen zurück. Weiter hinten im Haus, dort, wo die Küche liegen mochte, erklang kurz darauf Geschrei.
Taurus musterte die Schemel der anderen Gäste. »Warum sehe ich nirgendwo Braten, Wusun? Ist dies eine Garküche für die Armen?«
»Holz«, sagte Wusun, der an einer Rosine lutschte, »gibt es hier nicht. Keine Wälder. Einen Braten zu rösten dauert lange und ist teuer.«
Das Schwein ließ auf sich warten. Die drei Männer tranken schweigend ihren Wein und beobachteten die anderen Gäste bei Spiel und Schwatz. In einer Ecke würfelten Männer in abgenutzten grauen Schafspelzen mit Hammelknochen. Unversehens stand einer von ihnen auf und hob einen Krug in die Höhe. Dann ging er um seine Gefährten herum und goss ihnen Schnaps ins Haar. Nur wer rechtzeitig den Kopf in den Nacken legte und den Strahl mit dem Mund auffing, entging dem scharfen Schauer.
Als der tolle Mundschenk seine Freunde beglückt hatte, hielt er auf die Byzantiner zu. Taurus erhob sich und stellte sich dem Stumpfnasigen in den Weg. »Wir sind nicht für deine Späße zu haben. Verschwinde!«
Der Mann schaute zu seinem wuchtigen Gegenüber auf, schien zu zögern und drehte dann ab, um sich andere Mitspieler zu suchen.
»Diese Spinnen«, sagte Wusun, als Taurus sich wieder gesetzt hatte. »Wieso sollten die Serer sie euch überlassen?«
»Sei nicht blöd, Alter!«, entgegnete Olympiodorus. »Wir kaufen sie natürlich! Wir haben genug Münzfäden dabei, um alle Kamele Serindas zu kaufen, und die Schweine noch dazu.« Sein Blick flatterte zur Hintertür, wo der Wirt mit dem Braten auftauchen sollte.
Wusun schob sich ein Stück Brot in den Mund.
Taurus kniff die Augen zusammen. »Raus mit der Sprache! Worauf kaust du herum?«
»Brot?« Der Steppenreiter hielt ihnen einen Brocken entgegen.
Aus einem Winkel des HyrkanischenSchweins war irres Lachen zu hören. Der Schnapsgießer hatte neue Freunde gefunden.
Unversehens packte Taurus Wusuns Kaftan und zog ihn zu sich heran. »Wenn du etwas weißt, was unsere Mission vereiteln könnte, rückst du besser gleich mit der Sprache heraus! Das Überleben Roms hängt von uns ab. Verstehst du? Wenn wir scheitern, wird ein Reich untergehen, das seit tausendzweihundert Jahren die Welt regiert. Möchtest du dafür verantwortlich sein?«
Sacht strich Wusun die Hand des Byzantiners von seinem Überwurf. »Rom? Ich dachte, ihr kommt aus Byzanz.«
Olympiodorus stöhnte auf.
»Schon gut«, sagte Wusun. »Erklärt mir das ein anderes Mal. Jetzt bringe ich euch etwas bei. Passt auf: Da, wo wir hingehen, ist euer Geld etwa so viel wert.« Er nahm eine Rosine und zerdrückte sie zwischen zwei Fingern. »An manchen Orten sogar noch weniger.«
Taurus räusperte sich. »Willst du uns weismachen, die Serer handeln nicht mit Geld?«
»Doch, gewiss. Für Geld bekommt ihr viel in Serinda. Schinken, Schafdärme, den Duft des Schlafmohns, sogar Seide, wenn ihr welche wollt.«
»Die wollen wir«, erwiderte Olympiodorus.
»Oh«, brummte Wusun. »Ich dachte, ihr wolltet Spinnen kaufen.«
»Du kennst die Spinnen, nicht wahr? Es gibt sie! Ich wusste es!« Olympiodorus sprang auf. »Wie groß sind sie? Wie viel Seide stellen sie am Tag her? Wie viele werden wir benötigen, um fünfzig Ballen Rohseide in der Woche zu erhalten? Wie lange leben sie? Und wie schnell pflanzen sie sich fort?«
Der Steppenreiter zog die Augenbrauen hoch. »Du stellst die falschen Fragen.«
Taurus schaltete sich wieder ein. »Womit können wir die Tiere von den Serern kaufen?«
Wusun nickte.
Taurus und Olympiodorus warteten gespannt. Aber der Alte sprach nicht weiter.
»Nun?«, fragte Taurus.
»Ja«, sagte Wusun, »das war die richtige Frage.«
»Und die Antwort?«
Der Alte zuckte mit den Schultern. »Woher soll ich das wissen? Ich kaufe kein Geschmeiß.«
»Wenn die Serer kein Geld wollen, müssen wir wohl Tauschwaren mitnehmen«, sagte Olympiodorus und nahm wieder Platz. »Die Garnison wird uns damit ausstatten. Bunte Damaste, Teppiche aus Wolle, Gewirke mit Goldfäden, irgendetwas wird diese Serer schon betören. Und dann gehören die Spinnen uns.«
»Für solchen Tand wirst du kaum das Geheimnis der Seidenherstellung bekommen«, entgegnete Wusun.
»Dann vielleicht für Lapislazuli, Smaragde und Perlen?«, fragte Taurus. »Aber die führen wir nicht mit uns, und in der Garnison wird auch keine Truhe voller Geschmeide auf uns warten.«
Gerade als Wusun zu einer Antwort ansetzen wollte, spürte Taurus ein Prickeln auf seinem Kopf. Etwas Feuchtes rann seine Wange herab. Mit einem Satz war er auf den Beinen und packte den Betrunkenen, der sich ihm geräuschlos von hinten genähert hatte, bei der Gurgel. Er achtete nicht auf Olympiodorus’ Feixen, nicht auf das Johlen der anderen Gäste und nicht auf das Röcheln des Mannes in seinem Griff. Dem fiel der Krug aus den Händen und zerschellte auf dem Boden. Der Schnaps schwappte auf Taurus’ teure Lederstiefel und tränkte sein kaiserliches Gewand.
Angewidert blickte der Byzantiner an sich herab, sah die dunklen Flecken auf dem kostbaren Stoff, die Lache zu seinen Füßen und die Scherben des Krugs. Schlagartig ließ er den Trunkenbold los, der sich die Kehle massierte und ein paar Schritte zurückwich. Doch Taurus dachte nicht daran, ihn zu verfolgen. Seine Aufmerksamkeit galt voll und ganz der Bescherung zu seinen Füßen.
Im Durchgang zur Küche erschien der Wirt mit einer fetten Frau. Auf einer ausgehängten Tür trugen sie einen dampfenden Haufen Fleisch herein. Doch die drei Männer, die so begehrlich nach dem Braten gebrüllt hatten, waren verschwunden.
Taurus kniete im Schmutz der Gasse. Die Nacht hatte sich vollends auf Abaskan herabgesenkt, und die Laternen funkelten wie paarungsbereite Glühwürmchen.
Er hielt seinen Gefährten die glitzernden Hände entgegen. »In dieser Stadt liegt die Rettung des Reichs auf der Straße. Glas! Das ist es, was wir den Serern anbieten werden.«
»Der Schnaps ist dir wohl zu Kopf gestiegen und hat deinen Verstand verwässert«, sagte Olympiodorus.
»Wachgeküsst hat er ihn«, erwiderte Taurus. »Die Scherben des Schnapskrugs haben mich an die Glassplitter auf der Straße erinnert. Wir tauschen Glas gegen Spinnen! Wusun, glaubst du, die Serer können Glas herstellen?«
Der Steppenreiter schüttelte den Kopf. »Ich bin schon oft in Serinda gewesen, aber dieses Zeug habe ich dort noch nie gesehen.«
»Buchstäblich eine Schnapsidee!«, sagte Olympiodorus. »Der Weg ist viel zu weit. Wenn das Glas unterwegs zerbricht, war alles umsonst.«
Taurus schüttelte den Kopf. »Du denkst nur in eine Richtung – wie ein Insekt. Natürlich werden wir ihnen keine Sturzbecher und Glaskannen bringen. Sondern das Geheimnis der Glaskunst selbst. Verstehst du? Wir tauschen Wissen gegen Wissen.«
Olympiodorus kniete neben seinem Onkel nieder und tauchte die Hände in die Splitter. »Ich glaube, du hast soeben mit einem einzigen Gedanken das gesamte Reich gerettet. Au! Verflucht!« Er zog die Hände zurück und sah erschrocken, wie Blut über seine zerschnittenen Finger rann.
»Vielleicht kann uns der Besitzer dieser Scherben weiterhelfen«, sagte Taurus. »Wir sollten ihn ausfindig machen. Zeig uns den Basar, Wusun!«
Der nächtliche Markt von Abaskan lag unter einer gemauerten Kuppel und war das Fettstück einer mageren Stadt. Ein Teppichknüpfer arbeitete an vier Teppichen gleichzeitig. Männer mit Säcken auf der Schulter schoben sich an dem Trio vorbei. Die Stände rochen nach billiger Ware und schnellem Geld. Wie Musik aus einer anderen Welt klangen die Stimmen der Feilschenden zu ihnen herüber, übertönt von einem metallischen Klopfen.
»Was ist das für ein Lärm?« fragte Taurus.
»Geröstete Nüsse«, sagte Wusun.
»Ziemlich laut für Nüsse«, wandte Olympiodorus ein.
Doch Wusun zeigte auf seine Ohren. »Nussverkäufer schlagen ihren eigenen Rhythmus auf den Pfannen. Andere Rhythmen, andere Waren. Hört! Die Rassel dort hinten. Dort findet ihr gesalzene Gänseeier.«
Taurus legte den Kopf schief. Zunächst hörte er nur das Gewirr der Stimmen. Dann begannen seine Ohren, einzelne Laute zu unterscheiden. Eine Mutter rief nach ihrem Kind. Metall lief über einen Schleifstein. Eine Flöte spielte eine lebhafte Melodie. Der warme Wind ließ die Planen der Marktstände knattern.
Taurus blieb stehen und lauschte noch aufmerksamer auf die Klänge des Basars, erkannte die Rhythmen, die Hungrige herbeilocken sollten, das Schlagen, Trommeln und Klatschen der Händler. Und noch etwas erklang in der Ferne: das Klirren von Glas.
Dem Geräusch zu folgen war nicht einfach. Unablässig spielte die Musik, und die Nussverkäufer schlugen pausenlos auf die Pfannen. Nur ein einziges Mal noch hörte Taurus den hellen Klang von Glas, das gegen Glas stieß. Doch dank Wusuns Spürsinn, der auch in seinen Ohren zu wohnen schien, fanden sie sich wenig später vor einem Marktstand mit ungewöhnlicher Auslage wieder.
Teller, Schalen, Kümpfe – die Profanitäten des Alltags glitzerten in gläserner Pracht. Raunend drängten sich Schaulustige vor der Bude und deuteten auf die Waren. Die Welt war vor ihren Augen durchsichtig geworden. Nur die Kinder wagten sich nach vorn und versuchten, die Wunderwerke zu berühren. Doch die Frau des Glashändlers stand mit verschränkten Armen in dem Verschlag und drohte allzu Vorwitzigen mit der Sklaverei. Um ein zerbrochenes Trinkhorn aus dem kostbaren Material zu ersetzen, hätte ein gewöhnlicher Schauermann zwei Leben lang arbeiten müssen. Wieder erklang das Klirren. Seine Quelle lag hinter dem Marktstand, wo Taurus zwei Männer im Streit entdeckte. Der eine, in blau gestreiftem Gewand und mit einem Tuch auf dem Kopf, holte gerade einen Glasbecher aus einem Korb. Er schöpfte damit Wasser aus einem Eimer und schüttelte das gläserne Behältnis, das daraufhin zersprang. Eine beträchtliche Lache und ein Haufen Scherben hatten sich bereits zu Füßen der beiden Männer gebildet. Taurus, Olympiodorus und Wusun näherten sich den Streitenden.
»Betrüger!«, keifte der Mann mit dem Tuch.
Der andere zuckte mit den Schultern. »Nur weiter! Für jedes Stück, das du zerschlägst, wirst du zahlen.«
Taurus kniff die Augen zusammen. Die Stimme, die ungeschlachte Erscheinung – es war der Ruderknecht von der Poseidonia, jener Ägypter, dessen Hühnerorakel um ein Haar die Überfahrt verhindert hätte.
Taurus trat zu den Männern. »Was ist hier los?«, bellte er. »Soll ich die Hafenwache holen? Dieser Spitzbube hat erst vor drei Tagen die Gesetze gegen das Heidentum gebrochen. Die Gesetze des großen Theodosius, falls euch das ein Begriff ist. Ein Wort von mir, und er landet im Kerker.«
Der Ägypter fuhr herum. Als er Taurus erkannte, weiteten sich seine in dunklen Näpfen liegenden Augen. »Du!«, zischte er dem Byzantiner entgegen. Doch was ihm der Zorn auch auf die Zunge gelegt haben mochte, er schluckte es hinunter. »Wie gut, dass du kommst!«, sagt er stattdessen. »Ein Mann des Gesetzes. Sieh her! Dieser Händler hat bei mir Gläser in Auftrag gegeben. Ich habe sie geliefert. Jetzt zerschlägt er eins nach dem anderen, will aber nicht dafür zahlen.« Er zeigte auf den Kaufmann.
»Seid Ihr von der Garnison?«, fragte der Händler. Er musterte Taurus und seine Begleiter skeptisch. Die edle Kleidung und der byzantinische Greif schienen ihm Respekt einzuflößen.
»Nicht aus der Garnison, aus dem Kaiserpalast«, sagte Taurus. »Stimmt es, was der Götzenanbeter dir vorwirft?«
Der Händler sah ihn ungläubig an, beschrieb jedoch nun die Dinge aus seiner Sicht. Der Ägypter sei gelegentlich in der Stadt und würde im Schuppen seines Schwagers Glas blasen. Seine Fähigkeiten seien zwar beschränkt, doch bislang habe er ein Auge zugedrückt und ihm die Ware stets abgekauft.
»Ein Auge zugedrückt? Nach Strich und Faden hast du mich ausgenommen, Schakal!«, keifte der Ägypter.
Unbeeindruckt fuhr der Händler fort. Die Ware sei immer schlechter geworden, und die heutige Lieferung stelle den Tiefpunkt ihrer Geschäftsbeziehung dar. Die Becher des Ägypters seien so dünnwandig, dass sie schon barsten, wenn man nur eine halbe Kotule Wasser hineinfülle. Er bewies seine Behauptung, indem er das Phänomen erneut vorführte.
Taurus frohlockte. Die Götter waren auf seiner Seite. »Dann weißt du also, wie man Glas macht?«
»Ja«, sagte der Ägypter.
»Nein«, sagte der Händler.
»Wenn du es kannst, wirst du uns nach Serinda begleiten«, sagte Taurus. »oder ins Loch der hiesigen Kommandantur. Entscheide selbst.«
»Bei der Mumie meiner Mutter! Daraus wird nichts«, rief der Seemann.
Er wollte davonrennen, doch Taurus hielt ihn fest. Da holte der Ägypter aus und schlug seinem Gegner mit der Faust ins Gesicht. Der Kopf des Byzantiners ruckte, aber weder fiel er, noch wich er einen Schritt zurück. Noch einmal schlug der Ägypter zu. Dann lag er auf dem Boden, das Gesicht in der Pfütze. Taurus saß auf seinem Rücken und richtete sein Mandili.
»Wie heißt du, Ägypter?«
»Ur-Atum«, krächzte es vom Boden herauf.
»Ur, du wirst dabei helfen, das Römische Reich zu retten.«
Kapitel 3
Mit der aufgehenden Sonne erwachte die Seidenplantage Feng zum Leben, und der Tag brachte dasselbe wie Tausende Tage zuvor: Baumhirten maßen die Triebe der Gewächse, Gärtner karrten Dung herbei, Seidenweberinnen besserten die Gewichte ihrer Webstühle aus, und Köchinnen erhitzten die Wasserbassins. Noch vor Mittag sollten einige Hundert Seidenspinner darin ihr Leben lassen, um den Reichtum der Familie Feng zu mehren. Von den Feuern schlängelten sich Rauchfahnen in Ställe, Badehäuser und Schlafgemächer und würzten die Räume mit harzigem Duft.
Die Menschen nahmen ihre Arbeit dort wieder auf, wo sie sie bei Sonnenuntergang niedergelegt hatten. Und wie jeden Morgen schien es, als wäre der Schlaf der vergangenen Stunden nichts weiter gewesen als ein Traum. Doch an diesem Tag ging ein Riss durch das Gefüge der Gewohnheit.
»Du willst was?« Die Stimme Nong Es zerriss die Harmonie des Ankleideraums mit seiner atemberaubenden Aussicht auf die Felder. Das Bambusrohr in ihrer Faust pfiff durch die Luft und zerschmetterte das Teegeschirr auf dem lackierten Tischchen. Tee floss dampfend über das Lackbild eines Liebespaares unter Mandelblüten und verströmte seinen Jasminduft in einem einzigen Augenblick im ganzen Raum.
Guan, die alte Dienerin, hatte bislang gesenkten Hauptes in einem Winkel gehockt. Jetzt kroch sie auf allen vieren auf das Tischchen zu, um die Scherben einzusammeln. Nong E hieb ihr mit dem Stock auf den Rücken, und die Alte hielt inne.
»Wiederhole mir das!«, schnaubte Nong E an den jungen Mann gewandt, der in der Mitte des Raumes kniete. »Wiederhole mir, was du soeben gesagt hast, damit ich den Irrsinn auf der Zunge meines Sohnes erkennen kann.«
»Ich werde sie heiraten«, sagte Feng. Der vergossene Tee tränkte sein rotes Seidengewand und verbrühte seine Knie. Er zwang sich zu der Unhöflichkeit, seine Mutter direkt anzusehen. Eine Strähne ihres kunstvoll hochgesteckten Haars hatte sich gelöst und fiel ihr in das breite, erst zur Hälfte geschminkte Gesicht. Wie alt sie geworden ist seit Vaters Tod, dachte er.
»Du bist erst fünfzehn«, sagte Nong E. »Dein Geist ist der eines Kindes.«
»Aber mein Körper ist der eines Mannes. Ich bin der Erbe der Plantage, und es steht mir zu, eine Frau zu nehmen.«
»Eine Frau? Sie ist eine Streunerin. Wer weiß, womit sie ihr Geld verdient.«
»Sie ist Buddhistin. Sie verdient kein Geld, sondern lebt von den Almosen und der Wohltätigkeit ihrer Mitmenschen.«
»Eine Bettlerin also! Mein Sohn will eine Bettlerin heiraten! Verschwinde in deine Gemächer! Ich verbiete dir, dich vor Ende des Zyklus der Ratte wieder blicken zu lassen.« Wieder pfiff das Bambusrohr durch die Luft, diesmal ohne Schaden anzurichten.
Feng erhob sich und strich sein feuchtes Gewand glatt. Seine Kehle war wie ausgetrocknet. Schließlich sagte er leise: »Aber der Kaiser ist doch auch Buddhist. Er ist konvertiert. Erinnert Ihr Euch?«
»Ob ich mich erinnere? Glaubst du etwa, deine Mutter sei eine vergessliche Greisin? Einfältiger Bursche! Ich bin in einem Alter, in dem ich noch Kinder gebären könnte. Also sei vorsichtig, mein Sohn! Sonst könnte es geschehen, dass ich einen anderen Erben in die Welt setze.« Sie griff sich ins Haar und versuchte, die lose Strähne zu bändigen.
»Um ein Kind zu zeugen, braucht eine Frau einen Mann«, murmelte Feng und biss sich auf die Lippen.
»Was sagst du?«
»Damit wollte ich sagen, dass Ihr ebenso wie ich …«
Der Stock zeichnete einen Striemen auf Fengs Wange.
Er floh hinaus auf die Plantage. Aus dem Fenster gellten das Keifen seiner Mutter und die Schläge, die an seiner statt wohl die alte Guan einstecken musste. Feng fragte sich, ob der Zorn Nong Es sich nicht irgendwann wie eine Krankheit auf die Seidenraupen übertragen und die Qualität der Seide verringern würde. Zornseide, sagte er sich. Wir werden schwere Zornseide herstellen. Dabei sind wir doch für die zarteste Seide im Reich der Mitte berühmt. Seide, hatte sein Vater stets gesagt, muss so leicht sein wie der Wind, der die Reisfelder kämmt. Seine Mutter hingegen fegte wie ein Taifun über die Plantage.
Feng schlug den Weg zum Gästehaus ein. Es war das schönste Gebäude auf dem Besitz der Familie. Hier schliefen die hohen Besucher, die vom Kaiser aus Chang’an entsandt wurden, um Seide für den Sohn des Himmels zu kaufen. Angeblich hatte der Herrscher einmal persönlich in diesem Haus übernachtet, doch das musste sich vor Fengs Geburt ereignet haben. Sein Vater hatte das Gebäude seither stets gepflegt und wie einen Schatz gehütet. Und jetzt wohnte dort ein Gast, für den Feng sogar den Kaiser abgewiesen hätte.
Er fand sie im Garten, wo sie einer ihrer rätselhaften Beschäftigungen nachging. Diesmal legte sie Steine aus. Als sie Feng herannahen hörte, stand sie auf, klopfte sich den Schmutz von den Händen und verbeugte sich vor ihm. Wie immer trug sie ein weißes Gewand aus Baumwolle. Ihr schwarzes Haar war kurz geschnitten und verweigerte jede Art von Frisur. Ihre Augen waren grün. Nie zuvor hatte Feng einen Menschen mit grünen Augen gesehen.
»Helian Cui«, sagte er mit belegter Stimme und räusperte sich. »Wieso arbeitet Ihr? Ihr seid mein Gast, nicht meine Gärtnerin.«
»Gäste machen Geschenke, nicht wahr? Leider bin ich zu arm, um Euch etwas Wertvolles zu geben. Deshalb schenke ich Euch dies.« Sie deutete auf eine Rinne im Boden, die mit Kieselsteinen ausgelegt war. Sie verlief in Windungen durch den Garten und verschwand unter einem Busch. »Es ist ein Bach. Er ist noch nicht vollendet. Aber er wird fertig sein, bevor ich weiterreise. Das verspreche ich Euch.« Ihr Lächeln ließ den Ärger über seine Mutter verblassen.
»Bitte, Helian Cui, bleibt noch bei uns!« Die Worte kamen ihm schwer von den Lippen.
»Lieber Herr Feng, habt Dank für Eure Gastfreundschaft! Aber ich reise im Dienste Buddhas. Und der ist so schwer zufriedenzustellen.« Sie seufzte theatralisch. Dann fasste sie ihn bei der Hand und zog ihn mit sich, tiefer in den Garten hinein. »Wollt Ihr das Geschenk denn gar nicht sehen?«, fragte sie.
Feng war sprachlos, als er entdeckte, dass der Bachlauf den ganzen Garten durchzog. Dabei war Helian doch erst seit fünf Tagen hier – fünf Tage und vier Nächte, in denen er keine Ruhe gefunden hatte.
Sie führte ihn zu einem der Bäume, die nachts anders dufteten als tagsüber – ein Geheimnis der Gartenkunst seines Vaters. Unter einer moosbehangenen Baumwurzel entsprang der seltsame Bach.
»Aber er führt kein Wasser«, sagte Feng.
»Seid Ihr sicher?« Helian Cui setzte sich ins Gras und schlug die Beine in einer Art übereinander, die Feng schon beim Zusehen Schmerzen bereitete.
Er ging in die Knie und ergriff ihre Hände. Sie ließ es zu. Er begann zu schwitzen. Warum hatte sie ihn an diesen verborgenen Ort geführt?
Helian schloss die Augen. »Senkt Eure Lider, junger Herr Feng.«
Bereitwillig gehorchte er.
Dann sagte sie: »Dies lehrt uns Buddha in seiner endlosen Weisheit: Leben ist Leiden. Unser Leiden entsteht durch unsere Wünsche. Erst das Ende der Wünsche bedeutet das Ende des Leidens. Haltet Eure Augen geschlossen, ich bin noch nicht fertig.«
Feng presste die Lider fester auf die Augen.
»Was wir uns wünschen, ist unbedeutend. Alles, was wir brauchen, lebt bereits in uns. So wie dieser Bach. Ihr meint, er führe kein Wasser. Aber das stimmt nicht. Vertraut nicht auf das, was Ihr zu sehen meint. Öffnet Eure Ohren und Euren Geist, und hört, wie das Wasser fließt.« Feng wusste nicht, wie man die Ohren öffnete. Sie standen doch die ganze Zeit über offen. War das bei Frauen etwa anders? Er kniff die Augen noch angestrengter zusammen, um besser hören zu können. Seine Stirn legte sich in Falten.
»Ja, ich kann es deutlich hören«, log er.
Dann spürte er Helians Finger, die über seine Stirn strichen. »Das ist keine Prüfung, Feng. Ihr müsst weder der Beste noch der Schnellste sein. Verfolgt keinen Zweck, entledigt Euch aller Absicht, und legt die Geräusche der Welt auf dem Grunde Eures Gehörs ab.«
Er blinzelte. Drei Fingerbreit vor seinem Gesicht schwebten ihre grünen Augen. Sein Herz bellte. Langsam streckte er eine Hand nach ihrem Gesicht aus.
Sie erhob sich. »Vielleicht ist es noch zu früh. Aber der Bach wird bleiben, und Ihr könnt noch lernen, ihm zuzuhören, wenn ich fort bin.«
Noch zu früh? Was meinte sie damit?
»Ich bin der Erbe dieser Plantage«, stieß er hervor. »Bleibt bei mir! Dann müsst Ihr nie wieder betteln gehen.«
Sie lachte. »Aber junger Herr Feng! Habe ich nicht gesagt, Ihr sollt lernen zuzuhören? Habe ich Euch denn nicht gerade erzählt, dass ich im Dienste Buddhas unterwegs bin? Ich fürchte, Eure Mutter muss Euch die Ohren waschen.«
Die Hitze, die ihn durchströmte, fühlte sich mit einem Mal unangenehm an. »Meine Mutter?« Fengs Stimme zitterte wie ein gefangener Vogel. »Meiner Mutter muss ich nicht länger gehorchen.«
Mit glühenden Wangen sprang er auf, trat dabei versehentlich in den Bach und wäre beinahe gestürzt. »Wartet hier! Ich will Euch auch etwas schenken«, rief er und eilte über einen der überdachten Fußwege des Gartens auf das Badehaus zu.
Als er sich noch einmal umblickte, sah er, wie Helian sich zum Bach hinabbeugte und die Kieselsteine berührte. So verharrte sie einen Augenblick. Dann streifte sie mit den Fingern ihre Wangen und ihre Stirn.
Als Feng zurückkehrte, rollte Helian Cui gerade ihre Decken im Gästehaus zusammen. Das Tragegestell war gepackt. Ein Stock mit einem Glöckchen ragte über die Kiepe, um jeden Schritt der Trägerin mit einem hellen Ton zu begleiten. Auf dem Boden lagen zwei Wanderstecken aus Bambus, so gelb wie die Sonne. Die einzig verbliebene Spur von Helians Besuch war ein kleiner Buddhaschrein. Auf einem gelben Stück Stoff saß eine Messingstatuette des Weisen, umrahmt von sieben Opferschalen. In diesen erkannte Feng Flüssigkeiten, Blumen und kleine Glocken. Die Reste verbrannten Weihrauchs lagen auf einem Reisbett.
»Für Euch!«, sagte Feng und hielt ihr eine Halskette entgegen.
Sie nahm den Schmuck und betrachtete die Tierfiguren aus Jadestein, die daran hingen. Ihre Finger glitten über die gravierten Nasen und Ohren, Krallen und Schwänze. Warum sagte sie nichts?
»Der Stein hat die Farbe Eurer Augen«, erklärte er unnötigerweise.
»Oh nein! Meine Augen sind stumpfe Kugeln gegen diese meisterliche Arbeit. Die Kette ist so wunderschön, dass nur eine Königin sie tragen kann.« Sie gab ihm den Schmuck zurück. »Aber keinesfalls eine Bettlerin, wie ich es bin. Woher habt Ihr sie?« Sie hielt einen Augenblick inne. »Ihr tragt doch nicht etwa Frauenschmuck, junger Herr Feng?«
Er errötete. »Natürlich nicht. Die Kette gehörte meiner Mutter. Aber nun soll sie Euer sein. Seht Ihr jetzt, dass ich Herr über die Plantage bin?«
Sie trat einen Schritt zurück. »Feng, Ihr bringt mich in Gefahr. Geht und legt diese Kostbarkeit dorthin zurück, woher Ihr sie genommen habt.«
Feng schaute auf die Halskette in seinen Händen. Leblos hingen die Jadetiere an dem Seidenfaden – Abbilder seiner unerfüllten Liebe. Tränen traten ihm in die Augen. »Warum könnt Ihr denn nicht hierbleiben?«
»Wisst Ihr von den großen Schriften des Konfuzius, Feng?«
Er nickte.
»Ohne diese Schriften wäre der Konfuzianismus undenkbar, oder?«
Wieder nickte er geistesabwesend. Seine Nase füllte sich mit Flüssigkeit.
»Gleiches gilt für meine Religion. Der Buddhismus ist neu in diesem Teil der Welt, und viele Schriften Buddhas und seiner Nachfolger liegen in Klöstern und Höhlen verborgen. Es ist meine Bestimmung, diese Texte zu suchen.«
»Und wenn Ihr sie gefunden habt?«
»Sobald ich weiß, wo die Asanga-Texte aufbewahrt werden, muss ich zu jenem Ort wandern, sie kopieren und dem Kaiser persönlich die Abschrift zu Füßen legen.«
Eine Vision erschien vor seinen Augen. »Nehmt mich mit! Ich werde Buddhist und begleite Euch. Als wanderndes Paar würden wir Buddha dienen.« Er deutete vage auf die Figur des gut genährten Mannes.
Buddha lächelte. Doch Helian Cui sah Feng ernst an. »Ihr meint, was Ihr sagt. Das weiß ich. Doch der Weg zu Buddha ist kein Spaziergang für Verliebte, Feng. Und Euer Schicksal ist mit der Seide verwoben. Seid Ihr nicht der einzige Erbe Eures Vaters? Wenn Ihr nicht hierbleibt und lernt, die Plantage zu führen, wird sie untergehen. Was soll dann aus den Arbeitern werden, die von der Seide leben, aus ihren Familien, aus Eurer Mutter und den anderen Witwen Eures Vaters? Wenn Ihr wirklich in Armut leben wollt, so seid ein Bettler der Liebe und bittet Eure Nächsten um Almosen.«
Feng presste die Lippen aufeinander. Sie hatte recht. Aber diese Erkenntnis half nicht gegen die Schlaflosigkeit und die Erschöpfung, gegen die Krämpfe im Bauch und die Schmerzen im Kiefer, die von seinen mahlenden Zähnen herrührten.
Helian hob den Buddha von seinem improvisierten Altar und hielt Feng die Statuette entgegen. »Behaltet ihn! Er wird Euch an das erinnern, was ich gesagt habe, und Euch Trost spenden, wenn Ihr ihn nötig habt. An guten Tagen kann er Euch sogar zum Lachen bringen.« Sie lächelte die Figur mit einer solchen Hingabe an, dass Feng sich wünschte, ein Erleuchteter aus Messing zu sein.
Er nahm das Geschenk entgegen. Die Figur wog schwer in seinen Händen. Wie konnte diese zierliche Frau ein solches Gewicht auf dem Rücken tragen?
Helian leerte die Schalen, wischte sie mit einem Tuch aus und stellte sie aufeinander. Als sie die letzten Reste ihres spärlichen Besitztums verstaut hatte, hob sie das Gepäck an, geriet ins Taumeln und ließ es wieder sinken.
Feng war sofort zur Stelle. Er hob die Kiepe auf die Höhe ihrer Schultern. Sie angelte nach den schwarz gescheuerten Lederriemen und schob sie sich über die Arme. Während sie den Sitz prüfte, inspizierte Feng die Beutel und Fächer. Sie waren fadenscheinig und mit so vielen Flicken versehen, dass das Gestell seine Trägerin in einen bunten Vogel verwandelte. Ein Einfall zwickte ihn.
Noch eine Weile nestelte Helian Cui an Gurten und Gestängen, dann griff sie nach den beiden Wanderstöcken aus Bambus. Die Kiepe ragte über ihren Kopf hinaus. Sie klappte eine Art Segel aus, das die Trägerin wie ein Dach beschirmte. Schließlich schlug sie gegen das Glöckchen.
Der Moment des Abschieds war gekommen.
Feng rang mit sich. Er wollte sie in seine Arme reißen und ihr Gesicht mit seinen Lippen berühren. Doch er stand nur da und umklammerte den Buddha.
»Lernt zuzuhören, junger Herr Feng.« Sie kniff ihn in den Arm und zwinkerte. »Und hinzuschauen solltet Ihr auch üben.« Dann ging sie hinaus und verschwand. Zurück blieb nur der herbe Geruch des Weihrauchs.
Er blickte ihr noch lange nach. Wohin sollte er auch sonst schauen? Seine Finger fuhren über die Statue und ertasteten etwas an ihrer Rückseite. Neugierig drehte er das Geschenk herum. In das Messing waren Schriftzeichen graviert. Feng hielt sie ins Licht. Auf Buddhas Kehrseite entzifferte er die Worte: Die Liebe ist ein scheuer Vogel, der den Schlüssel deines Gefängnisses um seinen Hals trägt.
Feng schmunzelte. Diesen Vogel würde er zu fangen wissen.
*
Als sie die Halskette fand, hatte Helian Cui bereits den Rand der Wüste erreicht. Es geschah in den Stunden ohne Gefälle, wenn der Tag nicht mehr jung und noch nicht alt ist. Die Plantage lag schon längst außer Sichtweite, da strauchelte sie, und das Gewicht der Kiepe verschob sich. Sie stürzte, doch der Sand einer Düne fing sie auf. Gewiss hatte Buddha dafür gesorgt, dass sie nicht auf einen Felsen fiel.
Als sie das Gepäck neu ordnete, um das Gewicht besser zu verteilen, hielt sie plötzlich die Kette mit den Jadetieren in Händen. Nun war sie sich sicher, dass Buddha seine Finger im Spiel hatte. Nicht nur, weil er ihren Sturz gedämpft hatte. Er musste es überdies gewesen sein, der sie überhaupt zu Fall gebracht hatte. Dieser Schelm! Doch die Angelegenheit, auf die der Weise sie hatte aufmerksam machen wollen, war alles andere als erheiternd.
Feng hatte ihr die Halskette ins Gepäck gesteckt. Seine Absicht war klar: Sie sollte nach ihrer Reise zu ihm zurückkehren, um ihm das Kuckucksei zurückzugeben, und dann bei ihm bleiben. Wie gerissen er mit seinen fünfzehn Jahren war! Und doch dachte er wie ein Kind.
Ja, sie wollte ihm den Schmuck zurückbringen. Aber nicht erst in einigen Monaten, während derer sich Feng das Herz zermartern würde, sondern gleich heute. Dazu war es noch nicht zu spät. Mit etwas Eile würde sie den Weg zur Plantage zurücklegen und sich noch vor Sonnenuntergang wieder von ihr entfernen können. Um nichts in der Welt wollte sie eine weitere Nacht im Gästehaus verbringen. Wer ahnte schon, welche Fangeisen Feng aufstellen würde, wenn er sie wieder in seiner Reichweite wähnte? Nein! Sollte der junge Seidenfabrikant doch an seinem eigenen Vogelleim kleben bleiben.
Die Kiepe geschultert, machte sich Helian auf den Weg zurück zur Plantage. Im Abendlicht erreichte sie die Oase, in der Fengs Plantage lag. Die Torwachen staunten zwar über die Rückkehr der Besucherin. Da sie Helian Cui kannten, ließen sie sie jedoch ohne Weiteres passieren. Die Hände unter die Trageriemen geschoben, marschierte sie an Gärtnern und Webern, Köchen und Trägern vorbei. Das Tuscheln der Arbeiter war kaum lauter als das Rascheln der Maulbeerbäume bei Regen.
Wo war Feng?
Ein Kind, das einen Wassereimer trug, wies ihr den Weg zum Haupthaus, eine mit Steinen gepflasterte Straße, die von mehr Füßen blank gelaufen war, als Helian in ihrem Leben hätte zählen können. Wenn ich so etwas jemals vorhaben sollte, dachte sie und fragte sich, welche Prüfungen Buddha ihr noch auferlegen mochte.
Sie hatte das Haupthaus fast erreicht, als ihr Nong E entgegenkam. Helian hielt inne. Sie wollte Fengs Mutter nicht begegnen. Nicht mit dem Diebesgut im Gepäck – und ohne auch nicht. Doch es war bereits zu spät. Die Herrin des Haushalts schritt in Begleitung dreier Frauen den Hauptweg entlang, direkt auf Helian Cui zu. In der tiefstehenden Sonne warfen die Gestalten lange Schatten.
Helian Cui stellte die Kiepe ab und verneigte sich tief vor der Hausherrin.
Nong E blieb stehen. »Willkommen zurück auf meinem Besitz«, sagte sie und verbeugte sich ebenfalls, jedoch nur so weit, wie es ihr höherer Stand erforderte. »Oder wart Ihr noch gar nicht fort, Xiao Helian?«
Die Anrede »junge Helian« stellte eine Beleidigung im Rahmen der Anstandsregeln dar. Doch Helian beschloss, sich über den Beinamen zu freuen. Immerhin zählte sie schon mehr als dreißig Jahre.
»Ihr seid scharfsichtig, Lao Nong«, sagte sie und betonte die Anrede Lao für »alt« bewusst so, als zolle sie der Älteren damit nur Respekt.
»Und was ist meinem Scharfblick dann entgangen? Denn wenn ich richtig sehe, seid Ihr hier, obwohl Ihr fort seid.«
Hinter Nong E kicherten ihre drei Begleiterinnen. Nong E hob eine Hand, und sie verstummten.
»Mein junger Verstand ist noch ungeübt. Er hat vergessen, dass ich Meister Feng zum Abschied einen Strauß grüner Pappelzweige schenken wollte. Das bringt Glück. Deshalb suche ich ihn. Könnt Ihr mir sagen, wo ich ihn finde?«
»Mein Sohn ist mal hier, mal da.« Nong E schielte auf die Zweige, die tatsächlich an den Bändern der Kiepe befestigt waren. »Gebt mir das Gesträuch, ich werde es Feng in Eurem Namen bringen. Das Glück wird ihn trotzdem finden.«
»Oh, das wäre so gütig von Euch, Lao Nong. Aber ich gebe ihm die Zweige lieber selbst. Sie sind harzig und würden Eure Hände beschmutzen. Und das Glück soll doch besser an den Händen des jungen Herrn Feng kleben.«