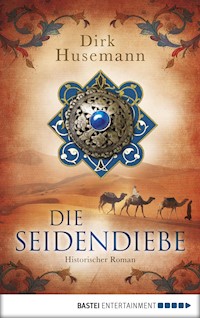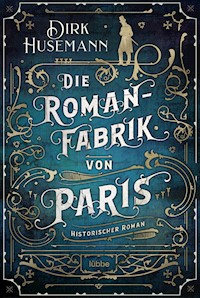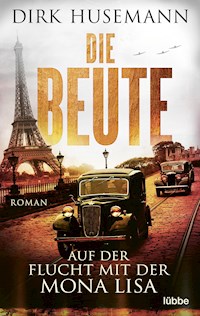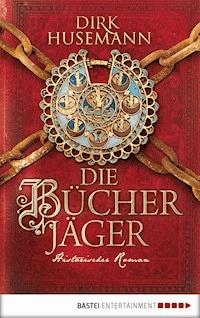9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wir schreiben das Jahr 802. Franken und Sarazenen kämpfen unerbittlich um die politische und religiöse Vormachtstellung. In dieser angespannten Lage schickt der Kalif von Bagdad seinem Widersacher Karl dem Großen ein gewaltiges Geschenk als Zeichen des Friedens: einen Elefanten. Der Jude Isaak und sein sächsischer Sklave Thankmar sollen das Tier unversehrt nach Aachen bringen. Eine heikle Mission, denn die Menschen, denen sie auf ihrem langen Weg durch das Frankenreich begegnen, halten den Elefanten für eine Ausgeburt der Hölle. Sein Tod aber würde die Großreiche der Franken und der Sarazenen in einen schrecklichen Krieg stürzen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Prolog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Nachwort
Danksagung
Dirk Husemann
EIN ELEFANT FÜR KARL DEN GROSSEN
Historischer Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln Lektorat: Lena Schäfer Kartenillustration: © Markus Weber, Guter Punkt München | Thinkstock Titelillustration: © shutterstock/llaszlo; © Design for the Elephant Fountain at the Place de la Bastille, 1813–14 (coloured engraving), Alavoine, Jean Antoine (1776–1834)/Musee de la Ville de Paris, Musee Carnavalet, Paris, France/Giraudon/Bridgeman Images; © Plant Study with Butterflies and Insects, ca. 1800 (gouache on paper), Chinese School, (19th century)/Fitzwilliam Museum, University of Cambridge, UK/Bridgeman Images; © shutterstock/wacomka Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau E-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-0686-6
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
PROLOG
772 n.Chr.
Durch das Gefieder der Krähe trieb Rauch. Blinzelnd reckte der Vogel den Kopf und spähte über die Trümmer der Gebäude, die mit Pfeilen und Speeren gespickten Hütten und die aufgeschichteten Leichname. Als das Tier sicher war, dass keinerlei Gefahr drohte, wandte es sich wieder dem Säugling zu, auf dem es soeben gelandet war. Das Kind lebte noch. Es war in eine Decke gewickelt. Nur das Gesicht schaute heraus. Unbeeindruckt von den Schreien des Bündels pickte die Krähe in seine Wangen und legte den Kopf schief, um zu prüfen, ob die Beute tatsächlich so hilflos war, wie es den Anschein hatte. Die aufgerissenen Augen des Kindes glänzten feucht und versprachen, Leckerbissen zu werden.
Ein Pfeil durchbohrte die Krähe, deren letzter Flug an einem Getreidefass endete. Eine junge Frau mit rotem Haar und einem Bogen in der Hand rannte über das Trümmerfeld, beugte sich über den Säugling, untersuchte ihn und hob ihn hoch. Bevor sie wieder verschwand, löste sie den Kadaver des Vogels von den Fassdauben. Dann zog sie sich, Kind und Krähe in den Armen, in ein lang gestrecktes Gebäude zurück, das zwischen den Überresten der Hütten lag.
Immas Augen gewöhnten sich rasch an das Zwielicht in der Halle. In den Schatten zwischen den Talglichtern erkannte sie die Männer und Frauen ihres Stammes, die an den Wänden lehnten und sich flüsternd unterhielten. Glaubten sie etwa, der Feind vor den Toren könne ihre Worte hier drinnen verstehen? Andere schliefen auf dem blanken Boden. Unter ihnen waren Flüchtlinge aus anderen sächsischen Dörfern, die vor dem Angriff der Franken auf die Aeresburg geflüchtet waren. Wenn die Prophezeiung des alten Drogo eintreten sollte, hatten sie ihr Schicksal nur hinausgezögert. Niemand, so hatte der Seher vor drei Tagen verkündet, sollte diese Belagerung unbeschadet überstehen.
Ein Strahl Tageslicht fiel durch den Rauchabzug in der Mitte der Halle. In Licht gebadet stand Osnag vor den Ältesten und hielt eine seiner Reden. Osnag, dachte Imma, hat uns diesen Krieg gebracht. Der Sachsenherzog hatte sich selbst den Beinamen Widukind – das Kind des Waldes – gegeben, einen Titel, den in der langen Geschichte der Stämme nur wenige hatten tragen dürfen. Solange die Priester zurückdenken konnten – und ihre Überlieferungen reichten bis in die Zeit, in der der heilige Baum gepflanzt worden war –, hatte sich kein Mensch selbst diesen Namen verliehen. Osnag aber hatte es gewagt. Ebenso wie er es gewagt hatte, die Stämme gegen die Franken aufzuwiegeln. Und jetzt waren die Dörfer verwüstet, die Brüder und Schwestern tot oder versklavt, und die letzten der einst so stolzen Sachsen kauerten sich in dieser Feste zusammen und warteten auf das Ende. Osnag jedoch stellte sich noch immer in das beste Licht und predigte Krieg, als sei nichts geschehen.
Imma ging auf die Gruppe der Ältesten zu, stellte sich vor Osnag und drückte ihm das Kind an die Brust. Verdutzt griff der Fürst nach dem Bündel.
»Kümmere dich darum, Osnag. Vielleicht gelingt es dir ja einmal, einen von uns zu retten.« Mit diesen Worten ließ sie den Herzog und die Ältesten stehen. Das Schweigen in ihrem Rücken sprach Bände.
Sie verließ die Halle durch eine Klappe an der Seite, die zum Hereintreiben des Viehs diente. Doch Schweine und Ziegen hatten diesen Weg schon seit Wochen nicht mehr genommen. Die Vorräte waren aufgebraucht, und der Hunger hatte sich in die Belagerten hineingefressen. Bevor die Franken vor der Aeresburg aufgetaucht waren, hatte Imma ihr Wollkleid ausgefüllt, sodass der Stoff an den Hüften gerieben hatte. Jetzt wehte dasselbe Gewand um ihren Körper wie ein Lumpen um einen Vogelschreck.
Die Irminsul, der heilige Baum, ragte im Glanz des sächsischen Sommers in den Himmel. Der riesige Stamm und die ausladenden Äste versetzten Imma stets in Staunen. Manchmal kniete sie halbe Tage lang vor der Eiche, in Ehrfurcht erstarrt vor der Kraft der Götter. Heute aber empfand sie kein Verlangen danach, Irmin zu huldigen. Ihr Sehnen war weltlicher Natur. Hinter dem gewaltigen Stamm der Irminsul stand ein Grubenhaus, ein Dach, das über eine Vertiefung im Boden gezimmert war. In der Kühle des Erdreichs pflegte Drogo die Opfergaben für Irmin frisch zu halten, Äpfel aus dem heiligen Hain und die Lendenstücke der geweihten Schafe und Ziegen. Jetzt aber diente das Grubenhaus einem anderen Zweck.
Sie grüßte die beiden Krieger, die vor dem Dach postiert waren, und wollte im Dunkel der Hütte verschwinden. Aber Radbert packte sie am Arm und hielt sie auf.
»Imma! Ich kann dir nicht schon wieder erlauben, zu den Geiseln hinabzusteigen. Wenn die Ältesten davon erfahren, wird uns Widukind an den Baum schlagen lassen.«
»Hast du den Gefangenen denn Speise gebracht?«, fragte sie und fühlte, wie ihr das Blut in den Kopf stieg. »Willst du vielleicht, dass sie verhungern? Was glaubst du, was Widukind mit dir anstellt, wenn du unser einziges Pfand gegen Carolus Magnus in einem Loch verenden lässt?«
Radberts Griff lockerte sich. »Du weißt so gut wie ich, dass es nichts mehr zu essen gibt. Sollen wir selbst verhungern, damit die Franken leben?«
Imma hielt dem Wachposten die Krähe vors Gesicht. »Dein letzter Vorrat Dörrobst wird nicht angetastet, Radbert, sei unbesorgt. Ich habe mich selbst darum gekümmert.«
Sie sah die Gier in Radberts Augen, als er die Krähe erblickte. Noch einen Moment hielt er Imma am Arm fest, dann ließ er sie los.
»Also gut, bei Saxnoth! Aber beeile dich. Wenn der nächste Angriff kommt, wirst du bei den Palisaden gebraucht.«
Imma huschte ins Innere des Grubenhauses. Eine Klappe war in die Holzplanken des Bodens eingelassen, gesichert mit einer Lanze, die durch zwei Schlaufen aus Hanfseil geschoben war. Imma zog die Waffe heraus, warf sie achtlos zur Seite und hob die Luke an. Darunter herrschte Finsternis. In einem Fass sollte man Radbert ertränken, dachte sie, hatte dieser Tölpel doch schon wieder vergessen, die Talglichter zu erneuern. Sie suchte im Grubenhaus nach einer Lampe, entzündete sie und stieg hinab in die Tiefe.
Das Erdreich empfing sie mit Kälte. Ein Labyrinth aus Gängen war in den steinigen Boden getrieben, gerade so, als habe ein riesiger Maulwurf hier unten seine Heimat. Kein Fremder fand jemals aus diesem Labyrinth heraus. Es war das perfekte Gefängnis.
Gespensterarmen gleich ragten die Wurzeln der Irminsul aus der Erde heraus. Imma orientierte sich an ihnen, sie kannte den heiligen Baum wie keine andere. Nur die Priester waren noch vertrauter mit dem Koloss, der seit Menschengedenken auf der Aeresburg wuchs und wuchs, Wahrzeichen der Sachsen und zugleich jener Ort, an dem die Götter an Festtagen auf die Erde herabstiegen. Kein Wunder, dass die Franken den Baum fällen wollten. Damit wäre der Untergang des alten Glaubens besiegelt. Ebenso wie der Triumph des Christentums, jener neuen Religion, die Imma auf eine unheimliche Art faszinierte.
»Isaak!«, rief sie in die Dunkelheit hinein, während sie durch die verwinkelten Gänge huschte. »Isaak!«
Die Stille, die Imma entgegenschlug, beunruhigte sie. War Isaak etwas geschehen? Unmöglich. Niemand würde sich in dieser Situation an einer Fürstengeisel vergreifen.
Sie sah den Lichtschimmer erst, als sie schon vor der Nische stand. Isaak hockte auf dem Boden, seinen roten Umhang zu einem Lager ausgebreitet, und hatte den Kopf über etwas Glitzerndes gesenkt. Hatte er sie denn gar nicht gehört?
»Isaak«, sagte Imma noch einmal, und sie wäre nicht verwundert gewesen, hätte er von seiner Beschäftigung nicht aufgesehen.
Aber Isaak hob den Kopf. Trotz der spärlichen Beleuchtung konnte sie jeden Zug seines Gesichts ausmachen. Die dunklen Haare fielen ihm bis über die Schultern hinab, sie waren das Zeichen des fränkischen Adels. Die Haltung war selbst nach Wochen in diesem Loch noch herrschaftlich. Seine Hände stark und sanft. Seine Augen leuchtend grün.
Imma sog die modrige Luft ein. »Woher hast du das Licht?« fragte sie.
»Zunderschwamm, Harz und Holz. Von allem findet man hier unten genug. Was es nicht gibt«, er zeigte auf einen mit Silberbeschlägen verzierten Beutel an seinem Gürtel, »hat der praktische Mensch selbst in der Tasche.«
Imma verkniff sich ein Schmunzeln und stellte das Talglicht auf den Boden. »Hier ist helleres Licht.«
»Seit du hier bist, ist es heller.«
Sie sah sich verlegen in der Dunkelheit um. In anderen, weit entfernten Nischen dieses Labyrinths hockten drei weitere Männer und warteten darauf, dass Carolus Magnus sie aus den Fängen der Sachsen auslösen möge. Imma hoffte, der Tag werde so rasch nicht kommen.
Sie zeigte ihm die Krähe. »Es ist nicht viel. Aber es wird helfen. Osnag wird die Rückkehr des Unterhändlers abwarten, bevor er entscheidet, ob ihr hier unten weiter durchgefüttert werden sollt oder …« Der Satz verdarb ihr auf der Zunge.
»Oder ob wir an die Irminsul genagelt werden? In dem Fall soll mir deine Krähe eine Henkersmahlzeit sein. Doch das muss warten. Schau, auch ich habe einen Vogel für dich gefangen.«
Er stand auf und hielt ihr etwas Glitzerndes entgegen. Imma hob das Licht, um besser sehen zu können. In Isaaks rechter Hand lag ein Amulett, das aus zahlreichen Edelsteinen zusammengesetzt war. Die tiefrote Farbe der Steine begann unter der Talglampe zu strahlen. Das Amulett hatte die Form eines Vogels, eines Raubvogels, wie Imma erkannte. Nie zuvor hatte sie dergleichen gesehen.
Mit einem Finger der Linken berührte der Franke das Schmuckstück und teilte es. Zauberei?
Imma verstand. Isaak hatte das Geschmeide präpariert. Zwei halbe Vögel lagen nun in seiner Handfläche, jeder hatte einen Flügel. Isaak nickte ihr zu, und sie nahm eine Hälfte.
»Er ist nicht so nahrhaft wie dein Geschenk. Dafür aber von Dauer.« Der Franke schloss die Hand fest um das verbliebene Stück.
Imma löste das Lederband, das ihr Haar in Zaum gehalten hatte, und wollte es um den Schmuck wickeln. Aber Isaak gebot ihr Einhalt.
»Dieser Schmuck ist sehr alt. Die Merowinger haben ihn getragen. Jemand deines Stammes könnte erkennen, dass du ein Zeichen des Feindes trägst. Halte ihn verborgen. Fürs Erste.«
»Für wie lange, Isaak?«
Er küsste sie.
Imma steckte das Amulett in eine Tasche ihres Gewandes. »Ich werde dich befreien. Noch heute Nacht. Ich führe dich aus dem Labyrinth, es gibt einen geheimen Weg fort von der Burg. Niemand kennt ihn, nur die Priester und die Sängerinnen.«
»Nein, Imma. Ich bin aus einem gewichtigen Grund hier. Nur gegen mein Leben als Pfand hat sich euer Unterhändler in das Lager meines Königs begeben. Die Verhandlungen dort könnten diesen Krieg friedlich enden lassen. Dann könntest du gehen, wohin du willst.«
»Ich bin bereits dort, wo ich sein will.« Sie löste die Fibeln, die ihr Kleid an den Schultern gehalten hatten. »Und wenn du nicht fliehen willst, so weiß ich einen anderen Weg. Du sollst für immer in diesem Abgrund schmoren, denn dann musst du bei mir bleiben. Solange ich es will.«
»In einem klammen Erdloch in ewiger Finsternis mit toten Krähen zum Mahl?« Er lachte. »Fürwahr, auch ich bin dort, wo ich sein will.«
Dann löschte er das Licht.
Der Unterhändler der Sachsen kehrte zwei Tage später von den Verhandlungen mit den Franken zurück. Sein Kopf steckte auf einer Lanze, die des Nachts vor dem Osttor der Aeresburg aufgestellt worden war. Auf Wangen und Stirn des Sachsen hatten seine Henker das Zeichen der Christen gemalt.
Osnag tobte. In der großen Halle schwang der Sachsenfürst weitere Reden, denen die Ältesten Beifall zollten, indem sie mit den Schwertern gegen ihre Schilde schlugen. Warum die Verhandlungen mit dem Frankenkönig gescheitert waren, wusste niemand. Gewiss hingegen war, dass von nun an nur noch die Waffen sprechen würden.
Imma trat bei Sonnenuntergang auf Osnag zu, als der Fürst sein Streitross inspizierte. Die Belagerten rechneten damit, dass die Franken beim nächsten Angriff alle Kräfte mobilisieren und die Palisaden stürmen würden.
»Osnag«, sagte Imma. Der Sachsenfürst beachtete sie nicht.
»Widukind«, versuchte sie es erneut. Kurz schaute der so Angesprochene in ihre Richtung.
»Was willst du? Mich erneut zurechtweisen? Dieses Mal hört dir kein Publikum zu. Spare dir deinen Atem.«
Imma knetete das Zaumzeug des Rappen. Trense und Zügelringe waren aus Eisen und trugen feine Ziselierungen. »Was geschieht nun mit den Geiseln?«
»Sie sterben heute Nacht. Die Franken werden erst bei Sonnenaufgang angreifen. Bis dahin haben wir Zeit, die Gefangenen Irmin zu opfern. Dafür wird er uns Glück im Kampf gewähren.«
»Wenn du die Gefangenen am Leben lässt, werden es die Franken vielleicht nicht wagen, uns anzugreifen.«
»Sie bekommen ihre Männer so lebendig zurück wie wir den unseren. Drogo wird dafür sorgen, dass ihre Schreie noch im Lager des Feindes zu hören sein werden.« Er runzelte die Stirn. »Was kümmert dich das Schicksal der Gefangenen?«
Imma nestelte an dem Amulett, das sie unter ihrem Gewand verborgen hielt. Als sie Osnag antwortete, zitterte ihre Stimme. »Ihr Schicksal ist mir einerlei. Wenn aber heute Nacht Irmin angerufen werden soll, muss ich mich rechtzeitig vorbereiten. Ich bin die erste Sängerin, und es ist meine Stimme, die den Gott aus dem Schlaf erwecken soll. Das weißt du doch, oder nicht?«
Osnag nickte. »Natürlich weiß ich es. So geh und bereite dich vor, auch ich muss mich rüsten.«
Imma entfernte sich. Als sie sicher war, dass der Fürst sie nicht länger sehen konnte, lief sie so schnell, wie ihr die Tränen die Wange hinabrannen, zum Grubenhaus hinüber.
Die Gefangenen waren fort. Nicht einmal mehr Radbert stand vor dem Grubenhaus Wache. Es war nicht notwendig, noch einmal in die Tiefe hinabzusteigen. Drogo hatte die Geiseln holen lassen und bereitete sie auf die Zeremonie vor.
Imma rang verzweifelt die Hände. Wie sollte sie vor die Irminsul treten, im Kreise aller Stammesmitglieder, und singen, während Isaak vor ihren Augen an den Baum geschlagen wurde? Wie sollte sie überhaupt jemals wieder dem Gott der Sachsen Ehrfurcht zollen? Wenn er Isaak tötete, hatte sie dann nicht das Recht, sich von Irmin abzuwenden und sich einem neuen Gott zu öffnen?
Ein Gedanke blühte in ihr auf. Im Schutz der Bäume huschte sie durch den heiligen Hain bis zum Ende der Festung. Hier waren die Palisaden unbewacht. Aus gutem Grund: Angreifer hätten die steilen Felsen hinaufklettern müssen und wären leichte Beute gewesen für hinabgeworfene Baumstämme und brennendes Birkenpech. Aus den Felsen entsprang im Frühjahr eine Quelle, ein Ereignis, das die Sachsen mit einem Festtag feierten. Auch im Sommer schoss gelegentlich Wasser hervor. Dank dieses Wunders konnte die Aeresburg Belagerungen viele Monde lang standhalten. Das Phänomen musste so alt sein wie die Welt, denn das Wasser hatte Zeit gehabt, einen Tunnel in das Gestein zu waschen. Einen Tunnel, den kaum jemand kannte, schon gar nicht die Franken. Aber das sollte sich ändern.
Imma kniete sich zwischen die Holundersträucher und fand den Stapel Totholz, der über dem Eingang des Tunnels aufgeschichtet war. Dann begann sie, die Äste und Stämme beiseitezuräumen. Drogo, dachte Imma, wird mit seiner Prophezeiung recht behalten: Kein Sachse würde die Belagerung unbeschadet überstehen.
1.
802 n.Chr.
In der Nacht spuckte die Alte wieder Blut. Er konnte es im Mondlicht sehen, das durch die Ritzen des Verschlags fiel. Dazu ihr Keuchen, ihr Geifern. Manchmal, wenn die Krämpfe sie weckten, verfluchte sie sogar den Tod.
Thankmar hielt es nicht länger neben Rosvith aus. Er löste sich aus ihrer ledrigen Umarmung und schob sich fort von ihr, leise, damit sie es nicht bemerkte. Aber das Zedernholz der Barackenwand hielt ihn auf. Er presste eine Wange an die Wand und lauschte dem Schnarchen der anderen Sklaven, dem Rascheln ihrer Lumpen und Klirren ihrer Ketten. Manch einer stöhnte, wenn ihn ein Alb drückte. Ein Greis sprach im Schlaf.
Sie waren um die fünfzig. Seit drei Wochen lagerten sie im Hafenviertel Genuas, dem berüchtigtsten Sklavenmarkt im Fränkischen Reich. An Orten wie diesem kaufte man keine Seide aus Byzanz oder Baumwolle aus Syrien. Niemand pries Glaswaren aus Tyrus, Sandelholz aus Ägypten oder Zuckerhüte aus Tripolis an. Hier roch es nach Schweiß und Schmutz, nach Fäkalien und Verzweiflung. Vor den Verschlägen harrten die Gefangenen zu Dutzenden einem Schicksal, das sie in den Glutofen Arabiens führen sollte. Dort lechzten die Abbasiden nach den hellhäutigen Sklaven aus dem Norden und wogen sie mit klingenden Dirhams auf.
In einem fernen Leben mochten die Sklaven furchtbare Schwertschwinger oder gutmütige Priester, Handwerker oder Kaufleute, Schweinehirten oder die Herren fruchtbarer Ländereien gewesen sein. In den Halseisen der Sklaverei waren sie nur noch Heiden, Ungetaufte, die den Glauben an den Gekreuzigten ablehnten. Zwar hatte das neue fränkische Volksrecht die Leibeigenschaft verboten, doch galt das nur für Christen. Wer den alten Göttern anhing, landete im Kerker, auf dem Richtplatz oder auf einem Menschenmarkt wie dem in Genua.
Rosviths Hand legte sich von hinten auf Thankmars Schulter und zog ihn zurück an ihren heißen Leib. Noch immer quoll rötlicher Schaum zwischen ihren Lippen hervor, während sie seinen Körper mit fordernden Händen betastete. Thankmar schloss die Augen und rief Saxnoth an, er möge der Greisin endlich den Tod schenken. Ihr Keuchen und ihr stockender Atem waren ein grässliches Liebeslied, das erst von den Geräuschen des nahenden Tages übertönt wurde.
Beim ersten Sonnenstrahl flog die Tür der Baracke auf. In der Öffnung erschien die bullige Silhouette des Sklavenhändlers Grifo. Wie immer trug er seine lederne Börse am Gürtel, die ebenso prall gefüllt war wie sein Wanst. Mürrisch trieb er die Gefangenen aus der Unterkunft, während er ihnen Folter und Tod prophezeite, wenn sich nicht bald Käufer für sie finden ließen. Dass er seine Morddrohungen ernst meinte, hatte er auf dem Weg in den Süden mehrfach bewiesen. Konnte er unterwegs nicht alle Sklaven durchfüttern, stellte er die Gefangenen der Reihe nach an ein Wagenrad. Die ersten drei, die größer als das Rad waren, verbrauchten zu viel Nahrung und wurden geköpft. Thankmar hasste den kahlköpfigen Sklavenhändler, und doch wartete er jeden Morgen sehnsüchtig auf Grifos Weckruf, der ihn aus der Umarmung der alten Hexe befreite.
Seit Tagen lähmte die Hitze das Geschäft. Selbst die Araber, in Sonnenglut geborene Wüstensöhne, schoben sich nur bedächtig durch den sonst so geschäftigen Genueser Hafen. Ohne den leisesten Windhauch schmorte die Stadt in Agonie, und über der Ligurischen See flirrte die Luft wie über einer Schüssel Fischsuppe. Die Flaute nagelte die Schiffe an die Molen. Die unglücklichen Kapitäne, die verderbliche Waren geladen hatten, mussten mit ansehen, wie ihre Fracht verfaulte. Ladeluken und Fässer gebaren Verwesungsgestank, der wabernd über dem Hafenviertel hing, und keine Windbö erbarmte sich, ihn fortzutragen.
Grifos Sklaven verbrachten den Tag im Schmutz vor der Baracke, wo sie sich den arabischen Kunden präsentieren mussten. Eine Staubschicht färbte ihre Körper grau, und Krankheit und Hunger hatten selbst die Kräftigsten unter ihnen ausgezehrt. Kaum ein Käufer schenkte Grifos Angeboten einen zweiten Blick. Trotzdem wurde der Sklavenhändler nicht müde, die Vorzüge seiner Sklaven mit voller Stimme und leeren Worten anzupreisen.
Er hatte nur derbes Volk zu bieten: Den stämmigen Odo, einst Fischer an den Stränden Aremoricas. Den weinerlichen Grimold, einen Geldverleiher aus Soissons, der sich damit brüstete, dem Kaiser einmal persönlich ausgeholfen zu haben. Werinbert, einen aquitanischen Seifenmacher mit verätzten Händen. Die kleine Bertrada, die dem Bischof von Salzburg gehört hatte, aber geflohen, eingefangen, geblendet und weiterverkauft worden war. Rosvith, die thüringische Hexe, die jedem im Lager Angst einflößte. Unter Grifos Sklaven fanden sich keine kräftigen Kerle für die Leibwache eines arabischen Fürsten und keine drallen Weiber für einen Harem.
Thankmar stach aus der Gruppe kaum heraus. Er war ein dunkelhaariger Bursche mit schmalem, aber kräftigem Körper. Seine Gliedmaßen waren lang. Nur der missgebildete Fuß störte das Bild eines schön gewachsenen jungen Mannes. In einem unnatürlichen Winkel war der Fuß nach innen verdreht, sodass statt der Sohle die Kante das Gehen verrichten musste. War die Muskulatur des übrigen Körpers ausgebildet, als hätte ein antiker Meister den Meißel an ihm geführt, so war das Fleisch des entstellten Beins bis zum Schenkel hinauf weich und weiß, weil keine Kraft in ihm wohnte.
Stundenlang saß Thankmar in der Sonne und formte aus einem Klumpen Lehm wundersame Dinge: Pferde mit Menschenköpfen, Schwerter, die aus Bäumen wuchsen, wilde Gesichter mit windzerzausten Bärten.
Zuhause in Haduloa an der Elbmündung hatten ihm seine geschickten Finger stets Ärger eingebracht. Durch den kranken Fuß war er für die Feldarbeit nicht geeignet. Stets hatten ihn seine Eltern und seine Brüder durch die langen Winter füttern müssen. Doch was seinem Fuß an Geschicklichkeit fehlte, machten die Hände wieder wett. Thankmar erhielt die Aufgabe, Ton zu brennen und die Familie mit Gefäßen zu versorgen – eine Arbeit, die in der Regel Frauen verrichteten. Doch er war geschickter als sie alle, und seine Hände vermochten noch mehr. Sie verwandelten den hinkenden Jungen in einen erfolgreichen Dieb. Wie oft hatte er sich nachts vom Hof geschlichen und das Dorf verlassen, um durch die Wälder in den Nachbarort zu humpeln. Dank seines außerordentlichen Talents gelang es ihm, in die Hühnerställe und Scheunen einzudringen und Eier und Milch zu stehlen, ohne dass jemand etwas davon bemerkte – nicht einmal Rinder und Federvieh schienen ihn wahrzunehmen. Der Fuchs, so hatte er es sich oft vorgestellt, musste ihn krank vor Neid aus dem Unterholz heraus beobachten. Keine Tür war vor ihm sicher, und wenn er am nächsten Morgen einige Eier unter die Hennen des elterlichen Hofes legte, fühlte er sich erleichtert, etwas zur Ernährung der Familie beitragen zu können. Weder sein Vater noch seine Mutter oder seine Brüder erfuhren je davon, dass ein Dieb unter ihnen lebte. Vielleicht hätten sie ihn sonst davongejagt. Der junge Sachse zweifelte selbst häufig an seinen nächtlichen Streifzügen, aber die Zufriedenheit auf dem Gesicht des Vaters, der morgens mit zwei Dutzend Eiern im Arm aus dem Hühnerstall kam, machte alle Gewissensbisse wett.
Doch diese Tage waren lange vorüber. Jetzt waren seine Hände die eines Sklaven, und das Einzige, wozu sie zu gebrauchen waren, war das sinnlose Kneten von Lehm. Am Abend quetschte Thankmar seine Werke wieder zu Klumpen zusammen, denn er wusste nicht, wen er jemals damit beschenken sollte.
Wenn die Sonne am Horizont verschwand, zogen die Sklaven zurück in die Baracke. Schlafplätze waren rar. Wer den Verschlag zu spät erreichte, musste im Stehen schlafen, was die Nacht unerträglich machte, selbst wenn man sich an einen Pfosten oder die Bretterwand stützte.
Thankmar verlor den Wettlauf um einen Ruheplatz jeden Abend. Zunächst zerrte er den verkrüppelten Fuß hinter sich her. Dann versuchte er, an Geschwindigkeit zu gewinnen, indem er mit der Fußkante auftrat. Dabei schrie er vor Wut, doch auch das half nichts. Sein Zorn galt nicht seiner Unzulänglichkeit, es war die Teilnahmslosigkeit der anderen Gefangenen, die ihn aufbrachte.
Rosvith war anders. Wie eine Freundin war sie ihm erschienen, als er zum ersten Mal hilflos inmitten der überfüllten Baracke gestanden hatte. Verzweifelt hatte er versucht, es sich im Stehen so bequem wie möglich zu machen, und das Gewicht auf das gesunde Bein verlagert. Aber alle Mühe war vergebens. Immer wieder strauchelte er, fiel auf einen der Schlafenden und erntete Schläge und Flüche. Da hatte er die Greisin vom anderen Ende des Raumes winken sehen. »Hierher, Söhnchen«, hatte sie gekräht, und an ihren fuchtelnden Armen schwang die Haut hin und her wie eine Fahne im Sturm. Dass die Schlafstelle neben ihr noch unbesetzt war, hatte Thankmar zwar verwundert. Doch er hatte sich dankbar auf das Stroh fallen lassen, ohne Fragen zu stellen.
Jetzt schlief er bereits seit vier Wochen an Rosviths Seite. Jede Nacht schüttelten Krämpfe ihren klapprigen Körper, und die Abstände zwischen den Hustenattacken wurden immer kürzer. Thankmar war die Natur ihrer Krankheit wohl bekannt: Der Fenriswolf, der Bruder der Midgardschlange und größte Feind der Götter, hielt die Alte im Würgegriff. Die Symptome waren eindeutig. Die Bestie hockte tief in ihrem Körper und zerfraß sie unter Bellen und Heulen von innen heraus. Man konnte ihr Wirken in der Nacht beobachten, wenn Rosviths Husten und der blutige Auswurf Zeugnis von dem Kampf in ihren Eingeweiden ablegten. Thankmar war niemals zuvor einem besessenen Menschen begegnet, doch er erinnerte sich an die Geschichtenerzähler seiner Heimat, die von schrecklichen Veränderungen zu berichten wussten, von Männern und Frauen, denen Wolfsköpfe wuchsen und die keine menschliche Regung mehr kannten, nur noch Blutdurst und Mordlust.
Noch hatte sich Rosvith nicht verwandelt. Aber ihr fieberhaftes Verlangen nach Thankmar war so ungewöhnlich für eine Greisin, dass es nur ein Zeichen ihrer Besessenheit sein konnte. Schon in der ersten Nacht hatte er plötzlich ihre Hand an seinen Lenden gespürt. Dann war die Alte unvermittelt über ihn gekommen. Ihre Augen hatten vor Gier geglüht, und ihre zitternde Hand hatte einen Dolch an sein Ohr gepresst. Widerstand zu leisten wäre eine tödliche Dummheit gewesen.
Sie quälte ihn fast jede Nacht. Sein verkrüppelter Fuß zwang ihn allabendlich auf Rosviths Lager, und von den Mitgefangenen war keine Hilfe zu erwarten. Sie sahen entweder grinsend zu oder wandten sich verschämt ab. Er war der Sklave einer Sklavin.
Die Klinge verlieh ihr Macht. Wenn er sie an sich bringen könnte, würde sie von ihm ablassen müssen. Wie hatte Rosvith den Dolch nur ins Lager geschmuggelt? Wo hielt sie die Waffe versteckt?
In unbeobachteten Momenten durchwühlte Thankmar das Stroh, immer mit demselben niederschmetternden Ergebnis. Nur eine Möglichkeit blieb: Der Dolch musste in ihren Lumpen verborgen sein, sodass sie ihn tagsüber bei sich tragen konnte. Thankmar wartete auf eine passende Gelegenheit, die Alte zu entwaffnen. Geduldig ließ er die Tage verstreichen, hockte auf dem kleinen Platz vor der Baracke, bearbeitete den Lehm und beobachtete jede Bewegung seiner Peinigerin.
An jenem Morgen saß Rosvith gegen einen mannshohen Tonkrug gelehnt und schien zu schlafen. Deutlich drang das wohlbekannte Röcheln zu ihm herüber. Wenn er jetzt zu ihr hinüberschlich, könnte er die Waffe vielleicht unbemerkt in seinen Besitz bringen. Wo sollte er danach suchen? Was würde passieren, wenn sie ihn bemerkte?
Während er nachdachte, entstand unter seinen Händen eine menschliche Figur aus feuchter Erde. Er betrachtete sein Werk mit gerunzelter Stirn, strich sanft an den Konturen entlang, über den kleinen Kopf, die weiblichen Formen des Rumpfes hinab. Eine Frau. Sein Finger verharrte. Er warf einen Blick zu Rosvith hinüber. Eine Kette aus blauen Tonperlen schlängelte sich von ihrem Hals in ihr Gewand hinab und verschwand zwischen ihren Brüsten. Natürlich. Ein besseres Versteck für die Klinge hätte sie nicht finden können.
Als er die Figur beiseitelegte, zerfiel sie, aber er achtete nicht darauf. Seine Aufmerksamkeit galt der Kette um Rosviths Hals. Die anderen Sklaven dösten oder arbeiteten im Schatten. Niemand beachtete ihn, als er sich erhob. Auch Grifo war nirgends zu sehen. Hätte er den dicken Sklavenhändler beschäftigt gewusst, es wäre ihm wohler gewesen. Unsinn! Er wischte die Besorgnis beiseite und humpelte durch den heißen Sand auf Rosvith zu.
Unbemerkt erreichte er den Haufen aus Töpfen, Kannen und Krügen, neben dem die schlafende Rosvith saß. Auf allen vieren schob er sich um die Gefäße herum. Im Stillen verfluchte Thankmar seinen kranken Fuß, der hörbar im Sand scharrte. Er kauerte sich hinter ein hohes Vorratsgefäß und lauschte. Auf der anderen Seite seines Verstecks tat Rosvith ihren Schlaf mit unverminderter Lautstärke kund. Vorsichtig kroch er um den Krug herum.
Ihre Augen waren geschlossen, der Unterkiefer heruntergeklappt – sie schlief tatsächlich. Bei jedem Atemzug hoben sich ihm die Tonperlen um ihren Hals einen Fingerbreit entgegen. Er brauchte nur danach zu greifen. Um das Fieber seiner Nerven zu kühlen, zwang er sich, nicht daran zu denken, was Rosvith mit ihm anstellen würde, wenn sie erwachte und ihn mit der Hand zwischen ihren Brüsten erwischte. Sein Blick heftete sich auf die flatternden Lider der Schlafenden. Dann langte er vorsichtig nach der Beute.
Wie ein Windhauch strichen seine Finger über den Körper der Alten. Er berührte die Tonkugeln und hob den Schmuck behutsam von ihrer Haut. Selbst als er den Flachsfaden zwischen den Perlen entzweiriss, die Kette von ihrem Hals löste und aus den Lumpen hervorangelte, rührte sich Rosvith nicht.
Die Klinge hing nicht an der Perlenschnur. Versteinert stierte Thankmar die wertlose Beute an, die an seiner Hand baumelte. Ungeachtet der Gefahr, entdeckt zu werden, stöhnte er vor Enttäuschung.
»Sehr geschickt, mein Junge«, sagte jemand hinter ihm, begleitet vom langsamen Applaus zweier Hände.
Thankmar wirbelte herum und stolperte in den Staub. Nur wenige Fuß entfernt von ihm standen zwei Männer. Grifos fetter Schädel glänzte im Sonnenlicht. Neben ihm wuchs die schlanke Gestalt eines Unbekannten empor, der seine besten Jahre bereits hinter sich hatte. Seinen ansonsten kahlen Kopf zierte ein weißer Haarkranz wie eine lange nicht mehr gestutzte Tonsur. Aus einem scharf geschnittenen Gesicht funkelten helle Augen zu Thankmar herab.
»Ein Meisterdieb«, sagte der Fremde zu Grifo, ohne den Blick von Thankmar zu nehmen.
»Wie recht Ihr habt«, beeilte sich der Sklavenhändler ihm beizupflichten. Speichel sprühte von seinen Lippen auf die Wange des Weißhaarigen, aber der zeigte keine Regung. »Überhaupt ist dieser Sklave äußerst geschickt mit den Händen. Er ist ein Meister der Töpferkunst und noch dazu ein talentierter Musikus auf dem Hifthorn, kann weben und böttchern, stellt feinste Goldschmiedearbeiten her, und ich persönlich habe ihn schon einen ganzen Tag lang auf den Händen gehen sehen. Das macht den schlechten Fuß allemal wieder wett. Lasst Euch sagen: Hätte der große Alexander einen Sklaven mit so geschickten Händen an seiner Seite gehabt, der Phrygische Knoten hätte ihn nicht in Fesseln halten können.«
Thankmar wunderte sich über seine neuen Talente, hütete sich aber, dem Sklavenhändler ins Wort zu fallen. Aus den Augenwinkeln sah er, wie Rosvith sich regte.
»Ihr scheint mit Euren Sklaven vertraut, als wären sie Eure Familie, und neben Eurem Wissen um die Legenden der Vergangenheit können nur wenige bestehen. Jedenfalls was die Präzision angeht.« Der Hauch einer Verbeugung des Fremden genügte, und Grifo blähte seinen fetten Leib stolz auf, sodass er einen gefährlichen Umfang erreichte. »Ihr bekommt zwölf Schillinge«, setzte der Hagere hinzu.
Grifo sackte wieder in sich zusammen und ruderte mit den Armen durch die Luft. »Zwölf! Schaut auf die prächtigen Kümpfe, Schalen und Töpfe, die unter seinen Fingern entstehen. Seht seinen schönen Körper an! Als Lustknabe wäre er eines Fürsten würdig. Ein halbes Pfund lötigen Silbers wird er Euch kosten. Nicht weniger.«
»Einen Fürsten scheint Ihr nicht in mir erkennen zu können. Einen fürstlichen Preis soll ich dennoch zahlen. Wie geht das an?«
Für einen Moment schien der Sklavenhändler irritiert. »Ich habe diesen Burschen von Haduloa bis hierher geschleppt. Niemand hat ihn mir abkaufen wollen. Durchfüttern musste ich ihn. Wochenlang. Ein Vermögen hat das gekostet. Ein Pferd ist genügsamer als dieser da.« Diesmal spuckte Grifo absichtlich aus. Laichgrün klatschte seine Verachtung in den Sand vor Thankmars Füßen.
»Haduloa? So ist er ein Sachse.« Der Fremde verschränkte die Arme vor seinem Gewand aus karmesinrotem Brokat. Thankmar fiel auf, dass die Hände des Alten zitterten. »Wenn ihn niemand zum Sklaven will, muss Euch doch jeder Preis recht sein. Warum wollt Ihr das Geschäft durch Wucher verderben? Fünfzehn Schillinge sind mein letztes Gebot. Schlagt ein!«
Grifo knetete den Geldbeutel an seinem Gürtel. Seine Blicke huschten zwischen Thankmar und der ausgestreckten Hand des Fremden hin und her.
Rosviths Stimme unterbrach kreischend das Geschäft. »Der Pestkrüppel ist mein. Ich schenkte ihm Liebe, und er hat mich bestohlen. Für einen feinen Herrn wie Euch ist seine Nähe viel zu gefährlich. Lasst ihn bei mir, den verlausten Schnapphahn, ich will ihm zur Strafe für seine Undankbarkeit meinen Namen in den Bauch schnitzen.« Sie hatte sich erhoben. Tränen rannen über ihr zerfurchtes Gesicht.
Der Irrsinn schien sie endgültig in Klauen zu halten. Nichts wünschte sich Thankmar sehnlicher, als diesen Ort für immer hinter sich zu lassen. Schloss Grifo das Geschäft nicht ab, würde er ihn, Thankmar, dafür zur Rechenschaft ziehen – falls die verrückte Hexe ihn nicht zuvor erstochen hatte. Jetzt lag es an ihm. Er musste sein Schicksal selbst in die Hand nehmen.
Die Glieder wurden ihm schwer, als er sich auf die Beine zwang. Sein Blut war Blei. Grifos scharfen Befehl zurückzubleiben hörte er nicht. Wankend stellte er sich vor den Rotgewandeten und hielt sich mit den Augen an dessen gezwirbelten Stiefelspitzen fest. Grifo bellte noch einmal, aber der Fremde gebot ihm mit einem Wink zu schweigen.
»Herr«, krächzte Thankmar. Verzweiflung schnürte ihm die Kehle zu. Er schluckte sie hinunter. »Herr, ich bin Thankmar der Euler. Ja, ich bin ein Sachse. Meine Heimat liegt am großen Fluss Albia, dort, wo das Marschland beginnt. Durch den Krieg bin ich zum Sklaven geworden. Aber ich selbst habe niemals gegen einen Franken gekämpft. Der Fuß, wisst Ihr? Es ist wahr, ich kann kaum gehen. Schon das Stehen bereitet mir Schmerzen. Aber arbeiten kann ich. Und ich will Euch treu dienen, wenn Ihr mir nur die Gelegenheit dazu gebt. Führt mich fort von hier, Herr! An diesem Ort wartet der Tod auf mich.«
»Was gehen mich deine Wünsche an, Unfreier? Dein Blut könnte das Meer rot färben, und ich würde starren Blicks darüber hinwegsegeln. Der Galgen, an dem du hängst, ist mir Belustigung am Wegesrand. Ein Sklave, der Forderungen stellt! In diesem Lager wohnt der Wahnsinn. Und ein Dieb bist du obendrein?«
»Noch nie habe ich genommen, was anderen gehört«, beteuerte Thankmar. Ihm fiel die Beute ein, die er noch immer in Händen hielt. »Die Kette der Alten, Herr, war nur ein Versehen.« Unter beschwörenden Gesten humpelte er auf den Fremden zu. »Sie hat einen Dolch, wisst Ihr, und …«
Grifos Faust explodierte auf seinem linken Auge und fällte ihn wie der Sturm einen morschen Baum. Mühevoll unterdrückte der Händler seinen Groll. »Verzeiht! Er ist noch jung und das Leben in Gefangenschaft nicht gewohnt. Fünfzehn Schillinge bietet Ihr? Ja, fünfzehn Schillinge«, presste er hervor.
Der Fremde holte tief Luft. Sein Blick ruhte lange auf Grifo. Dann sagte er: »Ihr solltet die Missgeburt töten. Erlöst Euch von dieser Plage. Sächsisches Ungeziefer ist selbst für die Sklaverei ohne Wert.« Damit wandte er sich zum Gehen, verharrte aber noch einmal und sagte zu Grifo: »Es war der Gordische Knoten, den Alexander mit dem Schwert zerschlug. Nicht der phrygische. Und gefesselt hatte man ihn auch nicht.« Hoheitlichen Schrittes verschwand der Fremde zwischen den Streunern des Hafens.
Eine Glocke des Schweigens senkte sich über das Lager. Grifo ruderte haltsuchend mit den Armen und sprach unhörbare Worte. Er atmete schwer, und sein Kopf verfärbte sich purpurrot.
Keinem der Sklaven war Grifos peinliche Abfuhr verborgen geblieben. Die fünfzig Männer und Frauen saßen starr und warteten, dass die Wut ihres Besitzers auf sie herabregnen würde – ein versteinertes Heer vor der Schlacht gegen einen übermächtigen Feind.
Es war Rosvith, die das Signal zum Angriff gab. Lachen brach sich Bahn aus ihrem zahnlosen Mund und ließ die aufgeblähte Stille zerplatzen. Es war ein freudloses Lachen, ein Kreischen der Häme. Der Laut fand ein Echo in den anderen Gefangenen. Plötzlich sprudelte aus allen Kehlen der kakophone Kanon des Spotts.
»Aufhören!« Grifos Stimme klang schrill. »Sofort aufhören! Ihr seid nur Unfreie. Euer Leben ist ohne Wert. Ich werde euch alle ersäufen.« Seine Stimme wurde noch schriller. Das Gelächter schwoll zu einem Tosen an.
Da trat Rosvith an Grifo heran. Ungelenk begann sie, um ihn herumzustaken. Der fette Sklavenhändler stand wie versteinert da, und seine Starre schien den Irrsinn der thüringischen Hexe erst recht zu entfachen. Immer schneller sprang sie um Grifo herum, hob ihre Lumpen vulgär in die Höhe, stampfte mit den dürren Beinen zum Gelächter der Sklaven. Als sie begann, mit den Händen unsichtbare Fäden in die Luft zu weben, Fratzen zu ziehen, zu speien und Grifo zu verfluchen, zitterte der Sklavenhändler und duckte sich.
»Einen Kopf, ein Auge, ein Bein. So viel kostet das Leben.« Rosvith wiederholte die Worte wie eine Beschwörung, während sie Grifo umkreiste. War das Zauberei oder bloß das Gestammel einer Wahnsinnigen? Eine Wirkung sollte sich niemals zeigen.
Rosviths Tanz endete so abrupt wie ihr Leben. Zweimal stießen Grifos Pranken ins Leere, dann bekamen sie den Kopf der Alten zu packen. Als er ihre Halswirbel brach, übertönte das leise Knacken den Lärm der Sklaven. Schweigen legte sich wieder über das Lager.
Rosviths Körper fiel in den Staub.
2.
Ein Windhauch schlich sich in die mörderische Hitze, griff in den Staub und wirbelte ihn auf. Sand flog Isaak in die Augen und zwang ihn innezuhalten. Der tiefrote Brokatmantel bauschte sich im Wind. Isaak spürte tausend Körnchen unter seinen Kaftan fahren und sich auf der schweißnassen Haut niederlassen. Es ist nichts, bloß ein Luftzug, dachte er. Aber trotz der Hitze schauderte es ihn, und seine Hände zitterten. Seufzend ließ er sich am Rand der Anlegestelle nieder. Nur einen Moment, ermahnte er sich. Dann brach, wie so oft, die Erinnerung über ihn herein.
Seit mehr als einem halben Jahrhundert tobte der Krieg zwischen Franken und Sarazenen. Orient und Okzident stritten gleichermaßen um die religiöse Vormachtstellung und um die Weltherrschaft. Byzanz, bislang dritte große Macht, war durch eine Reihe schwacher Kaiser zu einer politischen Hure verkommen, die sich an den Meistbietenden verkaufte. Kaiser oder Kalif, Carolus Magnus oder Harun ar-Raschid, einer musste das Ringen um Glauben und Grenzen für sich entscheiden. Beiderseits der Pyrenäen standen sich johlend die feindlichen Heere gegenüber. Aber während die Krieger darauf brannten, ihre Schwerter im Blut der Ungläubigen zu baden, waren ihre Herrscher des Kriegführens müde. Sie waren alt geworden und der Schlachten überdrüssig. Es war genug der Felder voller Leichen, genug der niedergebrannten Dörfer, genug der leeren Schatzkammern. Ihre gigantischen Reiche zu verwalten erforderte ihre ungeteilte Aufmerksamkeit und vielfach gepriesene Weisheit. Der Krieg selbst war ihr größter Feind, und er schwang sein Banner mit ungebrochener Kraft. Vor diesem Meister beugten selbst die beiden mächtigsten Männer der Welt ihre Häupter. Hätten sie ihren Friedenswunsch offen bekundet – ihre Widersacher am eigenen Hofe wären über sie hergefallen wie ein Rudel Löwen über zwei verirrte Lämmer. Eine Waffenruhe war unmöglich.
Carolus Magnus hatte den ersten Schritt gewagt und Isaak, seinen jüdischen Berater, in diplomatischer Mission nach Bagdad gesandt. Der Auftrag war delikat und drohte das Frankenreich in seinen Grundfesten zu erschüttern: Der Kaiser schickte dem Kalifen Geschenke. Geschenke für den Feind. Für den Mann, den die gesamte Christenheit für den Teufel in Person hielt. Zehn hispanische Rosse, ein Wagen gefüllt mit friesischem Tuch und zwanzig austrasische Jagdhunde mussten unbemerkt nach Bagdad überführt werden. Würde die Natur der Mission offenbar, ein Fegefeuer würde über das Land rasen und die jüngst erwachte Zivilisation Europas zu einem Klumpen der Barbarei zusammenschmelzen.
Grauen packte Isaak, als er an die Reise zurückdachte. Um möglichst wenig Aufsehen zu erregen, hatten sie eine Route durch menschenleere Ödnis und über die gefährlichen Hochgebirgspässe der Alpen gewählt. Zwanzig Menschen begleiteten die dreißig Tiere für den Kalifen. Seit den Zeiten Theoderichs, des mächtigen Ostgoten, hatte sich kein so seltsamer Tross die alten Pfade entlanggewunden. Staunende Bauern und neugierige Händler begegneten ihnen nur selten. Die wenigen, die ihren Weg kreuzten, bezahlten den Blick auf die geheime Fracht mit dem Leben. Sie fanden ihr Ende auf dem Grund einer Schlucht oder der Spitze einer Lanze.
In der unwirtlichen Bergwelt des Gelben Belchen überraschte sie der Winter. Der Frost traf sie zwei Wochen früher als erwartet und brachte die Mission an den Rand des Scheiterns. Zehn qualvolle Tage lang stemmten sich Mensch und Tier gegen den beißenden Wind, der ihnen die Haut von den Wangen riss und sie beim Atmen mit Eisnadeln geißelte.
Mit der Lawine brach die Katastrophe endgültig über sie herein. Die herabdonnernden Schneemassen erwischten die Nachhut und fegten fünf Maultiere in eine Klamm – und mit ihnen allen Proviant. Fortan wich der Hunger nicht mehr von ihrer Seite. Jagd, Fischfang, Beerensammeln – jeder Versuch, Nahrung zu beschaffen, war inmitten der vereisten Berge so aussichtslos wie die Hoffnung auf ein Bad in der Sahara.
Am dritten Tag ohne Futter wurden die Hunde toll. In einem unbeobachteten Moment fiel die Meute über eines der Prachtpferde her. Hätte sich Radulf nicht tapfer dazwischengeworfen, es wäre aus gewesen mit der Friedensbotschaft für Bagdad. Radulf, der sich stets durch Zurückhaltung und Besonnenheit ausgezeichnet hatte, sprang ohne Zögern zwischen die scharfen Fänge, um die vor Hunger wahnsinnigen Hunde von den Pferden fernzuhalten. Sie zerrissen ihn, bevor ihm einer der Gefährten beispringen konnte. Zwar fand Radulf einen entsetzlichen Tod, doch gleichsam bedeutete sein Ende die Rettung der anderen, denn die Hunde sättigten sich an ihrem Opfer. Sie ließen von den wertvollen Hengsten ab und liefen auch nicht länger Gefahr, sich gegenseitig anzufallen.
Entlang eisiger Kluften, über tückische Schneefelder und durch dichte Wälder setzte die Gruppe ihren Weg fort. Sie kampierten am Tag und marschierten in den langen Nächten, wenn die Lawinengefahr nicht so groß war. Menschen und Pferde duldeten den Hunger als grausigen Begleiter. Die Hunde hingegen verfielen zwei Tage nach ihrem schrecklichen Mahl erneut in Raserei. Ein vielstimmiges Knurren des Rudels kündigte eine neuerliche Katastrophe an.
Zu viel stand auf dem Spiel. Töteten die Hunde die Pferde, wäre die Mission gescheitert. Töteten die Hunde sich gegenseitig, wäre die Mission ebenfalls gescheitert. Starben hingegen einige der Gesandten und gelang es den Überlebenden, alle Tiere wohlbehalten nach Bagdad zu geleiten, wäre der erste Schritt zur Völkerverständigung zwischen Franken und Sarazenen getan.
Isaak ließ Lose ziehen. Dass es Hatto als Ersten traf, war ein schwerer Schlag für den Juden. Sein Schüler und Freund stand mit dem kurzen Hölzchen in der Hand im knietiefen Schnee und rang um Fassung. Sie verabschiedeten sich mit einer stummen Umarmung. Dann führte Isaak selbst den Schwertstreich aus. Hatto war tot, bevor er zu Boden stürzte. Augenblicklich witterten die Hunde das Blut und fielen über das Opfer her wie Grabräuber über eine königliche Gruft.
Hattos Tod verschaffte ihnen zwei Tage Zeit. Dann zog Gerbert von Friaul den Kürzeren. Der Reihe nach ließen Aregis, Grimwald und Theodo ihr Leben für das der Hunde. Bernhard von Kärnten erfror unter einem Felsüberhang, und Hugo der Schwertmeister kehrte von einem Erkundungsritt nicht zurück. Sie fanden ihn zwei Tage später, erhängt in einem Fichtenforst, ein Fanal ihrer Hoffnungslosigkeit.
Sie zählten weder die Toten noch die Tage. Allein dem Überleben der Tiere galt das Streben der verbliebenen Männer, und der Glaube, dass auf die weiße Wüste der Berninagruppe die grünen Täler der Lombardei folgen mussten, trieb sie voran. Als sie aus dem letzten Bergmassiv hervorkrochen, glitzerte zu ihren Füßen der See von Como im Mondlicht. Der Anblick brachte sie fast um den Verstand. Aus vollem Halse lachend fielen sich Dagobert und Erik in die Arme, während Tränen ihre eingefallenen Wangen hinunterrollten. Isaak gab seinen bebenden Knien nach und sank in den Schnee, der ihm nicht länger wie weißer Morast erschien, sondern unschuldig und federgleich anmutete.
Gott hatte ihn einer Prüfung unterzogen, und er, Isaak von Köln, hatte das Volk aus Ägypten geführt. So wie Mose einst die Fluten des Meeres geteilt hatte, so hatte er den Bergen befohlen, zurückzuweichen. Jetzt lag der Weg ins Gelobte Land vor ihnen. Einem Propheten gleich würde Isaak den Menschen den Frieden diktieren und den sinnlosen Krieg aus der Welt verbannen. Die kostbaren Tiere lebten. Gepriesen sei Jahwe!
Zwanzig Männer hatten die Reise angetreten. Siebzehn Seelen waren in der eisigen Hölle zurückgeblieben, und die drei Überlebenden waren schwer gezeichnet. Erfrierungen hatten Dagobert die Finger der rechten Hand gekostet. Eriks Augen waren mit Schneeblindheit geschlagen, von der sie sich nie wieder erholen würden. Einzig Isaaks Körper war der Kälte unversehrt entronnen. Aber sein geläuterter Geist, der in unauslotbare Abgründe geschaut hatte, ließ seine Knochen beben und seine Muskeln erschauern. Zunächst hielt er das unaufhörliche Zittern für ein Zeichen des Hungers. Dann, nachdem sie in einem Berghof Unterkunft und Nahrung gefunden hatten, glaubte er, an einem Fieber zu leiden.
Zwei Monate später hatte die Mission ihr Ziel erreicht: Bagdad, die runde Stadt, Blume am Tigris. Isaak kniete vor Harun ar-Raschid, dem Herrscher des Orients, nieder. Der Kalif wies den drei Gesandten einen Diwan zu und setzte an, die Gäste zu begrüßen. Doch im Moment des Triumphes schob sich ein Schatten über Isaaks Existenz. Ein Sturm fegte durch ihn hindurch. Er bebte am ganzen Körper, so stark, dass seine neuen arabischen Gewänder raschelten und der Kalif ihn fragend ansah.
Als ar-Raschid sprach, erklang nicht die schnurrende Stimme des arabischen Fürsten. Aus dem Mund des Kalifen vernahm Isaak das Wort Gottes. Und Gott schrie. Irritiert versuchte Isaak, die Vision zu ignorieren und dem Empfangszeremoniell Harun ar-Raschids gerecht zu werden. Doch die donnernde Stimme betäubte ihn. Keiner der Anwesenden schien etwas zu bemerken.
»Isaak«, rief Gott grollend, »du hast mich gelästert.« Das Gebrüll ließ Isaaks Sinne schwinden.
Der Kalif strich sich über den Bart und faltete die Hände vor dem immensen Bauch. Offensichtlich erwartete er Antwort auf eine Frage, aber Isaak hatte ihn nicht verstanden. Der Großwesir zischte dem Regenten einige arabische Worte zu.
Isaak erhob sich. Ihm war heiß.
Gott gab keine Ruhe. »Mose gleich wolltest du vom Berge Sinai hinabsteigen als Verkünder einer neuen Zeit. Aber deine Hoffart verrät die wahre Natur deines Strebens. Nicht Prophet bist du, sondern Pharao. Nicht das Volk führst du, sondern die Verfolger. Zittere vor dem Zorn deines Herrn, Isaak! Zittere!«
Plötzlich war das Gesicht des Kalifen über ihm. Die dunkel umrandeten Augen blickten sorgenvoll auf ihn herab, und die Haare des mächtigen schwarzen Bartes begannen zu leben. Sie sponnen einen Kokon um Isaak, der immer dichter wurde, immer enger, bis er schließlich vollständig in der Dunkelheit versank.
Er hatte zwei Jahre Zeit, um sich von dem Zusammenbruch zu erholen. Es drängte ihn zurück, aber Harun ar-Raschid legte bei der Wahl eines Gegengeschenkes für Carolus Magnus keine Eile an den Tag. Ein vergoldetes Astrolabium zur Beobachtung des Sternenhimmels? Oder ein leibhaftiges Einhorn? Fünfhundert mit Seide beladene Kamele? Oder gar des Kalifen Lieblingsfrau, die eine brillante Erzählerin abgab? Jeder neue Einfall begeisterte ar-Raschid mehr als der vorangegangene. Zu einem Entschluss ließ er sich jedoch nicht hinreißen. Erst Isaaks Mahnung, der Frankenherrscher habe zwar ein dickes Fell in diplomatischen Angelegenheiten, aber nicht unbegrenzt Zeit, brachte den Araber auf den Gedanken, nach dem er so lange gesucht hatte.
Aus den Werkstätten seiner persischen Mathematiker und Konstrukteure ließ der Kalif eine Apparatur herbeischaffen, die durch ein wundersames System aus Leitungen und Lagern die Stunden des Tages anzuzeigen vermochte. Eine Uhr, die mithilfe von Wasserkraft in Gang gehalten wurde. Waren zwölf Stunden verstrichen, fielen zwei Kügelchen auf eine Zimbel. Der helle Klang weckte zwölf kleine Bronzereiter, die aus ihren Toren hervorpreschten und dem Betrachter mahnend ihre winzigen Metallschwerter entgegenstreckten. Diese erstaunliche Maschine gab Isaak Rätsel auf. Aber er erkannte die großartige Geste Harun ar-Raschids. Was war eines Kaisers würdiger als die Zeit selbst?
Der Abbasidenherrscher ließ ein Segelschiff takeln, das Isaak den Euphrat hinauf bis nach Aleppo bringen sollte. Von dort sollte die Fahrt quer über das Mittelmeer, die italienische Westküste hinauf, bis nach Genua führen. Dagobert und Erik, die mit Isaak nach Bagdad gekommen waren, blieben als ständige Gesandte des Frankenreiches zurück. Vier arabische Fürstensöhne wurden an ihrer statt mit der Aufgabe betraut, Isaak mitsamt der wertvollen Gabe sicher zu seinem Kaiser zu geleiten.
Zusammen mit der Uhr wurden farbige Teppiche von bestaunenswerter Schönheit auf das Schiff geladen, Seidenstoffe, Räucherwerk und Balsame in messingbeschlagenen Truhen. Und noch etwas schickte Harun ar-Raschid auf das Schiff.
Etwas sehr Großes.
Die Nacht hatte sich auf Genua herabgesenkt. Noch immer wehte ein Wind von See her und schenkte der Stadt die lang ersehnte Abkühlung. Am Rand des Kais, zwischen Land und Meer, saß Isaak. Seine Beine hingen über dem glucksenden Wasser des Hafenbeckens. Gedankenversunken betrachtete er den Horizont. Dann griff er nach dem Amulett, einem halben Raubvogel aus Gold und rotem Almandin, das er um den faltigen Hals trug, und schloss die Augen. Er ließ seine Gedanken über das Meer schweifen, über die Schaumkronen der Wellen reiten und dahinter über die Dünen der Wüste fliegen. Und mit einem Mal war ihm, als grüßten ihn, funkelnd in der Schwärze, die hell erleuchteten Türme Bagdads.
3.
Auf den Hügeln hinter der Stadt lag das Feld der Verstorbenen. Grabsteine aus Basalt, kaum höher als eine Männerwade, spickten das Gelände, als wären sie wie zufällig vom Himmel gefallen. Verdorrter Oleander krallte sich in den sonnenverbrannten Grund. Knorrige Olivenbäume sogen den letzten Saft aus der trockenen Erde. Um ihre Stämme versammelten sich die Ziegen, um ihr Fell am Holz zu schaben, vom Silbergrün der Blätter zu naschen und im lichtdurchsiebten Schatten die Hitze des Tages zu verschlafen. Unter schweren Lidern blickte die Herde zu den beiden Menschen hinüber, die im Morgenlicht vorübertrotteten.
Fluchend zerrte Grifo an dem Strick, dessen Ende um Thankmars Hüften geknotet war. Rosviths Leiche hing über der Schulter des jungen Sachsen. Strauchelte Thankmar, so schaukelte der kalte Kopf vor seinem Bauch hin und her. Noch im Tod war Rosvith furchterregend.
Auch Thankmar selbst ähnelte einem Leichnam. Sein ganzer Körper war wund, die Haut zerschunden und aufgeplatzt. Grifo hatte Rosvith am Abend zuvor den Garaus gemacht und war dann auf ihn losgegangen. Als Thankmar aus der Ohnmacht erwacht war, hatte er in einer Pfütze aus Blut und Urin gelegen.
Doch schlimmer als der Schmerz quälte ihn die Sehnsucht nach der Heimat. Unter dem Gewicht der Toten schwor er sich, alles daranzusetzen, dorthin zurückzukehren, wo das Meer das Land zerbiss und das Marschland das Salz des Ozeans trank. Selbst wenn er der letzte Überlebende seines Stammes sein sollte. Um nichts auf der Welt würde er sein Dasein als Sklave fristen, nicht in diesem heißen Teil des Frankenreichs, nicht im Morgenland und auch nicht andernorts. Er würde in den Norden zurückkehren, selbst wenn es ihn das Leben kosten sollte.
Grifo blieb stehen. Er schlang das Seil um den Stamm eines Olivenbaums, ließ dem Gefangenen zehn Schritt Bewegungsfreiheit und zurrte die Enden zu einem Knoten zusammen. In diesem Bereich der Gräberstatt wurden die Ungetauften verscharrt. Hier sollte auch Rosviths Leichnam verschwinden. Falls der Boden die giftige Gabe nicht wieder ausspie, dachte Thankmar. Angewidert ließ er Rosviths Körper zu Boden gleiten.
Grunzend zog Grifo eine hölzerne Feldflasche aus einem Leinenbeutel, entkorkte sie und nahm zwei tiefe Züge. Der Trank brachte seine Schweinsaugen zum Leuchten. Dann angelte er eine Schüssel aus dem Beutel, die er Thankmar vor die Füße warf.
»Hier vergraben wir die Alte. Kratz das Loch mit ihrem alten Napf aus oder benutz deine Hände, das ist mir gleich. Versuchst du davonzulaufen, kannst du bald wieder an der Seite deines toten Liebchens ruhen. Auf ewig.«
Grifo gluckste vor Vergnügen. Übermütig trat er einer Ziege in die Flanke. Das Tier meckerte empört, sprang außer Reichweite und gab seinen Platz im Schatten eines Laubdachs frei. Der Sklavenhändler ließ sich zu Boden fallen und gab sich dem Inhalt seiner Feldflasche hin.
Durst plagte Thankmar, kaum dass er mit der Arbeit begonnen hatte. Er kniete auf dem steinharten Grund und schälte Staubschicht um Staubschicht von der Scholle, indem er mit der Schüssel darüberkratzte. Bald hüllte ihn eine gelbliche Staubwolke ein, die ihm den Atem raubte. Der Dreck, die brennenden Wunden, die sengende Hitze – Thankmar verlangte es nach der Heimat wie nie zuvor. Er schmachtete nach dem Tosen der eisigen Brandung, nach dem Gesang der Herbststürme und den Wiesen des Marschlandes. Noch ein einziges Mal wollte er dem Wispern der Bachläufe lauschen. Dann wäre er bereit für den Tod. Mit Schwert und Schild in der Hand dem Feind ins Gesicht lachen, dieses Ende würde ihm gefallen. Viele Männer seines Weilers hatte er so dastehen sehen, damals, als die Franken herangestürmt kamen. Er aber hatte zum Kriegsdienst nie getaugt.
»Schlaf nicht ein, Totengräber!« Träge warf Grifo kleine Steine nach ihm. Die Sonne hing über den Hügelkuppen wie eine vollreife Frucht, und Rosviths Grab sah aus wie ein dunkles Maul, das nach Nahrung gierte. Bis zu den Hüften hockte Thankmar schon im Erdreich. Das gedrechselte Holz der Schüssel war an vielen Stellen weggeplatzt. Immer wieder hieb er es in den Grund und zerrte widerspenstige Wurzeln mit bloßen Händen heraus. Seine Muskeln brannten. Nadeln bohrten sich in sein Rückgrat. Durch die Eingeweide fraß sich der Durst.
Die Flasche lag geleert zu den Füßen des Sklavenhändlers. Der Alkohol ließ Schweiß von seiner Stirn perlen. Sein Gesicht färbte sich rot, als er Thankmar zornig anbrüllte: »Verfluchter Judas! Schneller, hab ich gesagt. Streng dich an, sonst schlag ich dich in Stücke! Du denkst, ich wüsste nicht, was du im Schilde führst? Da täuschst du dich! Den ganzen Tag sollen wir hier vertrödeln? Das könnte dir so passen! Währenddessen braten meine Sklaven eingesperrt im Schuppen, und die Käuferschar irrt durch den Hafen und sucht nach ihrem zuverlässigsten Lieferanten. Wegen dir verliere ich meine Kundschaft. Und das weißt du genau.«
Die Worte prasselten auf Thankmar herab. Bei der Vorstellung, er könne noch einmal in die Gewalt von Grifos fetten Fäusten geraten, zapfte er die letzten Kraftreserven an. Er stemmte die Knie in den Boden, schleuderte die Schüssel beiseite und begann, mit bloßen Fingern Brocken aus der Erde zu hacken. Je schneller er vorwärtskam, desto eher würde Grifo sich beruhigen. Wie ein Vulkan spie das Erdloch Dreck über seine Ränder, bis dichter Nebel die Luft trübte. Tiefer, er musste noch tiefer graben. So tief, dass Grifo ihn in dem Loch nicht mehr finden konnte. Gehetzt warf Thankmar einen Blick zu dem Sklavenhändler hinüber.
Rasend vor Wut und vom Alkohol benebelt wuchtete sich Grifo auf die Füße, wankte, bemühte sich um einen stabilen Stand, wankte noch immer. Seine Augen fixierten den Sklaven, dann machte er einen Schritt auf die Grube zu.
»Jetzt werde ich dich Missgeburt zum Teufel schicken«, lallte er. »Du hast mir lange genug auf der Nase herumgetanzt.« Noch ein Schritt. Säuerliche Gase entwichen aus Grifos Mund. »Mit bloßer Faust will ich dich Sachsenschwein zerschmettern. Mit meiner Eisenfaust. Ja, das gefällt mir: Grifo Eisenfaust. Was sagst du dazu?« Der dritte Schritt kostete ihn beinahe die Balance. Einen Moment hielt er inne und betrachtete sein Opfer, das vor ihm in der Grube hockte.
Thankmar vermochte später nicht mehr zu sagen, wie der Sand in Grifos Gesicht gelangt war. Überall wirbelte Staub durch die Luft. Vielleicht hatte Saxnoth ihm einen Windstoß geschickt. Vielleicht war Grifo von selbst in den Nebel getappt. Vielleicht hatte Thankmar in seiner Panik eine Handvoll Dreck nach ihm geschleudert, als der Sklavenhändler den Rand der Grube erreicht hatte.
Jedenfalls umschwirrte der Schmutz Grifos Schädel wie ein Schwarm Honigbienen die erste Blüte. Der Staub flog ihm in den Rachen und ließ ihn husten. Sein Oberkörper zuckte in Spasmen, und seine Hände griffen haltsuchend in die Luft. Er keuchte, pfiff und röchelte so laut, dass selbst die stoischen Ziegen die Köpfe wandten. Das Prusten und Schnaufen steigerte sich zu einem beängstigenden Lärm. Grifo schlug sich auf die Brust, taumelte und ruderte mit den Armen, bis die Schwerkraft ihn besiegte. Rücklings kippte der Sklavenhändler in die Grube und schlug mit Wucht auf den harten Boden.
Im letzten Moment stemmte sich Thankmar aus dem Grab. Hinter ihm donnerte die Fleischlawine seines Herrn zu Boden. Noch mehr Staub wirbelte auf. Dann war es still.
Pochenden Herzens blickte Thankmar in die Grube. Grifo rührte sich nicht. Seine rechte Hand hing aus dem Grab wie die Klaue eines Wiedergängers, der sich anschickte, der Gruft zu entsteigen. Thankmar schlich näher heran. Grifos Augen waren verdreht und zeigten unnatürlich viel Weiß. Die Lippen klafften auseinander, und die Zunge hing blau zwischen ihnen hervor.
Grifo ist tot, schoss es Thankmar durch den Kopf. Entsetzen und Frohlocken ergriffen ihn. Frei. Er war frei. Nicht länger Eigentum eines anderen Menschen. Der Weg nach Hause stand ihm offen. Doch da war ein Stöhnen aus dem Grab zu vernehmen, das Thankmars Hoffnung zerplatzen ließ. Grifo lebte.
Der Wanst unter der ledernen Weste hob und senkte sich. Alkohol, Hitze und Atemnot hatten den Sklavenhändler zwar gefällt. Aber das Leben hatten sie ihn nicht gekostet.
Panik überkam Thankmar. Wenn Grifo erwachte, war es aus mit ihm. Einen Moment lang überlegte er, ob er Grifo töten könnte. Aber er wusste weder, wie er das anstellen sollte, noch, ob er es fertigbringen würde. Ihm blieb nur die Flucht.
Das spröde Hanfseil war eng um seine Hüften geschlungen und hielt ihn fest. Er widerstand der Versuchung, es über Brust oder Becken zu zwängen. Grifo verstand sein Handwerk: Versuchte man, die Fessel zu dehnen, zog sich der Knoten zusammen wie die Schlinge an einem Galgen. Thankmar fuhr sich nervös durch die schwarzen Locken und zwirbelte eine Strähne. Dann begann er, an dem Knoten zu nesteln.
Schon wenige Atemzüge später kapitulierte er vor dem Wirrwarr endloser Windungen. Dieses Knäuel zu entschlingen würde ihn Tage kosten. Aber ihm blieben bloß Augenblicke, bevor Grifo wieder zu sich kommen würde. Er sprang über den reglosen Riesen hinweg und versuchte sich an dem Gegenstück des Knotens, das um den Stamm des Olivenbaums gezurrt war. Vergeblich.
Mit beiden Händen zerwühlte er jetzt seinen Schopf. Es gab kein Entkommen. Er war Grifo ausgeliefert. Zum Tode verurteilt von zwanzig Fuß gedrehten Hanfs. Resigniert ließ er die Arme sinken. Seine Hände zitterten.
Der Fremde im roten Mantel kam ihm in den Sinn. Wäre er nur nicht so anmaßend gewesen. In einem reichen Haushalt könnte er jetzt dienen, wohlversorgt auf einem eigenen Strohsack in einem geräumigen Stall schlafen, angeschmiegt an die warmen Körper der Ziegen und Schweine. Ganz sicher war der Unbekannte fürstlicher Herkunft gewesen, vielleicht sogar im Auftrag eines Königs unterwegs. Von einem Mann namens Alexander hatte er gesprochen, einem großen Mann. Und von einem Knoten war die Rede gewesen. Einem Knoten, der zerschlagen worden war.
Der Dolch. Er musste noch immer an Rosviths Leiche verborgen sein. Da lag sie, die verendete Hexe, und hielt den Lohn für seine Liebesdienste bereit. Die Schatten der Baumkronen malten ein wissendes Lächeln auf ihren Mund.
Mit einem Satz war Thankmar bei ihr und begann, den steifen Leichnam abzutasten. Hastig fuhr er durch die fadenscheinigen Fetzen ihrer Tunika, aber kein Dolch war darin verborgen. Ihre Füße waren mit schmutzstarrenden Streifen aus Leinen umwickelt. Er riss den Stoff entzwei. Zehn tote Zehen reckten sich ihm entgegen, sonst nichts. Was blieb, war der Gürtel aus brüchigem Leder, der um Rosviths Hüften geschlungen war. Die angelaufene Schnalle ließ sich leicht lösen. Als die Enden auseinanderfielen wie welke Blüten, blitzte es metallisch. Thankmar zerrte an dem Leder, und der Riemen schnalzte unter Rosvith hervor. Aber nicht die ersehnte Klinge blinkte dahinter. Eine Münze, klein wie ein Daumennagel, war in den Gürtel genietet: ein Goldsolidus.
Außer sich vor Enttäuschung schleuderte Thankmar den Riemen zu Boden. Jetzt war er ein reicher Sklave und so gut wie tot. Wie viel Niedertracht hielt das Schicksal noch für ihn bereit? Warum, im Namen der Irminsul, hatte Rosvith eine so wertvolle Münze bei sich getragen? Der blanke Solidus blitzte im Sonnenlicht, als wüsste er die Antwort.
Da erinnerte sich Thankmar an eine der Legenden, mit denen die Sklaven sich die endlosen Tage vertrieben. Geschichten aus dunklen Zeitaltern, die von versunkenen Kontinenten und einäugigen Riesen berichteten, und von Helden, die Kriege um die Gunst einer Frau führten. Einer der gefürchtetsten Unholde jener Sagen war Charon, der Fährmann. In seinem Boot beförderte er die Seelen der Verstorbenen über einen schwarzen Fluss ins Reich der Toten. An den Namen des Flusses konnte sich Thankmar nicht erinnern, wohl aber an die Beschreibung des fürchterlichen Fährmanns. Ein rotäugiger, schlangenhaariger Unhold sollte er sein. Und er forderte für die Überfahrt ins Jenseits Entlohnung. Ein Kuhhandel treibender Gott. Thankmar hatte für diesen Aberglauben nur Spott und Verachtung übrig. Aber viele der Sklaven huldigten Charon. Der Ritus verlangte, Verstorbenen eine Münze unter die Zunge zu legen, mit der die Dienste des Fährmanns vergütet werden sollten.
Rosvith hatte diesem Glauben angehangen. Wozu sonst sollte das einsame Goldstück dienen? Thankmar hob den Gürtel auf, zerbrach die Niete und löste den Solidus aus dem Leder. Seine Finger schlossen sich um das Gold, und er spürte, wie sich das Metall in seiner Hand erwärmte. Es gab keinen Dolch, kein Entkommen, keine Freiheit. Zugrunde gehen würde er in diesem verfluchten Land, genau wie Rosvith.