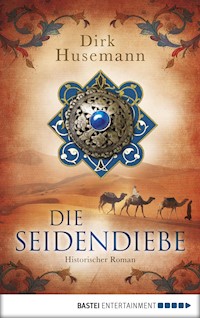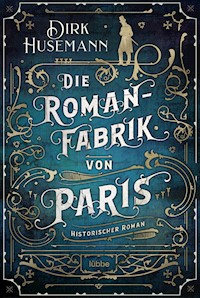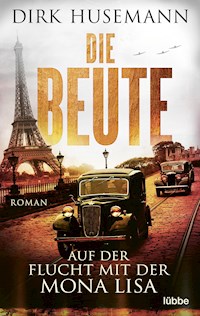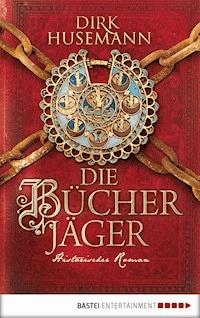6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Istanbul, 1599: Eine Orgel, die von selbst spielt. Dieses Wunderwerk soll der Orgelbauer Thomas Dallam dem osmanischen Sultan als Geschenk überreichen. Doch die Reise an den Bosporus dient noch einem ganz anderen Zweck: Im Auftrag von Königin Elizabeth I. begibt sich Dallam auf die Suche nach dem Griechischen Feuer - jener legendären Waffe der Byzantiner, die selbst Wasser zum Brennen bringt. Als der Sultan davon Wind bekommt, beginnt in den uralten Gassen, Kanälen und Zisternen Konstantinopels die Jagd auf ein Feuer von unvorstellbarer Macht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Dramatis Personae
Schauplätze
1588
Auftakt
Thomas Dallams von selbst spielende Orgel
1599
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Die Kathedrale von Westminster
1601
Nachhall
Nachwort
Glossar
Über das Buch
Istanbul, 1599: Eine Orgel, die von selbst spielt. Dieses Wunderwerk soll der Orgelbauer Thomas Dallam dem osmanischen Sultan als Geschenk überreichen. Doch die Reise an den Bosporus dient noch einem ganz anderen Zweck: Im Auftrag von Königin Elizabeth I. begibt sich Dallam auf die Suche nach dem Griechischen Feuer – jener legendären Waffe der Byzantiner, die selbst Wasser zum Brennen bringt. Als der Sultan davon Wind bekommt, beginnt in den uralten Gassen, Kanälen und Zisternen Konstantinopels die Jagd auf ein Feuer von unvorstellbarer Macht …
Über den Autor
Dirk Husemann, Jahrgang 1965, gräbt als Wissenschaftsjournalist und Archäologe Geschichten aus. Er studierte Ur- und Frühgeschichte, Klassische Archäologie und Ethnologie in Münster und schreibt Reportagen und Sachbücher über die rosaroten Steine von Stonehenge, Fische in der Sahara und den Sternenhimmel unter den Pyramiden Mexikos. Seine Romane werden in mehrere Sprachen übersetzt. Die Seidendiebe erreichte Platz 2 bei der Wahl zum Wissensbuch des Jahres und stand auf der Shortlist des HOMER-Preises.
DIRK HUSEMANN
DAS SCHWARZE FEUER VON BYZANZ
HISTORISCHER ROMAN
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze, BonnIllustrationen: © 2019 by Markus Weber, Guter Punkt MünchenDie Shakespeare-Zitate in Kapitel 16 stammen aus folgender Ausgabe: William Shakespeare, Dramatische Werke, übersetzt von A.W. Schlegel und J.J. Eschenburg, Wien 1810.Titelillustration: © Color Symphony/Shutterstock; © Vasilius/Shutterstock; © akg-images/Fototeca Gilardi Umschlaggestaltung: Kirstin OsenauE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-7234-2
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
In Erinnerung anHans-Jürgen Korn22. Juni 1940 – 1. November 2018
Dramatis Personae
Bei den kursiv gesetzten Namen handelt es sich um historische Persönlichkeiten.
Thomas Dallam, Orgelbauer
LONDON, GREENWICH PALACE
Elizabeth I., Königin von England
William Cecil, 1. Baron Burghley, englischer Staatsmann
Robert Radcliffe, Herzog von Sussex
Garcilaso de la Ruy, spanischer Gesandter
CITY OF LONDON
Roscoe Flint, Fährmann
Rowland Bucket, Rätselmeister
AN BORD DER HECTOR
Hoodshutter Wells, Kapitän
Winston, Segelflicker
John Flint, Fährmannssohn
Henry Lello, Sir, englischer Diplomat
Geoffrey Montagu, Lord, Diplomat
William Aldridge, Lord
Emily Aldridge, seine Frau
Mabel, ihre Zofe
Cuthbert Bull, Kaufmann
Dudley North, Kaufmann
IN ISTANBUL
Mehmed III., Sultan des Osmanischen Reiches
Ioannis, griechischer Schmied
Kassandra, seine Tochter
Eremyia, Wasserverkäufer
Melek Ahmed, Kerkermeister
Schauplätze
Greenwich Palace und City of London
An Bord der Hector
In Istanbul
1588
Auftakt
Ein kalter Wind fegte durch die Kathedrale von Westminster. Der alte Kantor rieb sich die von der Gicht verkrümmten Hände. Warum Kirchen mit den Portalen nach Osten gebaut werden mussten, hatte er noch nie verstanden. Von dort fiel zwar die Morgensonne in den Kirchenraum, aber mit ihr kam der Ostwind, und der brachte den Frost. Bisweilen kam aus dieser Himmelsrichtung auch das Unglück.
Kantor Hanscombe beugte sich über die Brüstung der Empore. Tief unter ihm summte die Kathedrale. Die Bänke waren mit Menschen gefüllt. Noch hatte die Messe nicht begonnen, noch redeten die Besucher miteinander, tauschten Neuigkeiten aus. Manche kamen nur aus diesem einen Grund, andere, um die Königin zu sehen. Denn an diesem kalten Morgen im März 1588 wollte Elizabeth persönlich an der Eucharistie teilnehmen. Der Krieg mit Spanien stand unmittelbar bevor, und die Königin konnte jede denkbare Unterstützung gebrauchen. Vor allem die Hilfe Gottes.
Schwere Schritte donnerten auf der Stiege zur Orgel. Farnham, der Küster, kam herauf, aber nur so weit, dass sein von Wein und Gottesfurcht gerötetes Gesicht über dem Treppenschacht erschien.
»Du wirst heute ohne Kalkanten arbeiten müssen. Ich brauche die Männer unten im Kirchenschiff. Verstanden?«
Hanscombe seufzte. Die Kalkanten waren junge Kirchendiener. Sie traten die Blasebälge hinter der Orgel mit Kraft und Ausdauer, damit das Instrument Luft bekam. Er, Hanscombe, hingegen würde dem Instrument mit seinen alten Beinen gerade genug Atem verschaffen, damit es überhaupt Töne von sich gab – ein flaues Flüstern, wo doch ein robustes Röhren zu hören sein sollte. Aber Hanscombe hatte keine Wahl. In dieser Kirche traf der Küster die Entscheidungen.
Farnham warf einen missmutigen Blick auf die leere Orgelbank. »Wo bleibt der Knabe?« In seiner Stimme lag mehr Eis als im Ostwind.
»Gib ihm noch etwas Zeit«, erwiderte Hanscombe. »Die Königin ist doch auch noch nicht da.«
»Zeit!« Der Küster spie das Wort von seinen feuchten Lippen. »Wenn Elizabeth’ knochiger Hintern die Kirchenbank berührt, kracht hier eine Kadenz von der Orgel, gegen die ein Furz des seligen Königs Heinrich wie das Winseln eines Welpen klingt.« Er schnappte nach Luft. »Oder ich sehe mich nach einem neuen Kantor um.« Farnhams Kopf verschwand.
Hanscombe nickte, stumm wie die Orgel. Allmählich bereute er seinen Wagemut. Er hatte einem Knaben ermöglicht, die Orgel für die Königin von England zu spielen. Der junge Thomas Dallam hatte Talent. Die Königin, selbst kinderlos, war vernarrt in Kinder. Und jeder wusste: Wer ein Lächeln auf das traurige Gesicht Elizabeth’ zaubern konnte, den liebte ganz London – und für Hanscombe war London die ganze Welt.
Aber dieses Lächeln würde Elizabeth’ dünne Lippen niemals zieren, wenn Thomas Dallam nicht bald an der Orgel erschien.
Thomas, dachte der alte Kantor, wo steckst du?
*
Südlich der Stadt schaute ein Knabe zum unerreichbaren nördlichen Ufer der Themse hinüber, dorthin, wo Westminster lag. Längst sollte er dort sein. Aber das Glück war auf dieser Seite des Flusses so viel wert wie zwei schäbige Münzen. In Thomas Dallams Hand lag jedoch nur eine einzige.
»Zwei Farthings«, wiederholte John Flint. Der Sohn des Fährmanns schaute Thomas herausfordernd an. Jedenfalls versuchte er es. Flint schielte. Auch sonst war sein Äußeres wenig dazu angetan, die Mädchen von Lambeth Marsh auf ihn aufmerksam zu machen. Sein Haar war kupferrot und struppig. Seine Ohren wuchsen in entgegengesetzte Himmelsrichtungen. Zwischen seinen Lippen ragten zwei Schneidezähne hervor, und wenn er grinste – so wie in diesem Augenblick –, bekamen diese Gesellschaft von einer Parade bleicher Gesellen, die an ausgemusterte Orgelpfeifen erinnerten. Wenn das Marschland südlich von London das Gesäß der Stadt war, so war John Flint die Warze darauf.
»So viel Geld habe ich nicht«, sagte Thomas. »Bei deinem Vater kostet die Überfahrt nur einen Farthing.«
»Mein Vater ist krank. Ich muss Medizin für ihn kaufen.« Das Grinsen in Flints Gesicht ließ Thomas ahnen, was für eine Medizin das war – und was für eine Krankheit. Gewiss hatte Flints Vater zu viel von dem billigen Bier getrunken, das die Wirte von Lambeth Marsh mit Themsewasser brauten.
Thomas hatte weder das Geld noch die Zeit, sich um die Trunkenheit von Flints Vater zu kümmern.
»Die Königin erwartet mich«, sagte er. Im selben Moment wünschte er sich, den Mund gehalten zu haben.
»Gewiss!« Flint vollführte eine Bewegung mit seinem Oberkörper, die einer Verbeugung recht nahe kam. »Was für eine Ehre, dass der feine Herr mit meiner Fähre vorliebnehmen will. Wartet, ich lege den Samtteppich für Euch aus.« Er zog sich das löchrige Schaffell von den mageren Schultern und breitete es auf dem Anleger aus. Dahinter schaukelte die Fähre im Fluss, und in einiger Entfernung ragten die Türme von Westminster aus dem Morgendunst empor. Glockenschläge erklangen von weit her.
»Hörst du nicht?«, fragte Thomas. »Sie läuten zur Messe. Ich muss rechtzeitig dort sein, um die Orgel zu spielen.« Er holte tief Luft und sagte so langsam wie möglich: »Für die Königin.«
Flint sperrte seine Zähne in seinen Mund ein und runzelte die Stirn. »Das glaubst du dir wohl selbst«, sagte er. »Du bist noch verrückter, als alle sagen.«
Wenn in Lambeth Marsh jemand als verrückt galt, so waren das Roscoe Flint, der Fährmann, und John Flint, sein Sohn. Die Kinder im Dorf um die Hügel Lambeth Heights machten sich einen Spaß daraus, »Flintauge« zu spielen. Dabei galt es, möglichst lange mit absichtlich gekreuzten Pupillen einem anderen ins Gesicht zu starren. Es hieß, wenn man diesen Spaß übertrieb, würden die Augen nie wieder geradeaus schauen können. Deshalb gewannen nur die Mutigsten diesen Wettbewerb. Thomas hatte bislang immer die hinteren Plätze belegt. Er war auch nie unter jenen Schreihälsen, die Flint schauerliche Geschichten andichteten. Darin grub der Fährmannssohn des Nachts Leichen auf dem Friedhof aus, weil er auf der Suche nach Augen war, die er gegen seine schief stehenden eintauschen konnte. So aberwitzig derlei Gerüchte waren, sorgten sie doch dafür, dass Flint von Gleichaltrigen gemieden wurde – und ihnen seinerseits aus dem Weg ging. Nur an der Fähre konnte es vorkommen, dass sich die Wege der Kinder von Lambeth Marsh mit denen des Fährmannssohns kreuzten.
Und das schien der Rotschopf Thomas nun spüren lassen zu wollen.
»Hör zu«, sagte Thomas und versuchte, sich größer zu machen. »Ich habe nichts gegen dich. Ich habe auch nie über dich Witze gerissen oder dich ausgelacht.«
»Warum solltest du über mich Witze reißen?«, fragte Flint. Sein Gesicht war so düster wie der Himmel über der Themse.
Thomas konnte die Füße nicht länger stillhalten. Er begann, vor dem Anleger auf und ab zu gehen. »Hör endlich auf damit, Flint«, sagte er und hob beschwörend die Hände in die Höhe. »Ich muss nach Westminster. Dort soll ich vor der Königin spielen. Master Hanscombe hat dafür gesorgt.«
»Hanscombe? Nie gehört«, erwiderte Flint.
»Der alte Kantor von Westminster Abbey«, erklärte Thomas mit gepresster Stimme. »Was willst du denn noch alles von deinen Passagieren wissen?«
»Deine Lieblingsfarbe«, sagte Flint.
Thomas starrte ihn entgeistert an. »Meine was?«
»Ich will’s wissen. Sag es, und ich fahre los.«
Dieser Flint war tatsächlich noch blöder, als alle immer behaupteten. »Gelb«, sagte Thomas.
Flint knetete sein linkes Ohr. »Gelb, ja?« Er spitzte die Lippen. »Gelb geht in Ordnung. Du kannst mitfahren.«
Jetzt war Thomas misstrauisch geworden. »Und der zweite Farthing?«, fragte er, gewiss, dass Flint ihn nur zum Narren halten wollte.
»Ich sehe das so«, sagte Flint. »Wenn du wirklich für die Königin auf der Orgel spielen wirst, zahlst du nur den halben Preis. Damit komme ich dir entgegen, nicht wahr? Weil du mir ebenfalls entgegenkommen wirst. Denn du nimmst mich mit in die Messe. Die Königin! Ich hab sie noch nie gesehen. Und sie mich auch nicht. Das wird ihr wohl einen ganzen Farthing wert sein.«
Die Fähre schob sich mit der Geschwindigkeit einer Seerose über die Themse. Thomas sah keine andere Möglichkeit, als Flint beim Rudern zu helfen. Aber er war den Umgang mit den Riemen nicht gewohnt, und es fiel ihm schwer, mit einem anderen Jungen im selben Rhythmus zu rudern. Wenn es darum ging, den Takt zu halten, war er an der Orgel stets auf sich allein gestellt.
Trotzdem hielt der Kahn nun so schnell auf das nördliche Ufer zu, dass er schon nach kurzer Zeit mit einem Ruck gegen den Anleger stieß. Thomas kletterte von der Ruderbank und lief los.
»Warte! Du musst mich mitnehmen!«, rief der Fährmannssohn ihm hinterher.
»Dann beeil dich!«, wollte Thomas rufen.
Da sah er das Unglück. Flint humpelte auf ihn zu. Etwas war mit seinen Beinen nicht in Ordnung. Das rechte Bein schien verdreht. Die bloßen Zehen zeigten auf die Innenseite des linken Fußes. Wenn Flint lief, schien sein linker Fuß geradeaus gehen zu wollen, während sein rechter einen Bogen beschrieb. Mit einem Mal wusste Thomas, warum Flint niemals unter den anderen Kindern von Lambeth Marsh zu finden war, warum er immer nur auf seiner Fähre über den Fluss schipperte, von Norden nach Süden, von Süden nach Norden. Seine Kompassrose hatte nur zwei Blütenblätter, weil er auf dem Fluss besser vorankam als zu Land.
Wenn er auf John Flint wartete, würde Thomas die Kathedrale wohl erst am nächsten Tag erreichen. Am liebsten wäre er sofort losgelaufen. Ratlos rieb er sich die Wangen.
»Damit kannst du nicht …«, begann er. »Du bist …« Er zeigte auf die missgestaltete Gliedmaße. Dann sah er den Schmerz in Flints Augen. »Ich meine, du bist doch der Fährmann. Du musst bei der Fähre bleiben, falls jemand übergesetzt werden will.« Die Lüge schmeckte fade wie ein Winterapfel. Thomas verzog das Gesicht und probierte ein Lächeln.
»Du hast gesagt, ich kann die Königin sehen.« In Flints Stimme lag ein Klang, den Thomas an der Orgel eingesetzt hätte, um einen dramatischen Effekt zu erzielen.
Er hatte keine Zeit für Diskussionen. Er hatte keine Zeit, einen Krüppel hinter sich herzuzerren. Er hätte längst in Westminster sein müssen. Die Königin von England erwartete ihn. Die Feenkönigin. Elizabeth. Thomas liebte sie, seit er sie zum ersten Mal in ihrer Kutsche gesehen hatte. Was wog dagegen das Unglück eines missgestalteten Burschen von der Themse? Weniger als das Licht einer Kerze.
»Komm!«, sagte Thomas und streckte eine Hand aus. Flint packte zu und ließ sich die Uferböschung hinaufziehen. Gemeinsam hielten die Jungen auf die Stadt zu.
Die Kathedrale von Westminster war ein Schiff in einem Meer aus Schneckenhäusern. Über das riesige Bauwerk zogen graue Wolken. Ein feiner Nieselregen färbte die Mauern schwarz. Thomas zog seinen Hut tief ins Gesicht. Flint trug nicht einmal eine Mütze. Schlapp hing ihm das rote Haar in die Stirn, und Tropfen rannen über sein Gesicht.
Flint gab sich Mühe, möglichst schnell voranzukommen. Aber schon von Weitem sah Thomas, wie sich die Portale der Kirche zu schließen begannen. Das bedeutete, die Königin war bereits eingetroffen.
Er bemerkte erst, dass er noch immer Flints Hand hielt, als der andere Junge sie ihm entzog. Thomas mochte nicht glauben, was er sah: Der Rothaarige wandte sich nach links. Hatte das etwas mit seinem Fuß zu tun?
Thomas überlegte kurz, ob er Flint einfach hinter sich herschleifen sollte. Doch dann verspürte er Erleichterung, dass sein langsamer Begleiter von selbst verschwand, und lief weiter. Als er sich noch einmal nach ihm umsah, war der Junge zwischen zwei Häusern verschwunden. Wird es wohl mit der Angst bekommen haben, dachte Thomas.
Ihm selbst erging es nicht besser. Vor ihm lag die endlose Straße, die zur Kathedrale führte. Angesichts der Entfernung schienen auch Thomas’ eigene Füße nichts weiter zu sein als die Gehhilfen eines beinlosen Bettlers. Aber Bettler gaben niemals auf, oder? Thomas atmete tief ein und rannte, so schnell er konnte, auf Westminster zu. Seine Schuhe klatschten in die Pfützen. Vergebens war die Mühe gewesen, das Leder glänzend zu polieren. Er hörte den eigenen Atem rasseln. Sein Brustkorb schmerzte, und trotz der Kälte lief ihm der Schweiß den Rücken hinunter. Nass von innen und von außen arbeitete er sich auf das gewaltige Bauwerk zu.
Thomas hörte den Hufschlag erst, als das Pferd schon seine Schulter streifte. Auf dem Rücken eines mageren Kleppers hockte John Flint. Diesmal war der Fährmannssohn an der Reihe, Thomas eine Hand entgegenzustrecken.
»Willst du etwa zu Fuß zur Königin?«, fragte Flint, und ein breites Grinsen entblößte seine riesigen Zähne. »Du wirst dir die Schuhe schmutzig machen.«
Thomas griff nach der Hand.
*
Als sich die Tore schlossen, hielt es Hanscombe nicht länger auf der Orgelempore aus. Er hastete die gewundene Holztreppe hinunter. Sein Rock verfing sich an einem Pfosten des Treppengeländers und ging entzwei, als der alte Kantor mit Schwung weiterlief. Gleichgültig! Ein Riss mehr oder weniger in seinem Leben konnte seine Lage kaum verschlimmern. Er hatte der Königin einen Knaben an der Orgel versprochen. Elizabeth war gekommen, aber Thomas war nicht da. Ihm musste etwas zugestoßen sein. Der Junge war stets korrekt und pünktlich. In Thomas’ Innerem lief ein Mechanismus ab. War der erst einmal aufgezogen, lief er beharrlich und vorhersehbar ab. Keine Aussetzer. Keine Überraschungen. Doch jetzt schien irgendetwas in das Getriebe geraten zu sein.
Hanscombe stahl sich durch das Seitenschiff. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt. Gerade stand die Gemeinde auf, denn Elizabeth schritt zwischen den Bänken hindurch, um ihren Platz in der ersten Reihe einzunehmen. Zwischen den schwarzen Schultern und Halskrausen des Londoner Adels erhaschte Hanscombe einen Blick auf etwas Rotes – Elizabeth’ Haar. So nah war er der Königin noch nie gewesen. Wie gern wäre er noch näher an sie herangetreten, nur um die Luft zu schmecken, die sie ausgeatmet hatte. Manche sagten, ein Blick aus ihren grünen Augen könne einen Mann die Erlösung im Himmelreich vergessen lassen. Hanscombe zwang sich, weiter in Richtung Portal zu laufen. Wenn Thomas noch kommen sollte, musste er ihm den Zugang ermöglichen. Sollte der Junge aber nicht erscheinen, wäre es wohl das Beste, sich durch das Portal in den grauen Londoner Regen davonzustehlen. So oder so: Der Eingang der Kirche hielt mehr für Hanscombe bereit als ein Blick aus den Augen Elizabeth’.
Die Tür war bereits geschlossen. Zwei Pennys überzeugten die Kirchendiener, sie noch einmal zu öffnen. Aber nur einen Spaltbreit, wurde der Kantor ermahnt, und nur für einen Augenblick. Hanscombe half selbst mit, die schweren Flügel aufzuziehen. Kaum war das Portal in Bewegung gekommen, steckte er seinen Kopf durch die Lücke. Das Erste, was er bemerkte, war der kalte Regen auf seinem fast kahlen Schädel. Das Zweite war das Pferd, das auf ihn zu galoppierte.
Im nächsten Augenblick stand Thomas Dallam vor ihm – oder das, was vorgab, Thomas Dallam zu sein. Das Gesicht des Jungen und seine Hände waren schmutzig, er trug keinen Hut, seine Haare waren so nass, dass Hanscombe eine Fontäne entgegenspritzte, als er Dallam eine Maulschelle gab.
»Wo bist du gewesen? Ich sollte dich mit den Ohren an der Orgelempore aufhängen lassen!«, schnauzte der Kantor.
Thomas senkte den Blick. »Bin ich noch zur rechten Zeit gekommen?«, fragte er mit leiser Stimme.
Natürlich! Jetzt entging der Knabe seiner Schelte, weil keine Zeit dafür war. Aber nach der Messe, das nahm sich Hanscombe vor, würde das Jüngste Gericht über Thomas Dallam hereinbrechen.
»Eile!«, zischte der Kantor. Er sah, wie die Menschentraube, deren Mittelpunkt die Königin bildete, die vordere Bank erreichte, und schob Thomas hastig vor sich her. Missmutig bemerkte Hanscombe, dass sich kleine Pfützen unter Thomas’ Schuhen bildeten. Die Schritte des Jungen quietschten auf den kostbaren Fliesen aus Luxemburger Platten.
Das Geräusch hatte Geschwister. Hanscombe schaute über die Schulter und sah, wie ein zweiter Junge hinter ihnen herlief. Er hinkte und versuchte, Schritt zu halten. Dabei biss er sich auf die Unterlippe und ließ zwei mächtige Vorderzähne sehen. Ein Monstrum aus den Eingeweiden der Stadt verfolgte sie.
»Verschwinde!«, zischte Hanscombe und schob Thomas weiter vor sich her.
»Einen Farthing!«, rief der lahme Verfolger. »Er schuldet mir einen Farthing.« Die Stimme hallte durch das Seitenschiff. Die Köpfe einiger Kirchenbesucher wandten sich zu ihnen um. »Und ich darf die Königin sehen«, quengelte der Rotschopf weiter.
Hanscombe achtete nicht auf ihn. Die Kirchendiener würden den Störenfried entfernen. Ein Straßenjunge, der versuchte, die Messe für die Königin zu stören – das würde kein gutes Ende für diesen Lumpen nehmen.
Doch jetzt blieb Thomas so abrupt stehen, dass Hanscombe hinter ihm stolperte.
»Er hat recht«, sagte der junge Orgelspieler. »Er hat mich über den Fluss gesetzt, aber ich hatte nicht genug Geld. Gebt ihm doch bitte, was ich schuldig bin, Master. Ich zahle es Euch zurück.«
Hanscombe spürte, wie das Lamm von gestern Abend in seinem Gedärm wieder zum Leben erwachte. Nur zu gern hätte er Dallam hochgehoben, ihn über die Schulter geworfen und zur Orgel getragen. Aber dafür war Thomas zu schwer und Hanscombe selbst – wie er sich eingestehen musste – zu alt.
»Später«, knurrte der Kantor. Dann kam ihm ein Einfall. Er wandte sich zu dem rothaarigen Anhängsel um und sagte: »Komm mit auf die Empore. Von dort kannst du die Königin besonders gut sehen.« Der Lammbraten beruhigte sich wieder. Du bringst doch immer noch eins und eins zusammen, Hanscombe, dachte er. Mit Schlägen trieb er Thomas und seinen hässlichen Freund vor sich her. Zu dritt hasteten sie die Holzstufen zur Orgelempore hinauf.
*
Thomas ließ sich auf die Bank vor dem Spieltisch fallen. Das Manual erstreckte sich vor ihm wie das Meer der Musik. Noch herrschte Windstille. Doch in wenigen Augenblicken würden seine Finger einen Sturm entfachen. Er kannte die Orgel von Westminster wie ein ungeborenes Kind den Mutterleib. An diesem Koloss hatte Master Hanscombe ihn ausgebildet. Allerdings war niemals zuvor die Königin zugegen gewesen, wenn er spielte.
Thomas warf einen Blick in die Tiefe. Aus einem Pulk aus Schultern in schwarzem Taft blühten weiße Halskrausen. Dazwischen leuchtete eine einzige rote Blume: die Haarpracht Königin Elizabeth’. Gerade stand sie vor dem Altar, kniete davor nieder. Thomas spürte eine leise Erregung. Er kam sich vor wie ein Dieb, der Blicke stiehlt. Dort unten stand sie. Er konnte sie tatsächlich sehen. Wenn er lange genug wartete, mochte sie den Kopf heben, um nachzuschauen, warum die Musik nicht einsetzte. Dann würde er in ihre Augen blicken und sie in die seinen.
Thomas schüttelte den Gedanken ab. Das war unmöglich. Hanscombe würde ihn von der Empore stoßen, wenn er nicht bald spielte. Er schwitzte noch immer trotz der Kälte. Als er die Hände auf die Tasten legte, genoss er die wohltuende Kühle. Sie half ihm, sich zu besinnen.
Er wollte die Messe mit einer Motette von Byrd eröffnen. Ein d-Moll-Akkord zu Beginn war besonders dramatisch. Thomas hörte in dem Ton stets die Schmerzensschreie Christi bei der Passion. Und er war sicher, dass er diesen Eindruck seinen Zuhörern würde vermitteln können.
Das Hecheln Hanscombes ließ ihn herumfahren. Der alte Kantor baute sich links neben dem Spieltisch auf. Er war es, der die Register ziehen würde, wenn Thomas ihm mit einem Nicken Zeichen gab. Aber noch konnte er nicht beginnen. Noch hatte die Orgel keine Luft.
»Sind die Kalkanten mit den Blasebälgen so weit?«, fragte Thomas.
»Ja, bereit!« Was war das für ein Lächeln auf Hanscombes Gesicht? Eben noch war der Kantor außer sich gewesen vor Zorn.
Gerade wollte sich Thomas nach Flint umschauen, da hörte er das Kommando Hanscombes. »Jetzt!«, zischte der alte Kantor. Thomas drückte mit aller Kraft die sechs Tasten nieder, mit denen er einen zweistimmigen d-Moll-Dreiklang hervorrufen wollte.
Der Drache erwachte. Er schüttelte seine Mähne aus Eisenblech, er stampfte mit den Füßen und wetzte seine Krallen. Das Untier riss das Maul auf, um die Kathedrale mit seinem Gebrüll zu erfüllen. Doch alles, was herauskam, war ein Gähnen. Das d-Moll trudelte durch die Weite des Kirchenschiffs, bis es auf halbem Weg durch die Kathedrale jämmerlich verendete. Statt eines Drachen hatte Thomas Dallam eine Ente zum Leben erweckt.
Er starrte auf seine Finger, die noch immer die Tasten niedergedrückt hielten. Die Orgel war verstummt.
Stille lastete auf der Kirche. Auch die Gemeinde, und mit ihr die Königin, tief unter der Empore gab keinen Laut von sich.
Die Mechanik der Orgel musste einen Fehler haben. Gewiss lag es an der Kombination der Tasten. Thomas versuchte einen anderen Akkord. D-Dur war zwar etwas fröhlicher, aber vielleicht funktionierte es ja.
Die Orgel schwieg. Nur die Pfeifenklappen schepperten vor sich hin.
Dem Drachen war der Atem vergangen. Das Untier war eingeschlafen, kaum dass es erwacht war. Thomas wusste, was geschehen war, noch bevor Master Hanscombe etwas sagte.
»Dieser verfluchte Straßenköter!«, schimpfte Hanscombe, leise zwar, doch Thomas war sicher, dass die Worte bis in die hintere Kirchenbank zu hören waren.
Da hielt es Thomas nicht mehr am Spieltisch aus. Er schob die Bank zurück – das Rumpeln war laut genug, um der misslungenen Vorstellung einen passenden Schlusston zu setzen – und lief um die Orgel herum. Ein kleiner Durchgang führte in die Kammer mit den Blasebälgen.
Der Raum lag im Halblicht. Die sechs Bälge lagen in einer Reihe auf dem Boden, ihre ledernen Bäuche waren flach und leer. Aus ihnen ragten die Pedale heraus, schenkeldicke Balken mit Aussparungen für die Füße. Dort hinein musste der Kalkant seinen Fuß setzen, um den Balken mit der Kraft seines ganzen Körpers herunterzudrücken. Erst dann füllte sich der Blasebalg mit Luft, die er nach und nach an die Orgel abgab.
John Flint klammerte sich an eine der ledernen Schlaufen, die als Haltegriffe dienten. Mit herausgestreckter Zunge versuchte er, seinen missgestalteten Fuß auf das Pedal zu setzen. Aber sobald ihm das gelungen war und er den Balg aufpumpen wollte, rutschte er ab. Dann baumelte er kurz in den Halteschlaufen, und das Spiel begann von vorn.
»Ich wäre doch besser auf dem Fluss geblieben«, ächzte Flint, als er Thomas in der Tür stehen sah. Schließlich ließ er die Schlaufen los. »Den Farthing für die Überfahrt, den kannst du behalten«, sagte er. Damit schob er sich an Thomas vorbei auf die Empore hinaus und verschwand.
Thomas sah ihm nach. Das schrille Lachen einer Frau, das die Kathedrale erfüllte, sollte er nie wieder vergessen.
Thomas Dallams von selbst spielende Orgel
1599
Kapitel 1
London trug sein Sommerkleid. Die Sonne kitzelte der Themse den Bauch, und wer genau hinhörte, der konnte den Fluss lachen hören. Die Brauereien verkauften Bier wie Brot. Die Pest war aus der Stadt vertrieben. Die Theater hatten wieder geöffnet. Der Tag saß den Landschaftsmalern Modell. Trotzdem war dieser 18. August 1599 ein schwerer Tag. Denn Königin Elizabeth war wieder einmal missgestimmt.
Mit ihrem Kleid aus weißem und goldenem Taft segelte die betagte Monarchin durch die Korridore von Greenwich Palace. In ihrem Kielwasser folgten ihre dümmlichen Zofen und ein Dutzend eingebildeter Höflinge. Dabei entstanden ein Rauschen und Rascheln und dieser widerliche Ton, wenn die Beulen der Melonenhosen gegeneinanderrieben.
Am liebsten wäre Elizabeth heute im Bett geblieben. Diesen Wunsch hegte sie seit Monaten. Nur zu Beginn ihrer Regentschaft, als die Macht noch wie eine süße Traube auf ihrer Zunge gelegen hatte, war sie jeden Morgen voller Schwung erwacht. Doch Trauben werden zu Rosinen, und ein Thron ist auch nur ein Stuhl. Seit sie vor elf Jahren die spanische Armada bezwungen hatte, waren Elizabeth alle folgenden Aufgaben nichtig erschienen. Sie unterzeichnete Dekrete mit schneller Hand und verteilte Posten im Vorübergehen, sie verurteilte Verräter und begnadigte sie anschließend wieder, sie ließ sich die Goldstücke ihrer Staatskasse vorzählen. All das waren wichtige Aufgaben einer Monarchin. Aber eine Herausforderung wie damals, als das Schicksal des Reichs auf Messers Schneide stand, die fehlte ihr fast noch mehr als ein Erbe.
Doch wen kümmerte schon die Langeweile einer Königin? Niemand am Hof wusste etwas von ihren Gedanken. Deshalb glaubten auch alle, Elizabeth leide an der Hitze und am Kummer der Kinderlosen. Heute Morgen versuchten sie wieder, ihre Herrscherin aufzuheitern. Was es diesmal sein sollte, hatte Elizabeth längst vergessen. Endlos erschien die Reihe der kostbaren Geschenke, der halsbrecherischen Salti italienischer Artisten, der Stammestänze von Wilden aus der Neuen Welt, der exotischen Tiere und schönen Knaben. Dabei war alles, was Elizabeth wollte, im Bett zu bleiben und wenigstens für einen Tag England seinem Schicksal zu überlassen. Aber sie war eine Läuferin, und eine Verschnaufpause würde ihr Herz und ihre Beine für immer zum Stillstand bringen.
Sie beschleunigte ihre Schritte. Ihr Gefolge keuchte.
»Ihr kennt ihn. Es ist Thomas Dallam«, sagte William Cecil. Der Lordschatzmeister erlaubte sich, nur einen Schritt hinter ihr zu gehen und in ihr Ohr zu flüstern.
Wer sollte das sein? Elizabeth legte den Kopf schief, um Cecil zum Weiterreden zu bringen. Dabei presste sie verärgert die Lippen zusammen. Jeder normale Mensch hätte sich danach erkundigen können, wer Thomas Dallam sei. Das wäre so einfach gewesen. Aber von einer Königin erwartete man, dass sie alles wusste und jeden kannte. Ein Schmierentheater! Elizabeth hoffte, dass Regeln wie diese für ihre Nachkommen abgeschafft würden – wenn sie doch nur Nachkommen hätte!
Cecil verstand die Aufforderung und sprach weiter. »Dallam hat vor etwa zehn Jahren die Orgel für Eure Majestät in Westminster Abbey gespielt. Jedenfalls hat er es versucht. Vielleicht erinnert Ihr Euch an den Vorfall.«
Und ob sie sich daran erinnerte! Sie hatte den Gottesdienst in Westminster Abbey besucht, hatte Gott nah sein wollen in der Stunde der Bedrängnis. Und irgendein einfältiger Kantor, sein Name und Gesicht waren längst aus ihrem königlichen Gedächtnis verschwunden, hatte einen Knaben an die Orgel gesetzt. Dessen Talent reichte jedoch gerade dazu, einen einzigen Ton aus dem Instrument hervorzuquälen und ihn dann jämmerlich verenden zu lassen.
Wie still es geworden war in der Kirche! Alle hatten sie dasselbe gedacht: ein schlechtes Omen für den bevorstehenden Kampf gegen Spanien. Die Stille hatte gedroht, über dem Haupt Elizabeth’ zusammenzuschlagen. Sie aber hatte gelacht, schrill und spitz – und als Einzige. Vermutlich hatten alle geglaubt, die Königin sei dem Wahnsinn verfallen. Vielleicht stimmte das sogar. Aber der versinkende Ton, der noch lange zwischen den Jochen und Gewölben der Kathedrale nachhallte, war für Elizabeth nichts anderes gewesen als das Geräusch der untergehenden spanischen Armada. In dem kläglichen Jaulen der Orgel hatte sie die Prophezeiung ihres Sieges gegen Spanien erkannt. Sie hatte gesehen, wie die stolzen Galeonen König Philipps zersplitterten, wie der Schlund der See sich öffnete und spanische Seeleute, spanische Admiräle und spanische Kanonen verschlang. Drei Monate später war diese Vision Wirklichkeit geworden.
»Ja«, sagte sie. »Ich erinnere mich.« Sie kam an einem Kerzenleuchter vorbei und strich mit dem Finger durch das heiße Wachs. Spanien, dachte sie, während sie den Talg zu einer Kugel rollte, du bist heiß und schmerzhaft. Aber meine Hand wird dich formen und zerquetschen.
»Der Organist von damals, er hat darum ersucht, Euch noch einmal vorspielen zu dürfen.« Cecils knarrende Feldherrenstimme riss Elizabeth aus ihren Gedanken.
»Und Ihr, Herzog, habt es ihm ermöglicht.« Sie schnippte die Talgkugel fort, die gegen eine Wand flog und daran haften blieb. »Ich habe keine Zeit für Musiker, die ihr Handwerk nicht verstehen.«
»Gewiss, Mylady«, sagte Cecil. »Aber Thomas Dallam ist kein Musiker mehr. Er ist jetzt Erfinder und Konstrukteur, und er möchte Euch einen Automaten vorstellen.«
Elizabeth sah zur Decke des Korridors, wo sich Spinnweben im Lufthauch blähten. »Hoffentlich ist es ein Automat, in den man oben Spanier hineingibt, damit unten Engländer herauskommen«, sagte sie. Die Höflinge lachten pflichtbewusst.
»Ein Automat, der von selbst Musik hervorbringt«, fuhr Cecil fort, so ernst wie zuvor. Die Höflinge lachten erneut.
Kurz überlegte Elizabeth, ob sie die Vorführung ablehnen sollte. Aber sie wusste, dass der gute alte Cecil sich stets bemühte, Zuckerstückchen aus dem Haferbrei des Londoner Lebens zu fischen, um seine Königin fröhlich zu stimmen. Außerdem hatte ihr dieser Dallam seinerzeit eine Vision verschafft.
»Also gut!«, sagte sie, während sie sich mit unverminderter Geschwindigkeit auf eine geschlossene grüne Tür zubewegte. »Wir wollen uns das Spektakel ansehen.«
In diesem Moment rissen zwei Diener die Flügel der Pforte auf, und die Königin schritt hindurch. Nachdem die letzte der Zofen in der Kapelle verschwunden war, schloss sich die Tür mit einem Klicken. Der Korridor in Greenwich Palace blieb wie ausgestorben zurück, als habe ihn niemals ein Mensch betreten. Die Kugel aus Talg fiel lautlos von der Wand.
*
Sonne und Mond hatten aufgehört, sich um die Erde zu drehen. Auch die anderen Planeten standen still. Mit der Spitze seines Zeigefingers tippte Thomas Dallam gegen Venus, gegen Mars. Die winzigen Gestirne aus Messing wackelten auf ihren Drahtspiralen, wollten aber nicht in Gang kommen.
Thomas erstarrte. Das Modell des Universums war die krönende Dekoration seiner von selbst spielenden Orgel. Vier Jahre lang hatte er an dem Instrument gebaut. Sein gesamtes Vermögen steckte in Pfeifen aus Zinn, in Tasten aus Elfenbein, in Uhrwerken aus Eisen und in dem kleinen Weltall aus Messing. Damit war er nicht nur Herr über die Dämonen der Musik, er zwang sogar den Sternen seinen Willen auf.
Nie wieder sollten die Gestirne über sein Leben bestimmen. An jenem Morgen in Westminster Abbey hatte das Schicksal die Orgel zum Schweigen gebracht. Zwar hatte der Küster flugs einen Chor herbeiholen können. Doch für Thomas und Kantor Hanscombe änderte das nichts. Sie waren der Kathedrale verwiesen worden. Und der Küster hatte ihnen hinterhergerufen, sie sollten im siebten Kreis der Hölle schmoren, bevor sie noch einmal einen Fuß in seine Kirche setzten. Kurz darauf trieb Hanscombe tot in der Themse. Wie sich herausstellte, hatte der alte Kantor seinen Schmerz und seine Verzweiflung in Gewürzwein zu ertränken versucht. Dabei musste der Unglückselige dem Fluss zu nahe gekommen sein.
Thomas selbst hatte sich nie wieder einer Orgel genähert. Alle Bemühungen seiner Mutter, den Knaben der Musik zurückzugeben, scheiterten. Er empfand nicht länger Liebe und Leidenschaft für die Kunst der Töne. Vielmehr erfüllte ihn Furcht, sobald er ein Kind ein Lied anstimmen hörte, jemand bei einem Fest eine Geige hervorholte oder der Chor bei der Messe das Lob Gottes sang. Jedes Mal hatte Thomas Angst, dass das Kind die nächste Strophe nicht auswendig kannte, dass an der Geige eine Saite riss, dass der Sopran im Chor den Ton nicht traf. Um das Unglück nicht miterleben zu müssen, hielt sich Thomas bei solchen Gelegenheiten mit beiden Händen die Ohren zu. Die Musik war ein wildes Tier, und er schwor sich, alles daranzusetzen, es zu kontrollieren.
Thomas’ Vater hörte das gern. Der alte Dallam hatte ohnehin noch nie etwas davon gehalten, den Spross zu einem Künstler ausbilden zu lassen. Deshalb war er auch erleichtert, als Thomas darum bat, bei seinem Onkel, einem Uhrmacher, in die Lehre gehen zu dürfen.
Und während Thomas in die Geheimnisse von Federwerken und Aufzugskronen eingeweiht wurde, während er lernte, Zeiger zu gießen und Ziffernblätter zu malen, war ihm ein Einfall gekommen: Wenn sich mit den Apparaten in der Werkstatt seines Onkels zu einer festgelegten Zeit ein Glöckchen schlagen ließ, dann waren doch gewiss auch zwei Glöckchen möglich, vielleicht sogar ein ganzes Musikstück. Die Berechenbarkeit der Mechanik würde die Wildkatze Musik in ein Schoßtier verwandeln.
Mit Feuereifer erlernte Thomas die Gesetze der Physik. So sehr beschäftigte ihn sein Rachefeldzug gegen die Musik, dass er sich taub stellte, wenn das Leben an seine Tür klopfte. Freunde, Frauen, Feste – sie störten Thomas beim Bau seiner Maschine. Nach einigen Jahren hörte das Klopfen auf. Thomas wurde einsam, ohne es zu bemerken. Da er kein Geld für Vergnügungen ausgab, wuchs ihm ein kleines Vermögen. Jeden Penny steckte er in die mechanische Orgel. Jetzt endlich stand sie vor ihm, und die Königin von England würde erkennen, dass Musik – und sogar die Planeten – ebenso beherrschbar waren wie die Spanier. Sie würde ihm verzeihen. Und vielleicht, dafür betete Thomas seit Langem, würde sie ihm erlauben, regelmäßig in ihrer Nähe zu sein.
Aber jetzt drehte sich das Zierwerk nicht! Sollte sich sein Missgeschick von damals wiederholen? Er schwor sich, dem Schicksal die Stirn zu bieten, und wenn es ihn den Verstand kosten würde.
Thomas’ Gedanken liefen zickzack. Der Fehler konnte nur in der Unrast liegen, deren Gewichte er unlängst noch einmal nachgestellt hatte. Diese aber rumorten tief im Bauch der Orgel, geschützt von einem Wald aus Spindeln, Scheiben und Schwingern. Fünf Tage hatte er gebraucht, um das Instrument im Palast von Greenwich aufzubauen. Ebenso lange würde es dauern, die Mechanik wieder freizulegen. Zwischen Glück und Untergang lag das Universum der Apparaturen – ein tückischer Ort, an dem Zeit hörbar war. Tickend verflogen die kostbaren Augenblicke, die bis zur Ankunft der Königin verblieben.
Ein Luftzug streifte Thomas’ Nacken. Er fuhr herum. Die Kapelle war riesig. Bis in den letzten Winkel hatte Thomas sie mit Kerzen ausleuchten lassen. Genau siebenhundertneunzig Talglichter waren es, nach dem Geburtstag der Königin am siebten September. Acht Diener hatten die Kerzen entzünden müssen, damit die erste nicht schon hinuntergebrannt war, bevor die Letzte leuchtete. Die Flammen spiegelten sich in den Beschlägen der Orgel. Wenn erst der Wind in die Orgelkanäle geblasen und durch die Pfeifen freigelassen würde, dann würden die Talglichter tanzen und schwingen wie das Volk der Feen. Und was passte besser zu Elizabeth, die von ihren Bewunderern »Gloriana, die Feenkönigin« genannt wurde?
Jetzt flackerten die Flammen in dem plötzlichen Lufthauch. Gern hätte Thomas kontrolliert, ob alle Lichter noch brannten. Doch vom fernen Ende der Kapelle sah er die Königin und ihren Hofstaat auf sich zukommen. Er riss die Augen auf. Sonne und Mond und alle Gestirne des Firmaments waren vergessen. Hier kam sie, die Herrin Englands und seines Schicksals. Sie sah genauso aus wie damals in Westminster Abbey, mit ihren roten aufgedrehten Haaren, dem kunstvollen Kragen aus Goldfäden und Damast und dem weiß geschminkten Gesicht. Doch konnte die Maske nicht verbergen, dass die Königin älter geworden war. Ein bitterer Zug hatte sich in ihren Mundwinkeln eingenistet. Um ihre Augen lagen Schatten.
Als ihr Blick ihn traf, kniete Thomas nieder und betrachtete den mit roten Kacheln ausgelegten Boden. Schritte, Stimmen und das Rascheln von Kleidern waren zu hören. Ein Mann sagte: »Das ist er. Und dort steht der Automat.«
»Sagt ihm, er möge beginnen.« Das musste die Stimme der Königin sein. Sie hatte einen rauchigen Klang. Die meisten Frauen Londons sprachen so. Es lag an den Herdfeuern, die einen Teil ihres Qualms in die Gemächer abgaben. Frauen wollten es stets wärmer haben als Männer. Dafür bezahlten sie mit ihren Stimmen. Offenbar hatte auch Elizabeth diesen Tribut zu entrichten, Königin oder nicht.
Jemand berührte seine Schulter. Thomas erhob sich, warf noch einen raschen Blick auf die Versammlung, die sich jetzt in den Bänken der Kapelle niedergelassen hatte, und ging dann rückwärts auf die Orgel zu. Niemand durfte der Königin den Rücken zukehren.
Dann musste er eben auf Sonne und Mond verzichten. Das Wunder des von selbst spielenden Instruments würde genügen, um Elizabeth in Entzücken zu versetzen.
Er griff nach dem Hebel, der alles in Bewegung setzen würde. Der Knauf am Ende der Holzstange war aus Elfenbein und lag kühl und glatt in seiner Hand. Thomas beruhigte seinen Atem. Dann zog er den Stab aus dem Gehäuse.
Zunächst war nur ein Knacken zu hören, gefolgt von einem Knattern. Was nun kam, war das Glucksen von Wasser. Es war der Auftakt zu dem folgenden Konzert. Denn durch die Adern des Instruments lief Flüssigkeit. In einem verschlungenen Auf und Ab sorgte sie dafür, dass die Blasebälge in dem Kasten eine Stunde lang in Bewegung blieben, ohne dass der Orgel die Luft ausging. Kalkanten, die leidigen Treter der Blasebälge – wer brauchte die noch?
Während es im Gehäuse der Orgel schwappte und rumorte, wandte sich Thomas seinem Publikum zu. »Majestät!«, begann er. Zunächst verkümmerte der Ton in seiner Kehle wie damals das d-Moll in Westminster Abbey. Er räusperte sich. »Majestät!«, hob er noch einmal an, diesmal laut und deutlich. »England und Eure Herrschaft sind ewig. Und die Musik ist es auch. Doch sie ist der Tölpelhaftigkeit der Menschen ausgesetzt.« Eine Woche hatte er für diese Ansprache geprobt. Jetzt sprudelten die Worte aus ihm hervor wie das Wasser, das durch die Orgel gepumpt wurde. Elizabeth sah ihn an. In ihren grünen Augen glänzte der Schein der siebenhundertneunzig Kerzen. Die Königin lächelte.
Beinahe hätte die unverhoffte Freundlichkeit auf dem bleichen Gesicht Thomas ins Stottern gebracht. »Wir Menschen sind es, die dafür sorgen, dass sich Musik nicht zu ihrer vollen Schönheit entfalten kann. Wir zwängen sie ein. Sie ist der Beschränktheit unserer Geschicklichkeit unterworfen. Deshalb«, er vollführte eine elegante Drehung in Richtung des Automaten, seine Rockschöße schwangen, »habe ich diese Orgel entwickelt. Sie spielt von selbst.«
Das Publikum raunte.
»Das ist weder Zauberei, wie mancher vielleicht befürchten mag, noch ist es Betrug. Was hinter meiner Erfindung steckt, sind einfache Naturgesetze. Zum Beispiel die Kraft des Wassers, das von oben nach unten fließt. Gern erkläre ich alles nach der Vorstellung. Doch zunächst«, er atmete tief ein, »die Musik.«
Bei seinen letzten Worten hatte das Gluckern im Innern der Orgel aufgehört. Alles war im Rhythmus. Thomas tastete über das polierte Eichenholz des Orgelkastens, fand den eisernen Knopf und drückte darauf.
Das Konzert begann.
Mit einem Dreiklang in d-Moll hob die Orgel zu spielen an. Es war jener Akkord, der vor zehn Jahren in Westminster hätte erklingen sollen, jener Ton, der die Karriere eines Wunderknaben an den Tasten hatte begründen sollen und der dann schneller verklungen war als der flüchtige Kuss eines Kindes. Diesmal nicht. D-Moll donnerte aus den Pfeifen und ließ den Boden vibrieren. Thomas schloss die Augen und erwartete das auflösende G-Dur. Es kam pünktlich. Die Maschine war zuverlässig. Der Mensch war es nicht.
Die Lautstärke nahm zu. Er nickte zum Takt der Musik. Hier die Kadenz, dort die Überleitung. Längst hatte er Sonne und Mond vergessen. Die Musik erfüllte den Raum, so wie es damals in der Kathedrale hätte sein sollen. Aber diesmal gab es keinen lahmen Flint, der alles zunichtemachte. Diesmal war nichts dem Zufall überlassen.
Da vernahm Thomas einen Missklang. Gerade als die Komposition zu dem schnellen Lauf ansetzte, für den er einige der Tastenhalterungen mit teurem Messing verstärkt hatte, gerade in diesem Moment mischten sich Stimmen unter die himmlische Musik.
Thomas riss die Augen auf. Auf der vordersten Bank der Kapelle schwatzte Königin Elizabeth mit dem Herzog von Cecil. Ausgerechnet Cecil, der Thomas diese Gelegenheit verschafft hatte, störte jetzt die Vorführung. Hitze stieg in Thomas’ Wangen. Er hob einen Finger, um die Aufmerksamkeit wieder auf die Musik zu lenken. Doch die Köpfe steckten weiterhin zusammen. Cecil hatte eine Schriftrolle in der Hand, auf die er immer wieder deutete. Das Lächeln auf Elizabeth’ Gesicht war einer gerümpften Nase gewichen.
Thomas trat von einem Fuß auf den anderen. Aus der Orgel tönte jetzt sein Meisterstück, der freie Teil. An einem normalen Instrument musste der Musiker bei diesem Part spielen, was er gerade fühlte, musste sich von seiner Liebe zu Christus überwältigen lassen und sich ganz der Musik hingeben. Das war eine Aufgabe, die kein Apparat übernehmen konnte – glaubten alle. Aber Thomas war es gelungen, diese schwierigen Takte so zu gestalten, dass sie wie freies Spiel klangen. Sogar kleine Fehler hatte er eingebaut, um der Musik Leben zu verleihen. Nur hörte die Königin nicht zu!
Er ging einen Schritt auf Elizabeth zu. Den mahnenden Finger hatte er noch immer erhoben. Dann trat er wieder zurück. Gewiss würde Elizabeth gleich wieder lauschen und lachen. Stattdessen war ihre Aufmerksamkeit weiterhin auf Cecil gerichtet.
Der freie Teil verklang unbeachtet. Als Nächstes würden jene Takte folgen, die Thomas mit einer Chiffre versehen hatte. Die Orgel würde die Töne EEGAAED spielen. Sie standen für eine Vermischung von »ELIZABETH« und »ENGLAND«. Die Königin musste ihn dafür lieben, ihn vielleicht zum neuen Kantor von Westminster ernennen. Wenn sie nur endlich die Ohren aufsperren würde!
Festen Schrittes ging Thomas auf die vordere Kirchenbank zu. Als er bis auf sechs Fuß heran war, sprangen zwei Edelleute auf und stellten sich ihm entgegen. Er entwischte ihren Händen. Schon stand er vor der Königin, so nah, dass er den Kampfer riechen konnte, mit dem ihre Kleider bestäubt waren, um Motten abzuhalten. Er sah die Falten an ihrem Hals und die einzelnen Haare ihrer Brauen. Für einen Moment war er enttäuscht. Elizabeth war nur ein Mensch. Doch die Erkenntnis schenkte ihm Mut. Er streckte die rechte Hand aus und fasste die Königin an der Schulter.
»Mylady!«, sagte Thomas mit fester Stimme. »Ihr müsst jetzt zuhören! Sonst entgeht Euch der beste Teil.«
*
Seine Hand hatte ihre Schulter berührt! Das hatten bislang nicht einmal Raleigh und Drake gewagt. Elizabeth bebte. Wenn dieser Automatenmann Mord statt Musik im Sinn gehabt hätte, würde sie jetzt in ihrem Blut liegen und der Griff eines Dolches aus ihrem Hals ragen.
»Das nächste Mal, wenn Ihr mir ein Vergnügen ankündigt, bester Cecil, werde ich in einer Rüstung erscheinen.« Ihre Stimme war mit Dornen besetzt. Sie stand am Fenster des Empfangsraums. Die Wände waren mit dunklem Holz getäfelt. Es hieß, ihr Vater, König Heinrich VIII., habe den Wandschmuck aus den Galgen anfertigen lassen, an denen er seine politischen Gegner aufhängen ließ. Elizabeth verabscheute solche Gesten. Nichtsdestoweniger fühlte sie sich in dem Zimmer wohl. Vielleicht, so dachte sie, steckt mehr von meinem Vater in mir, als ich bislang ahnte.
Cecil stand am anderen Ende des Raums und wartete schweigend.
Elizabeth schaute aus dem Fenster. Unter ihr lag der Garten von Greenwich Palace. Die Gärtner hatten die Formen von Kriegsschiffen aus den Büschen herausgeschnitten, zur Erinnerung an Englands Sieg über die spanische Armada. Aber ein Parasit hatte sich in den Gewächsen breitgemacht und drohte die grüne Pracht zu zerstören. Trockene gelbe Blätter sprenkelten die Schiffe wie Muschelbefall. Stellenweise wiesen die Büsche Löcher auf, die wie Lecks in den Rümpfen aussahen. Es hätte Elizabeth nicht verwundert, wenn die stolze Flotte eines Tages im Rasen versunken wäre.
»Genug von diesem dummen Vorfall!«, sagte sie mehr zu sich selbst. »Diese mechanischen Töne waren ohnehin kaum auszuhalten. Ich bevorzuge Musiker aus Fleisch und Blut.« Sie wandte sich vom Fenster ab und schenkte Cecil ein trockenes Lächeln. »So wie Euch. Auch wenn Euer Instrument die Diplomatie ist.«
Der Herzog räusperte sich in seinen schwarzen Spitzbart. Sein Kopf war viel zu klein für seinen Kragen. Dann begann er, mit seiner knurrenden Stimme zu sprechen, die Elizabeth immer an das Knarren von Schiffsplanken erinnerte.
»Es sind wieder die Spanier«, sagte der Herzog. »Wir haben erfahren, dass Philipp eine zweite Armada baut.«
Elizabeth trat einen Schritt zurück und stieß gegen die Täfelung. »Eine zweite Armada? Aber die Spanier schicken all ihre Schiffe in die Neue Welt. Womit könnten sie uns da angreifen?«
»Sie bauen neue Schiffe. Ihre Karavellen kehren mit Gold und Silber beladen aus dem neuen Indien zurück. Genug, um Philipps Palast mit goldenen Latrinen auszustatten. Und dann bleibt sogar noch etwas übrig, um eine Armada damit bauen zu lassen.«
Elizabeth zweifelte nicht an Cecils Worten. Was der Herzog sagte, hatte stets Hand und Fuß. Die Arbeit seiner Agenten kostete ein Vermögen.
»Ein zweiter Angriff der Spanier«, sinnierte Elizabeth. Noch einmal sah sie auf den Garten hinab. Es hatte angefangen zu regnen. Tropfen klatschten gegen das Fenster. Die Blätter der grüngelben Schiffe wiegten sich im Wind.
»Können wir ihnen noch einmal die Stirn bieten?«, fragte sie. Ihr Atem vernebelte das Glas.
»Die Stirn können wir ihnen bieten, aber wir werden den Kopf dabei verlieren«, sagte der Herzog. »Unsere Flotte …«
Sie hob die Hand, um ihn zu unterbrechen. Sie wusste genau, wie es um die englische Staatskasse bestellt war. Und Philipp von Spanien wusste das auch. »Wir können sie also nicht abwehren, und wir können Spanien wohl auch nicht angreifen.« Sie ging in Gedanken die Möglichkeiten durch. Es waren nicht viele. »Die Niederländer? Die Franzosen? Haben wir Hilfe von unseren Nachbarn zu erwarten?«
Cecil schüttelte den Kopf.
»Dann höre ich Euren Vorschlag, Herzog! Es ist hoffentlich nicht meine Abdankung.«
Cecils Gesicht blieb ernst, wie immer. »Wir holen uns Hilfe bei den Türken. Es mag sonderbar klingen, Mylady, aber Englands Heil könnte in Istanbul liegen.«
Trieb Cecil Schabernack mit ihr? Für einen Augenblick fühlte sich Elizabeth verunsichert – ein Zustand, in den sie sich nicht gern versetzen ließ, weder als Frau noch als Königin. »Die Ungläubigen um Beistand bitten? Ihr seid von Sinnen!«, stieß sie hervor.
Cecil ging einen Schritt auf sie zu. »Wenn das Schiff sinkt, springen wir in das letzte Rettungsboot, selbst wenn es von einem Wahnsinnigen gerudert wird.«
»Istanbul soll dieses Boot sein«, ergänzte Elizabeth. »Und der Sultan …«
»… ist der irre Ruderer.«
»Ihr schlagt also ein Bündnis vor.« Sie nahm eine Karaffe aus Zinn von einem kleinen Tisch aus Ebenholz und goss daraus Wein in einen Becher. Ihre Hände zitterten, und sie verschüttete einige Tropfen. Dann leerte sie den Kelch in einem Zug. Die Gewürze in dem Getränk prickelten auf ihrer Zunge. Kannten die Türken Wein? Sie hatte gehört, dass es ihnen verboten war, welchen zu trinken.
»Ein Bündnis«, sagte Cecil. »Gewiss. Das ist gut.«
Gut! Sie kannte den Herzog. Er versuchte, ihr einen besseren Vorschlag zu machen, wagte aber nicht, die Königin zu belehren.
»Redet endlich, Cecil! Ihr habt doch längst einen Plan erdacht, der so verschroben ist, dass eine einfältige alte Frau wie ich niemals darauf kommen wird.«
Cecil ging zwei Schritte zurück. Er war ein Krebs, der fürchtete, von einer Möwe verschlungen zu werden. Elizabeth spürte einen kalten Lufthauch durch ihr Gefieder streichen.
»Sprecht, Herzog! Wir sind allein. Lasst Eure Königin teilhaben an Eurem Wissen.«
»Wissen. Darum geht es tatsächlich. Ihr seid sehr klug, Mylady.« Cecils Hand fuhr an seinen Hals, wurde jedoch von seinem Kragen aufgehalten. Dann, endlich, offenbarte er seinen Plan.
Als der Herzog geendet hatte, war die Karaffe geleert. Dennoch spürte Elizabeth den Alkohol nicht. Stattdessen rauschte ihr das Blut in den Ohren.
»Ihr wollt also alles auf eine Karte setzen«, stellte sie fest. »Das ganze Reich würde von diesem Unternehmen abhängen. Und wenn es scheitert, was dann? Dann werden unsere Kinder die Sklaven von Spaniern sein. Unser Land wird unter den Katholiken wieder zu einem Morast des Glaubens werden. Die Ernte unserer Felder wird spanische Mäuler stopfen. Gott selbst wird das elende England vergessen wollen. Das und noch viel mehr steht auf dem Spiel, Herzog.«
»Ich weiß«, gab Cecil kleinlaut zu.
»Aber Ihr seht keine andere Möglichkeit«, fuhr Elizabeth fort. »Sonst würdet Ihr mir ein solches Unternehmen nicht vorschlagen.«
»Vielleicht findet ein anderer Eurer Herzöge einen erfolgversprechenderen Ausweg.«
Sie schüttelte den Kopf. Pembroke, Northumberland, Ormonde – sie alle würden ihr nur das Eine vorschlagen: den Überraschungsangriff auf Portugal, wo die wichtigsten Häfen der Spanier lagen. Hals über Kopf in die Höhle des Löwen. So etwas liebten ihre Admiräle. Damit plusterten sie sich bei den Hofdamen auf. Cecil unterbreitete ihr ein ebenso gefährliches Angebot, aber immerhin war er diskret.
»Ich werde mich zurückziehen, damit Ihr über dieses Vorhaben nachsinnen könnt«, sagte der Herzog.
»Ihr bleibt, bis ich Euch entlasse«, erwiderte Elizabeth.
Mit einem Mal war sie Cecil dankbar. Dafür, dass er ihr die schlechte Nachricht überbracht hatte. Dafür, dass er sie aus ihrer Schläfrigkeit riss. Sie betrachtete den stämmigen Mann mit dem kleinen Kopf, in dem das Wissen über alle Intrigen am englischen Hof steckte – und Gott weiß, was sonst noch.
Elizabeth konnte nicht länger auf der Stelle stehen. Sie schritt in dem Gemach auf und ab, strich um den großen Schreibtisch herum, zupfte die Schreibfeder aus dem Loch in der Tischplatte und strich damit über ihr Kinn.
»Diese Waffe, die wir in Istanbul finden könnten«, sagte Elizabeth, »beschreibt sie mir genauer.«
Kapitel 2
Die Hector war eines der stolzesten Schiffe der königlichen Flotte. Sie verdrängte dreihundert Tonnen, nahm hundert Mann Besatzung in Anspruch und schreckte mit ihren siebenundzwanzig Kanonen jeden Feind ab, ob er nun Spanier, Venezianer oder Dünkirchener war. Das jedenfalls behauptete Lord Geoffrey Montagu mit voller Stimme, als er neben Thomas Dallam den Kai entlangspazierte. In der einen Hand hielt Montagu einen Gehstock mit silbernem Knauf, mit der anderen tippte er immer wieder auf Thomas’ Schulter. Mit kleinen Gesten dirigierte der Lord die Aufmerksamkeit seines jungen Begleiters bald hierhin – auf die Kanonenkugeln und Pulversäcke, mit denen sich die Schauerleute beim Beladen plagten –, bald dorthin – auf die Proviantfässer und einen Käfig mit einem Dutzend Hühner. Das Federvieh lege während der Reise Eier für das Frühstück der Offiziere und Passagiere, erklärte Montagu, und seine Augen glänzten wie die eines stolzen Vaters. Sein grauer Kinnbart zitterte im Wind.
Thomas deutete auf eine Gruppe schwarz gekleideter Frauen, die etwas abseitsstanden. Ihre Gesichter waren blass und ausgezehrt, ihre Augen rot und geschwollen. »Worauf warten die?«, fragte er. Insgeheim hoffte er, die traurige Versammlung möge nicht zu den Passagieren der Hector gehören. Eine Gruppe missgestimmter Damen an Bord würde das Schiff mit Schwermut füllen, bis es sank.
»Die?« Lord Montagus Miene verfinsterte sich. Er wedelte mit dem Spazierstock in Richtung der schwarzen Gestalten. »Eine Versammlung von Unheilsschwestern. Am besten beachten wir sie überhaupt nicht.« Der Druck seiner Hand auf Thomas’ Schulter wurde stärker.
Thomas blieb stehen und betrachtete die Frauen genauer. Einige weinten. Alle sahen zur Hector hinüber. Lord Montagu wollte ihn fortziehen. Aber Thomas löste sich von seiner Hand. Drei Schritte brachten ihn zu den Frauen. Erst jetzt bemerkte er, dass sie in Pfützen standen.
»Was ist mit euch?«, fragte er.
»Dallam, Ihr folgt mir jetzt besser«, rief Lord Montagu ihm zu.
»Wir scheiden von unseren Männern und singen für sie«, sagte eine der Schwarzgewandeten mit wankender Stimme. »Sie fahren mit diesem Unglücksschiff zur See«, raunte sie.
Thomas schwieg einen Moment. »Ihr glaubt, die Hector sei ein Unglücksschiff?«, fragte er dann und fügte leise hinzu: »Ich werde auch mit ihr reisen.« Ein Windstoß ließ die Leinen des Schiffes knattern. Das Wasser in den Pfützen kräuselte sich.
»Wer singt für dich?«, wollte eine Frau aus der Gruppe wissen.
Thomas suchte nach einer Antwort. Niemand sang für ihn. Das wollte er auch gar nicht. Aber aus irgendeinem Grund fiel es ihm schwer, das vor den Seemannsfrauen zuzugeben.
Als Montagu ihn erneut rief, ließ sich Thomas von der Stimme des Lords fortziehen. Er schlang seinen Umhang enger um den Leib.
»Ein Unglücksschiff?« Er wandte sich Montagu zu. »Wir warten wohl besser auf einen Kauffahrer, der uns sicher nach Istanbul bringt.«
Montagu schwang seinen Spazierstock und lächelte Thomas an. »Wir sind im Dienste der Königin unterwegs«, sagte er mit einer Stimme, die ihm vom Kehlkopf in den Brustkorb gerutscht war. »Und die Hector ist eine königliche Fregatte. Überdies«, jetzt klopfte die Stockspitze einen gemächlichen Takt auf das Pflaster, »seid Ihr ein Verbrecher und könnt mir auf dieses Schiff folgen oder zurück in den Tower gehen.«
Thomas schwieg. Die eine Nacht in dem berüchtigten Londoner Gefängnis war die längste gewesen, die er in seinen vierundzwanzig Jahren erlebt hatte. Eingesperrt, nur weil er die Schulter der Königin berührt hatte! Am Morgen danach war William Cecil in seiner Zelle erschienen und hatte ihm einen Handel vorgeschlagen. Thomas würde freikommen. Dafür forderte der Herzog die von selbst spielende Orgel. Aber er wollte sie nicht für Greenwich Palace, nicht für die Königin, nicht einmal für London oder England. Zu den Türken wollte er den Musikautomaten schicken – mitsamt seinem Erfinder. »Zu den Türken?«, hatte Thomas mehrfach gefragt und beteuert, dass er sein Vermögen, seine Jugend und seine Liebe zu Königin Elizabeth in den Automaten gesteckt habe, dass die Orgel niemand anderem als Ihrer Majestät zustehe und kein Ungläubiger jemals Hand an das Instrument legen würde. Eigentlich wollte er noch hinzufügen, wie leid es ihm tue, sich der Königin genähert zu haben. Aber das überhebliche Schweigen des Herzogs machte es ihm unmöglich, sich zu entschuldigen.
Was blieb ihm übrig? Sie ließen ihm vier Tage Zeit, die Orgel zu zerlegen und für die Reise vorzubereiten. Sollte er sich weigern, so erklärte Cecil, würde Thomas seine Tage im Tower beenden. Überdies, so hatte der Herzog hinzugefügt, sei die Reise nach Istanbul keine Strafe, sondern eine Ehre. Thomas würde den englischen Diplomaten Lord Montagu begleiten, Sultan Mehmed persönlich begegnen und England am osmanischen Hofe vertreten. Denn in der Stadt am Bosporus sollte eine englische Handelsniederlassung eingerichtet werden. Der Sultan müsse das allerdings erlauben, und man hoffe, die Vorführung der Orgel werde helfen, den Herrscher von den Fähigkeiten der Engländer zu überzeugen.
Eine Möwe mit einem Fisch im Schnabel segelte an Thomas vorbei und landete auf einem Holzpfosten. Dort begann sie, ihre Beute zu zerlegen.
Thomas nahm allen Mut zusammen. Mochte Montagu ihn wieder in den Tower werfen lassen! Lieber sprach er aus, was er dachte, als sich von der Angst beherrschen zu lassen. Und dieses Schiff flößte ihm Angst ein. »Die Reise«, sagte er, »erscheint der Königin wichtig. Mir ist die Orgel wichtig. Und uns beiden ist unser Leben wichtig. Das sind drei Gründe, die dafürsprechen, ein sicheres Schiff zu wählen.«
»Wenn Euch der Musikautomat so sehr am Herzen liegt«, erwiderte Montagu, »dann solltet Ihr jetzt darauf achtgeben.« Die Spitze des Spazierstocks schwang in die Horizontale und wies auf drei Hafenarbeiter. Die Männer trugen längliche, in Segeltuch eingeschlagene Gegenstände auf den Schultern. Ihr Ziel war die Laderampe der Hector.
»Die Orgelpfeifen!«, brach es aus Thomas hervor. Schon lief er den Arbeitern entgegen. »Ihr müsst sie an jedem Ende mit je zwei Männern anfassen. Sie verbiegen sonst.«
Er zeigte den Seeleuten, was er meinte, und sie folgten seinen Anweisungen. Behände sprang Thomas zu den nächsten Arbeitern hinüber, erklärte ihnen, dass sie gerade eine Holzkiste trugen, in der eine kunstvolle Figur Königin Elizabeth’ verpackt war. Die Seemänner nickten. Anstatt den Kasten über die Leiter auf das Schiff zu tragen, schlangen sie Seile darum und hievten ihn mit einem Ladekran an Bord. Angespannt verfolgte Thomas, wie die zerbrechliche Elizabeth zu schweben begann.
Montagu lächelte anerkennend. Die Orgel sei nicht nur für Thomas von hohem Wert, betonte der Lord, sondern für das gesamte Königreich. Er schärfte Thomas ein, auch während der Fahrt gut auf die Einzelteile des Apparats aufzupassen.
»Dort hinten steht meine Reisetruhe. Gebt bitte auch darauf acht, bester Dallam, denn ich werde jetzt Lord und Lady Aldridge begrüßen. Sie sind Mitglieder unserer Gesandtschaft, und wenn ich meinen alten Augen trauen darf, steigen sie dort vorn gerade aus der Kutsche.«
Montagu verschwand in Richtung der Hafenmeisterei. Vor dem Gebäude stand ein Mann mit einer Frau, die gerade von einem Hustenanfall geschüttelt wurde. Ihr Mann reichte ihr ein Seidentuch. Daneben luden zwei Diener messingbeschlagene Truhen von einer Kutsche.
Thomas wandte sich ab. Er würde die Reisegesellschaft noch früh genug kennenlernen. Immerhin würde man ein halbes Jahr lang zusammen auf See unterwegs sein. Eine Fregatte war zwar ein großes Schiff, aber nach ein paar Tagen auf dem Meer schrumpfte selbst der größte Frachter zu einer Nussschale zusammen. Die Passagiere würden sich gegenseitig auf die Füße treten, noch bevor sie ihre Vornamen kannten.
Langsam näherte sich Thomas der Truhe Montagus, die darauf wartete, an Bord gehievt zu werden. Ein Mann machte sich daran zu schaffen. Er war in teure Stoffe gekleidet und offensichtlich kein Arbeiter. Und er untersuchte das Schloss.
»Was treibt Ihr da?«, rief Thomas und beschleunigte seine Schritte. Seine Schnallenschuhe platschten durch die Pfützen.
Der Unbekannte fuhr herum. Er war im selben Alter wie Thomas, trug einen modischen Hut mit einer Feder und einen dunklen Umhang, der ihm bis zur Taille reichte. Seine Beinlinge waren mit Pelz besetzt, der so weiß war, dass er nur von einem Schneewiesel stammen konnte. Trotz des frischen Winds hatte er keine Halskrause und kein Tuch umgelegt. An seinem Hals prangten drei Muttermale, groß und schwarz wie Käfer. »Wer schreit so laut und fordert Auskunft von Lord Henry Lello?«, fragte er.
Thomas blieb neben der Truhe stehen. »Dies ist das Gepäck von Lord Montagu. Wieso macht Ihr Euch daran zu schaffen?«
»Wieso beantwortest du meine Frage mit einer Frage?«, erwiderte der Mann, der sich Lord Lello nannte. Er verzog genüsslich den Mund. »Das sind bereits vier Fragen in Folge. Aber wer würde schon von einem Hafenarbeiter erwarten, dass er sich in der Kunst der Konversation auskennt?«
»Das wäre Frage Nummer fünf«, gab Thomas zurück. »Drei davon stammen von Euch selbst.«
Lello legte den Kopf schief und schloss eine Hand um den Griff seines Degens, der aus den Schichten seiner Kleidung herausragte. »Du lumpenbehangener Sklave kehrst jetzt in das Loch zurück, aus dem du hervorgekrochen bist. In diesem Augenblick! Oder ich lasse dich mein Eisen schmecken.«
Thomas zögerte. Er war kein Kämpfer. Sein schmaler Körper mit den langen Armen und Beinen würde gegen den gut genährten Lord nicht bestehen. Schon gar nicht, wenn dieser eine Waffe schwang.
Das Gelächter Lord Montagus traf Thomas’ Rücken. »Lello! Da haben wir ja noch einen Vertreter des Londoner Adels. Wir vier werden wohl genügen, um den Mohammedanern englische Manieren beizubringen.« Schon kamen Montagu und das Paar herbei, das aus der Kutsche gestiegen war.