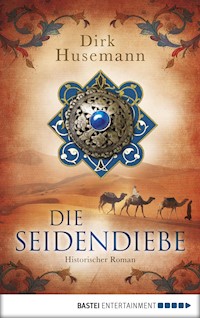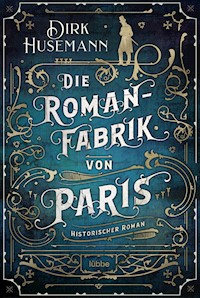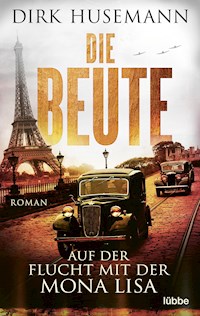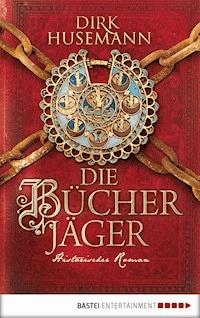
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Buch, das an eine Kette gelegt ist. Der Florentiner Poggio Bracciolini erkennt sofort, dass er einen Schatz vor sich hat. Er ist Meister im Aufstöbern antiker Texte - ein Bücherjäger, der sich in Klosterbibliotheken einschleicht. Doch diesmal kommt ihm jemand zuvor: Kaum hat Poggio die ersten Zeilen gelesen, ist das rätselhafte Buch verschwunden. Entschlossen nimmt er die Verfolgung der Diebe auf. Denn wenn dieser uralte Text in die falschen Hände gerät, wird er die gesamte abendländische Welt ins Wanken bringen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
TEIL I: BERG
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Stundenglas
Kapitel 5
Stundenglas
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
TEIL II: GRAB
Stundenglas
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
TEIL III: TURM
Stundenglas
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
TEIL IV: ABGRUND
Stundenglas
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Stundenglas
Nachwort
Dank
Karte
Dramatis Personae
Glossar
ÜBER DAS BUCH
Ein Buch, das an eine Kette gelegt ist. Der Florentiner Poggio Bracciolini erkennt sofort, dass er einen Schatz vor sich hat. Er ist Meister im Aufstöbern antiker Texte – ein Bücherjäger, der sich in Klosterbibliotheken einschleicht. Doch diesmal kommt ihm jemand zuvor: Kaum hat Poggio die ersten Zeilen gelesen, ist das rätselhafte Buch verschwunden. Entschlossen nimmt er die Verfolgung der Diebe auf. Denn wenn dieser uralte Text in die falschen Hände gerät, wird er die gesamte abendländische Welt ins Wanken bringen.
ÜBER DEN AUTOR
Dirk Husemann, Jahrgang 1965, gräbt als Wissenschaftsjournalist und Archäologe Geschichten aus. Er studierte Ur- und Frühgeschichte, Klassische Archäologie und Ethnologie in Münster und schreibt Reportagen und Sachbücher, zum Beispiel über die älteste Stadt der Welt in Syrien, die letzten Geheimnisse von Stonehenge oder Fleischdoping bei den antiken Olympischen Spielen. Sein Debütroman »Ein Elefant für Karl den Großen« wurde in mehrere Sprachen übersetzt.
Dirk Husemann
Die Bücherjäger
Historischer Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze, BonnKartenillustration: © Markus Weber, Guter Punkt MünchenTitelillustration: © shutterstock/AKaiser; © Earring, Persian (c.525-330 BC) (gold with inlays of turquoise, carnelian, and lapis lazuli), Achaemenid, (550-330 BC)/Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts, USA/Edward J. & Mary S. Holmes Fund/Bridgeman Images; © Lorant Matyas/shutterstock; © Textures and backgrounds/shutterstockUmschlaggestaltung: Kirstin OsenauE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5657-1
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
TEIL IBERG
Kapitel 1
Der Papst rannte. Er riss sich seine weiße Kappe vom Kopf und schleuderte sie an den Rand des Turnierplatzes. Hastig löste er den Verschluss seiner roten Mozzetta und wischte den Umhang von den Schultern. Der kostbare Stoff fiel in den Schnee, der vom Mist der Turnierpferde gesprenkelt war.
Zwei Knappen, die Rüstungen polierten, verschlug es die Sprache. Als Papst Johannes auf sie zugeeilt kam, beugten sie die Knie und senkten die Häupter. Hastig schlug er das Kreuzzeichen über ihren Scheiteln und ließ sich den Weg zu den Pferden weisen.
Der Turnierplatz lag nur einen Steinwurf von Konstanz entfernt. Doch ebenso gut hätte er am anderen Ende der Welt sein können – oder in der Hölle. Die Anhänger des deutschen Königs hatten Papst Johannes an diesem ungemütlichen Märztag des Jahres 1417 aus der Stadt hierher gelockt. Wie ein Esel war er ihnen in die Falle gegangen! Ein unterhaltsamer Nachmittag war ihm versprochen worden, mit zersplitternden Schilden, Prügeleien und erhitzten Damen. Nun bekam er die Quittung für seine mangelnde Vorsicht. Sie wollten ihn ermorden! Erwartet hatte er das schon lange: Wenn sie ihm nicht mit Argumenten beikommen konnten, dann eben mit scharfem Stahl.
Vor wenigen Augenblicken hatte ihn sein Freund, Herzog Friedrich von Österreich, gewarnt. Es war nur ein Flüstern gewesen, ein einziges Wort, im Vorübergehen in das päpstliche Ohr geraunt. »Flieh!«
Jetzt hetzte der Heilige Vater zwischen den Zelten der Turnierteilnehmer hindurch. Das letzte Mal, als er sich so würdelos fortbewegt hatte, war er noch ein Pirat auf dem Tyrrhenischen Meer gewesen. Ein Menschenalter lag das zurück. Statt des Säbels trug er jetzt den Hirtenstab, und sein Schiff war die Kirche – wie er dieses Sinnbild verabscheute!
Die Soutane war viel zu eng für seine weiten Schritte. Kurz hielt er inne, beugte sich hinab, packte den Saum und zog sich das Gewand über den Kopf. Darunter trug er ein weißes Hemd, aus dem seine bloßen Waden herausragten. Sie waren sogar für einen Siebenundvierzigjährigen noch kraftvoll. Bis nach Rom könnte er damit laufen, wenn man ihn nur ließe.
Drei Hofdamen, die vorüberflanierten, glotzten ihn an. Sie hatten sich mit bunten Stoffen und feinen Pelzen für das Turnier herausgeputzt. Wäre alles wie üblich verlaufen, so hätte er eine oder zwei von ihnen in seine Unterkunft eingeladen. Jetzt aber war er nicht länger einer der mächtigsten Männer der Welt, sondern einer der schnellsten.
Mit flatterndem Hemdsaum wieselte der Papst an den Damen vorüber. Ihr Tuscheln verfolgte ihn. Waren ihm die Mörder schon auf den Fersen? Er schaute zum Turnierplatz hinüber. Dort standen zwei Ritter in gesteppten Wämsern, die sich über den Rist ihrer Pferde hinweg unterhielten – die schielten doch zu ihm her! Zwei hagere Knechte rollten ein Fass mit dünnem Haferbier herbei und wollten seinen Weg kreuzen. Eine breithaxige Trine schleppte einen Korb mit Heringen und warf ihm einen finsteren Blick zu. Jeder abgelebte Knecht mochte derjenige sein, der einen Dolch für den Papst im Ärmel trug.
Endlich lag der Stall vor ihm. Eigentlich war es nur ein Wetterschutz aus schwerem Leinenstoff, ein Zelt für Streitrösser. Die Ränder der Stoffbahnen waren mit Steinen beschwert. Nur zwei Pferde standen darin. Ein Stallknecht rieb eines der Tiere ab. Der Papst legte dem wollhaarigen Mann seine verschwitzte Hand auf die Schulter.
»Kennst du mich?«, fragte er auf Deutsch.
Der Bursche musterte ihn aus kleinen Augen, schüttelte dann den Kopf. Gut! Die meisten Leute erkannten einen mächtigen Mann nur an seiner Gewandung. Und die lag jetzt in Schnee und Schmutz.
»Gib mir deine Kleider«, befahl Papst Johannes und ließ einen Gulden zwischen seinem linken Daumen und Zeigefinger erscheinen. Das Gold spiegelte sich in den Augen des Knechts. »Und diese beiden Pferde.« Er ließ eine weitere Münze erscheinen. Eine schmutzige Hand griff danach. Doch mit einem Mal hielt der Stallknecht inne und starrte auf Johannes’ Hand. Dann fiel er auf die Knie.
»Heiliger Vater, segnet mich!«, bat er grunzend.
»Dass dich Gottes Leichnam schände!«, fluchte Papst Johannes und starrte auf den Ring an seinem Finger. Darauf war ein Fisch graviert. »Sei still und steh auf, kotiger Bube!«, zischte er und versuchte, den Ring vom Finger zu ziehen. Aber der Schmuck ließ sich nicht abstreifen.
Doch der Stallknecht dachte nicht daran, sich zu erheben. Warum auch! Er hatte eine Privataudienz beim Papst. Zwei Handbewegungen seiner Heiligkeit – und schon wären ihm alle Sünden vergeben. Für diese Geste zahlten andere ein Vermögen.
»Segnet mich! Segnet mich! Bitte, Heiliger Vater!« Die Stimme des Stallknechts war viel zu laut. Rasch schlug der Papst das Kreuzzeichen über dem gesenkten Kopf. Doch der Bursche bemerkte es nicht. Erneut schrie er nach Erlösung.
Die Ritter unterbrachen ihr Gespräch und schauten zu den Ställen hinüber, vermutlich in Sorge um die Pferde. Die Diener mit dem Fass und die Heringsmatrone hielten an und linsten zwischen Zeltbahnen, Leinen und Wimpeln hindurch, wohl um dem Geschrei auf den Grund zu gehen.
Der Papst hatte genug. Mit einem Tritt stieß er den Stallknecht ins Stroh und schwang sich auf eines der Pferde. Es war ein Tier für Waffenträger, hart im Gang, aber schnell. Genau das, was er brauchte. Das Holz des Sattels scheuerte an seinem bloßen Schritt.
Die beiden Knechte kamen jetzt auf das Zelt zu. Sie hatten das Bierfass stehen lassen. Einer hielt etwas hinter seinem Rücken verborgen.
Es war Zeit zu verschwinden. Johannes ließ die Münzen wieder in den Beutel gleiten, den er um den Hals trug. Dann steckte er einen Finger in den Mund und zog mit den Zähnen den Ring des Fischers ab. Fetzen seiner Haut lösten sich. Den Schmerz und das Schmuckstück spie er vor dem Stallknecht ins Stroh. »Genug im Trüben gefischt«, rief er. Dann ließ er das Pferd antraben und die Meuchelmörder mitsamt seiner Karriere hinter sich.
Poggio!, dachte Papst Johannes. Wo steckst du? Wenn die Nachricht von seiner Flucht in Konstanz die Runde machte, wären seine Diener, seine Vizekanzler und Schreiber vogelfrei. Die Deutschen würden sie mit den Zungen an die Bäume nageln. Irgendwie musste es ihm gelingen, seinem Sekretär Poggio eine Warnung zukommen zu lassen.
In vollem Galopp trieb er das Streitross auf den Bodensee zu.
Kapitel 2
Oswald von Wolkenstein sang. Zwar verstand Poggio nicht alle Worte. Doch die Weise klang nach Schwermut und jener Form der Melancholie, wie sie die Langeweile eines adeligen Lebens in einer zugigen Burg hervorbringt.
Die beiden Männer ritten hintereinander durch einen verschneiten Wald. Schon lange hatte Poggio keine derart unberührte Landschaft mehr gesehen. In seiner Heimat Italien waren Dörfer zu Städten herangewachsen. Darin hungerten Kalkbrenner, Köhler und Baumeister nach Holz und wollten nicht warten, bis es nachgewachsen war. Wo kein Fürst die Hand über seinen Forst hielt, herrschte Kahlschlag. Poggio erinnerte sich an ein Sprichwort aus der Toskana. Darin spielte ein Eichhörnchen eine Rolle, das von Dorf zu Dorf springen konnte, ohne den Boden zu berühren. Jetzt würde sich das arme Tier seine winzigen Füße wund laufen.
Poggio liebte den Wald. Es war still darin, und das lud zum Nachdenken ein. Bevor Oswald von Wolkenstein zu singen angehoben hatte, war das Klopfen der Pferdehufe der einzige sie begleitende Laut gewesen, nur gelegentlich unterbrochen vom Zischen des Schnees, der von einem Ast glitt und vom Wind zu Staub zerblasen wurde. Sogar die Krähen, deren Rufe sie von Konstanz her begleitet hatten, waren verstummt, seit sie zwischen die Bäume geraten waren. Poggio war es erschienen, als habe die lärmende Welt mit ihren Konzilen und Beschlüssen, ihren Königen und Päpsten zu bestehen aufgehört. Doch jetzt war es mit dieser geradezu heiligen Stille vorbei.
Wolkensteins Stimme zerriss das Schweigen wie ein Lüstling das Gewand einer Jungfrau. Wenn die angestimmte Weise doch nur die Schönheit der Natur gepriesen hätte! Wenn die Laute die stillen Baumstämme umschmeichelt und den Wald bedeckt hätten wie rieselnder Schnee! Doch die deutschen Worte schlugen wie Äxte in das winterliche Paradies.
Poggio warf seinem Reisegefährten einen missmutigen Blick zu. Obwohl dieser schon das vierzigste Jahr erreicht hatte, trug er sein lockiges Haar lang wie ein Jüngling. Es hing unter einer Mütze aus Biberpelz herab. Poggio hatte Oswald noch nie ohne diese Kopfbedeckung gesehen. Nicht einmal in einer Taverne hatte der Tiroler sich barhäuptig gezeigt. Vermutlich hütete er einen kahlen Scheitel als Geheimnis seines Hauptes. Poggio verbesserte sich: Was er ein Haupt nannte, war ein massiger Schädel. Aus dem ragte eine gedrungene Nase hervor. Auf Oswalds üppiger Unterlippe leuchtete hell eine Narbe.
Wolkensteins gesundes Auge war hinauf zu den Kronen der Bäume gerichtet. Das andere war geschlossen. Immer. Viele glaubten, dass Oswald es in einer Schlacht gegen die Sarazenen verloren habe. Und der Tiroler wurde nicht müde, die Geschichte eines Zweikampfes zum Besten zu geben, in dem er jeden arabischen Hieb mit zwei abendländischen Streichen vergolten und den Feind mit blutüberströmtem Gesicht schließlich niedergestreckt habe.
Doch Poggio wusste es besser. Als Kind hatte er Männer gesehen, die einäugig, einbeinig oder einarmig aus dem Krieg heimgekehrt waren. In der Apotheke seines Vaters hatten sie um Kräuter gebettelt, die ihnen die Schmerzen nehmen sollten – und die Träume. Darin waren sie noch immer vollständigen Leibes, um dann umso zerstörter daraus aufzuschrecken. Oswald von Wolkenstein aber trug keine Spur eines Kampfes am rechten Auge. Das Lid war geschlossen wie bei einem Schläfer. Poggio war sicher: Das Organ war nicht ausgeschlagen, sondern zugewachsen. Keine ruhmreiche Schlacht, sondern eine Laune der Natur hatte dem Tiroler den halben Blick auf die Welt genommen.
Poggio hatte Verständnis für seinen Reisegefährten. In einer Welt wie dieser war es allemal einfacher, als verstümmelter Haudegen zu gelten, als ein von Natur aus Missgestalteter zu sein. Doch mit Poggios Wohlwollen war es nun vorbei.
Zug um Zug sog Oswald die kalte, klare Luft ein und sonderte die nächste Strophe seines traurigen Liedes ab. Der Wald hallte davon wider. Am Ostufer des Bodensees hatte der Forst begonnen und würde nicht enden, bis sie vor den Toren des Bergklosters Sankt Fluvius standen – so jedenfalls hatte Wolkenstein behauptet. Gern brüstete sich der Tiroler mit seiner Weltkenntnis. Die Prahlerei war eine Charaktereigenschaft, die Poggio sich nun zunutze machen wollte.
»Lieber Oswald«, sagte er auf Latein, »woher weißt du von dem Skriptorium und seinen Schätzen, wenn doch das Kloster so gut verborgen auf einem Berg liegt?«
Es funktionierte. Oswald brach mitten im Vers ab. »Zweifelst du etwa an meinen Worten?«
Poggio umfasste die ledernen Zügel fester. »Es ist eine Frage der Logik. Das Kloster liegt am Rande der Welt. Dennoch kennst du sein Inneres gut. Dahinter scheint sich eine Geschichte zu verbergen. Und Geschichten liebe ich über alles.«
»Euch Italienern ist die Neugier in die Wiege gelegt«, lästerte Oswald. »Du wirst schon sehen, welche Schätze im Skriptorium auf uns warten.«
Auf uns? Poggio hatte bereits befürchtet, dass Wolkenstein ihn nicht ohne eigenes Interesse den weiten Weg zum Kloster hinauf begleitete. Schließlich war es Oswalds Einfall gewesen, dass sie das langweilige Konstanz und sein träge dahinfließendes Konzil für einige Tage verlassen sollten, Oswalds Einfall, dass der berühmte Bücherjäger Gianfrancesco Poggio Bracciolini seine Zeit besser nutzen sollte, als sich mit Bittschriften an den Papst herumzuschlagen. Stattdessen, so hatte der Tiroler über einem Krug Wein geflüstert, könne er seinen italienischen Freund zu einem Bergstift führen, in dem angeblich die absonderlichsten Texte aus der Zeit der Römer in einem Zauberschlaf vor sich hin dämmerten. Augenblicklich war Poggio bereit gewesen, diese Träumer wach zu küssen.
Aristoteles, Cicero, Propertius – die Schriften der größten Geister der Menschheit waren seit Jahrhunderten verloren. Aber nicht gänzlich. In den Klöstern der Christenheit waren Fragmente der alten Texte zu finden. Zwischen Bibeln und Gesangbüchern hatten einzelne Pergamente, bisweilen auch ganze Bücher, die Jahrhunderte überdauert, und wenn nicht gerade ein eifriger Mönch die Rhetorik des Cicero abschabte, um auf der ledernen Seite Platz für das Lukasevangelium zu schaffen, so waren diese Schätze noch zu heben.
Glückliche Stunden in schimmeligen Bibliotheken hatten Poggio das Trostbuch des Boethius, die Prognosen des Hippokrates und das Decretum des Gratian beschert. Ungelesen hatten diese Meilensteine menschlichen Denkens in den staubigen Stuben vor sich hin gedämmert. Eifrig hatte Poggio sie kopiert, editiert, kommentiert und sodann zu seinem Freund Niccolò Niccoli nach Florenz geschickt, der sie in Umlauf brachte. Das Strahlen und Leuchten der wiedergefundenen Schriften war so stark, dass sich eine Gruppe um sie geschart hatte, die sich selbst »Humanisten« nannte. Seither vermehrten diese Menschen den Ruhm der antiken Autoren und ein wenig auch den ihres Entdeckers, des Bücherjägers Gianfrancesco Poggio Bracciolini.
Jetzt aber zeigte sich, dass Wolkenstein offenbar seine eigenen Pläne mit den Büchern hatte. Poggio beschloss, die Ansprüche an die Texte ein für alle Mal klarzustellen. »Sollten wir alte Schriften finden, so müssen diese so schnell wie möglich nach Florenz«, sagte er.
»Was zahlen sie denn in Florenz für so einen Folianten?«, fragte Oswald.
»Überhaupt nichts zahlt man dort für Folianten«, knurrte Poggio, »weil wir nämlich kein einziges Buch aus dem Kloster mitnehmen werden.«
Das also war der Grund, warum Oswald ihn hier hinaufführte. Nicht um die Langeweile von Konstanz hinter sich zu lassen, sondern um sich zu bereichern. Oswald schien die Schriften, die Poggio erkennen mochte, selbst verkaufen zu wollen – oder schlimmer noch: die Originale. An den deutschen König Sigismund vermutlich, unter dessen Schutz der Tiroler stand.
»Soso«, sagte Wolkenstein jetzt. »Und wieso führe ich dich dann zu dem Kloster, obwohl ich meine Zeit sinnvoller verbringen könnte? Wieso mühen wir uns den Berg hinauf, wenn du überhaupt nichts von dort mitnehmen willst?«
»Weil ich die alten Schriften kopieren werde.« Er klopfte gegen den Beutel, der schwer an seinem Gürtel hing. »Dafür trage ich mein Werkzeug bei mir.«
»Kopieren?«, echote Wolkenstein. »Wieso kopieren?«
Poggio durchlief es eiskalt. »Was außer kopieren sollten wir mit den Pergamenten anfangen, die wir dort finden werden?«
Jetzt lachte Oswald von Wolkenstein. Der Laut schlug in den Schneewald ein wie das Geschoss einer Blide. Poggios Pferd schnaubte.
»Wir werden mitnehmen, was auch immer wir finden«, sagte Oswald. »Neulich hat der deutsche König ein Exemplar irgendeines griechischen Dichters gekauft und hundert Gulden dafür bezahlt. Hundert Gulden! Meine Mägde daheim bekommen zwei Gulden im Jahr zum Lohn. Mit einem solchen Buch könnte ich meinen Hausstand aus der Schieflage heben.«
»Ich wusste gar nicht, dass der deutsche König lesen kann«, spottete Poggio.
Oswald fauchte zurück: »Versuch nicht, mir weiszumachen, du würdest die Texte erst mühsam abschreiben, um die Originale dann an Ort und Stelle weiter vermodern zu lassen.«
Es gab keinen Zweifel. Dieser Fürstenknecht wollte Bücher stehlen! Und er, Poggio, sollte ihm dabei helfen, die wertvollsten Exemplare auszusuchen. Mit einem Mal war ihm die Lust auf ein seit Jahrhunderten unberührtes Skriptorium vergangen. Er zog an den Zügeln, und sein Schimmel blieb stehen.
Die Luft knisterte vor Kälte. Oswald ritt noch ein paar Schritte weiter. Dann hielt auch er an und wandte sich im Sattel um. Sein gesundes Auge blitzte. Ein Hauch von Argwohn lag in der Luft.
»Was ficht dich an, Italiener?«, fragte er. »Glaubtest du etwa, du könntest die Bücher für dich allein beanspruchen?« Er breitete die Arme aus und setzte eine Unschuldsmiene auf. »Gib zu: Der Handel ist gerecht. Ich kenne den Ort, du kannst die richtigen Texte erkennen. Wir brauchen einander, wenn wir erfolgreich sein wollen.«
»Du willst die Bücher stehlen. Daran will ich keinen Anteil haben«, sagte Poggio.
»Oh, gut!« Wolkenstein grinste. »Dann behalte ich sie eben alle für mich.« Er streckte Poggio die Hand entgegen. »Komm schon, Bracciolini! Wir stehlen nichts. Wir bezahlen dafür. Die Mönche werden uns danken, wenn wir die Vorratskammer ihres abgerissenen Stifts auffüllen helfen. Was bedeutet denen schon ein uralter Text auf dreimal abgeschabtem Pergament, wenn sie sich dafür einmal richtig die Bäuche füllen können?«
Die Stille zwischen den beiden Männern war so tief wie eine Gebirgsklamm. Äußerlich war Poggio ruhig wie ein Gletscher. Doch in seinem Gedärm brodelte es wie in einem Vulkan.
»Wir kehren um nach Konstanz«, brach es schließlich aus ihm heraus. Lieber wollte er auf die alten Texte verzichten, als sie ihren Hütern zu entreißen.
Wolkenstein erstarrte. »Wie du willst! Aber ich reite weiter. Und ich finde diese Texte auch ohne dich.« Damit riss er am Zügel. Sein Rappe warf den Kopf herum und trabte an. Noch einmal wandte Oswald sich um und deutete unbestimmt mit dem Finger. »Zurück nach Konstanz geht es dort entlang. Reite einfach bergab. Das scheint ohnehin deine liebste Richtung zu sein.«
Poggio blieb zurück und sah, wie das schwankende Hinterteil von Oswalds Pferd zwischen den dicht stehenden Föhren verschwand. Er verharrte unter den Zweigen und spürte Schneeflocken auf seiner Nase landen. Dort schmolzen sie und hingen als zitternde Tropfen an der Spitze, bevor sie hinunterfielen.
Wolkenstein hatte recht: Es ging bergab für Poggio. Zwar hatte er es als Sohn eines einfachen Mannes von den Feldern bei Arezzo bis in die Nähe des Heiligen Stuhls in Rom geschafft. Doch dieser Stuhl stand nur noch auf drei Beinen. Kippte er, so würde er Poggio unter sich begraben.
Der Papst drohte abgesetzt zu werden. Nein, dachte Poggio. Es musste heißen: Die Päpste drohten abgesetzt zu werden. Im Jahre des Herrn 1417 hatte Gott drei Stellvertreter auf Erden. Die Welt war aufgespalten.
Dabei war Gott zu dienen das Einzige, das alle verband, ob sie Italiener, Deutsche, Engländer, Franzosen, Korsen, Schotten oder Ungarn waren. Die Kirche war überall. Sie half den Menschen, das Leben zu ertragen. Und der Papst wachte über seine Herde. Doch mit der Kirchenspaltung hatte sich der eine Hirte in drei Wölfe verwandelt.
Seit Beginn des Schismas feierte die Geistlichkeit auf den Altären die heilige Korruption. Die Simonie, der Verkauf von Kirchenämtern, war verbreiteter als die Inquisition. Dabei ging es nicht nur um Geld. Kardinalshüte wechselten ihre Träger beim Spiel oder als Gegenleistung für die Liebe einer Frau. Geistliche Würden waren gleichbedeutend mit einem Leben im Luxus geworden. Kardinäle suhlten sich in seidenbespannten Lotterbetten, bereisten ihre Pfründe und saugten sie aus. Eines der einträglichsten Geschäfte der Kirchenmänner war die Absolution. Der Sündenerlass für eine ganze Stadt mitsamt der Neuweihung des Friedhofs kostete die Bürger das Vermögen von sechzig Florentiner Gulden. Auf diese Weise konnte der Besuch eines Bischofs einen ganzen Landstrich ruinieren.
Da kein Gesetz sie in die Schranken wies, führten sich die Kirchenfürsten auf wie Freibeuter. Nur bei besonders derben Vergehen mussten die hohen Geistlichen mit Ahndung rechnen. Erst kürzlich war der Bischof von Toul wegen Unzucht seines Amtes enthoben worden. Seine liebste Konkubine war seine Tochter, die er mit einer Nonne hatte.
Poggio hatte selbst erlebt, dass viele Geistliche nicht einmal Latein beherrschten. So manchem hatte er vor der Ordination noch schnell die notwendigsten Formeln beigebracht, damit er bei der Zeremonie an der richtigen Stelle nicken und nachbeten konnte.
Wichtiger als Latein und Liturgie war für einen Kirchenmann dieser Tage der Umgang mit Giften. Natürlich musste man sie nicht nur mischen und in den richtigen Dosen verabreichen können, sondern auch stets das richtige Gegenmittel zur Hand haben. Wen wunderte es da noch, dass Bischöfe so verrufen waren, dass niemand glaubte, sie würden in den Himmel kommen – am wenigsten die Geistlichen selbst? Als der Prior von Clairvaux zum Bischof ernannt werden sollte, hatte er sich angeblich zu Boden geworfen und gefleht, stattdessen Wandermönch werden zu dürfen.
An der Universität von Paris verkündeten spindeldürre Theologen, nicht die Kirchenspaltung sei das große Übel des Abendlandes, sondern das Papsttum selbst. Es wuchere wie eine Schlingpflanze und drohe das Christentum zu ersticken. In diesen Worten lag Wahrheit. Der Papst war die Pest, sein Amt grassierte wie eine Seuche: Hatten anfangs noch zwei Päpste darum gestritten, wer der rechtmäßige Stellvertreter Gottes auf Erden sei, war beim Konzil von Pisa noch ein dritter hinzugekommen. Seither war die Christenheit dreigeteilt. Und wo die Trinität des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes den Menschen den Himmel versprach, da war das irdische Trio der Päpste dazu angetan, die Tore der Hölle aufzustoßen.
Niemand wollte weichen. Weder Gregor XII. noch Benedikt XIII. oder Johannes XXIII. ließen von ihrem Anspruch auf die Tiara, die Krone des Papstes, ab. Zwar behauptete jeder, sofort zurücktreten zu wollen, sobald seine Gegenspieler abgedankt hätten. Aber unglücklicherweise bestand jeder der drei darauf, dass die anderen beiden den ersten Schritt zu gehen hatten. So belauerten sich die päpstlichen Parteien, aber niemand rührte sich. Die Lage war aussichtslos. Auch das Konzil in Konstanz schien nicht das erwünschte Resultat zu bringen. Denn von den drei Päpsten war nur einer in der Stadt am Bodensee erschienen: Johannes XXIII. Als Teil seines Gefolges war auch sein Sekretär Poggio über die Alpen gereist.
Poggio blies sich in die Hände und schaute den Weg hinab, den er gekommen war. Zwischen den Bäumen hindurch sah er tief unter sich den See glitzern. Sollte er zurückkehren nach Konstanz, um seinem Herrn dabei zu helfen, die Kirche und das gesamte Abendland zu retten? Oder sollte er einen unverfrorenen Minnesänger davon abhalten, seine groben Hände nach wertvollen Pergamenten auszustrecken? Was für Schätze mochten in dem alten Kloster verborgen sein? Poggio dachte an die Verse des Lukrez, die er auswendig kannte.
»Frühling kommt«, rezitierte er laut, »und Venus, und ihnen voraus sind der Venus geflügelter Bote und Mutter Flora, auf den Fersen folgt ihnen Zephyr, und sie bereiten der Göttin den Weg, mit den Blumen verbreiten sie herrliche Farben und Wohlgerüche.«
Poggio atmete tief ein. Lag es an diesen wunderbaren Worten, oder roch er jetzt tatsächlich die Vorboten des Frühlings, die unter dem Schnee darauf warteten, die Welt in ihre Farben zu tauchen? Ach, Lukrez! Wohin sind deine Zeilen verschwunden? Erneut wandte Poggio den Blick, diesmal bergan. Dort oben gab es ein Kloster voller kostbarer Bücher. Er wischte sich mit dem Lederhandschuh über das Gesicht, ließ sein Pferd antraben und folgte den frischen Spuren von Oswalds Pferd im dichten Schnee.
Kapitel 3
Rasch holte Poggio zu Oswald auf. Der Tiroler saß regungslos auf seinem erstarrten Pferd. Als Poggio näher kam, grunzte er, ohne sich umzudrehen. »Vor uns liegt der Grund dafür, dass die Bibliothek dieses Klosters seit Jahrhunderten unangetastet geblieben ist.«
Poggio beugte sich vor. Von einem Grund konnte keine Rede sein, denn der war nicht zu sehen. Rechts und links waren die Baumstämme zurückgewichen. Vor den Hufen der Reittiere brach das Gelände jäh ab. Eine garstige Kluft gähnte den Männern entgegen. Ihren Boden sprenkelten Bäume, von hier oben sahen sie winzig aus und grün wie die Körner ungereiften Hühnerfutters. Die gegenüberliegende Seite war nicht weiter als fünfzehn Fuß entfernt. Ein Pferd hätte darüber hinwegspringen können. Doch war das unmöglich, denn dort drüben wuchsen die Bäume Stamm an Stamm. Dennoch gab es einen Weg hinüber: eine kleine Holzbrücke, die sich über die Schlucht spannte und sich starrsinnig an die schwarzen Felsen klammerte. Sie schien eilig aus zwei nebeneinanderliegenden Brettern und armdicken Seilen zusammengebastelt worden zu sein. Eis überzog die gewagte Konstruktion.
So tief wie der Abgrund war auch die Verlassenheit, die auf dem Ort lastete. Poggio wollte etwas sagen, doch die Kälte lähmte seine Zunge. Erst im zweiten Versuch gelang es ihm, Worte hervorzubringen. »Wenn du schon einmal bei dem Kloster gewesen bist, Wolkenstein, wieso weißt du dann nichts von dieser Schlucht?«
Oswald öffnete den Mund, aber seine Worte erstarben in einem Winkel der Zeit. Gut, dachte Poggio, immerhin wird er jetzt nicht wieder anfangen zu singen. Er knetete Blut in seine Beine und schwang sich vom Pferd. Das Leder seines Sattels knarrte. Sofort bedeckten Schneeflocken die Sitzfläche. »Wenn wir hier Wurzeln schlagen, wird uns der Schnee unter sich begraben, und man wird uns erst im Frühjahr finden«, rief er Oswald zu.
»Du willst doch nicht etwa dort hinüber?«, fragte der Tiroler und molk die Zügel.
Eine Krähe flog unter der Brücke hindurch und verspottete die beiden Männer mit einem lang gezogenen Schrei.
Poggio näherte sich dem Rand der Kluft, kniete nieder und tastete mit der Hand über die Bretter. In Eis gegossen wirkten sie fest und sicher. Doch unter dem glänzenden Überzug mochte das Holz morsch sein und tückisch.
»Jedenfalls nicht mit den Pferden«, gab Poggio zurück. Insgeheim hoffte er, Wolkenstein werde seiner Furcht nachgeben und umkehren. Dann würde Poggio das Skriptorium für sich allein haben und es nach alten Texten durchsuchen können, ohne auf seinen diebischen Begleiter aufpassen zu müssen.
»Ich sage: Wir kehren um!« Das sollte wohl wie ein Befehl klingen. Doch der tiefe, selbstsichere Bass war aus Oswalds Stimme verschwunden. Seine bartlosen Wangen bebten.
Schnee senkte sich auf Poggios Lider wie feiner Staub. Er blinzelte zu seinem Begleiter hinauf. Die Worte flogen wie von selbst aus seinem Mund. »Zurück nach Konstanz geht es dort entlang. Reite einfach bergab.«
Oswalds Gesicht sah aus wie entzündet. »Damit du überall herumerzählen kannst, ich sei ein Feigling? So seid ihr Florentiner. So krumm von Sitten wie von Gestalt.« Zu Poggios Erstaunen schwang sich der Tiroler nun ebenfalls vom Pferd und führte beide Tiere in den Wald.
»Lass sie frei laufen, sonst erfrieren sie«, rief Poggio ihm hinterher. Dass der Rappe und der Schimmel noch da sein würden, wenn sie zurückkehrten, glaubte er allerdings kaum. Doch zunächst einmal, dachte er und wandte sich wieder der Brücke zu, muss uns der Hinweg gelingen.
Poggio betrat als Erster den elenden Steg. Er war von hagerer Gestalt, ein leichter Mann. Nur der Beutel an seinem Gürtel wog schwer. Darin klapperte sein kostbarster Besitz. Eher würde er in den Tod stürzen, als sich davon zu trennen.
Er setzte seinen Fuß auf die zuvorderst liegende Holzbohle. Auf dem vereisten Brett verkrustete eine Schicht Schnee. Weder Mensch noch Tier hatten seit geraumer Zeit Spuren darauf hinterlassen.
Mit beiden Händen griff Poggio nach den Seilen. Ein Windstoß fuhr heulend durch die Kluft und fegte ihm das Barett vom Kopf. Der rote Samt trudelte in die Tiefe. Sanft wiegte sich die Brücke im Wind. Poggio spürte ein Ziehen in den Waden und den Drang hinabzuschauen. Doch er zwang sich, seinen Blick und seine Aufmerksamkeit auf einen Punkt am anderen Ende des Übergangs zu richten. Da sah er auf der anderen Seite Florentina da Pistoia zwischen den Bäumen hervortreten. Sie war noch immer ein Kind, trug dieselben Kleider aus hellblauem Taft wie an jenem Morgen in dem kleinen toskanischen Dorf. Auch ihre hochmütige Miene war noch dieselbe. Sie öffnete den Mund und war im Begriff, sich mit der Zunge über die rot geschminkten Lippen zu fahren.
»Tu das nicht!«, rief Poggio. Ehe er es sich versah, war er auf die Brücke hinausgetreten. Er lief über die sich senkenden Bohlen. Die letzte Strecke rutschte er vorwärts, ließ mit einer Hand das Seil fahren und streckte die Finger nach Florentina aus. Doch die Erscheinung zog sich in den Schutz der Bäume zurück. Bevor Poggio festen Boden erreichte, war sie verschwunden. Er glitt aus und krabbelte auf allen vieren zu der Stelle, an der Florentina soeben noch gestanden hatte. Sie war fort!
»Bist du von Sinnen, Italiener?« Oswalds Stimme wehte zu ihm herüber. Noch einmal schaute Poggio sich zwischen den Bäumen um. Er musste sichergehen, dass es nur ein Trugbild gewesen war, eine Luftspiegelung seines Geistes, ein Traum. Noch einmal glaubte er, hinter einer vom Frost gespaltenen Föhre etwas Blaues aufscheinen zu sehen. Doch als er auf den Ort zusprang, lag der Schnee dort unberührt. Wenn er einem Spuk aufgesessen war, so hatte dieser ihm immerhin auf die andere Seite der Schlucht geholfen.
Kurz überlegte Poggio, ob er Oswald von der Überquerung abraten sollte. Wolkenstein war ein schwerer Mann, darin geübt, Humpen zu heben, auf einem Schemel hockend Fleisch zu kauen und den Weibern ins Mieder zu singen. Auf vereisten Brettern über einen Abgrund zu balancieren, während der Wind an seinen Kleidern riss, gehörte gewiss nicht zu seinen Talenten.
Poggio legte die Hände an die Wangen und rief: »Es ist zu gefährlich, Oswald! Bleib zurück!«
Doch wenn er geglaubt hatte, den Tiroler damit zurückhalten zu können, so hatte er sich getäuscht. Wolkenstein stellte sich auf das Brett und schob sich langsam vorwärts. Dabei wagte er es nicht, seine Füße zu heben. Die hochgebogenen Spitzen seiner nassen Lederschuhe pflügten über die Brücke und schoben Schnee vor sich her. Flocken rieselten in die Tiefe.
»Nicht den Schnee!«, schrie Poggio. »Er gibt dir Halt.«
Doch Oswald hatte das Eis bereits freigelegt. Zum Dank schnappte es nun nach seinen Füßen. Wolkenstein schlupfte über das Brett. Zu spät entschloss er sich, die Brücke doch nicht überqueren zu wollen, und taumelte rückwärts. Dabei verlor er endgültig das Gleichgewicht. Im Sturz ließ er sich auf die Seile fallen. Es gab ein krachendes Geräusch, aber die Konstruktion hielt. Jedenfalls für den Moment.
Poggio sprang so nah wie möglich an die Brücke heran. Zu Wolkenstein hinauszugehen, wagte er nicht. Die Bretter trugen einen einzelnen Mann, sogar einen wie Oswald. Zwei aber mochten die im Frost hart gewordenen Seile zum Reißen bringen. Poggio streckte Wolkenstein eine Hand entgegen, aber der war zu weit entfernt. Drei Armlängen voraus klammerte sich der Tiroler an die Seile und starrte in den Abgrund.
Erneut fegte der Wind durch die Schlucht und ließ die Brücke schaukeln.
»Kehr um!«, rief Poggio und begleitete seine Worte mit entsprechenden Gesten, die, so hoffte er, Wolkenstein den Weg zurück in Sicherheit weisen würden. Doch der Tiroler kniete auf den Bohlen und hielt sich an den Seilen fest wie ein Seemann auf einem sinkenden Schiff.
Poggio schnaubte. Noch einmal rief er dem Regungslosen zu, er möge die Brücke verlassen. Diesmal schaute Oswald zu ihm herüber. Allerdings bewegte er dabei nur das Auge, der Kopf saß unbeweglich auf dem Hals. Oswalds Lippen formten ein einziges lautloses Wort.
Poggio schickte ein aufmunterndes Nicken zu ihm hinüber. Dann ließ er seinen Beutel in den Schnee gleiten und trat mit leisem Schritt auf die Bohlen hinaus. Fest packte er die Seile. Unter seinen Händen klimperten Eiszacken. Diesmal trieb ihn nicht die Vision eines Mädchens zu unerschrockener Eile, diesmal kroch er auf einen furchtsamen Junker zu. In den Schenken von Konstanz war Oswald dafür berüchtigt, mit seinen Abenteuern als Kreuzritter zu prahlen. Jetzt fragte sich Poggio, wie dieses Häuflein Mann gegen einen Heerbann Sarazenen bestanden haben sollte. Die Wahrheit, dachte er, wohnt auf einer morschen Brücke über dem Abgrund unserer Lügen.
Unter seinen Füßen knarrten Holz und Seilwerk. Der Schnee auf den Bohlen war nun, da Poggio zum zweiten Mal hinüberging, festgetreten und bot weniger Halt. Mit jedem Schritt bog sich die Brücke weiter durch. Als er in der Mitte angekommen war, hatte sich der Übergang so tief abgesenkt, dass er aufblicken musste, um den gegenüberliegenden Rand zu erkennen. Er bekam den Gürtel des Tirolers zu fassen und zog ihn zu sich heran. Nun hockten sie beide in der Mitte des Übergangs.
Poggio legte Oswald eine beruhigende Hand auf den Rücken. Durch seine Handschuhe spürte er, wie der andere zitterte. Sonst rührte Wolkenstein sich nicht. Unverwandt starrte er zwischen den Seilen hindurch in die Tiefe.
»Oswald!« Poggio zögerte, den Minnesänger anzustoßen. »Wir müssen weiter.«
Wolkenstein schüttelte fast unmerklich den Kopf. »Unsere Zeit ist abgelaufen. Erkennst du es nicht?«
Immerhin hatte er sich bewegt.
»Vorwärts!« Poggio rief das Wort auf Deutsch. Er hatte es von den Kutschern gelernt, die den Papst nach Konstanz gebracht hatten. Doch was für das Gespann eines Kirchenfürsten gut war, verpuffte wirkungslos an den Beinen eines Minnesängers. Oswald rührte sich nicht.
Vielleicht musste er nur erkennen, wie einfach der Weg zu passieren war, dann würde er sein Mütchen sammeln und es selbst versuchen. »Schau nur herüber!«, rief Poggio und versuchte, ermunternd zu klingen. Als er Wolkensteins Aufmerksamkeit gewiss war, wagte er zwei leichtsinnige Schritte in Richtung Sicherheit. Es sollte eine Demonstration von Leichtigkeit sein, ein Tänzeln über dem Rachen des Todes. Doch mittlerweile waren auch Poggios Korksohlen vom Schnee verklebt. Er glitt aus. Zwar griff er flugs nach den Seilen und hielt sich fest. Oswald aber hatte das Manöver verfolgt und war nun erst recht wie versteinert. Zerknirscht dachte Poggio an das Gleichnis von den Fischen, die übermütig an Land gesprungen waren und zu ersticken drohten – wenn ihnen nicht rechtzeitig die Flut zu Hilfe kam.
Wenn er mit Taten nicht weiterkam, so sollten Worte seine Flut sein.
»Oswald, wenn du dort hängen bleibst, wirst du erfrieren«, sagte Poggio. »Es sind nur fünf Schritte. Fünf Schritte braucht man, um vom Konstanzer Münster zur Schenke zu gehen. Das gelingt dir sonst spielend.«
Aber in Oswalds gefrorene Gedanken schien sich das Bild einer warmen Taverne nicht hineinschmelzen zu wollen. Der Junker hockte da wie erstarrt. Poggio zog sich die Seile entlang in Sicherheit. Mit einigem Schlindern erreichte er festen Boden. Von dort richtete er wieder das Wort an Wolkenstein.
»Ich werde in der Stadt nichts davon erzählen. Aber wenn du hier oben erfrierst«, er vermied es bewusst, vom Abstürzen zu reden, »muss ich natürlich davon berichten. Willst du etwa der Narr in einem Spottlied sein, das noch deine Kindeskinder singen werden?«
Oswald bewegte die Lippen.
»Was sagst du?«, rief Poggio hinüber.
»Ich habe keine Kinder.« Wolkenstein sprach die Worte gerade so laut, dass Poggio sie verstehen konnte.
»Dann willst du hier sterben, ohne Erben zu hinterlassen? Ich habe dich für einfältig gehalten, Oswald. Aber dass du so dumm bist, hätte ich nicht gedacht.«
»Ich bin nicht dumm!« Oswald sprach stockend. Aber seine Stimme war lauter geworden.
»Warum singst du dann Lieder, die von nichts anderem zeugen als von der Einfalt ihres Dichters?« Poggio musste nicht lange über die Worte nachdenken. Den gesamten Tag lang hatten sie in ihm gegoren. Jetzt sprang der Korken wie von selbst heraus.
»In Konstanz äffen dich die Kinder nach. Die Hübschlerinnen stolzieren herum und geben den einäugigen Sänger mit der krummen Stimme zum Besten.« Poggio rief sich die Weise ins Gedächtnis, mit der Oswald ihn den gesamten Weg über gequält hatte. Dann warf er sich in die Brust, stellte einen Fuß affektiert nach vorn, schwang den rechten Arm und sang so schief, wie es ihm möglich war, Oswalds deutsche Verse:
»O Welt, o Welt, ein Freud der kranken Mauer,
Wie schwer du bist! Dein Lohn, der wird mir sauer.«
»Sei still!« Der Tiroler zitterte jetzt sichtbar. Nicht mehr nur vor Kälte, hoffte Poggio.
»Blablablabla«, plärrte er die einfache Melodie weiter.
»So geht es nicht!«, rief Wolkenstein. »Der Text lautet …«
»Das soll ein Text sein?«, gab Poggio zurück. »Deine Worte sind so stumpf wie du selbst.« Erneut hob er an zu singen, diesmal erfand er etwas zu der furchtbaren Weise hinzu:
»O Welt, o Welt, O swald, O swald
Stampf und tob und knirsche,
Doch ich sing’ und tanze.«
»Du Schweineknecht!«, brüllte Oswald jetzt von der Brücke herüber. »Ich schlage dir den Schädel mürbe!«
»Richtig müsste es heißen: ›Ich werde dir den Schädel mürbe schlagen.‹ Nicht einmal mit deinem Latein ist es weit her. Von deiner Dichtkunst will ich nicht mehr reden. Deine Zunge ist ein unbeholfener Klump, Oswald von Wolkenstein.«
Der Tiroler kam auf die Beine. Seine Rechte fuhr an die Hüfte, wo sein Dolch am Gürtel hing. Er zückte die Waffe. Die Bewegung brachte die Brücke wieder zum Schwingen. Doch Wolkenstein schien das nicht länger zu bemerken.
»Ich will mein Messer im lauen Blut deines Herzens färben, Florentiner.« Oswald walzte auf Poggio zu. Schon war der Tiroler über die Brücke gelaufen. Er prallte gegen Poggio. Die beiden Männer gingen zu Boden. Alles an Wolkenstein war hart. Poggio umschlang seinen Gegner mit beiden Armen. Wolkensteins Messerarm wurde ihm an den Leib gepresst. So rollten sie ein Stück auf den Abgrund zu. Dann erschlaffte der Tiroler. Oswalds Atem wehte heiß in Poggios Ohr. Die Schultern des schweren Mannes zuckten. Weinte Oswald etwa?
Poggio schob sich unter der massigen Gestalt hervor. Drei Fuß entfernt ging es steil in die Tiefe. Kurz erlaubte er sich, zu Atem zu kommen. Dann fasste er Oswald unter dem Arm und zog ihn vorsichtig von der Kante weg. Diesmal ließ es der Junker zu. Tatsächlich sah Poggio die Spuren heißer Tränen, die sich in das vom Frost erbleichte Gesicht hineingeschmolzen hatten. Er fühlte zwar kein Mitleid mit dem Mann, aber die Erleichterung, die ihn überkam, war so tief wie der Abgrund, dem sie beide soeben entronnen waren.
Mit zitternder Hand pflückte Poggio sein Bündel aus dem Schnee. »Wir ruhen noch einen Augenblick aus«, sagte er. »Dann finden wir dieses Kloster und schlagen uns auf Kosten der Mönche die Bäuche voll.«
Kapitel 4
Die beiden Männer stiegen höher. Zwar hatte das Schneetreiben aufgehört, doch war der schmale Weg bis zu den Waden verschneit. Mehr und mehr ließ der Marsch bergan Poggio die Stirn heiß und die Beine müde werden. Oswald erging es nicht besser. Geschunden an Leib und Seele musste der schwere Tiroler immer wieder ausruhen, um auf seine Knie gestützt zu Atem zu kommen. Als der Wald endete, fanden sie sich zwischen Steingewürfel aus Basalt wieder. Der späte Himmel riss auf, und Lichtschwingen bestrichen das Gebirge. Ein feuchter Mond hing schon über den Graten und Zacken. Da sahen sie das Kloster.
Ein grauer Block mit spitzen Bögen und Giebeln duckte sich unter eine Felswand. Im schwindenden Licht waren Berg und Bauwerk kaum voneinander zu unterscheiden. Poggio kniff die Augen zusammen. Obwohl die Fassade Elemente des gotischen Stils aufwies, fehlte ihr jene Leichtigkeit, die solchen Bauwerken sonst zu eigen war. Poggio hatte schon die Kathedralen in St. Denis, Reims und zuletzt in Konstanz bewundert. Sie hatten ihren Besucher heiter dazu eingeladen, sie zu betreten und zu bestaunen. Hier jedoch herrschten Ernst und Abweisung. Die Dächer waren tief über die Mauern gezogen wie Kapuzen über die Gesichter von Finsterlingen. Wo Schnee gegen die grauen Wände geweht war, hatte er nasse, schwarze Flecken hinterlassen, die Poggio an die schrundige Haut eines Siechen gemahnten. Verschwindet!, war mit unsichtbarer Farbe auf die Mauern geschrieben. Poggio nahm sich vor, dieser Aufforderung so schnell wie möglich nachzukommen. Doch zuerst würden sie durch die winzige Pforte eintreten, sich wärmen, essen, ruhen und das Skriptorium in Augenschein nehmen.
»Du hast wohl geglaubt, ich wüsste nicht, wohin wir gehen.« Ein Hauch von Selbstbewusstsein war in Oswalds Stimme zurückgekehrt.
Poggio schwieg. Seit dem Zwischenfall auf der Brücke hatte er bis auf knappe Rufe kein Wort mit Wolkenstein gewechselt. Er war müde. Seine Beine waren gefühllos geworden, und weil er sein Barett verloren hatte, schützte nur noch die Kapuze seines Umhangs dürftig seinen Kopf. Immerhin wusste er durch Oswalds Worte, dass seine Ohren noch funktionierten und nicht unterwegs erfroren waren.
»Vorwärts!«, drängte Oswald. »Dort liegt Sankt Fluvius. Nur noch ein kleines Stück.«
»Es dringt kein Licht aus den Fenstern«, sagte Poggio.
Wolkenstein wedelte unbestimmt mit der Hand. »Benediktiner! Die können auch im Dunkeln sehen.«
Poggio hoffte, dass sein Begleiter recht hatte. Wenn das Kloster hingegen aufgegeben war, würden sie eine kalte Nacht vor sich haben. Angewidert schob Poggio die Vorstellung aus seinen Gedanken, sich in dem kalten Gemäuer an den Leib Oswalds schmiegen zu müssen, um nicht zu erfrieren.
Kaum hatten sie sich wieder in Bewegung gesetzt, vernahm Poggio von fern ein Geräusch. Was er da hörte, erkannte er nicht gleich. Doch der Laut war an diesem Ort fehl am Platz. Oswald ging unbeirrt weiter. Poggio fasste ihn bei der Schulter. »Hast du das gehört?«
Der Tiroler warf ihm einen ratlosen Blick zu. »Was denn?« Dabei trat er von einem Fuß auf den anderen, sodass laut der Schnee knirschte.
»Schschsch!« zischte Poggio. Oswald blieb stehen. Die Männer lauschten.
Da war es wieder. Töne ritten auf dem Wind. Ein Fetzen Musik wehte herüber.
»Ein Vogel ist das nicht«, sagte Oswald. »Dann ist wohl doch jemand zu Hause.«
Der Laut kehrte zurück. Es gab keinen Zweifel. Eine Frau mit dunkler Stimme sang eine klagende Melodie.
»Sagtest du nicht, das Kloster werde von Mönchen geführt?«, wollte Poggio wissen.
Oswald griente. »Vielleicht habe ich mich geirrt. Was hast du gegen ein warmes Lager im Nonnenstift?«
Poggio wollte einwenden, dass sie in ein von Frauen geführtes Kloster erst gar nicht eingelassen würden. Bestenfalls würde man sie im Schweinepferch vor dem Tor nächtigen lassen und ihnen ein paar Essensreste über die Mauer werfen. Doch Oswald marschierte bereits weiter.
Als sie die Pforte erreichten, hatte die Nacht sie vollends umfangen. Der bronzene Türklopfer war angefroren und zwang die Männer, sich mit Schlägen gegen das Holz und lautem Rufen bemerkbar zu machen. Lange Zeit geschah nichts. Auch der Gesang hatte aufgehört. Schließlich klackte und quietschte etwas, und die Tür wurde mit einem schrammenden Geräusch aufgezogen.
»Pax vobiscum«, beeilte sich Oswald zu sagen. Er schlang die Arme schützend um seinen Leib.
Die Gestalt in der Tür blieb stumm. Sie trug eine Öllampe in der Hand. Das Licht schien auf einen Mann von kräftiger Gestalt. Er trug die dunkle Kutte der Benediktiner. Im dämmrigen Schein wirkte sein Gesicht so dunkel wie die Stümpfe seiner Zähne, die er beim Sprechen entblößte. Seine Tonsur war längere Zeit nicht rasiert worden, und seine Haare hingen ihm über die Augenbrauen.
»Was wollt ihr hier?« Die Stimme knirschte wie Geröll unter den Sohlen.
»Wir sind Wanderer, die sich im Gebirge verirrt haben«, hob Oswald an, »und suchen Unterschlupf, bis sich das Wetter gebessert hat. Habt ihr zwei Lager frei und vielleicht etwas zu essen? Wir bezahlen natürlich.«
Der Pater schaute über Oswald hinweg und blickte in den Himmel. »Es schneit nicht mehr. Der Mond scheint hell. Ihr werdet den Weg hinab leicht finden.«
»Aber wir sind erschöpft. Überdies müssten wir bei Nacht über den gefährlichen Steg gehen«, entgegnete Oswald.
Der Mönch starrte Oswald einen Moment lang an, als sei dieser aus einem Zauberwald vor die Klosterpforte getreten. Die Brauen des Geistlichen hoben sich, wodurch seine Haare auf seine Nase herabsanken. »Ihr seid über das kleine Höllenloch gekommen?«
»Wie sonst sollten wir hierhergelangt sein?«, fragte Oswald. »Fliegen können wir ja nicht.«
»Das kleine Höllenloch hat seit Jahren niemand mehr passiert«, sagte der Geistliche. »Ich hätte nicht gedacht, dass der Steg überhaupt noch vorhanden ist.« Er räusperte sich. »Der Pfad zum Kloster verläuft dort im Westen und windet sich ruhig und sicher zum See hinab. Wir Mönche halten ihn frei, damit unsere Ochsengespanne ihn befahren können.« Er schüttelte den Kopf. »Das kleine Höllenloch«, sagte er zu sich selbst.
Liebend gern hätte Poggio Oswald einfach zurückgelassen und wäre den Berg hinabgestürmt. Doch trug er selbst Schuld an ihrem Irrgang. Warum hatte er sich einem einäugigen Tiroler anvertraut?
Oswald ließ sich von der Abweisung des Mönches nicht beirren. »Wir sind keine einfachen Wanderer. Ich bin Oswald von Wolkenstein, der letzte Minnesänger. Wenn ihr uns Unterschlupf gewährt, werden wir für euch Mönche …«
»… Bücher illuminieren«, ergänzte Poggio, bevor Oswald mit dem Angebot, seine Lieder zum Besten zu geben, alles verdarb. Von seinen Besuchen in den Klöstern von Sankt Gallen, Reichenau und Cluny wusste Poggio, dass es unter den Mönchen zwar fleißige Kopisten gab, die tagein, tagaus Pergamente abschrieben. Buchmaler aber, welche die Texte mit Heiligenbildern, goldenen Initialen und Ornamenten zum Leben erweckten, waren selten. Jetzt hoffte er, dass in diesem entlegenen Felsenstift Illuminatoren so begehrt waren wie Dirnen im Kreuzfahrerlager.
Der Blick des hochgewachsenen Mönchs fiel auf Poggio herab. »So etwas können sich nur reiche Klöster leisten. Wir haben kein Geld«, sagte er.
Poggio setzte nach: »Meine Bezahlung ist ein Blick in eure Bibliothek. Ich suche alte Schriften. Finde ich welche, würde ich sie gern abschreiben.«
»Aber das dauert Monate«, wandte der Benediktiner ein.
»Nicht in diesem Fall. Die Texte der Antike sind nur in Fragmenten erhalten. Wisst ihr vielleicht davon? Gibt es alte Schriften in eurem Skriptorium? Abgeschabte Seiten? Brüchige Papyri?«
»Davon weiß ich nichts. Aber einen Illuminator hatten wir schon seit Jahren nicht mehr hier.«
»Ein Blick in eure Bücher würde mir als Preis für meine Arbeit genügen – selbst dann, wenn darin nicht das zu finden sein sollte, was ich suche«, sagte Poggio.
»Und für Essen und ein Nachtlager bezahlen wir«, beeilte sich Oswald zu sagen.
Der Mönch gab die Tür frei. »Ich bin Abt Emilius. Tretet ein in Demut! Pax vobiscum.«
*
»Der gehört ans Kreuz geschlagen!«, brüllte jemand auf Italienisch. Poggio fuhr von seinem Lager auf. Unter seinen Händen knisterte trockenes Stroh. Das Ziegenfell, das ihm Abt Emilius gegeben hatte, glitt zu Boden. Woher war der Ruf gekommen?
Nachdem der Abt die beiden Männer in das Kloster eingelassen hatte, waren sie ihm eilig durch ein Gewirr von menschenleeren Korridoren gefolgt. Sämtliche Brüder schienen bereits zu schlafen. Wer also hatte da gerufen? Noch dazu in Poggios Muttersprache? Auf dem Gang vor der ärmlichen Zelle war nichts zu hören. Da erst erkannte Poggio, dass ihn ein Traum genarrt hatte, ein Nachtgesicht, wie es ihn manchmal heimsuchte. Kurz überlegte Poggio, ob er aufstehen und bis zum Morgen in den leeren Gängen umherwandern sollte. Doch der Weg den Berg hinauf hatte seine Kräfte aufgezehrt. Zudem war es verlockend, sich unter dem warmen Ziegenhaar in den Schlaf zurücksinken zu lassen. Vielleicht würde er jetzt von etwas anderem träumen. Vom sauren Ratzemann vielleicht, dem Wein, der nur in den kältesten Wintern gedieh. Von frischem Hering und von Lerchenzungen. Und vom scharfen Geschmack auf der Haut Florentina da Pistoias.
Kaum aber hatte er die Augen geschlossen, hing das Gesicht Tolomeos über ihm. Und die Hände, die immer wieder auf Poggios Kopf niedersausten. Tolomeo war ein Landpächter, wie er im Buche stand – welches er aber niemals hätte lesen können. Er war so ungebildet wie aufbrausend, ein mottenfarbiger Alter, der Lust gewann, wenn er am Abend seine Knechte durchprügelte.
Stundenglas
Poggio war zwölf Jahre alt und arbeitete auf den Feldern bei Arezzo. Sein Vater unterhielt eine Apotheke in der Stadt. Doch das Geschäft ging schlecht, und so hatten Poggios Eltern ihren ältesten Sohn aufs Land schicken müssen. Dort sollte er sich selbst den Unterhalt verdienen. Dass ihn das um ein Haar das Leben gekostet hätte, haben sie niemals erfahren.
Tolomeo erwischte Poggio regelmäßig. Am Abend, wenn die fünf Knechte des Hofes erschöpft von der harten Feldarbeit auf ihre Strohlager sanken, stand plötzlich Tolomeo in der Tür des Schuppens. Er schrie, bis den Jungen die Trommelfelle schmerzten, schimpfte sie Taugenichtse und Faulenzer. Sie allein seien schuld daran, dass er am Monatsende die Pacht nicht zahlen könne, behauptete er. Nachdem er einen Wasserfall toskanischer Flüche erbrochen hatte, packte er einen der Knechte bei den Ohren und schleifte ihn hinaus auf den Dreschplatz. Dort stand schon der Prügelstuhl bereit, ein schartiger Schemel, über den sich die Knaben zu beugen hatten, wenn Tolomeo ihnen den Hintern versohlen wollte, und auf den sie sich setzen mussten, wenn die Schläge ihr Gesicht treffen sollten. »Man kann einen schläfrigen, faulen Knaben mit einer Prügelsuppe laben«, schrie Tolomeo immer wieder, während seine Hand auf Poggios Gesicht oder Gesäß den Silben den Rhythmus schlug. Schon nach zwei Monaten auf Tolomeos Gehöft hatte Poggio mehr Schläge eingesteckt als bei seinen Eltern in seinem ganzen Leben. Er war in der Hölle gestrandet, und wenn er morgens auf die Felder ging, sah er auch so aus.
Seine zerrissenen Kleider und die Prügelflecken in seinem Gesicht erregten das Mitleid seiner Mitmenschen. Humpelte er, von Schmerzen geplagt, hinter Tolomeos Karren her, um die Feldfrüchte zu Markte zu bringen, starrten ihn die Mädchen des Dorfes sorgenvoll an. Eines Tages kam eine junge Frau nah heran und reichte ihm einen Krug Wasser. Damit schien ein Damm zu brechen. In der nächsten Woche schob eine zarte Hand Poggio ein Küchlein aus Mandeln zu. Eine andere strich ihm über das struppige schwarze Haar. Aufmunternde Worte erfrischten seine Ohren. Tolomeo auf seinem Karren bemerkte von alldem nichts.
Bald begriff der Knabe: Es war nicht Mitleid allein, dem er die Gunst der Mädchen verdankte. Unter dem Schmutz hatte er begonnen, zu einem jungen Mann heranzuwachsen. Seine Schultern strafften sich, seine Wangenknochen traten hart aus dem zuvor runden Gesicht hervor, und an seinen Händen und Armen schlängelten sich Adern dicht unter der Haut.
Es gelang Poggio, die flüchtigen Bekanntschaften mit den Dorfschönheiten zu vertiefen. Kaum war Tolomeo mit den Einnahmen des Tages im Wirtshaus verschwunden, traf der junge Knecht Lucia beim Brunnen, Constanza bei den Ställen und Emilia hinter der Sägemühle. Ihre schwieligen Hände drückten hart gegen seinen Leib, und der Geruch ihres Schweißes duftete noch am Abend aus seinen Lumpen hervor und half, die Prozedur auf dem Prügelstuhl zu erdulden.
Poggio gefiel das Leben als Prügelknabe, Bauersknecht und Herzensschmelzer. Zumal den alten Tolomeo nach und nach die Kraft verließ. Allmählich fielen die Stürme der Gewalt zu lauen Lüftchen zusammen. Bald waren die Schläge nur noch matte Versuche, Herr von fünf immer kräftiger werdenden Knechten zu sein. Tolomeo schrumpfte, und Poggios Angst vor ihm wurde zum Zwerg.
Aber die Mädchen! Jeden Monat schienen sie schöner zu werden, und das Begehren des Knaben wuchs mit seinem Körper. Poggio wurde ein Tagedieb. Nur stahl er niemandem die Zeit, sondern die Küsse junger Frauen unter der Bronzesonne der Toskana.
Es gab eine, die bewunderte er nur aus der Ferne. Florentina da Pistoia, die Tochter des Herzogs von Arezzo. Selbst mit seinen jungen Jahren wusste Poggio: Die heißen Hände der einfachen Mädchen waren Eisklumpen gegen das, was ein Kuss von Florentina für einen jungen Landarbeiter bedeutet hätte – den Scheiterhaufen.
Das Elend unerfüllter Liebe hielt Poggio umklammert. An Markttagen ritt der Herzog persönlich ins Dorf, saß zu Gericht und strich die Zölle ein. Seine Tochter begleitete ihn. Zunächst glaubte Poggio, das Mädchen wolle den anderen im Dorf zeigen, wer die Herrin sei. Denn niemals mischte Florentina sich unter das Volk, sondern sie blieb in der Nähe ihres Vaters. Doch was Poggio für Überheblichkeit gehalten hatte, erkannte er bald als Verzweiflung. Florentina war ein einsames Geschöpf. Sie hatte keine Geschwister und lebte mit ihren Eltern und der Dienerschaft in einem alten Gemäuer. Einst ein Schloss, war es jetzt nichts weiter als eine zugige Ruine, mehr vom Efeu zusammengehalten als vom Mörtel. Eines Tages würde die Schönheit der Herzogstochter dasselbe Schicksal erleiden.
Was für eine Schande! Florentina war das Abbild einer Göttin, und seit Poggio sie zum ersten Mal gesehen hatte, betete er sie an. Doch niemals, das wusste er, würde er den Olymp erklimmen, auf dessen Gipfel Florentina da Pistoia vor Einsamkeit verging. Da nutzte es wenig, dass er bisweilen nur fünf Schritte von ihr entfernt vorüberstrich.
Dann kam jener Tag, an dem Florentina da Pistoia an ihrer Unterlippe nagte.
Poggio nahm die Bewegung aus den Augenwinkeln wahr. Gerade versuchte er, der kichernden Maria den Knoten ihres Kopftuchs mit den Zähnen zu lösen. Halbherzig hielt Maria seine Handgelenke fest, sodass ihm nur der Mund blieb, um ihre Haare von dem Kopfschutz zu befreien. Doch Poggio sollte niemals ans Ziel gelangen.
Von ihrem Versteck unter dem Torbogen des Kirchhofs aus konnte Poggio den Marktplatz überblicken. Während seine Zähne am harten Stoff des Kopftuchs nagten und seine Zunge Bekanntschaft mit dem Salz auf Marias Haut schloss, waren seine Augen über ihre Schulter hinweg auf die Gestalt Florentinas geheftet. Deren Kleid aus hellblauer Seide schimmerte wie die Dämmerung eines Schirokkotages. Ihre Finger spielten mit ihrer Halskette. Sie schaute zu Boden. Hin und wieder verschwand ihre Unterlippe zwischen ihren Zähnen, um kurz darauf rot und glänzend aus dem Mund wieder hervorzukommen. Einen süßen Augenblick lang glaubte Poggio, Florentina wolle ihm ein Zeichen geben, damit er das Kopftuch Marias gegen ihren herzoglichen Mund eintauschen möge. Dann begriff er.
Die Tochter des Fürsten putzte sich heraus. Sie biss sich das Blut in die Lippen, damit diese rot und voll erblühten. Schon prangten sie auf ihrem blassen Antlitz wie ein königliches Siegel auf einem Bogen feinsten Kalbsleders. Mit einem Mal wusste Poggio, wie er aus den schattigen Verstecken der Dorfmädchen in den Schein von Florentinas Sonne treten konnte.
In den folgenden Tagen verwendete er jede freie Minute darauf, seinem Einfall Form zu geben. Dennoch dauerte es vier lange Wochen, bis es so weit war. Schließlich, an einem heißen Junitag des Jahres 1393, folgte Poggio Tolomeo wie immer zum Marktflecken. Er lief beschwingt wie nie zuvor. So schnell trugen ihn seine Füße vorwärts, dass er Beatrice, die altersschwache Eselin, überholte und der Bauer ihm zurief, endlich würden seine Schläge Wirkung zeigen. Aber es waren nicht die Hände Tolomeos, die Poggio Beine machten, sondern die Lippen Florentina da Pistoias.
Zugegeben: Er hatte Angst, dass seine Göttin der Einsamkeit ausgerechnet diesmal nicht im Dorf erscheinen werde. Doch als er und Tolomeo bei der Wassermühle um die Ecke bogen und der Marktplatz vor ihnen lag, glitzerte ihm die Seide ihres Kleides entgegen, und er stellte sich vor, dass sie in ihren Gedanken seinen Namen rief. Auch wenn sie den überhaupt nicht kannte.
An diesem Tag war Poggio ein König. Mit einer unsichtbaren Krone geschmückt hielt er Einzug im Dorf. An der zwinkernden Gracia, der winkenden Estrella und der lächelnden Maria schritt er hoheitsvoll vorüber. Als er sich dem dicht umlagerten Gerichtsstand näherte, rieb er seine schmutzigen Hände an seinen Lumpen sauber, richtete die Tunika, so gut es eben ging, und drängte sich durch die Menge. Tolomeo rief wütend hinter ihm her. Doch Poggio beachtete ihn nicht. Wenn sein Vorhaben gelang, würde ihn Florentina lieben und der Herzog ihn auf seine Burg holen. Dann würde es vorbei sein mit der rückenbrechenden Feldarbeit, den Hungernächten und dem Gebelfer des Pächters.
Auf der anderen Seite der Menge zwängte er sich hervor, verfolgt von den Flüchen der Wartenden. Eine zornige Hand stieß ihm in den Rücken. Er taumelte vorwärts und fiel in den Staub. Dieser Teil seines Vorhabens war misslungen. Aber nun hatte er das, was er wollte: die Aufmerksamkeit Florentinas. Zum ersten Mal sah sie ihn an. Verwundert, belustigt, verängstigt. Poggio bildete sich ein, Begehren in ihren Augen schimmern zu sehen.
Ermutigt stand er auf. Er fand sich auf dem einzigen Teil des Marktplatzes wieder, der gepflastert worden war. Der Herzog thronte vor der Wand eines großen Gebäudes auf dem Richterstuhl, flankiert von zwei Bütteln, und schüttelte eine beringte Hand über dem Kopf eines vor ihm knienden Mannes. Florentina war weit genug von dem Geschehen entfernt. Zwei Schritte ging er auf sie zu, langsam, so wie man sich einem scheuen Tier nähern würde. Dann holte er die Muschel hervor. Sie war so klein wie Florentinas Mund und ebenso zart. Die Muschelhälften waren noch miteinander verbunden. Dadurch ließ sich die Schale aufklappen wie ein Schatzkästchen. Und was für eine Kostbarkeit darin auf die Tochter des Herzogs wartete!
Poggio zupfte ein Stück Leinen aus seinem Gürtel hervor und breitete es im Staub aus. Der braune, von Motten zerfressene Stoff verwandelte sich in seiner Fantasie in ein Stück königsblauen Samt. Darauf platzierte er die Muschel. »Für Euch, Florentina!«, wollte er sagen. Doch aus seiner Kehle kam nur ein Krächzen. Dann zog er sich zurück und beobachtete, was geschah.
Die Neugier des Mädchens war geweckt. Sie warf verstohlene Blicke zu ihrem Vater und seinen beiden Schergen hinüber. Doch dort hatte niemand etwas bemerkt. Geschwind pflückte Florentina Poggios Geschenk vom Boden. Dann kehrte sie dem Treiben auf dem Marktplatz den Rücken zu, wohl um den Inhalt ungestört zu begutachten.
Die nun folgenden Lidschläge erschienen Poggio länger als die gesamte Zeit auf dem Prügelstuhl des Tolomeo. Würde Florentina erkennen, was er ihr gegeben hatte? Die Muschel war bis zum Rand mit Lippenrot gefüllt. Poggios Vater stellte es in seiner Apotheke in Arezzo her und hatte seinen Sohn das Rezept gelehrt. »Florentiner Lack« nannte er die Masse. Sie sah überhaupt nicht rot aus, sondern wie eine braune trockene Kruste. Doch auf den Lippen einer Frau erstrahlte sie in prachtvollem Karmesin.
Als Florentina sich wieder umdrehte, war sie verwandelt. Ihre Lippen strahlten roter als die Rosen der Daphnis, und als sie Poggio zulächelte, versank der Anbruch des Morgens vor Scham hinter dem Horizont. Zwar hatte sie den Florentiner Lack mit ungelenker Hand aufgetragen, sodass einige Flecken ihre Mundwinkel strichelten. Doch verfehlte das Geschenk seine Wirkung keineswegs. Weder bei Poggio noch bei der Herausgeputzten selbst.
Florentina nickte Poggio zu. Gewiss hätte sie ihm im nächsten Moment die Hand entgegengestreckt, damit er ihr einen Handkuss geben konnte – von dieser Sitte der vornehmen Leute hatte Poggio bereits gehört. Doch bevor sie ihre feingliedrigen Finger in seine Richtung ausstrecken konnte, fuhr Florentinas Zunge aus Florentinas Mund und leckte über Florentinas Lippen.
Da ging Poggios Sonne unter. Das liebliche Mädchengesicht verzog sich zu einer Grimasse. Ihre Miene, soeben noch die einer schönen Frau, zerfiel zu der kläglichen Fratze eines enttäuschten Kindes. Lautstark spie sie in den Sand, spie noch einmal. Dann erbrach sie sich auf ihr Seidenkleid.
Schon sprang der Herzog herbei und hielt seine Tochter in den Armen. Sie wand sich in seinem Griff und greinte, spie noch einmal. Zwei seiner Leibwächter nutzten die Gelegenheit, um sich mit gezückten Eisen vor Vater und Tochter aufzubauen. Auf eine Frage da Pistoias hin schüttelte Florentina den Kopf. Dann hob sie ihre rechte Hand und streckte sie gegen Poggio aus. Auf den zum Kuss bereiten Handrücken hatte er gehofft, stattdessen bekam er einen anklagenden Zeigefinger.
Bevor Poggio wieder in der Menge verschwinden konnte, packten ihn die Büttel. Schon stand er vor der schweren Gestalt da Pistoias. Dessen feindseliger Blick bohrte sich in Poggios Augen. Mit einer Stimme aus Brust und Kehle fragte der Herzog, was für ein Gift Poggio seiner Tochter verabreicht habe.
»Kein Gift, Herr!«, stotterte Poggio. »Florentiner Lack. Ein Geschenk.«
Etwas traf ihn in die Kniekehlen, und er ging zu Boden. Eine Stimme forderte ihn auf, die Augen gesenkt zu halten, wenn er mit dem Fürsten rede. Doch der Herzog schien anderer Ansicht zu sein. Seine wulstigen Fäuste packten Poggios Tunika und rissen ihn wieder auf die Füße – und noch etwas höher.
»Was fällt dem Knecht ein, meiner Tochter Geschenke zu machen?« Speichel sprühte von da Pistoias Lippen auf Poggios Gesicht, und er kniff die Augen zusammen. Die fürstlichen Fäuste quetschten seine Haut.
»Florentiner Lack ist Lippenrot«, presste Poggio hervor. »Das ist Schminke.«
»Hält er meine Tochter für eine Hure?«
Florentina war in der Zwischenzeit zum Brunnen gegangen und versuchte, ihren Mund sauber zu waschen. Das misslang jedoch so gründlich, dass ihr Gesicht nun mit blassrosa Streifen überzogen war. Ihr Mund hingegen war wund gerieben und glänzte in einer Farbe, die an eine schwärende Wunde erinnerte. Das Kunstwerk war dahin. Oh unglücksschwangere Sterne! Die Lust auf einen Kuss war Poggio ohnehin vergangen.
Er wusste nicht, ob der Herzog auf die Hurenfrage eine Antwort erwartete, beschloss aber, den Mund zu halten. Stattdessen paddelten seine Füße durch die Luft. Da Pistoia hielt ihn gnadenlos fest.
»Woraus besteht dieser Lack? Wenn du mich anlügst und meine Tochter stirbt, werde ich dir eigenhändig die Haut abziehen und dich damit auspeitschen.«