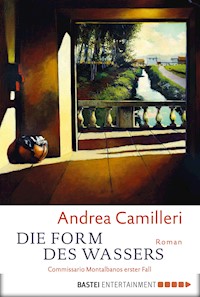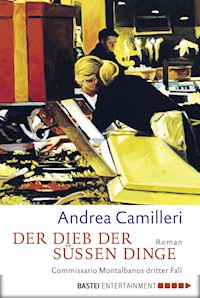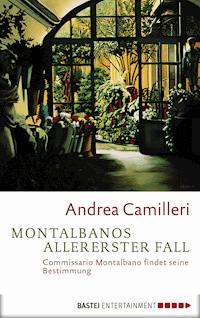Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
In Vigàta auf Sizilien soll das neue Theater eingeweiht werden. Der Präfekt hat dafür die drittklassige Oper ›Der Bierbrauer von Preston‹ ausgewählt. Ein Affront im opernverliebten Königreich Italien. Vigàtas Hitzköpfe machen daraufhin nicht nur die Obrigkeit lächerlich, sondern tun auch einiges dafür, dass die Premiere ein Reinfall wird. Am Ende geht sogar das neue Theater in Flammen auf. Herrliche Charaktere, intrigante Verwirrspiele, eine menschliche Komödie.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andrea Camilleri
Die sizilianische Oper
Roman
Aus dem Italienischen von Monika Lustig
FISCHER E-Books
Inhalt
Die Nacht war zum Fürchten
Die Nacht war zum Fürchten. Ein gewaltiger Donnerschlag brachte die Fensterscheiben zum Klirren und schreckte den knapp zehnjährigen Gerd Hoffer aus dem Schlaf. Im selben Augenblick spürte er, daß er dringend mußte. Das mit der schwachen Blase war eine alte Geschichte: die Ärzte hatten dem Knaben eine angeborene Nierenfunktionsstörung diagnostiziert, und Bettnässen war also etwas ganz Natürliches bei ihm. Doch sein Vater, der Bergbauingenieur Fridolin Hoffer, war auf dem Ohr taub: es ließ ihm keine Ruhe, einen solchen Nichtsnutz von deutschem Sohn in die Welt gesetzt zu haben. Er war der Meinung, daß hier keine medizinische Behandlung, sondern eine feste Hand zur Stärkung der Willenskraft angesagt sei. So machte er sich jeden von Gott gewollten Morgen daran, das Bett des Sohns zu untersuchen: er lüpfte die Decke oder das Leintuch, je nach Jahreszeit, ließ die inquisitorische Hand darunter gleiten… und stieß unweigerlich auf etwas Feuchtes. Darauf versetzte er dem Kind eine saftige Ohrfeige, auf daß die getroffene Wange anschwoll wie ein Klumpen Hefeteig. Um zumindest an diesem Morgen der Bestrafung durch die väterliche Hand zu entgehen, erhob sich Gerd in der Dunkelheit, die von Blitzen erleuchtet war, und machte sich tapsend auf den Weg in Richtung Abort. Das Herz schlug ihm bis zum Halse aus Angst vor lauernden Gefahren und Überraschungen auf seiner nächtlichen Wanderung. Einmal war ihm eine Eidechse die Beine hinaufgekrochen, und ein andermal war er mit nacktem Fuß auf einen Käfer getreten… Beim bloßen Gedanken an das glitschige Geräusch beim Zerquetschen drehte sich ihm heute noch der Magen um.
Am Abtritt angelangt, rollte er das Nachthemd bis zum Bauchnabel hoch und begann, Wasser zu lassen. Dabei blickte er wie immer durch das niedere Fenster in Richtung Vigàta und das Meer, einige Kilometer von Montelusa entfernt. Jedesmal geriet er in große Erregung, wenn er in der Ferne auf dem Wasser das schwache Licht einer Karbidlampe eines vereinzelten Fischerkahns auf Nachtfang gewahrte. Dann setzte mit einem Schlag eine Musik in seinem Kopf ein, Empfindungen ballten sich zusammen, die er nicht aus sich herausbrachte, seltene Worte kamen ihm in den Sinn und funkelten wie Sterne am tiefschwarzen Himmel. Schweiß trat ihm aus den Poren, und wenn er wieder im Bett lag, konnte er kein Auge schließen. Hin und her wälzte er sich, bis das Bettuch zu einem Strick geworden war. In einigen Jahren würde er Dichter und Schriftsteller sein. Aber noch ahnte er nichts davon.
In jener Nacht war es anders. Inmitten von Blitzen und Donnerschlägen, die ihn zugleich ängstigten und faszinierten, bot sich seinen Augen ein noch nie gesehener Anblick. Über Vigàta stand die Morgendämmerung oder etwas Ähnliches am Himmel, was mit absoluter Sicherheit nicht der Fall sein konnte und durfte. Hatte der Vater ihm doch mit teutonischer Genauigkeit bis in alle wissenschaftliche Einzelheiten erklärt, daß das Tageslicht auf der gegenüberliegenden Seite entstand, was vom großen Fenster des Speisesaals aus zu beobachten war. Er sah genauer hin. Da war kein Zweifel: ein rötlicher Halbmond bedeckte den Himmel über Vigàta, in seinem Widerschein waren sogar die Umrisse der Häuser zu erkennen, die oberhalb des Orts auf der Lanterna-Ebene standen.
Aus Erfahrung wußte er, wie gefährlich es war, den Vater aus dem Tiefschlaf zu wecken. Doch er befand, daß die Sache es dieses Mal wert sei. Zweierlei konnte nämlich der Fall sein: entweder war die Erdkugel es leid geworden, sich immer in dieselbe Richtung zu drehen, und hatte nun ihre Bahn geändert (bei dieser Vorstellung schwindelte ihm, dem geborenen Dichter und Schriftsteller, vor lauter Aufregung), oder sein Vater hatte ein einziges Mal seiner gewaltigen Unfehlbarkeit nicht entsprechen können (und diese Annahme brachte ihm, dem Sohn, den Kopf erst recht zum Glühen). Er lenkte seine Schritte hin zum väterlichen Gemach und war froh, daß seine Mutter nicht da war, sondern in Tübingen der Großmutter Wilhelmine zur Seite stand. Auf der Schwelle schon schlug ihm das ohrenbetäubende Schnarchen des Ingenieurs entgegen, eines einhundertzwanzig Kilogramm schweren und knapp zwei Meter großen Kolosses mit roten Stoppelhaaren und einem riesigen, ebenfalls roten Schnauzer. Er tippte den lärmenden Fleischberg an und zog schleunigst die Hand wieder zurück, als hätte er sich verbrannt.
»He?« machte der Vater, die Augen weit aufgerissen ob seines leichten Schlafs.
»Vater«, murmelte Gerd.
»Was ist denn? Was gibt’s?« fragte der Ingenieur und zündete ein Streichholz für die Lampe auf der Kommode an.
»Heute nacht kommt Licht aus Vigàta.«
»Licht? Was für ein Licht denn? Morgenröte?«
»Ja, Vater.«
Ohne eine Silbe zu sagen, bedeutete der Ingenieur dem Sohn, näher zu kommen, und einmal in Reichweite, verpaßte er ihm eine dröhnende Ohrfeige.
Der Bursche schwankte, hielt sich die Wange, ließ sich aber nicht beirren. Hartnäckig wiederholte er:
»Ja, Herr Vater, in Vigàta dämmert es.«
»Geh sofort auf dein Zimmer!« herrschte der Ingenieur ihn an, der sich niemals unter den vermeintlich unschuldigen Augen des Sohnes im Nachtgewand zeigen würde.
Gerd gehorchte. Es mußte schon etwas Seltsames geschehen sein, dachte der Ingenieur, während er sich den Hausrock überzog und zum Abtritt ging. Ein einziger Blick genügte ihm. In Vigàta war nicht die Morgenröte, sondern ein Brand, und zwar ein recht großer, ausgebrochen. Spitzte man die Ohren, war sogar das verzweifelte Glockengeläute einer Kirche zu hören.
»Mein Gott!« stieß der Ingenieur atemlos heraus. Freudengebrüll und Entzückensschreie nur mühsam zurückhaltend, kleidete er sich in fieberhafter Eile an, öffnete die Schublade des Schranks, zog eine große vergoldete Trompete mit Tragriemen heraus, stürzte aus dem Haus und vergaß sogar, die Tür hinter sich zu schließen.
Auf der Straße hob er zu einem langgezogenen Freudengewieher an und nahm die Beine unter den Arm. Endlich würde er Gelegenheit haben, das geniale Feuerlöschgerät einzuweihen, das nach seinen Entwürfen in langen Monaten hingebungsvoller Arbeit außerhalb der Arbeitszeit im Bergwerk entstanden war und das er patentieren lassen wollte. Es handelte sich um einen länglichen Handkarren ohne Seitenwände, auf dessen Tragfläche eine schwere Eisenplatte eingelassen war. Auf dieser Platte war eine Art riesiger Brennkolben aus Kupfer fest verankert, der mit einem zweiten, wesentlich kleineren Kolben verbunden war, unter dem sich ein eiserner, oben offener Kasten befand, der als Heizkessel diente. Der kleine, mit Wasser gefüllte Brennkolben – und das war der wunderbaren Erfindung Papins zu verdanken – produzierte kraft des lodernden Feuers unter sich so viel Druck, daß das kalte Wasser mit Wucht aus dem größeren Brennkolben herausschoß. An den großen Karren war ein kleinerer angehängt, der Brennholz und zwei zusammensetzbare Trittleitern mit sich führte. Das Ganze wurde von vier Pferden gezogen; die Mannschaft der freiwilligen Feuerwehr bestand aus sechs Leuten, die an den Seiten des großen Karrens standen. Der Ingenieur hatte seinen Platz an der Seite des Kutschers. Bei den Übungen und beim Probealarm hatte das Gerät bislang immer gut abgeschnitten.
Als Fridolin Hoffer die Straße quer durch das ehemals arabische Viertel Ràbato einschlug, wo jetzt Bergwerksleute und Schwefelgrubenarbeiter lebten, holte er tief Luft und stieß auf der Trompete einen ganz hohen Ton aus. Er ging die ganze Straße entlang und spürte vor Anstrengung den Schmerz in der mächtigen Brust, wenn er in die Trompete blies. Am Ende der Straße machte er kehrt und begann erneut zu trompeten.
Die nächtlichen Klänge hatten beinahe sofort Erfolg. Die Männer der freiwilligen Feuerwehr, die instruiert worden waren, was das unsanfte Wecken durch Trompetenstöße mitten in der Nacht zu bedeuten hatte, schlüpften schnell in ihre Kleider und beruhigten ihre zitternden, weinenden Ehefrauen und Sprößlinge. Dann eilte einer von ihnen, den Lagerraum aufzuschließen, in dem das Gerät aufbewahrt wurde, und der Kutscher sorgte dafür, daß die Pferde paarweise vor den Vierspänner gestellt wurden; ein dritter und vierter Mann machten Feuer unter dem kleinen Brennkolben
Die anderen Einwohner des dichtbevölkerten Viertels, völlig ahnungslos, was das alles zu bedeuten hatte, erschraken gehörig bei den Trompetenklängen, die das Jüngste Gericht zu verkünden schienen. In Windeseile und mit Geschrei, Gebrüll, Rufen, Weinen, Gebeten, Verwünschungen und Heiligenanrufungen verriegelten sie Haustüren und Fenster. Die dreiundneunzigjährige Nunziata Lo Monaco, unsanft aus dem Schlaf gerissen, setzte sich im Bett auf und war fest davon überzeugt, daß der Aufstand von 1848 wieder losging. Darauf verlor sie das Bewußtsein und kippte stocksteif nach hinten. Verwandte fanden sie bei Morgengrauen tot auf ihrem Lager und machten das schwache Herz und das hohe Alter dafür verantwortlich. Gewiß nicht das hohe C des Deutschen.
Als man mit den Vorbereitungen fertig war, hatte sich die Mannschaft um den Ingenieur geschart. Die Männer waren erregt und ergriffen ob der großartigen Gelegenheit, die sich ihnen bot. Der Ingenieur musterte einen nach dem anderen, hob den Arm und gab das Startzeichen. In Null Komma nichts waren sie auf dem Karren und brachen mit straffen Zügeln Richtung Vigàta auf. Hoffer stieß von Zeit zu Zeit in die Trompete, die er umgehängt hatte, vielleicht um Kaninchen oder Hunde in der Nähe zu warnen, gewiß keinen Christenmenschen, da zu nächtlicher Stunde und bei einem solchen Wetter keine Menschenseele unterwegs war.
Für den allein zurückgebliebenen Gerd war es eine merkwürdige Nacht. Als er hörte, daß der Vater aus dem Haus gegangen war, stand er auf, verriegelte die Haustür und zündete sämtliche Lichter an, um alles hell zu erleuchten. Dann stellte er sich vor den Wandspiegel im Zimmer seiner Mutter (der Ingenieur und seine Gemahlin schliefen in getrennten Zimmern, was im Ort großen Anstoß erregte und gewiß nicht den Sitten der Christenmenschen entsprach; im übrigen war niemand in der Lage zu sagen, welcher Religion der Deutsche und seine Frau angehörten), hob das Hemd hoch und begann seinen nackten Körper zu betrachten. Dann ging er ins väterliche Arbeitszimmer, nahm ein Lineal vom Schreibtisch, trat wieder vor den Spiegel, in dem man sich von Kopf bis Fuß sehen konnte, ergriff das Ding, das er zwischen den Beinen trug (wie hieß es wohl: Schwanz, Schwengel, Pimmel, Kolben?), und legte das Lineal an. Die mehrfach wiederholte Messung erbrachte jedesmal ein unbefriedigendes Ergebnis, obwohl er die Haut langgezogen hatte, bis es weh tat. Er legte das Lineal wieder weg und kehrte ins Bett zurück. Mit geschlossenen Augen begann er ein langes und ausführliches Bittgesuch an Gott zu richten, auf daß er ihm sein Ding durch ein entsprechendes Wunder so lang wachsen ließ wie das seines Banknachbarn Sarino Guastella, der genauso groß und schwer war wie er, aber eines hatte, das aus unerklärlichen Gründen viermal so lang und dick war wie das seinige.
Als der Ingenieur und seine Männer die Lanterna-Ebene oberhalb von Vigàta erreicht hatten, mußten sie entsetzt feststellen, daß das Feuer kein Kinderspiel war und mindestens zwei große Gebäude lichterloh brannten. Während sie dastanden und schauten und der Ingenieur überlegte, von welcher Seite er wohl am besten mit dem Gerät hinunterfahren sollte, um so rasch wie möglich die Flammen zu bekämpfen, sahen sie im flackernden Widerschein des Feuers einen Mann, der bedächtig einherschritt und von Zeit zu Zeit schwankte. Seine Kleidung war angesengt, und die Haare standen ihm zu Berge, ob vor Schreck oder der Haartracht wegen, war nicht zu erkennen. Er hatte die Arme in die Höhe gestreckt, als wollte er sich ergeben. Sie hielten ihn an. Aber sie mußten ihn zweimal rufen, bis er sie überhaupt hörte.
»Was sein passiert?« fragte der Ingenieur ihn in seinem teutonischen Italienisch.
»Wo?« erwiderte der Mann freundlich.
»Was heißt wo? In Figàta, was sein passiert?«
»In Vigàta?«
»Ja«, riefen alle wie aus einem Munde.
»Dort scheint es zu brennen«, sagte der Mann und blickte, wie um sich zu versichern, aufs Dorf hinunter.
»Aber wie ist gekommen? Wissen Sie?«
Der Mann ließ die Arme sinken, legte sie auf dem Rücken zusammen und betrachtete seine Schuhspitzen.
»Ja, wißt ihr das nicht?«
»Nein. Keiner hier wissen.«
»Ach, es heißt, der Sopran habe an einer bestimmten Stelle falsch gesungen.«
Nach diesen Worten setzte er seinen Weg fort, und seine Hände nahmen wieder die Haltung von zuvor ein.
»Was zum Teufel ist denn der Sopran?« fragte Tano Alletto, der Kutscher.
»Das ist eine Frau, die singt«, erklärte Hoffer und schüttelte sich vor Staunen.
Ein Gespenst geht um in Europa
»Ein Gespenst geht um in Europa, vor dem alle Musikanten zittern!« verkündete der Cavaliere Mistretta mit lauter Stimme und schlug mit der Hand heftig auf den kleinen Tisch. Allen Anwesenden war klar, daß mit Musikanten die Komponisten gemeint waren. Der Cavaliere handelte mit Saubohnen und war kein ausgesprochener Freund von Lektüre, doch beim Reden flackerten manchmal apokalyptische Bilder vor seinem geistigen Auge auf.
Seine laute Stimme und der heftige Schlag ließen die Mitglieder des Bürgervereins »Familie und Fortschritt« zusammenfahren, die nach über drei Stunden hitziger Diskussionen ziemlich nervös geworden waren.
Völlig anders hingegen war die Reaktion des Diplomlandwirts Giosuè Zito, der eine Viertelstunde zuvor eingenickt war, da er in der Nacht wegen starker Zahnschmerzen kein Auge zugetan hatte. So unsanft aus dem Schlaf geschreckt, klang ihm noch das Wort Gespenst im Ohr nach. Rasch ließ er sich auf die Knie nieder und begann, sich bekreuzigend das Glaubensbekenntnis zu beten. Das ganze Dorf wußte, daß der Landwirt drei Jahre zuvor in seinem Bauernhaus von einem Gespenst zu Tode erschreckt worden war, das ihn mit großem Kettengerassel und den verzweifelten Schreien eines zum Fegefeuer Verdammten von einem Zimmer ins andere verfolgt hatte. Als Giosuè Zito mit dem Beten zu Ende war, erhob er sich, immer noch bleich wie ein Leichnam, und richtete das Wort an den Cavaliere, wobei sich seine Stimme beinahe überschlug:
»Sie Gottloser, Sie dürfen sich in meiner Gegenwart nie wieder unterstehen, von Geistern oder Gespenstern zu reden! Wollen Sie das begreifen, ja oder nein, Sie kalabresischer Dickschädel?! Ich weiß nur zu gut, welchen Schrecken ein Gespenst verbreitet!«
»Sie, mein Lieber, wissen einen feuchten Kehricht.«
»Was fällt Ihnen ein?«
»Mir fällt das ein, was mir dabei einfallen soll«, erwiderte der Cavaliere Mistretta beleidigt.
»Erklären Sie besser, was Sie meinen.«
»Das weiß doch Hinz und Kunz, daß Sie in jener berühmten Nacht, mit der Sie der ganzen Welt bereits mehr als genug in den Ohren gelegen sind, von keinem Gespenst, sondern von dem großen Gehörnten, ihrem Bruder Giacomino, heimgesucht wurden. Er hatte sich mit einem Leintuch verkleidet, um Sie in den Wahnsinn zu treiben und sich so das gesamte väterliche Erbe unter den Nagel zu reißen.«
»Und was bedeutet das?«
»Was das bedeutet? Daß es kein Gespenst gab. Es war Ihr Bruder Giacomino, der herumgeisterte!«
»Aber einen Riesenschreck habe ich trotzdem gekriegt! Er hat auf mich wie ein echtes Gespenst aus Fleisch und Blut gewirkt! Fieber habe ich bekommen, vierzig Grad Fieber! Und Blasen auf der Haut! Deshalb hätten Sie aus Rücksicht ein anderes Wort benutzen können!«
»Welches denn?«
»Was weiß denn ich, Sie sprechen doch mit Ihren Worten, nicht mit den meinigen.«
»Sehen Sie, ich konnte und kann das Wort nicht ändern, es ist mir eben so in den Sinn gekommen. Ich finde jetzt so mir nichts dir nichts kein anderes.«
»Sie mögen mir verzeihen«, schaltete sich an dieser Stelle der Marchese Manfredi Coniglio della Favara wie immer höchst diplomatisch und von vornehmer Zurückhaltung ein, »aber wollen der verehrte Cavaliere uns freundlicherweise erklären, von welchem Gespenst er spricht?«
An dieser Stelle bedarf es einer Erläuterung. Dem Marchese Coniglio della Favara gebührte aufgrund seines Standes und seines Vermögens eigentlich ein Platz unter den Mitgliedern des »Zirkels der Adligen« von Montelusa – den er auch tatsächlich innegehabt hatte. Bis eines unheilvollen Tages im Vorjahr – es war der Ehrentag des heiligen Joseph – die Statue des Heiligen unter den großen Fenstern des Vereinssitzes vorübergetragen wurde. An einem der Fenster stand der Marchese Manfredi und verfolgte den festlichen Umzug. Das Unglück wollte es, daß der Baron Leoluca Filò di Terrasini, ein fanatischer Anhänger des Papstes und Laienbruder des Franziskanerordens, an seiner Seite Stellung bezog. Und genau in jenem Augenblick fiel dem Marchese auf – nie zuvor in seinem Leben hatte er einen Gedanken darauf verschwendet –, wie alt der heilige Joseph in Wirklichkeit schon war. So stellte er Mutmaßungen über den Altersunterschied zwischen Joseph und Maria an und beging den Fehler, seine Schlußfolgerung laut zu äußern:
»In meinen Augen war es eine Zweckheirat.«
Die Laune des Schicksals wollte es, daß dem Baron Leoluca just die gleiche Idee gekommen war. Höllenangst überfiel ihn ob seines gotteslästerlichen Denkens. Schweißgebadet begriff er bestens, was die Worte des Marchese bedeuteten.
»Wiederholen Sie doch, was Sie da gesagt haben, wenn Sie den Mut dazu haben.«
Herausfordernd blitzte der Marchese ihn an, und seine Augen glühten wie Kohlen, während er sich mit dem Zeigefinger den rechten Schnurrbart zwirbelte:
»Gewiß doch.«
»Warten Sie, ich warne Sie: was Sie sagen, kann Folgen haben.«
»Die Folgen sind mir scheißegal. Sehen Sie, mir scheint, daß der heilige Joseph einfach zu alt war, um es mit der Maria zu treiben.«
Mehr konnte er nicht sagen, denn blitzschnell hatte der Baron ihm auch schon eine geschmiert. Ebenso blitzschnell erfolgte der Fußtritt, den der Marchese nicht gerade vornehm dem Baron zwischen die Beine versetzte. Von der Wucht des Tritts niedergestreckt, hatte sich der Baron keuchend auf dem Boden gewälzt. Dann hatten sie sich zum Duell gefordert und mit dem Schwert geschlagen. Der Baron hatte dem Marchese eine Streifwunde zugefügt, worauf dieser aus dem Zirkel von Montelusa ausgetreten war:
»Alles Leute, mit denen sich nicht vernünftig reden läßt.«
So hatte er schließlich einen Antrag auf Aufnahme in den Verein von Vigàta gestellt, wo man ihn mit Begeisterung willkommen hieß, zumal die Mitglieder alles Kaufleute, Grundschullehrer, Angestellte und Ärzte waren und es weit und breit keine Spur eines Adligen gab. Sein Beitritt brachte Glanz und Ehre.
Auf die höfliche Frage des Marchese hin warf sich der Cavaliere in die Brust.
»Ich spreche von Uogner! Und von seiner göttlichen Musik! Von dem Geist dieser Musik, der allen anderen Musikanten einen Schrecken einjagt. An ihr werden sich früher oder später alle einmal die Hörner abstoßen müssen!«
»Den Namen Uogner habe ich noch nie gehört«, sagte Giosuè Zito ehrlich erstaunt.
»Das kommt daher, daß Sie ein Ignorant sind! Zwischen Ihrer und der Kultur einer Meerbarbe besteht keinerlei Unterschied! Es war die werte Signora Gudrun Hoffer, die mir eine Kostprobe dieser Musik auf dem Klavier vorgespielt hat. Und ich fühlte mich dabei wie im Paradies! Aber Teufel noch mal, wie kann man bloß Uogner nicht kennen? Haben Sie noch nie etwas vom Fliegenden Holländer gehört?«
Giosuè Zito, der sich gerade erst vom Schlag zuvor erholt hatte, schwankte und konnte sich gerade noch an einem Beistelltisch festhalten.
»Sie wollen mich also richtig in Rage bringen! Warum reden Sie verdammt noch mal weiter von Gespenstern?«
»Weil so der Titel lautet und es eine großartige Oper ist! Mir ist es völlig egal, wenn Sie sich in die Hosen scheißen! Es ist eine neue, revolutionäre Musik! Genau wie der Tristan!«
»Au weh, au weh!« murmelte der Kanonikus Bonmartino, ein Gelehrter der Patristik, der wie gewöhnlich dabei war, sich beim Patiencenlegen selbst zu bescheißen.
»Was wollen Sie mir mit Ihrem ›au weh, au weh‹ sagen?«
»Nichts weiter«, erklärte der Kanonikus, und sein Gesichtsausdruck war so unschuldig, als flatterten zwei leibhaftige Engelein um sein Haupt. »Ich will Ihnen nur klarmachen, daß Tristano in italienischer Sprache melancholischer Arsch bedeutet. Ano triste. Und wenn das so ist, kann ich mir gut vorstellen, daß dieses Werk wahrhaft beeindruckend sein muß.«
»Also auch Sie begreifen einen Scheiß von Uogner!«
»Als erstes schreibt er sich W-a-g-n-e-r und wird auch so ausgesprochen. Er ist Deutscher, mein Guter, weder Engländer noch Amerikaner. Und er ist tatsächlich ein Gespenst, wie Sie sagen, ohne der Gesundheit des Herrn Zito schaden zu wollen. Er war nämlich längst tot, noch bevor er auf die Welt gekommen ist. Eine Fehlgeburt war er. Die Musik Ihres Herrn Wagner ist ein hochgradiger Schwachsinn, eine geräuschvolle Kackerei, die aus mit Luft gefüllten oder luftleeren Furzen besteht. Sachen für die Kloschüssel, für den Abort. Wer ernste Musik macht, bringt es nicht über sich, dieses Zeug zu spielen, glauben Sie mir.«
»Sie gestatten, daß ich ein Wort hinzufüge?« fragte der Vereinsvorsitzende Antonio Cozzo, der zeitunglesend auf seinem Sessel saß und sich bis zu jenem Moment mit keiner Silbe in das Streitgespräch eingemischt hatte.
»Das ist Ihr gutes Recht«, sagte Bonmartino.
»Ich spreche nicht mit Ihnen«, stellte der Vorsitzende klar, »sondern meine den Cavaliere Mistretta.«
»Bitte schön«, sagte Mistretta und blitzte ihn kriegslustig an.
»Ich will nur über den Troubadour, das Meisterwerk des Schwans von Busseto, sprechen. Ist das klar?«
»Ganz klar.«
»Also, Cavaliere, hören Sie gut zu. Ich nehme die Abbietta zingara und stecke sie Ihnen ins rechte Ohr, dann greife ich mir Tacea la notte placida und baue es Ihnen ins linke Ohr ein, auf daß Sie nicht mehr Ihren geliebten Uogner, wie Sie ihn nennen, hören können. Dann packe ich Chi del gitano und stopfe es Ihnen ins linke Nasenloch, und ins rechte kommt Stride la vampa, und so können Sie nicht mal mehr schnaufen. Dann mache ich aus Il balen del tuo sorriso, Di quella pira und aus dem Miserere ein einziges Bündel und schieb’ es Ihnen in den Hintern, der, wie man sich erzählt, eine recht großzügige Öffnung hat.«
In der Vereinsrunde stand mit einem Schlag die Zeit still. Dann hob der Stuhl neben dem des Cavaliere Mistretta ab und flog quer durch den Saal auf den Kopf des Vorsitzenden Cozzo zu. Da dieser mit einer solchen Reaktion gerechnet hatte, war er rechtzeitig aufgestanden, um dem Geschoß auszuweichen, und griff sich mit der rechten Hand an die hintere Hosentasche, wo er das Schießeisen, einen Revolver Smith and Wesson mit fünf Schuß, verwahrte. Doch keiner der Anwesenden zeigte sich irgendwie beunruhigt. Alle wußten, daß die Geste des Vorsitzenden so etwas wie ein Tick war, der ihn bis zu dreimal pro Tag überkam – immer dann, wenn es zu heißen Diskussionen oder Raufereien kam. Cozzo aber würde nie und nimmer seinen Revolver mißbrauchen und auf irgendein Lebewesen, ganz gleich ob Mensch oder Tier, schießen, da war man sich ganz sicher.
»Schluß jetzt, meine Herren, wollen wir endlich mit diesen Dummheiten aufhören?« mischte sich der Commendatore Restuccia ein, ein verschwiegener, wortkarger Mensch voll gefährlicher Widersprüche.
»Der da hat mich provoziert!« versuchte der Cavaliere sich zu rechtfertigen, als wären sie zwei Schulbuben, die sich zankten.
Doch der Commendatore, offensichtlich der Sache leid, blickte die beiden Streithähne streng an und sagte in scharfem Ton:
»Ich habe Schluß gesagt, und das bedeutet Schluß.«
Schleunigst brachten sie alles wieder in Ordnung. Der Vorsitzende Cozzo hob den Stuhl auf, der ihn gestreift hatte, und der Cavaliere Mistretta richtete sein Jackett wieder her. »Geben Sie einander die Hand«, befahl der Commendatore. Ihm den Gehorsam zu verweigern hätte mit größter Wahrscheinlichkeit fatale Folgen gehabt. Ohne sich eines Blickes zu würdigen, gehorchten sie. Just in diesem Augenblick brachte der Diener Tano ein Tablett mit einer Kanne Kaffee, Biskuits Regina, Cannoli, Zitronenhalbgefrorenem, Jasminsorbets, Mandelmilch und Aniswasser. Tano bediente die Anwesenden ihren Wünschen entsprechend. Eine Weile herrschte Schweigen, und genau in diesem Schweigen vernahmen alle Anwesenden, wie Don Totò Prestia mit geschürzten Lippen Una furtiva lacrima anstimmte.
Schweigend aßen und tranken sie und ließen sich von Don Totòs Stimme verzaubern. Die Tränen hätten einem kommen können wie Lämmern auf der Schlachtbank! Nach dem Beifall am Schluß stimmte Don Cosmo Montalbano mit seiner wohltönenden Stimme mit Una voce poco fa eine Art Erwiderung an.
»Wahrlich, es gibt schon schöne Musik!« seufzte der Uogner-Liebhaber und machte so dem gegnerischen Lager ein gewisses Zugeständnis.
»Wollen Sie sich etwa bekehren?« fragte der Kanonikus Bonmartino. »Ich sag’ Ihnen eins, meinen Segen werden Sie nie und nimmer haben, für mich sind und bleiben Sie auf ewig ein Ketzer und werden in der Verdammung sterben.«
»Darf man fragen, was für ein beschissener Pfarrer Sie sind?« fragte wütend der Cavaliere Mistretta.
»Ruhe, meine Herrschaften, Ruhe«, ertönte die Stimme des Commendatore in die angespannte Stille hinein.
»Aber Sie haben recht, Cavaliere«, ließ sich der Kanonikus von neuem hören. »Es gibt wahrlich schöne Musik. Und doch sind wir gezwungen, uns nolens volens eine Musik zu Gemüte zu führen, von der wir nicht mal wissen, wie sie ist, nur weil die Obrigkeit das so will! Der reinste Wahnsinn! Wir sollen unsere Ohren mit der Musik von diesem Luigi Ricci strapazieren, nur weil der Herr Präfekt das verordnet hat.«
Der Fachmann für Patristik war ehrlich entrüstet und brachte sogar die Patience durcheinander, die ihm nach einer Reihe von Schummeleien endlich gelingen wollte.
»Wissen die Herrschaften schon?« schaltete sich der Arzt Gammacurta ein, »dieser Ricci, der die Musik zum Bierbrauer von Preston geschrieben hat, soll eine Oper komponiert haben, die eindeutig eine schlechte Kopie eines Stücks von Mozart ist.«
Bei diesem Namen fuhren alle Anwesenden entsetzt zusammen. Den Namen Mozart auszusprechen, der bei den Sizilianern aus unerklärlichen Gründen auf Ablehnung stieß, kam einer Gotteslästerung gleich. In Vigàta gab es nur eine einzige Person, die diese Musik verteidigte, die nach Meinung aller weder Fisch noch Fleisch war, und das war der Schreiner Don Ciccio Adornato. Doch wie es schien, tat er das aus persönlichen Gründen, über die er sich aber ausschwieg.
»Mozart?«
Das kam nicht wie aus einem Mund, auch wenn alle den Namen zum gleichen Zeitpunkt ausriefen. Die einen sprachen den Namen mit Abscheu, andere wiederum voller Schmerz aus, als handle es sich um Verrat, und wieder andere mächtig erstaunt oder tief entrüstet.
»Jawohl, meine Herren, Mozart. Das hat mir einer gesagt, der Bescheid weiß. Dieser Scheißkerl von Luigi Ricci hat in der Scala eine Oper mit dem Titel Die Hochzeit des Figaro aufführen lassen, die ein einziger Abklatsch einer Oper Mozarts war, die genauso heißt. Nach dem Ende haben ihm die Mailänder auf den Kopf gespuckt. Ricci brach deshalb in Tränen aus und stürzte sich trostsuchend in die Arme Rossinis, der ihm wer weiß aus welchem Grund wohlgesinnt war. Rossini kam seinen Freundespflichten nach und sprach ihm Mut zu, gab aber allen zu verstehen, daß Ricci sich das Ganze im Grunde selbst eingebrockt hatte.«
»Und wir sollen unser Theater in Vigàta mit der Oper eines Dilettanten einweihen, nur weil der Herr Präfekt übergeschnappt ist?« fragte der Vorsitzende und faßte sich drohend an die Hosentasche, wo der Revolver steckte.
»O du guter Gott«, rief der Kanonikus. »Mozart ist schon sterbenslangweilig, stellen wir uns noch die schlechte Kopie eines schlechten Originals vor! Darf man vielleicht wissen, was der Herr Präfekt im Hirn hat?«
Da keiner ihm eine Antwort geben konnte, machte sich erneut nachdenkliches Schweigen breit. Giosuè Zito war es schließlich, der in die Stille hinein und ganz leise, um nicht von der Straße her gehört zu werden, anhob:
»Ah, non credea mirarti…«
Der Marchese Coniglio della Favara stimmte ein:
»Qui la voce sua soave…«
Und in tiefem Baß sang der Commendatore Restuccia:
»Vi ravviso, o luoghi ameni…«
An dieser Stelle erhob sich der Kanonikus Bonmartino von seinem Stuhl, eilte an die Fenster und zog die Vorhänge zu. Der Vorsitzende Cozzo steckte ein Licht an, um das sich alle im Halbkreis aufstellten. Der Arzt Gammacurta sang im Bariton:
»Suoni la tromba e intrepido…«
Als erstes kam, wie es die Partitur vorschrieb, der Einsatz des Commendatore und nach und nach der aller anderen. Sie standen einander bei den Händen haltend im Kreis, sahen sich in die Augen und sangen instinktiv leiser.
In jenem Augenblick waren sie im Namen Bellinis zu Verschworenen geworden.
Der Bierbrauer von Preston, lyrische Oper von Luigi Ricci, die der Präfekt von Montelusa ihnen aufzwingen wollte, würde nicht zur Aufführung kommen.
Sollte er das Moskitonetz aufheben?
»Sollte er das Moskitonetz aufheben?« fragte sich Concetta Riguccio verwitwete Lo Russo, zitternd unter dem gestärkten Baumwolltuch verborgen, das im Sommer über ihrem Bett angebracht war, um sie vor Mücken- und Bremsenstichen zu schützen. Der Fliegenschleier glich einem Gespenst, das an einem Nagel hing. Der gewaltige Busen der Witwe wurde jetzt von einem Sturm Windstärke zehn gepackt: die Brust auf der Backbordseite drückte es nach Nordwesten, und die auf Steuerbord ließ sich nach Südosten treiben. Als Frau eines Matrosen, der in den Fluten bei Gibraltar ertrunken war, konnte sie nicht anders als in der Seefahrersprache denken, die ihr Mann ihr in fünf Jahren Ehe beigebracht hatte, bis sie schließlich im Alter von nur zwanzig Jahren schon strenge Trauer tragen mußte.
Jesus Maria! Was für ein Treiben! Was für eine Nacht! Und welch hoher Seegang! Wegen der ausgemachten Sache, die stattfinden sollte, war ihr Blut ohnehin schon in Wallung: einmal sank es, und sie wurde ganz bleich; dann stieg es bis an Deck und ließ sie rot und violett anlaufen. Zu allem Überfluß hatte sie in den ersten Nachtstunden voller Schrecken großes Geschrei aus dem neuen Theater gegenüber ihres Hauses vernommen; darauf ertönte eine Trompete, und der Lärm einer wilden Jagd von Christenmenschen und galoppierenden Pferden war zu hören. Vielleicht hatte es irgendwo eine Schießerei gegeben.
So war sie zu der Überzeugung gelangt, daß er sich wegen dieses schrecklichen, ihr unerklärlichen Treibens in dieser Nacht nicht zu ihr getrauen würde. Und deshalb durfte sie auch ihr Herz und andere Körperteile wieder beruhigen.
Sich in ihr Schicksal fügend, hatte sie sich entkleidet und zur Ruhe gelegt. Sie war gerade am Einnicken, als sie ein schwaches Geräusch auf dem Dach vernahm und dann seine vorsichtig schleichenden Schritte auf der Regenrinne. Mit einem gedämpften Aufprall war er vom Dach auf die Brüstung des großen Fensters gesprungen, das, wie abgemacht, nur halb geschlossen war. Jetzt, da sie sicher war, daß er sein Wort gehalten hatte und in wenigen Minuten in ihrem Zimmer stehen würde, überkamen sie Schamgefühle. Sie durfte doch nicht halbnackt wie eine Hure nur mit dem Nachthemd und nichts darunter auf dem Bett liegen! Eilig war sie aufgesprungen und hatte sich das große Moskitonetz gegen den Leib gepreßt.
Sie hörte, wie er in die dichte Finsternis ihres Gemachs eindrang und das Fenster hinter sich schloß. Jetzt mußte er wohl auf ihr Bett zusteuern. Schon ahnte sie seine Verwunderung, wenn er sie. nach langem Tasten nicht darin finden würde. Er machte sich neben dem Nachtschränkchen zu schaffen, und man hörte, wie er ein Streichholz anzündete. Durch das dichte Netz hindurch gewahrte sie erst den schwachen Schein, und als dann der zweiarmige Kerzenleuchter brannte, war das ganze Zimmer in helles Licht getaucht. In diesem Augenblick mußte sie, Concetta Riguccio verwitwete Lo Russo, feststellen, daß er vollkommen nackt war. Wann hatte er sich bloß ausgezogen? Gleich, nachdem er ins Zimmer geschlichen war, oder war er so schon übers Dach gekommen? Weiter mußte sie feststellen, daß ihm zwischen den Beinen ein dreißig Zentimeter langes Ankertau von der dicken Sorte hing, nicht das für Boote, sondern das für Dampfschiffe, ein Tau, das an einem Poller mit zwei merkwürdigen Knaufen befestigt war. Bei diesem Anblick wurde sie von einer heftigen Welle erfaßt, die sie in die Knie zwang. Trotz des Nebels, der ihr mit einemmal vor Augen stand, sah sie seine Gestalt zielsicher auf die Stelle zusteuern, wo sie sich zusammengekauert hatte, vor dem Fliegennetz haltmachen, den Kerzenleuchter auf dem Boden abstellen, das Netz ergreifen und mit einem Schlag die Segel hissen. Sie, die Witwe, wußte nicht, daß sein Kompaß nicht die Augen, sondern das Gehör war. So war er einfach dem jammernden Taubengurren gefolgt, das ihr aus der Kehle drang. Jetzt kniete sie vor ihm und klappte den Mund auf und zu wie eine Meerbarbe, die sich im Netz verfangen hat.
Doch trotz vorgeblicher Atemnot bekam die Witwe mit, wie das Ankertau seine Form veränderte und langsam zu einem steifen Bugspriet wurde. Darauf beugte er sich hinab, griff ihr wortlos unter die verschwitzten Achseln und hißte sie hoch über seinen Kopf. Sie merkte, welch schwere Last sie für sein Tauwerk geworden war; doch er hielt das Gleichgewicht und ließ sie nur ein Stück weit herab, damit sich ihre Beine auf seinem Rücken verankern konnten. Der Bugspriet hatte inzwischen noch einmal seine Form verändert: jetzt war er zu einem gewaltigen Großmast geworden, an dem die Witwe Lo Russo festgezurrt war und an dem sie bebte, flatterte, zerrte wie ein Segel im starken Wind.
Einmal hatte ihr Ehemann eine Geschichte erzählt, die er von einem Seemann gehört hatte, der auf Walfang ausgezogen war: In den kalten Wassern des Nordens, hatte der Seefahrer gesagt, lebt ein sagenhafter Fisch, der Narwal heißt. Er ist groß wie drei Mann und trägt mitten auf dem Kopf zwischen den Augen ein über drei Meter langes Elfenbeinhorn. Wer ihn findet, wird reich: eine winzige Prise seines zu Pulver gemahlenen Horns macht ein Mannsbild stark genug, um fünfzehn Weiber in einer Nacht zu nehmen. Damals hatte Concetta dieser Geschichte keinen Glauben schenken wollen. Jetzt aber wußte sie, daß es kein Märchen war. Sie hielt einen kleinen Narwal in den Armen, dessen Horn zwar nur dreißig Zentimeter lang war, ihr aber vollauf genügte.
Die Geschichte zwischen den beiden hatte an einem Sonntag begonnen, als sie mit ihrer Schwester Agatina zu spät zur Messe gekommen war. Die Kirche war voll, und es gab keine Spur mehr von einem jener Hocker mit Strohsitz, die der Küster gegen einen halben Tari vermietete. Sie hatten eine dichte Schar von Männern vor sich, und es wäre für sie nicht schicklich gewesen, um Verzeihung bittend da durchzugehen. Notgedrungen sahen sie den Altar nur aus einiger Entfernung.
»Laß uns hier am Eingang bleiben«, hatte darum Agatina gesagt.
Mit einemmal war der Flügel der Innentür aufgegangen, und er kam herein. Nie zuvor hatte Concetta ihn zu Gesicht bekommen. Doch kaum hatte sie ihn gesehen, war ihr klar, daß sie für einige Minuten die Gewalt über ihr Steuerruder verlieren würde. Schön war er, schön wie ein Engel im Paradies! Hochgewachsen, mit vielen blonden Locken, und hager war er, wie ein echtes Mannsbild sein mußte. Ein Auge war blau wie das Meer, und das andere, das rechte, fehlte. Es war unter den Augenlidern versteckt, die an der unteren Seite verklebt, ja wie zugemauert waren. Trotzdem wirkte es nicht abstoßend, im Gegenteil: das ganze Licht des verdeckten Auges erstrahlte in dem anderen, ließ es funkeln wie einen Edelstein, war hell wie ein Leuchtturm in der Nacht. Von Agatina erfuhr sie später, daß er das Auge durch einen Messerstich bei einer Rauferei verloren hatte. Für sie hatte das keine Bedeutung. Genau in diesem Augenblick wurde ihr klar, daß sich fortan alles auf ihrer Route ändern würde: um jeden Preis mußte er ihr Hafen werden – und müßte sie dafür Kap Hoorn umsegeln! Vielleicht hatte er ihre Gedanken erraten, denn er drehte den Kopf, bis er ihr in die Augen sehen konnte, und warf dort seinen Anker aus. Eine Minute lang starrten sie einander an, und die Minute dauerte eine Ewigkeit. Und so war die Sache abgemacht. Er drückte die Fingerspitzen der rechten Hand eng zusammen und bewegte die nach oben gewölbte Hand auf und ab. Das war eine eindeutige Frage.
»Wie stellen wir es an?«
Langsam löste Concetta ihre Arme vom Leib, ließ sie an den Hüften hinuntergleiten und kehrte mit betrübtem Gesichtsausdruck die Handflächen nach außen.
»Ich weiß es nicht.«
Ihr Zwiegespräch dauerte nur kurz und war auf ein paar knappe Gesten beschränkt.