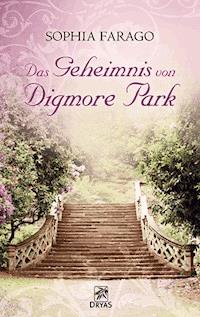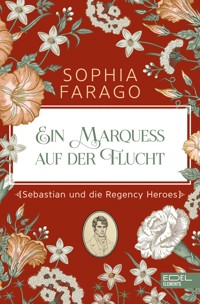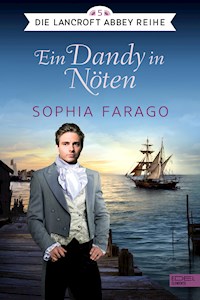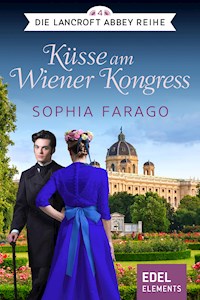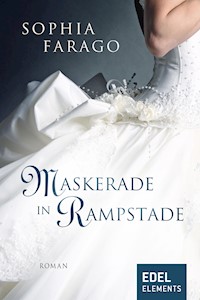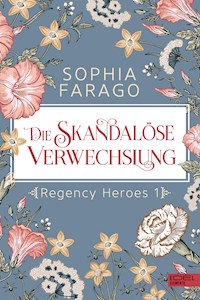
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Regency Heroes
- Sprache: Deutsch
Als sich Harold, Elliot, Reginald und Oscar eine Ecke im Schlafsaal der altehrwürdigen Universität Oxford teilten, malte der Hausmeister die Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen auf die Betthäupter: H, E, R, O – die Regency Heroes waren geboren. Jetzt 1812, fünf Jahre nach Studienende sind sie die tonangebendsten Gentlemen in ganz London und ihre Freundschaft ist wichtiger denn je. Erschöpft vom Krieg gegen Napoleon zurückgekehrt, hat Major Harold Westfield so gar keine Lust, nach der ihm unbekannten Schwester von Oscar zu suchen, die sich mit einem Hauslehrer auf dem Weg nach Gretna Green befinden soll. Ist es da ein Wunder, dass er sein Glück kaum fassen kann, als er bereits in der Poststation von Watford ein Paar antrifft, das zu dieser Beschreibung passt? Auf der Flucht vor ihrem Vormund beschließt Lady Amabel Cavendish die Stelle einer Nanny anzunehmen. Mit dem unfreundlichen Majordomus ihrer Arbeitgeber macht sie in Watford Halt und wird von einem schneidigen Major angesprochen, der verspricht, sie zu ihrem Bruder zurückzubringen. Ist es da ein Wunder, dass sie freudig die Gelegenheit ergreift, dem ungewissen Schicksal der Dienerschaft zu entkommen? Harold nimmt Amabel vor sich in den Sattel. Noch wissen sie weder von der Kugel, die in Kürze knapp an ihren Ohren vorbeipfeifen wird, noch von den empörten Blicken dreier Ladys, die sich in ihren Rücken bohren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
Copyright © 2021 Edel Verlagsgruppe GmbH
Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edelelements.com
Lektorat: Dr. Rainer Schöttle
Korrektorat: Christin Ullmann
Vermittelt durch: Michael Meller Literary Agency GmbH, München
Layout und Satz: Datagrafix GSP GmbH, Berlin | www.datagrafix.com
Cover: Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix GSP GmbH, Berlin | www.datagrafix.com
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
eISBN 978-3-96215-417-2
Anmerkung:
Dies ist Band 1 der Regency-Heroes-Reihe. In jedem der Romane wird eine Liebesgeschichte fertig erzählt. Du kannst dir also aussuchen, mit welchem du anfängst. Am meisten Spaß macht es trotzdem, wenn du mit dem ersten beginnst. Eine Liste der wichtigsten Personen und Fachausdrücke findest du im Anhang.
Regency Heroes – Wie alles begann
Während der Schulzeit im noblen Privatinternat von Harrow hatten sie sich noch misstrauisch beäugt. Harold, der trotz seiner Fröhlichkeit und dem Mut, der bisweilen an Übermut grenzte, äußerst pflichtbewusst war, betrachtete Elliot mit all seinen Streichen und dem lauten Gelächter, das durch die weiten Flure der Schule hallte, als kindischen Nichtsnutz. Dieser verstand nicht, wie man so wissensdurstig und vernünftig sein konnte wie Oscar, der sich wiederum vor der scharfen Zunge und dem Sarkasmus von Elliots Cousin Reginald hütete. Und der wiederum konnte mit den anderen drei überhaupt nichts anfangen, weil er sich ihnen überlegen fühlte.
Doch dann kam das Studium in Oxford. Die vier erkannten schnell, dass sie nur gemeinsam gegen die Übermacht der Schüler aus Eton bestehen und die Mutproben, die ihnen die Älteren abverlangten, bewältigen konnten. Fortan teilten sie Freud und Leid sowie eine Ecke im geräumigen Schlafsaal. Der Hausknecht hatte auf die Betthäupter die Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen gemalt: H E R O – die Regency Heroes waren geboren. Nun, 1812, fünf Jahre nach dem Studienabschluss, wird die Freundschaft der vier so unterschiedlichen Männer wichtiger denn je.
Kapitel 1
Poststation in Watford, Essex Etwa zwanzig Meilen nordwestlich von London 15. Mai 1812
Major Harold Westfields Laune als fröhlich oder gar hoffnungsvoll zu bezeichnen, hätte bedeutet, die Sachlage völlig zu verkennen. Er war müde, fühlte sich nach der langen, stürmischen Reise zurück in die Heimat ausgelaugt und seine Wunde unter dem linken Rippenbogen schmerzte. Die Tatsache, dass er sich auf ein paar geruhsame Stunden mit seinem Freund Oscar in dessen Haus in Hampstead gefreut hatte und nun stattdessen offensichtlich einem Phantom nachjagte, machte die Sache nicht eben besser. Aber da er sich hier in der Poststation ein Glas Ale genehmigt hatte, war zumindest der Durst gestillt. Nun duckte er sich unter dem niedrigen Türstock in der dicken Steinmauer des Gasthauses hindurch und trat ins Freie. Es war ein angenehm warmer Maitag. Die Sonne stach allerdings so grell vom Himmel, dass er einige Male zwinkern musste, um sich an die Helligkeit zu gewöhnen. Dass das kein gutes Zeichen war, sagte ihm seine langjährige Erfahrung im Feld. Sicher würde es nicht mehr ewig dauern, bis ein Gewitter über das Land zog. Dass er Gefahr lief, bis auf die Knochen durchnässt zu werden, fehlte ihm gerade noch zu seinem Glück.
»Bring mir mein Pferd, ich möchte ohne Verzögerung weiterreiten«, befahl er dem Burschen, dem er vor dem Besuch der Schankstube Oscars Hengst anvertraut hatte. Er warf noch einen Blick zum Himmel und seufzte. Dann einen weiteren auf seine Taschenuhr und das Seufzen verstärkte sich. Es war schon fast vier. Musste er sich wirklich weiter auf den Weg hinauf nach Luton machen? Konnte er nicht einfach umkehren und querfeldein zurück nach Südosten reiten? Wenn er Glück hatte, erreichte er das Haus seines Freundes noch, bevor das Donnerwetter loslegte. Nicht zum ersten Mal fragte er sich, was denn das überhaupt für eine seltsame Geschichte war, in die man ihn da verwickelt hatte. Warum sollte Oscars Schwester Emilia – oder hieß sie Amalia? Sein verfluchtes Namensgedächtnis ließ ihn natürlich wieder einmal im unpassendsten Moment im Stich … Aber egal, wie sie hieß: Warum sollte sie hinauf nach Schottland fliehen, um dort zu heiraten? Einen Mann, der anscheinend mehr als doppelt so alt war wie sie und alles andere als standesgemäß? Das Mädchen war kaum zwanzig, da hätte sie doch noch genügend Zeit gehabt, einen Passenderen zu finden als den Hauslehrer der Nachbarn.
Harold versuchte, sich Emilia, Emily, Amalia in Erinnerung zu rufen. Er hatte sie vielleicht zwei, drei Mal gesehen, als er noch mit den anderen Heroes in Harrow zur Schule ging. Da allerdings nur von Weitem, da sie sich noch in der Obhut der Gouvernante befand. Ein Schopf mittelbrauner Locken, der im Wind wehte, war das Einzige, was er sich ins Gedächtnis zurückholen konnte. Das war nicht wirklich viel und dennoch war sich Oscar sicher gewesen, dass er sie erkennen würde, wenn er ihr jetzt gegenüberstand. Dazu musste er sie allerdings erst einmal finden, wonach es derzeit leider nicht aussah. Harold schüttelte unwillig den Kopf. Was für eine verfahrene Situation und ganz offensichtlich völlig unnötig. Warum hatte die gute Amalia nicht einfach etwas mehr Geduld an den Tag gelegt? Warum hatte sie es nicht Oscar überlassen, einen geeigneteren Weg zu finden, die Dinge zu regeln? Der war doch bekannt dafür, dass er für alle Probleme die passende Lösung fand.
Das Quietschen altersschwacher Federungen ließ ihn aus den Gedanken auffahren. Eine reichlich betagte, schwarze Reisekutsche rumpelte durch den Torbogen, der den Vorhof der Poststation von der Straße trennte. Ihr folgte ein schnittiger Phaeton, der von einem Paar exzellenter Schimmel gezogen wurde und das Interesse des Majors sofort auf sich zog. Von so einem sportlichen Wagen träumte er bereits seit Jahren. Nun, da er den Kriegsdienst quittiert und beschlossen hatte, sich wieder in England niederzulassen, sprach nichts mehr dagegen, sich etwas Ähnliches anzuschaffen. Natürlich erst, wenn er das drohende Gespräch mit seinem Halbbruder hinter sich gebracht und einen Überblick über sein Erbe gewonnen hatte. Aber daran wollte er jetzt nicht auch noch denken. Ohne zu zögern, ging er quer über den Vorplatz, um sich das Gefährt aus der Nähe anzusehen.
»Kümmere er sich um die Tiere, Bursche, aber unterstehe er sich, mit seinen dreckigen Pratzen meinen Wagen zu berühren!«, befahl der junge Stutzer, dem der Phaeton gehörte, dem Knecht, der nach seinen Wünschen gefragt hatte. Dann machte er kehrt, verschwand in der Poststation und hinterließ eine Duftwolke aus Moschus und Lavendel.
Major Westfield zog die Nase kraus. Was für ein eingebildeter Geck! Sicher hatte er sein ganzes Leben noch nichts geleistet, was es gerechtfertigt hätte, ein so arrogantes und selbstverliebtes Auftreten an den Tag zu legen. Streng rief er sich zur Ordnung. Er war jetzt wieder zurück im Königreich. Da steckten kaum einem Adeligen Jahre auf dem Schlachtfeld in den Knochen. Es war höchste Zeit, dass er sich wieder an die heimatlichen Gepflogenheiten gewöhnte und mit der besseren Gesellschaft nicht mehr allzu streng ins Gericht ging.
»Es ist nicht der passende Zeitpunkt, um herumzutrödeln«, meldete sich da eine andere strenge Stimme zu Wort, diesmal kam sie von jemandem hinter seinem Rücken. »Wir haben nicht viel Zeit für eine Pause, wenn wir unser heutiges Ziel noch trockenen Fußes erreichen wollen. Also, hopp, hopp, Beeilung! Ich gehe schon mal voran.«
Harold, der eben die feinen grünen Ledersitze des Sportwagens bewundert hatte, blickte irritiert über seine Schulter zurück. Er sah einen älteren Mann, ganz in Schwarz gekleidet, neben der betagten Reisekutsche stehen. Nach einem Blick auf seine silberne Taschenuhr schnaufte dieser unwillig und machte sich anschließend daran, durch die niedere Türöffnung ins Innere des Hauses zu treten. Da er nicht allzu groß war, brauchte er dabei den Kopf kaum einzuziehen. Wie alt mochte er sein? Da sich schon einige Falten in seine blasse Gesichtshaut gegraben hatten, schätzte Harold ihn auf Mitte vierzig, was auch auf Oscars Schilderung von Emilias Bräutigam zutraf. Auch die Aura von Wichtigkeit, die er verströmte, passte zum Beruf des Hauslehrers, wenngleich seine Manieren zu wünschen übrig ließen. Welcher Mann, der die Bezeichnung Gentleman verdiente, ließ seine weibliche Begleitung allein am Vorplatz stehen, während er sich selbst ins Gasthaus begab? Da haben ja seltsame Sitten Einzug gehalten, während ich in Spanien war, dachte er kopfschüttelnd.
Der Kutscher des Reisewagens trat zu den Pferden nach vorn und nahm sie am Zügel, wohl um sie hinters Haus zur Tränke zu führen. Dabei gab er den Blick auf eine junge Frau frei, die nun allein auf dem Steinpflaster stand. Schmale Hände umklammerten den Griff einer kleinen Reisetasche, deren dunkles Leder auch schon bessere Tage gesehen hatte. Sie beachtete ihn nicht, sondern ließ den Blick über die Fassade der Poststation schweifen. Einzelne Locken hatten sich aus der Hochsteckfrisur unter ihrem Häubchen gelöst und flatterten fröhlich im aufkommenden Wind. Der Major zog scharf die Luft ein. Wie hatte Oscar seine Schwester beschrieben? Mittelgroß, schlank, mit mittelbraunen Haaren? Sein Herz begann, vor Freude und Erleichterung wie wild zu klopfen. Das Glück war ihm am Ende doch noch hold! Der strapaziöse Ritt war anscheinend nicht vergebens gewesen. Nun gut, er würde die junge Dame nicht als mittelgroß bezeichnen, sondern eher als klein. Allerdings überragte er selbst seinen Freund um Haupteslänge, da konnte diesem die eigene Schwester schon mal größer erscheinen, als sie war. Schlank war sie jedoch auf jeden Fall, ja, er war geneigt, sie als zart und zierlich zu bezeichnen. Eine Tatsache, die durch das Schwarz ihrer Kleidung noch zusätzlich unterstrichen wurde. Der Major konnte sich nicht erklären, warum die beiden Heiratswilligen Trauerkleidung für ihre Reise gewählt hatten. Hofften sie etwa, damit weniger aufzufallen? Er fand den Plan nicht sonderlich gelungen. Zumal die junge Dame überall auffallen würde, so hübsch, wie sie war. Jetzt hatte sie anscheinend bemerkt, dass er sie anstarrte, denn ihre großen bernsteinfarbenen Augen wandten sich mit prüfendem Blick zu ihm. Eine Augenbraue schnellte kaum merklich in die Höhe. Harold freute sich so sehr, sie gefunden und sich damit einen weiteren Ritt in den Norden erspart zu haben, dass er zu strahlen begann und sich beschwingten Schrittes zu ihr auf den Weg machte.
»Du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich es mich macht, dich gefunden zu haben«, sagte er im Näherkommen. Seine Erleichterung war so groß, dass er gute Lust verspürte, die junge Dame in die Arme zu schließen, als wäre sie nicht Oscars, sondern seine eigene kleine Schwester. Sie hatte sich kurz umgewandt und der skeptische Blick, mit dem sie ihn jetzt bedachte, zeigte nur allzu deutlich, dass sie dies nicht gutheißen würde. Also beließ er es dabei, sich höflich zu verbeugen.
»Verzeih, dass ich dich so unverfroren anspreche, aber mir fällt ein riesengroßer Stein vom Herzen. Ich hatte die Hoffnung, dich zu finden, schon fast aufgegeben. Wie du dir denken kannst, ist es dein Bruder, der mich schickt. Er ist außer sich vor Sorge und hat mich gebeten, dich umgehend nach Hause zu bringen.«
Harold stellte erfreut fest, dass sich ihre Skepsis etwas gelegt zu haben schien, denn auch ihre Lippen verzogen sich zu einem kleinen Lächeln. Das beglückte ihn so sehr, dass er nun doch spontan ihre Hände ergriff.
»Lass dich ansehen. Mein Gott, bist du hübsch … ich meine natürlich groß geworden.« Er unterbrach sich, ließ die Hände abrupt los und fügte mit reuigem Lächeln hinzu: »Oh Himmel, ich höre mich an wie mein eigener Opapa.«
Das Kichern, das sie nun hören ließ, erwärmte sein Herz.
»Als groß hat mich wirklich noch niemand bezeichnet«, sagte sie. »Sind Sie sicher, dass wir uns schon einmal begegnet sind?«
Er nickte. »Mehrmals sogar. Immer, wenn ich deinen Bruder besuchte. Das ist allerdings schon einige Jahre her. Damals warst du noch ein Mädchen und deine Gouvernante sorgte dafür, dass ich dich nur aus der Ferne zu Gesicht bekam.«
Er unterbrach sich kurz und wartete auf ein Zeichen des Erkennens in ihrem Gesicht. Doch stattdessen wurde ihr Blick noch ein wenig ratloser.
»Du weißt noch immer nicht, wer ich bin«, stellte er fest und ärgerte sich über sein unhöfliches Versäumnis. »Warum habe ich ungehobelter Tölpel mich aber auch noch nicht vorgestellt? Mein Name ist Westfield, Major Harold Westfield. Ich hoffe, dass dir zumindest mein Name etwas sagt. Ich bin einer der vier Heroes.«
Es verunsicherte ihn zunehmend, dass ihr Gesichtsausdruck unverändert prüfend blieb. Deshalb hielt er eine Entschuldigung für angebracht. »Es tut mir leid, dass du mir meinen plötzlichen Überfall krummnimmst, Emily«, sagte er reuig. »Doch ich bitte dich, komm mit mir zurück.«
»Amabel«, korrigierte sie ihn kühl. »Mein Name ist Amabel.«
Er schlug sich mit der Hand auf die Stirn. »Ich wusste es«, rief er aus. »Mein Namensgedächtnis lässt mich immer dann im Stich, wenn es am peinlichsten ist. Amabel, natürlich! Ich hoffe, du verzeihst mir auch diesen Fauxpas.«
Ihr Stirnrunzeln hatte sich vertieft. »Wie sollte denn mein Bruder nach mir suchen können? Ich habe doch gar keinen …«
Harold zog scharf die Luft ein und trat erschrocken einen Schritt zurück. Sein dringender Wunsch, Oscars Schwester gefunden zu haben, hatte ihn wohl zu falschen Hoffnungen verleitet. »Sie haben gar keinen Bruder? Was für ein fataler Irrtum meinerseits.«
»Doch, doch, natürlich habe ich einen Bruder«, beruhigte sie ihn und trat nun ihrerseits einen Schritt näher. »Mich hat lediglich gewundert, dass er über meine Reiseroute Bescheid weiß.« Sie seufzte, als sie ergänzte: »Ich kann mir denken, dass er meinen Plan hasst, aber mir bleibt keine andere Wahl. Res desperatae continent ad insolitas conditiones, wie mein Papa zu sagen pflegte. Verzweifelte Situationen bedingen ungewöhnliche Maßnahmen.« Sie stockte kurz und sah sich dann offensichtlich veranlasst, hinzuzufügen: »Er ist vor beinahe zwei Jahren gestorben …«
»Ich weiß, ich habe von dem Unglück gehört und es tut mir leid«, antwortete Harold, als er sich von der Überraschung erholt hatte, mit welcher Sicherheit sie einen lateinischen Satz von sich gab. Er hätte sie gern getröstet, wusste jedoch nicht, was die richtigen Worte dafür waren. Gab es in so einem Fall überhaupt richtige Worte?
»Woher kennen Sie meinen Bruder, Major?«, unterbrach sie seine Gedanken.
»Nenn mich doch Harold«, bat er, ohne nachzudenken. Da ihm diese Aufforderung dann doch etwas zu forsch erschien, setzte er hinzu: »Schließlich sind dein Bruder und ich schon seit Harrow gute Freunde. Damit sind wir beide doch eigentlich auch Freunde, nicht wahr?«
»Ah, Harrow!«, rief sie erfreut, ohne auch nur mit einem Wort auf das Thema Freundschaft einzugehen. »Das erklärt so manches.«
Das Klappern von Hufen eines Pferdes, das quer über den harten Vorplatz auf sie zugeführt wurde, zog die Aufmerksamkeit der beiden auf sich.
»Ihr Hengst, Sir.« Der Knecht verbeugte sich und übergab Harold mit der einen Hand die Zügel, während er die andere in der Hoffnung, ein paar Münzen zu ergattern, vorstreckte. Der Major ließ sich nicht lange bitten. Er holte einige Pennys aus der Hosentasche und ließ sie auf die schwielige Handfläche gleiten. Der Bursche bedankte sich und zog von dannen.
»Die Sache ist die, Amabel …« Harold blickte etwas unschlüssig vom Pferd zur jungen Lady. »Wie gesagt, dein Bruder möchte, dass du mit mir zu ihm nach Hause zurückkehrst. Ich bin gekommen, um zu verhindern, dass du … äh … mit diesem, diesem Mann … äh … weiterreist.« Harold beglückwünschte sich zu seinem diplomatischen Geschick. Es war ihm gelungen, die Worte Durchbrennen und Hochzeit zu vermeiden und dennoch zu sagen, was er zu sagen hatte. Eine Flucht nach Gretna Green war doch eine allzu delikate, ja, geradezu skandalöse Angelegenheit. Er wollte die junge Dame nicht dadurch in Verlegenheit bringen, dass er offen darüber sprach. Auch wenn er so verwegen gewesen war, ihr anzubieten, ihr Freund zu sein, gehörte er ganz bestimmt nicht zur Familie.
»Ich habe keine andere Wahl, als ihn zu begleiten … äh … Harold«, lautete ihre Erwiderung. »Du wirst dir darüber noch keine Gedanken gemacht haben, aber als junge Frau hat man wenig Möglichkeiten, zu Geld zu kommen. Ich muss mit ihm fahren, um meinem Bruder zu helfen, unser Leben zu finanzieren.« Sie seufzte zwar, senkte jedoch nicht den Blick.
Harold war zutiefst schockiert. Es konnte doch nicht wahr sein, dass sie sich aus finanzieller Not heraus verpflichtet fühlte, die Ehe mit einem ungehobelten Kerl einzugehen, der sie bei der nächstbesten Poststation allein im Hof stehen ließ.
»Was für eine Schande«, rief er aus. »Über so ein Thema solltest du dir gar keine Gedanken machen müssen. Das ist Aufgabe deines Bruders. Nach dem Tod eurer Eltern ist es seine Pflicht, für dein Wohlergehen zu sorgen, nicht umgekehrt.«
»Mein Bruder hat durch unseren Onkel genügend Probleme am Hals«, sagte sie bitter.
»Ja, der Onkel!« Westfield machte eine abfällige Handbewegung. »Der ist wirklich eine Zumutung. Ich habe von seinen Eskapaden gehört. Doch gerade weil er so schrecklich ist, ist er es nicht wert, dass du dein Leben wegwirfst. Glaube mir, wir werden für alles eine Lösung finden.«
»Wir? Meinst du das ernst?« Sie sah mit großen Augen zu ihm auf. »Stehst du uns denn tatsächlich in dieser misslichen Lage zur Seite?«
Westfield hörte die Überraschung und auch die aufkeimende Hoffnung in ihrer Stimme. Verdammt, Oscar, dachte er, warum hast du mir nicht gesagt, wie schlimm es um euch steht?
»Selbstverständlich meine ich das ernst. Ich würde meine Freunde nie im Stich lassen«, beeilte er sich zu versichern und legte sich die Rechte ans Herz. »Glaub mir, wäre ich in den letzten Jahren nicht in Spanien gewesen, hättet ihr längst auf mich zählen können.«
Aus dem Augenwinkel nahm er eine offene Kutsche wahr. In ihr saß eine Gruppe älterer Damen, die sich lebhaft unterhielten. Eine von ihnen lachte laut auf. Dann wurde es mit einem Schlag verdächtig ruhig und er hatte das unangenehme Gefühl, dass sich neugierige Blicke in seinen Rücken bohrten.
»Wir sollten keine Zeit mehr verlieren«, drängte er daher abermals und hörte selbst, wie gehetzt seine Stimme klang. »Alles Weitere können wir unterwegs besprechen. Es scheint, als würden wir bereits Aufsehen erregen.«
Amabels Augen folgten den seinen zur Kutsche hinüber. Die drei Damen hatten ihre Blicke abgewandt und winkten mit leeren Gläsern einen Lakaien heran, um sich mit neuen Erfrischungen versorgen zu lassen.
Zum Glück scheinen das keine von Mutters Freundinnen zu sein, dachte Harold, dem die Gesichter nicht bekannt vorkamen. Wie hätte ich ihr je erklären können, was ich hier zu suchen hatte, ohne Amabel in ein schiefes Licht zu rücken?
Vom Inneren der Poststation drang die ungehaltene Stimme eines Mannes ins Freie heraus. Harold bemerkte, dass Amabel erstarrte, und spürte ihren festen Griff am Unterarm. Nun klang ihre Stimme ebenso gehetzt wie seine kurz zuvor: »Du sollst mich wirklich nach Hause bringen?«, vergewisserte sie sich. »Und dort wartet tatsächlich mein Bruder auf mich?«
Es überraschte ihn, wie sehr sie diese Tatsache verwunderte, und daher beeilte er sich zu nicken.
»Dann nichts wie los«, entschied sie. »Ich höre ihn kommen und habe keine Lust, das Aufsehen noch durch einen lautstarken Wortwechsel zu vergrößern. Wo steht denn deine Kutsche?«
Harold griff sich mit der Hand in den Nacken und seufzte.
»Es gibt keine«, gestand er. »Wir waren so sehr darauf konzentriert, dich so schnell wie möglich zu finden, dass wir an deine Rückreise gar nicht gedacht haben. Also wirst du wohl vor mir auf den Sattel steigen müssen.«
Er unterbrach sich, da sie wieder zu kichern begonnen hatte und etwas flüsterte, das sich wie »Das sieht ihm ja so ähnlich!« anhörte.
»Wie, bitte?«, fragte er irritiert. Der Oscar, den er kannte, handelte stets vernünftig und überlegt. Wäre er nicht derart in Panik gewesen, er hätte seinen Plan sicher besser durchdacht.
»Wir reiten oft gemeinsam auf einem Pferd«, lautete ihre Antwort, die ihn noch mehr überraschte. »Die Frage ist allerdings: Wohin mit meiner Reisetasche?« Sie wies auf das kleine schwarze Gepäckstück, das sie am Pflaster abgestellt hatte.
Er erwog das Problem und entschied dann: »Die werden wir zwischen uns einklemmen. Wenn du dich gut bei mir festhältst, dann sollte ich weder dich noch deine Habseligkeiten verlieren.«
Kurz erwog sie diesen Vorschlag und nickte schließlich. »Ecce, hoc ita esto! Nun denn, dann soll es so sein. Bitte sei so freundlich, mir aufs Pferd zu helfen. Lass uns das Abenteuer beginnen.«
Erstaunt bemerkte er, dass sie die Arme erwartungsvoll ein Stück angehoben hatte, um sich von ihm auf das Pferd heben zu lassen, sodass sie quer im Sattel saß. In ihrem Blick lag so viel Vertrauen, dass es ihn rührte. Er kam ihrer unausgesprochenen Aufforderung mit einem Lächeln nach, reichte ihr die Tasche hinauf und schwang sich selbst hinter sie aufs Pferd. Bevor er sie auffordern konnte, sich gut an ihm festzuhalten, hatte sie ihr Gesicht schon seitlich an seine Brust geschmiegt und ihre Arme eng um seine Taille geschlungen. Die Tasche war zwischen ihren beiden Körpern eingeklemmt. Sein Lächeln vertiefte sich.
Sie hat recht, dachte er, während er das Pferd vorsichtig in Bewegung setzte, was als lästige Pflicht begonnen hatte, ist tatsächlich zu einem Abenteuer geworden. Nichts stand ihm ferner, als seinem Freund weiter zu zürnen. Wie hätte er aber auch ahnen können, was für eine bezaubernde Person seine Schwester war? Zum Glück, so dachte er, istsie auch noch leicht und zierlich.Mit einer großen, wuchtigeren Frauwäre das Pferd wohl nach kurzer Zeit unter uns zusammengebrochen.
Er war eben dabei, aus dem Hoftor hinauszureiten, als ein lautes »He, was soll denn das?« zu ihnen herüberklang. »Bleiben Sie auf der Stelle stehen! Lassen Sie das Mädchen frei, Sie Unhold!«
Als Offizier war Harold Westfield gewöhnt, Befehle zu befolgen. Er hatte aber auch gelernt, genau darauf zu achten, von wem er sie entgegennahm. Ein Hauslehrer, der in die höhere Gesellschaft einheiraten wollte und meinte, sich nicht um seine Braut kümmern zu müssen, gehörte nicht dazu. Also bog er seelenruhig auf die Landstraße ein. Das Kichern an seiner Brust erwärmte sein Herz noch ein Stück mehr.
Kapitel 2
Etwa zwei Monate vor dem Treffen in Watford Millcombe Castle, Landsitz des Marquess of Beaconsfield Beaconsfield, kaum dreißig Meilen westlich von London März 1812
Plötzlich war er da, der Vormund, auf den sie so lange gewartet hatten. Mit forschem Schritt und schnarrender Stimme stellte er das beschauliche Leben der Geschwister Amabel und Sebastian Cavendish von einem Tag zum anderen auf den Kopf. Und das nicht auf die »Von nun an lebten sie glücklich«-Art und Weise. Dabei hatten die zwanzigjährigen Zwillinge alles Recht der Welt, auf etwas mehr Glück in ihrem einsamen Dasein zu hoffen.
Es war nun mehr als eineinhalb Jahre her, seit ihre Eltern bei einem Kutschenunglück ums Leben gekommen waren. Der Wagen war in den Hochwasser führenden Fray’s River gestürzt, wo der Marquess of Beaconsfield mitsamt der Marchioness, dem Kutscher und auch den beiden Pferden in den reißenden Fluten ertrank. Es hatte seit Tagen in Strömen geregnet, die Böden waren aufgeweicht und nurmehr mit erheblichen Schwierigkeiten befahrbar gewesen. Zudem hatte ein Sturm die Blätter von den Bäumen geweht, die sich mit dem feuchten Lehmboden zu einer glitschigen Masse vereint hatten. Alle Bemühungen des Kutschers, seine Herrschaft sicher ans Ziel zu bringen, scheiterten.
Den Verlust mussten die Geschwister spätestens dann als unwiederbringlich erkennen, als sie weinend vor der offenen Gruft standen und sich an den Händen hielten, im sicheren Wissen, dass sie jetzt auf sich allein gestellt waren. Das Unglück hatte ihnen nicht nur die geliebten Eltern genommen, es hatte sie auch mit einem Schlag aus ihrem unbeschwerten Leben gerissen. Da ihr Vater noch nicht so bald mit seinem Ableben gerechnet hatte, hatte er noch keine ausreichenden Vorkehrungen für das Leben der damals neunzehnjährigen Zwillinge getroffen. Als sein nächster männlicher Verwandter stellte sich ein Cousin zweiten Grades heraus, ein gewisser Mr Edgar Prestwood. Das war ein Mann, über den die beiden bisher kaum ein Wort gehört hatten, und wenn, dann war dies kein gutes gewesen. Wie es das Gesetz vorschrieb, wurde er zum Vormund bestellt und sollte sich damit um alle Belange kümmern, bis die Zwillinge volljährig waren und Sebastian somit selbst in der Lage, das Erbe in vollem Umfang anzutreten. Das Einzige, was der verstorbene Marquess bereits festgelegt hatte, war, dass die Verwaltung des gesamten Besitzes nur im Einvernehmen zwischen dem Vormund und Mr Laurence geschehen konnte, seinem in Ehren ergrauten Rechtsanwalt.
So gut gemeint diese Bestimmung auch war, so unerfreulich erwies sie sich in der Folge. Wie es nämlich ein böser Zufall wollte, weilte Mr Prestwood zum Zeitpunkt des Unglücks nicht in England. Er war wenige Tage zuvor zu einer ausgedehnten Studienreise aufgebrochen, die ihn über Frankreich, Savoyen, Venetien und den Balkan bis nach Griechenland führen sollte. Die Nachricht seiner Bestellung erreichte ihn daher erst mehr als ein Jahr später, als er wieder in die Heimat zurückkehrte. Ohne seine Zustimmung waren dem alten Rechtsanwalt die Hände gebunden. So kam es, dass Sebastian zwar den stolzen Titel eines Marquess trug, aber nicht an das ererbte Vermögen herankam. Was wiederum bedeutete, dass er keine Löhne zahlen konnte und auch nicht die Mittel hatte, das standesgemäße Leben für seine Schwester und sich aufrechtzuerhalten. Als Erstes verließ sie der Butler. Den hatte der Vater allerdings erst wenige Monate vor dem Unfall eingestellt und er war so arrogant, dass ihm niemand eine Träne nachweinte. Es folgten der Verwalter, was schon bei Weitem schwerer wog, dann alle Hausdiener und schließlich auch die Köchin, was am allerschlimmsten war. Als Einzige blieben Jack und Marie in ihren Diensten, ebenfalls ein Geschwisterpaar, das ihnen treu ergeben war. Sie waren auf dem Landsitz aufgewachsen und hatten kein anderes Zuhause. Marie, das Küchenmädchen, stieg zur Köchin auf und Jack, der Stallbursche, begleitete seinen jungen Herrn zum Fischen und auf die Jagd und warf sich in die Uniform des ersten und einzigen Hausdieners, wann immer es nötig erschien.
Zum Glück für die vier jungen Leute gab es auch noch Mrs Allington, die Haushälterin. Sie war als Mädchen unter dem Großvater der Zwillinge ins Haus gekommen und wurde, seitdem die beiden denken konnten, von allen Kindern Tante Alli gerufen. Seit dem Tod der Eltern war Alli ihr einziger Halt. Sie führte nicht nur den Haushalt, sondern stand den Geschwistern auch mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem unterwies sie Amabel in allen Belangen der Haushaltsführung und fungierte als ihre Anstandsdame, wenn diese, was ohnehin selten vorkam, das Haus verlassen wollte. Wohin hätte die junge Lady auch gehen sollen? Für einen Bummel durch die verlockenden Läden der kleinen Stadt fehlte ebenso das Geld wie für den Besuch der Schneiderin. Da sie in Trauer war, scheuten die Nachbarn davor zurück, sie einzuladen. In den ersten Wochen waren noch einige Karten abgegeben worden, die nicht nur das Beileid zum Ausdruck brachten, sondern sie auch zum Tee baten. Da hatte sie dann mit Damen, die sie kaum kannte, in deren Wohnzimmern gesessen und war von Mitleid überhäuft worden, was sie nur sehr schwer ertrug. Manche nutzten die Gelegenheit, neugierige Fragen zum Unfall zu stellen oder Gerüchte an ihre Ohren zu tragen, wie sich das Unglück angeblich abgespielt hatte, was sie noch schwerer ertrug. Der Rechtsanwalt hatte es nicht für notwendig erachtet, sich persönlich nach Beaconsfield zu bemühen. Stattdessen hatte er dem jungen Marquess kurz und knapp mitgeteilt, dass ihm die Hände gebunden waren, bis der Vormund nach England zurückkehren würde, und dass seine Lordschaft daher davon absehen möge, ihm weitere, wie er es nannte, Bettelbriefe zu schicken.
»Jetzt weiß ich, was ich als Erstes tun werde, sobald ich volljährig bin«, hatte Sebastian verkündet und das Schriftstück ganz nach hinten in die Schreibtischlade gestopft. »Ich kündige diesem schrecklichen Menschen und verpflichte einen neuen Rechtsbeistand.«
In den kommenden Wochen und Monaten sollten noch ganz andere Dinge dazukommen, die er an seinem 21. Geburtstag als Erstes erledigen wollte. Da bis dahin allerdings noch viele Monate ins Land ziehen würden, hatte er mit seiner Schwester und Tante Alli beratschlagt, wie sie es schaffen konnten, finanziell über die Runden zu kommen, bis der unbekannte Vormund auf der Bildfläche erschien. Nahezu alle Pferde wurden verkauft. Außerdem Vaters Phaeton und der kleine, gut gepolsterte Wagen, mit dem Mutter gern übers Land gefahren war, um Pächter zu besuchen und sie mit Marmeladen und anderen Lebensmitteln aus dem Herrenhaus zu versorgen. Man behielt lediglich Sebastians Reitpferd Firefly und einen Wallach, den man gut vor den altersschwachen Gig spannen konnte.
Hatten sie gehofft, dass ihnen diese Maßnahmen erlauben würden, ein paar Ersparnisse zur Seite zu legen, so wurde das Vorhaben bereits zwei Monate später durch den Sturm zunichtegemacht, der einen Teil des nördlichen Flügels abdeckte. Ihre angespannte finanzielle Situation hatte sich im Landkreis herumgesprochen. Der Dachdecker, der, wie viele andere Respekt vor dem hohen Titel und auch Mitleid mit dem jungen Marquess hatte, kam zwar auf der Stelle, verlangte aber die vollständige Bezahlung vorab, bevor er bereit war, auch nur zum Hammer zu greifen. Damit waren ihre Ersparnisse dahin und sie aßen seither ausschließlich das, was der Küchengarten und das kleine Glashaus hergaben. Zudem hielten sie Hühner und auch zwei Kühe, die Jack mit Hingabe molk, bevor er sich oft mit seinem jungen Herrn auf den Weg machte, um Wildbret zu erlegen. Längst waren die beiden über alle Standesgrenzen hinweg so etwas wie Freunde geworden. So durfte er auf diesen Jagdausflügen das einzige intakte Gewehr benutzen. Sebastian war ein begnadeter Bogenschütze, der selbst bei geflügeltem Jagdgetier mit Pfeilen stolze Erfolge erzielte.
»Zwei Rehböcke, ein Fasan«, meldete sich Sebastian an diesem kalten Märztag von der Tür zum Wohnzimmer her und hielt mit strahlendem Lächeln das Federvieh in seiner Rechten hoch. »Jack wird heute Nachmittag einen der Böcke zum Schmied bringen, um ihn gegen Werkzeug und Schießpulver einzutauschen. Außerdem kann Firefly endlich neu beschlagen werden.«
Seine Schwester ließ die Stickerei in ihren Händen sinken und strahlte ihm entgegen. »Waidmanns Heil, mein lieber Bruder! Hoffentlich kann Jack in der Stadt auch ein paar zusätzliche Eisblöcke auftreiben. Dann sollte uns der Bock gut über die nächsten Wochen bringen.«
»Großartig gemacht, Master Sebastian«, meldete sich auch Mrs Allington lobend zu Wort, die neben Amabel auf dem wuchtigen dunkelgrünen Sofa beim Fenster saß. Vor ihr auf dem Boden stand ein Korb voll mit Bettwäsche, bei der es Risse zu flicken und Knöpfe zu ersetzen gab. Sie trug wie immer eines ihrer dunkelgrauen Kleider, deren Knöpfe mit demselben Stoff überzogen waren und die bis zum Hals geschlossen wurden. Ihre Haare hatten mit den Jahren die Farbe der Kleidung angenommen, sie waren zu einem Zopf geflochten und streng am Hinterkopf aufgesteckt. Auf der Nase thronte der unvermeidliche Zwicker, über dessen Rand sie ihren jungen Herrn nun mit strengem Blick ansah. »Aber unterstehen Sie sich, mit derart schmutzigen Stiefeln das Wohnzimmer zu betreten, junger Mann. Am besten bringen Sie das tote Geflügel umgehend in die Küche, damit Marie sich darum kümmern kann.«
Der Marquess hatte schon kehrtgemacht, als die Stimme seiner Schwester ihn zurückhielt: »Sebastian, kannst du Marie bitten, mir die schönsten Federn zur Seite zu legen? Wenn ihr tatsächlich der Meinung seid, dass ich meine Trauerkleidung ablegen darf, dann möchte ich gleich heute Nachmittag, noch bevor wir losreiten, den alten Strohhut ein wenig aufputzen.«
»Heute Nachmittag?« Mrs Allington, die eben konzentriert einen Faden durch das Nadelöhr ziehen wollte, hielt inne. »Was ist denn heute Nachmittag? Haben Sie beide etwas Besonderes vor?«
»Sebastian und ich werden nach Wooburn Green reiten«, erklärte Amabel. »Dort hat ein Wanderzirkus seine Zelte aufgeschlagen.«
»Er will in wenigen Tagen weiterreisen und wir dürfen auf keinen Fall versäumen, uns eine seiner Vorstellungen anzusehen!« Sebastians Begeisterung war unüberhörbar. »Im Lion & Heart schwärmten sie von den Akrobaten. Man sagt, es gäbe sogar einen Mann, der in der Lage wäre, Feuer zu schlucken.«
»Ach ja, richtig, der Zirkus. Wie konnte ich den nur vergessen? Dass Sie mir ja gut auf Ihre Schwester aufpassen, Master Sebastian«, meinte Mrs Allington, die seine Begeisterung offensichtlich nicht teilte. »Wollen Sie nicht doch lieber den Gig nehmen? Zu zweit auf einem Pferd, das ist doch nicht das Richtige.«
»Mit dem alten Karren sind wir viel zu langsam«, protestierte der junge Hausherr umgehend. »Außerdem könnte man uns glatt für Bauern oder Tagelöhner halten. Nein, nein, keine Sorge, Tante Alli, wir nehmen wie immer Firefly. Da Amabel so ein Leichtgewicht ist, kommt er mit uns beiden gut zurecht.«
»Wenn Sie das sagen.« Mrs Allington seufzte und wandte sich wieder dem Faden zu.
»Ich bin schon sehr gespannt, was uns erwartet«, erklärte Amabel, schwieg dann abrupt und drehte sich zum Fenster. »Hört ihr das auch? Das klingt nach Kutschenrädern. Es hat den Anschein, als bekämen wir Besuch.«
Da dies nicht häufig der Fall war, war die Aufregung in ihrer Stimme nicht zu überhören. Die Stickerei wurde achtlos auf das Sofa geworfen und schon trat sie mit raschen Schritten ans Fenster. Sebastian vergaß Tante Allis strenge Ermahnungen und war im nächsten Augenblick an ihrer Seite.
»Es handelt sich um einen geschlossenen Landauer«, wandte er sich über die Schulter zurück an die Haushälterin. »Nicht mehr ganz taufrisch, wie mir scheint. Haben Sie eine Ahnung, wer uns besuchen könnte? Wir erwarten doch niemanden, oder?«
»Was für eine schreckliche Farbe! Wenn wir wieder zu Geld kommen, Sebastian, dann darfst du für deine Kutsche keinesfalls so ein entsetzliches Rotbraun verwenden«, bestimmte seine Schwester.
Wie ähnlich sich die beiden doch sind und wie ähnlich sie sich sehen, dachte die Haushälterin mit einem gerührten Lächeln, steckte die Nadel in den Stoff und begann, das Kopfkissen, an dem sie gearbeitet hatte, zusammenzufalten. Die Geschwister hatten die gleichen hellbraunen Locken, die gleichen bernsteinfarbenen Augen, dasselbe offene Lachen. In der Statur unterschieden sie sich allerdings, was sie nur als Glück betrachten konnte. Sebastian war um einige Zentimeter größer als seine Schwester und muskulös, Amabel hingegen zierlich. Es wärmte ihr das Herz, wenn sie daran dachte, wie gut die beiden die letzten Monate gemeistert hatten. Trotz aller Trauer hatten sie stets zusammengehalten, ohne auch nur einen Augenblick lang in Bitterkeit zu verfallen. Mrs Allington hoffte so sehr, dass es der lang ersehnte Vormund war, der da vor dem Haustor eintraf. Und dass dieser bereit war, den Zwillingen endlich wieder jenes Leben zu ermöglichen, das ihnen von Geburt aus zustand. Dann könnte sie sich nämlich ruhigen Gewissens um ihre bettlägerige Schwester Maud kümmern, die in einem Häuschen am Stadtrand von Beaconsfield lebte. Bisher war ihre Nichte Prudence für die Pflege zuständig gewesen. Doch die hatte sich, um das dringend nötige Geld zu verdienen, erst kürzlich auf mehrere Inserate gemeldet, in denen ein Kindermädchen gesucht wurde. Wer wusste also, wie lange sie noch im Landkreis blieb? Mrs Allington seufzte. Apropos dringend nötiges Geld, das fehlte auch hier an allen Ecken und Enden.
Herr, lass es Mr Prestwood sein, flehte sie insgeheim. Wenn Gott ihre Gebete erhörte, dann würde es künftig genügend zu essen und die nötigen Mittel für dringende Reparaturen geben. Und wenn er ganz besonders gnädig war, dann würde sich der Vormund als verheiratet erweisen und die Geschwister zu einem Debüt nach London einladen. Um nicht falsche Hoffnungen zu erwecken, waren das indes keine Gedanken, die sie mit ihren Schützlingen teilen wollte.
»Wer auch immer es ist«, sagte sie stattdessen trocken, »er wird nicht erfreut sein, tote Tiere im Wohnzimmer vorzufinden. Also ab mit Ihnen in die Küche zu Marie, Master Sebastian! Bitte geben Sie bei der Gelegenheit auch Jack Bescheid, dass er die Gäste in Empfang nehmen soll. Außerdem würde ich vorschlagen, dass Sie sich umkleiden und mit sauberem Schuhwerk wiederkommen. Und Sie, meine Liebe«, wandte sie sich an Amabel, während Sebastian aus dem Zimmer eilte, »treten am besten vom Fenster weg. Eine Lady kann so neugierig sein, wie sie möchte, aber sie darf sich nicht dabei erwischen lassen.«
Amabel tat, wie ihr geheißen, ohne jedoch den Vorplatz gänzlich aus den Augen zu lassen. Der Kutscher war inzwischen vom Bock gestiegen und hatte den Wagenschlag der ausladenden, altmodischen Kutsche geöffnet. Zuerst wurden Männerbeine in abgetragenen schwarzen Stiefeln sichtbar und schon stand der Besucher auf dem Vorplatz.
»Es ist ein Gentleman«, informierte sie die Haushälterin. »Äh … das nehme ich zumindest an.«
Nun war Mrs Allington doch selbst zu neugierig, um dem Fenster länger fernzubleiben.
»Was soll das heißen?«, fragte sie stirnrunzelnd. »Sie werden doch auf einen Blick erkennen können, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt.«
»Es handelt sich ohne Zweifel um einen Mann«, bestätigte Amabel, ohne zu zögern. »Ob es sich dabei allerdings um einen Gentleman handelt, wage ich zu bezweifeln. Sehen Sie sich nur seine Haare an, Tante Alli. Erscheinen sie Ihnen nicht auch ein wenig ungepflegt? Und dann erst dieser altmodische Rock aus braunem Samt mit den seltsamen Verschlüssen.« Sie drehte sich zur Haushälterin um. »Diesen Mann habe ich mit Sicherheit noch nie gesehen. Können Sie sich vorstellen, warum er so einen schäbigen, flachen Hut trägt? Die beiden Pfauenfedern wollen so gar nicht dazu passen.«
Mrs Allington, die den Besucher nun ebenfalls durch den Vorhangspalt beobachtete, beschlich ein ungutes Gefühl. Wenn er der war, für den sie ihn hielt, dann hieß das, dass sich ihre Hoffnungen zwar erfüllten, aber damit gleichsam für immer unerfüllt blieben. Denn wenn das tatsächlich der lang herbeigesehnte Vormund war, dann verhieß bereits sein Äußeres nichts Gutes. Ohne ein Wort zu sagen, ging sie zum Sofa hinüber, schnappte den Wäschekorb und schob ihn hinter die schmale Tapetentür neben dem Kamin, hinein in das enge Treppenhaus, das direkt in den Garten führte. Da es seit Jahren nicht mehr benutzt wurde, diente es als Abstellraum für allerlei Krimskrams. Dann ging sie zum Sofa zurück, um die Kissen aufzuschütteln und den Teetisch wieder an seinen üblichen Platz zu rücken.
»Er ist nicht allein«, fiel Amabel in diesem Augenblick auf. Ein weiterer Gentleman hatte die Kutsche umrundet und stellte sich soeben neben den Mann mit dem Hut. Sie wechselten einige Worte, die sie von ihrem Platz aus nicht verstehen konnte. Er überragte den anderen um mindestens zwei Haupteslängen und war ungewöhnlich schlank, ja geradezu mager. Sein längliches, schmales Gesicht war bleich, die langen gelblichen Zähne ebenso hervorstehend wie seine Augen. Es waren Augen, die dauerhaft den Eindruck vermittelten, er würde etwas Schreckliches erblicken.
»Hoffentlich kommt Sebastian bald zu uns zurück. Die beiden Männer da unten auf dem Vorplatz scheinen keine besonders angenehmen Zeitgenossen zu sein«, befand Amabel. »Ah, da tritt ja auch schon Jack zu ihnen.«
Der Diener war mit grinsendem Gesicht aus dem Haupttor gekommen, um die Neuankömmlinge nach ihren Wünschen zu fragen.
»Er hat die Zeit genutzt, um sich umzukleiden«, stellte die Haushälterin zufrieden fest. »Das ist gut. Es wäre nicht das Richtige gewesen, die Besucher im Jagdgewand zu empfangen. Trotz ihres wenig einnehmenden Äußeren dürfte es sich um Mitglieder der Oberschicht handeln. Es würde mich nicht wundern, wenn sie aus London kämen.«
»Aus London?« Amabel fuhr zu ihr herum. »Sie meinen doch nicht etwa, dass es sich bei einem der beiden Herren tatsächlich um unseren Onkel handeln könnte?«
Wie innig hatte Amabel in den letzten Monaten dessen Besuch herbeigesehnt. In ihren Träumen war er ein freundlicher, älterer Gentleman, in Güte und Herzenswärme dem armen Papa nicht unähnlich. Nie hätte sie damit gerechnet, dass sie ihn vom ersten Anblick an unsympathisch finden könnte. Oder gar, dass er auftauchen und sie sich wünschen würde, er wäre auf dem Kontinent geblieben.
»Nun«, sagte Mrs Allington und nichts in ihrer Stimme verriet die Aufregung, die sie verspürte, »das halte ich durchaus für möglich. Schließlich ist es höchst an der Zeit, dass er seine Pflichten Ihnen gegenüber wahrnimmt.« Sie fing Amabels Blick auf: »Lassen Sie uns keine voreiligen Schlüsse ziehen, meine Liebe. Manchmal täuscht das Äußere. Vielleicht hat er ja einen besonders schönen Charakter.«
Von der Halle her waren Schritte zu hören, die sich entschlossen dem Wohnzimmer näherten. Wie auf Kommando drehten sich beide Frauen zur Tür, strichen sich die Röcke glatt und schauten, die Ältere einige Schritte hinter der Jüngeren, mit gebanntem Blick zur Tür. Jack, der als Erstes eintrat, vermittelte nicht den Eindruck, den man sich von einem Diener eines hochadeligen Hauses wünschte. In der Eile hatte er sein Jackett falsch geknöpft, sodass es nun schräg vor seiner Brust geschlossen war. Den Schuhen fehlte der Glanz, die Haare standen ihm vom Kopf ab, aber er bemühte sich zumindest mit seinem Verhalten tapfer, einen herrschaftlichen Eindruck zu erwecken: »Mr Edgar Prestwood, Mylady. Und Mr«, weiter kam er nicht, da hatte ihn der Mann mit dem flachen Hut in der Hand schon zur Seite gedrängt.
»Kein Grund für so ein förmliches Getue, Bursche, wir sind schließlich eine Familie. Jetzt geh und bring uns den Grog, den ich verlangt habe. Staubige Landstraßen machen staubige Kehlen. Du bist also meine Nichte. Lass dich ansehen!«
Amabel versank in einen Knicks und spürte, dass die Haushälterin hinter ihr es ihr gleichtat. Hatte sie wirklich gedacht, das karge Leben wäre ihre größte Herausforderung? Nun sah sie ganz andere Probleme auf sich zukommen. Vor allem, da der Begleiter ihres Onkels sie wie ein saftiges Stück Rindfleisch musterte, das er in nicht allzu langer Zeit zu verspeisen gedachte. Tatsächlich leckte er sich bereits mit der Zunge über die bläulichen Lippen. Sie befahl sich, den Blick abzuwenden, was ihr nicht allzu schwer fiel, und ihren Onkel zu begrüßen: »Willkommen auf Millcombe Castle, Oheim. Wir freuen uns sehr, dass Sie es nun doch einrichten konnten, uns aufzusuchen.« Ha, diese Spitze hatte sie sich nicht verkneifen können. »Mein Bruder, der Marquess, wird sich in Kürze zu uns gesellen. Es gibt so vieles, was wir mit Ihnen besprechen möchten.«
Sie reichte die Rechte zu ihm hinauf und erschrak, als sie spürte, wie kalt und feucht seine Finger waren. Am liebsten hätte sie ihre Hand am Rock des Kleides abgewischt, so sehr ekelte es sie vor dieser Berührung. Der Onkel verbeugte sich angemessen und musterte sie dann von oben bis unten, während sie sich erhob. Was er sah, schien ihm zu gefallen.
»Sauber!«, sagte er und schnalzte mit der Zunge, um sein Wohlwollen über ihr Aussehen zum Ausdruck zu bringen. »Ich habe nicht damit gerechnet, dass die arme Samantha, Gott hab sie selig, so etwas Ansehnliches hervorzubringen vermochte. Da werden wir nicht lange brauchen, um dich passend unter die Haube zu bringen.«
Amabel hörte, wie Mrs Allington hinter ihr scharf die Luft einzog. Hatte dieser Mann tatsächlich die Dreistigkeit besessen, ihre Mutter zu beleidigen und gleichzeitig so zu tun, als wäre es ein Kompliment? Sein Lächeln vertiefte sich, als er ihren erschrockenen Blick wahrnahm. Eine Bewegung im Augenwinkel ließ ihn herumfahren: »Warum steht denn dieser dämliche Kerl immer noch da, verdammt noch mal?« Schlagartig war jede auch noch so falsche Freundlichkeit aus seiner Stimme gewichen. »Ab in die Küche mit dir, du Lümmel«, herrschte er Jack an. »Hol den Grog und sag dem Butler Bescheid, dass ich ihn zu sprechen wünsche. Auf der Stelle!«
Der Diener trat unschlüssig von einem Bein auf das andere. »Wir haben keinen Rum im Haus«, gestand er schließlich.
Da fand es Amabel an der Zeit, ihre Sprache wiederzufinden. Dass ihr Onkel sie selbst einschüchterte, war eine Sache, aber ihre treuen Dienstboten würde sie mit Zähnen und Klauen verteidigen.
»Danke, Jack«, sagte sie daher und bemühte sich, ruhiger zu klingen, als sie sich fühlte. »Bring unseren Gästen Tee und am besten auch noch etwas von Maries herrlichem Kuchen. Dann kümmere dich um die Pferde.«
Der Diener nickte dankbar, verneigte sich und beeilte sich, aus dem Raum zu kommen. Rechtzeitig, um den Gast noch brüllen zu hören: »Tee? Wieso denn Tee? Wenn ich Grog sage, dann meine ich Grog! Du kannst dich gleich damit vertraut machen, dass meine Wünsche Gesetz sind, Mädchen. Denn anderenfalls werden wir es schwer haben, miteinander auszukommen.« Er trat zu ihr hin und hob ihr Kinn mit seiner behandschuhten Rechten ein Stück an. »Du willst doch, dass wir gut miteinander auskommen, nicht wahr? Das willst du doch?«
Seine Worte klangen so bedrohlich, dass Amabels Herz bis zum Hals schlug und ihr nichts anderes einfiel, als zu nicken. Dabei hätte sie am liebsten zugeschnappt und ihn in die Finger gebissen.
»Gut«, sagte er zufrieden und ließ das Kinn wieder los. Sein Atem verriet, dass es nicht der erste Grog des Tages war, nach dem er verlangt hatte. Amabel atmete erleichtert auf, als er einige Schritte zur Seite ging, um die Gemälde an der den Fenstern gegenüberliegenden Wand in Augenschein zu nehmen.
»Unsere finanziellen Mittel sind im letzten Jahr ebenso geschrumpft wie die Vorräte und die Anzahl des Personals«, bemühte sie sich, ihrer Stimme einen festen Klang zu geben. »Da wir nicht mit der nötigen Barschaft ausgestattet waren, verfügen wir weder über Rum, der für einen anständigen Grog notwendig wäre, noch über einen Butler. Wie Sie natürlich selbst am besten wissen, Onkel, ist mein Bruder noch nicht volljährig und kann somit nicht über das Vermögen verfügen, das ihm von Rechts wegen zusteht.«
»Ihm steht von Rechts wegen gar nichts zu!«, fuhr er sie an. »Ich bin sein Vormund. Also schweig und halte mich nicht mit einem Gestammel auf, das niemanden interessiert. Wo ist der Weinkeller? Gib mir den Schlüssel, Mädchen, ich mache mir selbst ein Bild über den Zustand dieses verlotterten Haushalts. Wollen wir doch sehen, ob es mir nicht doch gelingt, die eine oder andere Flasche Branntwein aufzuspüren.«
Mrs Allington hatte sich im Hintergrund gehalten. Wäre sie tatsächlich Amabels Tante gewesen, so hätte sie sich längst zu Wort gemeldet, so aber hielt sie es für angemessener zu schweigen. Nun aber hatte er ihren Wirkungskreis beleidigt und das war etwas, das sie nicht unwidersprochen hinnehmen konnte.
»Dieser Haushalt ist keineswegs verlottert«, widersprach sie so scharf, dass Amabel sich erschrocken umwandte. »Hätten Sie uns mit den nötigen Mitteln ausgestattet, Sir, so hätten wir ihn natürlich auf einem angemesseneren Standard halten können.«
Prestwood zog eine Augenbraue hoch und wandte sich an sein Mündel. »Wer ist denn die?«, wollte er wissen. Es war, als wäre ihm die Anwesenheit der Älteren erst durch ihre Wortmeldung aufgefallen.
»Das ist … äh … meine Tante. Mrs Allington.« Sie warf der Haushälterin einen bittenden Blick zu, jetzt nur ja nicht zu widersprechen. Sie wollte diesem schrecklichen Kerl keinesfalls schutzlos ausgeliefert sein. Und das wäre sie, würde er wissen, dass sie zur Dienerschaft gehörte.
»Allington?«, wiederholte er und zog die Stirn kraus. »Ich habe nie etwas von einer Familie Allington gehört. Du etwa, Tuckenhay?« Er blickte zu seinem Begleiter hinüber, der umgehend den Kopf schüttelte. Dabei trat er einen Schritt vor, unschlüssig, ob er sich nun selbst mit den Damen bekanntmachen sollte.
»Mrs Allington ist die Cousine meiner Mutter«, beeilte sich Amabel zu flunkern. »Sie stammt aus … aus …«
»… Newcastle«, ergänzte die falsche Tante den Satz.
»Na, dann ist es kein Wunder, dass ich noch nichts von Ihrer Familie gehört habe, Madam«, erklärte Mr Prestwood und verzog unwillig die Lippen. »Ich habe zwar den Kontinent bereist, aber so weit hinauf in den Norden unseres Königreichs habe ich es noch nicht geschafft.« Dann schien er sich doch an seine Manieren zu erinnern. Er trat vor die Haushälterin hin und verbeugte sich. »Ich hatte ja keine Ahnung … Sie sehen so … aber egal. Ich habe Sie für eine Dienstmagd gehalten, Madam, wenn Sie die Wahrheit wissen wollen. Aber gut, wenn die Sachlage eine andere ist, muss ich mich wohl entschuldigen. Edgar Prestwood, Mrs … äh … zu Ihren Diensten. Darf ich Ihnen auch meinen Freund vorstellen? Mr Jasper Tuckenhay.«
Er gab seinem Begleiter, der noch einige weitere Schritte vorgetreten war, einen Klaps auf den Hinterkopf: »Mach schön deinen Diener, Tucky, damit ich mich nicht für dich schämen muss.« Er ließ ein unangenehmes Lachen hören.
Der blasse Mann zögerte nicht zu tun, wie ihm geheißen. Er verbeugte sich zuerst vor Mrs Allington und trat dann ein paar Schritte zur Seite, um Amabel zu begrüßen. Diese bemerkte, wie er sie wieder von oben bis unten musterte, und Gänsehaut kroch über ihren Rücken. Was er sah, gefiel Mr Tuckenhay offensichtlich, denn er leckte sich abermals mit der Zunge über die bläulichen Lippen.
»Mund zu!«, forderte Mr Prestwood und lachte abermals spöttisch auf. »Meine kleine Nichte hier ist für einen wie dich außer Reichweite. Es sei denn, du schaffst es endlich, deinem werten Herrn Onkel eine Apanage von mindestens zehntausend abzuringen.«
Amabel ließ einen erschrockenen Laut hören. Als sie und Sebastian das Kommen des unbekannten Vormunds herbeigesehnt hatten, wäre es ihnen nie in den Sinn gekommen, dass er ihre Lage nicht verbessern, sondern dramatisch verschlechtern könnte. Bis zu ihrem Geburtstag im Januar waren es noch zehn ganze Monate. Zehn Monate, in denen sie und ihr Bruder dem Vormund auf Gedeih und Verderb ausgeliefert waren. Hatte er etwa wirklich vor, sie mit dem ekelhaften Kumpanen zu vermählen, wenn dieser die gewünschte Anzahl von Scheinen auf den Tisch legte?
»Selbst dann bleibt sie für ihn außer Reichweite«, hörte sie Mrs Allington hinter sich murmeln und atmete auf. Gemeinsam mit Tante Alli würden sie schon einen Weg finden, die Zeit dieser Vormundschaft zu überstehen.
»Wie meinen?« Mr Prestwoods Brauen zogen sich zusammen. Der Haushälterin wurde bewusst, dass ihr Gemurmel bis an seine Ohren gedrungen war, und sie hielt es für ratsamer, die Worte nicht zu wiederholen. Zu ihrem Glück trat in diesem Augenblick Jack mit dem Teetablett ein. Gefolgt vom jungen Hausherrn selbst, der, wie sie mit Stolz feststellte, im Rock seines Papas einen durchaus erwachsenen Eindruck machte.
Kapitel 3
Etwa ein Monat vor dem Treffen in Watford An Bord der »Queen Anne« auf dem Weg nach Dover April 1812
Vor einigen Jahren hatte er gelesen, dass mehrere Seelen in der eigenen Brust miteinander kämpfen konnten, doch erst jetzt verstand er den Sinn dieses Satzes. Major Harold Westfield stützte sich mit beiden Händen an der Reling ab und starrte auf das graue Wasser, ohne es wirklich wahrzunehmen. Anders als im Atlantik war das Meer hier im Ärmelkanal unbewegt und so hatte sich sein Magen wieder beruhigt und auch die Wunde unter dem linken Rippenbogen pochte nicht mehr ganz so stark. Er spürte, wie ihm der auffrischende Wind durch die langen blonden Haare strich, die sich längst aus dem Zopf gelöst hatten, den er für gewöhnlich trug, und sich die salzige Luft auf seine Lippen legte. Vor allem aber spürte er das schlechte Gewissen, seine Kameraden im Stich gelassen zu haben, und gleichzeitig eine tiefe Sehnsucht, endlich wieder nach Hause zu kommen.
Je weiter er sich von Spanien entfernte, je näher er der Heimat kam, desto inniger wurde das Glücksgefühl. Vier Jahre hatte er nun auf dem Kontinent verbracht, um auf der Iberischen Halbinsel gegen die Truppen von Napoleon, diesem vermaledeiten Korsen, zu kämpfen. In Gedanken trieb er Jupiter, seinen Wallach, immer noch über staubtrockene Lehmböden, duckte sich unter den Ästen knorriger Olivenbäume und atmete den Duft von Thymian und Rosmarin. Vor allem aber roch er Blut. Dieser beißende Gestank von Eisen und Verwesung schien sich für immer in seiner Nase festgesetzt zu haben. Dazu hörte er das Geschrei der Verwundeten, spürte das hilflose Gefühl, ihnen nicht helfen, ja nicht einmal beim Sterben beistehen zu können. Dann war da noch die Hitze, diese unerträgliche, übergroße Hitze! Der Schweiß schien ihm auch jetzt noch unter der dicken Uniformjacke in Bächen über den Körper zu rinnen. Der Lärm von abgefeuerten Kanonen, das Surren von Gewehrkugeln, die ihn zum Glück fast alle verfehlt hatten, all das war ihm immer noch präsent.
Auch an diesem kalten Apriltag schien die Sonne, während die weißen Klippen von Dover in sein Blickfeld gerieten. Mit dem Ärmel seiner blauen Jacke wischte er sich Tränen aus den Augenwinkeln. Ob sie ihm aus Erleichterung, die Hölle heil überstanden zu haben, in die Augen getreten waren oder aus Freude, die Heimat wiederzusehen – er wusste es nicht und es war ihm auch egal. Hätte ihn jemand danach gefragt, dann hätte er dem Wind die Schuld gegeben und dem Salz des Meeres, das auf seinen geröteten Wangen brannte. Er fuhr herum, als er die trampelnden Schritte zweier Matrosen vernahm, die, jeder ein Bündel Seile um die Schulter, an ihm vorübereilen wollten.
»Wo finde ich Captain Whittaker?«, begehrte er zu wissen. »Ich würde gern erfahren, wie lange es noch dauert, bis wir am Hafen anlegen.«
»Worthaker, Major. Unser Captain heißt Worthaker«, berichtigte ihn einer der Seeleute. Harold verzog das Gesicht, strich sich mit der Rechten über den Nacken, was er immer tat, wenn ihm etwas unangenehm war, und verfluchte sein schlechtes Namengedächtnis. »Worthaker, ja natürlich«, murmelte er.
»Der steht am Steuerrad, Major. Sie würden nicht wollen, dass er es jetzt aus der Hand lässt, glauben Sie mir. Ihre Frage kann auch ich beantworten. Etwa noch eine Stunde, dann haben wir’s geschafft.« Die Matrosen salutierten und eilten mit großen Schritten weiter das Deck entlang. Harold rief ihnen einen Dank hinterher, den der Wind davontrug. Dann ging er in seine Kajüte ins erste Unterdeck hinunter, um seine Sachen zusammenzusammeln. Viel war es nicht, was er bei sich trug, denn als Offizier war er es gewöhnt, mit leichtem Gepäck zu reisen. Außerdem war der Großteil seines wenigen Hab und Guts im Januar dem Kanonenhagel von Ciudad Rodrigo zum Opfer gefallen. Genauso wie Jupiter, sein geliebtes Pferd. Und Riley, sein armer Bursche, der ihm seit Jahren treu zur Seite gestanden hatte. Ob er je wieder einen Diener finden würde, mit dem er sich ohne Worte verstand? Der Major schüttelte leicht den Kopf, und seine Rechte griff zur Brusttasche seines Rocks, um zu überprüfen, ob die beiden wichtigsten Gegenstände, die er bei sich trug, sicher verwahrt waren. Das eine war die Army Gold Medal, die man ihm für Tapferkeit und Verdienste in eben jener Schlacht nahe der portugiesischen Grenze verliehen hatte. Er hatte das Kommando übernommen, als Generalmajor Craufurd von der Light Division beim Sturm auf die Festung getötet worden war. Black Bob, wie ihn alle nannten, war eines seiner großen Vorbilder gewesen. Harold seufzte und zwang sich, nicht schon wieder an diesen Tag zurückzudenken, der ihm seit Monaten fast jede Nacht den Schlaf raubte. Stattdessen klopfte er auf ein Konvolut von Papieren. Man hatte ihm Dokumente und ein Schreiben des Generals mit dem Befehl anvertraut, alles schnellstmöglich im Kriegsministerium abzugeben. Daraufhin legte sich seine Linke auf die Hosentasche, wo ein prall gefüllter Geldbeutel davon zeugte, dass es sich gelohnt hatte, in Spanien sparsam mit dem Sold umzugehen. Er würde bequem und vor allem auch sicher nach London weiterreisen können.
So kam es, dass er kaum zwei Stunden später in einer modernen Reisekutsche Platz nahm, deren Miete sich nur wirklich Betuchte leisten konnten und die von einem Mann gelenkt wurde, der im Unterschied zu so manchem Postkutscher nüchtern war. Harold lehnte sich müde, aber zufrieden in die dunklen Lederpolster zurück. Er konnte sich an der Landschaft, die an ihm vorbeizog, kaum sattsehen. Saftige Wiesen statt verbrannter Erde. Die seit der Kindheit vertrauten groben Steinmauern, die die Felder von der Landstraße abtrennten. Alleen von Bäumen, deren Äste so tief hingen, dass Reisende, die die billigsten Plätze auf den Dächern der Postkutschen erklommen hatten, ständig den Kopf einziehen mussten. Auf den Weiden grasten wohlgenährte Rinder und Schafe, die so gar nichts mit den mageren, zähen Tieren des Südens gemeinsam hatten. Es hatte leicht zu regnen begonnen und ihm war, als könne es kein herzerwärmenderes Geräusch geben als das Pochen der Tropfen auf das Kutschendach. In Spanien war Regen selten und wenn, dann so heftig gewesen, dass er die militärischen Operationen erschwert und den trockenen Boden in eine Schlammwüste verwandelt hatte. Hier in England gehörte Regen zum gewohnten Bild und sorgte dafür, dass die Wiesen grün und saftig blieben.
Mit einem kleinen Lächeln lehnte er sich noch tiefer in die Polster zurück. Er war zu Hause. Er war wirklich und wahrhaftig wieder in England. Nun zeitigten sowohl die vielen schlaflosen Nächte, die von der Wunde verursachte Schwäche und auch das Rattern der Kutschenräder ihre Wirkung. Während ihm die Augen zufielen, überlegte er sich, was ihn in den kommenden Tagen erwarten würde. Als Erstes freute er sich auf ein weiches, sauberes Bett, auf ausreichend zu essen, auf ruhige Nächte, in denen ihn kein Kampfgefecht aus dem Schlaf reißen würde. Und irgendwie – es fiel ihm schwer, es vor sich selbst zuzugeben – freute er sich auch auf seine Mutter. War es nicht erbärmlich, dass sie derzeit die einzige Frau in seinem Leben war, die er liebte? Dabei war die verwitwete Baronin Tetbury laut, voller verrückter Ideen und hielt nie mit ihrer Meinung hinter dem Berg. Kurz: Sie war ihm nicht unähnlich. Zumindest dem Harold Westfield, der er gewesen war, bevor ihm die kalten Klauen des Krieges viel von seiner Unbeschwertheit genommen hatten. Wie sehr wünschte er sich, dass ein alter Spruch wahr werden würde und die Zeit alle Wunden heilte. Vielleicht kam der Tag, an dem er wieder aus vollem Herzen lachen konnte.
Energisch riss er sich zusammen. Welchen Sinn hatte es, in Selbstmitleid zu versinken? Stattdessen stellte er sich den Empfang bei seiner Mutter vor. Da sein Vater in der Zwischenzeit gestorben war und er keine Geschwister hatte, war sie seine einzige Familie. Außer seinem Halbbruder George natürlich, dem gegenwärtigen Baron, der aus Vaters erster Ehe stammte, sechzehn Jahre älter war als er und den sie beide nicht leiden konnten. Westfield freute sich, seine Mutter wiederzusehen, wusste aber, dass es nicht lange dauern würde, bis sie sich gegenseitig auf die Nerven gingen. Sobald er einen Überblick über seine finanzielle Lage gewonnen hatte, würde er sich eigene vier Wände suchen. Dies war umso schneller nötig, da Mama geschrieben hatte, sie sei nach Vaters Tod in ein schmales Stadthaus in der Hill Street gezogen. In solchen Gebäuden gab es höchstens drei Zimmer in jedem Geschoss. Da würden sie es nicht schaffen, einander aus dem Weg zu gehen. Abgesehen davon, dass Mutters tiefe Stimme und vor allem auch ihr Lachen ohnehin jede noch so dicke Wand mühelos durchdrang. Dennoch war er ihr zutiefst dankbar, dass sie ihn zu sich eingeladen hatte. Allein der Gedanke, sonst bei seinem Halbbruder in jenem Stadtpalais am Grosvenor Square, in dem er aufgewachsen war, unterkommen zu müssen, erfüllte ihn mit Schrecken. Tetbury war ein steifer, selbstgerechter Mann, den er schon als Junge nicht gemocht hatte. Seit es George gelungen war, die Tochter eines Earls zu ehelichen, war er unausstehlich geworden.
Bevor Harold der Schlaf übermannte, erkannte er mit einem Seufzen, dass ihn sein erster privater Weg zu ebendiesem Halbbruder führen musste. Hoffentlich hatte Papa nicht dessen Drängen nachgegeben, ihm, George, als dem Älteren und Träger des Titels, sämtlichen Besitz zu hinterlassen. Er, Westfield, würde seinen neuen Lebensabschnitt in der Heimat lieber wohlversorgt beginnen. Denn auch wenn er derzeit weder Weib noch Kinder, ja nicht einmal eine Mätresse zu versorgen hatte, war ein Aufenthalt in der Hauptstadt teuer und das, was er künftig als königlicher Beamter verdienen würde, keinesfalls ausreichend, um ihm einen standesgemäßen Hausstand zu ermöglichen. Nun denn, kommt Zeit, kommt Rat, dachte er und freute sich, dass er seine Unbeschwertheit nicht gänzlich verloren hatte. Während die Kutschenräder ihn seiner Zukunft entgegenratterten, fiel er das erste Mal seit Tagen in einen tiefen Schlaf.
Kapitel 4
Eine Woche vor dem Treffen in Watford In den Räumen des ehrwürdigen White’s Club, London
Während also die Geschwister Cavendish seit der Ankunft des Vormunds ihrer Zukunft mit bangem Herzen entgegenblickten und sich einer der Heroes, nämlich Major Harold Westfield, langsam wieder an das Leben in London gewöhnte, standen zwei weitere Heroes einem ganz anderen Problem gegenüber. Dieses war keineswegs neu und lautete: Wie schützen wir unseren Freund Oscar vor seinem verrückten Onkel?
»Glazebury, so eine Narretei können doch nicht einmal Sie ernst meinen.« Der ehrenwerte Mr Reginald Ashbourne hatte sich durch die ständig anwachsende Gruppe von Schaulustigen und Sensationsgierigen durchgekämpft und stand nun in deren erster Reihe. Der alte Earl hatte einen Stuhl erklommen und blickte siegessicher in die Runde. Ashbournes Vorwurf nahm er nicht einmal mit dem Zucken einer Augenbraue zur Kenntnis. Natürlich wusste dieser, dass es ihm nicht zustand, den Älteren öffentlich zu kritisieren. Irgendwann einmal, sobald der Cousin seines verstorbenen Vaters das Zeitliche gesegnet hatte, würde er ein Duke sein und im Rang über Glazebury stehen. Doch bis dahin war er nichts als ein simpler Mr Ashbourne und als solcher einem Earl gegenüber verpflichtet, den Mund zu halten. Noch dazu, da Glazebury mehr als doppelt so alt war wie er. Das hatte ihn allerdings noch nie davon abgehalten, das Wort zu ergreifen, wenn ihm der Sinn danach stand. Im Augenblick stand ihm der Sinn sogar sehr danach. Die kleine Gestalt des Earls sah auf einem wackeligen Stuhl noch grotesker aus als sonst. Wer bitte, so fragte sich Ashbourne, trägt heutzutage noch Perücke? Dichte, gepuderte graue Locken, die ihm bis zu den Schultern fielen, als lebten sie noch im achtzehnten Jahrhundert. Dazu trug er einen taillierten weinroten Samtmantel, der in seiner Jugend modern gewesen sein mochte und nun an den Ellbogen deutliche Spuren von Abnutzungen aufwies. Mit den sandfarbenen Kniebundhosen hätte er schnurstracks zu einer Audienz beim Prinzregenten gehen können, da der Hof weiterhin solche Beinkleider vorschrieb. Wären da nicht die geringelten Strümpfe in bunten Farben gewesen, die … die … Reginald überlegte, wo sie passend hätten sein können, allein es fiel ihm kein Anlass ein.