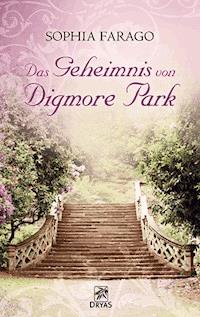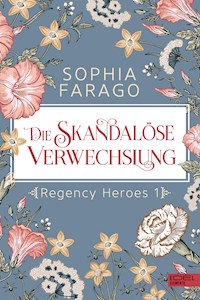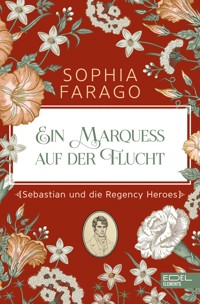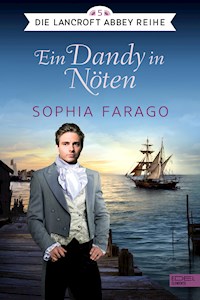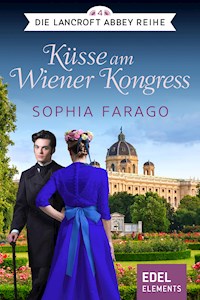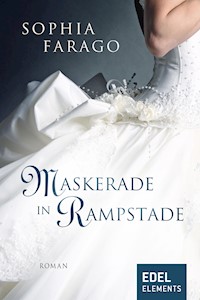7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gar seltsame Dinge geschehen in London 1812. So muss der junge, vormals reiche Grafensohn Emil von Kirchhoff als einfacher Emil Church am Gemüsemarkt von Mayfair Kisten schleppen. Wie kam er bloß in diese missliche Lage? Ja, wie hat es ihn überhaupt aus dem Kaiserreich nach London verschlagen? Und was, um Himmels willen, hatte Napoleon damit zu tun? Sein einziger Ausweg aus der bitteren Armut scheint das Testament seines englischen Großonkels zu sein, das bis zu seiner Volljährigkeit wohlverwahrt bei der Botschaft des Kaisertums liegt. Wirklich wohlverwahrt? Wie gut, dass sich sein Weg unverhofft mit einem der Regency Heroes kreuzt. Dann ist da noch die junge Lady Harriet Morrington, die in Männerkleidung aus dem Fenster klettert, um sich im verwilderten Garten mit Emil zu treffen. Wie sollen die beiden von einer gemeinsamen Zukunft träumen, wenn ihr Vormund sie mit dem Meistbietenden verheiraten will und Emil immer noch kein Geld hat? Als schließlich die Themse zufriert und auf dem Frost-Jahrmarkt ein Elefant übers Eis geführt wird, überschlagen sich die Ereignisse...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
Copyright © 2024 Edel Verlagsgruppe GmbH
Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2024 by Sophia Farago
Projektkoordination: Claudia Tischer
Lektorat: Dr. Rainer Schöttle
Korrektorat: Tatjana Weichel
Vermittelt durch: Michael Meller Literary Agency GmbH, München
ePub-Konvertierung: Datagrafix GSP GmbH, Berlin | www.datagrafix.com
Covergestaltung: Groothuis. Gesellschaft der Ideen und Passionen mbH | www.groothuis.de nach einer Reihengestaltung von Anke Koopmann | Designomicon
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
eISBN 978-3-96215-517-9
Emil und die Regency Heroes – Wie alles begann
Harold, Elliott, Reginald und Oscar kannten einander bereits seit der Schulzeit und waren spätestens seit dem Studium zu besten Freunden geworden. In Oxford hatte der Hausknecht auf alle Betthäupter im Schlafsaal die Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen gemalt: H E R O – so wurden die Regency Heroes geboren.
Mittlerweile waren die vier knapp über dreißig und Seite an Seite erwachsen geworden. Sie hatten die Titel und Güter ihrer Vorväter geerbt und Familien gegründet. Dabei wurden sie durch die zahlreichen Irrungen und Wirrungen des Lebens immer noch enger zusammengeschweißt. Eines Tages lernte Reginald den um einiges jüngeren Emil kennen …
Anmerkungen:
Dieser Roman erzählt Emils Geschichte. Sie lehnt sich an die vier Bände der Regency-Heroes-Reihe an, kann jedoch auch allein gelesen werden. Am meisten Spaß macht es trotzdem, wenn du auch das Leben der Heroes kennst und, mit Die skandalöse Verwechslung beginnend, in deren Welt eintauchst.
Eine Liste der wichtigsten Personen und Fachausdrücke findest du im Anhang.
Achtung! Wenn du Cliffhanger nicht leiden kannst, dann kannst du beruhigt das ganze Buch lesen. Nur den Epilog 2 ganz am Ende, den ersparst du dir lieber.
Kapitel 1
Damals im Kaisertum Österreich
Oktober 1811Irgendwo in der Wiener Innenstadt
„Servus miteinand’!“ Der alte Fiaker lüftete seinen speckigen Zylinder und brachte sein offenes Gefährt neben dem geschlossenen seines Kollegen zum Stehen. Dabei war es ihm völlig gleichgültig, dass sein Fahrgast, ein preußischer Offizier in Zivil, um eine zackige Beförderung gebeten hatte. „Na, wie schauen wir aus, Pepi? Es ist so ein schöner, warmer Herbsttag. Ich liefer’ den Herrn hier ab, und dann fahren wir hinaus zum Heurigen?“
„Nichts zu machen“, antwortete der andere und grinste breit. „Ich hab eine Porzellanfuhr, du verstehst? Das kann dauern.“
„Ja, dann“, sagte der Ältere und stimmte in das Grinsen ein. „Dann fahr halt deine Runden und kassier ordentlich ab. Ich gönn’s dir.“
Er schnalzte mit der Zunge, und seine beiden Pferde setzten sich in flottem Tempo wieder in Bewegung, während die Tiere des anderen in einen so langsamen Schritt verfielen, dass man den Eindruck gewinnen konnte, sie kämen kaum von der Stelle.
„Das verstehe ich nicht“, rief der Fahrgast aus dem fernen Berlin zum Kutschbock hinauf. „Welchen Sinn soll es denn haben, mit Porzellan im Wagen Runden zu drehen? Sollte man die kostbare Fracht nicht lieber schnurstracks an ihren Bestimmungsort bringen?“
„Aber woher denn!“ Der Kutscher ließ ein raues Lachen hören. „Da ist kein kostbares Geschirr nicht im Wagen. Da ist ein gnädiger Herr drin und sein Gspusi, seine weibliche Begleitung, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wenn jemand bei uns eine Porzellanfuhr bestellt, dann wissen wir, was das heißt: Immer schön langsam, und so lange im Kreis, bis der Herr fertig ist und klopft. Bis dahin darf man um Himmels willen nicht stören. Wenn man Glück hat, dauert so eine Fuhr mehr als eine Stunde und es gibt ordentlich Kohle, also Pinke-Pinke, verstehngans?“ Er blickte über die Schulter zurück und rieb zum besseren Verständnis zwei Finger und den Daumen aneinander.
„Sitten sind das hier!“, kommentierte der Berliner kopfschüttelnd.
„Das können’s laut sagen!“, gab ihm der Wiener recht. „Wir haben schon ein Glück.“
Die Insassen in der anderen Kutsche hörten vielleicht, dass draußen etwas gesprochen wurde, konnten aber die Worte nicht verstehen. Das war auch gut so, handelte es sich doch bei dem Herrn im Wagen um einen Angehörigen der allerbesten Gesellschaft. Noch dazu um einen, der nicht dafür bekannt war, allzu viel Spaß zu verstehen. Graf Heinrich Ferdinand von Kirchhoff-Aisterthal war ein groß gewachsener, stattlicher, durchaus gut aussehender Mann von einundvierzig Jahren, dessen beeindruckender dunkler Backenbart sich an manchen Stellen bereits grau färbte. Eine kleine, alte Wunde auf der Nase, die er sich beim Fechten zugezogen hatte, war etwas wuchernd verheilt, tat aber seinem guten Aussehen keinen Abbruch. Nach einer kurzen Ehe, die ihn zum ersten Mal zum Vater und mit knapp über zwanzig zum Witwer gemacht hatte, musste er auf Geheiß seines despotischen Vaters in zweiter Ehe die blutjunge, ebenso verwaiste wie verarmte, aber hochnoble Prinzessin Luise Marianne Winterfurth-Solenau heiraten, mit der ihn bis zum heutigen Tage kühle Abneigung verband. Sie hatte ihm zwei weitere Söhne geschenkt, die im Aussehen nach ihm kamen. In der Wesensart ähnelten Emil und Helmuth jedoch seiner Gattin, und zwar derart stark, dass er die beiden deshalb genauso wenig leiden konnte wie sie. Wen er jedoch leiden konnte – und zwar mehr, als ihm guttat – war das junge Fräulein, dessen linke Wade er soeben mit innigen Küssen bedeckte. Er hatte ihr kleines Lederstiefelchen abgestreift und sich ihren bestrumpften Fuß auf den Schoß gelegt. Noch ein Kuss auf den großen Zeh, dann richtete er sich auf und begann mit der Hand über ihr Knie zu streichen, bevor sie unter ihrem Rock verschwand und sich auf die Suche nach dem Strumpfband machte. Auf eine vergebliche Suche, wie sich umgehend herausstellte.
„Heini!“, rief die junge Dame nämlich empört aus und schlug ihm zweimal fest auf den Unterarm. „Wirst du wohl aufhören, du schlimmer, schlimmer Bub!“
Der Graf ließ ein schallendes Lachen hören. „Stanzi, du bist einmalig!“, schnurrte er beglückt. Noch nie, seitdem er zurückdenken konnte, hatte ihn jemand einen schlimmen Buben genannt. Nicht einmal der strenge Hauslehrer, der ihm seine Kindheit schwer gemacht hatte. Selbst der hatte zu viel Respekt vor seiner hohen Geburt gehabt, um ihn einen schlimmen Buben zu nennen. Und jetzt, als Erwachsener? Da begegnete man ihm mit Achtung, devoter Unterwürfigkeit und einer gehörigen Portion Vorsicht. Schließlich war er nicht nur von hohem Stand, sondern gehörte als Mitglied der kaiserlichen Staatskanzlei zum engsten Kreis des leitenden Ministers Clemens Graf von Metternich-Winneburg zu Beilstein. Dem Mann, von dem alle erwarteten, er würde in nicht allzu langer Zeit von seiner Majestät Kaiser Franz zum Fürsten und dann auch zum Staatskanzler ernannt werden.
„Wuff!“, kam ein protestierender Laut vom Boden der Kutsche her.
Constanze von Glinzendorf entzog ihrem Galan das Bein, schlüpfte in ihr Stiefelchen, ohne es zuzuknöpfen, beugte sich zu ihrem cremefarbenen Zwergpudel hinunter und kraulte ihm das lockige Fell. „Tust du die Unschuld von deinem Frauerl verteidigen? Was ist er nur für ein braver Bub, mein Napoleon! So ein braver, braver Bub!“
Sie kicherte, als sie sich wieder aufrichtete. Kirchhoff war weniger zum Lachen zumute.
Der Köter ist also brav, ich hingegen schlimm?, ging es ihm durch den Kopf. Aber bitte, wenn sie das ohnehin schon so sieht, dann kann ich getrost einen weiteren Vorstoß wagen.
Doch auch beim neuerlichen Versuch, das Strumpfband zu erreichen, wurde er entschlossen zurückgehalten.
„Hörst du wohl auf, Heini! Unter meine Röcke kommt mir nur mein Gemahl. Das bin ich ihm schuldig.“
Mit einem Ruck saß auch er wieder kerzengerade. „Aber du hast doch gar keinen Gemahl!“
„Noch nicht“, entgegnete sie würdevoll. „Doch ich hebe mich für den auf, den ich einmal haben werde.“
Nicht zum ersten Mal verspürte Heinrich das dringende Verlangen, selbst dieser Gemahl zu sein. Er wollte sie aus dem modischen Samtkleid schälen und nicht nur ihre Fesseln mit Küssen überhäufen. Von diesem erotischen Gedanken überwältigt, riss er sie in seine Arme und stahl sich einen innigen Kuss von ihren Lippen. Ein Kuss ab und zu war nämlich etwas, das sie ihm gewährte und das sein Blut immer weiter in Wallung versetzte.
„Ich wünschte, der Gemahl wäre ich!“, gestand er schließlich. „Ach, könnte ich dich doch als die Meine nach Hause führen.“
„Oh, Heini!“ Sie seufzte und drückte seine Hand. „Das wünschte ich mir auch. So sehr!“
Da küsste er sie wieder und verfluchte sich dafür, dass er sich vor zwanzig Jahren an seine ungeliebte Frau weggeworfen hatte. Gäbe es Luise nicht, könnte er Stanzi auf der Stelle ehelichen. Sein Vater war nur ein knappes Jahr nach Heinrichs Eheschließung mit Luise verstorben. Hätte er nur etwas länger mit der Heirat zugewartet! Dann hätte sie überhaupt nicht stattfinden müssen und er hätte jetzt keine Familie als Klotz am Bein.
„Kannst du dich denn nicht scheiden lassen, Heini?“, hörte er Constanze fragen. Es klang so hoffnungsvoll, dass es ihm körperliche Schmerzen bereitete, sie enttäuschen zu müssen.
„Ach, mein Täubchen, wie stellst du dir denn das vor?“ Er vergrub sein Gesicht in ihrem Nacken und küsste sie am Haaransatz. Das brachte sie wieder zum Kichern und er hätte sie am liebsten auf der Stelle mit Haut und Haaren verschlungen.
„Du wirst es nicht glauben, aber so eine Scheidung ist heutzutage durchaus möglich“, sagte sie. „Mein Nachbar, ein gewisser Edler von Gerblhofer – ich weiß nicht, ob der dir etwas sagt, Heini – der hat sich im letzten Jahr scheiden lassen.“ Sie wandte ihm ihr Gesicht zu. „Die verschmähte Frau ist daraufhin zu ihrer Mutter nach … ich weiß nicht, irgendwo in Böhmen gezogen und er hat meine Cousine Milli geheiratet. Also erzähl mir nicht, dass so etwas nicht möglich ist. Wie sagt ein altes Sprichwort? Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.“
Wie sehr er ihren strengen Ton liebte! Er hätte sie beißen können!
„Die Gerbl…dings, wie auch immer sie heißen mögen, sind Protestanten, so wie du, Stanzi. Es stimmt schon, dass eine Scheidung möglich ist, seitdem der unselige Kaiser Joseph die Trennung zwischen Kirche und Staat verfügt hat. Aber das gilt nicht für uns Katholiken.“
„Aha!“, fuhr sie auf und verzog dann die Lippen zu einem reizenden Schmollmund. „Aber deine Religion wird dir doch nicht wichtiger sein als ich?“ Neckisch kraulte sie ihn mit dem Zeigefinger unter dem Kinn.
Jeder andere hätte sie für diese ungeheuerliche Aussage sicherlich in die Schranken gewiesen. Natürlich ging Religion allem Irdischen vor. Darüber brauchte man kein Wort zu verlieren. Doch Graf Kirchhoff war viel zu vernarrt, um sich darum zu scheren.
„Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Welt!“, beteuerte er. „Doch wir müssen vernünftig sein. Wenn ich der Religion den Rücken kehre, verliere ich nicht nur meine Stelle beim Fürsten, sondern auch mein Ansehen. Man würde mich eiskalt aus der guten Gesellschaft verstoßen. Würde ich dich dann heiraten, würde ich dich mit in den Abgrund reißen. Das könnte ich dir doch niemals zumuten.“
Das sah sie allerdings genauso.
„Du hast ja so recht, mein lieber Heini!“, sagte sie deshalb und strahlte ihn an. „Ich gehöre selbstverständlich mitten hinein in die vornehme Gesellschaft. Wenn du mich also zur Frau haben willst, musst du dir etwas anderes einfallen lassen. Zeit dazu hast du ja jetzt genügend, während ich einen Monat bei meinen Verwandten in Ungarn verbringe.“
„Würde ich nicht selbst ebenfalls verreisen müssen, wüsste ich nicht, wie ich es so lange ohne dich aushalten sollte“, murmelte er in ihren Nacken. Ihr Verwandtenbesuch kam für ihn zur rechten Zeit. Metternich hatte ihm nämlich befohlen, in London gewissen Pflichten nachzugehen. Niemals wäre ihm das beruhigt möglich gewesen, würde sich seine Angebetete währenddessen nicht weit weg von Wien und damit außerhalb der Reichweite von modischen Stutzern aufhalten, die ihm gefährlich werden konnten.
„Ach, ja, richtig!“ Sie seufzte tief. „London.“ Es klang sehnsuchtsvoll. „Wie sehr wünsche ich mir, ich könnte dich begleiten, mein lieber, lieber Heini. Warum bloß dürfen nur immer Männer in die Welt hinaus?“
„Ungarn ist doch auch recht schön“, sagte er leichthin und tätschelte ihr das Knie.
Sie kniff die Lippen zusammen, überlegte kurz und sagte dann in anscheinend harmlosem Tonfall: „Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass meine ungarische Tante die allerbesten Kontakte zu einem reichen Baron pflegt? Er soll einen unglaublich gut aussehenden Sohn in meinem Alter haben.“ Sie klatschte in die Hände. „Der ist nicht nur sein Erbe, nein, stell dir vor, Junggeselle ist er obendrein!“
Schon hatte sie wieder seine ungeteilte Aufmerksamkeit, denn, nein, das hatte der Graf nicht gewusst. Und es war auch nichts, was ihm gefiel. Spontan beschloss er, ihrem Aufenthalt in Ungarn einen Riegel vorzuschieben. An seiner Reise nach England war leider nicht zu rütteln. Der Minister hatte beschlossen, einen Sondergesandten am Hof des Prinzregenten in Brighton zu etablieren, und ihm die ehrenvolle Aufgabe übertragen, vor Ort alles Nötige für diesen hohen Diplomaten zu regeln, auch wenn der noch gar nicht bestellt worden war. Derartige Aufgaben fielen in den letzten Jahren stets ihm zu, war seine Mutter doch eine Engländerin gewesen. Sie hatte ihr letztes Lebensjahrzehnt mit ihm und seiner Familie in Linz gelebt und dafür gesorgt, dass alle ihre Muttersprache beinahe so gut beherrschten, als wären sie ebenfalls in England geboren. Seine Sprachkenntnisse kamen dem Kaisertum bei den Beziehungen zum Königreich auf das Erfreulichste zugute. Graf Kirchhoff fand sich in England inzwischen gut zurecht, auch wenn es ihm bei seinen bisherigen Reisen nie gelungen war, Anschluss an die feine Gesellschaft zu finden.
„Sind die Leute dort in England eigentlich Katholiken oder Protestanten?“, hörte er seine Begleiterin fragen.
„Aber geh, Stanzi, du müsstest doch eigentlich wissen, dass das sogenannte Anglikaner sind.“ Auch wenn er noch so verliebt war, konnte er den belehrenden Tonfall nicht lassen. „Da hat es einen König Heinrich VIII. gegeben, der …“
„… all seine Frauen köpfen ließ“, vollendete sie seinen Satz.
„Nicht alle, nur zwei von ihnen“, sah er sich genötigt zu korrigieren. „Außerdem hat er extra eine Religion gegründet, damit er sich von seiner ersten Frau scheiden lassen konnte.“
„Na, da schau her!“, meinte Constanze und sah ihn erwartungsvoll an.
Heinrich konnte den Gedanken kaum glauben, der ihm jetzt durch den Kopf schoss. War es denn möglich, dass England die Lösung all seiner Probleme darstellte? Konnte er sich auf der Insel tatsächlich so mir nichts, dir nichts scheiden lassen wie sein königlicher Namensvetter?
Ich muss mich unbedingt nach dem genauen Vorgehen erkundigen, dachte er. Wen kann ich danach fragen, ohne Verdacht zu erregen? Wird man am Ende gar verlangen, dass ich zum anglikanischen Glauben übertrete?
Er erschrak, als seine Begleiterin ihm die Wange tätschelte.
„Was schaust denn auf einmal so bös, Heini? Das ist ja zum Fürchten. Geh, lach doch wieder ein bisserl!“
Also lachte er wieder ein bisserl.
„Weißt du was, Stanzi?“, verkündete er dann und drückte ihre Hand. „Ich werde mich in England scheiden lassen.“
Immerhin sind die Anglikaner doch auch irgendwie Christen, dachte er dabei. Der Papst in Rom wäre halt nicht mehr mein Oberhaupt. Aber was soll’s, da ist mir mein Glück doch um einiges wichtiger.
Heinrich spürte, wie eine lange schon nicht mehr gekannte Zuversicht von ihm Besitz ergriff, die sein Herz in reiner Vorfreude schneller schlagen ließ.
Wenn alles gut läuft, dann kann das Ganze sogar ohne jeden Skandal vor sich gehen, dachte er. Er musste nur mit Stanzi einige Zeit in England bleiben, und dabei war es wohl am besten, wenn er selbst die Position des Sondergesandten bekleidete. Dann brauchte in Wien niemand von seiner Scheidung zu erfahren. Luise konnte auch als geschiedene Frau weiter das zurückgezogene Dasein in Linz führen, das sie auch jetzt schon bevorzugte. Für diese Frau interessierte sich doch ohnehin niemand. Da fiel ihm das Testament seines verstorbenen Großonkels ein, das in der Botschaft in London auf ihn wartete, und er hätte um ein Haar aufgejubelt. Der selige Verwandte hatte nämlich ein kleines Palais in Brighton besessen, also in genau der Stadt, in der er als Sondergesandter tätig werden wollte. Das konnte doch kein Zufall sein – das war Bestimmung!
„Stanzi“, rief er. „Es ist beschlossene Sache! Du fährst nicht nach Ungarn, sondern kommst mit mir nach England! Dort werde ich mich scheiden lassen, dich heiraten und wir …“
„Also, gar so eine beschlossene Sache ist das nicht, Heini“, fiel sie ihm ins Wort. „Du hast mir ja noch nicht einmal einen richtigen Antrag gemacht. Außerdem …“, sie wedelte mit den Fingern vor seinem Gesicht herum, „… sehe ich hier keinen Verlobungsring.“
Er nahm eben diese Hand und zog sie an sein Herz. „Fräulein Constanze von Glinzendorf“, sagte er feierlich. „Willst du mir die Ehre erweisen, meine Frau zu werden, sobald ich geschieden bin, und dann mit mir in England wohnen? Zumindest für eine Zeit lang?“
„Ja, gewiss will ich das“, lautete die Antwort, auf die er gehofft hatte. „Doch du verdienst hier dein Geld. Wovon wollen wir in England leben? Du darfst nicht verlangen, dass ich auf den Komfort verzichte, den ich gewöhnt bin, Heini.“
Wieder machte sie einen derart reizenden Schmollmund, dass er am liebsten niemals mehr aufgehört hätte, sie zu küssen.
„Ich werde Metternich davon überzeugen, mich selbst zum Sondergesandten zu bestellen. Wir ziehen in das Palais, das mir mein Großonkel vermacht hat, und du bekommst den schönsten Ring, um den dich die vornehmen englischen Ladys beneiden werden.“
Während er seine Pläne ausschmückte, ging er großzügig darüber hinweg, dass noch viele Hindernisse auf seinem Weg lagen, die er nicht allein beseitigen konnte. Und dass er aus der noblen englischen Gesellschaft kaum jemanden kannte, in deren Mittelpunkt er seine Angebetete jetzt schon stellte. Je länger er sprach, umso mehr glaubte er seinen eigenen Worten und umso schillernder wurde seine Version einer gemeinsamen Zukunft.
„Ich wäre wirklich und wahrhaftig eine Gräfin?“, vergewisserte sie sich.
„Du wärst nicht nur eine Gräfin“, berichtigte er sie und seine Brust schwoll an. „Du wärst meine Gräfin!“
Daraufhin strahlte sie so glücklich, dass er sie an sich riss und ihr einen Kuss auf die Stirn drückte. Dabei konnte er es gar nicht mehr erwarten, auch ganz andere Stellen ihres Körpers mit Küssen zu übersäen.
„Napoleon darf mit“, bestimmte sie in diesem Augenblick und holte ihn damit unsanft aus seinen erotischen Zukunftsvisionen.
Warum muss bloß immer alles einen Haken haben?, dachte er und zwang sich dennoch zu einem Lächeln.
„Aber selbstverständlich!“ Mit einer halbherzigen Bewegung streichelte er dem Hund gegen den Strich über den Rücken, worauf der die Zähne fletschte und zu knurren anfing. „Wir gehen nirgendwo hin, ohne den lieben, braven …“ Mistköter war wohl nicht der richtige Begriff. „… Pudel“, schloss er daher.
„Dann kannst du auf mich zählen, Heini! Großtante Wiltrud wird außer sich vor Freude sein, wenn sie mich nicht länger chaperonieren muss. Sie hat gesagt, die Verantwortung wird ihr zu viel auf ihre alten Tag‘. Und du bist ein Graf, Heini. Das ist allemal mehr wert als der Sohn von einem ungarischen Baron. Mag der noch so jung sein und in vollem Saft stehen.“
Kapitel 2
Noch immer im Kaisertum Österreich
Oktober 1811Linz an der DonauIm Stadtpalais des Grafen Heinrichvon Kirchhoff-Aisterthal
Von all dem ahnte der siebzehnjährige Sohn des Grafen Kirchhoff naturgemäß nichts. Emil war ein gut aussehender junger Mann mit dunkelblonden Haaren, die einen Stich ins Rötliche aufwiesen, und Sommersprossen, die ihm rund um die Nase tanzten. Noch war er nicht wirklich groß gewachsen, doch seine Mama war sich sicher, dass er in nicht allzu ferner Zeit die Größe seines Papas erreichen würde, wenn sich seine schlanke Gestalt auch deutlich von der des stattlichen Grafen unterschied. Die Lehrer am Gymnasium der Jesuiten lobten Emil für seine rasche Auffassungsgabe, seinen Wissensdurst und seine überragenden Sprachkenntnisse. Seine Freunde mochten ihn, weil er verlässlich war, für jeden Scherz zu haben, und auch waghalsige Unternehmungen nicht scheute. Seine Mutter wiederum liebte beide Söhne bedingungslos. Doch auch sie schätzte seine Verlässlichkeit und seinen gesunden Sinn für Humor. Und sein Vater? Der wiederum brauchte keinen Grund dafür, ihn nicht zu mögen, und das brachte er auch oft und lautstark zum Ausdruck. War es daher verwunderlich, dass Emil froh darüber war, den Grafen nur selten zu Gesicht zu bekommen? Er genoss es jedes Mal, mit Mutter und Helmuth allein in Linz zu sein, während Heinrich seinen Verpflichtungen in der Hauptstadt nachging. Wenn es nach Emil gegangen wäre, hätte er überhaupt für immer dort bleiben können. Das Leben war viel fröhlicher und unbeschwerter ohne ihn. Es wäre allerdings noch um einiges unbeschwerter gewesen, hätte nicht ständig das Damoklesschwert seiner Rückkehr über der Familie gehangen. Der Graf hielt es nämlich nicht für notwendig, Bescheid zu geben, wann man ihn zurückerwarten musste, und daher war auch seine Rückkehr an diesem Abend eine Überraschung. Wenn auch keine freudige.
Emil saß mit seiner Mutter und seinem dreizehnjährigen Bruder Helmuth beim Abendessen. Obwohl keine Gäste erwartet wurden, war die Gräfin wie immer ein Musterbeispiel unaufdringlicher Eleganz. Die hellbraunen Locken, kunstvoll aufgesteckt, ließen den schlanken Hals frei, den, wie meist, eine dreireihige Perlenkette zierte. Der eierschalenfarbene Brokat ihres schlicht geschnittenen Kleides schimmerte im Schein der zahlreichen Kerzen. Die Stimmung war, wie immer, wenn sie unter sich waren, heiter, ja heute Abend geradezu ausgelassen.
„Fünf Minuten vor der Zeit ist des Gymnasiasten Pünktlichkeit. Merken Sie sich das, meine Herren!“, verkündete Helmuth soeben mit verstellter Stimme und erhobenem Zeigefinger. Er hatte über seinen Tag in der Schule berichtet und verstand es, den alten Oberstudienrat Schlägel so täuschend echt zu parodieren, dass die anderen in schallendes Lachen ausbrachen.
„Herr Professor Fischer hat mich heute nach dem Unterricht zur Seite genommen und meine Fortschritte in Französisch gelobt“, war Emil mit dem Erzählen an der Reihe. „Er meinte, seit ich mich mit den beiden Flüchtlingen herumtreibe, sei meine Aussprache fast schon so gut, wie sie es auf Englisch ist.“
„Das ist aber wahrlich ein großes Lob“, befand die Mutter. „Besonders von einer Lehrkraft, die bekannt dafür ist, in jeder Suppe ein Haar zu finden. Darauf kannst du wahrlich stolz sein.“
„Das bin ich, Mama.“ Er lächelte, wurde aber gleich wieder ernst. „Ich mag nur nicht, dass er meine Freundschaft zu Alain und Jean Noël herumtreiben nennt. Ihre Familie musste aus Paris fliehen, weil sie Anhänger der Bourbonen sind und die Guillotine drohte. Ich treibe mich nicht herum, ich verbringe gern Zeit mit ihnen. Warum sollen Flüchtlinge nicht meine Freunde sein dürfen?“
„Apropos Noël“, fiel Helmuth ein. „Wie ich heute erfahren habe, gehören er und ich zu der kleinen Gruppe des Schülerchors, die bei der Weihnachtsmette in der Pfarrkirche singen darf.“
Als Emil ihm daraufhin gratulieren wollte, tat sein Bruder die Befürchtung kund, Vater könnte ihm ein derart öffentliches Zurschaustellen seiner Fähigkeiten verbieten.
„Also, so weit kommt es noch!“ Die Gräfin plusterte ihre Backen auf. „Das lasst nur meine Sorge sein, Kinder! Natürlich wirst du bei der Mette singen. Keinem guten Christen darf es verwehrt werden, den Herrn zu preisen.“
Die Buben grinsten einander zu. Sie wussten, dass nicht viel schiefgehen konnte, wenn Mama auf ihrer Seite war. Zum Glück war sie das so gut wie immer.
Dann widmeten sich die drei wieder ihrer gehaltvollen Rindssuppe, die die Köchin großzügig mit Kaiserschöberl versehen hatte, und freuten sich auf den süßen Grießschmarrn, den es zum Nachtisch geben sollte. Sicher hatte Fanni auch bei den Rosinen und Zibeben nicht gespart.
Die heitere Familienszene wurde jäh unterbrochen, als sich die Tür zum Esszimmer öffnete und der Hausherr den Raum betrat. Er blieb an der Schwelle stehen und zupfte seine Manschetten zurecht. „Was ist denn hier für ein Aufruhr?“, erkundigte er sich mit strenger Stimme. „Ich habe euch bei meiner Ankunft bis in den Vorraum hinaus lachen gehört.“
Emil bemühte sich, sich seinen Unmut nicht anmerken zu lassen. Kannst du dich nicht einfach freuen, dass es uns gut geht?, dachte er, während er mit Helmuth gemeinsam so schnell in die Höhe schoss, dass die Stuhlbeine übers Parkett kratzten. Musst du an allem, was wir tun, etwas auszusetzen haben?
„Guten Abend, Vater“, hörte er seinen Bruder sagen und beeilte sich, sich ihm anzuschließen. Dabei hoffte er, es würde nicht allzu lange dauern, bis sie sich wieder setzen durften. Er hätte die Suppe gern fertiggegessen, solange sie noch heiß war.
„Sie sind zurück, wie schön“, hörte er seine Mutter das Offensichtliche feststellen, wobei sie sich um einen warmen Tonfall zu bemühen schien. „Wir haben Sie heute noch gar nicht erwartet.“
„Es ist mein Haus!“, antwortete der Graf anstelle einer Begrüßung mit etwas ebenso Offensichtlichem, und Emil konnte nur mit Mühe ein missmutiges Schnaufen unterdrücken. Vater war noch keine fünf Minuten im Raum und schon war die Stimmung in den Keller gerasselt. „Ich komme heim, wenn ich es für richtig halte.“
Er setzte sich auf seinen Stammplatz am Kopfende, gab dem Diener ein stummes Zeichen, sein Essen aufzutragen, und erlaubte dann seinen Söhnen gnädig, wieder Platz zu nehmen und das Mahl fortzusetzen. Es dauerte jedoch keine zwei Minuten, da fand er den nächsten Grund zur Beanstandung: „Sitz nicht so bucklig, Helmuth! Ein gekrümmter Rücken ist das Zeichen des niederen Volkes. Willst du allen Ernstes, dass man einen von Kirchhoff für gemeines, hart arbeitendes Gesindel hält? Steht dir der Sinn danach, dass man dich mit deinem Buckel mit einem Kohlenträger verwechselt?“
Wie vom Pfeil getroffen schoss sein jüngerer Sohn in eine steife, aufrechte Position. Emil hätte ihm gern beigestanden und hielt doch den Mund. Er wusste aus leidvoller Erfahrung, dass jede Einmischung die Lage des Jüngeren lediglich verschlimmern würde.
„Antworte, wenn ich dich etwas frage!“, befahl der Graf. Er war aufgesprungen und schlug seinem Jüngsten nun mit der aufgestellten Handkante so hart zwischen die Schulterblätter, dass dieser nur mit eiserner Disziplin verhindern konnte, nach vorn in den Teller zu kippen. Dann ging er seelenruhig zu seinem Stuhl zurück.
„Nein, natürlich nicht, Vater“, antwortete Helmuth daraufhin folgsam.
Die Gräfin hatte die Lippen zu einem Strich zusammengepresst, und Emil knirschte heimlich mit den Zähnen. Außer dem Pendelschlag der schweren Standuhr neben der Tür war es mucksmäuschenstill im Esszimmer. Alles Heitere hatte einer bedrückenden Kälte Platz gemacht.
„Die Buben erzählten soeben von ihren Erlebnissen in der Schule“, versuchte die Gräfin ein Tischgespräch zu beginnen, während sich ihr Gatte vorlegen ließ. Für ihn hatte man, als seine Kutsche vor dem Haus vorgefahren war, in Windeseile kalten Braten, Essiggurken und Krautsalat zusammenstellen lassen und ein weiterer Lakai schenkte Bier in ein hohes Glas, eifrig darauf bedacht, ebenjene Menge Schaum zu erzeugen, die sein Herr für richtig hielt. „Sie haben beide wieder ein Sehr gut in einer Schularbeit erzielt. Bei Emil …“
Weiter kam sie nicht.
„Was sollten sie denn sonst für Zensuren nach Hause bringen? Ich bitte Sie!“, unterbrach sie ihr Gatte nicht eben höflich. „Alles andere als ein Sehr gut ist eines Kirchhoffs unwürdig. Das mag Sie überraschen, meine Gute, da Sie ja keinerlei Schulbildung genossen haben und Ihr Bruder, wie ich Sie wohl nicht erinnern muss, zeitlebens ein erbärmlicher Versager war, aber bei uns, hier in meiner Familie, zählen Leistung und Fleiß.“
Emil zog scharf die Luft ein und blickte zu seiner Mutter hinüber, die das Kinn nach vorn reckte, nicht gewillt, seinem Vater diese Aussage durchgehen zu lassen.
„De mortuis nihil nisi bene“, sagte sie und bewies, dass die Bildung, die sie von ihrer Gouvernante erhalten hatte, durchaus umfassend gewesen war. Emil hätte ihr am liebsten applaudiert.
„Was soll das heißen?“, verlangte ihr Gatte zu wissen, um gleich darauf den Hausdiener anzufahren: „Herrgott, so rücke er doch das Brot etwas näher! Soll ich mich quer über den Tisch legen, wenn ich ein Kipferl will, oder wie stellt er sich das vor?“
„Mein Bruder ist tot, ich bin das letzte lebende Mitglied meiner Familie“, erklärte die Gräfin kühl, während der Diener mit hochrotem Kopf den Brotkorb zurechtschob. „Wir sollten nichts Schlechtes über Tote sagen.“
Nun war es der Graf, der die Lippen zusammenpresste. Dann herrschte, von einigen Kaugeräuschen abgesehen, wieder Schweigen im Esszimmer. Emil wechselte einen verstohlenen Blick mit seinem Bruder und hätte viel darum gegeben, den Raum verlassen zu dürfen. Er bemerkte, dass seine Mutter tief durchatmete und dann ein neues Thema anschlug: „Es wird Sie freuen zu hören, dass unser Helmuth dieses Jahr bei der Christmette wird singen dürfen.“
„Bei der Christmette, tatsächlich?“, wiederholte ihr Gatte und schien der Idee nicht so abgeneigt, wie alle befürchtet hatten.
„Natürlich muss er vorher noch üben“, setzte die Gräfin eines nach. „Aber fleißig, wie er ist, wird er dies gern tun, nicht wahr, mein Lieber?“ Sie griff über den Tisch und tätschelte Helmuth die Hand, der noch immer stocksteif auf seinem Stuhl saß und sich nicht zu rühren wagte.
„Was habe ich dir eben befohlen?“ Die Faust des Vaters knallte so heftig auf die Tischplatte, dass die Gläser klirrten. „Antworte deiner Mutter gefälligst, wenn sie dich etwas fragt!“
Emil sah, wie seinem Bruder Tränen in die Augen schossen, ob aus Angst oder Wut, wusste er nicht zu sagen. Es war auch einerlei. Tatsache war, dass sich ihr Vater wieder einmal von seiner unerfreulichsten Seite zeigte. Er war noch nie ein angenehmer Zeitgenosse gewesen, doch in letzter Zeit hatten sich seine Launen und seine Selbstgerechtigkeit immer noch weiter verschlimmert.
„Ja, natürlich, Mama“, beeilte sich Helmuth zu antworten, was ihm ein weiteres beruhigendes Tätscheln ihrerseits einbrachte.
„Dennoch wird daraus nichts werden.“ Ihr Gatte wies mit dem Zeigefinger auf sein Glas, auf dass es abermals gefüllt werden möge. „So wie ich die Reichardts kenne, werden sie ihm keine Möglichkeit zum Üben geben. Gotthelf mag keine Kinderstimmen. Er bevorzugt Trommeln und Marschmusik, wie ihr wisst.“
„Die Reichardts?“, wiederholten die Gräfin und Emil wie aus einem Mund, während Helmuth erbleichte und ihre Mutter hinzufügte: „Ich kann Ihrem Gedankensprung nicht folgen, Gemahl.“
Wenn in diesem Palais jemand noch stärker gefürchtet wurde als der Hausherr selbst, so war dies das Ehepaar Clodwiga und Gotthelf von Reichardt, dessen erste Schwiegereltern.
Heinrich war kaum siebzehn gewesen, als er sich mit geradezu glühender Leidenschaft in die junge Editha von Reichardt verliebt hatte. Das hübsche Mädchen stammte aus Wien und war bei ihrer alten, beinahe blinden Großtante in Linz zu Besuch gewesen. Bei einem ihrer Spaziergänge am Fuße des Römerbergs kreuzte ihr Weg den des jungen Grafensohns, der zu seinem Stammkaffeehaus in der Rathausgasse unterwegs war. Während die Tante zusammengesunken auf der Parkbank ein Nickerchen hielt, kamen die beiden zuerst ins Gespräch und in den darauffolgenden Tagen einander näher. Waren es anfangs verstohlene Küsse hinter einem dicht belaubten Fliederbusch, die sie tauschten, blieb es bald nicht mehr bei Küssen. Es kam, wie es kommen musste, wenig später war Editha schwanger und es wurde eilig Hochzeit gehalten, um ja keinen Skandal zu erregen. Da waren die beiden noch keine achtzehn Jahre alt gewesen. Die Eltern der Braut waren ein gestrenges, gottgläubiges Ehepaar aus niederem Adel. Er hatte für Kaiser und Vaterland gedient und 1790 in der Schlacht von Cetingrad einen Arm verloren. Auch wenn er daraufhin abrüstete, blieb von Reichardt dem Militär eng verbunden. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er sich für sein einziges Kind einen schneidigen Offizier zum Gatten gewünscht und nicht einen Müßiggänger wie den jungen Grafensohn.
Editha starb bei der Geburt ihres Sohnes im Kindbett und ihre Eltern beschlossen, den kleinen Wilhelm mit nach Wien zu nehmen. Darüber waren Heinrichs Eltern nur zu erfreut, wollten sie sich doch nicht mit einem so überraschend in ihr Leben getretenen Enkel belasten. Heinrich hatte bei der Entscheidung nichts mitzureden. Er hätte aber wohl ohnehin nicht widersprochen, da er sich mit dem Kind völlig überfordert fühlte und es überdies seinem Wunsch nach einem feuchtfröhlichen Studentenleben diametral entgegenstand. So jedoch konnte er stets behaupten, dass man ihm sein Kind gegen seinen Willen weggenommen hatte, und er wurde allseits bewundert und bemitleidet, was ihm eine Zeit lang recht gut gefiel.
Dass aus den rauschenden Plänen für ein Studium der Rechtswissenschaften an der Alma Mater Rudolphina in Wien dann doch nichts wurde, lag zum einen daran, dass er mit Bomben und Granaten durch die erste Staatsprüfung gerasselt war, und zum zweiten, dass ihn sein Vater daraufhin zwang, sich abermals zu verheiraten. Nach dem Fehlgriff beim ersten Mal musste es diesmal eine Braut sein, die er ihm ausgesucht hatte. Wie hätte sich der alte Graf die Gelegenheit, eine wahrhaftige Prinzessin zur Schwiegertochter zu bekommen, entgehen lassen können? Noch dazu eine, die zwar bettelarm war, aber als Mitgift ein Stück Land mitbrachte, das die Besitzungen des Grafen auf das Vortrefflichste abrundete? Dass Heinrich und Prinzessin Luise Marianne sich vom ersten Kennenlernen an nicht leiden konnten, war für ihn nicht von Bedeutung.
„Ja, die Reichardts“, lautete jetzt Heinrichs knappe Antwort, so als wäre damit irgendetwas erklärt. Natürlich war es das nicht, und die Gräfin keine Frau, die sich mit nichtssagenden Antworten abspeisen ließ.
„Das verstehe ich nicht. Was haben Ihre ehemaligen Schwiegereltern mit Helmuth zu tun?“
Das wollte Emil allerdings auch wissen. Ihm schwante Böses.
„Unsere Söhne werden einige Monate bei ihnen in Wien wohnen, solange ich Sie in London brauche“, lautete da auch schon die erschreckende Antwort. „Willhelms Hauslehrer hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, die beiden unter seine Fittiche zu nehmen.“ Und dann zum Diener gewandt: „Halte er keine Maulaffen feil und reiche er mir das Salz!“
Emil zog scharf die Luft ein und sein Bruder wurde noch blasser, als er ohnehin schon war. Ihr Halbbruder Wilhelm war ein arroganter, bösartiger Schnösel, der nicht müde wurde, den Erben herauszukehren und ihnen zu erklären, sie wären nicht nur bei ihrem gemeinsamen Vater, sondern im Leben generell, zweite Wahl. Und dessen Hauslehrer? Der war schuld daran, dass ihr Halbbruder so geworden war. Monate mit den beiden verbringen zu müssen, erschien Emil als der Vorhof zur Hölle.
„Aber was ist mit der Schule …?“, brachte er hervor und Helmuth schenkte ihm einen dankbaren Blick.
Ihre Eltern beachteten sie nicht.
„Was soll das heißen, Sie bräuchten mich in London?“, wollte die Gräfin stattdessen wissen. „Sie waren jetzt bereits drei Mal im Königreich, ohne dass meine Anwesenheit vonnöten gewesen wäre.“
„Das ist mir bewusst. Doch diesmal ist es anders. Ihre Anwesenheit ist unabdingbar. Sie werden mich daher begleiten und ich verbitte mir jede weitere Diskussion.“
Und wieder zog Emil scharf die Luft ein. So sehr der Graf seine Söhne auch oft beschimpfte und kritisierte, Mutter gegenüber schlug er im Allgemeinen einen respektvolleren Ton an. Was mochte bloß in Wien vorgefallen sein? Warum war er an diesem Abend noch unausstehlicher als sonst?
„Wobei genau erscheint Ihnen meine Anwesenheit unbedingt erforderlich?“, ließ sich die Gräfin den Mund nicht verbieten.
Ihr Gatte schwieg kurz, öffnete dann die Lippen und schloss sie wieder. Emil fielen fast die Augen aus dem Kopf. Hätte er nicht gewusst, dass das unmöglich war, hätte er beinahe angenommen, dass eine leichte Röte über Vaters fahle Wangen gezogen war.
„Es ist … es findet … es wird eine Zeremonie stattfinden. Richtig. Eine Zeremonie“, antwortetet dieser nun ungewohnt unsicher, ja es klang beinahe, als würde er stottern. Dann atmete er hörbar durch und straffte die Schultern. „Diese Ze-re-mo-nie …“, er betonte jede Silbe des letzten Wortes, „ist wichtig, also sehr wichtig. Ungeheuer wichtig. Da ist es unumgänglich, dass Sie, als meine Gattin, anwesend sind.“
„Gut.“ Die Gräfin faltete in aller Seelenruhe ihre Serviette zusammen, um sie links neben dem Teller abzulegen. „Wenn diese Ze-re-mo-nie …“, jetzt betonte auch sie jede Silbe, „für Sie so wichtig und meine Anwesenheit unumgänglich ist, dann werde ich Sie selbstverständlich begleiten.“
Der Graf nickte zufrieden und Emil hatte den Eindruck, als wäre dieser ernsthaft erleichtert. Was man von ihm selbst nicht sagen konnte.
„Ich bestehe jedoch darauf“, setzte seine Mutter fort, „dass uns unsere Söhne nach London begleiten, um bei diesem gar wichtigen Ereignis ebenfalls dabei zu sein.“
Es hätte nicht viel gefehlt und Emil wäre aufgesprungen, um ihr um den Hals zu fallen. Auf Mama ist immer Verlass, dachte er und sein Herz schwoll an vor Liebe und Dankbarkeit. Sie würde ihn und Heli nicht nur vor den Reichardts bewahren, sie würde ihnen auch eine spannende Reise und damit die Tür zur großen, weiten Welt eröffnen. Seitdem er ein kleiner Junge war, hatte er sich gewünscht, das Heimatland seiner Großmutter kennenzulernen, über das diese ihm so vieles in den buntesten Farben erzählt hatte.
„Das kommt doch überhaupt nicht infrage“, begann der Vater polternd, seinen Traum gleich wieder zunichtezumachen. Bevor er jedoch weitersprechen konnte, kam ihm seine Gemahlin zuvor.
„So überlegen Sie doch, was Emils Anwesenheit in London noch für Vorteile mit sich brächte. Ihr Onkel, Baron Redenhall, hat zwei Testamente bei der Botschaft hinterlegt. Eines davon ist angeblich für Emil bestimmt. Das kann unser Sohn nun persönlich in Empfang nehmen.“
„Onkel Richard?“, hörte Emil seinen Vater sagen. Er hatte nicht angenommen, dass sein Tonfall noch verächtlicher werden konnte, dennoch war es so. „Ich habe ihn nur zwei, drei Mal getroffen, aber vermutlich war er ein alter Narr. Wie wäre er sonst auf die Idee gekommen, dem Buben etwas zu vererben? Ich war sein Neffe. Ich war der Sohn seiner Schwester. Mir hätte das gesamte Erbe zugestanden.“
„Was ist mit mir?“, wollte Helmuth wissen und strich sich die blonden Haare aus der Stirn. „Warum wurde eigentlich ich nicht bedacht?“
„Ich weiß es nicht, mein Herz“, sagte die Gräfin. „Er war schon sehr betagt, vielleicht hat er vergessen, dass es dich gibt.“
„Ein alter Narr war er, das sagte ich ja!“, meinte ihr Gatte zufrieden. „Und was den Anteil betrifft, der Emil zufällt, so kann ich mich um diesen kümmern. Dazu braucht es seine Anwesenheit nicht.“
Dann herrschte Stille im Raum. Eine Stille, die schließlich wieder von der Gräfin durchbrochen wurde.
„Es ist ganz einfach, mein werter Herr Gemahl“, sagte sie. „Wenn Sie darauf bestehen, dass ich Sie begleite, bestehe ich darauf, dass unsere Söhne das ebenfalls tun.“
Der Graf hielt im Kauen inne, kniff die Lider zusammen und spitzte schließlich die Lippen. „Von mir aus“, sagte er. „Machen Sie doch, was Sie wollen.“ Dann schluckte er, sprang auf, warf die Serviette auf seinen Teller und verließ den Raum. Die Flügeltür knallte hinter ihm ins Schloss.
Kapitel 3
Anfang Dezember 1811Auf der Überfahrt nach Dover, England
In der holzvertäfelten Kabine roch es nach abgestandener Luft, doch Wind und Wellengang ließen es nicht zu, eine der runden, mit mattem Messing umrandeten Luken zu öffnen. Emil streckte sich auf seiner Pritsche aus und drückte das prall gefüllte, leicht feuchte Kopfkissen mit beiden Händen gegen die Ohren. Helmuth hatte sich in den letzten Tagen eine Erkältung zugezogen und schnarchte zum Gotterbarmen. Das war jedoch nicht der einzige Grund, der Emil wachhielt. Nein, er war vielmehr einfach zu unruhig, um einschlafen zu können oder das überhaupt nur zu wollen. Die Fahrt durch all die Länder bis zur Küste war lang und anstrengend gewesen, aber aufgrund der vielen neuen Eindrücke und Erkenntnisse auch ein einziges berauschendes Abenteuer. Was zählte da schon Helis Schnarchen, wenn sie dafür so viel Spannendes miteinander erlebt hatten? Was zählten die unzähligen Stunden, die sie in der Kutsche durchgeschüttelt wurden, wenn dabei die unterschiedlichsten Landschaften an ihnen vorbeizogen? Wen störte der eine oder andere juckende Biss eines Flohs, wenn man dafür malerische Städte und Dörfer kennenlernen durfte und Dinge zu essen bekam, von denen er bisher nicht einmal etwas gehört hatte?
„Elvira“, kam es murmelnd von der Pritsche neben der Eingangstür her. Emil grinste in sein Kissen. Herr von Stockerau sprach wieder einmal im Schlaf. Der Mann, den ihnen Vater als Reisemarschall zur Seite gestellt hatte, war groß und hager und hatte ein auffallendes Muttermal auf der Nase. Er war, soweit Emil wusste, unverheiratet und hatte die vierzig bestimmt seit Längerem überschritten. Dennoch verzehrte er sich Nacht für Nacht nach einer gewissen Elvira. Nur mit Mühe hatte Emil Helmuth bisher davon abhalten können, ihren Reisebegleiter darauf anzusprechen. Es erschien ihm doch allzu unverschämt, mit neugierigen Fragen im Privatleben eines Fremden herumstochern zu wollen. Heli kannte da bei Weitem weniger Skrupel. Gut, dass er jetzt tief und fest schlief und das neuerliche liebeskranke Murmeln nicht mitbekam. Doch auch Stockerau war inzwischen wieder still.
Nur Emil war noch immer hellwach. Er lag da, genoss das leichte Schaukeln des Schiffes und lauschte nun zur Abwechslung dem Knirschen des Holzes. Von der vierten Schlafgelegenheit in der Kabine blieb es ruhig. Das war wenig verwunderlich, denn diese Pritsche war leer. Sie wäre für den Kammerdiener seines Vaters vorgesehen gewesen. Dass der nicht mit von der Partie war, hatte einen einfachen und durchaus angenehmen, wenn auch in Emils Augen reichlich seltsamen Grund: Auch Vater fehlte auf dieser Reise.
Es war drei Tage vor dem geplanten Aufbruch gewesen, als der Graf wieder einmal aus Wien zurückgekommen war und verkündet hatte, seine Abreise würde sich aufgrund einer wichtigen Angelegenheit um ein paar Tage verzögern. Gattin und Söhne sollten jedoch auf keinen Fall die Passage verfallen lassen und sich mit einem Reisemarschall zur Seite wie geplant auf den Weg machen.
„Was mag das bloß für eine Angelegenheit sein, die Sie davon abhält, Ihre Familie zu begleiten?“, hatte Mutter stirnrunzelnd wissen wollen.
Wenn Emil nun an dieses Gespräch zurückdachte, jetzt, da er auf seiner Pritsche lag und der Wind wieder stärker ums Schiff zu pfeifen begann, da konnte er es immer noch nicht so recht glauben: Sein Vater hatte sich gewunden. Die blassen Wangen waren sichtbar gerötet gewesen und sein Blick war durchs Wohnzimmer geirrt, so als könnte sich irgendwo auf der seidenen Tapete die Antwort auf Mutters Frage verstecken. Als er schließlich sprach, klangen seine ersten Worte wie vage Ausflüchte, und Mutter hatte erst Ruhe gegeben, als er erbost geschrien hatte: „Wenn Sie es genau wissen wollen: Grund dafür ist der verdammte Napoleon! Na, sind Sie jetzt zufrieden?“
Mutter hatte die Augen aufgerissen und war ganz offensichtlich nicht zufrieden gewesen, hatte aber geschwiegen, als er hinzufügte: „Das Ganze obliegt höchster Geheimhaltung!“
Seither rätselte die Familie, was Napoleon, der Kaiser der Franzosen höchstpersönlich, mit den Reiseplänen eines österreichischen Grafen zu tun haben sollte. Sie konnten es drehen und wenden, sie kamen dabei auf keinen grünen Zweig.
„Elvira!“, meldete sich wieder die krächzende Stimme vom Bett neben der Tür her. „Alles wird gut. Wird gut. Wird gut.“
Jetzt hatte Emil fast schon ein schlechtes Gewissen, dass er wieder grinsen musste. Stockerau war ein angenehmer Zeitgenosse, der nicht viel sprach und die Reise umsichtig organisierte. Seine Anwesenheit war der des Grafen bei Weitem vorzuziehen und Emil wünschte dem Reisemarschall daher nur das Beste. Schwungvoll drehte er sich auf die Seite. Es war jetzt doch an der Zeit, dass er endlich einschlief. Bereits am nächsten Vormittag sollten sie Dover erreichen. Jetzt, da sich das Meer zum Glück wieder beruhigt hatte, dürfte diesem Ziel nichts im Wege stehen. Der stärkste Wintersturm des Jahres hatte sich ausgerechnet die Stunden ausgesucht, als sie in den Ärmelkanal hineingesegelt waren. Mama und Elli, ihre Kammerfrau, waren daraufhin einen Tag lang nicht aus ihrer Kabine aufgetaucht. Heli, dem das Rollen und Schaukeln des Schiffes nichts ausgemacht hatte, war fröhlich im menschenleeren Herrensalon herumgeturnt, während er selbst ermattet in einem der schweren Lehnsessel gelümmelt und befürchtete hatte, das karge Frühstück, das man ihnen an Bord servierte, käme jeden Augenblick wieder zutage. Dennoch hatte er stets dabei gedacht: Was bedeutet schon ein flauer Magen gegen den weiten Blick über die raue, graue See? Wie oft hatte er in Linz davon geträumt, einmal in seinem Leben das Meer zu sehen?! Allein schon die erste Stunde an der Reling, als der Sturm noch eine steife Brise war und bevor die Matrosen sie ins Innere gescheucht hatten, hatte er ein Gefühl von Freiheit verspürt, das er so in seiner Heimat noch niemals gekannt hatte. Im Stillen konnte er Minister Metternich gar nicht genug dafür danken, dass er Vater zu dieser Zeremonie ins Königreich beordert hatte, und Vater nicht genug dafür, dass für ihn Mutters Anwesenheit dabei unumgänglich war. Bei diesem Gedanken hielt er inne und wälzte sich abermals im Bett herum. Was mochte das bloß für eine Zeremonie sein, die ihnen da bevorstand? Er konnte sich beim besten Willen nicht erklären, warum sein Vater gar so geheimnisvoll tat. Im Unterschied zu ihm und seinem Bruder begegnete ihre Mama dieser Geheimnistuerei mit viel größerer Gelassenheit.
„Worum soll es sich schon groß handeln?“, hatte sie gemeint. „Wenn Metternich euren Vater bereits zum vierten Mal nach England schickt, dann wird der Grund ein ähnlicher sein wie die letzten Male. Warum soll der Minister nicht ausnutzen, dass euer Vater der Sohn einer englischen Lady ist und das Kaisertum in England besser vertreten kann als irgendeiner, der in dieser Sprache lediglich radebricht?“
„Ja, aber die Zeremonie!“, hatte Helmuth ausgerufen. „Bisher hat es doch noch niemals eine Ze-re-mo-nie gegeben, oder, Mama?“
„Aber durchaus“, hatte die Mutter widersprochen. „Vor einigen Jahren wurde ein neuer Gesandter des Kaisers ins Amt eingeführt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne Pomp und Gloria vonstattengegangen sein soll. Und im vorigen Jahr wurde der Prinz of Wales zum Regenten ernannt. Auch diese Zeremonie war bestimmt ein Ereignis.“
„Ja, aber deine Anwesenheit war weder bei dem einen noch dem anderen gewünscht“, hatte Helmuth eingeworfen. „Also muss es doch diesmal etwas ganz Besonderes sein, was uns in London erwartet, nicht wahr, Mama?“
Die Gräfin hatte genickt, die Stirn gerunzelt und ganz leicht mit den Schultern gezuckt.
Kapitel 4
Anfang Dezember 1811In der Nähe von Worthing, SussexAnwesen des Earls of Elmstead
Zur selben Zeit, als sich das Schiff mit den Österreichern an Bord den weißen Kreidefelsen von Dover näherte und hektisches Treiben und lautes Geschrei an der Reling einsetzte, ging es etwa hundert Meilen weiter westwärts um einiges fröhlicher zu. Sechs Jugendliche im Alter zwischen zwölf und fünfzehn Jahren hatten sich Kufen unter die Winterstiefel geschnallt und genossen einen klaren, kalten Nachmittag im Freien. Der Winter war in diesem Jahr schon im November mit großer Eiseskälte übers Land gezogen, sodass sich der Teich, der zum Anwesen des Earls of Elmstead gehörte, bereits in einen tragfähigen Eislaufplatz verwandelt hatte. Man vernahm das Kratzen des Metalls auf der glatten Fläche, weithin hörbare Rufe und schallendes Gelächter. Alle Anwesenden waren vergnügt und frohgemut. Alle – bis auf eine.
„Miss Harriet, ich bitte Sie!“, schallte da nämlich eine aufgeregte Stimme zu den Jugendlichen hinüber. Sie gehörte zur ältlichen Gouvernante, die sich, ihre dicken grauen Röcke mit beiden Händen geschürzt, inständig bemühte, am Rand des Teiches einherzulaufen. Dass dort der Schnee zentimeterhoch lag, erschwerte ihr das Vorwärtskommen erheblich. So war sie schon mehrfach ausgerutscht und die eisige Nässe kroch längst höchst unangenehm durch ihre knöchelhohen Lederstiefel. „Miss Harriet, nicht so schnell!“, forderte sie nicht zum ersten Mal. „Sie werden sich noch das Genick brechen.“
Ihr Schützling beachtete sie nicht. Da die junge Lady bereits das gegenüberliegende Ufer erreicht hatte, konnte man ihr allerdings zugutehalten, dass sie Miss Stupels vielleicht gar nicht gehört hatte.
„Harry, schieß den Ball zu mir!“, forderte der junge John Grimes und fuchtelte mit seinem Schläger in der Luft herum. „Zu mir musst du schießen, du dummes Mädchen, sonst schaffen wir den Ausgleich nie und nimmer!“
Ein unaufmerksamer Beobachter hätte die fünfzehnjährige Lady Harriet Morrington, das einzige Kind des Earls of Elmstead, gut und gern für einen der Jungen halten können. Wären die zarte Statur und der lange, grüne Tweedrock nicht gewesen, so hätte sie sich im Aussehen kaum von den anderen fünf vermummten Gestalten unterschieden, die tatsächlich Jungen waren. Gekonnt schwangen sie allesamt ihre Holzschläger und versuchten mit Feuereifer, einen Gummiball in das jeweils gegnerische Tor zu befördern, das sie mit Tannenzapfen arrangiert hatten. Sie hatten ihre dicken Schals bis übers Kinn hinauf um den Hals gewickelt und wollene Mützen über beide Ohren gezogen. Diese Mützen hatte Johns Mutter bereits im vorigen Jahr für die Gruppe gestrickt. Drei in Blau und drei in Gelb, damit man die Mannschaften gut auseinanderhalten konnte. Ihnen gefror der Atem, kaum dass er den Mund verlassen hatte, und ihre Nasen glänzten in einem mehr oder weniger leuchtenden Rot. Neben dem Rock gaben auch noch die hellbraunen Locken, die an der Schläfe neben der Kopfbedeckung hervorlugten, ein untrügliches Zeichen dafür, dass es sich bei der grazilsten Gestalt auf dem Eis um ein Mädchen handelte. An Schnelligkeit und fahrerischem Können stand sie ihren Freunden ebenso wenig nach wie im Hinblick auf ihren treffsicheren Schuss.
In diesem Augenblick tat Harriet wie ihr von John geheißen und lenkte den Ball in seine Richtung. Der Bursche war so überrascht davon, dass sie seinem Wunsch tatsächlich Folge leistete, dass er einen falschen Schritt setzte und der Ball ihn mit voller Wucht am Schienbein traf. Er ließ einen markerschütternden Schmerzensschrei los, worauf zwei der gegnerischen Burschen laut auflachten und der dritte in Harriets Mannschaft die Chance nutzte, den Ball im Tor zu versenken. Das hatte lauten Jubel bei der einen und enttäuschtes Murren bei der anderen Mannschaft zur Folge.
„Jetzt ist aber Schluss!“, befahl die Gouvernante im verzweifelten Versuch, sich endlich Gehör zu verschaffen. „Sehen Sie denn nicht, was Sie angerichtet haben?!“ Sie zeigte auf John, der sich schon wieder aufgerichtet und am Jubel beteiligt hatte. „Der arme, arme Bursche!“
„Es ist alles in Ordnung, Miss Stupels“, beeilte sich der arme, arme Bursche zu versichern. Er winkte ihr fröhlich zu und schlug dann Harriet kameradschaftlich auf den Oberarm. „Das wird schon wieder. An einem blauen Fleck ist noch niemand gestorben!“
„Es tut mir leid!“ Harriet erwiderte die kameradschaftliche Geste, was ihre Anstandsdame erst recht nach Luft schnappen ließ:
„Was ist denn das schon wieder für ein undamenhaftes Benehmen?“, rief sie zu ihrem Schützling hinüber. „Ich muss schon sehr bitten!“
Miss Stupels gehörte noch nicht lange zum Haushalt des Earls. Ihre Vorgängerin hatte sich überraschend mit einem fahrenden Händler vermählt und war mit ihm nach Yorkshire hinaufgezogen. Das hatte den Earl vor die schwierige Aufgabe gestellt, sich um einen rasch verfügbaren Ersatz umzusehen. Seine mutterlose Tochter brauchte schließlich nicht nur Unterricht, sondern auch eine passende weibliche Begleitung, wenn sie ins Dorf gehen oder eine der zahlreichen Einladungen aus der Gegend wahrnehmen wollte.
Der Earl kannte Harriet nur zu gut und wusste, wie sehr sie es hasste, eingesperrt zu sein. Was das betraf, kam sie nämlich ganz nach ihm. Wie er liebte auch sie Bewegung im Freien, wie er liebte auch sie die Musik, wie er liebte sie es, sich über Regeln hinwegzusetzen, die sie nicht für sinnvoll erachtete. Und doch gab es einen großen Unterschied. Ihm gestatteten sein hoher Stand und die Tatsache, dass er ein Gentleman war, ein weites Feld an Freiheiten. Sie hingegen war eine junge, noch dazu unverheiratete Lady. Sie brauchte stets jemanden an ihrer Seite, der ihre Freiheitsliebe in geordnete Bahnen lenkte. Von den fünf Bewerberinnen, die sich in der Eile auftreiben ließen, hatte Miss Stupels die besten Referenzen. Dabei übersah der Earl allerdings, dass sie bisher keinerlei Erfahrung mit Jugendlichen hatte sammeln können, war sie doch ausschließlich für kleine Kinder zuständig gewesen, die ihr von einer Nanny am Morgen ordentlich gescheitelt ins Schulzimmer gestellt worden waren. Was sie jetzt im Haus des Earls of Elmstead erleben musste, fühlte sich für sie in schockierendem Maße ungehörig an, und das ließ ihr tagtäglich mehrfach das Blut in den Adern gefrieren. Wie erzog man einen halbwüchsigen Wildfang, der sich nichts dabei dachte, mit Söhnen aus der Umgebung herumzutollen, als wäre sie einer von ihnen? Dem musste sie doch Einhalt gebieten! Das war sie ihrer Gouvernantenehre schuldig.
„Kommen Sie sofort her, Miss!“ Inzwischen hatte sich Miss Stupels vom Bitten aufs Brüllen verlegt und die Hände an den Hüften aufgestützt. „In zwei Stunden erwarten wir den Tanzmeister, und Flöte haben Sie heute auch noch nicht geübt! Schluss mit dem rohen Spiel auf dem Eis. Wir gehen!“
„Jetzt seien Sie doch nicht gar so streng“, meldete sich da eine warme Männerstimme hinter ihrem Rücken und ließ sie herumfahren. Da saß er hoch zu Ross, ihr Dienstgeber, der Earl of Elmstead höchstpersönlich. Die Schneedecke hatte den Laut der Hufe derart gedämpft, dass sie sein Kommen nicht bemerkt hatte. Rasch beeilte sie sich zu knicksen und wünschte sich inständig, sie hatte Lady Harriet nicht völlig unangemessen mit einem simplen Miss angesprochen. Auch wenn es ihr gutes Recht gewesen war, den ungezügelten Wirbelwind in seine Schranken zu weisen, stand es ihr nicht zu, sich dabei im Ton zu vergreifen. Eben jenem Wirbelwind, der seinem Vater soeben fröhlich zuwinkte und sich dann daranmachte, den Ball ein weiteres Mal mit ihrem Schläger zu verfolgen. Schon war sie mit weit ausholenden Schritten abermals quer über den Teich unterwegs. Miss Stupels knirschte mit den Zähnen.
„So freuen Sie sich doch, dass Ihr Schützling so viel Spaß hat“, lenkte der Earl ihre Aufmerksamkeit wieder auf sich. „Die Ferien dauern ohnehin nicht ewig und dann müssen die jungen Herren nach Eton zurück oder nach Harrow oder wo immer sie auch zur Schule gehen. Dann ist immer noch ausreichend Zeit für die Flöte, finden Sie nicht auch?“
„Selbstverständlich“, beeilte sich Miss Stupels zu versichern und knickste ein weiteres Mal. Insgeheim fragte sie sich, was bloß aus dem Mädchen werden sollte. Natürlich hatte sie den höchsten Respekt vor seiner Lordschaft. Dennoch: Er war ein Mann und zudem auch noch ein in seine Tochter vernarrter Vater. Der wusste nicht, wie man ein Mädchen richtig erzog. Ihrer Erfahrung nach hatte es noch keiner jungen Lady gutgetan, zu viele Freiheiten zu genießen. Spätestens anlässlich ihrer ersten Saison in London würde damit ohnehin Schluss sein. Dann würde man sie ins Korsett der gesellschaftlichen Konventionen schnüren, ob sie wollte oder nicht. Wie sollte sie denn anderenfalls den so dringend benötigten Ehemann finden? Der Vater lebte schließlich nicht ewig, Bruder gab es keinen. Also brauchte Lady Harriet einen Gemahl, der sie versorgte. Und ein Gentleman von Stand erwartete eine stille, duldsame Ehefrau, die an der Tafel präsentierte, anmutig zu tanzen wusste und lange Winterabende durch gekonntes Musizieren verkürzte. Er erwartete keinen Wildfang, der sich wie ein Junge benahm und der hinter einem Gummiball herhetzte, als gäbe es kein Morgen. Miss Stupels kniff die Lippen zusammen. Irgendwann, so schwor sie sich, irgendwann gewinne ich die Oberhand. Dann ist Schluss damit, dass ich mir auf der Nase herumtanzen lassen muss, oder Ihr müsst auf meine Dienste verzichten.
Kapitel 5
Anfang Dezember 1811Dover, EnglandGasthof Crown and Feathers
Während sich Miss Stupels also insgeheim überlegte, wie es ihr gelingen könnte, ihrem Schützling Folgsamkeit und Manieren beizubringen, und den Earl dafür verdammte, dass er ihr körperliche Züchtigungen strikt verboten hatte, drehte Harriet weiterhin fröhlich und mit roten Wangen ihre Runden übers Eis. Sie konnte schließlich nicht ahnen, dass sich ihr Leben in nicht allzu langer Zeit dramatisch verändern würde. Der kleinen Reisegruppe aus dem Kaisertum erging es ähnlich. Auch die Gräfin und ihre beiden Söhne waren, als sie den Gasthof Crown and Feathers in Dover betraten, weit davon entfernt zu ahnen, welches Schicksal ihnen in Kürze bevorstand.
Also sahen sie sich zufrieden in der Herberge um, die, wie ihnen ihr Reisemarschall versichert hatte, zu den respektabelsten der Stadt gehörte. Man bezog die besten Zimmer im ersten Stock und ließ sich schmecken, was Küche und Keller hergaben. Die Fenster der gemieteten Kammern gingen nach hinten zum Garten hinaus, und so störte in der darauffolgenden Nacht kein Gegröle betrunkener Gäste den wohlverdienten Schlaf.
Am folgenden Morgen begab sich Herr von Stockerau zum Hafen, um die Ankunftszeit des nächsten Schiffes zu erfragen, auf dem sie den Grafen als Passagier vermuteten. Die Kirchhoffs machten es sich derweilen im Extrazimmer gemütlich und genossen ein deftiges Frühstück, das aus Eiern, Speck, Blutwurst, Pilzen und Bohnen bestand und ihnen reichlich fremd vorkam.
„Das ist ja sicher nicht schlecht“, meinte Helmuth und beäugte kritisch die bunte Mischung auf seinem Teller. „Aber ein Kaisersemmerl mit Butter und Marillenmarmelade wäre mir doch noch alleweil lieber. Obwohl der Speck …“, er schnappte sich eine Scheibe vom Tablett in der Tischmitte, „der ist wirklich schön knusprig.“
Seine Mutter klopfte ihm auf die Finger.
„So, da hätten wir noch etwas Zitronenkuchen“, meldete sich Mrs Ladock, die rundliche Wirtin, zu Wort, die mit Schwung den Raum betreten hatte. Sie war eine warmherzige Frau in einem violetten Wollkleid, dessen Oberteil mit Knöpfchen bis zum kleinen grauen Kragen geschlossen war. Eine ebenfalls graue Haube verdeckte die Haare, und die gestreifte Schürze diente ihr zum Abwischen sowohl der Hände als auch der Tische. Ihre patente Freundlichkeit machte sie zur perfekten Gastgeberin. An diesem Morgen aber strahlte sie noch stärker vor Fröhlichkeit als sonst. Solch vornehme Gäste, die ganz offensichtlich nicht aufs Geld schauen mussten und dennoch angenehme Umgangsformen aufwiesen, bewirtete sie schließlich nicht alle Tage.
Mrs Ladocks Eintreten kam Emil gerade recht, erinnerte er sich doch daran, worum Elli ihn gebeten hatte.
„Mutters Kammerfrau möchte sich mit einem Gebet für das glückliche Ende unserer Reise bedanken“, begann er. „Wo gibt es denn hier in der Nähe eine katholische Kirche?“
Für einen Augenblick entglitt das gut gelaunte Lächeln dem Gesicht der Wirtin. „Eine katholische Kirche?“, rief sie aus. „Nein, so etwas haben wir hier bestimmt nicht. Wissen Sie denn nicht, dass diese Religion im Königreich verboten ist?“
Drei erschrockene Gesichter wandten sich ihr zu.
„Verboten?“, fragte Emil fassungslos. „Heißt das etwa, dass wir Katholiken befürchten müssen, in den Kerker geworfen zu werden?“
Da musste die Wirtin doch wieder lachen. „Nein, nein, so schlimm ist es nicht“, beeilte sie sich, ihre vornehmen Gäste zu beruhigen. „Ihnen geschieht mit Sicherheit nichts. Schließlich sind Sie Fremde und noch dazu aus bestem Hause. Und, wenn man es genau nimmt, so ist Ihre Religion hierzulande zwar offiziell verboten, sie wird aber irgendwie geduldet, wenn man damit nicht auffällt. Wenn Sie verstehen, was ich meine.“
„Das heißt, ich muss der Elli sagen, dass sie heimlich in ihrer Kammer beten soll?“, vergewisserte sich Emil. „Das wird ihr schwer zu schaffen machen, denn sie ist gar so gläubig.“
Die Wirtin war zu einem vergilbten Stadtplan hinübergetreten, der in einem breiten Holzrahmen zwischen den beiden Fenstern hing.
„Wenn es der frommen Frau so wichtig ist, kenne ich eine Lösung“, sagte sie und wandte sich zu Emils Mutter um: „Denn wie heißt es so richtig: Nur glückliche Dienstboten sind gute Dienstboten.“
„Das könnten meine Worte sein!“, rief die Gräfin erfreut und die beiden Frauen lächelten sich in stillem Einvernehmen zu.
„Außerdem habe ich persönlich nichts gegen die Katholischen“, sprach Mrs Ladock weiter. „Soll doch jeder nach seiner Façon glücklich werden, sage ich immer. Kommen Sie her, junger Mann!“
Emil tat wie ihm geheißen, während sich Helmuth und die Gräfin in ihren Stühlen zur Wirtin umwandten. „Es gibt tatsächlich einen katholischen Gebetsraum. Ich selbst war natürlich noch nicht dort, aber ich habe gehört, dass er sich hier in einem versteckten Hinterhof befinden soll.“ Ihr Zeigefinger tippte in die rechte Ecke des Stadtplans. „Sagen Sie der Dienerin, sie soll sich von hier in östliche Richtung begeben. Zwischen dem Bäckerladen und der Werkstatt des Schusters“, wieder tippte der Zeigefinger auf die Karte, „muss sie durch ein schmales, braunes Tor. Wenn sie direkt davorsteht, kann sie es eigentlich nicht übersehen.“
So kam es, dass sich Fräulein Elli kurz darauf mit ihrer Ledertasche auf den Weg machte. Die Gräfin hatte beschlossen, nur das Nötigste für die nächsten ein, zwei Tage auspacken zu lassen, sodass keine anderen Pflichten ihrem Ausflug entgegenstanden. Da man gleich nach Ankunft des Grafen weiterreisen wollte, hätte es keinen Sinn gehabt, die zahlreichen prall gefüllten Koffer die enge Treppe zu den Zimmern hinaufzuschleppen.
Nun, da die beiden Diener ausgegangen waren, hielt auch die Kirchhoffs nichts mehr im Gasthaus. Arm in Arm bummelten sie durch die kleine Stadt, bewunderten die Schaufenster der Geschäfte, die so anders aussahen als zu Hause, und gönnten sich schließlich Tee mit Scones, Clotted Cream und einer süßen Erdbeermarmelade in einem Kaffeehaus mit Blick auf das Meer. Emil lehnte sich in seinem Stuhl zurück und lächelte. Er glaubte, noch nie in seinem Leben so glücklich gewesen zu sein wie in diesem Augenblick. Es sollte für lange, lange Zeit das letzte Mal sein, dass er so dachte.
Das Unheil begann damit, dass sie an diesem Tag vergeblich auf die Ankunft des Grafen warteten. Also begab sich Herr von Stockerau am nächsten Morgen abermals zum Hafen, von wo er dann erst zu später Abendstunde zurückkehrte. Die Familie überlegte bereits, sich in die Schlafkammern zurückzuziehen, da tauchte er hektisch schnaufend auf und verkündete, dass der Graf wohlbehalten auf der Insel eingetroffen sei. Daraufhin sprangen die beiden Burschen auf, bereit, ihren Vater zu begrüßen, und auch die Gräfin drehte sich erwartungsvoll zur Tür, die sich hinter dem Reisemarschall geschlossen hatte. Doch sie ging nicht wieder auf.
„Ja, und wo ist er jetzt?“, fragte sie irritiert. „Wurde er am Hafen aufgehalten?“
Der Marschall drehte seinen Zylinder in beiden Händen und schüttelte den Kopf. Man brauchte keine besondere Menschenkenntnis zu besitzen, um zu erkennen, wie unwohl er sich dabei fühlte.
„Nun sagen Sie schon!“, forderte die Gräfin ungeduldig. „Wann können wir meinen Gemahl erwarten?“
„Gar nicht“, lautete die Antwort, die auf drei Gesichtern für irritiertes Stirnrunzeln sorgte. „Also … ich meine …, in diesem … Gasthof. Gar nicht. Seine Durchlaucht hat entschieden, anderweitig zu übernachten.“