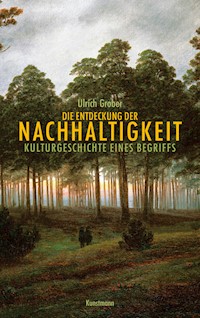Ulrich Grober
Die Spracheder Zuversicht
Inspirationen und Impulsefür eine bessere Welt
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2022 oekom verlag, Münchenoekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH,Waltherstraße 29, 80337 München
Lektorat: Laura Kohlrausch, oekom verlagKorrektorat: Petra KienleUmschlaggestaltung: Büro Jorge SchmidtUmschlagabbildung: © marukopum / shutterstock
E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-96238-922-2
Inhalt
Annäherungen
Kapitel einsMillas »da«
Kapitel zweiPasswort WOW – Zugänge zum magischen Moment
Kapitel dreiIkone Erde – Die Gaia-Perspektive
Kapitel vierNachhaltigkeit – Booster für einen Leitbegriff
Kapitel fünfBange machen gilt nicht! – Anatomie der Furchtlosigkeit
Kapitel sechsEine andere Welt ist möglich – Einspruch gegen die Alternativlosigkeit
Kapitel siebenDraußen zu Hause – Die Idee von friluftsliv
Kapitel achtWeniger ist mehr – Lob des Minimalismus
Kapitel neunDas gute Leben für alle – Eine Visionssuche
EpilogTools der Zuversicht
Zitierte und weiterführende Literatur
Danksagung
Über den Autor
Annäherungen
Die Zeit, so scheint es, ist aus den Fugen. Die Schocks der laufenden Ereignisse lösen Tag für Tag neues, lähmendes Entsetzen aus. Sie bringen uns dazu, die dunkelsten Bilder aus dem kollektiven Gedächtnis abzurufen. Etwas Kostbares droht hier und jetzt zu zerbrechen: der Glaube an die Zukunft. Dieses Buch möchte einladen, innezuhalten und einen Schritt zurückzutreten, um zu versuchen, aus der Distanz eine neue Perspektive zu gewinnen.
An jenem Wintermorgen 2022, als Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, gab es das Gefühl, man sei in einer anderen Welt aufgewacht. Die Regierung rief eine Zeitenwende aus. Mit anderer Welt verband ich bis dahin – und verbinde ich immer noch – Bilder von jungen Menschen mit leuchtenden Augen. Ich höre ihre Sprechchöre auf den Klima-Demos: »Eine andere Welt ist möglich!« Mit Zeitenwende assoziierte ich die Einteilung der historischen Zeit in vor und nach Christi Geburt. Oder ich dachte an die »Gezeitenwende«, den Wechsel von Ebbe und Flut, wie er sich seit Ewigkeiten in stetem, majestätischem Rhythmus unter dem Einfluss der Mondenergie Tag für Tag und Nacht für Nacht an den Küsten der Ozeane abspielt. Kriege aber sind keine Naturgewalten. Sie sind menschengemacht. So wie Erderwärmung, Artensterben, Pandemien und andere Erscheinungsformen der multiplen Krise, die uns in ihrem Bann hält. Diese Zeitenwende, so scheint mir, ist überhaupt keine Wende. Sie bedeutet vielmehr ein »Weiter so« in alten Mustern, nämlich in der Logik imperialer Geopolitik des 19. und 20. Jahrhunderts. Diese ist heute zutiefst aus der Zeit gefallen. Im 21. Jahrhundert ist sie nicht nur – wie schon immer – zutiefst unethisch, sondern auch zutiefst irrational. Denn angesichts der existenziellen Herausforderungen der Zukunft können wir uns Kriege schlicht und einfach nicht mehr leisten. Es sei denn, wir wollten es tatsächlich auf eine »Endzeit« – Apokalypse – ankommen lassen.
*
Ich bin Wanderer und weiß: Wenn du merkst, dass du die Orientierung verloren hast, dich verirrt hast, ist der erste Impuls, einfach weiterzugehen. Entweder willst du dir aus Trotz und Stolz nicht eingestehen, dass du irgendwann, irgendwo einen Fehler gemacht hast. Oder du bist in eine Art Panik geraten und klammerst dich an die Hoffnung, dass vor dir im nächsten Moment doch wieder vertraute Landmarken in Sicht kommen. Erst jetzt machst du den entscheidenden Fehler. Je länger du dich nämlich in die falsche Richtung bewegst, desto weiter entfernst du dich von deinem Ziel. Kleine Kurskorrekturen helfen da nicht. Das Klügste, was du jetzt tun kannst, ist die Umkehr. Du musst zurückgehen bis zu dem manchmal weit zurückliegenden Punkt, zu der Weggabelung, wo du wieder auf sicherem Gelände bist. Erst von dort aus kannst du dir den richtigen Weg suchen, den du beim ersten Mal verpasst hast. Einen, der dich zum Ziel führt.
*
Mit den Wörtern Wende und Wendezeit verbindet sich eine radikale Hoffnung auf eine tatsächliche Umkehr. Eine solche Zeit nannten die alten Griechen*)Kairos: der günstige Moment, das Zeitfenster, in dem sich neue Möglichkeitsräume auftun. Und damit alternative Pfade in ein unbekanntes Terrain – die Zukunft.
Ein solches Zeitfenster öffnete sich vor jetzt fünfzig Jahren. Es ist ein halbes Jahrhundert, zwei Generationen, her. Auf dem bis heute letzten bemannten Flug zum Mond, im Dezember 1972, kehrten die drei Astronauten ihren Blick um und sahen durch die Schwärze des Weltalls hindurch … »den schönsten Stern am Firmament«. In diesem Moment entstand das ikonische Foto des blauen Planeten. Es war ein epochales Bild: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte sah die Menschheit die Erde, ihren Heimatplaneten, von außen. Die ganze Erde, in ihrer vollen Schönheit, Einzigartigkeit und Zerbrechlichkeit. Magischer Augenblick. Wende zu einer Großen Transformation?
Die Umkehr des Blicks erzeugte ein Wir-Gefühl, das nicht mehr nur auf den Nahraum begrenzt war, sondern die ganze Erde mit einschloss. Das Bild des scheinbar schwerelos im All schwebenden blauen Planeten vermittelte eine Art Flow-Gefühl. Man spürte etwas von der Leichtigkeit des Seins: »Das Leben ist gut.« Nur ein kurzer Satz. »Life is good« prangt in den USA auf T-Shirts und Baseballkappen. Ist das banal? »Wie es auch sei, das Leben, es ist gut«: Diesen Vers schrieb Goethe vor fast zwei Jahrhunderten in dem Gedicht Der Bräutigam. So bekommt die Aussage Tiefe: Das Leben ist es wert, gelebt zu werden. Es ist lebenswert, liebenswert, bejahenswert. Es ist von Bedeutung. Wie es auch sei! Auch mit den unvermeidbaren Anteilen von Leid, Schmerz und Verzweiflung.
Die Erde ist der schönste Stern am Firmament. Und: Das Leben ist gut. Das sind die beiden Setzungen, die dieses Buch vornimmt. Das ist der Rahmen, den dieses Buch vorschlägt. Es ist – unhintergehbar, nicht zu beweisen – der Nullpunkt, den es fruchtbar machen will. In diesen Grundannahmen und diesem Grundvertrauen, denke ich, liegen die Quellen aller positiven Energien. Die anderen Fragen schließen sich an: Was macht das Leben nachhaltig, verleiht ihm Bedeutung? Für was lohnt es sich, mit Hingabe zu arbeiten und manchmal alles einzusetzen, was man hat, kann und ist? Was gibt Zuversicht? Die Überzeugung von der Wirksamkeit des eigenen Tuns ist jedenfalls ein wichtiger Faktor. Eine alte Erfahrung: Erfolgreich kämpfst du nur für etwas, nicht bloß gegen etwas. Lässt sich in einen solchen Rahmen der tagtägliche Horror einordnen – und positiv verarbeiten?
*
Wir erleben gerade, was die Astronauten der Mondmissionen vor 50 Jahren beim Anblick des Planeten mit dem Wort Zerbrechlichkeit ausdrücken wollten: Das »Netz des Lebens«, die Biosphäre, diese hauchzarte Hülle, die alles Leben hält und trägt und immer wieder neu ermöglicht, droht an vitalen Knotenpunkten zu reißen. Lebensspendende Kräfte der Biosphäre wie Klima, Gewässer, Wälder, Böden und Biodiversität könnten bald »Kipp-Punkte« erreichen, von denen aus keine Umkehr mehr möglich ist. In unserer Lebenszeit, unter unseren Augen, live über die sozialen Medien gesendet, könnten lebenserhaltende Systeme kollabieren. Rette sich, wer kann?
Der russische Schriftsteller Daniil Granin zog aus seinen Erlebnissen als Soldat während der mörderischen Belagerung von Leningrad durch die deutsche Wehrmacht einen ganz anderen Schluss: »Diejenigen, die andere retteten, die sich um andere kümmerten, ihnen halfen, … die mit letzter Kraft ihre Pflicht erfüllten … sie überlebten häufiger.« Es stimmt, Horror und Verzweiflung, Gier und Egoismus sind ein Teil der Realität. Schönheit, Empathie, Nachhaltigkeit aber – die Möglichkeitsräume – sind eine mindestens ebenso starke Realität. Eine einfache Feststellung: Die Mehrzahl der Menschen überall auf der Welt ist freundlich, friedfertig und hilfsbereit. Oder?
»Rätta jorden« (Greta Thunberg), die Erde retten, ist möglich. Aber es erfordert das Vertrauen, dass es die Wege gibt, und die Kraft, umzukehren und sie zu betreten. Zuversicht ist eine Ressource, mit der wir in diesem historischen Moment besonders achtsam umgehen, die wir nähren sollten. Denn wir brauchen sie für das, was kommt. Sie darf nicht illusionär sein. Leere Worte helfen nicht weiter. Ein nur gut gemeintes Bla, bla, bla stärkt niemanden. Basis von Zuversicht ist ein Grundvertrauen in die Güte der, wenn man so will, Schöpfung oder der Evolution, ein Grundvertrauen in die Güte des Lebens, in die eigene Kraft und die Kraft des »Wir«. Ein solches Vertrauen zu bilden, muss früh anfangen. Es ist der Kern von frühkindlicher Bildung. Selbst im tiefsten Zweifel, so scheint mir, wäre eine Haltung angebracht, die mittelalterliche Mönche mit dem Satz »credo, quia absurdum« umrissen: Ich glaube es, auch wenn es absurd ist.
*
»Die Zukunft ist ein unbetretener Pfad«, sagt ein tibetisches Sprichwort. Jeder und jede von uns verfügt über ein Navigationssystem, um sich auf diesem Terrain zu bewegen. Davon erzählt dieses Buch. Es handelt von der orientierenden Kraft der Sprache und der Energie ihrer Wörter. »Alle Menschen tragen einen Vorrat an Wörtern mit sich, den sie dazu einsetzen, ihre Handlungen, ihre Überzeugungen, ihr Leben zu rechtfertigen.« Es sind diejenigen Wörter, so der amerikanische Philosoph Richard Rorty, in denen wir »unsere Zukunftspläne, unsere tiefsten Selbstzweifel und höchsten Hoffnungen« formulieren.
Die Sphäre der zwischenmenschlichen Beziehungen lebt von der Sprache und vom Erzählen, von unseren Narrativen, unserem Storytelling. Es führt uns von der Ich-Du-Verbundenheit zum Wir. Von der Familie, der Nachbarschaft, dem lokalen Gemeinwesen bis zum »globalen Dorf«. Unsere Werte und Ideale bilden sich über die Sprache. Auch die Intimität zwischen Mensch und Natur entsteht über die Sprache. Unser Geist entfaltet sich an der lebendigen Natur, der wir zugehören. Selbst deren Stille ist beredt, wenn wir die »Signaturen«, die Zeichensprache der Lebewesen und der Dinge, neu wahrnehmen, deuten, davon erzählen können.
Sprache ist ein offenes System, ein Gemeingut, das Wichtigste, was wir haben. Unser Vokabular lenkt unser Denken. Der gesamte Wortschatz, über den wir aktiv und passiv verfügen, vor allem aber der kleine Vorrat an Wörtern, die man aus dem großen Ganzen im Laufe seines Lebens für sich auswählt und besonders wertschätzt. Lässt sich dieses Vokabular flexibel gestalten, zukunftsfähig machen? Denn was wir als Wegzehrung für die Reise in eine unsichere Zukunft besonders dringend brauchen, ist eine Sprache der Zuversicht, eine, die verbindet. In meinem Fokus stehen Wörter, Begriffe, Sprüche, Sinnbilder, ikonische Bilder, die uns befähigen, einen Bogen zu schlagen von unseren zartesten Empfindungen zu den großen Fragen des Menschseins im 21. Jahrhundert.
*
Ich möchte dazu anregen, die konvivialen Wörter im eigenen Wortschatz besonders wertzuschätzen. Convivium – das ist das Gastmahl der Antike, das unbeschwerte, offene Gespräch beim geselligen Zusammensein. Es schließt den Genuss von liebevoll zubereiteten Gaben der Natur, den Blickkontakt, die Augenhöhe mit ein. 1972, im Jahr des letzten Mondflugs, hat der Philosoph und Theologe Ivan Illich das alte Wort aufgenommen und seine Bedeutung erweitert. Er sprach von konvivialen Werkzeugen, die jedem, der sie benutzt, die Möglichkeit böten, »die Mitwelt mit den Ergebnissen seiner Visionen zu bereichern«. In diesem Sinne sprach er auch von der »Wiederherstellung der konvivialen Funktion der Sprache«. Finden wir in den Schockwellen der Gegenwart die Sprache wieder, die uns befähigt, uns eine andere Welt vorzustellen und daran zu arbeiten?
Unsere elementaren Wörter, Leitsprüche und ikonischen Bilder suchen wir uns im Laufe unseres Lebens zusammen. Sie schwirren durch unseren Alltag, wir »lesen« sie auf. Die Möglichkeiten dazu haben sich innerhalb einer Generation geradezu entgrenzt. Statt nur in den vertrauten Nahräumen und in ein paar verbindlich gemachten Schriften finden wir sie in den sozialen Medien, im Feuerwerk der globalisierten Popkultur und Reklamesprache. Auf Wikipedia und anderswo können wir ihre Bedeutungen erschließen. Das Netz speichert die Literaturen aller Zeiten und aller Sprachen. Stets in Gemengelage mit den allgegenwärtigen Botschaften des Kommerzes. Die Schwerkraft elementarer Wörter verwandelt sich in spielerische Leichtigkeit. »Bei Gott sind alle Dinge möglich« (Matthäus 19) – »Eine andere Welt ist möglich« (Fridays for Future) – »Nichts ist unmöglich« (Toyota). Schlüsselwörter erscheinen in neuer Vitalität, oft genug aber auch abgenutzt, verbraucht, entleert. Wer auf die Energie der Wörter vertraut, sucht nach Wegen, sie zu recyceln oder – besser noch – zu upcyceln, mit neuem Gebrauchswert für sich ins Spiel zu bringen.
*
Dazu will dieses Buch einladen: Wörter und Bilder der Zuversicht auf die Goldwaage zu legen, um ihre Bedeutungsschichten zu erkunden, zu vergegenwärtigen, ihnen neue Kraft zu geben. Zu diesem Zweck, nicht aus musealem Interesse, suche ich sie in ihren historischen Kontexten auf. Dabei bin ich immer wieder auf zwei Momente in der Geschichte gestoßen, zwei Wendezeiten, historische Weggabelungen, an denen über einen radikal anderen Umgang mit der Welt nachgedacht und gesprochen wurde. Beide waren zugleich Blütezeiten konvivialer Sprache.
So ein Kairos war die Zeit um 1800. In dieser Epoche nahmen Industrialisierung und fossiles Zeitalter Fahrt auf. Daher wählt die aktuelle Klimaforschung genau diesen Moment als Nullpunkt, um die menschengemachte Erderwärmung zu messen. In der Kultur jener Zeit entstand aber zugleich eine betörende Fülle alternativer Bilder des »guten Lebens«, ja einer »anderen Welt«. In der poetischen Arbeit an der »Romantisierung« der Welt ging es im Kosmos Weimar und anderswo in Europa um die Erneuerung der menschlichen Fähigkeit, sich verzaubern zu lassen. Um eine andere, naturnahe Moderne.
Die Zeit um 1968 war noch so ein historischer Moment. Die Anthropozänforschung sieht ihn als Beginn der Erdüberlastung, mit der wir heute konfrontiert sind. Doch damals kamen im Umfeld des Buches Die Grenzen des Wachstums auch radikale Alternativen zum »weiter so« in den Blick. Die Bilder aus dem All eröffneten neue Perspektiven. Die Imagination an die Macht! Jeder und jede, die etwas auf sich hielt, hatte die Blaupause für ein alternatives Projekt in der Tasche – und sprach darüber. Mächtiger allerdings wirkte der Sog in die globale Konsumgesellschaft. Deren Medien, deren Sprache drangen tief ins Bewusstsein und imprägnierten unser Alltagsvokabular.
*
Also zurück zu den Wurzeln, zurück zur DNA der Wörter. Das Interesse an der Etymologie zieht sich durch das Buch. Es ist weniger sprachwissenschaftlich, eher spielerisch angelegt. Grimms Deutsches Wörterbuch – 33 lindgrüne Bände, ein ganzer Meter auf meinem Bücherbord – war ständiger Begleiter beim Schreiben. Ergänzt durch das Online Etymology Dictionary. Den Bogen von der deutschen Gegenwartssprache zurück zu den gemeinsamen Wurzeln mit dem Englischen zu schlagen, eröffnet überraschende Perspektiven. Englisch ist, salopp gesagt, ein Mix aus Plattdeutsch und Vulgärlatein. Das alte Niederdeutsch, also das Idiom, das zur Zeit der Völkerwanderung in dem Land zwischen Weser und Elbe, Nord- und Ostsee gesprochen wurde, ist eine starke Wurzel des modernen Englisch, der Verkehrssprache von Globalisierung und Internet. Ihre Sprache nahmen die Angeln und Sachsen um das Jahr 500 beim Aufbruch zu ihrer Landnahme auf die britische Insel mit. Dort verdrängte es das Keltische und verschmolz weitere 500 Jahre später mit dem romanischen Idiom der normannischen Eroberer. Der Gang zu diesen etymologischen Wurzeln ist höchst anregend, wenn wir zu der vielschichtigen Bedeutung unserer elementaren Wörter vordringen wollen. Nur ein Beispiel: Das altsächsische hêl ist zugleich die Wurzel von whole, holy und healthy, von heilen und heilig. Alte, neue Verbindungen. So entfalten achtlos benutzte Wörter und scheinbare Fremdwörter ihre Potenziale und ihren Zauber.
*
Als Wanderer bin ich mit leichtem Gepäck unterwegs. Ich lasse mir die Lust an der freien Bewegung nicht von der Qual des Tragens verderben. Beim Rucksackpacken lautet die Schlüsselfrage: Was brauche ich wirklich? Gilt das nicht auch für unser survival kit, für unsere eiserne Ration an Wörtern und Bildern? Eine Sprache für das 21. Jahrhundert sollte, so der italienische Schriftsteller Italo Calvino, »leicht« sein. Und das bedeutet: »schnell, genau, anschaulich, vielschichtig und – nachhaltig (consistent)«. Mir scheint, das wäre auch eine gute Beschreibung für eine Sprache der Zuversicht.**)
*) Dieses Buch richtet sich an alle Geschlechter gleichermaßen und bemüht sich um eine geschlechtsneutrale Sprache. Leider ist dies aus Gründen der Lesbarkeit nicht immer möglich, sodass in diesem Buch vorrangig die männliche Form benutzt wird. Sämtliche Personenbezeichnungen beziehen sich auf Personen jeglicher Geschlechtsidentität.
**) In dieses Buch sind wichtige Gedankengänge aus meinen früheren Büchern eingeflossen und wurden weiterentwickelt. Alle diese Titel sind noch greifbar (siehe Literaturverzeichnis). Ich möchte sie zur weiterführenden Lektüre schon an dieser Stelle herzlich empfehlen.
Kapitel eins
Millas »da«
Milla war da. Im Vorfrühling hat sie uns besucht. Zwei kostbare Wochen lang. Da war unser Enkeltöchterchen gerade mal ein Jahr und drei Monate auf dieser schönen Erde. Zuletzt hatten wir sie in ihrer Krabbelphase erlebt. Als sie begann, sich bäuchlings mit allen Vieren fortzubewegen, sich hinzusetzen oder an einem Schubladengriff hochzuziehen. Aus der Ferne so nah, über WhatsApp sahen wir dann atemlos zu, wie sie ihre ersten Schritte machte. Das linke Bein anheben und strecken, den Fuß aufsetzen. Das rechte Bein – unsicher – nachziehen, den Fuß aufsetzen. Und wieder das linke Bein heben … und … so … weiter. Fünf oder sechs kostbare, erste selbständige Schritte. Dann knickte sie ein. Das war um ihren ersten Geburtstag herum. Nur wenige Wochen später sahen wir, auch via Smartphone, wie sie im Winterwald der brandenburgischen Schorfheide ihre erste Wanderung unternahm. So weit die kleinen Füße trugen. Durch den Schnee stapfend, vorneweg, ohne helfende Hand, die Eltern folgten ein paar Schritte hinter ihr. Der Begegnung mit dem Unbekannten wich sie nicht aus, sondern ging ihm selbstsicher und neugierig entgegen. Den Blick nicht nur auf den Weg vor sich gerichtet, sondern immer wieder auch zur Seite, zu den Baumstämmen, ins Unterholz richtend. Schweifend, suchend, als ob sie von dem, was unterwegs zu sehen sein würde, rein gar nichts verpassen wollte. Nun also ihr nächster Auftritt bei den Großeltern. Wir konnten es kaum erwarten …
»Da!« ist Millas Passwort zum Leben. Aufrecht gehend, erhobenen Hauptes, erschließt sich das kleine Wesen mit diesem einen Wort neue Wirklichkeiten. Die Nahräume im Haus, draußen, im Garten, im Wäldchen hinterm Gartentor und so immer weiter. »Da« ist ihr erstes Wort. Nach dem Schreien und Weinen, auf das sie bis hierhin angewiesen war, um Hunger, Schmerz, Leid aller Art auszudrücken, nach den Gurr-Lauten und dem Brabbeln, mit dem sie Wohlbefinden kundtat. Fünfzehn Monate nach der Entbindung, als sie sich, unterstützt vom Pressen ihrer Mutter, durch den Geburtskanal gedreht und gewunden hatte, das große Köpfchen voran, dann die eine Schulter, dann die andere, um – endlich draußen – die Ärmchen weit auszubreiten, tief Luft zu holen, mit dem ersten Atemzug die Lungen so gut wie irgend möglich zu füllen – und dann mit ganzer Leibeskraft den ersten Laut auszustoßen. Urschrei des Daseins. Abschluss eines Kraftakts, Beginn von etwas ganz Neuem.
Jetzt also das erste richtige Wort. »Da«. Lautgestalt und Bedeutung decken sich. Atemstrom, Vibration der Stimmbänder, Bewegung von Zunge und Unterkiefer sind perfekt koordiniert und jederzeit wiederholbar. Am Anfang steht ein Wort. Wie bei allen Kindern in allen Sprachen der Welt. Wahrnehmung, Körpersprache und Sprache bilden eine Einheit. Schritt für Schritt treten die Erscheinungen hervor, werden sichtbar, werden greifbar. Die Augen wandern, der Blick schweift. Er taucht in den Fluss der Eindrücke ein, tastet die Dinge ab. Blickachsen wechseln, auch Duftfelder, Klanglandschaften, die Anordnung der Gegenstände im Raum. Etwas weckt ihre Aufmerksamkeit. Sie nimmt Blickkontakt auf, hält inne. Einen Moment lang unverwandte, unverstellte, ungeteilte Aufmerksamkeit.
Der Sinn des aufrechten Gangs, seit vor rund zwei Millionen Jahren Homo erectus in Afrika auf zwei Beinen zu laufen begann: der größere Überblick. Beim Gehen siehst du mehr als beim Laufen auf vier Beinen. Was IST da? Du siehst den großen Zusammenhang um dich herum. Der Blick trifft auf einen Blickfang. Was ist DA? Du siehst die Einzelheiten. Warum beginnen Kinder, sich aufzurichten und zu gehen? Ganz einfach: Weil es ihnen Freude macht. Die selbstständige Fortbewegung im Raum erlaubt es ihnen, die Welt zu entdecken. Die Sprache ermöglicht es ihnen, das Entdeckte zu verstehen und mitzuteilen.
»Da« ist hier und jetzt. Ganz hier und ganz jetzt! Milla streckt den Arm aus. Der Zeigefinger schnellt hervor. Indem sie auf etwas deutet, deutet sie das Phänomen für sich, begreift es, eignet es sich an. »Da«! Die Augen leuchten. Sie moduliert ihre Stimme. Lautstärke und Körpersprache variieren. »Da! Da!« Verschiedene Grade, Schattierungen von Aufmerksamkeit, Betroffenheit, Begeisterung, Entzücken kommen zum Ausdruck und in dem einen Wort zur Sprache. Sie gehen durch alle Fasern des Körpers. Alle Sinne, der ganze Leib ist beteiligt – Kopf, Bauch, Atemwege, Kehlkopf, Stimmbänder, Mund und Zunge. So wirbelt sie durch den Tag. Vom ersten Auftritt mit Mama am Frühstückstisch, noch verschlafen und rotbäckig, bis zum schlaftrunkenen Winke-winke beim Zubettgehen. Wenn sie wieder aufwacht, ist sie schlicht und einfach da. Und bereit für all die frischen Eindrücke des neuen Tages: die Schale Brei, die Scheibe Gurke, Handpuppe und Schaukelpferd, Regentropfen auf der Haut, der Schmetterling auf der Schulter, Stock und Stein, Sand und Matsch unter den Füßen auf dem Weg durch den Wald. Da – eine Baumwurzel im Boden. Milla purzelt hin, ist ganz verdutzt, erhebt sich, streift sich die Erde von den Handtellern. Weiter geht’s. Eine Pfütze kommt näher. Links herum? Rechts herum? Mittendurch!
Besonders fasziniert sie das ganz Flüchtige: Vogelzwitschern, Wolken, Seifenblasen, so etwas. All die Momente des Staunens! Nur die Gegenwart, das Hier und Jetzt, ist wirklich. Die Welt ist, wie sie ist, und das Leben, wie es ist, ist gut. Das schließt Momente des bitterlichen Weinens und angsterfüllten Schreiens nicht aus. Große Gefühle, das Überwältigende, Unaussprechliche, Unfassbare, Unsagbare müssen raus. Ihr Erleben, ihre Vitalität brauchen ein Ventil, drängen nach außen. Einatmen, ausatmen – Merkwelt, Wirkwelt. Sie will sie mit-teilen, mit uns teilen. »Da«, Schau du doch auch mal hin! Das Miteinander wächst durch Sprache. Die Sprache wächst am Miteinander. Etwas entsteht neu. Mit welchem Wort Kinder anfangen zu sprechen, ist individuell verschieden, hängt von zufälligen Einflüssen ab. Die Zusammenhänge von Sprache, Spiel und Kreativität sind unerschöpflich.
Kinder erschließen sich ihre Umwelt unter anderem, indem sie eigene Wörter erfinden. Sie betreiben Lautmalerei. Milla ahmt Tierlaute nach. Von den struppigen Nebelkrähen in ihrem Prenzlauer-Berg-Hinterhof hat sie das »kra-kra« gelernt. So benennt sie alle Vögel, selbst das zarte Rotkehlchen, auch ihre geliebte Raben-Handpuppe. Von den Hunden im Kiez kam der »wawa« in ihr Anfangsvokabular. Ihr erstes »richtiges« Wort hat Milla aus dem Schatz ausgewählt, den ihre Bezugspersonen ihr sprachlich anboten. »Milla, guck mal … da.« Das Wort, das sich für sie am leichtesten nachahmen, am leichtesten sprechen ließ, erschien ihr gleichzeitig als das Wort mit der umfassendsten Bedeutung – ihr Ur-Wort.
Heiß und innig liebt Milla das Fort-und-da-Spiel. Im Wald läuft sie ein Stück voraus, bis sie den knorrigen Stamm einer alten Eiche neben sich hat, schaut sich kurz nach uns um, verschwindet hinter dem Baum und wartet. Unsere Rufe: »Milla ist weg! Wo ist Milla?« werden zunehmend verzweifelter. Mit einem triumphierenden Lächeln tritt sie hinter dem Baum hervor. Sehen und gesehen werden. Jemand von uns ist plötzlich fort. Mit vertauschten Rollen geht das Spiel weiter. »Da« und »fort« gehören zusammen. Kein Geringerer als Sigmund Freud hat das im Spiel mit seinem Enkelsöhnchen Ernst entdeckt und darüber nachgedacht. Es gehe um etwas Existenzielles, nämlich die Verlustangst, die Urangst, dass die Mutter weggeht – und nicht mehr wiederkommt. Spielerisch vergewissert sich das Kind, dass ein Verschwinden aus dem Blickfeld nicht wirkliches Verschwinden, nicht die katastrophale Trennung bedeutet. Das Spiel stärkt etwas Wesentliches, nämlich Grundvertrauen in die Güte der Welt und das Gute im Menschen. Alles wird gut. Jedenfalls ist es jederzeit möglich, dass alles wieder gut wird. Dazu passt Millas Vertrauen in das Unbekannte. Bei unseren Ausflügen in Wald und Heide entwickelt sie ihren Eigensinn. Sie hat eine große Neigung, vom Weg abzuweichen – ins Weglose. Bis Brombeerranken und Gestrüpp undurchdringlich werden. Dann dreht sie sich um, winkt uns zu und tritt den Rückzug an.
»Kommt ihr zum Essen?« rufe ich aus der Küche, wo Millas Buchweizengrütze köchelt. »Lass sie«, antwortet ihre Mama, »sie ist gerade im Flow.« Alle solche Phasen des selbstvergessenen Aufgehens in der Umwelt sind wesentlich, sind heilig, sollten möglichst wenig gestört werden. Ich spiele, also bin ich. Ich bewege mich, also bin ich. Ich weine, also bin ich. Ich greife und begreife, also bin ich. Ich esse den Buchweizen, den Opa für mich geschrotet, aufgekocht und mit Banane zubereitet hat, also bin ich. »Da«, jubelt sie, als ich sie in ihren Hochsitz hebe und den süßen Brei serviere. Und ich? Ich koche hier und jetzt für mein Enkeltöchterchen, also bin ich. Mir fällt der Satz aus der afrikanischen Philosophie des Ubuntu ein: »Ich bin, weil du bist.«
»Da«, dieses schlichte Hinweiswort führt mitten hinein in das Wunder des »Da-Seins«, des Lebens in seinem ganzen Umfang, seiner ganzen Fülle, seiner Ganzheit. In dem Wort äußert sich eine wunderbare Eigenschaft aller Kinder: die Fähigkeit, zu staunen. Ist sie angeboren? Ist sie eine Begabung? Eine Gabe?
*
»Vorzeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag: Ach, wenn wir doch ein Kind hätten! Und kriegten immer keins.« So beginnt Grimms Märchen Dornröschen. Bekanntlich bringt ein Frosch die Wende. »Dein Wunsch«, verheißt er der Königin, »wird erfüllt werden. Ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen.« So geschah es und die Geburt sollte mit einem großen Fest gefeiert werden. Eingeladen waren auch die weisen Frauen des Königreiches, damit sie »dem Kind hold und gewogen wären«. Allerdings musste von den insgesamt dreizehn Feen des Landes eine daheimbleiben, denn im königlichen Haushalt gab es nur zwölf goldene Teller. Die zwölf Geladenen waren an der Tafel versammelt und als es so weit war, traten sie eine nach der anderen hervor und beschenkten das Kind mit jeweils einer »Wundergabe«, als da wären: Tugend, Schönheit, Reichtum …
An dieser Stelle des Märchentextes hakte Rachel Carson ein. Die amerikanische Meeresbiologin, Schriftstellerin und Aktivistin war, könnte man sagen, eine der weisen Frauen des 20. Jahrhunderts. Ihr Buch Der stumme Frühling von 1962 war ein früher, wirkmächtiger Einspruch gegen die globale Zerstörung der Umwelt, gegen unseren, wie sie sagte, Krieg gegen die Natur. »Hätte ich Einfluss auf die gute Fee, die über die Taufe aller Kinder wacht«, schrieb Rachel Carson in einem früheren Essay, »dann würde ich sie nur um eine einzige Gabe für jedes Kind dieser Erde bitten, nämlich um den sense of wonder. Und der sollte so unverwüstlich sein, dass er das ganze Leben lang hält.«
Sense of wonder. Wunderbarer Ausdruck! Schwer zu übersetzen. Rachel Carson schöpfte – wie Sigmund Freud – aus dem direkten Erleben. Mit ihrem vierjährigen Großneffen Roger erkundete sie 1956 einen Sommer lang die Umgebung ihres Ferienhauses an der Küste von Maine, den Wald, den Strand, den Saum der Gezeiten. Daraus entstand ein Essay mit dem Titel Help your child to wonder – Hilf deinem Kind beim Staunen. Die Grundlagen sind angelegt: Die Welt des Kindes ist frisch, neu und wunderbar, voll von Staunen und Faszination. Carson umschreibt den sense of wonder in mehreren Anläufen. Es ist dieses klarsichtige »Schauen« (vision) des Kindes, sein echter Instinkt für das, was schön und »ehrfurchteinflößend« (awe-inspiring) ist. Es ist die kindliche Neugier, die Faszination für das Neue und das Unbekannte, der Sinn für Schönheit, ein Gefühl der Empathie, des Mitfühlens und Einfühlens, der Bewunderung oder Liebe – und daraus folgend der Wunsch nach mehr Wissen über das, was einen emotional berührt hat. »Ich glaube von ganzem Herzen«, heißt es bei Rachel Carson, »dass für das Kind – wie auch für die Eltern, die es begleiten und leiten – nicht halb so wichtig ist, zu wissen als zu fühlen. Wenn Fakten die Samen sind, die später Wissen und Weisheit erzeugen, dann bilden die Emotionen und Sinneseindrücke den fruchtbaren Boden, den es braucht, damit die Samen des Wissens wachsen können.«
Sense of wonder. Wie lässt sich dieser prägnante Ausdruck angemessen ins Deutsche übersetzen? Ziemlich wörtlich mit Sinn für das Wunder oder Sinn für den Zauber? »Sensorium für das Wunderbare«? Vielleicht mit »Fähigkeit, zu staunen«? Oder – unter Rückgriff auf Heidegger – mit »Offenheit für das Geheimnis«? Oder nehmen wir den Ausdruck von Papst Franziskus, »Offenheit für das Staunen und das Wunder«? Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Rachel Carson jedenfalls war inspiriert von Albert Schweitzer, dem Theologen, Pazifisten und (wie man ihn in den fünfziger Jahren nannte) Urwalddoktor. Seine Ethik, die damals weltweit Einfluss erlangte, hat Schweitzer in drei Worten zusammengefasst: »Ehrfurcht vor dem Leben.«
Zurück zum Märchen. Dornröschen geht bekanntlich wundersam weiter. Der Bannfluch der dreizehnten, der bösen oder genauer gesagt in ihrem Stolz gekränkten Fee versetzt die fünfzehnjährige Königstochter und ihre gesamte Umgebung in einen hundertjährigen Schlaf. Eine dichte, für jeden Eindringling todbringende Dornenhecke wächst rings um das Schloss empor. Und dennoch gerät der Ruf von Dornröschens Schönheit nicht ganz in Vergessenheit. Nach langer Zeit traut sich mal wieder ein Königssohn, die Brautwerbung zu versuchen. Mit den Worten »Ich fürchte mich nicht« macht er sich auf den Weg ins Innere des Schlosses. Zum Glück sind die hundert Jahre gerade verflossen und der Weg in den Turm, in dem Dornröschen schläft, ist frei. Der magische Moment, es wachzuküssen, ist gekommen. »Da lag es und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte, und er bückte sich und gab ihr einen Kuss. Wie er es mit dem Kuss berührt hatte, schlug Dornröschen die Augen auf, erwachte und blickte ihn ganz freundlich an.« Da ist er – der Blickkontakt, der »unverwandte« Blick, die zärtliche Berührung. Ein sense of wonder ist allen Märchen eingeschrieben. Sie handeln ja von der Wiederverzauberung der Welt – und von der Selbstverständlichkeit des Unmöglichen. »Und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem Dornröschen in aller Pracht gefeiert, und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende.« So weit, so gut, das Ende einer Geschichte über eine Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat …
*
Millas Mama kannte dieses Märchen so gut wie auswendig. Damals, als sie selbst erst drei, vier, fünf Jahre alt war, bildeten die Erzählungen der Brüder Grimm den Grundstock ihrer Gutenachtgeschichten. Manchmal gefolgt von einem alten Lagerfeuerlied zur Gitarre. Und wenn ich das Märchen mal mittendrin sanft abbrach, weil ich selber erschöpft war und dachte, sie sei eingeschlummert, sagte sie mir noch im Halbschlaf die nächsten drei, vier Sätze aus dem Kopf vor, damit ich noch ein kleines bisschen weiterläse …
Und du, Milla? Am Ende des Tages bringt Mama sie zu Bett. Als sie so gut wie eingeschlafen ist, übernehme ich die Wache. Noch ein herzzerreißendes Schreien, nur ganz kurz, dann schläft sie friedlich. Auf dem Rücken liegend, das Köpfchen zur Seite geneigt, die Ärmchen angewinkelt, ein Händchen aufs Kuscheltier gelegt, das andere lose zur Faust geballt. Lange Zeit verharrt sie regungslos, fast lautlos atmend. Dann fährt sie sich mit der Hand übers Gesicht, bettet den Kopf zur anderen Seite, ein paar tiefere Atemzüge. Später ein kurzes Seufzen – wie im Traum …
Eine plötzliche Eingebung: Das innere Kind, mit dem Milla in späteren Zeiten, auch in Zeiten höchster Not, Zwiesprache halten wird, bei dem sie Trost suchen und Kraft schöpfen kann – dieses innere Kind bildet sich genau jetzt. Quo vadis? Wo führt dein Weg dich hin, Milla? Genau an der Schwelle vom 21. zum 22. Jahrhundert wirst du 80 Jahre alt. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Mädchen deines Alters liegt noch ein Stück höher. Jedenfalls von heute aus gesehen! Wirst du 2099 den runden Geburtstag richtig feiern können? Gesund an Leib und Seele? Auf einem sich erholenden, wieder gesund, wieder cooler werdenden Planeten? Oder nicht? Wirst du dir deinen Sinn für das Wunder und das Wunderbare des Lebens bewahren können? Gelingt es dir, dein kindliches Staunen bei der ersten Erkundung der Welt in einen Weg lebenslanger Selbstermächtigung zu überführen? Und werden dich diese Fähigkeiten durch die prekärsten Zeiten tragen? Durch Zeiten mit einem höllischen Klima, Not und Gewalt? Oder wird der Leidensdruck irgendwann so groß, dass du an irgendeinem Punkt sogar den Tag deiner Geburt verfluchen wirst? Wie werden du und deine Generation an Neujahr 2100 auf die Zeit der Kindheit und die Generation der Großeltern zurückblicken? Wehmütig? Anklagend? Mit unendlicher Bitterkeit? Versöhnt? Voll Stolz auf die eigene Lebensleistung?
Für einen wie mich, zur Welt gekommen fast auf den Tag genau in der Mitte des 20. Jahrhunderts, kommt das Ende in Sicht. Du bist meine einzige leibhaftige Verbindung zum 22. Jahrhundert. Nach mir die Zukunft – deine Gegenwart. Was kann ich in der Zeit, die mir noch bleibt, für dich tun? Wie »generationengerecht« denken und handeln? »Enkeltauglich«, wie man neuerdings sagt. Was muss ich noch weitergeben? Fragen über Fragen! In diesem Buch versuche ich ein paar Antworten. Vielleicht machen sie Lust auf ein Leben, das weit ausgreift …
*
Kurz bevor sie zwei wurde, übte Milla in der Kita ihr erstes Lied ein. Für den Martinszug. Das Laternenlied erzählt über Sonne, Mond und Sterne. An diesem Abend zeigte Papa ihr aus dem Fenster ihrer Wohnung im vierten Stock die Venus, den Abendstern, der knapp über dem Horizont am südwestlichen Himmel über Berlin hell leuchtete. »Abend …tern« wiederholte sie andächtig. Ja, Milla*), der wird dich auf deinem ganzen langen Weg begleiten. Und Sonne, Mond und all die anderen Sterne auch. Bis zum Ende.
*
Eine tröstliche Stimme aus der Vergangenheit hallt herüber. Von jemandem, der wahrlich keine glückliche Kindheit hatte. Ziemlich genau 100 Jahre vor Millas Geburt, am 18. Oktober 1921, schreibt Franz Kafka in sein Tagebuch: »Ewige Kinderzeit. Wieder ein Ruf des Lebens. Es ist sehr gut denkbar, dass die Herrlichkeit des Lebens um jeden und immer in ihrer ganzen Fülle bereitliegt, aber verhängt, in der Tiefe, unsichtbar, sehr weit. Aber sie liegt dort, nicht feindlich, nicht widerwillig, nicht taub. Ruft man sie mit dem richtigen Wort, beim richtigen Namen, dann kommt sie. Das ist das Wesen der Zauberei, die nicht schafft, sondern ruft.«
*) Millas Fußabdruck, genommen im Alter von drei Monaten, wird uns durch das Buch begleiten.
Kapitel zwei
Passwort WOW
Zugänge zum magischen Moment
Es hat eine schöne Leichtigkeit. Schon der Wortkörper ist purer Minimalismus. WOW. Eine Silbe, zwei Laute. Die Grammatik spricht von »Interjektion«. Das ist ein Ausruf, den man »dazwischenwirft«. Die Begegnung mit etwas Außergewöhnlichem drängt zur spontanen Äußerung. Im Deutschen nennt man das auch »Empfindungswort«. Genau darum geht es: Um die Empfindung, die instinktive Regung, die den Gefühlen und den Gedanken vorausgeht.
WOW lässt sich flüstern, in einer intimen Zwiesprache. Oder stumm artikulieren, im Selbstgespräch mit der eigenen inneren Stimme. Oft bricht es aber als Aufschrei hervor, ekstatisch, endlos dehnbar, fast wie ein Wolfsgeheul. Manchmal ist das Wort von einer Gänsehaut begleitet. Diese Form der Erregung stammt aus der Frühzeit unserer Evolution. Die Nackenhaare stellen sich auf. Sie signalisieren einen Ausnahmezustand, nämlich das Ereignis des Wunderbaren, des Unfassbaren – oder aber einer drohenden Gefahr für Leib und Leben. Komplett Gänsehaut heißt die Steigerungsform in der Sprache der sozialen Medien. In den USA steht WOW auf der Liste der ersten fünfzig Wörter, die ein Kind lernt. Auch im Deutschen ist es längst kein Fremdwort mehr. Der Duden beschreibt es als Ausruf der Anerkennung, der positiven Überraschung und unvorhergesehenen Begeisterung. Der WOW-Moment ist unverfügbar. Der Impuls kommt unwillkürlich. Es ist ein magischer Moment. Er erfasst eine besondere Konstellation von Innenwelt und Außenwelt. Blitzartig hebt er dich aus der Routine des Alltags heraus. Deswegen muss er »raus«, muss kurz und bündig geäußert und möglichst schnell kommuniziert werden. Nur winzige Zuckungen des Daumens auf der Smartphone-Tastatur, schon sind Wort und Botschaft versendet.
WOW ist sehr netzaffin. Dort ist es Mittelpunkt eines kompletten Wortfeldes. Nahe dran ist Oh my God, chiffriert als OMG. Synonym verwendet wird awesome – wörtlich: Ehrfurcht gebietend. Im Deutschen machen aktuell unfassbar und magisch Karriere. Oder auch irgendwie surreal, also unwirklich, übernatürlich. Ähnliche motionale Ausnahmezustände signalisieren die Wörter flow (Fluss, Flut), glamour (Glanz) und event (Ereignis). All diese Wörter flirren, flimmern und schwirren durch die sozialen Netzwerke – Tag und Nacht, jede Sekunde, rund um den Globus, inflationär. Sie werden mit strahlenden Emojis verziert, mit emporgereckten Daumen bekräftigt, mit Ausrufezeichen verstärkt. Stets ist ein Hauch von sense of wonder mit im Spiel, die ungestillte Sehnsucht nach der Verzauberung. Diese Wörter, so banal sie meist benutzt werden, haben einen spirituellen Unterton. Ja, in vielen Fällen sind sie der Sprache des Sakralen entlehnt.
Auf dieser Ebene trifft sich das WOW mit einem anderen Empfindungswort, seinem Gegenpol. Der Seufzer OH WEH löst eine plötzliche Empfindung von Schmerz, Angst, Leid und Mitleid in einen hauchzarten Klang und ein beinahe schwereloses Wortgewebe auf. Klingt etwas altmodisch, ist fast in der Versenkung verschwunden, hätte aber, denke ich, jetzt wieder einen hohen Gebrauchswert. Die Wurzeln reichen tief. Darin steckt das altsächsische wê, das im Englischen in dem Wort woe – Trauer – weiterlebt. Im Mittelhochdeutschen war das Owê Schlüsselwort für das Liebesleid des Minnesangs. Dass Goethe ein O …weh, weh! einwirft, wenn er – empfindsam – von den Leiden des jungen Werther erzählt, verwundert nicht. Das Jiddische, das im Mittelhochdeutschen wurzelt, überliefert es in der Fassung oy vey. Mit einem kurzen OH WEH soll Albert Einstein seine Empfindung zum Ausdruck gebracht haben, als ihn 1945 die Nachricht vom Atombombenabwurf auf Hiroshima erreichte.
WOW und OH WEH. Verzauberung einerseits, Bewältigung von Angst, Leid und Wehmut auf der anderen Seite. Zwischen beiden Polen spielt sich das Leben im 21. Jahrhundert ab. Wir werden dafür beide Wörter dringend brauchen. Entscheidend ist, eine Balance zwischen den beiden Stimmungen und Gefühlslagen zu finden und zu halten.
*
Das Leben ist gut – wie es auch sei! Die Sehnsucht, seinem Leben und Erleben Glanz zu verleihen, die Entschlossenheit, das Schöne, das Wunder, den Zauber in sein Leben hereinzuholen, haben ihre Dynamik in unserer so prekären Gegenwart keineswegs verloren. Und das ist gut so. Dieser Wille gehört untrennbar zum Streben nach Glück, ist uralt und ewig jung. Er sucht sich immer neue Kanäle und Ausdrucksformen. Doch wie die sozialen Medien, ja das Netz insgesamt, ist gerade das Wortfeld WOW heillos verstrickt in die Sprache der Werbung und die Welt der Warenästhetik. Es wird seines Zaubers beraubt von endlosen Plakaten zu Lippenstiften, Videos über Wischmopps und Anzeigen zum nächsten Wochenendtrip. Lassen sich die Wörter aus dieser Falle befreien? Wir müssen ihre Tiefenschicht freilegen, ihre ursprüngliche Magie in die heutige Sprache zurückbringen.
Nehmen wir also WOW als ein Passwort. Es öffnet Zugänge. Sein Geheimnis ist die ungeteilte Aufmerksamkeit, die leibhaftige Präsenz. Alles loslassen, was ablenkt. Sich einlassen auf das, was dann auf einen zukommt. Die Welt, das Da-Sein findet genau jetzt, genau hier statt. Hic et nunc, sagten die Philosophen der Renaissance. Right here, right now heißt es prägnant auf Englisch. Die Pforten der Wahrnehmung so weit wie möglich öffnen, höchste Geistesgegenwart mit allen Sinnen – wo das gelingt, entsteht ein Resonanzraum, in dem wir mit der Welt in Verbindung treten. So verstanden ist WOW überhaupt nicht mehr trivial.
*
Eine überraschende Entdeckung: WOW ist keineswegs den Sprechblasen von Comics aus den 1980er- oder 1990er-Jahren entsprungen und von dort in den globalisierten Jugendjargon übergewechselt. Man muss tief graben, um zu seinen Wurzeln vorzudringen. Er stammt aus der Scots leid, dem alten schottischen Idiom.
The gypsies came to our good lord’s gateAnd, WOW, but they sang sweetly!They sang sae sweet and sae very completeThat down came the fair lady.
So beginnt eine schottische Folk-Ballade. In einer Volksliedsammlung aus dem Jahr 1740 erschien sie, schon dem damaligen Standard-Englisch angepasst, zum ersten Mal gedruckt. Bis heute ist sie in Schottland populär. Johnnie Faa, the Gypsie Laddie erzählt von einem Roma-Jüngling, der mit seinen Gesellen die fair lady eines Schlosses durch seinen Gesang verzaubert. Die Geschichte geht so weiter:
And she came tripping down the stair,And a’ her maids before her;As soon as they saw her well-far’d faceThey cast their glamour o’er her.
Die schöne Lady, geleitet von ihren Kammerjungfern, kommt also leichtfüßig die Treppe herunter ans Tor. Als die Musikanten ihr wohlgeformtes Gesicht erblicken, »werfen sie einen Zauber (glamour) über sie«, der sie dazu verführt, mit dem Jüngling durchzubrennen. Die Geschichte, soviel sei verraten, endet blutig. An ihrem Beginn aber steht die Verzauberung, das WOW und ein weiteres Wort, das heute Karriere gemacht hat. Wir verbinden es mit großem Kino, mit Design, Mode, Pop und Dolce Vita: glamour.