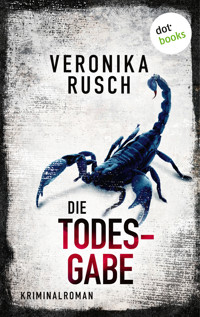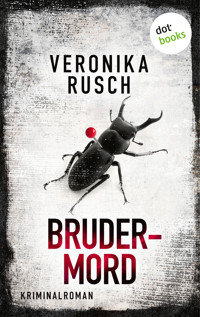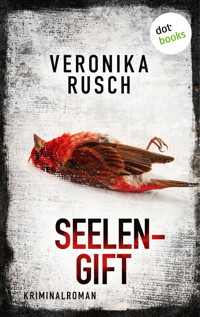9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Die Schwarze Venus«-Trilogie: Historische Spannung um eine legendäre Figur – Josephine Baker, Tänzerin, Vordenkerin, Kämpferin! Band 2 »Die Spur der Grausamkeit« spielt in Wien 1928: Bei Josephine Bakers Ankunft in der Stadt fällt ein rätselhafter Schuss. Als kurz darauf die grausam zugerichtete Leiche eines Mannes gefunden wird, begreift Tristan Nowak, dass die Verschwörer noch nicht aufgegeben haben. Mit seinem Versuch, sie zu finden, bringt er nicht nur sich selbst in Gefahr, sondern auch die Frau, die er liebt … In ihren historischen Kriminalromanen (Bd. 1: »Der Tod ist ein Tänzer«, Bd. 2: »Die Spur der Grausamkeit«, Bd. 3: »Die Dunkelheit der Welt«) macht Veronika Rusch die faszinierende Tänzerin und Sängerin Josephine Baker, die man auch »Die schwarze Venus« nannte, zur zentralen Figur einer groß angelegten Verschwörung. Die drei Bände führen die Leser in drei glamouröse Hauptstädte – Berlin, Wien und Paris – und von den goldenen Zwanzigern bis ins Paris des Jahres 1942: Drei Schicksale treffen wieder und wieder aufeinander, ein Mann, gezeichnet durch den Krieg, eine Frau, entschlossen, die Welt zu erobern, ein Gegner, gefährlich und unberechenbar … »›Der Tod ist ein Tänzer‹ ist ein großartiger historischer Roman, eine gelungene Mischung aus Fakten und Fiktion, unheimlich atmosphärisch und spannend bis zum Schluss. Dieser Roman macht unbedingt Lust auf Teil zwei und drei.« WDR 4 Die Josephine-Baker-Verschwörung Band 1: Der Tod ist ein Tänzer Band 2: Die Spur der Grausamkeit Band 3: Die Dunkelheit der Welt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Kriminalroman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die Spur der Grausamkeit« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Redaktion: Martina Vogl
Covergestaltung: zero-media.net, München
Coverabbildung: Lebrecht Music & Arts / Alamy Stock Photo; FinePic®, München
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Motto
Einleitung
ERSTER AKT
1
Berlin, April 1926
2
Wien, Dienstag, 14. Februar 1928
3
4
Paris, einige Stunden zuvor
5
Wien, Mittwoch, 15. Februar 1928
6
7
8
9
10
11
12
ZWEITER AKT
13
14
Berlin, Donnerstag, 16. Februar 1928
15
16
17
18
19
20
Berlin, Freitag, 17. Februar 1928
21
22
23
24
25
26
27
28
Berlin, Samstag, 18. Februar 1928
29
30
31
32
33
34
DRITTER AKT
35
Wien, Sonntag, 19. Februar 1928
36
37
38
39
40
Montag, 20. Februar 1928
41
42
43
44
45
46
Mittwoch, 22. Februar 1928
47
48
Donnerstag, 23. Februar 1928
49
50
51
Wien, Donnerstag, 1. März 1928
52
53
54
Wien, Sonntag, 4. März 1928
Nachwort
Anmerkungen zum historischen Hintergrund
Lebenslauf Josephine Baker von 1906 bis 1928
Saint Louis – New York – Paris – Berlin, Wien und die Welt
Literaturverzeichnis
Quellenangaben
»Ich sehe mich in allen Spiegeln.«
Josephine Baker
Die Dinge, die man sieht, die Schreie, die man hört, verschwinden nicht einfach, wenn man nicht mehr daran denkt. Sie sinken auf den Grund des Bewusstseins und bilden dort Schlacken und Ablagerungen. Schicht für Schicht verdecken sie die Spuren der Grausamkeit, die sie einst selbst gegraben haben. Bis, eines Tages, ein Stein geworfen wird und alles, was dort unten begraben liegt, wieder aufwühlt. Vergessenes steigt nach oben, Gespenster der Vergangenheit kommen ans Tageslicht.
Ich war Nowak.
Doch mein Name hat mich wiedergefunden. Und an ihm klebt Blut.
ERSTER AKT
»Moderluft erfüllt die Gasse,
denn es leben nur Gespenster.
Um zu atmen, rat ich, lasse
schleunig schließen alle Fenster!«
Karl Kraus, »Wien«, 1922
1
Berlin, April 1926
Als er den Fahrer bat, ihn zu dem Boxclub in der Grenadierstraße zu fahren, war er sich nicht im Klaren darüber, was ihn erwartete. Sein Bestreben war es lediglich, seinen Widersacher in Augenschein zu nehmen. Bisher kannte er nur dessen Namen und wusste, dass er rote Haare hatte. Als er ihn aber dann tatsächlich sah, war er für einen Moment versucht, an eine Fata Morgana zu glauben, an einen bösen Streich, den sein überreiztes Gehirn ihm spielte.
Nowak stand vor dem Boxclub auf dem Bürgersteig, zusammen mit einigen seiner Spießgesellen, allesamt kräftige, finster aussehende Männer. Sie rauchten, ein paar hatten eine Flasche Bier in der Hand, und alle genossen sichtlich die ersten warmen Sonnenstrahlen dieses Frühlings, was sie mit Sicherheit nicht hätten tun können, wenn alles nach Plan verlaufen wäre. Nowak selbst lehnte lässig an der Hausmauer, die Hemdsärmel hochgekrempelt, und scherzte mit einem dunkelhaarigen, am Hals tätowierten Mann. Sie lachten.
Sein Blick glitt über Nowaks Haare. Ungläubig musterte er den dunklen Rotton, der in der Sonne leuchtete, die unverwechselbaren störrischen Wirbel, die ihm die Haare immer wieder ins Gesicht fallen ließen. Mit tonloser Stimme bat er seinen Fahrer, unauffällig etwas näher heranzufahren. Der Wagen rollte langsam weiter, bis ihn nur noch ein paar Meter von dem Boxclub trennten. Jetzt konnte er Nowak genau betrachten.
Der Mann, der ihn herausgefordert und bis aufs Blut gereizt hatte, war gut zehn Jahre jünger als er, mittelgroß, und obwohl er ziemlich durchtrainiert wirkte, sah er nicht wie der muskelbepackte Boxer aus, den er nach den Beschreibungen vor Augen gehabt hatte. Er hatte zwar breite Schultern, aber sein Körper war schlank, eher sehnig als massig, und seine Bewegungen waren geschmeidig. Er hatte die helle Haut der Rothaarigen und ein schmales, kantiges Gesicht.
Sein Herz machte einen hastigen Sprung, so als habe es sich erst jetzt besonnen weiterzuschlagen, und die verzweifelte Hoffnung, sich getäuscht zu haben, verflog. Er hätte das Profil unter Tausenden wiedererkannt, die arrogante Linie von Stirn und Nase, das kräftige Kinn, die spöttisch zusammengekniffenen Augen. Dann wandte Nowak plötzlich den Kopf und sah direkt in seine Richtung.
Er wich ruckartig zurück. »Fahren Sie los!«, herrschte er den Fahrer an, und als dieser auf das Gaspedal trat, drückte er sich in den Sitz, ohne noch einmal nach draußen zu blicken. Er hatte genug gesehen. Glühender Hass stieg in Wogen in ihm auf und nahm ihm die Luft. Voller Abscheu starrte er auf die verbliebenen Stummel seiner beiden fehlenden Finger. Dieser Mann, der sich Nowak nannte, war nicht erst sein Widersacher, seit er seine Pläne durchkreuzt hatte. Er war sein Todfeind.
Er hatte ihm das Schlimmste angetan, wozu ein Mensch fähig war.
2
Wien, Dienstag, 14. Februar 1928
Als Tristan hinaus auf den Bahnhofsvorplatz trat, wehte ihm ein eisiger Ostwind entgegen, der direkt aus Russland zu kommen schien. Es lag kein Schnee, und der Himmel über der Stadt war sternenklar. Er kam Tristan höher und dunkler vor als zu Hause, und die Sterne funkelten stärker, was vermutlich daran lag, dass der Bahnhofsplatz nicht so hell strahlte, wie er es von Berlin gewohnt war. Zwar gab es auch hier überall elektrische Straßenbeleuchtung, hohe, elegant geschwungene Bogenlampen, doch ihr Licht war gedämpfter, diffuser, weniger aufdringlich. Fast schien es Tristan, als scheuten sich die Lampen, allzu grell zu leuchten, um nicht Dinge zu enthüllen, die lieber im Dunkeln blieben. Die Lichter von Berlin dagegen waren schamlos, sie legten das Schöne und das Hässliche, das Offensichtliche und das Geheimnisvolle gleichermaßen bloß. Er zog ein letztes Mal am Stummel seiner Zigarette, warf die Kippe achtlos in den Rinnstein und sah sich nach einem Taxi um. Die Zugpassagiere, die mit ihm angekommen waren, begannen sich bereits zu zerstreuen. Als Tristan auf den Taxistand zuging, fuhr gerade das letzte Auto mit dem schwarz-weißen Würfelmuster an den Türen weg. Er blieb stehen und fluchte leise.
»Brauchn S’ einen Träger, gnädiger Herr?«, sprach ihn jemand an. Tristan drehte sich um. Hinter ihm stand ein mickriges Männlein undefinierbaren Alters in einer schmuddeligen Jacke und mit einer Schiebermütze auf dem Kopf. Er hatte kohlschwarze, schlau funkelnde Augen, einen zerfransten Kosakenschnurrbart und einen Goldzahn, der hervorblitzte, wenn er sprach. Tristan musterte die dürre Gestalt, an dem die Kleider hingen wie an einem Kleiderständer, und schüttelte den Kopf. »Danke, nein.« Er hatte nur für ein paar Tage gepackt, seine Reisetasche war nicht schwer, doch selbst wenn, fiele es ihm mit Sicherheit leichter, sie zu tragen, als diesem schwindsüchtigen Klappergestell.
»Wissen S’ denn, wohin?« Der Mann trat einen Schritt näher. »Gestatten, Anton Lowatschek.« Er tippte sich an seine Mütze. »Nur für den Fall, dass Sie nicht wissen, wohin, wüsst ich nämlich, wo ich Sie zum Übernachten hinschicken tät.«
»Ach ja?« Tristan musterte den Mann. Er schien ihm nicht besonders vertrauenerweckend. »Ich suche ein Hotel, nicht allzu weit vom Zentrum …«
»Ja, eh! Da hab ich genau das Richtige für Sie. Ich führ Sie auch hin. Kostet Sie nur ein paar Groschen.«
Anton Lowatschek sah Tristan erwartungsvoll an, und als dieser nach kurzer Überlegung nickte, wollte er nach der Reisetasche greifen, aber Tristan schüttelte den Kopf. »Die trage ich schon selbst.« Er folgte dem kleinen Mann, der jetzt flink um den Bahnhof herumging und zielsicher in eine der Gassen einbog, die im rechten Winkel zum Bahnhofsgebäude verliefen. Dabei redete er ununterbrochen, gestikulierte, deutete hierhin und dorthin und lieferte offenbar Erklärungen zu der Gegend, in der sie sich befanden. Tristan verstand höchstens die Hälfte von dem, was Anton Lowatschek von sich gab, was zum einen an seinem ausgeprägten Wiener Dialekt lag und zum anderen daran, dass er fast so schnell redete, wie er dahinwieselte. Nach rund zehn Minuten bogen sie in eine weitere, nur spärlich beleuchtete und sehr lange Gasse ein, an deren Ende sich, soweit Tristan verstand, die angepriesene Herberge befinden sollte. Schließlich blieben sie vor einem schlichten, etwas in die Jahre gekommenen Haus im Biedermeierstil stehen. Es war ziegelrot gestrichen, mit weiß abgesetzten Fenstern. Über der Tür hing eine große, kugelrunde Milchglaslampe, und darüber stand: Hotel Vollmond.
»Da wär ma’s jetzt«, sagte Lowatschek und ließ dabei seinen Goldzahn aufblitzen. Er wirkte fast so stolz, als handle es sich um sein Hotel.
Tristan musterte das Haus. Es sah ganz passabel aus. Und seine Ansprüche waren ohnehin nicht besonders hoch. »Danke.« Er gab seinem Begleiter den vereinbarten Lohn. Dieser deutete eine Verbeugung an. »Wann S’ mich mal wieder brauchen, fragen S’ einfach am Bahnhof nach dem Lowatschek. Die kennen mich da alle. Und wenn’s Ihnen nichts ausmacht, tät ich mich freun, wenn Sie der gnädigen Frau Salminger sagen täten, dass ich Sie hergebracht hab.«
Tristan versprach es, Lowatschek tippte sich an die zerknautschte Mütze und eilte den Weg zurück, den sie eben gekommen waren.
Tristan wollte gerade die Eingangstür öffnen, als er aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahrnahm. Er war es inzwischen so gewöhnt, auf das kleinste Detail, auf jedes Geräusch und jede unerwartete Bewegung in seiner Umgebung zu achten, dass er augenblicklich in Alarmbereitschaft versetzt wurde. Er ließ die Klinke los und wandte den Kopf. Reflexartig war er versucht, gleichzeitig nach seiner Pistole zu greifen, bis ihm einfiel, dass sich diese nicht unter seinem Jackett, sondern ganz unten in seiner Reisetasche befand. Lautlos trat er aus dem Licht der Lampe und fixierte den unbeleuchteten Hauseingang schräg auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wo er die Bewegung wahrgenommen hatte. Kurz darauf trat ein Mann daraus hervor. Er hatte seinen Hut tief ins Gesicht gezogen und trug einen schwarzen Mantel. Einen Augenblick lang blieb er stehen, und Tristan hatte das deutliche Gefühl, dass der Mann direkt zu ihm herüberblickte, obwohl sein Gesicht im Schatten lag und er seine Miene nicht sehen konnte. Dann drehte der Mann sich um und ging gemächlich davon.
Tristan sah ihm einen Moment lang unschlüssig nach, dann schüttelte er den Kopf und schalt sich überreizt. Wie hatte er nur daran denken können, seine Pistole zu ziehen, nur weil jemand aus einem Hauseingang trat? Wer sollte ihm hier, unmittelbar nach seiner Ankunft in dieser ihm völlig fremden Stadt, etwas Böses wollen?
»Guten Abend, der Herr.« Die Stimme schien von nirgendwoher zu kommen. Das Foyer des Hotels war nur schummrig beleuchtet. Mit den zahlreichen gerahmten Bildern an der einen und einem deckenhohen, mit Büchern, Zeitschriften und allerlei Nippes vollgestopften Regal an der anderen Wand wirkte es ein bisschen wie das Wohnzimmer einer alten Dame. Der große Käfig mit dem grünen Papageienpärchen am Fenster verstärkte den Eindruck noch. Eine Sitzgruppe mit verblichenem Gobelinmuster stand vor einem offenen Kamin, in dem ein Feuer brannte, doch niemand saß dort, und die Rezeption war nicht besetzt. Die Luft war erfüllt von süßlich orientalischem Rauch, der jedoch nicht vom Kaminfeuer herrührte. Tristan sah sich um und bemerkte, wie sich hinter dem hohen Tresen der Rezeption etwas regte. Eine kleine Frau erhob sich aus einem Lehnsessel, und sie sah so steinalt aus, dass es ihn wunderte, dass sie sich überhaupt noch bewegte. Ihre spärlichen grauen Haare hatte sie am Hinterkopf zu einem walnussgroßen Dutt zusammengezurrt, und ihre Haut war pergamentartig, fast durchscheinend und von blauen Adern durchzogen. Die alte Dame war sorgfältig zurechtgemacht, trug ein elegantes grünes Kleid mit Schleife am faltigen Hals und ein Schultertuch, leuchtend orangefarbenen Lippenstift, Lidstrich, grünen Lidschatten und Ohrringe mit smaragdgrünen Steinen. Sie rauchte eine Zigarillo, was den intensiven Geruch erklärte.
»Sie wünschen?«, fragte sie, und ihre Stimme war für eine so gebrechliche Person überraschend klar und kräftig.
Tristan kam näher und erkundigte sich nach einem Zimmer, und da er vermutete, dass es sich bei der Dame um die gnädige Frau Salminger handelte, von der Anton Lowatschek gesprochen hatte, hielt er sich auch gleich an sein Versprechen und erwähnte, dass dieser ihn hergebracht habe.
Das Gesicht der Frau legte sich in tausend Falten, als sie lächelte. »Der Lowatschek. Ein guter Kerl. Bringt mir oft Gäste.« Sie nickte Tristan beifällig zu, als stiege er in ihrer Achtung allein deshalb, weil er sich von dem seltsamen Vogel hatte herbringen lassen.
»Er ist kein Dienstmann, oder? Er trägt keine Uniform«, sagte Tristan, neugierig geworden, was es mit seinem beflissenen Begleiter auf sich hatte.
»Er war mal einer. Aber sie haben ihm die Kommission abgenommen«, erwiderte die alte Frau, während sie sich eine Lesebrille aufsetzte, die an einer Kette um ihren Hals hing, und mit gichtgekrümmten Händen langsam in einem großen Buch blätterte. An fast jedem ihrer knochigen Finger prangte ein Ring. »Hat nicht viel Glück gehabt im Leben, der Anton. Zuerst war er im Waisenhaus, da war es schon schwer für ihn, überhaupt was zu werden, und dann, als er sich grad so aufgerappelt hatte, ist er in Hefn gekommen …« Als sie Tristans verständnisloses Gesicht sah, übersetzte sie ins Hochdeutsch: »Ins Zuchthaus haben sie ihn gesteckt. Danach war die Konzession als Dienstmann weg. Und jetzt schlägt er sich so durch, und seine alten Kollegen lassen ihn a bisserl was mitverdienen. Die meisten jedenfalls. Von mir kriegt er für jeden Gast eine Provision.« Frau Salminger beugte sich über den Tresen und tätschelte Tristans Hand. »Das haben Sie gut gemacht, dass Sie mit dem mitgegangen sind. Auf den Lowatschek kann man sich verlassen.« Sie reichte ihm einen Meldeblock und einen Stift. »Name und Anschrift«, sagte sie dann, jetzt ganz geschäftsmäßig. »Und dann bräuchte ich noch Ihren Ausweis.« Letzteres kam fast entschuldigend, so als erwarte sie, dass diese Bitte auf Widerstand stieß. »Die Stadt verlangt das, und wir sind ein anständiges Hotel.«
»Kein Problem.« Tristan griff in die Innentasche seines Mantels und legte ihr seinen Ausweis hin. Er war nagelneu. Und falsch. Tristan hatte ihn sich extra für diese Fahrt machen lassen, bei einem Fälscher, der ihm empfohlen worden war, und er hatte eine Stange Geld dafür bezahlt. Außer dem falschen Militärpass und der Geburtsurkunde mit seinem richtigen Namen hatte er bislang keine Papiere besessen und auch nicht gebraucht. Seit dem Krieg war er nicht mehr aus Berlin herausgekommen, hatte keinerlei Ambitionen gehabt, irgendwo anders hinzugehen. Abgesehen davon, dass er in den ersten Jahren nicht das Geld für eine Reise gehabt hätte, war ihm die Aussicht auf Neues nach der Zeit auf den Schlachtfeldern in Belgien und Frankreich auch nicht besonders verlockend erschienen.
Es war auch nicht so, dass es ihn inzwischen mehr reizte, fremde Städte zu besuchen. Berlin war seine Stadt, sein Territorium, dort fühlte er sich sicher. In Wien war Tristan nur aus einem einzigen Grund, und wenn er ehrlich zu sich war, war dieser Grund eher zweifelhaft und nicht dazu geeignet, sein grundsätzliches Unbehagen, was Reisen und fremde Orte anbelangte, zu zerstreuen. Im Gegenteil. Je länger die Fahrt hierher gedauert, je mehr Zeit er zum Nachdenken gehabt hatte, desto mehr war er davon überzeugt, dass die Entscheidung hierherzukommen, ein Fehler gewesen war.
Die Hotelwirtin öffnete das kleine graue Heft, das absolut echt aussah, oder womöglich sogar echt war, so genau wusste Tristan über die Arbeitsweise des Fälschers nicht Bescheid. Auf der Innenseite prangte sein Foto, mit Stempel und Unterschrift, und darunter stand der Name, der ihm inzwischen – zumindest was den Nachnamen anbelangte – zu einer zweiten Haut geworden war. Obwohl er ihn schon so lange trug, hatte es ihn dennoch eigentümlich berührt, ihn zum ersten Mal unter seinem Bild in einem offiziellen Dokument stehen zu sehen.
»Jan Nowak«, las sie und hob forschend den Kopf. »Stammen Sie aus Polen?«
Tristan schüttelte den Kopf. »Ich bin Berliner.«
»Ist eh gleich.« Sie reichte ihm den Ausweis zurück. »Nowak heißen bei uns viele. Meistens Juden. Es bedeutet neuer Mann. Aber das wissen Sie ja wahrscheinlich.«
Tristan nickte unverbindlich und versuchte dabei, seine Überraschung zu verbergen. Er hatte sich noch nie Gedanken über die Bedeutung des Namens gemacht. Aber neuer Mann war so passend, dass man hätte meinen können, er hätte ihn sich allein deswegen ausgesucht.
Die alte Dame legte einen Zimmerschlüssel auf den Tresen, an dem eine Kugel aus massivem Messing hing, und deutete zur Treppe, die neben der Rezeption nach oben führte. »Erster Stock. Nach der Stiege rechts. Frühstück gibt’s von halb acht bis neun. Wasserklosett und Duschbad ist auf dem Gang neben dem Stiegenhaus.« Dann griff sie nach einem Gehstock, der an der Wand lehnte. Er war glänzend schwarz und hatte einen silbernen Pferdekopf als Griff. Den Stock fest umklammert schlurfte sie mit kleinen Schritten und krummem Rücken zu einer Tapetentür, die Tristan bis dahin gar nicht bemerkt hatte, und verschwand dahinter. Tristan blieb allein im Foyer zurück. Er nahm den schweren Schlüssel und seine Reisetasche und stieg die knarzende, mit einem abgetretenen blutroten Teppich ausgelegte Treppe nach oben.
Sein Zimmer war riesig und sah aus wie ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert. Das Bett war aus Mahagoniholz und ebenfalls von beeindruckender Größe, ebenso der wuchtige Schrank und der Schreibtisch. Es gab ein breites Sofa, einen Waschtisch und sogar einen offenen Kamin, der allerdings kalt war. Stattdessen stand in einer Ecke ein Kohleofen. An den hohen, dunkelgrün tapezierten Wänden hingen großformatige Frauenakte in Öl. Er zog den Mantel aus, warf ihn aufs Bett und ging zu einem der beiden Fenster. Die Gasse lag still und verlassen da. Kein Mann, keine Maus war zu sehen, nur eine einzelne Laterne einige Meter entfernt beleuchtete das Kopfsteinpflaster, der Rest lag im Dunkeln. Er trat näher heran und sah nach unten. Sein Zimmer befand sich direkt über dem Eingang, wo die milchige Kugellampe die Illusion eines vom Himmel gefallenen Vollmonds suggerierte. Ein großer Nachtfalter schwirrte trotz der Kälte um das Licht, stieß gegen das Glas und nahm dann taumelnd erneut Anlauf. Immer und immer wieder. Tristan kam der unangenehme Gedanke, dass er selbst eine gewisse Ähnlichkeit mit diesem Falter hatte. Auch er kreiste seit zwei Jahren um ein Licht, das unerreichbar war, und hatte dafür etwas aufs Spiel gesetzt, was womöglich viel wertvoller gewesen war.
3
Wenn Tristan an Helene dachte und es ihm dabei gelang, ihre schmerzhafte letzte Begegnung auszublenden, fiel ihm als Erstes der Tag der Prüfung ein. Es war im letzten Jahr, Anfang Dezember gewesen. Er hatte sie zusammen mit Fanny und den Mädchen abgeholt. Die Universität zu Berlin war im Palais des Prinzen Heinrich am Boulevard Unter den Linden untergebracht und wirkte in seiner weitläufigen U-Form herrschaftlich und Ehrfurcht gebietend wie ein Schloss. Als sie darauf zugingen, die Mädchen schnatternd und aufgeregt, Fanny nur scheinbar abgeklärt, waren ziemlich widersprüchliche Gefühle in ihm hochgekommen, und er war kurz versucht gewesen, einfach umzudrehen. Am Ende hatte er sich dann aber zusammengerissen und war weitergegangen. Schließlich ging es um Helene und nicht um ihn. Was keine seiner Begleiterinnen ahnte und was er auch niemandem verraten würde, war die Tatsache, dass er nicht das erste Mal hier war.
Sein letzter Besuch der Universität lag allerdings viele Jahre zurück, hatte gewissermaßen in einem anderen Leben stattgefunden. Dennoch konnte er sich an jedes Detail erinnern. An den weitläufigen Vorplatz, die geschäftig umhereilenden Studenten mit den Büchern unter den Armen, die hohe Eingangshalle, in die sie gleich treten würden und in der jeder Schritt von den Wänden widerhallte und jedes gewechselte Wort irgendwie bedeutsam klang. An einem sonnigen Maitag im Jahr 1912, an seinem vierzehnten Geburtstag, hatte ihm sein Vater die Universität gezeigt. Er hatte sich gewünscht, dass Tristan später einmal hier studierte. Rechtswissenschaften wie er selbst, oder Medizin, zur Not auch Philosophie, Geschichte, Literatur, Hauptsache, etwas Ziviles, etwas, was der Menschheit zugutekam und sie nicht zu zerstören trachtete, so hatte er sich ausgedrückt. Sie waren gemeinsam durch die heiligen Hallen spaziert, wie sein Vater sie ein wenig spöttisch und dennoch liebevoll bezeichnete, hatten die Hörsäle und die Bibliothek besichtigt und einen alten Professor besucht, der sich an seinen Vater als Student erinnerte. Nach diesem Besuch hatte ihm sein Vater den Füllfederhalter geschenkt, mit dem er damals seine Examina geschrieben hatte, und sie waren zusammen ins Café Kranzler gegangen. Tristan hatte jede Minute dieses Tages genossen, er war stolz darauf gewesen, allein mit seinem Vater den Tag verbringen zu dürfen und behandelt zu werden, als sei er schon erwachsen. Dennoch hatte er zwei Jahre später mit einer einzigen falschen Entscheidung alle Hoffnungen, die sein Vater in ihn gesetzt hatte, für immer zerstört. Und er hatte keine Ahnung, wo der Füllfederhalter geblieben war.
»Sollen wir hier warten oder reingehen?« Doros rauchige Stimme riss ihn abrupt aus seinen bitteren Gedanken.
Er schrak zusammen. »Wie?«
»Du träumst wohl auch von ’ner Professorenkarriere, was, Nowak?«, kicherte sie und knuffte ihn scherzhaft in die Seite. »Überlass das mal lieber unserem Lenchen. Ich glaub nicht, dass die hier Verwendung für ’nen zerbeulten Boxer ausm Scheunenviertel haben.«
»Der Nowak und Professor!« Fanny schnaubte, als sie Doros Worte hörte. »Dass ick nich lache. Genügt schon, wenn eene solche Flausen im Kopp hat. Ihr andern behaltet mal schön de Beene uffm Boden.«
»Beene uffm Boden? Was denn noch alles!« Doro verdrehte theatralisch die Augen. »Ich dachte immer, wir sollen die Beine breitmachen …«
Die anderen lachten lauthals los, und Fanny versetzte Doro eine Kopfnuss. »Halt bloß die Gusche, du freches Luder«, sagte sie, jedoch mit einem gutmütigen Grinsen im Gesicht. Dann zupfte sie ihr Kostüm zurecht und wandte sich an Tristan. »Wat meenste, lassen die uns hier überhaupt rin?«
Tristan, der zur Feier des Tages den besten Anzug trug, den er besaß – inzwischen waren es einige mehr als noch vor zwei Jahren, wo er tagein, tagaus dasselbe abgetragene Jackett und alte Hosen getragen hatte –, musterte das bunte Grüppchen Frauen, das jetzt mit ihm vor dem großen Eingangsportal der Universität stand. Die fünf Frauen hatten sich genau wie er in Schale geworfen, allerdings mit unterschiedlichem Erfolg. Fanny, die Namensgeberin von Fannys Wohnheim für junge Mädchen, das in Wirklichkeit ein gepflegter kleiner Puff mit Rundumservice war, hatte ihre unübersehbare Leibesfülle in ein hautenges schwarzes Wollkostüm gezwängt und trug darüber einen Mantel mit Fuchskragen. Ihre kohlschwarz gefärbten Haare waren wie immer zu einem hohen, bienenkorbartigen Dutt aufgetürmt, die Ohrringe groß und glitzernd, die Strümpfe mit Naht. Dorothea, die alle nur Doro nannten, trug ein feuerrotes Kleid, das in etwa die gleiche Farbe wie ihre Haare hatte und ihre Kurven äußerst vorteilhaft zur Geltung brachte. Darüber hatte sie ein wollenes schwarzes Cape drapiert. Auch wenn sie die Masse ihrer Haare mithilfe einer züchtigen Flechtfrisur gebändigt hatte, hatte sie noch immer eine gewisse Ähnlichkeit mit einer glühenden Fackel, an der man sich schnell verbrennen konnte, wenn man ihr zu nahe kam. Frieda dagegen, mit ihrem Kleinmädchengesicht und den zu einer Gretlfrisur aufgesteckten weißblonden Haaren, wirkte mit ihren rot geschminkten Lippen und den Schuhen mit schwindelerregend hohen Absätzen wie eine Zwölfjährige in den Sachen ihrer Mutter, was, wie Tristan vermutete, durchaus beabsichtigt war. Viele Männer standen auf so etwas. Einzig die rundliche, semmelblonde Babette und Olga, schmal und blass, mit streng gescheitelten Haaren, machten einen unauffälligen Eindruck, was vermutlich daran lag, dass die beiden Fannys Service nur im Nebenerwerb in Anspruch nahmen und tagsüber ein mehr oder weniger bürgerliches Leben führten.
Tristan erwiderte Fannys fragenden Blick mit einem Lächeln. »Wer, bitte, sollte uns daran hindern wollen, Helene nach ihrer Prüfung gebührend zu empfangen?«
»Recht haste, Nowak!«, rief Doro, öffnete schwungvoll die Tür und stolzierte hinein. Die anderen folgten ihr.
In der Eingangshalle warteten bereits einige andere Angehörige, überwiegend stolze oder bange Eltern und ein paar Freunde und Freundinnen auf die Studenten, deren letzte mündliche Prüfung heute anstand. Ihre Köpfe fuhren herum, als die Truppe eintrat. Tristan bemerkte die spöttischen bis interessierten Mienen der Männer sowie die versteinerten Gesichter der Frauen, die hastig die Köpfe abwandten, sobald Doro, die sich eine Zigarette angezündet hatte, sie, den Rauch aufreizend langsam ausstoßend, herausfordernd betrachtete. Eine Frau im Pelzmantel schüttelte den Kopf und flüsterte ihrem Mann, der den Blick nicht von Doro abwenden konnte, etwas zu. Hastig wandte auch er sich ab.
»Schau sie dir an, diese elenden Heuchler«, flüsterte Doro halblaut. »Hier kuschen sie vor ihren Weibern, und wenn es dunkel ist, kommen sie angeschlichen, all die geilen Böcke, und warten nur darauf, dass wir ihnen einen …«
»Sei stille«, zischte Fanny. »Wir machen unserem Lenchen hier keine Schande, hörste?«
Doro klappte den Mund zu und schwieg.
Als die ersten Prüflinge den Gang entlanggelaufen kamen, fast nur junge Männer, die meisten mit erleichtertem Gesichtsausdruck, manche auch mit betretenen Mienen, ein junger Mann weinte sogar, wurde Tristan nervös. Er drehte den Strauß Rosen, den er in den Händen hielt, unschlüssig hin und her, wusste plötzlich nicht mehr, wohin damit. Was, wenn sie durchgefallen war? Helene hatte seit Jahren auf diesen Moment hingearbeitet. Anfangs hatte sie selbst nicht recht daran geglaubt, doch in der letzten Zeit war sie immer fleißiger geworden, hatte wochenlang nur über ihren Büchern gesessen, sich regelrecht hineingefressen, geflucht und geschimpft und viele Vormittage lang mit Tristan über Kants Kategorischen Imperativ, die Existenz Gottes oder das Recht auf Glück diskutiert. Tristan hatte dazu nicht recht viel beizutragen gehabt, er hatte sich nur vage an den Unterricht im Gymnasium erinnert und sich insgeheim gefragt, weshalb sich Helene ausgerechnet Philosophie für ihr Studium ausgesucht hatte. Dennoch hatte er sie nach Kräften unterstützt, und wenn Zeit war, hatte er sie Definitionen und Begriffe abgefragt und ihre Arbeiten gelesen, die sie für die Professoren schreiben musste. Und jetzt standen sie hier, und wenn alles gut gegangen war, würde Helene, die ihren Lebensunterhalt wie die anderen Mädchen seit Jahren in Fannys Wohnheim für junge Mädchen verdiente, tatsächlich einen Universitätsabschluss in der Tasche haben.
Tristan stieß geräuschvoll die Luft aus, als eine blonde junge Frau heranstürmte und die Frau im Pelzmantel, die eben noch über Tristan und die Frauen den Kopf geschüttelt hatte, freudestrahlend umarmte.
Fanny warf ihm einen Blick zu. »Dit Lenchen packt dit och. Glaub mir, Nowak. Die is helle.«
Tristan nickte. »Ich weiß, Fanny. Ich weiß …«
Inzwischen hatte sich die Eingangshalle mit Studenten gefüllt. Die meisten von ihnen strahlten, die wenigen, die nicht bestanden hatten, schlichen leise davon. Die erhabene, Ehrfurcht gebietende Stille von vorhin war verflogen, der Raum war erfüllt von Lachen und aufgeregten Stimmen. Von Helene noch immer keine Spur. Dann, endlich kam eine zierliche Gestalt den Flur entlang. Tristan straffte sich, und die Frauen stießen sich an.
»Da kommt sie.«
»Wie guckt sie?«
»Lacht sie?«
Helene lachte nicht. Sie ging langsam, wirkte klein und schmal in den flachen Schuhen und dem mokkabraunen Hosenanzug, den sie sich extra für die mündliche Prüfung gekauft hatte, obwohl Doro der Meinung gewesen war, Hosen wären doch wirklich das Allerletzte, wenn die Prüfer Männer wären. Helenes dichte, stark gelockte kastanienbraune Haare waren kinnlang geschnitten und hinter die Ohren gestrichen, und ihre Wangen glühten. Auf ihrem Gesicht lag ein ungläubiger Ausdruck.
Als sie näher kam und Tristan ansah, erkannte er, dass ihre Augen leuchteten, und er wusste, dass alles gut gegangen war. Er seufzte erleichtert auf und wollte ihr die Rosen geben, dessen Papier von seinem nervösen Händedruck ganz feucht und zerknittert war, doch Helene flog ihm um den Hals und zerdrückte damit auch die Rosen.
Jubel brach unter ihren Freundinnen aus, sie klatschten, lachten und redeten durcheinander, jede wollte Helene drücken und küssen, und Doro sprang um sie alle herum wie ein Derwisch.
Als sie kurz darauf auf dem Weg zur Straßenbahn gewesen waren, hatte Fanny stolz gesagt: »Dit möchte ich mal sehen, ob’s in Berlin noch ’n Puff gibt, der Huren mit Diplom beschäftigt.«
Tristan musste jedes Mal lächeln, wenn er daran dachte, auch jetzt wieder, während er am Fenster stand und auf die dunkle Gasse hinunterblickte.
Sie hatten damals den ganzen restlichen Tag Helenes Abschluss gefeiert. Fanny hatte alles aufgetischt, was ihr für diesen Anlass angemessen erschien. Es gab Fleischsuppe mit Klößchen, dann Königsberger Klopse mit Kartoffeln und viel Kapernsoße, Helenes Lieblingsgericht, außerdem Buletten mit Kartoffelsalat und als Nachtisch Kirschgrütze mit flüssiger Sahne und eine riesige Buttercremetorte. Nach Feierabend war Vito, Fannys Liebhaber, vorbeigekommen. Er hatte sein Akkordeon mitgebracht und italienische Schlager gespielt, und Tristan hatte zur Feier des Tages eine ganze Kiste Champagner organisiert. Seine Verbindungen waren trotz der Tatsache, dass er den Schwarzmarkthandel seit Freddys Tod aufgegeben hatte, noch immer recht gut. Seine engsten Freunde aus dem Boxclub, Kurt Herzfeld, Rudko Franzen und Otto Michalke, waren ebenfalls dazugekommen, und der junge Rudko entpuppte sich nicht nur als exzellenter Gitarrenspieler, der der alten, verstimmten Gitarre, die schon seit ewigen Zeiten in Fannys Salon an der Wand hing, erstaunliche Rhythmen entlockte, sondern auch als ausgesprochen talentierter Tänzer. Er tanzte reihum mit allen Frauen, doch besonders angetan hatte es ihm Frieda, die er am liebsten nicht mehr losgelassen hätte, was den anderen Mädchen nicht entging. Sie stießen sich an und rissen Witze, und Doro meinte: »Wenn du Frieda weiter so angrapschst, Rudko, musst du Eintritt bezahlen.«
Es war weit nach Mitternacht, als sich die Gesellschaft langsam auflöste. Kurt und Rudko, beide selbst nicht mehr nüchtern, mussten Otto stützen, während sie schwankend zu dritt die Treppe hinabstiegen, und Rudko warf noch vom unteren Treppenabsatz einen sehnsüchtigen Blick zu Frieda hinauf, die jedoch nur ihr rätselhaftes Puppenlächeln lächelte, ihm einen Handkuss zuwarf und dann in ihrem Zimmer verschwand.
Tristan dagegen blieb. Willig ließ er sich von Helene an der Hand nehmen und in ihr Zimmer führen, wo eine kleine, mit einem Tuch gedämpfte Nachttischlampe sanftes Licht verbreitete und ein frisch bezogenes, duftig aufgeschütteltes Bett wartete.
Bereits seit geraumer Zeit trafen sich Tristan und Helene regelmäßig, immer spät in der Nacht, nachdem ihr letzter Freier gegangen war. Manchmal schliefen sie miteinander, im Licht der kleinen Lampe, und zumindest für Tristan war es jedes Mal ein Versuch, die Erinnerung an die anderen Männer, die vorher da gewesen waren, auszulöschen. Oder zumindest eine Weile fernzuhalten. Meistens jedoch hielten sie sich nur fest, im Dunkeln, atmeten den Geruch des anderen, flüsterten einander Dinge ins Ohr, die sie bei Tage nicht zu sagen wagten. Es war eine Nachtbeziehung, die sie führten. Ein vages, schwebendes Miteinander, beschränkt auf ein kleines, kaltes Zimmer, das oft noch nach dem allzu üppigen Aftershave eines vorherigen Freiers stank und ihnen doch Geborgenheit und Wärme schenkte.
Heute jedoch war es anders. Helene nahm ihn vor aller Augen mit in ihr Zimmer, er musste nicht auf das Klopfzeichen an dem Rohr warten, das von oben hinunter und durch sein Zimmer im Boxclub führte und anzeigte, dass der letzte Freier gegangen war.
»Fanny hat mir bis zum Jahresende freigegeben«, hatte Helene lächelnd gesagt und langsam ihre strenge weiße Bluse aufgeknöpft.
»Keine Männer?«, hatte Tristan gefragt.
»Keine Männer außer dir.«
Tristan machte einen Schritt vom Fenster zurück und zog mit einer unwirschen Bewegung den Vorhang zu. Er durfte nicht mehr an Helene denken. Nicht an die uneingestandene Hoffnung, die er sich bei diesen Worten gemacht hatte, an seinen vergeblichen, ganz und gar idiotischen Wunsch, dass all die anderen Männer nie mehr zurückkämen. Und er mochte auch nicht an die Wut denken, die ihn gepackt hatte, als ihm klar geworden war, dass dem nicht so war. Er ballte seine Hände zu Fäusten, bis die Fingerknöchel weiß anliefen, und ließ dann abrupt wieder locker. Es gab Momente, da fürchtete er sich vor sich selbst.
4
Paris, einige Stunden zuvor
»Aber nein!« Marquise Marguerite de Beaufremont schüttelte genervt den Kopf. »Zwanzig nach vier, Mademoiselle Baker. Ist das denn so schwer zu verstehen?«
Josephine sah stirnrunzelnd auf den Teller, der vor ihr auf dem Tisch stand, und schob unschlüssig das Besteck hin und her. »Aber Sie sagten doch vorhin, zwanzig vor vier …«
»Ja, das ist die Position, wenn Sie mit dem Essen noch nicht fertig sind und nur eine kleine Pause einlegen. Dabei legt man aber auch die Gabel mit dem Rücken nach oben neben das Messer.« Die Marquise stand auf und zeigte es ihr. »Wenn Sie fertig sind, legen Sie es auf die andere Seite, die Gabel mit der Innenseite nach oben, Position zwanzig nach vier.« Sie setzte sich wieder und sah Josephine streng an: »Serviette?«
Josephine nahm die Serviette vom Schoß und legte sie auf den leeren Teller.
»Neben den Teller! Und nicht so zerknüllt hinwerfen. Legen Sie sie ordentlich zusammen, mit der sauberen Seite nach oben.«
Josephine unterdrückte einen Seufzer und tat wie geheißen.
Die Marquise nickte gnädig. »Und daran denken, das Weinglas immer nur am Stiel anfassen. Jetzt noch ein paar französische Vokabeln: Gabel?«
»Fourchette.«
»Teelöffel?«
»Ähm … kuijärr …?«
»Mais non!« Die Marquise schnalzte mit der Zunge. »Nicht immer das R so amerikanisch knödeln. Da versteht Sie doch kein Franzose! Cuillère! Das französische R braucht Kontur. Charakter. Und es heißt petite cuillère, denn es gibt ja noch den Suppenlöffel …«
Ein lautes Meckern von draußen unterbrach sie.
Josephine sprang von ihrem Stuhl auf. »Das ist Toutoute! Ich habe vergessen, sie zu füttern.«
»Aber …«
»Machen Sie ruhig weiter, Marquise!« Josephine lächelte der ältlichen Gräfin mit den steingrauen Haaren zu. »Ich kann auch lernen, während ich Toutoute füttere.« Sie lief nach draußen und kam kurz darauf mit einer kleinen Ziege und einer Milchflasche mit Sauger zurück und setzte sich wieder. Als sie der Ziege behutsam den Sauger ins Maul schob, begann das Tier glücklich schmatzend zu saugen. Die Milch spritzte über den Tisch und auf den Boden.
»Wo waren wir stehen geblieben?«, fragte Josephine und kraulte der Ziege den Kopf. »Ach ja, petite cuillère ohne Knödeln … Was für ein komplizierter Name für so einfaches kleines Dingelchen.« Sie schüttelte den Kopf, nahm den Teelöffel und klopfte damit auf das Weinglas: »Mesdames and Messieurs: I’d like to present you ma petite chèvre Toutoute. She is vraiment french, und spricht viel besser Französisch als ich …«
Als sie das Gesicht der Marquise sah, wollte sie sich schier ausschütten vor Lachen. Die Ziege, die jetzt die Flasche ausgetrunken hatte, begann am Tischtuch zu knabbern.
»Nicht, Toutoute«, schalt Josephine sie, noch immer lächelnd. »Nimm lieber die Serviette. Aber leg sie schön zusammen, wenn du fertig bist …«
Die Marquise stand auf. »Ich glaube nicht, dass es noch viel Sinn hat weiterzumachen.«
»Sie wollen schon gehen? Unsere Zeit ist doch noch gar nicht vorbei …« Josephine sah überrascht auf die große Standuhr, die an der Wand neben der Tür stand und einen so ehrwürdigen und verdrießlichen Eindruck machte, dass Josephine anfangs, als sie die zwei Zimmer der eleganten Pension in der Rue Henri Rochefort bezogen hatte, automatisch ein schlechtes Gewissen bekommen hatte, wenn ihr Blick darauf gefallen war. Irgendwann hatte sie die Uhr mit einer ihrer Federboas dekoriert, und seitdem sah sie nicht mehr ganz so streng aus. Bevor die Marquise etwas erwidern konnte, fügte Josephine schnell hinzu: »Ich will Sie natürlich nicht aufhalten. Sie haben sicher noch was vor.« Im Grunde war sie heilfroh, die alte Gewitterziege für heute los zu sein. Es durfte nur Pepito nicht zu Ohren kommen, dass sie nicht die volle Stunde gelernt hatten, sonst würde er wütend werden. Sie sprang auf und lief zu der Kommode, die zwischen den beiden großen Fenstern stand. In der Ferne konnte sie den Parc Monceau sehen, wo eine blasse Sonne die winterlich leere Parklandschaft beschien. Es war kurz vor vier Uhr nachmittags, und Josephine war erst vor einer Stunde aufgestanden. Wenn sie sich richtig erinnerte, musste hier irgendwo noch Geld sein … Tatsächlich lagen auf dem Grammofon unter einem rosa Büstenhalter ein paar zerknüllte Hundertfrancscheine. Daneben waren die neuesten Geschenke ihrer Bewunderer aufgehäuft: ein Rosenbukett in einem Mooskörbchen, das von einem unbekannten Verehrer stammte, der ihr seit fast zwei Jahren bei jedem Auftritt Rosen schickte, ohne sich je zu erkennen zu geben, ein kleiner Elefant aus geschnitztem Elfenbein, ein Armband mit roten Steinen, ein Spielzeugautomobil, antike Ohrringe, Pralinen und ein Ring mit einem Stein so groß wie ein Ei. Sie schnappte sich einen der Scheine und die Pralinen und drückte der Marquise beides in die Hand. Diese nahm es mit dem ärgerlichen Gesichtsausdruck entgegen, den sie immer an den Tag legte, wenn es um Geld und Geschenke ging.
Die Marquise von Beaufremont hatte zwar jede Menge blaues Blut in den Adern, was nach Josephines Meinung auch ihre fahle Gesichtsfarbe erklärte – kein Leben in der Frau! –, doch das Adelsgeschlecht, dem sie entstammte, war schon seit der Französischen Revolution verarmt, weshalb sie gezwungen war, ahnungslosen Ausländern wie Josephine Unterricht in französischer Sprache und den richtigen Umgangsformen zu geben. Pepito hatte sie engagiert. Für ihre Verwandlung, wie er es nannte. Und er konnte sehr ungehalten werden, wenn sie sich nicht richtig anstrengte.
Leider erfüllte sich ihre Hoffnung, dass Pepito nichts von dem verfrühten Aufbruch der Marquise mitbekommen würde, nicht. Die Gräfin hatte gerade die Tür des Salons hinter sich geschlossen, als Pepito zurückkam. Josephine konnte seine Stimme im Flur hören, als er sie begrüßte. Sie ging näher zur Tür, um zu lauschen. Die Stimme der Marquise klang aufgeregt, als sie mit Pepito sprach. Josephine hörte nur Wortfetzen: »Unmöglich … all diese Tiere … kein Ernst …« So ging es weiter, nur hin und wieder kurz unterbrochen von Pepitos tiefer Stimme. Sie klang beruhigend. Er wusste genau, wie er mit dieser alten Schreckschraube reden musste, damit sie ihm aus der Hand fraß.
Josephine sah ihn vor sich, wie er noch im Überzieher im Flur stand und die knochige Hand der Gräfin tätschelte, ein begütigendes Lächeln auf dem Gesicht, die schwarzen Augen ernst und verständnisvoll, das Monokel funkelnd. Dann hörte sie, wie die Gräfin ging, und Pepito kam herein. Er lächelte kein bisschen.
Josephine ging zu Toutoute, die inzwischen der Serviette den Garaus gemacht hatte, legte ihre Arme um die kleine Ziege und schmiegte ihre Wange an das weiche, warme Fell. Toutoute leckte ihr das Gesicht ab.
»Guten Morgen, Schatz.«
»Es ist vier Uhr, Josephine. Da kann man wahrlich nicht mehr von Morgen sprechen.«
Josephine zuckte mit den Schultern. »Morgen ist für mich, wenn man aufsteht.«
Pepito seufzte. »Die Marquise hat mir gerade ihr Leid geklagt. Sie glaubt, dass du den Unterricht nicht ernst genug nimmst.«
»Das stimmt nicht«, empörte sich Josephine. »Ich nehme ihn sehr ernst. Zwanzig vor vier, zwanzig nach vier, fourchette, cuillère … petite cuillère, Weinglas, Serviette … Ich kann das alles. Aber es ist so langweilig, Pepito … diese Person schläfert mich ein.« Sie gähnte. Dann stand sie auf und ging zu ihm, strich ihm mit den Fingern über das Gesicht, die dichten schwarzen Augenbrauen, das streng gescheitelte, mit Pomade geglättete Haar, den dünnen Schnurrbart. Sie legte ihre Arme um seinen Hals, schmiegte sich an ihn und zog einen Flunsch. »Können wir nicht etwas machen, was ein bisschen spannender ist …?«
Pepito nahm ihre Hände von seinen Schultern und schüttelte den Kopf. »Nicht jetzt, Josephine. Du musst die Lieder üben. Wir reisen schließlich morgen nach Wien, und sie sitzen noch immer nicht hundertprozentig.«
Sie entwand sich seinem Griff. »Natürlich sitzen sie. Ich kann sie im Schlaf.« Sie sang ihm ein paar Takte von Pretty Baby vor und verzog dann das Gesicht. »Ich verstehe übrigens immer noch nicht, warum wir mit der Tournee unbedingt in Wien anfangen müssen? Ich wäre so gerne noch einmal in Berlin aufgetreten …«
»Nach dem, was in Berlin passiert ist, wäre das keine gute Idee gewesen, das weißt du«, sagte Pepito, und sie hörte an seiner Stimme, wie sehr er sich bemühte, geduldig zu sein. »Es soll doch ein Neubeginn für dich werden. Den fängt man nicht in einer Stadt an, in der beim letzten Engagement das Theater in die Luft gesprengt wurde.«
»Aber das Publikum in Berlin hat mich geliebt! Man hat mich auf Händen getragen …«
Pepito sah sie einen Moment lang schweigend an. »Es ist wegen dieses Kerls, oder? Deswegen willst du unbedingt nach Berlin.«
»Ich weiß nicht, wovon du sprichst.« Josephine wandte sich ab und sah aus dem Fenster.
»Sieh mich an, wenn ich mit dir rede.«
Widerwillig drehte sie sich wieder um.
Pepitos Miene hatte sich verfinstert. »Verkauf mich nicht für dumm, Josephine. Dieser Mann, der dich damals gerettet hat. Du willst ihn wiedersehen.«
»Blödsinn!«, gab Josephine zurück. »Das war doch nur mein Fahrer. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß.«
Sie hatte das Falsche gesagt, das erkannte sie in dem Moment, als sie Pepitos Augen sah. Sie blitzten vor Zorn. »Ach ja? Und deshalb trägst du ständig sein Foto mit dir herum? Ich habe es in deiner Tasche gesehen.«
Josephine gab keine Antwort.
Pepitos Blick wanderte zur Kommode. »Ist dieser Mann aus Berlin der unbekannte Verehrer, der dir ständig diese Rosen schickt? Trefft ihr euch vielleicht sogar heimlich, hinter meinem Rücken?« Er war jetzt laut geworden.
»Nein! Pepito …«
Er packte das Mooskörbchen, riss die Rosen heraus und warf sie zu Boden. Dann trampelte er darauf herum, zermalmte die zarten roten Blüten unter den Absätzen seiner Lackschuhe.
Josephine starrte ihn an. »Bist du verrückt geworden?«
Pepito strich sich schwer atmend über die Haare. Mühsam beherrscht sagte er: »Du lernst jetzt deine Lieder, Josephine, und morgen fahren wir nach Wien. Von Berlin will ich nie mehr etwas hören.«
Er packte sie am Arm und zog sie hinter sich her ins Schlafzimmer. Dann ging er und schloss Tür hinter sich. Josephine konnte hören, wie sich der Schlüssel im Schloss drehte. Sie setzte sich achselzuckend auf das Bett, griff nach ihrer kleinen, mit Strass besetzten Handtasche und nahm Tristans Foto heraus.
Pepito hatte natürlich recht gehabt, sie trug Tristans Foto immer mit sich herum, seit sie es – Pepitos wegen – nicht mehr an ihren Garderobenspiegel klemmen konnte. Liebevoll strich sie darüber. Tristan wirkte noch ziemlich angeschlagen auf dem Bild, sein Arm steckte in einer Schlinge, doch er lachte, was er in der Zeit, in der sie sich begegnet waren, eher selten getan hatte. Er hatte ein schönes Lachen, das sein Gesicht veränderte, offener, freier machte. Und er zeigte es auf dem Bild nur ihr zuliebe. Dessen war sie sich sicher. Um sie zu trösten, wenn sie einmal traurig war.
Sie schob das Bild zurück in die Tasche. Tristan würde bei ihr bleiben, da konnte Pepito sagen, was er wollte. Normalerweise hielt Josephine nichts davon, an der Vergangenheit festzuhalten. Ihre Kindheit, ihre Jugend, die ersten Auftritte in Philadelphia, dann in New York, die beiden lächerlichen Ehen, die sie eingegangen war, noch als Kind, das alles war vorbei und nahezu vergessen. Die erste Ehe, mit dreizehn von ihrer Mutter arrangiert, um sie loszuwerden, war ohnehin ungültig gewesen, und von der zweiten, die auch nur ein paar Wochen gedauert hatte, hatte sie nur den Nachnamen behalten. Sie war allem entronnen, und jetzt lebte sie mit jeder Faser ihres Körpers in der Gegenwart. Und diese lautete: Erfolg. Sie stand im Zenit ihrer Karriere. Paris war verrückt nach ihr. Sie wurde gezeichnet, gemalt, karikiert, mit Geschenken und Kleidern überhäuft. Und doch war es an der Zeit, sich neu zu erfinden, hatte Pepito gemeint. Paris war eine anspruchsvolle Liebhaberin. Wenn es ihr langweilig wurde, wandte sie sich jemand anderem zu.
»Wie lange, glaubst du, wird man der süßen kleinen Wilden im Bananenrock noch zusehen?«, hatte Pepito sie gefragt und sogleich einen Plan für ihre Zukunft entworfen. »Wir gehen zwei Jahre auf Welttournee, und wenn du zurückkommst, wird Paris dir erneut zu Füßen liegen. Du wirst sie völlig neu bezaubern. Dieses Mal nicht mit Bananen und dem Danse Sauvage, sondern mit deiner Sensibilität, deinem Charme und deiner Stimme. Du wirst dir treu bleiben und dennoch überraschen.«
Josephine wusste, dass Pepito recht hatte. Sie war noch jung, erst einundzwanzig, doch sie hatte in der kurzen Zeit ihres Aufstiegs schon viele Gesichter auftauchen und wieder verschwinden sehen. Die Karrieren einiger vielversprechender junger Künstler, die ihr begegnet waren, waren vorbei gewesen, bevor sie richtig angefangen hatten. Das würde ihr nicht passieren. Für sie gab es nur einen Weg, und der führte auf gar keinen Fall zurück.
Sie warf noch einen gleichgültigen Blick zur verschlossenen Tür, bevor sie das Notenblatt zur Hand nahm und pflichtbewusst anfing, das erste Lied zu singen, Pretty Baby, extralaut, damit Pepito es hörte. Er sollte ruhig glauben, dass er gewonnen hatte. Doch die Wahrheit war, dass sie sich nur fügte, weil sie es selbst für richtig hielt.
Josephine unterbrach ihren Gesang, ließ ihre Gedanken ein letztes, wehmütiges Mal zu Tristan wandern und sagte dann leise zu sich selbst: »Ich tue, was mir passt.«
5
Wien, Mittwoch, 15. Februar 1928
Tristan erwachte spät, nachdem er erst gegen Morgen, als bereits graues Dämmerlicht durch die Vorhänge drang, eingeschlafen war. Doch das war nichts Neues. Seit Wochen schlief er ausgesprochen schlecht. Dicht unter der Oberfläche seines Bewusstseins lauerte etwas, wartete nur darauf, dass er wegzudämmern begann und seine Abwehr aufgab, um ihn zu quälen. Wenn er gehofft hatte, dies würde sich während dieser Reise ändern, so war er heute Nacht eines Besseren belehrt worden. Er konnte zwar nicht mit Sicherheit sagen, weshalb ihn diese nächtlichen Albträume heimsuchten, aber er wusste genau, wann es angefangen hatte.
Es war kurz nach Silvester gewesen. Willy Ahl, sein Freund bei der Polizei, war zu ihm in den Boxclub gekommen und hatte ihm erzählt, dass man im selben Kartoffelkeller des Männerwohnheims in Spandau, wo Josef Kurtz Tristan damals festgehalten und gefoltert hatte, eine Leiche gefunden hätte. Sie habe sich dort offenbar seit fast zwei Jahren befunden und sei aufgrund der gleichbleibend trockenen Bedingungen in dem alten Gewölbe weitgehend mumifiziert. Man ging davon aus, dass es sich bei dem Toten um Josef Kurtz handelte.
Tristan hatte Willy gefragt, wie Kurtz gestorben sei.
»Es wurde totgeschlagen«, hatte Willy berichtet. »Der Gerichtsmediziner meinte, so etwas habe er noch nie gesehen. Es wäre eine geradezu unheimliche Brutalität im Spiel gewesen. Der Täter habe mit Sicherheit noch auf ihn eingeschlagen, als er längst schon tot gewesen war. Kopf und Oberkörper wurden regelrecht zertrümmert.«
Tristan hatte sich bei Willy bedankt und weitergemacht wie bisher, hatte trainiert und geboxt, Helene besucht, so oft es ging, bei Fanny und den Mädchen gegessen, mit seinen Freunden in der Blauen Maus Skat gespielt und währenddessen versucht zu begreifen, dass Josef Kurtz, der Schlächter, tatsächlich tot war, und das schon seit geraumer Zeit.
Totgeschlagen.
Tristan sagte sich, die Geschichte sei zu Ende, er müsse nicht mehr weitersuchen, nicht mehr auf Rache sinnen, sich nicht mehr vorstellen, wie es wäre, Kurtz in die Finger zu bekommen. Doch anders als erwartet, brachte Kurtz’ Tod ihm keine Erleichterung. Im Gegenteil. Irgendetwas daran beunruhigte ihn, machte ihn nervös, und er konnte nicht sagen, was es war. Dann begannen die Albträume. Ein formloser Schatten, lichtlos wie ein dunkler Brunnenschacht, verfolgte ihn, sobald er die Augen schloss. Tristan sah ihn immer nur aus den Augenwinkeln, hinter sich, neben sich, am Ende einer Straße, in einem verlassenen Park, und jedes Mal, wenn er im Traum versuchte, sich ihm zuzuwenden, auf ihn zuzugehen, erwachte er schweißgebadet und mit klopfendem Herzen.
Die schlaflosen Nächte zerrten an seinen Nerven, und er wurde zunehmend reizbar. Die alte Aggressivität, die er in letzter Zeit in den Griff bekommen hatte, kehrte zurück und gipfelte zuletzt in einem Trainingskampf mit Rudko, bei dem er beinahe die Kontrolle über sich verloren hatte. Es hatte aber auch so schon gereicht. Tristan hatte Rudko die Nase und zwei Rippen gebrochen, was ihn zutiefst erschreckt hatte.
Auch heute Nacht hatte ihn die Schattengestalt im Traum beobachtet, doch dieses Mal hatte sie eine frappierende Ähnlichkeit mit jenem Mann gehabt, den Tristan gestern Abend bei seiner Ankunft aus dem Hauseingang gegenüber des Hotels hatte kommen sehen. Die Art, wie jener einen Moment lang nur dagestanden und zu ihm herübergestarrt hatte, hatte etwas diffus Unheilvolles gehabt, und so hatten sich im Schlaf offenbar Realität und Traumbilder vermischt. Vielleicht wurde er auch langsam verrückt.
Tristan richtete sich auf und gähnte, schüttelte die dunklen Gedanken ab und griff nach seiner neuen Armbanduhr, die neben ihm auf dem Nachttisch lag. Er hatte sie sich von seinem letzten Honorar geleistet.
Als ihm der Reichstagsabgeordnete Friedrich Lemmau vor zwei Jahren angeboten hatte, dauerhaft für die Regierung zu arbeiten, hatte er zunächst ablehnen wollen, nach kurzer Bedenkzeit jedoch akzeptiert. Zusammen mit seinen Freunden Kurt, Rudko und Otto sowie einigen weiteren vertrauenswürdigen Männern aus dem Boxclub hatte er eine schlagkräftige und effektive Einsatztruppe zusammengestellt, die sich im Regierungsauftrag um den Schutz von Politikern kümmerte. Mit der Zeit waren auch andere gefährdete Personen hinzugekommen, und sie hatten gut zu tun. An Aufträgen mangelte es nicht, im Gegenteil. Sie dachten sogar daran, personenmäßig aufzustocken. Da Otto Michalke geheiratet und eine neue Arbeit gefunden hatte, würde er über kurz oder lang wegfallen, und sie würden sich einen ebenso durchsetzungsfähigen wie vertrauenswürdigen Ersatz suchen müssen, was nicht so einfach war. Zudem wurde die politische Lage in Berlin immer kritischer. Seit Joseph Goebbels Gauleiter der NSDAP in Berlin geworden war, verhielten sich die rechten Schlägerbanden, allen voran die SA, immer unverfrorener. Das Verbot, das die Polizei im letzten Jahr gegen die SA ausgesprochen hatte, hatte niemanden lange gekümmert, Goebbels hatte bereits im Oktober seine Redefreiheit zurückerhalten, und was die kommenden Reichstagswahlen anbelangte, so befürchtete Tristan das Schlimmste.
Ein Blick auf die Uhr sagte ihm, dass es bereits zu spät fürs Frühstück war, was ihn jedoch nicht weiter kümmerte. Er ließ diese Mahlzeit auch zu Hause meist ausfallen. Mit einem letzten Gähnen stand er auf, zündete sich eine Zigarette an und öffnete das Fenster. Der Himmel hatte sich über Nacht bezogen, und die Luft, die hereinströmte, war knochenkalt. Tristan trug nur seine Unterwäsche, doch er empfand das Frösteln auf seiner Haut als belebend. Es vertrieb die letzten Spuren der nächtlichen Schatten. Rauchend stand er eine Weile am Fenster und ließ die ungewohnten Bilder und Geräusche der fremden Stadt auf sich wirken.
Wie schon gestern, beim Anblick der Straßenbeleuchtung, kam ihm Wien irgendwie gedämpfter vor als Berlin. Freundlich gesagt, würde man es vermutlich als gemächlich bezeichnen, doch das traf es seiner Ansicht nach nicht ganz. Es lag etwas Düsteres, Beklemmendes in dieser Gemächlichkeit. Als hätte sich ein vergilbter Schleier über die Häuser und Gassen gelegt, ein zähes, stockfleckiges Gespinst aus alten Geschichten und längst ausgeträumten Träumen, das die Hauptstadt der ehemaligen Habsburgermonarchie in einem Dämmerschlaf gefangen hielt, und Tristan fragte sich unwillkürlich, welches Gesicht die Stadt der Welt wohl präsentieren würde, wenn sie eines Tages daraus erwachte. Einem plötzlichen Impuls folgend wandte er sich vom Fenster ab, ging zu seiner Reisetasche und nahm seine Luger 08 heraus. Die Pistole stammte aus seinen und Freddys Schwarzmarktzeiten. Sein Freund hatte damals zwei von ihnen durch einen Tausch erstanden und im Keller deponiert. Si vis pacem, para bellum, lautete das lateinische Zitat, nach dem die Waffe ihren Spitznamen Parabellum bekommen hatte. Wenn du Frieden willst, bereite Krieg vor.
Das Grauen des Krieges noch vor Augen, war den beiden Ex-Soldaten dieses Zitat damals wie der blanke Hohn vorgekommen, und sie hatten sich geschworen, sie nie zu benutzen. Vor zwei Jahren jedoch waren sie gezwungen gewesen, diesen Schwur zu brechen. Freddy hatte die Pistole nicht beschützen können. Doch er selbst trug sie inzwischen ähnlich selbstverständlich wie seine Hosenträger und kam sich fast nackt vor, wenn er ihr Gewicht nicht spürte.
Als Tristan wenig später nach unten kam, saß die Hotelwirtin wieder in ihrem Lehnsessel hinter dem Tresen. Sie trug dasselbe Kleid wie gestern Abend, dazu heute jedoch einen Fuchspelz um die mageren Schultern und bernsteinfarbene Ohrringe. Sie las Zeitung, und auf dem Tresen standen eine Kaffeetasse und ein Aschenbecher, in dem ihre Zigarillo vor sich hin glimmte. Andere Gäste waren nicht zu sehen.
»Das Frühstück haben Sie verpasst«, murmelte sie, ohne von ihrer Lektüre aufzusehen, als er den Schlüssel bei ihr ablegte und ihr einen Guten Morgen wünschte. Tristan wollte sich schon abwenden, da senkte sie die Zeitung doch und musterte ihn prüfend über den Rand ihrer Lesebrille hinweg. »Unser Frühstücksmädl, die Ursi, kann Ihnen aber noch einen kleinen Braunen machen, wenn Sie mögen. Sie schauen aus, als könnten Sie einen brauchen.«
Er schüttelte den Kopf. »Danke, aber ich habe es eilig.«
»Keine Zeit fürs Frühstück?« Die Wirtin schnalzte missbilligend mit der Zunge. »So werden Sie aber nicht alt, Herr Nowak.«
»Morgen!«, versprach Tristan und verließ nach einem kurzen Nicken das Hotel. Nach den beunruhigenden Albträumen in der Nacht war er nicht in der Stimmung, sich von der alten Dame Prophezeiungen über seine voraussichtliche Lebensdauer anzuhören, auch wenn sie nur so dahingesagt waren. Wenn er irgendwann in ferner oder naher Zukunft ins Gras beißen sollte, würde es mit Sicherheit nicht am fehlenden Frühstück liegen. Außerdem fragte er sich, ob in diesem Hotel überhaupt jemand frühstückte. Er war bisher keinem anderen Gast begegnet. Die einzigen Geräusche, die man im Foyer hörte, waren das Rascheln von Frau Salmingers Zeitung und das leise Gezwitscher der beiden Papageien am Fenster.
Draußen auf der Gasse ging er zielstrebig in die Richtung, wo er gestern Abend den Mann im schwarzen Mantel gesehen hatte.
Im Grunde kam nur ein etwas zurückgesetzter Eingang schräg gegenüber des Hotels infrage, denn nur dort könnte sich eine Person verbergen, ohne gesehen zu werden. Tristan trat näher und las die Klingelschilder an der Tür. Drei Parteien wohnten im Vorderhaus, ein Durchgang führte in den Hinterhof, wo vermutlich noch mehr Parteien lebten. Nichts daran war in irgendeiner Weise außergewöhnlich. Der Mann konnte hier wohnen. Oder er hatte jemanden besucht. Es gab keinen Grund, etwas anderes zu glauben, nur aufgrund dieses flüchtigen Gefühls des Unbehagens, das er bei seinem Anblick verspürt hatte. Tristan sah sich dennoch sorgfältig um, untersuchte das Kopfsteinpflaster im Bereich des Durchgangs, aus dem der Unbekannte gestern getreten war, und hob schließlich eine einzelne Zigarette auf, die dort lag. Sie war höchstens halb geraucht, so als habe sie sein Besitzer weggeworfen, weil ihn etwas gestört hatte. Etwa Tristan, der sich nach ihm umgedreht hatte?
Tristan besah sie sich genauer. Overstolz. Eine deutsche Marke. Auch das hatte natürlich nichts zu sagen. Deutsche Zigaretten konnte man auch in Österreich kaufen. Nachdenklich ließ er die Kippe zu Boden fallen.
Kurz ärgerte er sich, dass er gestern Abend nicht daran gedacht hatte, sich am Bahnhof einen Stadtplan zu kaufen oder die Hotelwirtin danach zu fragen. Doch er hatte auch keine Lust, noch einmal zum Hotel zurückzugehen. Es würde auch so gehen. Er wusste immerhin, dass er sich in der Nähe des Bahnhofs befand und das Stadtzentrum sich irgendwo in südlicher Richtung befinden musste, daher ging er nun den Weg zurück, den er gestern mit Anton Lowatschek gekommen war.
Trotz des trüben Wetters war die Gasse recht belebt. Eine Frau mit einem Hund an der Leine stand vor einem Haus und plauderte mit einer Frau, die gerade im ersten Stock die Fenster putzte und sich dafür gefährlich weit herauslehnte. Radfahrer fuhren vorüber, zwei kleine Jungs von etwa vier oder fünf Jahren spielten, dick eingepackt mit Schal und Mütze, Murmeln in einer Sandkuhle an der Hausmauer. Ein Lieferwagen knatterte heran, hielt vor dem Kaffeehaus, an dem Tristan gerade vorbeikam, ein junger Mann sprang heraus und lud mehrere Kisten Wein auf eine Sackkarre. Als ihm ein Kellner die Tür öffnete, drang der Duft von Kaffee heraus. Spontan folgte Tristan dem Lieferanten. Eine Tasse Kaffee zum Start in den Tag wäre jetzt doch nicht so schlecht. Dabei konnte er auch gleich nach dem Weg ins Zentrum fragen.
Das Kaffeehaus war gut besucht. Mehrere Kellner in weißen Hemden, schwarzem Jackett und Fliege eilten umher und brachten Brotkörbchen, Rühreier, dampfenden Kaffee und süße Gebäckteile zu den Gästen. Lange Sitzbänke aus dunklem Leder zogen sich an der Wand entlang, an der Decke hingen Lampen im Art-déco-Stil, und das vermutlich einmal in hellem Gelb gestrichene Gewölbe hatte die Patina von vielen Jahren und zahllosen Zigaretten angenommen. Tristan setzte sich an einen kleinen Tisch am Fenster.
Als ein Kellner zu ihm kam, bestellte er eine Tasse Kaffee. Der Ober runzelte die Stirn. »Einen Braunen oder einen Türkischen? Oder wollen S’ lieber einen Verlängerten? Oder einen Kapuziner oder vielleicht eine Melange …?«
Tristan hatte keine Ahnung, wovon der Mann sprach. Auch die Hotelwirtin hatte von einem kleinen Braunen gesprochen, ohne dass sich ihm erschlossen hätte, worum es sich dabei genau handelte. Er hatte nur vermutet, dass es Kaffee sein musste.
»Einfach einen Kaffee.«
»Sie sind nicht von hier, oder?«
»Nein.«
Der Kellner sah ihn schweigend an, offenbar erwartete er eine weitere Erklärung.
»Schwarz und ohne Milch, bitte.«
Diese Information schien zu genügen. Als der Kellner zurückkam, hatte er eine kleine Tasse tiefschwarzen Mokka und ein Glas Leitungswasser dabei. Er stellte beides vor Tristan ab. »Ich hab Ihnen einen Türkischen gemacht«, sagte er im Tonfall eines gutmütigen Lehrers, der seinen ahnungslosen Schüler aufklärt. »Stark und schwarz. Trink ich in der Früh auch immer.«
Tristan nickte. »Perfekt. Danke.«
Der Mokka war köstlich, süß und so stark, dass er Tote aufgeweckt hätte, und Tristan bestellte sich noch eine zweite Tasse. Als er kurze Zeit später bezahlte, ließ er sich von dem Kellner den Weg zum Hotel Sacher erklären.
Der Mann beschrieb ihm nicht nur den Weg zu Fuß, sondern nannte ihm auch die Linie der Trambahn – die er Tramway nannte –, die ihn direkt zur Oper bringen würde. »Und von da ist es nur noch ein Vogelschiss weit bis zum Sacher.«
6
Tristan beschloss, zu Fuß zu gehen und sich dabei ein wenig die Stadt anzusehen. Der Weg war tatsächlich so einfach, wie es der Kellner beschrieben hatte, und nach einer guten halben Stunde erreichte er den inneren Stadtkern. Das Hotel befand sich hinter der Oper, ein wuchtiger grauer Solitär, der, obwohl vom Lauf der Zeit sichtlich in Mitleidenschaft gezogen, selbstbewusst und arrogant wie eine alte Diva seinen Platz zwischen Oper und Hofburg behauptete. Als er in das edle Foyer trat und sich umsah, eilte augenblicklich ein hochnäsig wirkender Concierge auf ihn zu und fragte nach seinen Wünschen, wobei sein Unterton unüberhörbar besagte, dass man schon einen sehr guten Grund haben musste, in das Foyer des Hotel Sacher zu treten, ohne Hotelgast zu sein.
Tristan bedachte ihn mit einem kühlen Blick und teilte mit, dass er mit dem Grafen von Seidlitz verabredet sei.
Die Haltung des Concierge änderte sich sofort. Er machte eine kleine Verbeugung, und als er antwortete, hatte sich sein misstrauischer Unterton in Luft aufgelöst: »Natürlich. Der Herr Graf ist noch beim Frühstück. In der Roten Bar. Ich werde Sie sofort hinbringen.«
Die Rote Bar machte ihrem Namen alle Ehre. Die Wände, der Teppich, die Vorhänge, alles war in einem samtigen Weinrot gehalten. Von der Decke hingen mindestens fünf Kronleuchter und tauchten den Raum in ein warm funkelndes Licht, ein starker Kontrast zum trüben Grau vor den Fenstern. Tristans Onkel saß zusammen mit seinem Sekretär Paul Ballin an einem Tisch abseits der Fenster. Über ihnen an der Wand hing das großformatige Ölgemälde einer französischen Bulldogge.
Als Tristan näher kam, hob der Graf den Kopf. »Sieh an«, sagte er mit feinem Spott in der Stimme. »Da bist du also doch gefahren. Warum wundert mich das nicht?«
»Vielleicht, weil Vernunft noch nie meine Stärke war?« Tristan hatte seinem Onkel nichts von seinem Entschluss gesagt, nach Wien zu kommen, aber im Grunde war es auch nicht nötig gewesen. Beide hatten in dem Moment, in dem Tristan seinem Onkel den Briefumschlag gezeigt und ihn gefragt hatte, ob er von ihm stamme, gewusst, dass er fahren würde.
Paul lachte auf. »Vernehme ich da etwa einen Anflug von Selbsterkenntnis?«
»Dass ausgerechnet du das hörst?«, meinte von Seidlitz kühl. »Wo Selbsterkenntnis dir doch völlig fremd ist.«
Paul verzog den Mund zu einem bitteren Lächeln, rückte sich seine dezent gemusterte seidene Krawatte zurecht und widmete sich seinem Frühstücksei.
Tristan musterte seinen Onkel erstaunt. Noch nie hatte er Spannungen zwischen dem Grafen und Paul, dessen Rolle im Leben seines Onkels sich nach allem, was Tristan wusste, nicht auf seine Aufgabe als Sekretär beschränkte, mitbekommen.