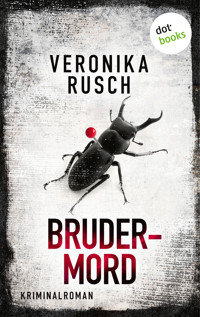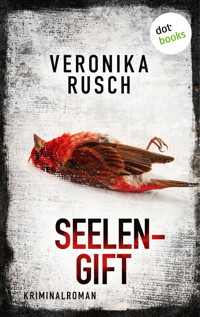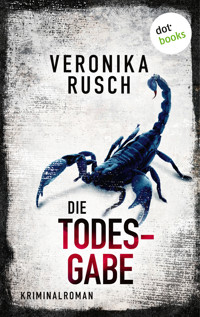
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Clara Niklas
- Sprache: Deutsch
Ein Ritualmord erschüttert München: Der abgründige Kriminalroman »Die Todesgabe« von Veronika Rusch jetzt als eBook bei dotbooks. Mit leeren Augen kauert er neben der grausam zugerichteten Leiche seines Bruders – mit dessen abgetrenntem Kopf in den Händen ... Als Rechtsanwältin Clara Niklas die Verteidigung des schwer verstört wirkenden Jugendlichen übernimmt, ist sie schon bald überzeugt von seiner Unschuld. Unmöglich, dass der sensible Solo seinen Bruder nach einem uralten keltischen Ritual getötet hat. Doch warum musste Frank ausgerechnet auf diese grausige Art sterben – und wer ist der wahre Killer? Schnell findet Clara heraus, dass der junge Mann den falschen Menschen vertraut hat, ihnen zu lange gefolgt ist und dafür den ultimativen Preis bezahlen musste. Aber kann sie ihre Identität aufdecken, bevor die finsteren Drahtzieher hinter dem Mord sie ins Visier nehmen? »Veronika Rusch beweist uns, dass nicht nur schwedische und britische Krimiautoren einen Sinn für Spannung haben.« Brigitte Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Kriminalroman »Die Todesgabe« von Veronika Rusch ist der vierte Band ihrer Reihe um die Rechtsanwältin Clara Niklas, die Fans von Inge Löhnig und Elisabeth Herrmann begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Mit leeren Augen kauert er neben der grausam zugerichteten Leiche seines Bruders – mit dessen abgetrenntem Kopf in den Händen ... Als Rechtsanwältin Clara Niklas die Verteidigung des schwer verstört wirkenden Jugendlichen übernimmt, ist sie schon bald überzeugt von seiner Unschuld. Unmöglich, dass der sensible Solo seinen Bruder nach einem uralten keltischen Ritual getötet hat. Doch warum musste Frank ausgerechnet auf diese grausige Art sterben – und wer ist der wahre Killer? Schnell findet Clara heraus, dass der junge Mann den falschen Menschen vertraut hat, ihnen zu lange gefolgt ist und dafür den ultimativen Preis bezahlen musste. Aber kann sie ihre Identität aufdecken, bevor die finsteren Drahtzieher hinter dem Mord sie ins Visier nehmen?
»Veronika Rusch beweist uns, dass nicht nur schwedische und britische Krimiautoren einen Sinn für Spannung haben.« Brigitte
Über die Autorin:
Veronika Rusch studierte Rechtswissenschaften und Italienisch in Passau und Rom und arbeitete als Rechtsanwältin in Verona sowie in einer internationalen Anwaltskanzlei in München, bevor sie sich selbständig machte. Heute lebt sie als Schriftstellerin wieder in ihrem Heimatort in Oberbayern. Neben Krimis schreibt sie historische und zeitgenössische Romane sowie Theaterstücke und Kurzgeschichten. Ihre Werke wurden mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem 2. Platz im Agatha-Christie-Krimiwettbewerb und dem DELIA-Literaturpreis.
Veronika Rusch veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre Krimireihe um die Anwältin Clara Niklas mit den Bänden »Das Gesetz der Wölfe«, »Brudermord«, »Seelengift« und »Die Todesgabe«.
Die Website der Autorin: https://www.veronika-rusch.de/
Die Autorin bei Instagram: instagram.com/veronikarusch
***
eBook-Neuausgabe August 2023
Copyright © der Originalausgabe 2013 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Dmitry Prudnichenko, Nadia Chi, Kaiskynet Studio
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-793-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Todesgabe«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Veronika Rusch
Die Todesgabe
Kriminalroman
dotbooks.
TEIL EINS
Ich sehe Rot. Scharlachrot.
Weissagung der Sidhe
Sie weiß nicht, ob sie tot ist.
In ihrem Kopf kann sie die Dinge noch sehen: das kalte Licht der Straßenbeleuchtung, die Schatten unter den Bäumen, den fernen, wolkenverhangenen Himmel. Regen war gefallen. Regen. Jetzt gibt es keinen Himmel und keinen Regen mehr. Ist das Sterben? Den Himmel nicht mehr sehen? Das Atmen fällt ihr schwer. Doch Atmen bedeutet Leben. Also ist sie noch nicht tot. Der Gedanke gibt ihr neue Kraft. Sie bewegt ihren Kopf. Es tut weh. Irgendetwas ist vor ihrem Gesicht, etwas Raues, es stinkt nach verfaulten Kartoffeln. Jemand hat ihr einen Sack über den Kopf gestülpt. Sie zieht ihn herunter und stöhnt vor Schmerz auf. Der Sack ist an ihrem Hinterkopf festgeklebt. An ihrem Blut. Als sie versucht, sich aufzurichten, stößt sie mit dem Rücken gegen ein Hindernis. Ihre Hände beginnen zu tasten und verfangen sich in rauem, unnachgiebigem Metall. Plötzlich versteht sie ihre gebückte Haltung: Sie kauert in einem Käfig, der kaum höher ist als sie selbst, zusammengekrümmt wie ein Embryo. Vor Entsetzen vergisst sie weiterzuatmen, und ihr Herz macht einen schmerzhaften Sprung. Jetzt kann sie die Gitter auch unter sich spüren. Sie drücken in ihre Knie. Wenn ich tot bin, werden sie ein Muster auf mir sehen können, denkt sie. Kleine Karos an den Knien ...
Sie beginnt zu schreien. Zuerst nach Hilfe, dann nur noch wortlos, und das Echo wirft ihre Stimme hohl und verzerrt zurück.
Doch dann hört sie noch etwas anderes.
»Hallo?«, flüstert sie in die Dunkelheit. »Ist da wer?«
Doch es kommt keine Antwort.
EINS
»Ich hab’s kommen sehen. Da war ein Unheil im Dorf, seit die da waren. Ich kann nicht sagen, woran es lag. An den Kindern vielleicht. Man hat’s ihnen angesehen, dass etwas nicht stimmt.«
Zeugenaussage Leichensache Wolfsberg1. November 1998
Die Kälte kam über Nacht. Wie eine Diebin schlich sie sich in die schlafende Stadt, schickte Windböen die Fassaden der Häuser entlang und ließ die Fensterscheiben erzittern. Gegen drei Uhr morgens begann es zu regnen; es war ein alles durchdringender, eisiger Regen, der den goldenen Herbst schlagartig in weite Ferne rückte.
Am nächsten Tag war die Temperatur auf neun Grad Celsius gesunken, und das welke Laub lag nass und braun in den Rinnsteinen.
Clara hatte schon den ganzen Tag Kopfweh; mit einem einseitigen, pochenden Schmerz reagierte ihr Körper auf den plötzlichen Temperatursturz. Sie rieb sich die Schläfen, trank einen Schluck schal gewordenen Kaffee und senkte dann den Blick wieder auf die Monatsabrechnung ihrer Kanzlei, die ihr, wie die vorherigen auch, unverändert Kopfzerbrechen bereitete, gleichgültig, wie oft sie die Zahlen addierte. Wenn es so weiterging, würde sie aufgeben müssen.
Vor über einem Jahr hatte ihr Kollege und alter Freund Willi Allewelt die gemeinsame Kanzlei verlassen, und seitdem war es sowohl mit ihrer Motivation als auch mit ihren Einnahmen stetig bergab gegangen. Clara seufzte und schaltete die Schreibtischlampe ein. Obwohl es erst halb fünf war, war es bereits düster in dem großen Raum, der sich über zwei Ebenen erstreckte und der jetzt, da sie allein war, langsam den Geruch staubiger Verwahrlosung annahm. Aber vielleicht war es auch der Geruch der Einsamkeit, der sie nach und nach einhüllte und der ihre Schritte begleitete, wenn sie die Stufen hinunter in das verwaiste Sekretariat ging, den Kopierer einschaltete oder auf das Piepen des Faxgeräts wartete, mit dem das erfolgreiche Versenden eines Schriftstücks gemeldet wurde. Hatten ihre Schuhe immer schon so laut auf dem Dielenboden geklappert? Hatte sie ihre Schritte überhaupt jemals gehört, als Willi und Linda, ihre gemeinsame Sekretärin, die mittlerweile Willis Ehefrau war, noch da gewesen waren?
Im Augenblick hörte sie nichts als den Regen, der in Wellen gegen die großen Fensterscheiben der ehemaligen Buchhandlung prasselte, und einen gelegentlichen tiefen Seufzer von Elise, ihrer kalbgroßen grauen Dogge, die ausgestreckt auf dem Boden lag und träumte. Clara wandte sich um und sah zum Fenster hinaus. Die Straße war kaum wiederzuerkennen. Wo die Münchner erst gestern noch viel braune Haut, lackierte Zehen und schicke Sonnenbrillen präsentiert hatten, fegte jetzt ein ruppiger Wind Plastiktüten über den Asphalt. Ritas Café wirkte verlassen, die Stühle standen aufeinandergestapelt neben dem Eingang, und man konnte durch das Regengrau kaum erkennen, ob im Inneren überhaupt Licht brannte. Eine alte Frau kam mühsam den Gehsteig entlang. Sie hatte einen durchnässten Hut über ihr graues Haar gestülpt und hielt den Kopf gegen den Regen gesenkt. Ihre Hände umklammerten einen Rollator, an dessen Gummireifen nasse Blätter klebten. Meter für Meter schob sie sich vorwärts, und Clara konnte sogar von ihrem entfernten Platz hinter dem Fenster erkennen, dass die Frau am Ende ihrer Kräfte war. Clara stand auf, um ihr ihre Hilfe anzubieten. Doch es erwies sich als unnötig, nach draußen zu gehen, denn noch bevor sie an der Tür war, schellte die altmodische Klingel, und Clara konnte durch die regenverspritzte Scheibe erkennen, dass es die alte Frau war, die geklingelt hatte.
Clara öffnete rasch, und die Frau stolperte herein. Der Rollator rumpelte über die Dielen, und schmutzige Pfützen breiteten sich auf dem Holzboden aus. Clara reichte ihr den Arm und führte sie zu einem Stuhl. Die Frau ließ sich keuchend darauf nieder und nahm dann mit einer erschöpften Bewegung den Hut vom Kopf. In dem Moment erkannte Clara sie. Es war Lilly Groman, eine sechsundachtzigjährige Dame, die im St. Anna-Stift lebte, einem Altersheim nur wenige Straßen von ihrer Kanzlei entfernt. Sie hatte keine Angehörigen und litt unter zunehmender Vergesslichkeit. Clara hatte ihr schon früher bei verschiedenen Angelegenheiten unter die Arme gegriffen, und seit zwei Jahren, seit Frau Gromans Vergesslichkeit durch die Heimleitung den neuen, hässlichen Namen Altersdemenz erhalten hatte, war sie auch ihre rechtliche Betreuerin.
»Frau Groman! Wie kommen Sie denn hierher?«, rief Clara überrascht. Sie hatte geglaubt, Lilly Groman könne kaum mehr ihr Zimmer verlassen.
»Auf meinen zwei Beinen!«, antwortete Frau Groman, doch die für sie so typische, schnippische Antwort kam nur gehaucht, und Clara konnte das angestrengte Zittern hören, das ihre Worte begleitete.
»Möchten Sie eine Tasse Tee?« Clara half ihr aus dem nassen Mantel und hängte ihn an die Garderobe.
Lilly Groman schüttelte stumm den Kopf. Sie war dünn und winzig und schien so zerbrechlich wie ein kleiner Vogel. Den Blick auf ihre blau geäderten, knotigen Hände gesenkt, versuchte sie, wieder zu Atem zu kommen. Clara setzte sich zu ihr und wartete. Nach endlosen Minuten qualvoller Stille hob Lilly Groman plötzlich den Kopf. »Sie müssen helfen!«, sagte sie. Clara nickte. »Gerne, wenn Sie mir sagen, worum es geht? Sie hätten auch anrufen können ...«
Lilly Groman schüttelte wieder den Kopf.
»Nein. Es ist nichts ... was ...« Sie hob fahrig die Hand und fuhr sich über die zerfurchte Stirn, als müsse sie einen Schatten wegwischen, der ihr die Sicht versperrte.
»Es ist etwas passiert! Etwas Furchtbares ...«
»Etwas passiert?«
»Menschen verschwinden ...«
»Wie?« Clara runzelte die Stirn. »Was meinen Sie?«
Lilly Groman packte Clara am Arm und krallte sich mit so unerwarteter Kraft fest, dass Clara zusammenzuckte.
»Sie werden getötet«, sagte die alte Frau und starrte Clara aus weit aufgerissenen Augen an. »Getötet!«
Clara wich zurück und versuchte vergeblich, ihren Arm zu befreien. »Was reden Sie denn da, Frau Groman? Niemand wird getötet!«
Lilly Gromans Griff verstärkte sich. »Sie müssen mir glauben. Er hat es mir gesagt!«
»Wer?«
»...«
»Wer, Frau Groman? Wer hat Ihnen so etwas gesagt?«
Die alte Frau zögerte, und ihre Augen füllten sich langsam mit Tränen. »Ich ... ich kann mich nicht erinnern ...« Sie ließ Claras Arm los und schlug beide Hände vor das Gesicht. Ihre Stimme klang gedämpft dahinter hervor, als sie weitersprach. »Dieser verdammte Kopf. Man müsste ihn mir abschlagen. Ich wusste es noch, als ich losging ...« Sie ließ die Hände verzagt sinken.
Clara legte ihre Hand auf Lilly Gromans Schulter. »Ich mache uns jetzt doch eine Tasse Tee, und dann fällt es Ihnen sicher wieder ein«, sagte sie aufmunternd und ging in die Küche. Während sie auf den Wasserkocher starrte und dazwischen immer wieder einen Blick hinunter in den Raum warf, wo Lilly Groman zusammengesunken auf ihrem Stuhl saß, überlegte sie, was das zu bedeuten hatte. Sie kannte sich mit Demenz nicht aus. War die Krankheit weiter fortgeschritten? Bildete sich Lilly Groman Dinge ein? Oder hatte irgendjemand im Altersheim ihr diesen Unsinn erzählt? Angesichts der täglichen Schreckensmeldungen in den Nachrichten bekamen die alten Leute oft Angst und brachten dann das eine oder andere durcheinander.
Als Clara mit zwei Bechern Tee zurückkam, schenkte ihr Lilly Groman ein zittriges Lächeln. »Sie denken, jetzt ist die alte Schrulle völlig verrückt geworden, nicht wahr?«
Clara erwiderte ihr Lächeln. »Es klingt schon ein wenig merkwürdig, was Sie mir da erzählen«, gab sie zu.
Lilly Groman nickte nachsichtig. »Da haben Sie recht. Doch es ist die Wahrheit.«
»Was macht Sie so sicher?«, wollte Clara wissen.
»Ich kann es spüren.« Lilly Groman klopfte sich mit einer Hand gegen die flache Brust.
Clara wusste nichts zu erwidern. Demenz war eine teuflische Krankheit, die den Menschen nach und nach ihre Würde und alles raubte, was sie als Person jemals ausgemacht hatte. Sie wollte sich nicht in den Reigen derer einreihen, die Menschen wie Lilly Groman automatisch wie dreijährige Kinder behandelten, und beschloss, zumindest den Versuch zu machen, sie ernst zu nehmen. »Wer ist verschwunden, Frau Groman?«, fragte sie daher. »Wer wird getötet? Jemand aus dem Altersheim?«
Lilly Groman warf ihr einen entrüsteten Blick zu. »Aber nicht doch! Das würde doch jemandem auffallen.« Sie zögerte und fügte dann unsicher hinzu: »Hoffe ich jedenfalls.«
»Wer dann?«
»Ich weiß es nicht ...«
»Und was soll ich jetzt tun?«
Lilly Groman zwinkerte angestrengt. »Ich denke ... Sie müssen auf die Zeichen achten ...«
»Auf die Zeichen ...? Welche Zeichen?«
»Ich weiß nicht ...« Lilly Gromans Hände zitterten so, dass sie ihren Tee verschüttete. Clara half ihr, die Tasse abzustellen. Sie wartete, doch Lilly Groman schüttelte verzagt den Kopf und verfiel in ein grüblerisches Schweigen. Eine Weile waren nur der Regen zu hören, der immer wieder in Böen gegen die Scheibe prasselte, und das leise Rauschen der Reifen vorbeifahrender Autos auf dem nassen Asphalt.
»Äh, ja dann ...« Clara trank ihren Tee aus und stand auf. »Ich denke, ich sollte Sie jetzt nach Hause bringen lassen, Frau Groman ...«, begann sie, wurde aber von Lilly Groman unterbrochen, die plötzlich den Kopf hob und sie aus rot geränderten, wässerigen Augen ansah.
»Salamander!«, rief sie, und ihre Stimme war dünn und hoch vor Aufregung. »Sie müssen auf die Salamander achten!« Sie erhob sich mühsam von ihrem Stuhl und umklammerte Claras Arm mit beiden Händen. »Salamander! Ich weiß es wieder! Bitte! Tun Sie etwas! Sonst werden sie erneut töten!«
»Salamander?« Clara räusperte sich und entwand ihren Arm behutsam aus dem Klammergriff der alten Frau. »Ich weiß nicht ... äh ... das war ein sehr anstrengender Ausflug, den Sie da heute unternommen haben.«
»Das kann man wohl sagen!« Lilly Groman wandte sich ab und griff mit einer unsicheren Bewegung nach ihrem Hut. »Aber angesichts der Umstände war es selbstverständlich notwendig, persönlich zu kommen.«
Clara nickte unbehaglich. »Selbstverständlich«, stimmte sie leise zu und ging zum Telefon, um ein Taxi zu rufen.
Während sie draußen im nachlassenden Regen standen und zusahen, wie der Taxifahrer den Rollator in den Kofferraum wuchtete, griff Lilly Groman noch einmal nach Claras Arm. »Sie werden etwas unternehmen, nicht wahr?« Ihre Stimme war drängend.
»Ja ... ich werde sehen, was ich ...« In dem Moment bat der Taxifahrer die alte Frau einzusteigen. Sie fuhren los, und Clara winkte erleichtert.
Die feuchte Kälte drang ihr bis in die Knochen, und sie schlug fröstelnd die Arme um den Oberkörper. Mit Ausnahme eines jungen Mannes, der sich mit einer tief ins Gesicht gezogenen Kapuze gegen den unangenehmen Sprühregen zu schützen versuchte und in dem für seine Generation typischen schlurfenden Gang an ihr vorbeischlich, war die Straße menschenleer.
Clara ging zurück in ihre Kanzlei. Lilly Gromans Besuch hatte sie deprimiert. Was war das für eine grausame Krankheit, die eine eigentlich durch und durch pragmatische Frau so außer sich geraten ließ? Was sollte das Gefasel von Salamandern und getöteten Menschen? Was hatte sie so durcheinandergebracht, dass sie sogar zu Fuß zu ihr gekommen war? Wie hatte sie überhaupt hierher gefunden?
Lilly Groman war alleinstehend und nicht sehr gesellig. Ihr erster Mann war im Krieg gefallen, und ihr zweiter Ehegatte, Eugen Groman, war vor etwa zehn Jahren gestorben. Sie hatten keine Kinder. Soweit Clara wusste, bekam Lilly Groman nie Besuch – sie würde die Pfleger fragen. Vielleicht hatte es irgendeine Veränderung im Heim gegeben, oder Lilly Groman hatte sich mit jemandem angefreundet? Nachdenklich räumte Clara die Tassen in die Küche, goss den Rest Tee in die gesprungene Spüle und ging zu ihrem Schreibtisch zurück. Die Lust, sich noch weiter mit den unerfreulichen Zahlen zu beschäftigen, war ihr jetzt gänzlich vergangen. Es kam sowieso nichts dabei heraus. Sie schob ihre Papiere auf einen unordentlichen Haufen zusammen und schaltete die Schreibtischlampe aus. Damit lag der obere Teil der Kanzlei fast im Dunklen, und das düstere Zwielicht gemahnte an den Winter, obwohl es erst Oktober war.
Ein leises Klappern der Krallen auf dem Dielenboden zeigte an, dass Elise aufgestanden war und zu Clara herüberkam, die ihren Hund abwesend am Nacken kraulte und dann hinunterging. Auf Lindas altem Schreibtisch lag die magere Ausbeute eines ganzen Arbeitstages: vier dünne Briefe, die Clara noch in den Briefkasten werfen musste. Eine Sekretärin hatte sie schon seit längerem nicht mehr. Eigentlich schon seit Lindas Weggang. Die halbherzigen Versuche, jemand Neues einzustellen, waren überwiegend an ihren eigenen überzogenen Ansprüchen gescheitert. Es war ihr bisher einfach nicht gelungen, jemanden zu finden, der Linda ersetzen konnte. Und wenn sie ehrlich war, wollte sie das auch gar nicht. Clara sperrte ab und ging mit hochgestelltem Kragen Richtung U-Bahn am Sendlinger Tor. Elise folgte ihr mit missmutig gesenktem Kopf.
Anders als in der Stadt herrschte in der U-Bahn-Station noch immer die drückende Schwüle der vergangenen Föhntage. Im Zwischengeschoss lungerten einige Jugendliche herum, die Schutz vor dem Regen gesucht hatten. Sie tranken Bier und grölten Passanten an. Die gefliesten Wände waren mit Graffitis beschmiert, und überall lagen leere Flaschen herum. Die Jugendlichen kamen von dem nahen Park, der sich in der letzten Zeit als Treffpunkt der Drogenszene herausgebildet hatte. Solche Treffpunkte gab es überall in der Stadt. Sie verlagerten sich immer wieder, Wanderdünen gleich, vom Ostbahnhof zur U-Bahn Giselastraße oder, wie jetzt, zum Sendlinger Tor, je nachdem, wo die Polizei ihre Überwachungskameras aufstellte oder verstärkt Streife ging. Es war ein trauriges Hase-und-Igel-Spiel, das vor allem den Zweck hatte, für positive Nachrichten in den Medien zu sorgen: Die Stadt tat etwas. Bis die Störenfriede zurückkamen, andernorts ebenfalls vertrieben, und das Spiel erneut begann.
Clara ging an einem älteren Mann mit Hut vorbei, der im sicheren Abstand zu der Gruppe stehen geblieben war und den Kopf schüttelte. »Arbeiten sollt man die lassen, hart arbeiten, dann wär gleich a Ruh«, murmelte er halblaut und sah sich Beifall heischend nach Clara um.
Clara nickte ironisch: »Ab ins Arbeitslager, gell?«
Der Mann zuckte ungerührt mit den Achseln. »Arbeit hat noch keinem geschadet, und so was wie die da hat’s seinerzeit jedenfalls nicht gegeben.«
Clara ließ den Mann stehen und ging zu der leise summenden Rolltreppe hinüber, die sie einen Stock tiefer zu den Bahnsteigen brachte, wo die Luft noch ein paar Grad wärmer war und der Sauerstoff fast ganz zu fehlen schien.
Eine stickige U-Bahn brachte sie zwei Stationen weit. Sie stand mit Elise eng gedrängt zwischen stummen, schwitzenden Menschen und bereute es zutiefst, nicht zu Fuß gegangen zu sein. Mit jedem Atemzug schien ihre Lunge ein Stück mehr zu verstopfen. Schweißgebadet gelangte sie schließlich am Kolumbusplatz wieder nach oben, wo sie ein rauer Wind empfing. Fröstelnd schlug sie ihren Mantelkragen nach oben und beeilte sich, nach Hause zu kommen.
ZWEI
»Die schauten immer so komisch. Nicht so, wie Kinder sonst schauen. Mir ist’s kalt den Rücken runtergelaufen, wenn ich die beiden durchs Dorf hab gehen sehen.«
Zeugenaussage Leichensache Wolfsberg1. November 1998
»Das hat sie gesagt?« Mick schüttelte den Kopf. »Und was hat das zu bedeuten?«
»Keine Ahnung.« Clara zuckte mit den Achseln. Ihr Kopf ruhte angenehm schwer auf Micks Schulter, und das Glas Whisky, das neben ihr auf dem Klavier stand, funkelte bernsteinfarben. »Sie ist dement. Vielleicht hat sie nur etwas geträumt«, sagte sie ohne rechte Überzeugung.
»Aber du glaubst, dass etwas dahintersteckt?«, bohrte Mick nach und versuchte vergeblich, sich eine Zigarette zu drehen, ohne Clara loszulassen. Sie nahm ihm den Tabak aus der Hand und drehte die Zigarette für ihn zu Ende. Die klare Stimme einer Jazzsängerin hallte durch den leeren Raum, und Clara sang leise mit:
Very, very close to heaven
So unobserved, you let it slide
Lucky you, you had forgotten
That you really couldn’t fly
Mick hatte das Pub längst geschlossen, doch weder er noch Clara hatten bisher Lust verspürt, nach Hause zu gehen. Draußen goss es in Strömen. Sie saßen im Nebenzimmer auf einem durchgesessenen Sofa mit weinrotem Samtbezug, das zusammen mit einer wackligen Tiffanystehlampe auf der kleinen Bühne neben dem Klavier stand. Elise lag wie erschossen vor ihnen auf dem Boden und schnarchte laut.
»Ich weiß, es klingt verrückt«, sagte Clara unsicher. »Aber sie war so außer sich, und sie hat mich gebeten, etwas zu unternehmen, damit nicht noch jemand getötet wird.«
»Vielleicht ist im Altenheim etwas vorgefallen? Das hört man immer wieder, überforderte, genervte Pfleger fesseln die armen Leute an die Betten ...«
Clara schüttelte den Kopf. »Nein. Mit dem Heim hat es nichts zu tun. Ich habe Lilly Groman extra danach gefragt.« Sie nippte an ihrem Whisky. »Was hat sie nur damit gemeint, ich solle auf die Zeichen achten? Und was haben Salamander damit zu tun? Das klingt doch wirklich total bescheuert, oder?«, fragte Clara und tippte sich an die Stirn.
»Glaze under the salamander and surround the dish with port jus«, murmelte Mick und sah der dünnen Rauchfahne seiner Zigarette nach, die sich an die Decke ringelte.
»Wie? Wovon sprichst du?« Clara versuchte, sich aus der Tiefe des Sofas aufzurichten, scheiterte aber an Mick, der sie festhielt und näher zu sich heranzog.
»Das ist aus einem Kochrezept. Ist mir gerade eingefallen.«
»Ein Kochrezept? Engländer essen Salamander?« Clara kicherte nervös und trank zur Sicherheit noch einen Schluck von ihrem Whisky. »Also nicht, dass es mich besonders erstaunen würde, aber ...«
»Man sieht, dass du vom Kochen rein gar nichts verstehst. Und von Engländern auch nicht.« Mick zupfte Clara strafend am Ohr. »Salamander ist auch der Name für eine Warmhaltevorrichtung. Mit Heizschlangen, die das Essen von oben wärmen. Und das Rezept spricht von Beef Tournedo. Sehr lecker. Beef, weißt du, das ist Rindfleisch, nicht Molchfleisch ... aua!«
Clara hatte ihn in die Rippen geknufft. »Idiot!«
»Und jetzt ist Schluss mit Salamandern!« Mick nahm ihr das Glas aus der Hand und stellte es auf den Boden. Dann beugte er sich über Clara und küsste sie.
Er stand vor dem Fenster des Pubs und beobachtete, wie die undeutlichen Schemen hinter den bunten Glasscheiben miteinander verschmolzen. So schnell würden sie offenbar nicht herauskommen. Der Regen prasselte unverändert heftig vom Himmel, und seine Schuhe waren so durchnässt, dass er das Gefühl hatte, barfuß durch die Pfützen zu waten. Doch das Haus, in dem sich das Pub befand, hatte glücklicherweise ein kleines Vordach, sodass die Fassade einigermaßen trocken blieb. Vorsichtig schaute er sich um: Kein Mensch war zu sehen. Es war halb drei Uhr morgens, eine gute Zeit. Er nahm die Dosen aus seiner Jackentasche, ging in die Hocke und begann, mit schnellen, geübten Bewegungen zu sprayen. Dazwischen hielt er immer wieder kurz inne und sah sich um, sprungbereit, fluchtbereit. Doch niemand kam. Niemand störte ihn. Es dauerte keine zwei Minuten, und er war fertig. Zufrieden musterte er sein Werk, steckte die Sprühflaschen zurück in seine Jackentasche und verschwand in der regennassen Nacht.
Clara und Mick gingen in dieser Nacht nicht mehr nach Hause. Irgendwann brachte Mick eine Decke, und sie schliefen auf dem alten Sofa ein, eng aneinandergeschmiegt, Elise ausgestreckt vor ihnen auf dem Boden.
Als Clara mit einem Ruck erwachte, wusste sie im ersten Moment nicht, wo sie sich befand. Durch die bunten Glasfenster am anderen Ende des Raumes fiel helles Sonnenlicht und warf grüne und rote Streifen auf die aufgestellten Stühle und den ausgetretenen Holzboden. Sie lag am äußersten Rand des Sofas, und hätte Mick sie nicht noch immer im Arm gehalten, wäre sie längst heruntergefallen. Die große Wanduhr, die Big Ben nachempfunden war, zeigte halb neun. Glücklicherweise war heute Samstag. Clara befreite sich vorsichtig aus Micks Umarmung und sammelte ihre Kleider zusammen. Als sie sich anzog, wurde sie ein wenig rot bei dem Gedanken, dass sie tatsächlich auf der Bühne des Pubs miteinander geschlafen hatten und vor den Fenstern noch nicht einmal Vorhänge waren. Doch die bunten Scheiben waren dick und gewölbt, vermutlich konnte man von außen gar nichts erkennen. »Who cares?«, würde Mick sagen und grinsen.
Clara ging in den Schankraum, schaltete die große Espressomaschine ein und öffnete alle Fenster. Elise war ebenfalls aufgewacht und tapste hinter ihr her. Clara stellte ihr eine Schüssel Wasser hin und holte aus dem Vorratsraum die Tüte Hundefutter, die Mick immer für Elise bereithielt. Dann machte sie sich einen Kaffee.
Es war nicht ratsam, Mick um diese Zeit zu wecken. Er würde außer unwilliger Grunzlaute nichts zu ihrer Unterhaltung beitragen können. Sie setzte sich mit ihrer Tasse auf die Fensterbank, ließ die Füße baumeln und sah hinaus, während sie in kleinen Schlucken von dem heißen, starken Kaffee trank. Die Regenwolken von gestern hatten sich verzogen, und der Himmel war von einem tiefen, strahlenden Blau. Herbstblau. Die Häuserfassaden wirkten wie frisch gewaschen, und der noch feuchte Asphalt begann langsam im Licht der Sonne zu trocknen. Aus der Bäckerei gegenüber drang ein verführerischer Duft nach frischem Brot. Clara holte ihren Geldbeutel und ging hinüber, kaufte Brezen, Semmeln und vier Croissants. Zwei davon waren für Elise reserviert, die neben ihr wartete, die schnuppernde Nase freudig erhoben.
Die junge Verkäuferin trank mit ihrer Kollegin nach Feierabend oft ein Bier im Pub, weshalb Clara sie kannte. Jetzt deutete sie mit dem Kinn hinüber. »Das ist wirklich eine Sauerei«, sagte die junge Frau mitfühlend. »Wir haben auch schon mal solche Schmierereien gehabt. Die gehen so schwer wieder weg.«
»Was meinen Sie?«, fragte Clara verständnislos.
»Na, des greislige Viech da.« Die Verkäuferin deutete auf das Murphy’s.
Clara wandte den Blick in die gleiche Richtung, und ihr blieb der Mund offen stehen: Auf die Fassade des Murphy’s war unübersehbar mit schwarzer Farbe ein Tier gesprüht worden: ein Salamander.
»Da ... das ...«, stotterte Clara und ließ ihre Tüte fallen.
»Oh, mei! Ich wollt Sie nicht erschrecken!«, sagte die Verkäuferin. »So schlimm ist des auch wieder nicht. Man braucht halt ein spezielles Reinigungsmittel ...«
Clara hob die Tüte auf und stürmte ohne ein weiteres Wort zurück ins Murphy’s. Die Verkäuferin, betrogen um ihren morgendlichen Ratsch, schaute ihr verwundert nach.
Clara riss Mick unsanft aus dem Schlaf. Sie trat ungeduldig von einem Bein aufs andere, während Mick schlaftrunken in seine Kleider stieg, und lief dann wieder hinaus, noch bevor er seine Schuhe gefunden hatte. Sie stand mit verschränkten Armen vor der Wand, als Mick, noch immer nicht ganz wach, herauskam. »Was ist denn los? Bist du verrückt geworden?«, rief er ihr wütend zu, doch Clara deutete nur stumm auf die Zeichnung.
Mick folgte ihrem Finger und schüttelte ungläubig den Kopf. »Was zum Teufel hat das zu bedeuten?«
Clara sah ihn an. Sie war blass geworden. »Ich habe keine Ahnung«, sagte sie leise.
»Das kann kein Zufall sein!« Clara und Mick saßen vor ihrem Frühstück. Während Mick sich den Appetit nicht verderben ließ, pflückte Clara nur unentschlossen an ihrem Croissant herum und ließ dann und wann einen Fetzen in Elises erwartungsvolles Maul fallen. »Wir haben gestern Abend noch davon gesprochen und heute Morgen dann das!« Clara schauderte. »Das ist unheimlich!«
»Hm. Zumindest merkwürdig«, gab Mick kauend zu.
»Vielleicht sollte ich zur Polizei gehen.«
»Aber was willst du denen denn sagen? Das ist doch viel zu absurd.«
Clara nickte. »Du hast recht. Aber ich könnte zu Gruber gehen. Der wird mich wenigstens nicht auslachen.«
»Meinst du?«, fragte Mick zweifelnd.
Walter Gruber lachte sie nicht aus. Zumindest nicht gleich.
Clara und der Kriminalkommissar kannten sich schon einige Jahre, und aus tiefer beiderseitiger Abneigung hatte sich mit der Zeit eine echte Freundschaft entwickelt – vor allem, seit Clara Gruber geholfen hatte, als dieser unter Verdacht geraten war, seine eigene Frau getötet zu haben. Doch deswegen war er noch lange nicht von Claras Geschichte überzeugt.
»Bist du sicher, dass dieses Graffiti nicht schon am Abend zuvor da war?«, fragte er skeptisch.
»Hundertprozentig sicher. Erst am nächsten Morgen, nachdem wir darüber geredet hatten. So als ob jemand davon gewusst hätte ...«
»Könnte euch jemand belauscht haben?«
Clara schüttelte den Kopf. »Es war niemand mehr da. Das Pub war längst geschlossen.«
Gruber seufzte. »Aber besonders aussagekräftig ist das alles nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, was eine alte, demenzkranke Frau aus dem Altersheim mit einem Graffiti zu tun haben sollte. Oder glaubst du, dass sie selbst in der Nacht herumgeistert und die Wände besprüht? Obwohl, wenn ich es mir recht überlege ... Vielleicht hat sie die Spraydosen ja in ihrer Rollatortasche versteckt.« Er grinste.
Clara schnaubte empört. »Wenn du mich nicht für voll nimmst, kann ich ja wieder gehen!«
Gruber schüttelte, noch immer lächelnd, den Kopf. »Würde ich mich nie trauen. Doch was soll ich deiner Meinung nach tun? Ihr könnt Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt erstatten ...«
»Und Lilly Gromans Aussage?«
»Dass Menschen verschwinden und du auf Salamander achten sollst?« Er winkte ab. »Bei allem Respekt, Clara, aber das ist doch keine Aussage!«
»Ja, aber die Zeichnung ...«
»... hat sich irgendein Jugendlicher ausgedacht, genauso wie tausend andere Schmierereien auch.« Er warf einen Blick auf das Foto, das Clara mit ihrem Handy gemacht hatte. »Wer sagt denn, dass das unbedingt ein Salamander ist? Das könnte auch ein Gecko sein oder ein Krokodil oder Grisu, der kleine Drache ...« Sein Grinsen wurde breiter.
»Und ich habe Mick noch gesagt, du würdest mich sicher nicht auslachen!«, sagte Clara und warf ihm einen wütenden Blick zu.
Gruber wurde ernst. »Ich lache dich auch nicht aus. Ich will dich nur beruhigen. Das ist eine dumme Schmiererei, sonst nichts.«
Er tippte etwas auf der Computertastatur und deutete dann auf den Bildschirm. »Schau, es gibt weder aktuelle Vermisstenanzeigen noch ungeklärte Todesfälle.«
Clara seufzte. »Und wenn doch etwas passiert? Frau Groman meinte, es würde noch jemand getötet werden, wenn ich nichts unternehme.«
»Clara! Hörst du mir zu? Es wurde niemand getötet, und es wird auch niemand getötet werden! Deine Frau Groman hat wahrscheinlich nur einen Fernsehkrimi zu viel gesehen.«
Clara nickte beschämt. »Du hast recht. Das ist wirklich Blödsinn.« Sie stand auf. »Danke, dass du mir trotzdem zugehört hast. Und das an einem Samstag!«
Gruber winkte ab. »Wenn dein Besuch das Schlimmste daran war, dann bin ich ganz zufrieden mit meinem Wochenenddienst.«
Clara ging durch die samstäglich stillen Flure des Präsidiums und versuchte vergeblich, den Rest Unbehagen abzuschütteln, den auch Grubers Worte nicht hatten vertreiben können. Immer wieder sah sie Lilly Gromans erregtes Gesicht vor sich, ihre aufgerissenen Augen, fühlte den harten Griff ihrer Finger an ihrem Arm. War alles nur Unsinn? Hatte sich die alte Frau tatsächlich nur etwas eingebildet? Immerhin war sie deswegen sogar zu ihr gekommen. Clara verzog zweifelnd das Gesicht. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie Lilly Groman herausgefunden haben sollte, wo genau ihre Kanzlei lag. Clara hatte Frau Groman bisher immer nur im Altenheim getroffen. Andererseits hatte die alte Dame seit Jahrzehnten in der Gegend gewohnt. Vielleicht gab es lichte Momente, in denen sie sich mühelos an die Straßen ihres Viertels und der Umgebung erinnerte?
Ein Anruf von Mick holte sie aus ihren Gedanken zurück. Er hatte eine Vertretung für das Pub organisiert und schlug vor, einen Ausflug in die Berge zu machen. Mick liebte alles, was kahl und schroff und hoch war, und hätte am liebsten jede freie Minute im Gebirge verbracht. Clara war von Kraxeleien und schweißtreibenden Wanderungen weniger angetan, ebenso Elise, was Clara als willkommene Ausrede diente. Meistens gelang es ihnen, sich auf einen Kompromiss zu einigen, bei dem sie zuerst ein bisschen im flachen Gelände herumwanderten und Clara und Elise dann auf der Terrasse irgendeines gemütlichen Gasthofs warteten, bis Mick von seinen Höhenwanderungen zurückkam. In der Zwischenzeit gönnte sie sich ein Weißbier und ließ sich die Sonne ins Gesicht scheinen.
Sie trat aus dem Polizeigebäude und warf einen Blick zum Himmel. Dünne Nebelschwaden waren heraufgezogen und verdeckten bereits die Sonne, die nur noch eine matt glänzende Scheibe hinter dem dichter werdenden Grau war. Wahrscheinlich würde der Nebel das ganze Wochenende über der Stadt hängen. Bei diesen Aussichten fiel es nicht schwer, Micks Vorschlag zuzustimmen, und sie einigten sich nach einigem Hin und Her darauf, nach Südtirol zu fahren und keine, wirklich keine große Wanderung zu unternehmen, sondern stattdessen Schlutzkrapfen und Kastanien zu essen und vielleicht einen Abstecher nach Bozen zu machen, um ein bisschen shoppen zu gehen.
Als Clara auflegte, fiel ihr Blick auf einen jungen Mann mit Kapuzenshirt, der an der Hausmauer gegenüber dem Präsidium lehnte und zu ihr herübersah. Sie konnte sein Gesicht im Schatten der Kapuze nicht erkennen, doch etwas an seiner Haltung ließ sie stutzig werden. Er stand verkrampft da, leicht vornübergebeugt, als ob er Schmerzen hätte, doch gleichzeitig schien er sie zu beobachten. Clara runzelte die Stirn und blieb stehen. Kannte sie ihn? Er hatte die schlaksige, hoch aufgeschossene Gestalt eines Jugendlichen, trug ausgefranste Jeans und Turnschuhe mit dünnen Sohlen. Seine Hände waren in den Taschen seiner Jacke vergraben. Sie machte unentschlossen ein paar Schritte auf ihn zu, überlegte es sich dann jedoch anders und bog in die Fußgängerzone ein. An der Ecke drehte sie sich noch einmal um: Von dem Jungen war nichts mehr zu sehen.
Er starrte der Frau aus dem Schatten des Hauseingangs heraus nach. Sie war bei der Polizei gewesen. Was hatte er nur getan? Seine Finger bohrten sich in die Innenseiten seiner Handflächen, und er schnappte unwillkürlich nach Luft.
Den Verrätern bleibt nichts als der Tod.
Die Stimme flüsterte in seinem Kopf, und er sprach die Worte nach, während er gebeugt in dem engen Hauseingang lehnte. Seine Beine begannen zu zittern, und er überlegte, dass er sich noch ein paar Tabletten besorgen musste. Sonst hielt er es nicht aus. Seine Kiefer waren so angespannt, dass ihm die Zähne schmerzten, und es gelang ihm nicht, sie zu lösen. Er schüttelte eine Zigarette aus der Packung und schob sie sich zwischen die Lippen. Es half, seine Zähne lockerten sich ein wenig. Tief inhalierte er den Rauch und dachte daran, wie gut es täte, ein bisschen Shit zu rauchen. Doch er hatte geschworen, davon nichts mehr anzurühren. Also blieben ihm nur die Zigaretten und ab und zu eine Packung Diazepam. Er stellte sich vor, wie das Nikotin in sein Gehirn schoss und die Adern verengte. Er stellte sich vor, wie es ihm die Angst nahm. Doch es klappte nicht. Es reichte nicht.
DREI
»Sie waren immer zu zweit. Immer hat der große Bub den Kleinen an der Hand geführt. Ich meine, das ist doch auch nicht normal, wenn ein großer Bub sich so um seinen kleinen Bruder kümmert. Normale Kinder gehen doch zum Fußballspielen oder so. Die haben auch nie gelacht. Und ganz blass waren sie.«
Zeugenaussage Leichensache Wolfsberg1. November 1998
Als Clara am Montagmorgen die Post vom Wochenende durchsah, fiel ihr ein Briefumschlag aus teurem cremefarbenem Papier auf, der zwischen den Rechnungen hervorleuchtete. Die Adresse ihrer Kanzlei war von Hand geschrieben, und als Absender trug der Brief den Stempel der Universität München. Neugierig riss Clara den Umschlag auf. Es war eine Einladung: Die Stadt München und die Ludwig-Maximilians-Universität luden zur festlichen Übergabe eines archäologischen Fundstückes, das während der Grabungsarbeiten des Tunnels am Luise-Kiesselbach-Platz gefunden worden war und das nun der archäologischen Staatssammlung übergeben werden sollte. Clara hatte flüchtig darüber in der Zeitung gelesen. Offenbar war der Fund, über den im Frühsommer seitenlang berichtet worden war, eine Sensation. Clara kannte sich in frühzeitlicher Geschichte überhaupt nicht aus, und es hatte sie auch noch nie interessiert. Interessant fand sie allerdings, dass man sie eingeladen hatte. Der Festakt sollte bereits heute Abend stattfinden. Sie sah sich den Umschlag noch einmal an. Er war am Samstag abgestempelt worden. Offenbar hatte man sich in letzter Minute auf sie besonnen. Aber wer? Sie kannte niemanden an der Universität, das war immer Willis Domäne gewesen. Erst jetzt fiel ihr auf, dass der Einladung eine Visitenkarte beigefügt war. Clara las neugierig den Namen: Priv.-Doz. Dr. Marcel Ringgenberg. Institut für Altertumsforschung. In kleiner schnörkeliger Handschrift stand auf der Rückseite der Karte:
Nachdem ich Sie telefonisch nicht erreichen konnte, hier die schriftliche Einladung. Ich hoffe, Sie zusammen mit Ihrer Kollegin am Montagabend im alten Rathaus begrüßen zu dürfen!
Herzlichst,
Ihr Dr. Ringgenberg
Damit war das Rätsel gelöst. Natürlich war Willi gemeint gewesen. Offenbar kannte er diesen Herrn Ringgenberg persönlich. Clara glaubte sogar, sich düster erinnern zu können, dass Willi einmal ein umfangreicheres rechtliches Gutachten für jemanden aus der Universität angefertigt hatte. Dabei war es um irgendwelche Ansprüche einer Forschungsabteilung, um abstruse Scherbensammlungen und Fliesenstücke gegangen. Probleme der Art, die Willi geliebt hatte, wie Clara sich wehmütig erinnerte. Je verworrener und abwegiger ein Rechtsgebiet gewesen war, desto begeisterter hatte sich ihr Kollege der Sache angenommen. Clara steckte die Einladung an den Wandkalender und beschloss, am Abend hinzugehen. Möglicherweise ließen sich alte Kontakte erneuern, vielleicht sprang sogar ein neues Mandat heraus. Den klammen Kanzleifinanzen täte es jedenfalls gut, und dafür wäre Clara sogar bereit, sich um die Besitzrechte am Schwanzknochen eines Eichhörnchens aus der Bronzezeit zu streiten – falls es damals überhaupt schon Eichhörnchen gegeben hatte.
Clara schaltete alle Lichter, die Kaffeemaschine und ihren PC ein und gab dem Kaktus auf dem Fensterbrett, der als einzige Zimmerpflanze Lindas Weggang überlebt hatte, etwas Wasser. Blumen waren nichts für Clara. Sie konnte mit ihnen nicht umgehen. Genau genommen war ein Kaktus aber keine Blume, vielleicht hielt er es deshalb so lange bei ihr aus. Sie betrachtete ihn nachdenklich. Er wuchs kaum, hatte weder Blätter noch Blüten und überstand lange Trockenperioden ohne sichtbare Probleme. Er war weder schön noch besonders exotisch. Einfach ein runder, dicker Kaktus mit höllisch spitzen gelben Stacheln, die in einem perfekten Reihenmuster angeordnet waren. Sie goss noch ein wenig Wasser um den Rand herum und sah aus dem Fenster. Wie sie vorhergesehen hatte, war der Hochnebel seit Samstag nicht mehr gewichen. Die Stadt sah grau und leblos aus.
In Südtirol war der Himmel blau gewesen. Sie waren durch die Weinberge spaziert, hatten roten, leichten Wein getrunken und am Abend so viel gegessen, dass sie wie tot in die Betten gefallen waren. Clara dachte daran, dass Mick ihr von dem Fluss erzählt hatte, an dem er aufgewachsen war, davon, wie flach die Landschaft um Newcastle herum war und wie das Land in South Shields unvermittelt wie abgebrochen am Meer endete. Er hatte ihr erzählt, wie sich die Stadt in den letzten Jahren verändert hatte, wie modern sie geworden war und wie er jedes Mal, wenn er dorthin kam, etwas Neues entdeckte und etwas Altes nicht mehr wiederfand. Clara hatte nur mit halbem Ohr zugehört. Sie war zu sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt gewesen. Jetzt fiel ihr das Gespräch aber wieder ein, und sie fragte sich, wieso Mick plötzlich dieses Thema angeschnitten hatte. Er sprach so selten von zu Hause, dass Clara immer der Ansicht gewesen war, er dachte kaum daran. Womöglich war das ein Irrtum. Clara zündete sich eine Zigarette an und wandte sich vom Fenster ab. »Carry coals to Newcastle«, murmelte sie leise. Die englische Redewendung war so ziemlich das Einzige, was sie über die einstige Kohlenstadt wusste, aus der Mick stammte, und bedeutete so viel wie »Eulen nach Athen tragen«. Der Gedanke daran deprimierte sie unerklärlicherweise, und sie wischte ihn mit einer wütenden Handbewegung zur Seite. Es war Zeit, mit der Arbeit zu beginnen.
»... und so habe ich die große Ehre, Ihnen, verehrte Gäste, nun diese Kostbarkeit zu enthüllen, die seit mehr als zweitausend Jahren tief unten in den Eingeweiden unserer Stadt verborgen war und nun so unerwartet wieder ans Tageslicht kam. Meine lieben Münchner und Münchnerinnen, heute ist ein großer Tag für uns und unsere Stadt ...«
Clara nippte an ihrem Glas Prosecco und reckte den Kopf. Sie stand im Rathaussaal inmitten der Festgäste, von denen die meisten sie um ein gutes Stück überragten, und versuchte, einen Blick auf die Kostbarkeit zu erhaschen, die dort vorn noch von einem Tuch verhüllt auf einem Sockel ruhte. Besonders groß schien sie nicht zu sein. Daneben standen der Bürgermeister und der Kurator der archäologischen Staatssammlung, der über das ganze Gesicht strahlte, und beide hoben jetzt mit einer bedeutungsvollen Geste das Tuch. Ein ehrfurchtsvolles Raunen ging durch das Publikum. Auf dem Sockel stand – effektvoll beleuchtet – ein bauchiger Silberkessel, innen und außen reich mit Mustern und Motiven verziert, die Clara aus der Ferne nicht erkennen konnte. Sie kniff die Augen zusammen.
Jemand neben ihr reichte ihr einen Zettel. »Da können Sie es besser sehen«, meinte er und zwinkerte ihr aus winzigen, runden Brillengläsern zu.
Clara bedankte sich lächelnd bei dem Mann, dessen wirre graue Lockenpracht und offensichtliche Kurzsichtigkeit ihn wie einen Gelehrten aus dem Bilderbuch erscheinen ließen, und schlug das kleine Faltblatt auf, das offenbar irgendwo auslag und das sie übersehen hatte. Sie hatte gerade die Beschreibungen der einzelnen Motive zu lesen begonnen, die den Kessel zierten, als lautes Klatschen das Ende des offiziellen Teils der Veranstaltung verkündete und damit den Run auf das Büfett eröffnete. Sie nutzte die plötzliche Verlagerung der Aufmerksamkeit, um sich das gefeierte Fundstück aus der Nähe anzusehen. Der Kessel war aus mehreren dünnen Einzelplatten gefertigt, die allesamt mit merkwürdigen Gestalten verziert waren: Ein sitzender Mann mit Hörnern hielt eine Schlange in der Hand, die ebenfalls Hörner hatte. Dann gab es Hirsche, weitere Schlangen, Hunde, einen Stier, Soldaten und eine weibliche Figur mit einem großen Rad in der Hand und einem Drachen an ihrer Seite. Clara runzelte die Stirn und blätterte in dem Faltblatt.
»Fantastisch, nicht wahr?« Der Mann mit den wirren Haaren, der ihr zuvor das Informationsblatt gegeben hatte, gesellte sich zu ihr. Er deutete mit einem langen, dünnen Finger auf den gehörnten Mann mit der Schlange. »Dieser Cernunnos ist noch filigraner gearbeitet als der auf dem Kessel von Gundestrup, finden Sie nicht auch?« Seine Stimme war weich und melodisch und hatte einen leichten Schweizer Akzent.
»Äh, ja, sehr schön«, gab Clara unsicher zurück. »Ich kenne mich in solchen Dingen leider nicht besonders gut aus ...« Sie schielte hilfesuchend auf das Blatt in ihren Händen.
»Ein nahezu identischer Kessel wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Gundestrup in Dänemark gefunden«, half ihr der Mann freundlich weiter. »Es war damals eine Sensation. Ähnlich wie jetzt dieser Fund.« Er reichte ihr die Hand. »Mein Name ist Ringgenberg. Ich arbeite hier am archäologischen Institut an einem Forschungsprojekt über keltische Kunst.«
»Clara Niklas. Ich bin Rechtsanwältin.« Jetzt erst fiel ihr der Name auf. »Dr. Marcel Ringgenberg? Sie haben die Einladung an die Kanzlei geschickt, nicht wahr? Niklas und Allewelt ...«
»Oh, ja, ja! Dann sind Sie der Kompagnon von Willi?«
Clara gefiel, wie er das Wort Kompagnon aussprach. Er war definitiv Schweizer. »Ja. Das heißt, ich war es. Jetzt bin ich allein in der Kanzlei. Willi ist letztes Jahr nach Brüssel gegangen.«
»Ich habe mich schon gewundert, warum er heute nicht gekommen ist.« Ringgenberg sah sich um, als hoffte er trotzdem, Willi noch irgendwo zu erblicken. Dann wandte er seine Aufmerksamkeit wieder Clara zu. »Er hat mir nie erzählt, wie hübsch und charmant seine Kollegin ist.« Ringgenberg zwinkerte ihr erneut zu, und Clara stellte fest, dass er bei weitem nicht so alt war, wie die Brille und sein etwas exzentrisches Äußeres auf den ersten Blick vermuten ließen.
Sie lächelte und deutete auf den Kessel. »Dann können Sie mir sicher erzählen, was das alles bedeutet?«
Ringgenberg nickte, offensichtlich erfreut, dass sie ihn danach fragte. »Ich kann Ihnen gerne die Details ein wenig erläutern. Dann ergibt auch alles einen Sinn.« Er deutete erneut auf den Mann mit Hörnern. »Cernunnos, der keltische Gott der Dunkelheit und des Winters. Sein Symbol waren der Hirsch und die gehörnte Schlange.«
»Und der hier?« Sie deutete auf einen weiteren Mann, den sie gerade entdeckt hatte: Er hielt ein Kind kopfüber an einem Fuß fest und war offensichtlich dabei, es in einen Kessel zu werfen. »Was hat das zu bedeuten?« Clara musterte den Kessel kritisch. »Ist das ein Menschenopfer oder so etwas?«
Ringgenberg zögerte. »Das ... ist ein uralter keltischer Mythos ...«
»Marcel Ringgenberg, wie immer dabei, alles den Kelten in die Schuhe zu schieben, nicht wahr?«
Ein weiterer Besucher war zu ihnen getreten, ein alter, weißhaariger Herr im dunklen Anzug und mit Krawatte, der sich mit seiner knotigen Hand schwer auf einen Stock stützte. Am kleinen Finger trug er einen protzigen Siegelring mit einem schwarzen Stein.
Ringgenberg musterte ihn finster. »Um Ihre Meinung hat hier niemand gebeten.«
Der andere ging nicht darauf ein, sondern wandte sich mit einer knappen Verbeugung Clara zu. »Darf ich mich vorstellen? Professor Dr. Friedrich Hagenfeld. Ich habe zufällig Ringgenbergs Ausführungen zu dem Fund mit angehört und kann diese nicht unwidersprochen lassen.« Er lachte heiser. Ringgenberg drängte sich dazwischen. »Ich glaube nicht, dass die Dame Interesse an unseren Disputen hat ...«
»Nein, eigentlich nicht ...«, pflichtete Clara ihm unbehaglich bei, doch der alte Mann wischte die Einwände mit einer herrischen Geste beiseite.
»Natürlich ist dieser Kessel nicht keltischen Ursprungs, wie es immer wieder behauptet wird. Das habe ich schon in meinem Aufsatz von 1972 über den Kessel aus Gundestrup ausführlich dargelegt, und dieser neue Fund, hier, so tief im Süden, beweist meine These, dass es sich um einen Opferkessel der Kimbern und Teutonen handelt, die auf dem Weg über die Alpen waren ...«
»Das ist doch völliger Quatsch!«, unterbrach ihn Ringgenberg erbost, und seine Locken über der Stirn zitterten vor Erregung. »Die gesamte Symbolik ist keltisch, es steht doch völlig außer Zweifel, dass dieser Kessel ein keltischer Kultgegenstand ist ...«
»Papperlapapp!« Der alte Mann schüttelte eigensinnig den Kopf. »Die germanischen Stämme hatten längst die Kelten überlagert. Es sind die Germanen, verstehen Sie! Die Germanen!« Der alte Professor war jetzt laut geworden, und einige Besucher schauten neugierig zu ihnen herüber. Clara fand, dass dies der richtige Zeitpunkt war, um sich aus der Diskussion, zu der sie ohnehin nichts beizutragen hatte, zurückzuziehen. Höflich lächelnd trat sie einen Schritt zurück, und nachdem keiner der beiden Männer sie beachtete, ging sie, ohne sich zu verabschieden. Mit zwei Lachsbrötchen vom fast leer gefegten Büfett verließ sie schnellen Schrittes die Veranstaltung.
Der Abend war kühl. Wie ausgestorben lag der Marienplatz im Licht der Straßenlaternen. Nur vereinzelt schlenderten noch ein paar späte Touristen umher, und aus der Fußgängerzone war das laute Lachen einer Gruppe Jugendlicher zu hören. Clara ging in Richtung Viktualienmarkt und dann weiter hinunter zur Isar.
Der Fluss strömte ruhig und dunkel unter der Reichenbachbrücke dahin, und ein paar flackernde Lichter auf den Sandbänken zeigten an, dass der plötzliche Kälteeinbruch die Jugendlichen, die sich dort unten während der Sommermonate regelmäßig versammelt hatten, noch nicht völlig hatte vertreiben können. Leises Murmeln drang herauf, ab und zu ein plötzliches Auflachen. Clara hörte das Klirren von Flaschen und dann einen dumpfen Schlag, gefolgt von einem leisen Zischen; offenbar war eine Flasche zu Bruch gegangen.
Als Clara kurz danach in ihre von Kastanien gesäumte Straße einbog, löste sich wenige Meter vor ihr eine Gestalt aus dem Schatten eines Baumes. Sie blieb einen Augenblick reglos stehen, starrte Clara unverwandt an und verschwand dann ebenso schnell, wie sie aufgetaucht war, wieder in der schützenden Dunkelheit der kleinen Anlage zwischen Flussufer und Straße. Clara, die erschrocken stehen geblieben war, konnte nur noch eine schwarze Silhouette erkennen, die sich lautlos von ihr fortbewegte, dann wurde auch diese von der Nacht verschluckt.
Langsam ging Clara weiter, die Augen angestrengt in das Dunkel gerichtet. Sie konnte nichts erkennen, nur der Fluss hob sich auf der anderen Seite etwas heller gegen die schwarzen Bäume ab. Wo war die Gestalt hingelaufen? War sie überhaupt weg, oder lauerte sie noch in der Dunkelheit? Kauerte jemand im Schatten und beobachtete sie? Clara drehte sich langsam um. Die Straße war um diese Zeit menschenleer. Die Fenster der Häuser auf der gegenüberliegenden Seite waren dunkel. Ihr Nacken begann zu kribbeln, und sie zwang mit Mühe den Impuls nieder, einfach loszurennen. Schritt für Schritt ging sie weiter, überquerte an der Ecke die stille Straße und erschrak dabei über das laute Geräusch, das ihre Schuhe auf dem Asphalt machten. Als sie die schützende Häuserzeile erreicht hatte, wurde sie schneller, und jetzt klangen ihre Schritte nach Flucht, hallten an den Wänden wider und jagten ihr noch mehr Angst ein. Sie rannte durch den Torbogen ihres Hauses, sperrte mit zitternder Hand die Haustür auf und schloss sie dann hastig hinter sich. Das Licht im Treppenhaus surrte wie immer, und aus der Hausmeisterwohnung drang noch der leichte Geruch nach Grillhähnchen und Pommes frites. Irgendwo im Obergeschoss war Musik zu hören. Erleichtert atmete Clara auf und stieg die Stufen zu ihrer Wohnung hinauf. Hinter der Tür ertönte Elises freudiges Bellen.
VIER
»In der Schule war der Bub unauffällig. Nicht gut, nicht schlecht. Ganz still und angepasst. Aber er hatte etwas Merkwürdiges an sich.«
Zeugenaussage Leichensache Wolfsberg1. November 1998
Er hatte es schon oft gehört, doch der erste Schrei kam immer überraschend. Er fuhr ihm in die Knochen und ließ ihn erstarren. Selbst wenn er gewollt hätte, hätte er in diesem Moment nicht ausschalten können. Doch er wollte nicht. Er musste es sich anhören. Immer und immer wieder. Es war kein menschlicher Schrei mehr. Er drückte nicht einmal mehr Angst aus, nur noch Schmerz. Es war der letzte Schrei vor dem Tod.
Er ließ die Aufnahme noch einmal von vorn laufen und zuckte erneut zusammen, als der gellende Ton kam. Irr, irr vor Schmerz. Tränen stiegen ihm in die Augen. Dieser Laut rührte etwas ganz tief in ihm. Es war da, meistens ruhig, doch manchmal bewegte es sich. Es war wie eine Erinnerung an etwas, doch er wusste nicht, woran. Und er konnte es auch nicht lange genug festhalten, um es herauszufinden. Solo hatte von Déjà-vu-Erlebnissen gehört, Dingen, an die sich Menschen erinnerten, obwohl es in Wirklichkeit gar nicht möglich war, weil sie noch nie an dem erinnerten Ort oder in der erinnerten Situation gewesen waren. Ihm ging es auch so. Ein Geräusch, ein bestimmter Geruch, ein paar aufgeschnappte Wortfetzen, und es begann sich in ihm eine vage Ahnung zu regen, dass er dies schon einmal gehört, gerochen, gesehen hatte. Ganz leise nur, kaum spürbar, dann wischte er das Gefühl immer schnell beiseite, denn wenn er es nicht tat, dann kam die Angst. Dieses Monster aus der Tiefe, das ihn packte, wenn er nicht damit rechnete, und das nur zu besänftigen war, wenn es Blut sah. Eine Träne tropfte auf das Display seines Handys, wo grünliche undeutliche Schemen das Grauenhafte andeuteten, was geschehen war.
»Ich bin der Todbegleiter«, flüsterte Solo und lauschte auf die grausigen Geräusche und schließlich das letzte, erstickte Wimmern. Er schaltete aus und krümmte sich, als müsse er sich übergeben. Seine zu Fäusten geballten Hände bohrten sich in seine Magengrube.
Den Verrätern bleibt nichts als der Tod ... den Verrätern bleibt nichts als der Tod ... den Verrätern bleibt nichts als der Tod ...
Die Zimmertür öffnete sich so überraschend, dass er vor Schreck zusammenfuhr.
»Da bist du ja!« Frank stand in der Tür. Offenbar war er nach Hause gekommen, ohne dass Solo ihn gehört hatte. »Ich hab gerufen ...« Er warf einen Blick auf Solos gekrümmte Haltung. »Was ist los?« Er kam ein paar Schritte auf ihn zu.
Solo wich zurück. Schweiß hatte sich auf seiner Oberlippe gesammelt. »Kannst du nicht anklopfen?«, zischte er wütend.
»Hey, tut mir leid, ich dachte, du wärst gar nicht da.« Frank blieb stehen. »Ich warne dich, wenn du wieder mit dem Scheiß anfängst ...«
»Verpiss dich!«
Frank hob die Arme. »Schon gut.« Er ging und schloss die Tür nachdrücklich hinter sich.
Solo stöhnte leise auf. Er holte das Handy aus seinem Hosenbund und schob es unter die Matratze seines Betts. Er konnte Frank im Flur herumgehen hören: Zuerst zog er seine Schuhe aus, dann ging er in die Küche, öffnete den Kühlschrank, machte ihn wieder zu und ging dann in sein Zimmer. Die Tür schloss sich mit einem kurzen Schnappen. Wenig später ertönte gedämpfte Musik.
Solo fühlte sich unsagbar elend. Sein Bruder war immer für ihn da gewesen, seit er denken konnte. Solo konnte sich sogar erinnern, wie er ihn zum ersten Mal in den Kindergarten gebracht hatte:
Sie gingen zusammen eine lange, öde Straße hinunter. Es regnete an dem Tag, und er trug gelbe Gummistiefel. Frank hielt ihn fest an der Hand, musste ihn hinter sich herziehen, weil er Angst davor hatte, in den Kindergarten zu gehen. Er war froh, dass es wenigstens regnete, weil er dann Gummistiefel anziehen durfte. Er konnte sich nämlich die Schuhe noch nicht selbst binden. Niemand hatte es ihm bisher gezeigt. Doch Frank hatte ihm versprochen, es ihm bald beizubringen, denn so etwas musste man im Kindergarten können.
Das Haus, in dem sich der Kindergarten befand, war rosa gestrichen, und es roch nach nassen Kindern und Früchtetee. Während Frank mit der Erzieherin redete, starrte Solo auf seine Gummistiefel. Er musste sie ausziehen und unter eine Bank stellen, wo sie eine schmutzige Pfütze auf dem Boden bildeten. Anders als die anderen Kinder hatte er keine Hausschuhe dabei. Er hatte noch nie welche besessen. Seine Socken waren nass, und eine Socke hatte vorn ein Loch, durch das zwei Zehen passten. Die Erzieherin nahm ihn bei der Hand und führte ihn in ein Zimmer, in dem ihm tausend Kinder entgegenstarrten. Frank war weg. Solo war allein. Mit all den fremden Kindern, die ihn anstarrten.
Doch Frank würde wiederkommen.
Er würde ihn wieder abholen.
Er würde ihn nicht hier zurücklassen.
Daran dachte er, während die Erzieherin ihn auf einen kleinen Stuhl setzte und ihm ein Puzzle hinschob. Er nahm ein Teil davon in die Hand und hielt es ganz fest, während die Kinder um ihn herum aufsprangen und herumzutoben begannen. Und während die Kanten des Puzzleteils schmerzhaft in seine Handfläche drückten, dachte er unablässig daran, dass Frank kommen und ihn wieder abholen würde.
Den Verrätern bleibt nichts als der Tod ... den Verrätern bleibt nichts als der Tod ... den Verrätern bleibt nichts als der Tod ...
Solo ließ sich auf das Bett fallen und schloss die Augen. Vielleicht konnte er ein bisschen schlafen. Eine Stunde wenigstens.
Der nächste Tag begann so trüb, wie der vorige aufgehört hatte. Die Stadt schien im schmutzigen Nebelgrau erstarrt, das alle Farben aufsaugte. Die Bäume entlang der Isar verloren sich darin ebenso wie die Häuser auf der gegenüberliegenden Uferseite. Man konnte kaum entscheiden, ob es früher Morgen oder schon Nachmittag war.
Clara überquerte den Fluss am deutschen Museum und bog dann nach rechts ab. Wie eine Decke lag die feuchte Nebelluft über der Isar und stieg nur zögernd nach oben, sodass man das unwirkliche Gefühl hatte, einen Fluss aus zähem weißem Rauch zu überqueren.
Das St. Anna-Stift lag in einer ruhigen Nebenstraße, durch eine Häuserzeile vom Isarufer getrennt. Clara ging mit Elise durch die endlos langen Flure in den Trakt des Gebäudes, in dem Lilly Groman ihr Zimmer hatte. Der gelbe Gang.
Jede Abteilung, jedes Stockwerk war farblich gekennzeichnet, damit die meist demenzkranken Bewohner sich besser zurechtfanden. Passend zu den gelben Handlaufleisten und den gelben Streifen an der Wand gab es hier im ersten Stock großformatige Fotos mit Sonnenblumen, Schlüsselblumen und Butterblumen. Es roch nach Alter und Gebrechen, vermischt mit einem Deodorantduft, der unablässig aus einer kleinen Maschine durch die Flure geblasen wurde und die Illusion frischer Luft verbreiten sollte.
Die Tür zu Lilly Gromans Zimmer war nur angelehnt, doch Clara klopfte trotzdem. Als keine Antwort kam, ging sie zusammen mit Elise, deren Krallen auf dem PVC-Boden leise klackerten, hinein. Unwillkürlich musste Clara lächeln, wie jedes Mal, wenn sie Frau Groman besuchte. Der Kontrast zwischen dem penetrant gelben und trotzdem so traurigen Flur und Lilly Gromans Zimmer war einfach überwältigend. Man wähnte sich nicht mehr länger in einem Altersheim, sondern in einer vornehmen Villa. In einer solchen hatte Lilly Groman als Kind gewohnt, doch nach und nach waren ihre Wohnungen kleiner geworden, und am Ende war nur dieses Zimmer übrig geblieben, eine winzige Insel großbürgerlicher Pracht inmitten zweckmäßiger Tristesse. Seidene Vorhänge hingen an den Fenstern, drapiert mit ockerfarbenen Kordeln. Es gab eine Vitrine aus glänzendem Mahagoniholz, angefüllt mit Kristallgläsern, aus denen niemand mehr trank, und zierlichen Sammeltassen aus Meißener Porzellan. Gegenüber der Anrichte stand ein Bücherregal mit gedrechselten Beinen, in dem sich die Gesamtausgaben von Rilke und Shakespeare mit goldgeprägten Buchrücken befanden. Daneben ein Klappsekretär mit Intarsien, auf dem in silbernen Rahmen Porträts der beiden verstorbenen Ehemänner von Lilly Groman standen.
Das Bett allerdings störte den eleganten Gesamteindruck etwas, es war ein stilloses Krankenbett mit automatisch verstellbarem Lattenrost und einer Notrufvorrichtung an einem stumpfen grauen Kabel. Dies und die Tatsache, dass kein Teppich erlaubt war, waren Anlass ständigen Unmuts von Lilly Groman, die in regelmäßigen Abständen den Hausmeister, oder wen sie dafür hielt, energisch anmahnte, dass nun endlich ihre Teppiche und ihr Bett angeliefert werden sollten.
Lilly Groman lag noch im Bett. Sie trug ein gerüschtes rosa Nachthemd und hatte die Augen geschlossen. Ihre altersfleckigen Hände mit den knallrot lackierten Fingernägeln ruhten entspannt auf der Bettdecke. Clara stellte die Gebäckstücke, die sie mitgebracht hatte, auf dem kleinen Esstisch ab, der in die letzte freie Ecke zwischen Vitrine und Kleiderschrank gezwängt worden war, und berührte Lilly Groman sacht am Arm. Er fühlte sich trocken wie Papier an.
»Frau Groman? Ich bin es, Clara Niklas. Schlafen Sie?«
»Jetzt nicht mehr!«, kam es prompt zurück, und ohne die Augen zu öffnen, fuhr Lilly Groman fort: »Haben Sie das Hundchen mitgebracht?«
»Ja, natürlich.« Clara klopfte auf das Bett, und Elise kam herangetapst und legte schnaufend ihren schweren Kopf auf die Hand der alten Frau.
Lilly Gromans faltiges Gesicht überzog ein Lächeln, und sie öffnete die Augen. »Fein.« Mit Hilfe von Clara richtete sie sich ächzend auf und tätschelte Elise den Kopf. »Ich habe gar nichts für dich«, meinte sie bedauernd.
»Das macht nichts.« Clara deutete auf das Paket. »Ich habe ein Croissant für sie dabei.«
»Croissant? Das ist französisch, oder?« Lilly Groman runzelte die Stirn.
»Ja. Für ein französisches Frühstück!« Clara packte die Croissants und Brioches aus. »Das ist doch genau das Richtige für so einen trübsinnigen Morgen.« Sie gab Elise, die bereits erwartungsvoll den Hals reckte, ein halbes Hörnchen.
»Nun, warum eigentlich nicht?« Lilly Groman schlüpfte verkehrt herum in ihre Hausschuhe. »Sieht jedenfalls ganz ordentlich aus.«
»Kaffee?«, fragte Clara und hob die Thermoskanne vom Nachttisch hoch.
»Nein, danke!« Die alte Frau verzog angewidert das Gesicht. »Das Gesöff kann man nur zum Abspülen verwenden. Ein Piccolöchen wäre mir lieber.« Sie deutete auf den Tisch. Dort standen sorgfältig aufgereiht sechs Piccoloflaschen Sekt.
»Das ist aber ein Service!«, lächelte Clara. Ihr war noch nie aufgefallen, dass Lilly Groman Sekt im Zimmer hatte. »Bekommen Sie die vom Haus?« Sie holte zwei der staubigen Kristallgläser aus der Vitrine und pustete kräftig hinein.
»Vom Haus? Nein, die kaufe ich mir bei Seidlmann um die Ecke. Schon seit dreißig Jahren.«
Seidlmann war ein Feinkostladen in der Straße gewesen, in der Lilly Groman früher gewohnt hatte. In ihrer lückenhaften Erinnerung kaufte sie dort noch immer ein.
Clara verzichtete darauf, sie zu korrigieren, schenkte stattdessen ein und hob das Glas. »Auf Ihr Wohl!«
»Gin, gin«, sagte Lilly Groman und nahm einen kräftigen Schluck.
»Ich wollte mit Ihnen noch einmal über Ihren Besuch bei mir sprechen«, begann Clara zögernd, während sie aßen und Lilly Groman dem überaus dankbaren Hundchen immer wieder Croissantstückchen zusteckte. »Haben Sie noch etwas von dieser furchtbaren Geschichte gehört?«
»Furchtbare Geschichte?«
»Von den Menschen, die verschwinden. Und den Zeichen, auf die ich achten soll. Die Salamander. Erinnern Sie sich?«
Lilly Groman starrte sie an. Sie hatte helle Augen, die wie leuchtend blaue Seen in ihrem alten Gesicht lagen. »Menschen verschwinden ...«, sagte sie. »Ja ...«
Clara zögerte. »Ich habe ... einen Salamander gesehen. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Was bedeutet das alles?«
»Sie sind tot ... alle tot ...« Lilly Groman machte eine hastige Bewegung und stieß dabei gegen den Nachttisch. Das Croissant fiel zur Freude von Elise auf den Boden.
»Wer ist tot?«, wollte Clara beunruhigt wissen.