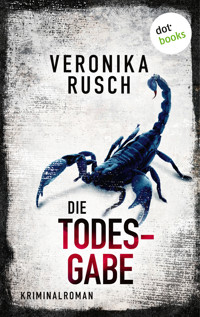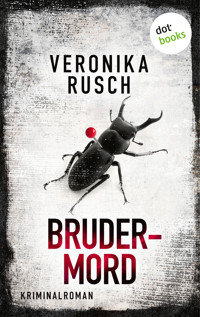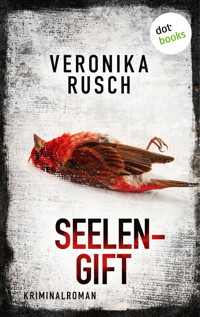9,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Clara Niklas
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ein Routinefall wird zu einem Kampf auf Leben und Tod: Der fesselnde Kriminalroman »Das Gesetz der Wölfe« von Veronika Rusch als eBook bei dotbooks. Wer hat es auf diesen Mann abgesehen? Die Münchner Rechtsanwältin Clara Niklas ist schockiert: Ihr Mandant, der unbescholtene Italiener Angelo Malafonte, wird wegen eines Bagatelldelikts hinter Gitter gebracht – und im Gefängnis brutal zusammengeschlagen. Obwohl der Fall für Clara eigentlich längst vorbei ist, kann sie ihn nicht im Stich lassen. Doch vor wem fürchtet Malafonte sich so sehr, dass er seinen Namen nicht einmal der Anwältin verraten kann, die ihn schützen will? Immer tiefer verstrickt Clara sich in ein Netz aus Gewalt und Verrat. Und plötzlich stehen Menschenleben auf dem Spiel – auch ihr eigenes ... »Ein spektakuläres Krimidebüt, durch und durch fesselnd! Die Serienfigur Clara Niklas ist sympathisch, klug und lebensnah.« Bild am Sonntag Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende Kriminalroman »Das Gesetz der Wölfe« von Veronika Rusch ist der erste Band ihrer Reihe um die Rechtsanwältin Clara Niklas, die Fans von Inge Löhnig und Elisabeth Herrmann begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 621
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wer hat es auf diesen Mann abgesehen? Die Münchner Rechtsanwältin Clara Niklas ist schockiert: Ihr Mandant, der unbescholtene Italiener Angelo Malafonte, wird wegen eines Bagatelldelikts hinter Gitter gebracht – und im Gefängnis brutal zusammengeschlagen. Obwohl der Fall für Clara eigentlich längst vorbei ist, kann sie ihn nicht im Stich lassen. Doch vor wem fürchtet Malafonte sich so sehr, dass er seinen Namen nicht einmal der Anwältin verraten kann, die ihn schützen will? Immer tiefer verstrickt Clara sich in ein Netz aus Gewalt und Verrat. Und plötzlich stehen Menschenleben auf dem Spiel – auch ihr eigenes ...
»Ein spektakuläres Krimidebüt, durch und durch fesselnd! Die Serienfigur Clara Niklas ist sympathisch, klug und lebensnah.« Bild am Sonntag
Über die Autorin:
Veronika Rusch studierte Rechtswissenschaften und Italienisch in Passau und Rom und arbeitete als Rechtsanwältin in Verona sowie in einer internationalen Anwaltskanzlei in München, bevor sie sich selbständig machte. Heute lebt sie als Schriftstellerin wieder in ihrem Heimatort in Oberbayern. Neben Krimis schreibt sie historische und zeitgenössische Romane sowie Theaterstücke und Kurzgeschichten. Ihre Werke wurden mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem 2. Platz im Agatha-Christie-Krimiwettbewerb und dem DELIA-Literaturpreis.
Veronika Rusch veröffentlichte bei dotbooks bereits die Clara-Niklas-Reihe mit den Kriminalromanen »Das Gesetz der Wölfe«, »Brudermord«, »Seelengift« und »Die Todesgabe«.
Die Website der Autorin: www.veronika-rusch.de
Die Autorin bei Instagram: www.instagram.com/veronikarusch
***
eBook-Neuausgabe Juni 2023
Copyright © der Originalausgabe 2008 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Bildern von shutterstock / mayer kleinostheim / WSY imagens / scaiphotography / Here
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-655-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Gesetz der Wölfe«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Veronika Rusch
Das Gesetz der Wölfe
Kriminalroman
dotbooks.
Dieses Buch ist ein Werk der Fiktion. Die Personen, Ereignisse und Dialoge entstammen der Fantasie der Autorin. Jegliche Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen, lebenden oder toten Personen ist rein zufällig.
Für Martin, meinen Leuchtturm
TEIL EINS
»Es sterben für gewöhnlich diejenigen, die allein sind in einem Spiel, das zu groß für sie ist.
Es sterben diejenigen, die nicht über die notwendigen Bündnisse verfügen, die schutzlos sind.«
Giovanni Falcone, sizilianischer Richter und Mafiajäger
† 23.05.1992
ROM, 1999
Die Stadt war ein Monster. Ein Menschen fressendes, bösartiges, schmutzstarrendes Monster. Man hatte es ihr immer gesagt, damals, als sie weggewollt hatte, weg aus der Provinz, weg aus der lähmenden Hitze und dem Staub. Nicht irgendeine Stadt, die Hauptstadt hatte es sein müssen für sie. Das große Leben. Schöne Schuhe hatte sie sich kaufen wollen, mit Riemchen über den Fesseln und hohen Absätzen. Schönere Schuhe als die, die es bei ihr zuhause zu kaufen gab. Und dann, dann war sie tatsächlich weggegangen. Mit knapp zwanzig und voller Träume. Aber nicht in die große Stadt mit den Touristen und dem Papst und all den Geschäften und Cafés. Sie war an einen Ort gegangen, der schlimmer war, als sie sich je einen Platz auf der Welt hätte vorstellen können. Sie war aus Liebe gegangen, aber ihr Ziel war die Finsternis gewesen. Ihre Falle. Der Ort, aus dem es keinen Ausweg gab. Dabei hatten sie es versucht, Raffaele und sie. Sie hatten versucht, glücklich zu sein. Doch sie hatten es nicht geschafft. Die Spinne hatte ihre Fäden immer fester um sie gezogen, so lange, bis sie fast daran erstickten.
Sie stand auf und ging in das Badezimmer, ein elender Verschlag, leer bis auf eine Kloschüssel und ein gesprungenes Waschbecken, über dem ein winziger Spiegel hing. Der Duschkopf ragte aus der Wand frei in den Raum hinein, ein Loch im Boden diente als Abfluss. Die Wand am Fenster war schwarz vom Schimmel, und unter dem Spiegel krochen ebenfalls große grünschwarze Flecken heraus. Kreisrund und pelzig wie kleine Tierchen. Sie starrte sich im Spiegel an. Ihr Gesicht war aufgedunsen, die Lider dick geschwollen. Blondes Haar hatte sie einmal gehabt, früher, glänzendes, honigfarbenes Haar. Jetzt war es stumpf, hatte die Farbe von abgestandenem Bier und hing ihr dünn und leblos ins Gesicht. Doch das interessierte sie nicht. Schon lange nicht mehr. Sie wollte sich in die Augen sehen. Helle blaue Augen, Erbe der Normannen, hatte ihre Mutter immer gesagt und so rätselhaft dabei gelächelt, dass sie irgendwann anfing zu vermuten, der Normanne sei vermutlich eher ein sehr lebendiger Zeitgenosse aus einem Land jenseits der Alpen gewesen.
Ihr Sohn hatte ihre Augen nicht geerbt. Bereits bei der Geburt waren sie schwarz wie Kohle gewesen. Caprisi-Augen. Man braucht vermutlich solche Augen, um dort zu überleben, hatte sie einmal gedacht. Augen, genauso tief und dunkel wie die Finsternis, die sie umgab und der sie zu trotzen versuchten. Lass uns weggehen, hatte sie Raffaele immer wieder gebeten, lass uns woanders hingehen, etwas Neues anfangen. Doch er hatte nie gewollt. Nie gekonnt.
Sie sah sich in die Augen. Wässrig blau. Stumpf wie ihre Haare waren sie geworden, längst nicht mehr wie Sterne, die vom Himmel gefallen waren. Sie waren zu schwach gewesen, diese blassen, blauen, nordischen Augen. Sie war schwach gewesen. Konnte nicht standhalten. Hatte versagt. Hatte ihn im Stich gelassen und ... Sie kniff die Lippen zusammen und beobachtete, wie sich nutzlose Tränen in ihren Augenwinkeln sammelten. Sie hatte ihren Sohn dort zurückgelassen. In der Finsternis. Eine Träne löste sich und glitt langsam die Wange hinunter zu ihrer Nase, verharrte dort einen Augenblick und rollte weiter zu ihrem Mund. Sie war schwach gewesen. Zu schwach. Ihre Tränen waren heuchlerisch. Kamen zu spät. Sie durfte nicht weinen. Es war nicht erlaubt, es stand ihr nicht zu. Nichts stand ihr mehr zu. Die Tränen kamen trotzdem. Unaufhörlich. Sie flossen wie ein Strom aus ihr heraus, als wollte sie gänzlich zerfließen, hier in dem schimmeligen Badezimmer am Rande der Stadt. Sie musste sich setzen. Das Schluchzen schüttelte ihren mageren Körper in Wellen, es schmerzte, sie holte ächzend Luft wie eine Ertrinkende, hustete Rotz und Schleim und weinte ihren Schmerz heraus wie ein Kind. Als sie wieder zu sich kam, zitterte sie am ganzen Körper, und ihre nackten Füße waren eiskalt. Sie stand mühsam auf und wischte sich mit den Händen das Gesicht ab. In den Spiegel sah sie nicht mehr. Sie ging zurück in das Zimmer, das Wohnzimmer, Küche und Schlafzimmer in einem war. Es hatte keine Heizung, dafür einen Balkon, wie der Vermieter, ein graugesichtiger Wucherer, damals stolz angemerkt hatte: »Vom Balkon können Sie die ganze Stadt überblicken, Signora. Die ganze Stadt!«
Man sah die Stadt tatsächlich, in der Ferne, aber nur, wenn man sich weit über die Brüstung des winzigen Vorsprungs beugte, den der Vermieter als Balkon bezeichnet hatte. Aber da war sie, die Ewige Stadt, mit ihren orangefarbenen Lichtern, die die ganze Nacht leuchteten und ihren Schein weit in den Himmel hinaufjagten. In den ganzen zehn Jahren, in denen sie jetzt hier wohnte, war sie kein einziges Mal in die Stadt hineingefahren. Anfangs hatte sie warten wollen, bis sie etwas Geld gespart hatte, um sich Schuhe zu kaufen, essen zu gehen. Doch mit der Zeit war die Stadt zunehmend verschwunden in ihrem orangefarbenen Dunst, war verschlungen worden von der Finsternis, der sie hatte entfliehen wollen. Und irgendwann, zu einem Zeitpunkt, als sie auch aufgehört hatte, in den Spiegel zu sehen, war etwas anderes übermächtig geworden, gegen das alles andere verblasste: der Wunsch zurückzukehren. Zu ihm. Und ihrem Sohn. Doch es war ein Wunsch geblieben. Immer gab es etwas, das sie zögern, innehalten, vergessen ließ. Bis heute.
Spät am Morgen, als sie langsam aus einem Nebel von Wodka und Wein erwacht war, hatte ihr Nachbar, der fette Emilio geklopft. Schüchtern wie immer hatte er an der Tür gestanden, die strähnigen schwarzen Haare über die Stirn gekämmt, und ihr eine Zeitung hingehalten. »DDas ist vvvon dir dahhheim, ggglaub ich«, hatte er gestammelt und ihr die Zeitung in die Hand gedrückt. Dann war er ohne ein weiteres Wort in seiner Wohnung gegenüber verschwunden. Sie hatte nichts begriffen, außer dass ihr Kopf hämmerte und sie kotzen musste. Doch dann fiel ihr Blick auf die Zeitung und auf das Foto auf der Titelseite. Die grotesken Überreste von etwas, das einmal ein Auto gewesen war, der unversehrt gebliebene Fahrersitz, die dunklen Flecken, Blut, Glassplitter, eine Brille ...
Die fetten Schlagzeilen sprangen ihr wie Blitze in die Augen, schmerzten hinter ihren Lidern und drangen tief in sie ein. Sie brüllten ihr ins Gesicht und holten allen Schmerz zurück, das Grauen und die Hoffnungslosigkeit.
Zerfetzt von einer Bombe!
Sie wusste den Namen, bevor sie ihn unter dem Bild von dem zerstörten Auto las: Raffaele de Caprisi, 36, Journalist.
Sie war auf ihrem ungemachten Bett sitzen geblieben und hatte zum Fenster hinausgestarrt. Doch sie sah nicht die Hochhäuser, terrakottafarben, eines am anderen, glatt und sauber aus der Ferne, solange man die abgeplatzten Putzplatten und die nassen Stellen, die zugeklebten Fenster und das Gerümpel auf den Balkonen nicht sah. Sie sah andere Dinge: die silbernen Tische der Bar in Reggio di Calabria, wo sie als Kind mit ihrem Vater morgens die Zeitung geholt hatte. Den geharkten Kies vor Raffaeles Haus in San Sebastiano, die alten Olivenbäume. Sie sah die steinernen Augen der Baronessa und Raffaeles lächelnden Mund. Sie sah sich in einem blauen Kleid, lachend, und das Zimmer mit den hohen Fenstern zum Hof, in dem Raffele und sie versucht hatten, glücklich zu sein. Doch sie sah nicht das Kind. Nicht den Säugling, den sie im Arm gehalten hatte, nicht den großen Jungen, der er jetzt sein musste. Das Kind konnte sie nicht sehen.
Und als die Dämmerung hereinbrach und die Stadt mit ihrem orangefarbenen Schein die Vorstädte aus zweiter Hand bestrahlte, trocknete sie ihre Tränen, diese ersten seit zehn Jahren, und ging hinaus auf ihren Balkon. Ohne einen Blick zurück kletterte sie auf die ausgewaschene Betonbrüstung und sprang sechs Stockwerke in die Tiefe.
Es war der fette Emilio, der sie fand, die blonde Frau im Nachthemd und mit verrenkten Gliedern, die Zeitung von heute Morgen noch in der Hand.
MÜNCHEN
Clara Niklas starrte die Zweige der Kastanie an, die der Wind an die Scheibe drückte, was ein tickendes Geräusch verursachte. Ihr Blick wanderte durch den Baum hindurch, hinüber zum Fluss, und sie stellte sich vor, wie es wohl wäre, jetzt einfach dort hinunterzugehen und mit Elise einen langen, sehr langen Spaziergang zu machen. Bis zum Flaucher könnten sie gehen, auch wenn der Biergarten an einem so windigen Frühlingstag wie heute sicher nicht geöffnet hatte. Trotzdem würde sie sich an einen der leeren Biertische setzen, und dort würde sie sitzenbleiben und schauen und warten, bis es Zeit war, wieder heimzugehen. Dann würde sie sich auf die Couch setzen und die Beine hochlegen. Musik hören. Den ganzen restlichen Tag.
Sie warf einen Blick auf die graue Dogge zu ihren Füßen, die hingebungsvoll an einem Knochen, so groß wie ein menschlicher Oberschenkelknochen, herumkaute. »Wir sollten einen Spaziergang machen, was, Elise?« Elise richtete ihre blutunterlaufenen Augen auf Clara und sah sie einen Augenblick skeptisch an. Doch das Wort Spaziergang schien sie im Augenblick nicht zu locken. Lieber wandte sie sich wieder den wichtigen Dingen des Lebens zu und biss krachend ein Stück von dem Knochen ab.
Clara seufzte. Es gab keinen Grund, heute nicht in die Kanzlei zu gehen. Keinen wirklichen. Außer vielleicht der Tatsache, dass Sean gestern Abend einen Flieger nach Dublin bestiegen hatte und sie ihn erst zu Weihnachten wiedersehen würde. Sie kratzte mit dem Fingernagel über das weißgestrichene Fensterbrett, von dem die Farbe in großen Platten abblätterte, und zerkrümelte sie zwischen den Fingern. Ihr Sohn war neunzehn und folglich erwachsen. Und er war nicht allein in Dublin. Er war bei seinem Vater. Doch dieser Umstand beruhigte Clara nicht im Geringsten. Um ehrlich zu sein, war es gerade der Gedanke an Ian, der sie ruhelos wie ein Tiger im Käfig durch die leere Wohnung streifen ließ. Sie mochte nicht an ihn denken. Es waren andere Zeiten gewesen damals, und sie waren lange vorbei. Es war lange vorbei. Und dabei waren es nicht nur die Erinnerungen, die sie beunruhigten. Es war dieses Gefühl des Vergangenen, das Ian symbolisierte, das andere Leben, das sie geführt hatten. Und es war die Angst, Sean an dieses alte, ferne Leben zu verlieren. Ihm nicht beistehen zu können. Und wie jedes Mal, wenn sie sich diese Angst eingestand, und das war recht oft gewesen in den letzten Wochen, seit Sean ihr seinen Entschluss mitgeteilt hatte, spürte sie die Wut in sich heraufkriechen, unaufhaltsam, wie ein gefräßiges Tier, bereit, alles zu verschlingen, was sich ihr in den Weg stellte. Clara ballte die Hände zu Fäusten und zwang sich, den Blick von dem Kastanienbaum abzuwenden. Sie wusste, dass ihr Zorn ungerecht war. Ian konnte nichts dafür. Dafür nicht. Trotzdem hasste sie ihn deswegen, weil Sean jetzt bei ihm wohnen und in der Stadt studieren würde, die ihnen gemeinsam gehört und die sie mit so viel Zorn und Mühe aus ihrem Herzen verbannt hatte. Sie war eifersüchtig, und sie hatte Angst. Und beides machte sie wütend. Sie zog eine Zigarette aus der Schachtel am Fensterbrett und setzte sich zu Elise auf den Boden. Der Hund hob fragend den Kopf, dann trennte er sich mit einem wehmütigen Seufzer von den Überresten seines Knochens und legte seinen großen, grauen Kopf auf Claras Beine. Seinen Nacken kraulend, rauchte Clara ihre Zigarette und versuchte, sich auf den heutigen Tag zu konzentrieren.
Die Rechtsanwaltskanzlei Niklas & Allewelt befand sich fast genau gegenüber von Claras Wohnung auf der anderen Seite der Isar in einer etwas heruntergekommenen Seitenstraße. Gemessen an der Tatsache, dass man von dort in nur wenigen Minuten zu Fuß in die Innenstadt laufen konnte, war die Miete sagenhaft günstig. Deshalb hatte Clara auch nicht lange gezögert, als sie damals, vor gut vier Jahren, Knall auf Fall beschlossen hatte, ihren öden Versicherungsjob und damit ihre und Seans so mühsam gesicherte Existenz wieder einmal aufs Spiel zu setzen, um sich zusammen mit ihrem alten Studienkollegen und Freund Willi Allewelt selbstständig zu machen. Keinen von beiden hatte es bislang gestört, dass die ehemalige Buchhandlung in dem sanierungsbedürftigen Altbau nicht gerade das war, was man im Allgemeinen unter einer renommierten Adresse verstand: ein langer, hoher Raum mit abgetretenem Parkett und zugigen Fenstern. Zur Straße hin hatte er ein großes Schaufenster, das ständig geputzt werden musste, und eine Eingangstür aus Glas, die jedes Mal klirrte, wenn man sie öffnete. Die Glocke, die früher angezeigt hatte, dass ein Kunde den Laden betrat, hatten sie beibehalten. Clara mochte das nostalgischen Bimmeln, das ertönte, wenn ein Mandant in die Kanzlei kam. Es erinnerte sie an die Bäckerei ihrer Kindheit, und sie war jedes Mal versucht zu glauben, jemand käme, um drei Semmeln und ein Breze zu kaufen oder den bestellten Rosinenzopf für Ostern.
Stattdessen kamen Menschen mit Sorgen und Problemen zu ihr, baten sie, zermürbende, selbstzerstörerische Kämpfe um das Sorgerecht ihrer Kinder zu führen, empörten sich über himmelschreiende Ungerechtigkeiten und versuchten, mit Claras Hilfe gegen Windmühlen zu kämpfen. An manchen Tagen wünschte sich Clara, ihre Aufgabe im Leben wäre es tatsächlich, Brote zu backen, die nach Kümmel und Koriander dufteten, Krapfen mit Hagebuttenmarmelade zu füllen und am Abend die Tür hinter sich zu schließen mit der Gewissheit, dass das Bimmeln der Türglocke tatsächlich erst wieder am nächsten Morgen erklingen würde und sie nicht mitten in der Nacht hochschrecken ließ, wenn sie an einen drohenden Gerichtstermin oder an eine weinende Frau dachte, die andere Hilfe nötig hatte, als sie ihr geben konnte.
Direkt neben dem Eingang hatte Linda, die Sekretärin, ihren Arbeitsplatz. Sie war blond und jung und so hübsch, dass Willi bei ihrer Einstellung vorgeschlagen hatte, sie zu Werbezwecken gleich direkt ins Schaufenster zu setzen, was ihm ein Kichern von Linda und einen bösen Frauenbeauftragtenblick von Clara eingebracht hatte. Linda war jedoch nicht nur hübsch. Sie war darüber hinaus auch noch ausgesprochen tüchtig. So tüchtig, dass es Clara mitunter fast unheimlich zumute wurde und sie unweigerlich begann, nach einem Haken an der Sache zu forschen.
Drei knarzende Stufen höher, in der ehemaligen Fachbuchabteilung, war Willis und Claras Reich. Ihr großer, unordentlicher Tisch stand quer zur Wand, damit sie einen Blick hinaus zum Fenster und über den kleinen Vorplatz neben der Kanzlei hatte. Sie brauchte den freien Blick, die Illusion, jederzeit hinaus-, weggehen zu können, auch wenn es meistens nur bei einem sehnsuchtsvollen Blick blieb, bevor sie sich wieder über ihre Akten beugte. Über Willis Schreibtisch an der anderen Wand wölbte sich eine Treppe, die hinauf in die Galerie führte, wo sich ein weiteres, kleines Zimmer befand, ihr Besprechungsraum. Die Holztreppe vermittelte den Eindruck, als säße Willi unter einer Dachschräge, und die zahlreichen Bücher, die jedes freie Stück der fensterlosen Wände um ihn herum bedeckten, verstärkten den höhlenartigen Eindruck seines Arbeitsplatzes, den er mit eigensinniger Hartnäckigkeit gegen jeden möglichen Eindringling verteidigte.
Als Clara an diesem Morgen an der Kanzlei ankam, saß Willi in seiner Höhle und las im Schein einer altmodischen Messinglampe die Zeitung. Sie klopfte an die große Scheibe und signalisierte ihm und Linda, dass sie nebenan zu finden sei. Nebenan, das war Ritas Bar, Claras zweites Wohnzimmer, an dem sie morgens selten ohne Zwischenstopp vorbeikam. Und heute ganz besonders nicht. Willi hob kurz den Kopf, nickte flüchtig und widmete sich wieder seiner Lektüre. Linda winkte Clara strahlend zu und zeigte ihre ebenmäßigen weißen Zähne. Ihr glattes, blondes Haar glänzte auf eine Art, die Clara zu einem hastigen, ordnenden Griff in ihre eigenen widerborstigen Locken veranlasste, die in ihrem ganzen Leben noch nie so einen seidigen Schimmer besessen hatten. Sie begann, sich nach einer zweiten Zigarette zu sehnen.
Das Café empfing sie mit dem Duft nach Kaffeebohnen und italienischer Musik. Dies und der schaumige Cappuccino, den Rita ihr zusammen mit einem Teller frischer Croissants und einem Lächeln hinstellte, sorgten endlich dafür, dass Dublin und Ian und Sean ein Stückchen im irischen Nebel verschwanden und Claras Gesichtszüge sich entspannten. Sie nahm eines der Croissants und hielt es Elise vor die erwartungsvoll geöffnete Schnauze.
Die Dogge verschlang es mit einem einzigen Bissen. Ihr drängender Blick, unterstützt von einem heftig auf den Boden klopfenden Schwanz, nötigte Clara, ihr ein zweites zukommen zu lassen, das ebenso schnell verschwunden war wie das erste. Doch als ihr Elise danach nochmals ein aufforderndes »Wuff« entgegenbellte, schüttelte Clara den Kopf. »Bei dir piept’s wohl, du gefräßiges Monster. Jetzt bin ich dran.« Theatralisch ließ sich Elise auf den Boden fallen, legte den gewaltigen Kopf auf ihre Pfoten und seufzte schwer. Dann schloss sie die Augen und begann unvermittelt zu schnarchen. Clara warf ihr einen neidvollen Blick zu. Es gab Augenblicke, in denen hätte sie liebend gerne mit ihrem Hund getauscht. Und dann, gerade als sie in ihr Croissant biss, steckte Willi den Kopf zur Tür herein.
»Clara, kannst du mal eben kommen? Ich hab da so einen Italiener sitzen. Er spricht so gut wie kein Deutsch.« Er hob hilflos die Arme.
Clara warf einen Blick zu Rita, die hinter dem Tresen stand und jetzt interessiert aufblickte. Sicher war der neue Mandant auf Ritas Intervention hin zu ihnen gekommen. Weil Clara in ihren früheren Sturm- und Drangjahren auch einen Sommer in Apulien verbracht hatte, sprach sie noch leidlich gut Italienisch. Rita schickte ihnen deshalb recht häufig einen ihrer Landsleute, wenn sie der Ansicht war, dass dieser einen avvocato nötig hatte. Clara unterdrückte einen Seufzer, stopfte sich das restliche Croissant in den Mund und folgte Willi, ihre Tasse in der Hand. Elise hob nicht einmal den Kopf.
Im Büro wartete ein junger Mann auf sie. Er hatte ein langes, trauriges Gesicht mit schweren Lidern und pechschwarzen Augen, die sie abwartend, fast furchtsam musterten. In den Händen hielt er einen zerknüllten Umschlag. Er reichte Clara eine große, schlaffe Hand: »Buon giorno, avvocato. Sono Malafonte. Angelo Malafonte.«
Sie stellte ihre halbleere Cappuccinotasse auf Lindas Schreibtisch und ging mit ihm hinauf in das Besprechungszimmer. Er setzte sich so vorsichtig auf einen der Stühle, als fürchtete er, der Stuhl könnte unter ihm explodieren. Clara schaute ihn neugierig an.
Was er wohl auf dem Herzen hatte? Doch der junge Mann schwieg. In sich zusammengesunken, als ob er keinen einzigen Knochen im Leib hätte, saß er vor ihr, den Blick auf die Tischplatte gesenkt.
»Womit kann ich Ihnen helfen, Signor Malafonte?«, fragte Clara schließlich nach einer Weile auf Italienisch, als klar war, dass der junge Mann von sich aus nicht zu reden beginnen würde.
Er hob den Kopf und sah sie an, und dann, unendlich zögernd, schob er den zerknitterten Umschlag, den er in den Händen gehalten hatte, über den Tisch. »Ecco avvocato, ho ricevuto questa lettera.«
Clara zog einen dicken grauen Packen Blätter aus dem Kuvert. Unverkennbar das offizielle Schreiben eines Gerichts. Sie las die Seiten mit wachsendem Unbehagen. Es war eine Ladung zur Hauptverhandlung in einer Strafsache. Für morgen.
»Um was geht es hier, Signor Malafonte?« Sie wedelte mit den Blättern und legte sie dann auf den Tisch.
Der junge Mann hob die hängenden Schultern ein wenig. »No’ lo so, avvoca’.«
»Morgen findet eine Strafverhandlung gegen Sie statt. Sie müssen doch wissen, was man Ihnen vorwirft?«
Angelo Malafonte schüttelte vage den Kopf und schwieg.
Clara gestattete sich einen leisen Seufzer und begann, die Papiere durchzublättern. Die Anklageschrift war der Ladung beigefügt. »Ihnen wird vorgeworfen, am ...« Clara überflog die zwei Seiten und gelangte zum Ende: Besitz und gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln.
»Sie sind angeklagt wegen Rauschgifthandels, Herr Malafonte. Wussten Sie das?«
»Eh?«
»Droghe, signor Malafonte.«
Da erlaubte sich der junge Mann ein kleines Lächeln. »Das waren keine Drogen, avvocato. Un pó d’erba.«
Clara las die letzte Seite noch mal: »Sieben Gramm Marihuana wurden beim Angeklagten sichergestellt.« Sie beugte sich vor und sah ihrem neuen Mandanten scharf in die Augen. Sie waren blutunterlaufen. »Marihuana ist eine Droge, Herr Malafonte.«
Angelo Malafonte zuckte mit den Schultern. »Nur Konsum, avvocato, das ist nicht strafbar.«
»Da täuschen Sie sich.« Clara schüttelte den Kopf. Es hatte keinen Sinn, ihm jetzt die Details zu erklären. Ebenso wenig hatte es Sinn, ihn zu fragen, weshalb er nicht früher gekommen war. Stattdessen bot sie ihm eine Zigarette an, die dankbar angenommen wurde. »Sie müssen mir genau erzählen, was passiert ist, Herr Malafonte.«
»Sì.« Der junge Italiener nickte und richtete sich ein wenig auf. »Ich bin pizzaiolo, Pizzabäcker, avvocato. In der Pizzeria Napoli. Ainmillerstraße. Ich arbeite immer bis elf, zwölf, und dann gehen wir weg. Ich und meine Freunde. Wir rauchen ab und zu etwas zusammen. Nur Konsum, avvocato.«
»Wo haben Sie den Stoff gekauft?«
»In Italien.« Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. »In Bologna.«
Clara glaubte ihm kein Wort. »Wann?«
»No’ lo so, avvoca’. Es ist lange her.« Angelo Malafonte zog ein letztes Mal an seinem Zigarettenstummel, bevor er ihn ausdrückte. Er hatte außergewöhnlich große Hände. Die Fingerspitzen waren bräunlich verfärbt vom Nikotin, die Fingernägel sorgfältig geschnitten und peinlich sauber.
Clara wartete.
»Vielleicht war es zu Weihnachten?«, kam es schließlich zögernd von ihrem Gegenüber.
»Das Rauschgift wurde im November bei Ihnen sichergestellt.« Clara hob die Augenbrauen. »Unwahrscheinlich, dass Sie es danach in Italien gekauft haben, nicht?«
»Nein, nein, ich weiß wieder. Es war im Sommer, im August.« Angelo Malafonte lächelte matt.
Clara sah sich ihren neuen Mandanten an und versuchte es mit den Augen eines Strafrichters zu tun, der jede Woche zig Fälle wie diesen zu entscheiden hatte. Sie seufzte ein zweites Mal. Diesmal lauter. »Hören Sie, Signor Malafonte. Wenn Sie möchten, dass ich Sie morgen verteidige, dann nur unter zwei Bedingungen: Erstens, Sie sagen bei der Verhandlung kein Wort zur Sache. Kein einziges, haben Sie verstanden? Sie lassen nur mich reden.«
Angelo Malafonte nickte.
»Und zweitens«, fuhr Clara fort, »erhalte ich von Ihnen einen Vorschuss von fünfhundert Euro.«
Wiederum ein Nicken. »Ich bringe Ihnen das Geld heute Abend, avvocato.«
Irgendetwas stimmte nicht. Irgendetwas war seltsam, und sie kam nicht darauf, was es war. Seit einer halben Stunde saß Clara nun in der Geschäftsstelle des Gerichts und las in der Strafakte ihres neuen Mandanten. Im November letzten Jahres hatte die Polizei Malafontes Zimmer oberhalb der Pizzeria, in der er arbeitete, durchsucht und sieben mickrige Gramm Marihuana in einer Plastiktüte unter dem Bett sichergestellt. Dies hatte den Beamten genügt, ihn auf der Stelle zu verhaften und erst am nächsten Tag wieder auf freien Fuß zu setzen.
Clara runzelte die Stirn, während sie das dürre Ermittlungsergebnis las. Immer wieder blätterte sie zurück. Ein Landsmann von Malafonte hatte den Tipp gegeben. Ein gewisser Massimo Moro, der offenbar bei einer Razzia aufgegriffen worden war, hatte bei seinem Verhör vor dem Ermittlungsrichter unter anderem Malafontes Namen erwähnt. Aber seine Aussage schien seltsam unmotiviert, er gab keine Hintergründe an, keine Details, nichts Konkretes, nur zwei Namen. Eine Aussage vom Hörensagen, ein Hinweis, mehr war es nicht. In der ganzen Akte gab es außer diesen vagen Angaben keinen echten Beweis, dass Malafonte tatsächlich mit Rauschgift gehandelt haben sollte. Clara wunderte sich, dass bei einer derart dünnen Beweislage überhaupt Anklage erhoben worden war. Damit konnte ihm wohl nicht mehr als der Besitz der gefundenen sieben Gramm vorgeworfen werden, was kein so gravierendes Vergehen darstellte, wie der Handel mit Betäubungsmitteln. Es würde morgen ausschließlich auf die Aussage dieses Zeugen ankommen. Und wie glaubhaft würde er sein? Immerhin war er selbst angeklagt gewesen. Doch aus der Akte ging nicht hervor, wie dieses Verfahren geendet hatte. War er verurteilt worden, oder hatte man ihn womöglich laufen lassen? Clara notierte sich das Aktenzeichen und ging zur Sekretärin der Geschäftsstelle: »Wären Sie so freundlich, mir diese Akte ebenfalls zur Einsicht zu überlassen?«
Die korpulente Dame setzte ihre Brille auf und musterte Claras Notizen. Sie nickte. »Ja, sicher.« Sie watschelte zu einem der grauen Metallregale, in denen sich die Akten stapelten, und zog sich einen abgetretenen Plastikschemel heran. Sie suchte eine Weile im obersten Regal, das sie nur mit Mühe erreichen konnte, dann schüttelte sie den Kopf. »Das verstehe ich nicht.«
»Gibt es ein Problem?« Clara hob fragend die Augenbrauen.
»Mmh. Ja. Nun. Die Akte ist nicht da, wo sie sein sollte. Sind Sie sicher, dass es das richtige Geschäftszeichen ist?«
Clara kontrollierte noch einmal die Zahlenfolge. »Doch, so steht es im Protokoll.«
Die Dame blätterte zwischen den roten Akten herum, hob einige hoch, suchte daneben, davor und dahinter, dann schüttelte sie den Kopf. »Die Akte ist nicht da.«
»Kann es sein, dass sie schon abgelegt ist?«, schlug Clara vor.
»Nein. Diese Aktennummer wurde noch nicht abgelegt, selbst wenn die Sache schon erledigt ist. Sicher nicht.« Sie stieg ächzend vom Schemel herunter. »Kommen Sie doch in einer halben Stunde wieder. Dann ist Richter Oberstein auch hier und ich kann ihn fragen. Soll ich Ihnen die Akte Malafonte in der Zwischenzeit schon mal kopieren?«
»Gerne.« Clara reichte sie ihr erfreut. »Ich könnte Ihnen einen Kaffee aus der Cafeteria mitbringen?«
Zwei Grübchen erschienen auf dem runden Gesicht der Sekretärin. »Mit Milch und zwei Stück Zucker bitte.«
Als Clara aus der Cafeteria zurückkam, war die freundliche Dame nicht im Zimmer. Sie stellte die Tasse Kaffee vorsichtig auf ihren Schreibtisch und wartete. Neben dem Computerbildschirm stand ein Foto in einem silbernen Rahmen. Es zeigte eine schwarze Katze, die verschreckt in die Kamera blickte. Daneben lagen die Kopien der Akte Malafonte. Sorgfältig gelocht und geheftet.
Dankbar nahm Clara sie und steckte sie in ihre Tasche. Ein lautes Geräusch ließ sie zusammenzucken. Sie ging ein paar Schritte zurück. Das Geräusch war aus dem Nebenzimmer gekommen. Ein lautes Klatschen, wie wenn eine Akte auf den Tisch geworfen wurde. Sie hörte Stimmen, und dann ging die Tür auf. Die Sekretärin kam mit hochrotem Gesicht heraus. Als sie Clara sah, bemühte sie sich um ein Lächeln, das ihr jedoch nicht recht gelingen wollte. Die Türe nur angelehnt, ging sie zurück zu ihrem Schreibtisch.
»Ich kann Ihnen leider nicht helfen, Frau Rechtsanwältin. Die Einsicht in die Akte Moro wurde Ihnen nicht genehmigt.« Ihre Stimme war laut und kühl. Sie setzte sich vor ihren Computer und hämmerte eilig auf ihrer Tastatur herum. Den Kaffee beachtete sie nicht.
Clara schüttelte den Kopf. »Was soll das denn heißen? Ich habe ein Recht auf Akteneinsicht, ich bin die Verteidigerin ...«
»Aber nicht in dem Verfahren Massimo Moro, Frau Anwältin.« Die Stimme kam aus dem Nebenzimmer, aus dem Richter Oberstein nun heraustrat. Ein kleiner, untersetzter Mann um die fünfzig mit einem sorgfältig gestutzten Ziegenbärtchen und stechenden Augen. Er musterte Clara von oben bis unten und blieb einen Augenblick an ihren langen Korallenohrringen hängen. »Ich sehe keinen Zusammenhang in den beiden Verfahren. Eine Einsicht in die Akte Moro werde ich Ihnen nicht gewähren.«
»Und ob es dort einen Zusammenhang gibt! Er ist der einzige Zeuge!«
»Ach, tatsächlich?« Richter Oberstein lächelte nachsichtig.
»Ich muss wissen, in welchem Zusammenhang er seine Aussage gemacht hat, um ihn morgen entsprechend befragen zu können ...«
»Oh, da werden Sie sich schwer tun, Herr Moro wird morgen nicht erscheinen.« Der Richter wandte sich zum Gehen.
»Wie bitte? Warum nicht?« Clara war fassungslos.
»Der ist doch längst wieder in Italien. Da hat es gar keinen Sinn, ihn zu laden. Er würde sowieso nicht kommen. Im Übrigen reichen die Indizien auch ohne ihn aus.«
»Sie haben ihn nicht einmal geladen?« Clara wurde rot. Sie spürte, wie ihr die Hitze in den Kopf stieg, und sie kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen. »Und wie gedenken Sie dann, über den Angeklagten urteilen zu können?«, fauchte sie erbost.
Richter Obersteins Haltung wurde steif, während er sich langsam wieder zu Clara umdrehte. Sein arrogantes Lächeln war wie weggewischt: »Was maßen Sie sich an, Frau ... Rechtsanwältin? Wollen Sie mir etwa sagen, wie ich meine Arbeit zu tun habe? Und übrigens: In meiner Geschäftsstelle ist es nicht gestattet, Kopien der Akten anzufertigen.«
»Laut Strafprozessordnung ...«, begann Clara wütend.
»Wenn Ihnen das nicht passt, legen Sie Beschwerde ein. Bitte schriftlich und in dreifacher Ausfertigung. Wir sehen uns dann morgen.«
Noch ehe Clara eine passende Erwiderung gefunden hatte, schlug der Richter die Tür hinter sich mit einem Knall zu.
Clara atmete zweimal tief durch, dann drehte sie sich zu der Sekretärin um, die wie gebannt auf ihren Bildschirm starrte.
»Ist der immer so?«
»Fast immer.« Die Frau lächelte schief und deutete auf den Kaffee. »Danke.« Während sie umrührte, wanderte ihr Blick zu der Stelle, auf der die Kopien der Akte gelegen hatten. Clara blickte schuldbewusst auf ihre Aktentasche und umklammerte sie ein wenig fester.
»Tut mir leid, dass Sie nicht kopieren durften«, meinte die Sekretärin schließlich mit einem verschwörerischen Blinzeln. »Ich wünsche Ihnen trotzdem viel Erfolg morgen.«
»Danke.« Hastig wandte sich Clara zur Tür. »Sie werden ja erfahren, ob ich gefressen wurde.«
»Da wären Sie nicht die Erste«, meinte die dicke Dame seufzend und widmete sich ihrem Kaffee.
Clara starrte auf die Kopien vor sich. Hatte es etwas zu bedeuten, dass hier zwei Blätter fehlten, oder war es nur ein Zufall, ein Versehen? Zwischen ihren Augenbrauen bildete sich eine steile Falte. Sie glaubte nicht an solche Zufälle: Dieser arrogante Richter hatte ihr nicht gestattet, von der Akte Kopien zu machen, die Einsicht in die Akte Massimo Moros war ihr verweigert worden, und ausgerechnet in dem Aussageprotokoll dieses Zeugen fehlten zwei Seiten. Clara hatte es zunächst übersehen, die Vernehmung schien vollständig zu sein. Zumindest hatte sie einen Anfang und ein Ende. Aber jetzt, während sie zurück in ihrer Kanzlei auf Malafonte wartete, hatte sie die Aussage nochmals gründlicher gelesen, und ihr war klar geworden, weshalb ihr die Aussage schon von Anfang an so merkwürdig vorgekommen war: Moro erzählte zunächst Belanglosigkeiten, nichts, was irgendwie von Interesse gewesen wäre, doch auf der nächsten Seite, plötzlich und ohne dass ein Grund hierfür erkennbar gewesen wäre, sprudelte es nur so aus ihm heraus. Und dazwischen fehlten zwei Seiten.
Clara war sich sicher, auf diesen Seiten stand etwas, was nicht für die Augen von Verteidigern bestimmt war. Wahrscheinlich war Moro unter Druck gesetzt worden, oder man hatte ihm etwas versprochen. Clara schlug mit der flachen Hand so heftig auf die Tischkante, dass die Tasse mit dem schalen Rest Kaffee von heute Morgen einen Satz machte und Elise erschrocken den Kopf hob. »Und er hat diesen Zeugen einfach nicht geladen!«, brummte sie an ihren Hund gewandt und schüttelte den Kopf. »Es kann doch unmöglich sein, dass er eine Verurteilung nur auf dieses lückenhafte Protokoll stützt, oder?« Elise gab ein zweifelndes Bellen von sich. Sie seufzte. »Ja, ja. Du hast ja recht.« Clara ahnte, dass es genau so kommen würde. Und dass es wenig, sehr wenig gab, was sie dagegen unternehmen konnte. In dem Moment klopfte es. Angelo Malafonte stand vor der Tür. Clara strich sich ihre dichten, rotbraunen Locken, die wie immer in alle Richtungen abstanden, aus dem Gesicht und ging hinunter, um ihm zu öffnen.
Als Clara den trostlosen Blick bemerkte, mit dem ihr Malafonte die zerknitterten Scheine für den Vorschuss reichte, wurde sie von einer plötzlichen Welle des Mitleids für den jungen Mann erfasst. Am liebsten hätte sie ihm das Geld wieder in die Hand gedrückt und ihn mit ein paar beruhigenden Worten nach Hause geschickt. Doch sie nahm das Geld und schwieg. Schließlich, nach einem Moment des inneren Kampfes, wie viel sie von dem, was ihn aller Wahrscheinlichkeit nach morgen erwarten würde, preisgeben sollte, entschied sie sich, nichts zu sagen, was ihn noch mehr beunruhigen würde. Richter Obersteins Bekanntschaft würde er noch früh genug machen. Stattdessen fragte sie ihn nur nach Massimo Moro.
»Kennen Sie ihn?«, wollte sie wissen.
Zu ihrer Überraschung lächelte Malafonte: »Sì, avvocato. Er ist Friseur. Schneidet mir ab und zu die Haare.«
»Er war es, der dem Richter Ihren Namen genannt hat, wussten Sie das?« Clara sah ihm forschend ins Gesicht. Doch sie sah nur ehrliches Erstaunen. »Massimo? Es war Massimo? Aber warum denn?«
»Das müssen Sie mir schon sagen, Signor Malafonte. Hat er etwas gegen Sie?«
Malafonte schüttelte den Kopf. Er schien ehrlich verwirrt zu sein. »No’ lo so. Weiß nicht.«
»Herr Malafonte, Sie müssen mir sagen, was Sie wissen.« Clara sah ihn eindringlich an.
Malafonte wich ihrem Blick aus. »Ich weiß nichts. Ich kenne ihn nur so.« Er wedelte vage mit seiner Hand herum und ließ sie wieder sinken »Wir treffen uns manchmal. Gehen zusammen weg.«
Und rauchen ein paar Joints zusammen, dachte sich Clara hinzu, sagte es aber nicht. »Warum sollte er diese Aussage über Sie machen, wenn sie nicht stimmt?«
»No’ lo so.« Malafontes Schultern sanken noch tiefer, während er diese stereotypen Worte wiederholte. Er hielt den Kopf gesenkt und starrte seine Hände an. »Werden sie mich ins Gefängnis stecken?« Er flüsterte fast, und Clara konnte die Angst in seiner Stimme hören.
»Das glaube ich nicht.« Clara lächelte. »Aber es wäre trotzdem gut, wenn Sie mir ein wenig helfen würden.«
Malafontes Kopf sank noch tiefer. Er schüttelte fast unmerklich den Kopf. »Ich muss zur Arbeit.«
Clara zuckte resigniert mit den Achseln: »Gut. Wie Sie wollen. Wir sehen uns morgen.«
Sie begleitete ihn zur Tür und sah ihm nach, wie er mit schlurfenden Schritten über die Straße davonging.
Noch ein paar Minuten blieb sie an der Tür stehen und sah hinaus. Es begann zu dämmern, und die Häuser waren in ein letztes, unwirkliches Frühlingslicht getaucht, das sich mit einem Mal zwischen den feuchten Regenwolken hervorgestohlen hatte. Das Licht spiegelte sich in den Pfützen, und die Bäume vor Claras Büro hoben sich wie Scherenschnitte vom bewegten Himmel ab. Clara pfiff nach Elise und nahm ihren Mantel vom Haken. Genug gearbeitet für heute. Jetzt war der Spaziergang fällig.
Die Luft war genauso, wie das Licht versprochen hatte: Frisch und klar mit einem Hauch von Wärme. Clara blieb einen Moment stehen und atmete tief ein. In solchen Augenblicken wünschte sie sich, die Luft und das Licht aufbewahren zu können, in einer Schachtel oder einer Dose, wie man sie für Lebkuchen verwendet. Für trübere Zeiten, in denen der Nebel zwischen den Gehsteigen hing und die Verkehrsampeln verschwommen wie Augen eines Ungeheuers dahinter hervorglommen. Oder für die stickigen Sommertage, in denen einem der Schweiß klebrig und graugelb wie die Autoabgase um einen herum den Rücken hinunterlief und jeder Schritt sich anfühlte, als wöge man zwanzig Pfund mehr. An solchen Tagen würde sie sich in die Tiefen ihres roten Sessels zurückziehen, den Blick auf den Kastanienbaum vor ihrem Fenster gerichtet, und die Dose öffnen, einen tiefen Zug nehmen, inhalieren. Und das Licht um sie herum würde zu leuchten beginnen wie an einem solchen Frühlingstag im März.
Clara ging los. Elise lief bellend neben ihr her. Sie ging schnell, mit großen Schritten an den grauen Häuserzeilen entlang, lief fast, mit offenem Mantel und wehenden Haaren.
Als sie zwei Stunden später den Schlüssel zu ihrer Haustür herumdrehte, fühlte sie sich wie elektrisch aufgeladen, sie glühte förmlich vor Sauerstoff und Energie, und ihre Haare ringelten sich nach der feuchten Luft noch mehr als sonst. Ein Blick auf den Anrufbeantworter im Gang, und das Glühen ließ ein wenig nach. Sean hatte nicht angerufen. Bis auf ein kurzes Hallo gestern Nacht vom Flughafen in Dublin hatte sie noch nichts weiter von ihm gehört. »Alles o. k., Mum, Ian hat mich abgeholt, wir fahren jetzt nachhause.« Das war alles gewesen, sie hatte nicht einmal richtig mit ihm reden können. Nachhause hatte er gesagt. Zu Ian. Er nannte ihn immer Ian, nie Vater oder Dad, aber es klang, als ob er von einem guten Freund sprach. Sie hätte dankbar sein sollen. Glücklich über das gute Verhältnis, das die beiden zueinander hatten. Immerhin war es nicht immer so gewesen. Aber sie war nicht glücklich darüber. Ganz und gar nicht. Sie war stinkwütend. Sie war so wütend, dass sie jede Lust auf den gemütlichen Abend auf der Couch verlor, auf den sie sich noch vor ein paar Minuten gefreut hatte. Sie starrte den schmalen Gang entlang, der an der Tür mit dem großen Poster endete. Sie war geschlossen, und Clara wusste, dass es dahinter seltsam leer war. Halb ausgeräumt, halb aufgeräumt, nur der Kinderkram, Spiele, alte Comics, ein lädierter Stofftiger, war zurückgeblieben und lag achtlos herum. Abrupt machte sie kehrt. Dies war kein Abend für die Couch. Elise folgte ihr erstaunt, als sie mit klappernden Absätzen die Treppe hinunterlief, während hinter ihr die Wohnungstür ins Schloss fiel.
Nach einem Sandwich und zwei Bier in der kleinen, stillen Eckkneipe zwei Straßen weiter, in die sie manchmal flüchtete, wenn der Kühlschrank oder ihre Wohnung allzu leer waren, kehrte sie missmutig, aber zumindest müde zurück und ging sofort ins Bett. Natürlich war es zu früh, um sofort einzuschlafen, und natürlich war sie nicht müde genug, um nicht mehr zu denken. Und während sie wütende, traurige und zutiefst beunruhigende Nachtgedanken wälzte und sich dabei selbst leidtat, begann es zu regnen und zu stürmen. Die Tropfen prasselten in böigen Wellen gegen die Fensterscheiben und machten einen solchen Lärm, dass sie das verstohlene Tapsen nicht rechtzeitig hörte. Erst als das Bett unter Elises Gewicht nachgab, schrak Clara hoch, doch da war es zu spät. Sie gab dem Ungetüm von einem Hund zwar formhalber einen kräftigen Stoß mit dem Ellenbogen und raunzte ihm entrüstet zu: »Sag mal, spinnst du?«
Elise entlockte die halbherzige Empörung ihres Frauchens jedoch nur ein zufriedenes Grunzen, und sie rückte näher heran. Clara, der zunächst noch vage Elises Sprünge durch Schmutzpfützen auf dem Weg von der Kneipe zur Wohnung vor Augen standen, legte ergeben den Kopf auf Elises warmen Rücken und schlief wundersam getröstet ein.
Der nächste Tag begann grau und windig. Clara wachte schon um kurz nach sechs auf. Sie hatte schlecht geschlafen. Wirre Träume hatten sie immer wieder hochschrecken lassen, und das pappige Sandwich von gestern Abend lag ihr im Magen. Irgendwann gegen Morgen war es Elise zu unruhig geworden, und sie war davongeschlichen, um sich ein geruhsameres Plätzchen zu suchen. Clara warf einen kurzen Blick auf die Schmutzspuren auf Kissen und Laken, die Elises nächtlicher Besuch hinterlassen hatte, und zog gnädig die Decke über die Bescherung.
Sechs Uhr morgens war keine gute Zeit für solche Dinge, und so verschob Clara die Bestandsaufnahme auf irgendwann später und schlich stattdessen barfuß und mit halb geschlossenen Augen in die Küche. Während ihre altersschwache Kaffeemaschine keuchend wie ein Asthmakranker das Wasser in den Filter spuckte, stellte sich Clara unter die Dusche, um langsam aufzuwachen.
Angelo Malafonte fiel ihr ein, als sie mit einer Zigarette und der ersten Tasse schwarzen Kaffees, in der Küche saß und die Zeitung las. Im Münchner Teil stand eine kurze Notiz über eine italienische Familie, die von den Behörden abgeschoben worden war, weil der Vater seine Arbeit verloren hatte. Man hatte sie in ein Flugzeug nach Mailand gesetzt und offenbar gehofft, die Sache damit aus der Welt geschafft zu haben. Die Familie, die aus Sizilien stammte und seit Jahren in Deutschland lebte, war jedoch mit dem Zug zurück nach Deutschland gefahren und bei Freunden untergekommen. Jetzt hatten sie Klage erhoben. Das Verfahren dauere an, hieß es im glatten Journalistendeutsch, und der Anwalt der Familie wurde mit den üblichen kämpferischen Phrasen zitiert, die gedruckt immer irgendwie platt und ölig klangen: Man werde, wenn nötig, bis zum Bundesverfassungsgericht gehen, Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof einlegen und diesem »Politikum« ein Ende bereiten.
Clara faltete kopfschüttelnd die Zeitung zusammen und schenkte sich eine neue Tasse Kaffee ein. In einem kleinen Artikel, einem von der Sorte, den man gewöhnlich überlas, dem die wenigsten Menschen mehr als einen flüchtigen Blick widmeten, stand – selbstverständlich wie der tägliche Börsenkurs – eine Ungeheuerlichkeit. Nicht, dass es jemandem aufgefallen wäre, wenn der Artikel größer gewesen wäre, nein, dazu war das Ereignis viel zu unblutig, zu wenig grausam. Ein paar Italiener mussten in ihre Heimat zurück. Na und? Sizilien soll schön sein, Mailand ist es allemal, mit dem Comer See und dem Gardasee um die Ecke! Und überhaupt, es herrscht ja kein Bürgerkrieg dort und Hunger doch auch nicht, man denke nur an Carpaccio und Saltimbocca alla romana, schon bei den Namen läuft einem das Wasser im Mund zusammen.
Clara starrte nachdenklich aus dem Fenster in die graue morgendliche Stadt. Freies Aufenthaltsrecht aller europäischen Bürger. Wir sind ein Europa. Was für eine Errungenschaft haben die Politiker ihren Bürgern da verkaufen wollen. Doch es hat schon damals niemanden wirklich interessiert, was die da oben in Brüssel so beschließen, DIN-Normen und Richtlinien und Meilensteine. Und jetzt, da dieser Meilenstein so mir nichts dir nichts mit den Füßen getreten wird, interessierte es gleich zweimal niemanden. Clara nahm einen tiefen Zug und spann ihr gedankliches Stammtischgespräch grimmig weiter: Alles zu kompliziert, und überhaupt, das sind doch eh alles Ausländer, die bekommen sowieso mehr als wir deutsche Staatsbürger! Wo kämen wir da hin, wenn wir den Ausländern auch noch die Sozialhilfe bezahlen sollten, soll doch deren Regierung für sie zahlen ... Clara schloss für einen Moment die Augen. Sie sollte solche Selbstgespräche lassen. Sie frustrierten fast ebenso wie ein echtes Streitgespräch von dieser Sorte und waren gleichermaßen sinnlos. Zumindest kam es ihr regelmäßig so vor, als ob Diskussionen dieser Art im realen Leben genauso im Nichts verhallten wie in ihren Gedanken. Und sie ließen sie mit dem Gefühl zurück, eine Außerirdische zu sein, jemand, der merkwürdige Ufo-Theorien zu verbreiten versucht, oder, noch schlimmer, eine Spinnerin, eine Träumerin, ein Verrückte, die es nicht lassen kann, eine Welt verbessern zu wollen, die eben so ist, wie sie ist, und in der man doch ganz gut zurechtkommt im Großen und Ganzen und wenn man das Kleingedruckte nicht liest. So eine, die sich über Lauschangriffe empört gegenüber Verbrechern! Als ob die das nicht verdienten. Eine, die nicht verstehen will, dass man nichts zu befürchten hat als rechtschaffener Bürger, der nichts zu verbergen hat. Eine, die gegen die Todesstrafe ist. Sogar bei Kinderschändern. Eine Verrückte eben. Alleinerziehende Akademikerin! Na ja, kein Wunder.
Clara stand auf und stellte das Geschirr in die Spüle. Dann beugte sie sich zu Elise hinunter und kraulte sie hinter den Ohren. »Wir haben’s nicht leicht, was?« Elise zuckte zustimmend mit ihren Schlappohren und schnaufte überzeugend tief.
Eine gute Stunde vor der Verhandlung saß Clara bei Rita im Café und schlürfte ihren unnachahmlichen Espresso.
»Der Kleine war gestern bei euch, ja?«, fragte Rita beiläufig und klapperte hinter dem Tresen mit den Tassen.
»Angelo Malafonte?«
»Sì. Angelo.« Rita, wie immer im kurzen Rock und mit aufgesteckten blondgefärbten Haaren, nickte. »Ein guter Junge. Ein wenig Pech vielleicht, aber in Ordnung. Du wirst ihm doch helfen, Clara?«
»Ich versuche es.« Clara zögerte. »Er scheint sehr beunruhigt. Kennst du ihn gut?«
»Nicht besonders. Er ist der Sohn einer entfernten Kusine von mir. Er ...« Sie verstummte. Clara sah sie aufmunternd an. »Ja?«
Rita schüttelte abwehrend den Kopf und fragte unvermittelt: »Wo warst du gleich noch mal, als du damals in Italien warst?«
»In Apulien.« Clara wunderte sich ein wenig über Ritas abrupten Themenwechsel. Weshalb wollte sie nicht über Angelo sprechen? Immerhin hatte sie ihn doch zu ihr geschickt.
»Ah, Puglia.« Rita lächelte »Es ist schön dort, nicht wahr?«
Clara nickte, und eine Woge der Wehmut überrollte sie so unerwartet, dass sie nicht weitersprechen konnte. So lange hatten die Erinnerungen an diese Zeit in einem verstaubten Winkel ihres Geistes gelegen. Sie gehörten nicht hierher. Nicht in dieses Leben. Sie war eine andere gewesen damals, zu diesen anderen Zeiten, als die Welt noch unendlich groß und alles möglich gewesen war.
»Ja«, flüsterte Clara schließlich, als sie ihre Stimme wiedergefunden hatte. »Es ist wunderbar dort.« Doch Rita hörte sie nicht mehr. Sie plauderte längst mit einem Gast am Nebentisch.
Es hatte zu regnen begonnen. Der Wind peitschte Clara die kalten Tropfen ins Gesicht, während sie auf das monströse Gebäude in der Nymphenburger Straße zulief. Beim Bau dieses Gerichtsgebäudes hatte der Auftrag sicher gelautet, das hässlichste, abschreckendste Gebäude zu entwerfen, das man sich nur vorstellen kann. Beton, so weit das Auge reichte. Abweisende, blinde Fenster hinter wulstigen Vorsprüngen, die, verhängt mit Taubengittern, die Ahnung eines Gefängnisaufenthaltes bereits vorwegnahmen. Hatte man den Sicherheitscheck am Eingang hinter sich, erwartete einen ein schier endloses Labyrinth aus orange gekachelten Gängen und rohen Betonpfeilern. Aufgang A, Trakt B, Aufzug C. Clara war mit Sean einmal hierhergekommen, als er fünfzehn war und so manche Gesetzesübertretung cool gefunden hatte. Unter den Neonleuchten, die allen Farben, die sich hierhin verirrten, einen kranken Schimmer verliehen, war nichts mehr cool. Nur deprimierend. Verbrechensverwaltung. Graubraun bespannte Wände in den Verhandlungssälen. Dunkelbraun furnierte Tische mit Metallfüßen aus den Siebzigern. Billiger Filzteppichboden. Und über allem ein Gefühl von Resignation. Man atmete die Müdigkeit der Richter, die sich tagein, tagaus die gleichen Lügen anhören mussten und dennoch jeden Abend mit einem Rest von Zweifel nach Hause gingen, und fror in der Angst der Angeklagten, ihrem Bemühen, ihre Haut zu retten mit Beteuerungen, Lügen und Schweigen. Nur eines spürte man nicht zwischen den kalten Kacheln und den trüben Fenstern: Unschuld. Das mochte davon herrühren, dass die Menschen, die hier arbeiteten, dazu verpflichtet waren, die Schuld zu beweisen, nicht die Unschuld. Die wurde von Gesetzes wegen zwar vermutet, hatte aber einen schlechten Stand, denn wer glaubt schon einer bloßen Vermutung? Und leider wurde sie oft genug auch gründlich widerlegt.
Angelo Malafonte wartete schon vor dem Sitzungssaal. Er hatte eine ungesunde, fast grünliche Gesichtsfarbe, und seine Augen schienen noch mehr gerötet als am Tag zuvor. Er trug ein weißes T-Shirt und eine dunkelblaue Jeans. Mehr Zugeständnisse an das Gericht schien er nicht machen zu wollen oder zu können. Immerhin waren T-Shirt und Jeans sauber. An seinem mageren rechten Oberarm prangte eine Tätowierung, verschnörkelte Runen, die sich wie ein Ring um den Bizeps zogen. Eine Sonnenbrille mit orangefarbenen Gläsern auf den gegelten, glänzend schwarzen Haaren und eine Kette mit einem Kreuz um den Hals vervollständigten das Bild, das man sich von einem kleinen, italienischen Dealer machte. Dazu war er nervös, knetete seine Finger und trat von einem Fuß auf den anderen. Claras Druck in der Magengegend verstärkte sich. Angelo Malafonte bot dem Richter und dem Staatsanwalt genau die Zielscheibe, die sie brauchten, um ihn zu verurteilen.
»Kommen Sie.« Clara winkte ihn in einen der langen Gänge. Dort stand ein großer Aschenbecher, mit Kippen vollgestopft. Sie bot ihm eine Zigarette an. »Versuchen Sie, sich zu entspannen.« Dankbar ließ sich der junge Mann Feuer geben. Clara zündete sich auch eine an. Weniger aus Solidarität, als um ihr eigenes, ungutes Gefühl zu beruhigen.
»Lassen Sie sich vom Richter nicht aus der Reserve locken. Ihrer Aussage vor der Polizei haben Sie nichts hinzuzufügen. Es ist ihr gutes Recht zu schweigen.« Sie lächelte ihm zwischen zwei Zügen – wie sie hoffte, ermutigend – zu.
»Avvoca’ ...«
»Ja?«
»Non mi mettono in galera, no?«
»So schnell sperrt man bei uns niemanden ein.« Clara warf ihrem Mandanten einen beunruhigten Blick zu. »Wer hat Ihnen nur den Quatsch mit dem Gefängnis eingeredet? Die wollen Ihnen doch nur Angst machen. Ein paar Gramm Marihuana sind selbst bei uns in Bayern noch kein Kapitalverbrechen.«
Doch Malafonte ließ sich nicht beruhigen. Clara sah die Panik in seinen Augen und fragte sich, weshalb dieser junge Mann solche Angst hatte. Sie hatte schon die unterschiedlichsten Typen vor Gericht vertreten. Solche, die tatsächlich abgebrüht waren, und solche, die nur so taten. Auch welche, die sich vor Angst fast in die Hose machten, waren dabei gewesen und das nicht selten. Doch diese Panik, diese Todesangst wegen eines so geringen Vergehens hatte sie noch nicht erlebt. Dabei hatte Malafonte Richter Oberstein noch gar nicht zu Gesicht bekommen.
Sie packte ihn spontan am Arm und schüttelte ihn ein wenig: »Was ist los mit Ihnen? Gibt es etwas, was Sie mir noch sagen sollten?«
Malafonte schüttelte den Kopf. »Ich habe von vielen gehört, die sie einfach wegsperren. Und dann zurück nach Italien.« Er schnippte mit den Fingern. Plötzlich starrte er Clara aus weit aufgerissen Augen an:
»Ich kann nicht nachhause. Auf keinen Fall.«
Clara ließ Malafontes Arm los. Etwas in seinem Gesichtsausdruck machte auch ihr Angst. »Weshalb?«, fragte sie schließlich. »Haben Sie dort etwas angestellt? Gibt es einen Haftbefehl? Sie müssen mir das sagen, Herr Malafonte! Ich muss so etwas wissen!«
Angelo Malafonte schüttelte den Kopf, doch er gab keine Antwort.
»Reden Sie mit mir, verdammt!« Clara war versucht, mit dem Fuß aufzustampfen, doch sie drückte nur energischer als notwendig die Zigarettenkippe in den Aschenbecher.
Der junge Mann wandte ihr sein blasses Gesicht zu und sagte: »Sie werden mich töten.«
Clara spürte, wie sich ihre Nackenhaare aufstellten. »Was ...«, begann sie, bemüht, ihren Schrecken, der mehr durch Angelos Gesichtsausdruck, als durch seine Worte verursacht worden war, nicht zu zeigen. Doch in dem Moment rief sie eine blecherne Lautsprecherstimme in den Sitzungssaal.
»Herr Angelo Malafonte. Geboren am 11. März 1983 in San Sebastiano in Kalabrien. Von Beruf Pizzabäcker. Wo wohnen Sie derzeit?«
...
»Herr Malafonte?«
»Ainmillerstraße 31, Pizzeria Napoli.«
»Wollen Sie mich verarschen? Ihre Wohnungsadresse. Sie werden doch kaum hinter dem Tresen schlafen.« Richter Oberstein lachte.
Als Malafonte die Bemerkung übersetzt bekam, zuckte er zusammen und sank, was kaum möglich war, noch tiefer in seinen Stuhl.
»Ich darf Sie bitten, solche unsachlichen Bemerkungen zu unterlassen. Sie verunsichern meinen Mandanten unnötig«, wandte Clara scharf ein.
»Und ich darf Sie darauf hinweisen, dass der Angeklagte verpflichtet ist, ordnungsgemäße Angaben zu seiner Person zu machen«, gab der Richter kühl zurück.
Ein bittender Blick von Malafonte veranlasste Clara, nichts weiter zu erwidern. Vielleicht war es besser, die Sache nicht bereits zu Anfang eskalieren zu lassen.
»Ich ’abe Zimmer dort. Erste Stock«, antwortete Malafonte schließlich unbeholfen auf Deutsch.
»Was verdienen Sie?«
»Fünfhundert Euro. Und Zimmer und Essen.«
»Und Zimmer und Essen. Aha.« Der Richter warf dem Staatsanwalt einen viel sagenden Blick zu, bevor er sich Notizen machte.
»Wollen Sie zur Sache aussagen?«
»Mein Mandant wird nicht aussagen ...«, begann Clara, doch sie wurde von Malafonte unterbrochen: »Ich bin nicht gewese’, Herr Richter, ich gar nicht da, ich zuhause.«
»Zuhause, so so.« Der Richter machte sich weiter Notizen, ohne Claras Einwurf zu beachten. »Wann war denn das?«
»Herr Richter, mein Mandant wird von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen ...«, versuchte Clara es noch einmal, wurde jedoch wieder von Malafonte unterbrochen: »In August.«
Der Richter lachte, und auch der Staatsanwalt, ein blasser junger Mann mit Brille, konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Ihr Mandant scheint anderer Meinung als Sie zu sein, Frau Verteidigerin. Haben Sie ein Verständigungsproblem?«
Clara wurde rot und schwieg. Sollte er sich doch um Kopf und Kragen reden, der Idiot.
»Können Sie den Zeitraum etwas eingrenzen, Herr Malafonte?«
Clara sah es kommen. Sie sah es an der Körperhaltung Malafontes. Seine Schultern rutschten nach vorne, seine Handflächen öffneten sich und tatsächlich: Den Blick auf seine Knie gerichtet, zuckte der junge Italiener ein wenig mit den Achseln: »No’ lo so.«
»Ach, Sie wissen es nicht?« Obersteins Stimme war trügerisch sanft. »Nun, ist ja auch schon über ein halbes Jahr her. So etwas vergisst man leicht, besonders wenn man sich so dann und wann einen Joint reinzieht, nicht wahr?«
Malafonte nickte, noch bevor Clara auch nur ein Wort des Protestes äußern konnte. Auf seiner Stirn glänzten Schweißperlen.
»Nur Konsum. Kleine Menge. Nicht strafbar.«
Clara stöhnte innerlich und gab Malafonte unter dem Tisch einen Tritt. »Halten Sie endlich Ihre Klappe, verdammter Idiot«, zischte sie auf Italienisch. Die Übersetzerin warf ihr einen erschrockenen Blick zu.
Richter Oberstein fletschte seine Zähne zu einem Haifischlächeln: »So, so, nicht strafbar. Hat Ihnen das Ihre Verteidigerin erzählt, oder haben Sie sich schon vorher schlau gemacht? Egal, ich werde Ihnen einmal erzählen, wie das bei uns läuft: In Bayern existiert diese Regel nicht, kapito? Das liegt nämlich im Ermessen des Richters, und der Richter in diesem Verfahren bin ich. Und für mich sind sieben Gramm Marihuana siebenmal Grund genug, Sie einzusperren.«
Noch bevor Clara protestieren konnte, winkte Oberstein ab. »Genug getändelt, lassen Sie uns zur Sache kommen.«
Während der Staatsanwalt in monotonem Singsang die Anklage verlas, redete Clara ihrem Mandanten ins Gewissen. Doch der schien gar nicht mehr aufnahmefähig zu sein. Er nickte zwar, aber sein Blick war abwesend. Sein Gesicht glänzte vor Schweiß, und seine Augen waren trübe. Er starrte abwesend in die Ferne, wo ihn eine Heimsuchung zu erwarten schien, von der Clara nichts wusste.
Es kam, wie es kommen musste: Der Richter entschied, das Protokoll der Aussage des Massimo Moro zu verlesen, wobei die beiden Seiten, die in Malafontes Akten fehlten, stillschweigend übergangen wurden, und begründete die fehlende Ladung schlicht mit »Unauffindbarkeit« des Zeugen.
Er lehnte Claras Beweisanträge ab und setzte sich über ihre zahlreichen Einwände hinweg. Am Ende drohte er ihr sogar, Schritte einzuleiten wegen »mutwilliger Prozessverschleppung«. Für den Angeklagten hatte er am Ende der »Beweisaufnahme« noch den Hinweis übrig, er habe sich selbst »reingeritten«, in dem er nicht sofort gestanden hatte. Die Namen seiner Kunden und die der Lieferanten, und man hätte »über alles reden können«. Claras empörtes Verlangen, diese Bemerkung in das Protokoll aufzunehmen, wurde, wie alle anderen Anträge auch, abgelehnt.
Angelo Malafonte saß während der gesamten restlichen Verhandlung unbeweglich auf seinem Stuhl, die großen Hände, die so gar nicht zu seinen schmalen Schulten passen wollten, lagen auf seinen Knien. Er sagte kein Wort mehr, und Clara zweifelte daran, dass er der Übersetzerin überhaupt folgen konnte.
Während noch Claras wutentbranntes Plädoyer im fahlen Licht der Neonlampen folgenlos verhallte, kritzelte Richter Oberstein einige Zeilen auf seinen Notizblock. Clara war sich sicher, dass es sich schon um das Urteil handelte, doch auch dieser Verstoß gegen die Strafprozessordnung würde ungesühnt bleiben, da er nicht zu beweisen war. Dennoch entschloss sie sich zu einem letzten verzweifelten Versuch und hielt mitten im Plädoyer inne. Als Richter Oberstein erstaunt aufblickte, fragte Clara mit zusammengekniffenen Augen und ohne jegliche Höflichkeit in ihrer Stimme: »Was schreiben Sie da, Herr Richter? Doch nicht etwa das Urteil?«
Der Staatsanwalt zuckte erschrocken zusammen, und die Protokollführerin duckte sich unwillkürlich, wie in Erwartung eines Schlages.
Doch der Wutanfall von Richter Oberstein blieb aus, und Clara war nach dem vorangegangenen Desaster noch ein kleiner Triumph vergönnt: Reflexartig bedeckte der Richter die Seiten vor ihm mit der Hand und wirkte für einen kurzen Augenblick wie ein Schüler, den man beim Abschreiben erwischt hatte. Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch dann überlegte er es sich anders und räusperte sich. Er benötigte noch einige Sekunden, bis er seine Fassung zurückgewann. Dann schickte er Clara sein arrogantestes Grinsen hinunter: »Netter Versuch, Frau Verteidigerin. Sind Sie fertig mit Ihrem Plädoyer?«
Clara grinste zurück, doch es war eher ein Zähnefletschen: »Nein. Ich muss noch meine Anträge stellen.«
Richter Oberstein winkte huldvoll: »Tun Sie das, tun Sie das!«
Angelo Malafonte verzichtete auf sein letztes Wort, er schüttelte nur den Kopf, und so wurde fünf Minuten später das Urteil verkündet.
Clara hatte nach dieser Verhandlung mit dem Schlimmsten gerechnet, doch das, was sie zu hören bekam, überstieg ihre bisherige Vorstellung von »schlimm« bei weitem: Richter Oberstein befand den Angeklagten nicht nur des Besitzes, sondern auch des gewerbsmäßigen Handels mit Rauschgift für schuldig. Er stützte sich dabei auf die Zeugenaussage von Massimo Moro, der sich in der Vernehmung durch ihn selbst als »rundherum glaubwürdig« dargestellt hatte. Aus der »Lebenserfahrung« des Richters ergäbe sich, dass Moro »keinen vernünftigen Grund« gehabt hatte, Angelo Malafonte ungerechtfertigt anzuzeigen. Als strafverschärfend wertete der Richter überdies die »Verstocktheit« des Angeklagten und seine Weigerung, mit dem Gericht zusammenzuarbeiten. Er verurteilte Angelo Malafonte daher zu einer Gefängnisstrafe von 18 Monaten ohne Bewährung.
Clara schnappte nach Luft. Sie konnte nicht glauben, was sie da hörte. Sie sprang auf und rief, eine Hand wie zur Beschwörung auf die Schulter ihres Schützlings gelegt, dem diese Ungeheuerlichkeit gerade noch übersetzt wurde: »Wir legen Berufung gegen dieses Urteil ein. Sie können sich die Rechtsbelehrung sparen.«
Der Richter lächelte: »Nicht so ungestüm, Frau Niklas. Ich bin noch nicht fertig: Gegen den Angeklagten wird außerdem sofortiger Haftbefehl erlassen. Es besteht Fluchtgefahr, da der Angeklagte Ausländer ist und keinen festen Wohnsitz in Deutschland unterhält. Als Anschrift konnte er nur die Adresse einer Pizzeria angeben.« Er drückte auf den Lautsprecherknopf: »Heinzeller und Lieroth bitte in den Sitzungssaal.« Als die Türe sich öffnete und zwei Polizeibeamte hereinkamen, sprang Angelo Malafonte auf. Wie ein gehetztes Tier blickte er sich um, und sein Blick blieb an Clara hängen. Die beiden Beamten legten dem jungen Mann Handschellen an. »Gemma!«
Clara blickte ihm nach, noch immer fassungslos. »Es tut mir leid«, murmelte sie. »Es tut mir so leid.« Dann packte sie mit gesenktem Kopf ihre Papiere zusammen und verließ grußlos den Saal.
Clara rannte an der Pforte vorbei, als wäre sie auf der Flucht. Zum Glück kannte der Beamte die kleine, rothaarige Anwältin mit dem energischen Kinn und dem extravaganten grünen Tweedmantel, sonst hätte er sie womöglich festgehalten. So blickte er ihr nur verblüfft nach, als sie an ihm vorbeirauschte, mit hochrotem Kopf, das Kinn kämpferisch nach vorne gestreckt. Claras Hände zitterten, als sie vor dem Gerichtsgebäude ihre Zigaretten hervorkramte und erfolglos versuchte, sich eine anzuzünden. Ein Kollege, den sie flüchtig kannte, gab ihr im Vorbeigehen Feuer. Sie warf ihr leeres Feuerzeug mit einer heftigen Bewegung in die staubgrünen Blumenrabatten, die sogar jetzt, im frühlingshaften März, aussahen, als seien sie nach einem Umzug in der alten Wohnung vergessen worden, und nahm einen tiefen Zug. Vergeblich versuchte sie, sich zu beruhigen. Ihr Herz hämmerte im Hals, und sie spürte die Wut bis in die Fingerspitzen. Distanz, Distanz, flüsterte eine Stimme irgendwo in ihrem Kopf, leise und ohne Chance. Sie krümmte ihre Finger wie zu Krallen, und wäre ihr Richter Oberstein jetzt gegenübergestanden, sie wäre ihm an die Kehle gefahren.