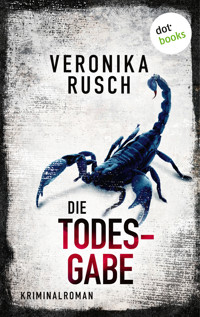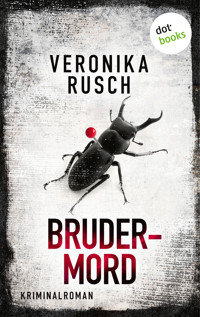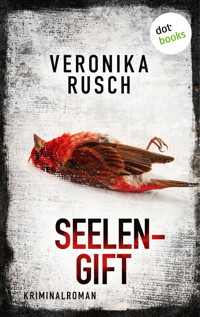
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Clara Niklas
- Sprache: Deutsch
Wenn Rivalen sich verbünden müssen ... Der packende Kriminalroman »Seelengift« von Veronika Rusch jetzt als eBook bei dotbooks. Nackt liegt das Opfer am Ufer des Eisbachs ... Der Schock sitzt tief: Als Hauptkommissar Walter Gruber zu einem Tatort im Englischen Garten gerufen wird, muss er entsetzt feststellen, dass die Tote, die eingekeilt im Unterholz gefunden wurde, seine Frau ist – und er bald der Hauptverdächtige. Von seinen Kollegen im Stich gelassen und verhaftet, bleibt ihm nur die Hilfe seiner ewigen Gegenspielerin, der Rechtsanwältin Clara Niklas. Gemeinsam stoßen sie auf eine mysteriöse Spur und rollen einen alten Fall wieder auf, der Parallelen zu dem Mord an Grubers Frau aufweist. Doch je näher sie dem Täter kommen, desto mehr gerät Clara in sein Visier ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Kriminalroman »Seelengift« von Veronika Rusch ist der dritte Band ihrer Reihe um die Rechtsanwältin Clara Niklas, die Fans von Inge Löhnig und Elisabeth Herrmann begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Nackt liegt das Opfer am Ufer des Eisbachs ... Der Schock sitzt tief: Als Hauptkommissar Walter Gruber zu einem Tatort im Englischen Garten gerufen wird, muss er entsetzt feststellen, dass die Tote, die eingekeilt im Unterholz gefunden wurde, seine Frau ist – und er bald der Hauptverdächtige. Von seinen Kollegen im Stich gelassen und verhaftet, bleibt ihm nur die Hilfe seiner ewigen Gegenspielerin, der Rechtsanwältin Clara Niklas. Gemeinsam stoßen sie auf eine mysteriöse Spur und rollen einen alten Fall wieder auf, der Parallelen zu dem Mord an Grubers Frau aufweist. Doch je näher sie dem Täter kommen, desto mehr gerät Clara in sein Visier ...
Über die Autorin:
Veronika Rusch studierte Rechtswissenschaften und Italienisch in Passau und Rom und arbeitete als Rechtsanwältin in Verona sowie in einer internationalen Anwaltskanzlei in München, bevor sie sich selbständig machte. Heute lebt sie als Schriftstellerin wieder in ihrem Heimatort in Oberbayern. Neben Krimis schreibt sie historische und zeitgenössische Romane sowie Theaterstücke und Kurzgeschichten. Ihre Werke wurden mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem 2. Platz im Agatha-Christie-Krimiwettbewerb und dem DELIA-Literaturpreis.
Veronika Rusch veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre Krimireihe um die Anwältin Clara Niklas mit den Bänden »Das Gesetz der Wölfe«, »Brudermord«, »Seelengift« und »Die Todesgabe«.
Die Website der Autorin: https://www.veronika-rusch.de/
Die Autorin bei Instagram: instagram.com/veronikarusch
***
eBook-Neuausgabe Juli 2023
Copyright © der Originalausgabe 2011 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Dmitry Prudnichenko, Nadia Chi, Edward Fielding
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ys)
ISBN 978-3-98690-790-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Seelengift«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Veronika Rusch
Seelengift
Kriminalroman
dotbooks.
Es wird nicht genug sein, dir zu sagen:
»Ab heute bist du wieder die alte.«
Ich sehe es dir an: du träumst noch von deinem Handwerk.
Der Griff ums Messer wird dich erinnern,der einsame Spaziergänger wird dir Lust machen.
Die Frauen werden erschrecken, wenn du ihre Kinder hochhältst,und die Männer werden bei deinem Anblick zu sprechen aufhören.
Dein Handwerk ist noch in dir, ich sehe es dir an.
Versteck dich.
Günther Anders»Heimkehrender Mörder spricht zu seiner Hand«
PROLOG
Entsetzt starrte er den Mann an, der vor der Haustür stand und auf den Klingelknopf drückte. In der letzten Zeit hatte er ihn zunehmend aus den Augen verloren. Nicht mehr so auf ihn geachtet, wie er es hätte tun müssen. Blanker Hohn war es, dass er ihn hier wiedersah. Natürlich hier. Wo sonst? Es war so klar, so einfach. Und er hatte es nicht gesehen. Verachtung stieg in ihm auf. Wie hatte er nur so nachlässig, so blind sein können? Er presste seine Lippen zusammen und wartete darauf, dass dem Mann geöffnet wurde.
Als das Licht im Treppenhaus anging, zog er sich weiter in den Schatten der hohen Buche zurück, um nicht gesehen zu werden. Das wäre das Schlimmste. Wenn sie ihn hier entdecken würde. Seine Finger krampften sich um das kleine Päckchen, das er in den Händen hielt. Jetzt ging die Tür auf, und er konnte sie sehen. Sie hatte sich fein gemacht, trug einen schwingenden, schwarzen Rock aus leichtem Stoff, der knapp bis unter die Knie reichte, und eine tief ausgeschnittene Bluse. Schimmernde Strümpfe, hochhackige Schuhe. Für ihn hatte sie sich noch nie so angezogen. Natürlich nicht. Warum auch? Er verzog den Mund. Wie hatte er nur glauben können ..., wie hatte er nur annehmen können ...? Seine Hände umklammerten das Päckchen immer fester, und er konnte hören, wie das Papier riss. Ein hübsches Papier hatte er gekauft, mit Flugzeugen darauf. Genau das Richtige für einen kleinen Jungen. Er hatte ganz lange in dem Schreibwarengeschäft gestanden und die vielen Bogen Geschenkpapier studiert, die dort auf den silbernen Bügeln hingen. Fast nur Mädchensachen: rosa, mit Bärchen und Blümchen und Mäuschen und Kätzchen. Er hatte den Kopf geschüttelt. Immer und immer wieder. Nein. Das war alles nicht das Richtige. Eine Verkäuferin hatte sich ihm genähert, und er hatte sich schnell weggedreht, damit sie ihm keine dieser Fragen stellen konnte: Was wünschen Sie? Kann ich Ihnen helfen? Nein danke. Er konnte sich schon selber helfen. Am Ende hatte er dann das Richtige gefunden, unter Glitzerpapier mit Schafen versteckt: einen dunkelblauen Bogen festen Papiers mit Flugzeugen darauf. Keine kindischen, knuffigen Babyflieger mit Augen und einer Nase statt eines Propellers, sondern naturgetreue Doppeldecker in Rot, Gelb und Grün. Keine Wölkchen, keine Sterne. Nur die Flieger, fein gezeichnet, auf nachthimmelblauem Grund. Er hatte eine grüne Schleife dazu gekauft, aus Stoff, genau einen Zentimeter breit. Für so etwas hatte er ein Auge. Zu Hause hatte er das Band noch einmal nachgemessen. Es stimmte genau: einen Zentimeter breit. Dann hatte er das Geschenk eingepackt. Sorgfältig und ohne einen Streifen Tesafilm.
Sie umarmten sich nicht. Ein höfliches Händeschütteln, ein wenig distanziert, wie er sofort bemerkte. Und er, er schien verlegen, wahrscheinlich ärgerte er sich, dass er keine Blumen mitgebracht hatte, wusste nicht, wohin mit seiner linken Hand. Er konnte sehen, wie er nervös am Saum seiner Jacke zupfte. Trotzdem: Sie hatte sich hübsch gemacht, hatte ihn erwartet. Sie waren verabredet. Bittere Galle stieg in ihm hoch, und er schluckte heftig. Jetzt bat sie ihn herein, mit einer offenen, einladenden Geste. Und dann, für einen winzigen Augenblick, ruhte ihre Hand auf seinem Rücken. Eine vertraute Geste, die ihn mitten ins Herz traf. Er senkte hastig den Blick auf seine Schuhspitzen, als habe er etwas Obszönes gesehen. Als er den Kopf wieder hob, war die Tür geschlossen.
Es war bitterkalt in dieser Nacht. Mindestens 15 Grad unter null. Und obwohl es schon Anfang Februar war, lag nirgendwo auch nur ein Stäubchen Schnee. Nackt und kahl ragten die Äste der Bäume in den sternenklaren Himmel. In solchen Winternächten begriff man erst wirklich, dass es da oben nichts anderes gab als die eisige, unendliche Leere des Weltalls. Es gab kein Himmelszelt wie in dem Schlaflied für Kinder, kein Dach, das sich über einem wölbte, keinen Schutz. Es gab nichts.
Er spürte die Kälte jedoch kaum. Seine Augen waren auf die beiden leuchtenden Vierecke im ersten Stock des Hauses gegenüber geheftet, in der Hoffnung, irgendetwas zu erkennen. Silhouetten der beiden Menschen, die jetzt dort oben saßen und redeten. Er wusste genau, worüber sie sprachen. Er wusste es so genau, als säße er daneben. Sie sprachen über ihn. Über seine Dummheit. Seine grenzenlose Dummheit. Wahrscheinlich lachten sie sogar. Seine Finger, die noch immer um das Päckchen gekrampft waren, öffneten sich, und das kleine Paket fiel auf den Boden. Er merkte es nicht. Er merkte auch nicht, wie sich seine Hände wieder zusammenzogen und zu harten Fäusten ballten.
EINS
Die Sonne war zu weit entfernt, zu blass und zu schwach, um die klirrende Kälte zu durchdringen, die die Stadt seit Tagen gefangen hielt. Nur zögernd kletterte sie über die Baumwipfel, nur schamhaft langsam wagten sich ihre Strahlen auf die von schartigem Raureif bedeckte Rasenfläche. Die Eiskristalle begannen trotzdem zu funkeln, Zentimeter für Zentimeter, kalt und schön und spitz wie Glasscherben. Endlich lag die Wiese voll im Licht, glitzernd und totenstill. Im nördlichen Teil des Englischen Gartens war es auch im Sommer ruhiger als um den Kleinhesseloher See, den Monopteros und den Chinesischen Turm herum. Aber im Winter war es einsam. Eine weitläufige Parklandschaft aus Wiesenflächen, hohen Bäumen und einsamen Wegen, die vielleicht gerade deshalb so leer und verlassen wirkte, weil sie von Menschen geschaffen worden war. Ein kunstvolles, künstliches Stück Natur. Schön und gleichzeitig unendlich traurig.
Hauptkommissar Walter Gruber mied den Englischen Garten für gewöhnlich. Er mochte überhaupt keine Gärten und Parks. Nicht einmal dann, wenn sich Biergärten darin befanden. Sie deprimierten ihn. Aber eine besondere Abneigung empfand er für den Teil des Parks hinter dem Nordfriedhof, mit dem er nur schlechte Erinnerungen verband. Hier hatte sich seine Frau immer mit ihren Radlfreunden getroffen. Und bei diesen Radltreffen hatte sie den »Adi« kennengelernt, was das Aus für ihre Ehe bedeutet hatte. Gruber schloss für einen Moment die Augen, als er daran dachte, und versuchte, das bittere Gefühl hinunterzuschlucken, das ihn noch immer überkam, wenn seine Gedanken Adolf Wimbacher streiften.
Doch Adolf Wimbacher war passé. Stattdessen gab es die Möglichkeit eines neuen Anfangs. Eine echte Chance, und er gedachte, sie zu nutzen. Er würde dieselben Fehler nicht noch einmal machen. Er war keiner von denen, die sich nicht von der Stelle bewegen konnten, selbst wenn die ganze Welt um sie herum zusammenbrach. Es dauerte vielleicht ein wenig, ja, das schon, und so manch einer würde sagen, er sei stur und dickschädelig und ein Gewohnheitstier, und das stimmte auch, aber er konnte sich auch ändern. Langsam vielleicht und erst nach ein paar Schubsern und besser noch einem Fußtritt in den Allerwertesten, aber er konnte es. Und er würde es beweisen.
Aber nichts überstürzen. Keine zu großen Schritte und keine übereilten Entscheidungen. Langsam. Das hatte sie auch gesagt. Langsam. Mit jeder Geste, jedem Blick hatte sie es angemahnt. Er würde es beherzigen. Geduld hatte er, eine ganze Menge sogar. Und vor allem jetzt, nach den letzten Monaten, als ihm klar wurde, wie nahe er der Katastrophe seines Lebens gekommen war.
Er hatte seine Frau fast verloren. Hatte sie schon endgültig verloren geglaubt: an einen Versicherungsvertreter mit Stirnglatze und Schmerbauch. Und plötzlich, als er schon nicht mehr zu hoffen wagte, hatte er noch einmal eine Chance bekommen. Er würde sie nutzen. Er würde sie festhalten. Und nicht mehr loslassen.
»Aber langsam!«, mahnte er sich zum wiederholten Mal, als er endlich mit dem Freikratzen der Scheiben fertig war und in sein Auto stieg. Ganz sachte. Er rieb seine roten, eiskalten Hände und hauchte ein paar Mal hinein. Saukälte! Und dann auch noch eine Leiche im Freien. Das würde wieder blau gefrorene Zehen geben, trotz der zwei Paar dicken Socken, die er sich extra angezogen hatte.
»Herrgottsakrament!«, fluchte er, als der Wagen hustete und wieder abstarb. Er startete erneut, und beim dritten Versuch, kurz bevor die Batterie ihren Geist aufgegeben hätte, sprang der Wagen an. Mittlerweile waren die Scheiben schon wieder angefroren, diesmal von innen, doch Gruber machte sich nicht die Mühe, sie ein zweites Mal ordentlich freizukratzen. Am Ende würde der Wagen wieder absterben, und einen weiteren Startversuch machte die Batterie sicher nicht mehr mit. Er schaltete die Heizung auf Hochtouren und kratzte mit dem Schaber auf Augenhöhe zwei handtellergroße Gucklöcher frei. Dann fuhr er vorsichtig los, nach vorne gebeugt, die Augen konzentriert auf den kleinen Fleck Straße gerichtet, den er durch die freien Stellen erkennen konnte.
Es war nicht weit von seiner Wohnung in Milbertshofen zum Tatort. Er bog ein paar Mal um die Ecke, langsam, mit zusammengekniffenen Augen auf den Verkehr achtend, dann lichtete sich der Nebel auf der Scheibe. Die Gucklöcher vergrößerten sich, und er fuhr rechts auf den Frankfurter Ring. Dann bog er wieder ab, stadteinwärts, an der U-Bahn-Station Alte Heide vorbei.
»Gleich hinter dem Nordfriedhof, unmittelbar an dem Spazierweg, der am Schwabinger Bach entlangführt«, hatte Kollegin Sommer ihm am Telefon mitgeteilt.
Er hatte ihr ungläubig zugehört. Sogar nachgefragt: »An dem Spazierweg? An dem Spazierweg?«
»Ja, da sind doch die Parkplätze hinter dem Nordfriedhof, direkt an der Straße, und da geht ein Spazierweg ab, gegenüber ist eine große Wiese«, hatte sie ihm erklärt, so, als ob sie einen Idioten am anderen Ende der Leitung hätte, der sich in München nicht auskannte. Als ob er den Ort nicht kennen würde. Er kannte ihn nur zu gut, und das nicht nur wegen Adi und dem Radltreff seiner Frau.
»Bin in fünf Minuten da«, hatte er geraunzt und ohne ein weiteres Wort aufgelegt. Wie kam es, dass die Sommer sich nicht erinnerte? Konnte das sein? Oder erinnerte sie sich und fand es nicht wichtig? Eine Leiche vor, wann war das? Es war auch im Winter gewesen, kurz vor Weihnachten, also war es schon über ein Jahr her. So lange schon?
Gruber schüttelte den Kopf und seufzte. War das ein Zeichen zunehmender Senilität, dass man sich an die Dinge immer besser erinnerte, je weiter sie in der Vergangenheit lagen? Eigentlich hatte er sich den heutigen Morgen etwas anders vorgestellt. Ein bisschen Zeit zum Nachdenken hätte er sich gewünscht, eine Tasse Kaffee am Fenster seines Büros, ein bisschen Papierkram, bei dem man nicht viel denken musste. Und dann und wann ein hoffnungsvoller Blick auf das Handy, ob sie wohl ... oder ob er ... Nur ein kurzes »Hallo« und »Guten Morgen, na, ausgeschlafen?«. Nein – Zeit! Geduld! Doch schon diese Mahnung bereitete ihm eine stille Freude.
Denn sie bedeutete Hoffnung. Er würde es nicht mehr versauen. Diesmal nicht.
Er sah die Einsatzfahrzeuge schon von weitem. In den Parkbuchten entlang der Straße standen die Autos seiner Kollegen. Gruber parkte hinter dem Wagen von Kollegin Sommer und stieg aus. Plötzlich fühlte er sich müde. Er war nicht für eine neue Mordermittlung bereit. Hatte nicht die Kraft für unzählige Überstunden und den ständigen Druck von allen Seiten. Er dachte an die prüfenden Seitenblicke seiner Kollegin, ihren Ehrgeiz und ihre Perfektion, die ihm immer etwas unheimlich war, und seine Müdigkeit verstärkte sich noch. Seine Beine fühlten sich bleischwer an, und anstatt hinüber zu seinen Kollegen zu gehen, blieb er stehen, die Hände in den Manteltaschen, und hob seinen Blick in den frostigen, klaren Himmel. Er hatte in der Nacht kaum geschlafen, höchstens zwei, drei Stunden.
Ein feines, melancholisches Lächeln durchbrach seine Erschöpfung, als er an den Grund für den fehlenden Schlaf dachte, und das gab ihm neue Kraft. Eine neue Ermittlung würde ihn ablenken, würde ihm helfen, die Sache langsam angehen zu lassen, würde ihn am Grübeln hindern. Er klappte seinen Mantelkragen hoch und setzte sich endlich in Bewegung.
Unter den kahlen Bäumen an der Uferböschung erspähte er den kurzen, blonden Haarschopf von Sabine Sommer und daneben eine bunt geringelte Strickmütze. Sie gehörte zu Roland von der Spurensicherung. Roland Hertzner, Heavy-Metal-Fan und in seiner Freizeit Bassgitarrist in einer düsteren Band mit unaussprechlichem Namen. Ein supergenauer Arbeiter, der sich in die Untersuchung von Erdkrümeln und Staubflusen, und was sonst noch alles zu den Freuden seines Jobs gehörte, geradezu hineinfressen konnte. Jetzt stand er mit verschränkten Armen neben Sabine und hörte ihr zu, wie sie etwas erklärte. Hertzner senkte den Blick die Böschung hinunter. Der Schwabinger Bach, der von der Reitschule in Schwabing bis hinaus nach Freimann eine natürliche Grenze zwischen dem Englischen Garten und dem westlichen Stadtgebiet bildete und dann weiter durch die Isarauen bis nach Ismaning floss, machte hier am Rande der ausgedehnten Sportanlagen des Vereins Blau-Weiß eine Kurve. Eine flache Böschung führte zum Bach hinunter, der sich dort im Knick zu einem kleinen, flachen Teich verbreiterte. Im Sommer war es hier sicher sehr schön. Jetzt, im Winter, war die Stimmung melancholisch, fast ein wenig unheimlich. Kahles Gestrüpp stakte im Schatten einiger krumm gewachsener Bäume am Ufer, und auf dem Grund des Baches lag eine dicke Schicht brauner Blätter vom Herbst, was dem ansonsten klaren Wasser einen moorigen, bräunlichen Schimmer verlieh.
Gruber versuchte, der Beklemmung Herr zu werden, die ihn erfasste, als er Rolands Blick zu der Stelle folgte, wo die Leiche liegen musste: Es war genau dieselbe Stelle wie damals. Haargenau. Warum hatte die Sommer davon nichts am Telefon gesagt? Erinnerte sie sich tatsächlich nicht? Aber das konnte doch nicht sein. Es war nicht möglich. Sie war schließlich dabei gewesen, von Anfang an. Sicher, es hatte keine große Ermittlung gegeben, notgedrungen hatten sie den Fall nach kurzer Zeit eingestellt, aber ihn hatte er trotzdem sehr berührt. Und wütend gemacht, unglaublich wütend. Selten hatte er sich so hilflos gefühlt wie in dem Moment, als er diese Akte ins Archiv geben musste. Er wusste bis heute nicht einmal genau, warum ihn gerade diese Geschichte so betroffen gemacht hatte. Der Fall hatte im Grunde nicht einmal zu seinem eigentlichen Zuständigkeitsbereich gehört, zumindest nicht im strafrechtlichen Sinn. Für Gruber hatte das jedoch keinen Unterschied gemacht: Es war ein Verbrechen gewesen. Grausam, gefühllos, eiskalt. Und was das Schlimmste daran war: Niemand hatte dafür gesühnt.
Als Gruber das Absperrband hochhob und darunter hindurchschlüpfte, bemerkten ihn die beiden. Er hob grüßend die Hand, doch weder Roland noch Sabine grüßten zurück. Sie starrten ihn mit einem merkwürdigen Gesichtsausdruck an, und Gruber ließ die Hand sinken. Angst machte sich in seinem Magen breit, ohne dass er gewusst hätte, wovor.
»Was ist ...«, begann er und spürte, wie er zu zittern anfing. Die Kälte, versuchte er sich zu beruhigen, das ist diese mörderische Kälte. Er wollte zu ihnen hinuntergehen, doch eine abwehrende Handbewegung von Sabine Sommer hielt ihn davon ab.
Endlich, es sah aus, als habe Roland ihr erst einen Schubs geben müssen, kam sie zu ihm. »Warte!«, rief sie, »Bitte, Walter, warte ...«
Doch es war zu spät. Gruber konnte nicht mehr warten. Sein Blick hatte die Leiche bereits gefunden. Sie lag auf halber Höhe der Uferböschung, eingekeilt zwischen dem kahlen Unterholz, die nackten Glieder steif von sich gestreckt wie eine entsorgte Schaufensterpuppe.
Etwas in Gruber zog sich schmerzhaft zusammen. Es wurde dunkel um ihn herum. Der Himmel, vor wenigen Sekunden noch strahlend blau, verlor plötzlich an Farbe, ebenso wie alles andere. Gruber machte einen Schritt nach vorne, spürte, wie seine Kollegin versuchte, ihn festzuhalten, schüttelte ihren Griff ab. Noch einen Schritt, noch einen und noch einen. Er stolperte die Böschung hinunter auf den blassen Fremdkörper zu, der dort zwischen den Ästen steckte. Jemand fluchte, es war wohl Roland, doch Gruber nahm es nicht wirklich wahr. Dann war er angekommen, fiel auf die Knie und wusste nicht mehr weiter.
Er starrte auf den nackten Körper seiner Frau und konnte noch immer nicht begreifen, was er da sah. »Geduld«, flüsterte er, als habe das noch irgendeine Bedeutung. »Ich hätte doch Geduld gehabt ...« Er nahm ihre Hand. Sie war eiskalt, steif, nichts Vertrautes lag mehr darin. Er ließ sie wieder los und spürte, wie das Zittern stärker wurde. Sein ganzer Körper zitterte, doch es lag nicht an der Kälte, es kam von innen.
Ein Knacken hinter ihm verriet, dass die beiden Kollegen ihm gefolgt waren.
»Walter, bitte ...«, begann Sabine Sommer erneut, und Gruber fuhr herum.
»Weg!«, schrie er plötzlich. »Haut ab! Sofort!« Er machte eine drohende Handbewegung in Richtung Sabine, die sofort stehen blieb.
»Walter, du bist doch Polizist. Du weißt doch, dass wir die Spuren ...«
Er hasste diesen Ton, diesen behutsamen Polizisten-Betroffenheits-Scheißton, den er oft genug selbst angewandt hatte. Aber nicht bei ihm. Er stand auf und fing an, seinen Mantel aufzuknöpfen. Schlimmer als alles andere, absolut unerträglich war ihm plötzlich der Gedanke, dass die anderen seine Frau so sehen konnten: nackt, entblößt, den Blicken preisgegeben, ohne sich wehren zu können. Er spürte, wie ihm die Tränen in die Augen stiegen. Er achtete nicht darauf, zog seinen Mantel aus und breitete ihn über ihren leblosen Körper. Dann setzte er sich neben sie und wartete. Darauf, dass sie kämen und auf ihn einredeten, um ihn dazu zu bringen, wieder nach oben zu gehen. Versuchten, ihn mit einer Tasse Tee, einem Schulterklopfen, einem Hinweis auf seine Professionalität fortzulocken. Darauf, dass sie wütend würden und dann still, hilflos verstummten.
Es dauerte fast eine Stunde.
Irgendwann gab er nach, ließ sich von Roland auf die Beine ziehen, die er kaum noch spürte. Er setzte gehorsam einen Fuß vor den anderen und dachte dabei an die zwei Paar Wollsocken, die er extra angezogen hatte und die ein Weihnachtsgeschenk seiner Frau gewesen waren.
ZWEI
Clara träumte. Sie schwamm im Meer, seit Stunden schon. Allmählich gingen ihr die Kräfte aus. Sie würde ertrinken. Da war ein Boot, es schaukelte auf den Wellen, mal war es ganz nah, dann entfernte es sich wieder. Sie strengte sich an, schwamm, so schnell sie konnte, und kam ganz dicht heran. Eine Hand streckte sich ihr entgegen, sie griff nach ihr, mit letzter Kraft – und griff ins Leere.
Mit einem Ruck wachte sie auf. Sie lag in Micks Bett, und sie war allein. Ihre Hand, die im Traum so verzweifelt nach der Rettung gegriffen hatte, lag ausgestreckt auf der leeren Bettseite ihres Freundes. Langsam zog sie sie zurück und setzte sich auf. Es war keine gute Idee gewesen hierherzukommen. Hier fühlte sie sich noch verlassener als bei sich zu Hause. Sie stieg aus dem Bett und tappte zu Elise, ihrer großen, grauen Dogge, hinüber, um ihr einen guten Morgen zu wünschen. Nach anfänglichen Anpassungsschwierigkeiten hatte sich Elise, wie Clara auch, an die immer häufiger werdenden Ortswechsel zwischen ihrer und Micks Wohnung gewöhnt, und sie hatte mittlerweile auch einen Lieblingsplatz gefunden, der gleichzeitig Micks Lieblingsplatz war: einen alten Ohrensessel, der am Fenster stand und mit Stapeln von Büchern umgeben war wie ein Strandkorb von einer Sandmauer. Fehlten nur noch die Wimpel. Der Stuhl war, obwohl ziemlich groß, eigentlich zu klein für Elise, die den Umfang eines mittelgroßen Kalbes hatte, doch es schien sie nicht zu stören. Zusammengerollt, als sei sie ein kleines Kätzchen, kauerte sie auf dem Polster, und je nach Entspannungszustand hingen nach und nach verschiedene Körperteile darüber hinaus. Im Augenblick waren es ihr Kopf auf der einen und das rechte Hinterbein auf der anderen Seite. Es war Clara ein Rätsel, wie man in dieser Stellung schlafen konnte, selbst wenn man ein Hund war.
Sie ging auf der Seite des Kopfes in die Knie und kraulte Elise hinter den Ohren. Der Hund öffnete ein Auge und schnaufte freundlich. Zu mehr war er noch nicht zu bewegen. Clara lächelte und wanderte weiter zur Küchenzeile, die sich auf der anderen Seite des großen Raumes befand und ebenso verlassen wirkte wie die ganze Wohnung. Sie öffnete eine Schranktür, eine Schublade nach der anderen und seufzte. War ja klar gewesen: Tee, Tee, nichts als Tee. Wenn sie nicht für Kaffee sorgte, war keiner da. Es gab an Mick zwei Dinge, die so typisch englisch waren, dass Clara manchmal glaubte, er selbst habe seinen größten Spaß daran, diese Klischees am Leben zu erhalten: seine absolute Überzeugung, dass Tee das einzig mögliche Heißgetränk war, das man zu sich nehmen konnte, mit Ausnahme von heißem Whiskey für die ganz schweren Fälle, und seine Vorliebe für unverdauliches Frühstück, das er passenderweise »first heart attack« nannte und das werktags in der Regel aus riesigen, labbrigen Weißbrotscheiben mit lauwarmen weißen Bohnen in Tomatensoße bestand und an Feiertagen von zahllosen Eiern mit Speck und grünlichen Würstchen mit Sägespänefüllung gekrönt wurde. Der Gipfel jedoch waren die – Gott sei Dank seltenen – Gelegenheiten, an denen er außerdem gebratene Scheiben Blutwurst zu sich nahm, bei deren Anblick Clara ihr Croissant regelmäßig im Hals stecken blieb.
Aber heute war nichts dergleichen in seiner Küche zu finden. Nur Tee. Tee und Haferflocken für die magere Variante des englischen Frühstücksrituals, Porridge, das, wenn man Mick glauben mochte, ein Allheilmittel für jegliche Art von Unwohlsein am Morgen darstellte, was aus Claras Sicht kein Wunder war. Wer würde nicht nach ein paar Löffeln lauwarmen, fädenziehenden Haferschleims zur sofortigen Genesung tendieren und fluchtartig das Weite suchen?
Sie machte sich auf den Weg ins Bad. Also Frühstück bei Rita im Café. Das war ohnehin eine bessere Idee, als allein in der leeren Wohnung herumzusitzen und trüben Gedanken nachzuhängen. Was hatte sie sich nur dabei gedacht, hier zu übernachten? Als ob ein Raum, eine Wohnung allein trösten könnte. Als ob darin etwas von der Geborgenheit zurückbliebe, die nur ein bestimmter Mensch geben kann. Aber seit Mick fort war, kamen ihr des Öfteren solche wunderlichen Gedanken. Obwohl es ja erst zwei Wochen waren. Und drei Tage. Er war zu seiner Familie nach Newcastle gefahren, seine Schwester Katie hatte ein Baby bekommen. Mick hatte versucht, Clara zu überreden mitzukommen, doch sie hatte sich entsetzt geweigert. Familienveranstaltungen waren ihr bei ihrer eigenen Familie schon ein Gräuel, aber die Vorstellung, Mick zu begleiten und bei seiner Familie als seine Freundin aufzutreten, war schlichtweg unmöglich. Mick war neun Jahre jünger als sie, gerade einmal vierunddreißig, was zumindest für sie immer wieder Anlass zu Grübeleien war. Und dann noch ein Baby! Freudiges Familienereignis, Oma, Opa, Onkel, Tanten, was auch immer ...
Clara fing an, sich die Zähne zu putzen, und schnitt dabei ihrem etwas zerknitterten Spiegelbild eine Grimasse. Das fehlte gerade noch. Und was, wenn Mick auf die Idee kam, ein Baby wäre auch für sie beide eine gute Idee? Er war noch so jung. Sicher wollte er Kinder ... Clara verharrte mitten in der Bewegung. Ihr Gesicht war wie immer blass, hatte nicht viel mehr Farbe als der Zahnpastaschaum um ihren Mund, und ihre Augen waren von einem feinen Kranz Fältchen umgeben. Normalerweise sah man sie nicht so genau, aber dieses boshafte Neonlicht in Micks Bad hatte die Eigenschaft, jede Falte einzeln nachzuzeichnen. Was, wenn sie Mick klar machen musste, dass ein Baby für ihn vielleicht eine gute Idee war, aber nicht für sie, die schon einen erwachsenen Sohn hatte und für die das Thema längst abgehakt war? Clara spuckte den Schaum ins Waschbecken und spülte sich den Mund aus. Dann wusch sie sich das Gesicht so lange mit eiskaltem Wasser, bis es die Farbe eines frisch gesottenen Krebses angenommen hatte, und begann, mit feuchten Fingern ihre krausen Haare zu entwirren.
Der Morgen war bitterkalt. Aus den U-Bahn-Schächten stieg weißer Dampf, und Clara spürte nach wenigen Schritten ihre Nasenspitze nicht mehr. Elise drückte sich immer wieder zwischen ihre Beine, sodass Clara mehrmals ins Stolpern kam und die Dogge endlich fluchend eine Armlänge von sich schob. »Als ob es wärmer würde, wenn du mir zwischen die Füße läufst«, schimpfte sie. An Tagen wie diesem nahm sie sogar ihre Klaustrophobie in Kauf und zwängte sich mit halb geschlossenen Augen und so ruhig atmend wie möglich in eine vollbesetzte U-Bahn. Ihre Angstanfälle in solchen Situationen hatten seit dem letzten Jahr erheblich abgenommen, als sie sich im Zusammenhang mit einem dramatischen Fall mehr oder weniger freiwillig einer Schockbehandlung in Sachen Panikattacken unterzogen hatte. Seitdem konnte sie besser damit umgehen. Trotzdem gehörten U-Bahnen, Aufzüge und sonstige enge Räume mit vielen Menschen darin noch immer nicht zu den Orten, an denen sie sich gerne aufhielt.
Bei Rita war es warm und roch nach Kaffee und Gebäck, und Rita, mit frisch blondierten Haaren, im Rollkragenpullover und in Stiefeln zum üblichen, kurzen, engen Rock, winkte ihr freundlich zu. Der einzige Wermutstropfen war das Rauchverbot. Clara vermisste ihre Morgenzigarette zum Cappuccino schmerzlicher als jede andere Zigarette des Tages, und sie weigerte sich aus Prinzip, sich zum Rauchen auf die Straße zu stellen. Die Folge war ein erheblich eingeschränkter Zigarettenkonsum und eine leicht gereizte Stimmung, die zu bekämpfen sich Clara zwar redlich bemühte, was ihr jedoch nicht immer gelang. Heute ganz besonders nicht. Missmutig zerpflückte sie die Serviette, auf der ihr Croissant und das von Elise gelegen hatte, zu kleinen Kügelchen und kämpfte mit sich. In die Kanzlei hinübergehen und pünktlich aufsperren oder noch einen Cappuccino trinken? Ohne Zigarette? Zu allem Überdruss war zurzeit nicht nur Mick nicht da, sondern auch Willi Allewelt, Claras Sozius und langjähriger, guter Freund. Er hatte sich zusammen mit Linda, ihrer beider Sekretärin und neuerdings seiner ständigen Begleiterin, zum Skiurlaub verkrümelt. Clara war im Moment also nicht nur zu Hause, sondern auch in der Arbeit allein, was ihre Motivation nicht gerade steigerte. Sie warf einen Blick auf die Uhr: fünf vor halb neun. Also gut, dann eben arbeiten. Einen Vorteil hatte Willis und Lindas Abwesenheit nämlich, Clara konnte überall ungestört rauchen, was sie mit Begeisterung tat. Irgendwo musste sie schließlich dafür sorgen, dass ihr Nikotinspiegel nicht zu sehr abfiel. Auf dem Weg zur Tür fiel ihr noch etwas ein: »Sag mal, Rita, wie wäre es mit einem Coffee to go?«
Rita starrte sie einen Moment verständnislos an. »To go?«, wiederholte sie. Dann, verstehend und mit sich verfinsternder Miene: »Cappuccio a portare via? Plastikbecher mit Schnabel zum Trinken? Che schifo, Madonna mia! Bist du verrückt?« Sie rang die Hände.
Clara lachte. »Nein. In einer schönen, großen Porzellantasse und nur für mich und nur für gegenüber! Ja? Bitte, bitte!« Sie deutete auf ihre Kanzlei und machte eine Handbewegung, die Rauchen! signalisieren sollte.
»Ah!« Ritas Miene hellte sich ein wenig auf. »Aber dass mir das nicht zur Gewohnheit wird, eh? Was ist schon ein Café ohne Gäste? Kann man sich gleich den caffè aus dem Internet bestellen!«
Sie wedelte zur Bekräftigung mit den Händen noch ein bisschen zornig in der Luft herum und begann dann, halblaut auf Italienisch vor sich hin schimpfend, an der Kaffeemaschine herumzuhantieren. Clara wusste, wem ihre Beschimpfungen galten: den Politikern im Allgemeinen, deutschen wie italienischen, und zurzeit mit Vorliebe den bayerischen Politikern im Besonderen, weil diese das Rauchverbot verbrochen hatten. Es war ihr auch egal, dass dieselben Politiker seit einiger Zeit schon wieder damit begonnen hatten, das Objekt ihres Zorns aufzuweichen, und ihr Geschäft bisher keine größeren Einbußen zu verzeichnen gehabt hatte. Eine derartige Einmischung seitens des Staates in affari propri konnte sie schon aus Prinzip nicht gutheißen. Sollte er sich doch um seine eigenen Angelegenheiten kümmern, dieser Staat, da hatte er genug zu tun, und anständige Leute in Frieden lassen.
Die Kanzlei war, mit Ausnahme von Claras Schreibtisch, geradezu unanständig aufgeräumt. Linda hatte vor ihrer Abreise noch etliche Überstunden geschoben, um auch wirklich jeden Brief zu beantworten, jeden noch so kleinen Vermerk zu bearbeiten, jeden Anruf zu erledigen und jede aktuelle Akte sorgfältig mit Notizen zu versehen und eine lange Liste mit Hinweisen für Clara zu erstellen, die ihr Überleben und vor allem das der Kanzlei sichern sollten. Diese Liste handelte vom ordnungsgemäßen Heizen des Schwedenofens über die Tücken des Faxgerätes und das Versteck des Kopierpapiers bis hin zu mit drohenden Ausrufezeichen versehenen Erinnerungen an fällige Schriftsätze alle erdenklichen Katastrophen ab, die sich während ihrer einwöchigen Abwesenheit ereignen könnten. Clara hatte die Liste mit einem spöttischen Strammstehen quittiert, sich aber angesichts von Lindas Ernst und Willis warnendem Blick jede weitere Bemerkung verkniffen und stattdessen pflichtschuldig genickt. Ja, sie würde sich um den Weihnachtsstern auf dem Fensterbrett kümmern, natürlich, und ja, sie würde bestimmt am Montag Frau Rampertshofer in ihrer Scheidungssache anrufen, versprochen. Ganz sicher. Und sie würde auch Herrn Malic anrufen und über den Termin nächste Woche sprechen, und sie würde seine Strafakte unbedingt bis spätestens Dienstag zurückschicken ...
Dann waren sie abgezogen, und Clara hatte ihnen nachgelächelt und sich wunderbar gefühlt bei dem Gedanken, einmal eine ganze Woche lang die Kanzlei für sich allein zu haben. Doch da hatte das zweite einsame Wochenende noch vor ihr gelegen, und Mick hatte noch nicht angerufen und ihr mitgeteilt, dass er noch eine Woche länger in Newcastle bleiben würde.
Jetzt hielt sie Lindas Liste in den Händen, und ihr Blick wanderte unschlüssig zur Akte Rampertshofer gegen Rampertshofer. Sie fühlte sich definitiv nicht in der Verfassung, Frau Rampertshofer anzurufen. Clara seufzte. Sie konnte die Frau ja grundsätzlich verstehen. Ihre Wut, ihre Verletztheit, ihre Existenzängste. Aber jedes Mal, wenn sie mit ihr gesprochen hatte, fühlte sie sich danach so ausgelaugt wie nach einem Boxkampf über zehn Runden. Technisches K.o. oder besser, K.o. durch Erschöpfung. Und keines ihrer Gespräche brachte sie weiter. Keines der langen, von Wutausbrüchen und Tränen durchtränkten Telefonate und Treffen in der Kanzlei führte dazu, dass sie in dem Rechtsstreit auch nur einen Zentimeter vorankamen. Spielte es eine Rolle, ob die Gardinenstangen im Wohnzimmer ein Geschenk der Mutter des Ehegatten oder von Frau Rampertshofer selbst gekauft worden waren? Brachte es sie weiter, wenn der Ehemann darüber Buch führte, wie lange der gemeinsame Sohn für die Hausaufgaben brauchte, wenn er zu Besuch bei ihm war, und verlangte, diese Zeiten mit denen bei der Mutter zu vergleichen, als Beweis für deren Unzulänglichkeit bei der Erziehung der Kinder? Claras Seufzen vertiefte sich, als sie an ihren letzten Gerichtstermin dachte, bei dem sich die beiden Eheleute fast an die Gurgel gegangen waren, als es darum ging, wer darüber zu entscheiden habe, welches Mountainbike für die Tochter angeschafft werden solle, und wer die Kosten für die Zahnspange und den Musikunterricht zu übernehmen habe. In dieser Verhandlung hatte sie mit den vereinten Kräften des Richters und sogar des gegnerischen Anwalts zu regeln versucht, welche Geschenke für die Kinder als angemessen anzusehen wären, ob ein Computerspiel »außer der Reihe« ein Bestechungsversuch um die Gunst des Sohnes darstelle und ob die Mutter es verbieten könne, dass der Tochter eine Barbie geschenkt würde, da sie diese Puppen für pädagogisch schädlich hielt, als Auslöser von Magersucht und Konsumwahn. Ihre Bemühungen waren vergeblich geblieben. Die Verhandlung hatte keine Einigung, ja nicht einmal einen Minimalkompromiss gebracht. Also würde es weitergehen. Mindestens noch ein Jahr oder auch zwei oder drei. Blieb zu hoffen, dass die Kinder diesen ebenso scheinheiligen wie verbitterten Stellvertreterkrieg der Eltern um das angebliche Kindeswohl einigermaßen unbeschadet überstanden. Aber sie befürchtete, dass sich diese Hoffnung nicht erfüllen würde. Auf den Nebenkriegsschauplätzen blieb immer am meisten verbrannte Erde zurück.
Sie hakte feige, aber ohne schlechtes Gewissen den Punkt Rampertshofer als erledigt ab und griff sich eine der anderen Akten, die mit leuchtenden Klebezetteln versehen waren: Fristsache! Verhandlung!! Eilt!!!
Gerade als sie nach dem Diktiergerät greifen wollte und ihr gleichzeitig klar wurde, dass Diktieren bei Abwesenheit der Schreibkraft wenig sinnvoll war, klingelte die Türglocke, ein Relikt aus alten Zeiten, in denen die Kanzlei ein Buchladen gewesen war. Clara hob überrascht den Kopf. Sie erwartete niemanden.
In der Tür stand ein junger Mann und sah sich suchend um. Clara hatte ihn noch nie gesehen. Sie stand auf und ging die wenigen Treppen zum Eingangsbereich hinunter.
»Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen?« Sie musterte ihn neugierig. Er war etwa Anfang zwanzig, blass, dunkelhaarig und schien sich definitiv nicht wohl in seiner Haut zu fühlen. Unruhig trat er von einem Fuß auf den anderen, und sein Blick flatterte zwischen Clara und seinen Schuhspitzen hin und her. Er hatte dunkle, sehr dunkle Augen, die Clara an jemanden erinnerten, doch sie kam nicht darauf, an wen.
»Kann ich Ihnen helfen?«, wiederholte sie, nachdem der Mann nicht geantwortet hatte.
»Sind Sie Rechtsanwältin Clara Niklas?« Der Blick des jungen Mannes traf endlich Claras Augen.
»In voller Größe.« Sie reckte sich und lächelte aufmunternd. »Was haben Sie denn auf dem Herzen?«
Der junge Mann schnappte nach Luft, als befände er sich kurz vor dem Ertrinken, und schloss für einen Moment gequält die Augen. »Also ...«, begann er zögernd, stoppte wieder und schluckte schwer. »Mein, mein Vater hat mich zu Ihnen geschickt ...« Seine Stimme erstarb.
»Ja?«, versuchte Clara ihm auf die Sprünge zu helfen. »Worum geht es denn?«
»Sie haben ihn ... äh ... heute Morgen haben sie ihn ...«, er begann zu stottern, und sein blasses Gesicht wurde rot. »Sie haben ihn verhaftet!«, stieß er endlich hervor, und sein Kinn fing vor Erregung an zu zittern. Er biss sich auf die Lippen.
Clara nahm ihn vorsichtig am Arm: »Kommen Sie mit nach oben. Dort können Sie mir alles in Ruhe erzählen.«
»Ihr Vater wurde also heute Morgen verhaftet«, begann Clara behutsam, als sie oben an ihrem Schreibtisch saßen. »Wissen Sie, was man ihm vorwirft?«
Der Mann nickte und wandte den Blick ab. »Mord«, flüsterte er, und nach einer Ewigkeit und dem verzweifelten Versuch, seine Gesichtszüge wieder unter Kontrolle zu bekommen, fügte er hinzu: »An meiner Mutter.« Dann fing er zu weinen an.
Clara sah ihn erschüttert an. Öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, und klappte ihn dann wieder zu. Nach einigen Augenblicken des Schweigens, in denen sich der Mann wieder zu sammeln versuchte, unternahm sie einen neuen Anlauf. Sie verkniff sich sinnlose Worte der Anteilnahme, die ohnehin nur heuchlerisch gewirkt hätten, und fragte stattdessen so sachlich wie möglich: »Ihr Vater möchte also, dass ich ihn vertrete?«
Der junge Mann nickte.
»Er ist hier in München in Haft?«
Wieder ein Nicken.
Clara nahm einen Zettel. »Dann bräuchte ich noch seinen Namen und die Wohnanschrift ...«
»Gruber. Walter Gruber.«
Clara hob den Kopf. »Walter Gruber?«, wiederholte sie ungläubig. Das war nicht möglich. Konnte nicht sein. »Ist er ...«, begann sie und starrte dabei auf ihren Stift, der bei dem Namen bewegungslos in der Luft verharrt war, »bei der Kriminalpolizei?«
»Ja. Kriminalhauptkommissar Walter Gruber, Abteilung Tötungsdelikte.« Die Mundwinkel des jungen Mannes zogen sich bitter nach unten, und schlagartig wurde Clara klar, woran sie diese dunklen, bohrenden Augen, der scharfe Blick von Anfang an erinnert hatten: an Walter Gruber, den Kommissar, mit dem und gegen den sie im vergangenen Jahr einen so verzweifelten wie vergeblichen Kampf geführt hatte.
»Sie sind Grubers Sohn!«, rief sie aus und konnte noch immer nicht glauben, was sie gerade gehört hatte. Erschüttert und ratlos zugleich angelte sie sich eine Zigarette aus der Schachtel und bot dem jungen Mann, der Armin hieß, Armin Gruber, wie er ihr jetzt mitteilte, auch eine an.
Er lehnte ab. Nichtraucher, seit zwei Jahren. Dann begann er zu erzählen. Fand nur dürre Worte, die das Schreckliche dahinter so wenig wie möglich berührten. Am Freitagmorgen habe man die ... Leiche seiner Mutter gefunden. Im Englischen Garten.
Sie war erwürgt worden.
Armin Gruber rieb sich ein paar Mal mit den Händen über das Gesicht, bevor er weitersprach.
Nachdem sein Vater ihn angerufen hatte, sei er am gleichen Tag noch nach München gekommen. Aus Berlin, fügte er erklärend hinzu. Und heute Morgen seien dann die Kollegen seines Vaters gekommen und hätten ihn mitgenommen. Ohne Erklärung. »Einfach so!« Seine Stimme zitterte zwar noch etwas, aber er hatte sich jetzt wieder in der Gewalt. »›Ruf die Niklas an‹, hat er noch zu mir gesagt. ›Rechtsanwältin Clara Niklas!‹« Er zögerte, warf ihr einen forschenden Blick zu. »Sie kennen sich näher?«
Clara schüttelte den Kopf. »Eigentlich nicht so besonders gut. Wir hatten letztes Jahr einen gemeinsamen Fall. Dabei haben wir uns allerdings die meiste Zeit gestritten.«
»Mein Vater kann Anwälte nicht ausstehen«, sagte Armin Gruber.
»Ich weiß.« Clara lächelte traurig.
DREI
Als an diesem Tag die Sonne unterging, fühlte er sich einen Augenblick lang frei. Die Kälte war den ganzen Tag über kaum gewichen, nicht einmal in den Mittagsstunden, und schon früh am Nachmittag wurden die Schatten eisig blau. Er saß am Fenster und sah hinaus. Sah die Sonne schwächer werden und schließlich hinter den Dächern verschwinden. Die Uhr an der Wand tickte.
Seine Gedanken wanderten durch die Straßen, kreuz und quer, und gelangten schließlich zu ihr. Er schreckte einen Moment zurück, wartete, doch es passierte nichts. Die Erde tat sich nicht auf, und kein Blitz fuhr auf ihn herab. Der Himmel blieb klar und unbeteiligt. Er wurde mutiger, tastete sich weiter vorwärts, bis er ihr ganz nahe kam. Bis er sie riechen konnte. Seine Gedanken begannen ein wenig zu zittern, zu flackern wie eine alte Glühbirne. Er konnte den Geruch nicht festhalten. Er warf einen weiteren Blick auf die Uhr, dann auf seine Hände. Es war Montag. Er war nicht gekommen. Anfangs hatte ihn das verunsichert, nervös gemacht. Das konnte doch nicht sein. Nahezu jede Minute hatte er auf die Uhr gesehen. Die Tür fixiert, den Schritten draußen im Treppenhaus gelauscht. Keinen Schritt hatte er selbst nach draußen gesetzt. Keinen einzigen Schritt. Um ihn nicht zu verpassen. Doch dann hatte er es im Radio gehört, in den Vier-Uhr-Nachrichten. Da hatte er verstanden, warum er nicht gekommen war. Und ihm war klar geworden, dass jetzt niemand mehr kommen würde. Nie mehr. Und da war es plötzlich, das Gefühl. Ganz leise am Anfang, fast schüchtern klopfte es an. Er ließ es herein: Es war zu Ende. Endlich. Er hatte sich befreit. Mit einem großen, einem gewaltigen Schlag hatte er sich befreit.
Das Zögern des Zeigers vor der vollen Stunde war kaum wahrnehmbar. Trotzdem hörte er es. Und auch das Klack, wenn sich der Zeiger schließlich losriss und die letzte Minute vollendete. Es unterschied sich vom üblichen Ticken, war lauter, satter. Endgültiger. Wie es sich für eine volle Stunde gehörte. Er bückte sich und hob sein Akkordeon auf die Knie. Behutsam steckte er beide Arme durch die Riemen und rückte es zurecht. Dann ließ er seine Finger lautlos über die Knöpfe und Tasten wandern, einmal nach unten, dann wieder nach oben, zog den Balg schnaufend auseinander und beugte sich nach vorne. Ganz eng angeschmiegt, den Kopf geneigt und mit geschlossenen Augen, begann er zu spielen.
***
Clara wartete bereits ein halbe Stunde. Sie fühlte sich äußerst unbehaglich, und das nicht nur wegen der bedrückenden Enge des Raumes. Sie hatte Angst, dem Mann gegenüberzutreten, auf den sie wartete. So gesehen konnte es, wenn es nach ihr ging, ruhig noch eine weitere halbe Stunde dauern, bis er kam. Ihre Finger fuhren an den abgeschabten Kanten des Tisches entlang, bohrten sich in eine Kerbe an der Ecke, kletterten weiter zu der Schachtel Zigaretten, die unberührt vor ihr lag, und machten kurz Halt, als sie den leeren Notizblock erreichten. Trommelten auf das weiße Papier, tam, tatatam, rollten den Füller hin und her und nahmen dann ihre Entdeckungsreise über den Tisch wieder auf.
Was sollte sie zu ihm sagen? In welcher Verfassung würde er sein? Sie versuchte, sich ein Bild zu machen, aber es gelang ihr nicht. Wie fühlte man sich, wenn die eigene Frau ermordet worden war? Man selbst dafür im Gefängnis saß? Als Polizist. Von den eigenen Leuten verhaftet.
Sie hatte es an dem Abend, nachdem Grubers Sohn zu ihr gekommen war, noch in den Nachrichten gehört. Eine äußerst knappe Meldung, nicht viel mehr als ein, zwei spröde Sätze. Clara konnte sich gut vorstellen, wie die Pressestelle der Polizei sich hatte überwinden müssen, überhaupt etwas davon preiszugeben. Ein Mordverdächtiger in den eigenen Reihen. Und nicht irgendein kleiner Streifenpolizist, dem die Nerven durchgegangen waren, nein, ein Kriminalhauptkommissar. Der Nachrichtensprecher hatte hörbar Mühe gehabt, den neutralen Ton seiner Stimme nicht zu verlieren. Man kannte Kommissar Gruber in München. Ein paar aufsehenerregende Ermittlungen der vergangenen Jahre gingen auf sein Konto, zuletzt der Fall Ruth Imhofen, an dem Clara nicht unmaßgeblich beteiligt gewesen war.
Als endlich die Tür aufging, fuhr sie zusammen. Nervös wischte sie sich ihre feuchten Hände an der Hose ab und stand zögernd auf.
Der Beamte, der Gruber hereinbrachte, fühlte sich in seiner Rolle ebenfalls sichtlich unwohl. Stumm und mit verlegen gesenktem Blick schloss er die Tür, während Gruber ein paar Schritte auf Clara zukam und dann stehen blieb.
Clara wollte ihm die Hand reichen, ließ es dann aber sein. »Hallo«, begann sie verlegen und musste sich räuspern.
Gruber nickte, und das altbekannte, bittere Lächeln erschien auf seinem Gesicht. »So sieht man sich wieder«, sagte er.
Sie setzten sich schweigend. Es war, als wäre zwischen ihnen nicht genügend Raum für Worte: Gruber und sie in diesem winzigen Zimmer, ein Tisch, zwei Stühle, der Beamte vor der Tür. Ihre Rollen hatten sich auf eine Art und Weise umgekehrt, die beide sprachlos machte.
Noch vor nicht allzu langer Zeit hätte Clara dieses Schweigen nicht ausgehalten. Sie hätte sofort angefangen, nach Worten zu suchen, um es zu durchbrechen, wäre vorgeprescht, hätte es mit vielen Worten und leeren Phrasen totgeschlagen. Heute war es anders. Clara hatte nicht das Bedürfnis, irgendetwas zu sagen. Sie empfand dieses gemeinsame Schweigen fast ein wenig erholsam nach dem inneren Aufruhr, den die Nachricht von Grubers Verhaftung und die Bitte an sie, ihn zu verteidigen, bei ihr verursacht hatten.
Gruber schien es ähnlich zu gehen. Er saß reglos auf seinem Stuhl, die Unterarme auf die Tischplatte gestützt, die Hände ineinander verschränkt, und starrte vor sich hin. Dann, nach einer Weile absoluter Stille, begann er zu sprechen.
Er flüchtete sich in Polizeiberichtjargon: Am Freitagmorgen hatte man an der Uferböschung des Schwabinger Bachs die Leiche einer Frau gefunden. Seine Kollegin Sommer hatte ihn gleich nach der Meldung angerufen, noch bevor jemand wusste, um wen es sich handelte. Erst ein Kollege von der Spurensicherung, Roland Hertzner, hatte Irmgard Gruber erkannt. Doch da war es zu spät gewesen, ihn noch vorzuwarnen. In Erinnerung an den Moment, in dem er seine Frau gesehen hatte, verlor Grubers Stimme den unbeteiligten Nachrichtenton und wurde brüchig. Er wandte den Blick von Clara ab, hinauf zu den winzigen Fensterschlitzen oben an der Wand.
Clara musterte ihn mitfühlend. Äußerlich merkte man ihm nichts an, er sah aus wie immer. Ein bisschen dünner vielleicht, aber das konnte täuschen, ein bisschen blasser. Aber seine Augen. Sie waren ... Clara fand keine Bezeichnung dafür, was aus dem einst so durchdringend scharfen Blick des Kommissars geworden war. Erschöpft. Verzweifelt. Müde. Nichts davon wurde dem gerecht, was sie sah. Manche Dinge konnte man nicht in Worte fassen.
Sie griff nach ihrem Füller, schraubte die Kappe auf und schrieb Grubers Namen auf den Block. Um irgendetwas zu tun. Um ihm Zeit zu geben.
Endlich redete er weiter. »Sie wurde erwürgt. Mit bloßen Händen, wie es aussieht.« Gruber wandte den Blick vom Fenster ab und starrte seine eigenen Hände an. Hob und streckte sie, drehte sie hin und her und schloss sie dann ganz langsam um einen imaginären Hals.
Clara fröstelte. »Hören Sie auf », bat sie, und ihre Stimme war alles andere als fest. »Bitte!«
Er ließ seine Hände sinken. »Entschuldigung.« Er sprach nicht weiter. Wartete auf ihre Fragen.
Clara zündete sich eine Zigarette an und wünschte, den Rauch so tief in ihre Lungen inhalieren zu können, dass nichts mehr davon herauskam. »Warum hat man Sie verhaftet?«, sprach sie endlich die Frage aus, die schon von Anbeginn im Raum stand. »Was für Verdachtsmomente sprechen gegen Sie?« Sie drückte sich absichtlich so vage, so betont anwaltlich aus, weil sie die andere Frage, die dahinterstand, nicht stellen wollte: Waren Sie es? Haben Sie Ihre Frau getötet?
Auf Grubers Gesicht erschien wieder dieses bittere Lächeln, das sie schon kannte. Doch jetzt lag noch so etwas wie Wehmut darin. Und tiefe, bittere Trauer. »Ich war bei ihr. Die ganze Nacht.« Er schluckte, sah Clara nicht an. »Gegen fünf Uhr morgens bin ich nach Hause gegangen. Wegen der Arbeit. Wollte noch duschen und mich umziehen und ... ein bisschen allein sein.«
Clara runzelte die Stirn. Waren Gruber und seine Frau nicht seit einiger Zeit getrennt gewesen?
»Wir hatten ... Es sah so aus, als ob wir wieder ...« Er konnte nicht mehr weitersprechen und vergrub sein Gesicht in den Händen.
Clara betrachtete angestrengt einen Punkt auf der Tischplatte. Nach einer Weile fragte sie: »Und der Todeszeitpunkt?«
»Zwischen fünf und viertel nach fünf«, gab Gruber zurück.
»So genau weiß man das?« Clara hob erstaunt die Augenbrauen.
»Der Nachbar von unterhalb hat genau um diese Zeit etwas gehört, er war schon wach, musste zur Arbeit. Er gibt an, Stimmen gehört zu haben. Und einen dumpfen Schlag. Aber es war ganz schnell alles wieder ruhig. Da hat er sich nicht weiter gekümmert.«
»In ihrer Wohnung? Ihre Frau wurde in ihrer Wohnung getötet?« Clara war verwirrt. »Aber sie wurde doch im Englischen Garten gefunden?«
Gruber nickte. »Man hat sie dorthin gebracht, als sie schon tot war. Im Kofferraum ihres eigenen Autos. Sie trug nur einen Morgenmantel. Den ... den hat er ihr ausgezogen und sie nackt die Böschung zum Bach hinuntergestoßen. Dann ist er mit dem Auto zurückgefahren, hat es in der Tiefgarage geparkt, ist wieder in die Wohnung und hat den Schlüsselbund zurück an den Haken im Flur gehängt. Der Gürtel des Morgenmantels lag noch im Kofferraum.«
Claras Zigarette war zwischen ihren Fingern ungeraucht heruntergebrannt. Sie drückte sie in den Blechaschenbecher.
»Und was ist mit Fingerabdrücken?«
»Keine, außer Irmis und meinen. Und noch ein paar unübersehbare Spuren meiner Anwesenheit.« Er verzog die Mundwinkel. » Außerdem hat man einen Blutfleck im Flur gefunden, der stammt von einer Wunde an ihrem Kopf. Sie ist gestürzt oder wurde gestoßen, hat sich dabei am Kopf verletzt und wurde dann erwürgt. Mit bloßen Händen.«
»Woher weiß man, dass sie mit ihrem eigenen Auto transportiert wurde?«, fragte sie.
»Es gibt Spuren von ihr im Kofferraum, Blut, Haare. Und der Gürtel ihres Morgenmantels lag noch drin.«
Clara zögerte einen Augenblick, dann sagte sie vorsichtig: »Das klingt nicht gut für Sie.«
Gruber schüttelte den Kopf. »Ich weiß. Es klingt nach einer klassischen Beziehungstat. Ein getrenntlebendes Ehepaar. Ein Versöhnungsversuch, die alten Konflikte brechen wieder auf, es kommt zum Streit, er läuft aus dem Ruder ...« Er seufzte. »Ich hätte mich auch verhaftet.«
Clara nickte langsam. »Aber warum wurde die Leiche fortgebracht? Das war doch höchst riskant. Warum sollte man so etwas tun? Ein Fremder käme doch wohl nicht auf die Idee ...«
»Es gibt keinerlei Hinweise auf einen Fremden!«, unterbrach Gruber sie heftig. »Warum sollte ein vollkommen Fremder um fünf Uhr morgens zu meiner Frau nach Hause kommen? Nur wenige Minuten, nachdem ich gegangen war? Der aufmerksame Nachbar unter ihr hat auch keine Klingel gehört. Nur das Klingeln am Vorabend. Das war ich.«
»Aber ...«, begann Clara ratlos.
Gruber verzog das Gesicht zu einer spöttischen Grimasse. »Na los, spucken Sie’s aus. Sie waren doch früher nicht so rücksichtsvoll. Hat man Ihnen die Zähne gezogen? Ich sag’s Ihnen gleich: Ein zahmes Kätzchen kann ich in meiner Situation nicht gebrauchen.«
Clara wurde rot. »Ich denke, in Ihrer Situation können Sie es sich auch nicht leisten, auf abgebrüht zu machen«, fauchte sie ihn an. »Das nimmt Ihnen keiner ab!«
Gruber lächelte.
»Also gut.« Clara beugte sich vor und sah Gruber in die Augen: »Sie hatten also ein Date mit Ihrer Frau. Zuerst ein bisschen Blabla, ein paar Gläser Wein, hie und da ein tiefer Blick. Ein bisschen Sex in Erinnerung an frühere Zeiten ... Und danach, nachdem die Spannung verflogen war, zack, wieder die üblichen Vorwürfe, Schuldzuweisungen, ein paar Eifersüchteleien. Sie wollen gehen, Ihre Frau läuft Ihnen nach, wirft Ihnen etwas besonders Gemeines an den Kopf, Frauen können das, nicht wahr? Vielleicht waren Sie ja gar nicht so gut, wie Sie gedacht hatten ... Sie werden wütend. Unglaublich wütend. Sind enttäuscht über diesen Scheißabend, ärgern sich, dass Sie sich überhaupt noch einmal darauf eingelassen haben. Ihre Frau keift und schimpft, vielleicht weint sie, drückt auf die Tränendrüse, will Ihnen wieder den Schwarzen Peter zuschieben, Sie geben ihr einen Stoß, sie fällt, schlägt sich den Kopf an. Doch das beruhigt sie nicht, im Gegenteil, sie wird hysterisch, und da packen Sie sie, legen ihr die Hände um den Hals und drücken zu, so lange, bis sie endlich still ist.«
Grubers ironisches Lächeln war verschwunden. Sein Gesicht war grau geworden vor Schmerz.
Sie war zu weit gegangen. Clara bereute, dass sie sich von ihm aus der Reserve hatte locken lassen. »Es tut mir leid«, sagte sie leise.
Gruber wehrte mit einer müden Handbewegung ab. »Ist schon gut. Ich wollte es ja so.«
Clara biss sich auf die Lippen. »Aber so etwa sieht es die Staatsanwaltschaft, nicht wahr?«
»Ja. So etwa.« Er sah sie erschöpft an, und die ganze Bitterkeit war aus seinem Gesicht verschwunden. »Werden Sie mir helfen können?«
Clara hob die Schultern. »Ich weiß es nicht«, sagte sie ehrlich. »Aber ich werde es versuchen.«
Sie schob ihm die Vollmacht hin, die bereits ausgefüllt auf dem Tisch lag. »Sie müssen das unterschreiben.«
Während Gruber seinen Namen unter das Papier setzte, sagte Clara langsam: »Aber ich verstehe trotzdem nicht, wieso die Leiche weggeschafft wurde. Was hat das für einen Sinn?«
Gruber reichte ihr den Füller zurück. »Sie glauben, ich hätte das gemacht, um von mir abzulenken. Ich musste ja davon ausgehen, dass ich nicht alle Spuren meiner Anwesenheit bei Irmi tilgen konnte, also habe ich es gar nicht erst versucht. Stattdessen bringe ich die Leiche fort.«
Clara runzelte die Stirn. »Aber sie war im Morgenmantel! Kein vernünftiger Mensch käme doch auf die Idee, ihre Frau wäre im Morgenmantel in den Englischen Garten gelaufen und hätte sich dort umbringen lassen! Zumal die Spuren im Kofferraum und im Flur offenbar nicht beseitigt wurden. Das wäre doch ein sehr durchsichtiges Täuschungsmanöver, ziemlich dämlich, vor allem für einen Polizisten. Und es hat ja auch nicht geklappt.«
Gruber hob die Schultern. »Ich habe keine Ahnung. Es gibt jedenfalls keinen Grund anzunehmen, ich wäre es nicht gewesen. Wer kann schon so genau sagen, was man alles unter Schock tut? Kurzschlussreaktion, Panik, irgendein kopfloser Impuls ...«
Clara nickte nachdenklich. Es war möglich. Das Ganze war so unsinnig, so wenig durchdacht, dass eine solche Erklärung die wahrscheinlichste war: Er hatte sie nicht einfach so liegen lassen können. Dazu das Entsetzen über die Tat, das Wissen all der Spuren, die auf ihn und nur auf ihn deuten würden. Und er hatte in seiner Panik dem erstbesten Impuls nachgegeben: Weg mit der Leiche. Sie schob die Vollmacht und ihren unberührten Schreibblock, auf dem außer Grubers Namen nichts stand, in ihre Tasche. »Ich werde mich als Verteidigerin bestellen und Akteneinsicht beantragen. Wir werden einen möglichst baldigen Haftprüfungstermin bestimmen lassen ...«, sie brach ab und seufzte. Es half nichts. Sie musste ihn fragen. »Waren Sie es?« Ihre Stimme war leise, furchtsam.
Gruber sah sie müde an: »Wenn ich nein sage, glauben Sie mir dann?«
Clara antwortete nicht.
VIER
Clara stützte ihre Arme auf die rote Mappe vor ihr und dachte nach. Nicht über das Verbrechen, von dem in dieser Akte die Rede war, und nicht über die Schritte, die sie unternehmen musste, um ihrem neuen Mandanten zu helfen. Sie dachte über sich nach. Über sich und Gruber. Warum war sie so gemein gewesen? Hatte absichtlich Worte benutzt, die ihn verletzen mussten. Es reichte nicht aus, sich zu sagen, er habe sie dazu herausgefordert. Was hatte er schon gesagt? Nichts, was man nicht mit einem freundlichen Lächeln, einem leichten Satz hätte übergehen können: Keine Sorge, wenn es nötig ist, kann ich meine Zähne schon zeigen, oder so etwas in der Art. Es war nicht professionell gewesen. Kein bisschen. Und das ärgerte sie.
Sie zündete sich eine Zigarette an und sah zu, wie sich der Rauch langsam verteilte. Sie würde kräftig lüften müssen, bevor Linda und Willi wiederkamen. Außerdem war es kalt. Sie hatte vergessen, Feuer im Ofen zu machen, und die uralte Heizung war den derzeitigen Temperaturen nicht gewachsen. Zu zugig waren der offene Raum und das riesige Schaufenster. Von Wärmedämmung keine Spur. Sie trank einen Schluck Kaffee und wärmte ihre Hände an der heißen Tasse.
Das Schlimmste an der ganzen Sache war, dass sie genau wusste, warum sie so reagiert hatte. Es war wie immer: Um Distanz zu wahren, wurde sie aggressiv. Im letzten Jahr war Gruber ihr Gegner gewesen. Ein hartnäckiger, verbissener Gegner in einem Fall, der ein böses Ende genommen hatte. Am Ende hatten sie beide verloren. Aber sie hatten dadurch so etwas wie Respekt voreinander gewonnen. Bei aller Wut, die sie auf ihn gehabt hatte, wegen seiner Borniertheit, seiner Weigerung, die Dinge so zu sehen wie sie, hatte sie ihn doch am Ende schätzen gelernt. Ihn jetzt so zu sehen, in Haft, hilflos und von dieser persönlichen Tragödie gezeichnet, war unerträglich gewesen. Sie konnte damit nicht umgehen. War nicht in der Lage, ihren Beruf von ihren Gefühlen zu trennen. »Weichei«, schimpfte sie leise vor sich hin. »Hast den falschen Beruf gelernt.« Dann drückte sie die Zigarette aus und schlug die Akte auf.
Die Sache war klar. So sonnenklar, dass es weh tat. Wie Gruber schon gesagt hatte, gab es keinerlei Hinweise auf eine dritte Person in Irmgard Grubers Wohnung. Der Tatortbefundbericht listete akribisch die Spuren auf, aus denen der Hergang des Abends rekonstruiert werden konnte. Die Reste eines romantischen Abendessens: Antipasti, Salat, Nudeln mit Scampi, Tiramisù. Eine halbleere Flasche Weißwein, eine leere Flasche Prosecco, drei Flaschen Pils. Kerzen auf dem Tisch, Stoffservietten. Die Teller und das Besteck hatten noch auf dem Esstisch gestanden, nur beiseitegeschoben. Keine Zeit zum Aufräumen. Sie hatten geredet. Die halbe Nacht geredet. Und dann »Spuren von Geschlechtsverkehr« auf der Bettwäsche, Spermaspuren im Bad. Fingerabdrücke von Gruber in Küche, Wohn- und Schlafzimmer, im Bad, im Flur, überall.
Clara zündete sich eine neue Zigarette an. Sie wollte das alles nicht lesen, sich nicht vorstellen. Doch trotzdem blätterte sie weiter, und ein Teil ihres Geistes, der Teil, der von ihrem Widerwillen, sich mit der Sache zu beschäftigen, unberührt geblieben war, begann, nach einem Punkt zu suchen, an dem sie ansetzen konnte, eine Unstimmigkeit, ein Zweifel, etwas, das für Gruber sprach. Doch es gab nichts. Im Gegenteil. Im hinteren Teil der Akte fand sie die Kopie eines Eintrags aus Grubers Personalakte. Der Eintrag war vom vergangenen Sommer und betraf einen Vorfall während der Vernehmung eines Verdächtigen. Dieser hatte behauptet, Gruber sei ihm gegenüber handgreiflich geworden, habe ihm mit dem Unterarm gegen die Kehle gedrückt und ihn gegen die Wand gepresst. Weiter war darüber nichts zu finden. Offenbar hatte man gegen Gruber deswegen keine Schritte eingeleitet. Es gab auch keine Stellungnahme Grubers oder seines Vorgesetzten dazu. Aber allein die Tatsache, dass sich dieser Eintrag in der Akte befand, war schon schlimm genug. Dabei spielte es keine große Rolle, ob es sich tatsächlich so zugetragen hatte oder nicht. Es genügte, um ein schlechtes Licht auf Walter Gruber zu werfen.
Clara las Grubers Vernehmungsprotokoll, das sich mit seinen Angaben ihr gegenüber deckte: Er war am Donnerstagabend um acht zu seiner Frau gegangen und bis kurz vor fünf geblieben. Er hatte niemanden bemerkt, als er das Haus verließ. Um acht Uhr am nächsten Morgen war er von seiner Kollegin telefonisch über den Leichenfund im Englischen Garten informiert worden.
Außer Grubers Aussage gab es noch die Protokolle zweier Kollegen am Tatort, von Sabine Sommer, die Clara damals schon kennengelernt und in wenig sympathischer Erinnerung hatte, und einem Roland Hertzner, Leiter der Spurensicherung. Beide sagten übereinstimmend aus, dass Gruber »geschockt« über den Fund seiner Frau gewesen war. Offenbar hatte er sich zunächst geweigert, die Leiche abtransportieren zu lassen, und war nur unter Mühen dazu zu bewegen gewesen, den Tatort zu verlassen. Doch hier gab es einen Unterschied. Während Roland Hertzner, der Irmgard Gruber auch persönlich gekannt und sie als Erster identifiziert hatte, Grubers Reaktion »verständlich« nannte und auf seine Betroffenheit und seinen Schockzustand zurückführte, bezeichnete Sabine Sommer dieses Verhalten als »merkwürdig« und »unangemessen«.
Clara runzelte die Stirn. Was sollte das heißen? Sie nahm sich die Protokolle genauer vor. Obwohl die beiden Aussagen hinsichtlich der Tatsachen übereinstimmten, unterschied sich Kommissarin Sommers Wertung der Ereignisse ganz erheblich von der Hertzners. Grubers Versuch, die nackte Leiche seiner Frau mit seinem Mantel vor den Blicken der anderen zu schützen, war Sommer »aufgesetzt« und »etwas übertrieben« vorgekommen. Unverständnis zeigte sie auch für seine Weigerung, die Leiche zu verlassen: »Er war außer sich, hat mir sogar gedroht für den Fall, dass ich näher kommen sollte.«