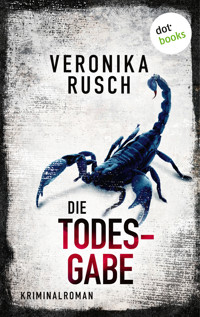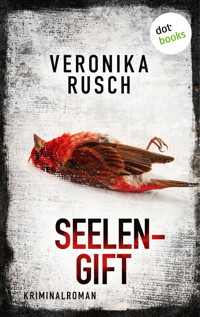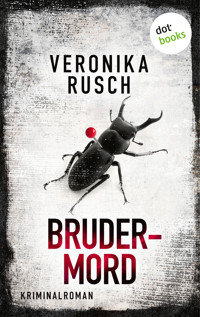
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Clara Niklas
- Sprache: Deutsch
Wurde sie unschuldig verurteilt und weggesperrt? Der abgründige Kriminalroman »Brudermord« von Veronika Rusch jetzt als eBook bei dotbooks. Die Vergangenheit ist nicht vergessen – und nicht vergeben ... Der junge Psychiater Dr. Lerchenberg beauftragt die Anwältin Clara Niklas mit der rechtlichen Betreuung seiner neuen Patientin: Seit 24 Jahren wird die Malerin Ruth Imhofen in der psychiatrischen Klinik festgehalten, weil sie ihren Geliebten im Drogenrausch erschlagen haben soll. Lerchenberg ist überzeugt von ihrer Unschuld und sorgt dafür, dass sie endlich entlassen werden kann. Doch kurz darauf wird ihr Bruder ermordet – und der Verdacht fällt sofort auf Ruth. Clara ist entsetzt: Hat sie dabei geholfen, eine Mörderin auf freien Fuß zu setzen? Unter Hochdruck beginnt sie zu ermitteln und stößt auf mehr als ein dunkles und gefährliches Geheimnis ... »Hervorragend und spannend geschriebener Krimi um ein zentrales Thema der Moderne: Die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn.« Münchner Merkur Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Kriminalroman »Brudermord« von Veronika Rusch ist der zweite Band ihrer Reihe um die Rechtsanwältin Clara Niklas, die Fans von Inge Löhnig und Elisabeth Herrmann begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die Vergangenheit ist nicht vergessen – und nicht vergeben ... Der junge Psychiater Dr. Lerchenberg beauftragt die Anwältin Clara Niklas mit der rechtlichen Betreuung seiner neuen Patientin: Seit 24 Jahren wird die Malerin Ruth Imhofen in der psychiatrischen Klinik festgehalten, weil sie ihren Geliebten im Drogenrausch erschlagen haben soll. Lerchenberg ist überzeugt von ihrer Unschuld und sorgt dafür, dass sie endlich entlassen werden kann. Doch kurz darauf wird ihr Bruder ermordet – und der Verdacht fällt sofort auf Ruth. Clara ist entsetzt: Hat sie dabei geholfen, eine Mörderin auf freien Fuß zu setzen? Unter Hochdruck beginnt sie zu ermitteln und stößt auf mehr als ein dunkles und gefährliches Geheimnis ...
»Hervorragend und spannend geschriebener Krimi um ein zentrales Thema der Moderne: Die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn.« Münchner Merkur
Über die Autorin:
Veronika Rusch studierte Rechtswissenschaften und Italienisch in Passau und Rom und arbeitete als Rechtsanwältin in Verona sowie in einer internationalen Anwaltskanzlei in München, bevor sie sich selbständig machte. Heute lebt sie als Schriftstellerin wieder in ihrem Heimatort in Oberbayern. Neben Krimis schreibt sie historische und zeitgenössische Romane sowie Theaterstücke und Kurzgeschichten. Ihre Werke wurden mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem 2. Platz im Agatha-Christie-Krimiwettbewerb und dem DELIA-Literaturpreis.
Veronika Rusch veröffentlichte bei dotbooks bereits »Das Gesetz der Wölfe«, »Seelengift« und »Die Todesgabe«.
Die Website der Autorin: https://www.veronika-rusch.de/
Die Autorin bei Instagram: instagram.com/veronikarusch
***
eBook-Neuausgabe Juli 2023
Copyright © der Originalausgabe 2009 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Cameramannz, kojihirano
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-677-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Brudermord«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Veronika Rusch
Brudermord
Kriminalroman
dotbooks.
MM, in Liebe
Wir sollten unsere Gesellschaft so rekonstruieren, dass alle von Geburt an trainiert werden, selber zu wollen, was die Gesellschaft von ihnen fordert.
(James McConnell, US-Psychologe, in seinem Bericht »Criminals Can Be Brainwashed«)
PROLOG
Die alte Frau blinzelte mühsam mit den Augen. Es war dämmrig im Zimmer, und sie wusste nicht, wie spät es war. Draußen plätscherte der Regen. In diesem morgendlichen Zwielicht konnte die alte Frau noch schlechter als sonst sehen. Im Grunde erkannte sie nur Schemen in unterschiedlichen Grautönen.
»Eva?« Sie hatte Schritte im Flur gehört. Doch niemand antwortete. Das war ungewöhnlich. Die Pflegerin, die ihr morgens beim Aufstehen half, machte sich immer schon von weitem bemerkbar, um sie nicht zu erschrecken.
»Bist du das, Eva?«, fragte sie noch einmal und hörte selbst, wie zittrig ihre Stimme klang. Mühsam richtete sich die alte Frau in ihrem Bett auf und lauschte. Es war totenstill im Haus. Sie musste sich getäuscht haben. Doch gerade als sie sich wieder zurück in ihre hohen Kissen sinken ließ, hörte sie wieder etwas. Schritte, die näher kamen. Und dann eine Stimme. Sie kam von der Tür her, flüsternd, für die schwachen Ohren der Greisin kaum vernehmbar.
»Wer ist da?« Die Frau wollte energisch klingen, wollte sich solche Späße verbitten, doch die Stimme versagte ihr den Dienst. Hilflos lag sie im Bett und versuchte zu hören, was dort hinter der Tür gesprochen wurde, während langsam die Angst in ihr hochkroch. Als sie die Worte endlich verstand, erstarrte sie. Es waren die Zeilen eines Gedichtes, Worte, die sie seit Jahren nicht mehr gehört hatte. Hastig versuchte sie, die Lampe auf ihrem Nachttisch anzuknipsen, doch ihre von Arthritis verkrümmten Finger bekamen den Schalter nicht zu fassen. Mit einem dumpfen Schlag landete die Lampe auf dem Boden. Die Frau konnte hören, wie die Glühbirne zerbrach. Sie begann zu zittern.
»Die Gefangnen im Turm halten den Wächter gefangen ...«
Die Tür öffnete sich langsam, und die flüsternde Stimme wurde deutlicher:
»und üben mit ihm das Einmaleins der Stunden ...«
Die Frau hielt sich die Ohren zu. Sie wollte diese Worte nicht hören. Nie mehr. Doch sie hatten sich so tief in ihr Gedächtnis eingegraben, dass sie unwillkürlich die Lippen bewegte und lautlos mitsprach, während die schemenhafte Gestalt langsam näher kam:
»Nachts holen die Gefangnen verstohlen die Welt in den Turm ...«
Sie begann zu schreien. Ein dünner, hoher Altfrauenschrei, zu schwach, um die grauenhafte Stimme zum Verstummen zu bringen, die immer weitersprach, noch immer flüsternd, ewig die gleichen Zeilen wiederholend, gleichförmig, unbeteiligt.
»Die Gefangenen im Turm halten den Wächter gefangen ...«
Als Johannes Imhofen an diesem Abend nach Hause fuhr, war er mit sich und der Welt vollkommen im Einklang. Seine Befürchtungen hatten sich als unbegründet erwiesen. Nichts von dem, was er sich ausgemalt hatte, war eingetroffen, und es sah so aus, als würde es dabei bleiben. Sie war zahm geworden. Endlich. Seine Anstrengungen waren nicht umsonst gewesen. Auch wenn er nicht hatte verhindern können, was dieser windige Pfuscher mit seinem krankhaften Ehrgeiz ins Rollen gebracht hatte: Sein Leben würde trotzdem weitergehen wie bisher.
Er ahnte nicht, wie sehr er sich damit täuschte.
Mit einem sanften Klicken schloss die Fernbedienung seinen Wagen ab, diese elegante silbergraue Limousine mit allem Pipapo, den man sich denken konnte. Dieser Wagen war ein Vermögen wert. Und dabei das pure Understatement. Ein kurzes warmes Aufleuchten der Blinklichter antwortete ihm, dann war alles ruhig. Friedlich. Seine Schritte hallten durch den leeren Raum. Von der Tiefgarage führte ein direkter Zugang hinauf in seine Villa. Natürlich hätte er selbst sie nie so genannt, er war schließlich keiner dieser protzigen Neureichen, die ständig mit ihren Besitztümern angeben mussten. Das hatte er gar nicht nötig. Aber es war unbestritten eine Villa. Alt und ehrwürdig noch dazu.
Grundstück in Grünwald, die allerbeste Gegend. Gerade kam er von einem kleinen Umtrunk bei Bekannten nach Hause, sehr angenehme, kultivierte Leute. Seine Frau war heute unpässlich gewesen, wie so oft in letzter Zeit. Die ganze Geschichte hatte sie natürlich sehr mitgenommen. Es war nicht einfach für sie, all das wieder in den Zeitungen zu lesen. Nicht sehr schön, aber nicht zu vermeiden. Er hatte es versucht; vor allem für Sybille, sie litt so sehr darunter, sie hatte damals schon immer Angst gehabt. »Sie ist unheimlich«, hatte sie immer gesagt. »Beunruhigend.« Nun, Sybille war immer schon recht leicht zu beunruhigen gewesen.
Johannes Imhofen verbrachte die letzten Sekunden seines Lebens damit, in seinem staubgrauen Burlington-Mantel nach dem Schlüssel für die Tiefgaragentür zu suchen. Er war nicht in seinen Manteltaschen, wo er ihn vermutet hatte, und auch nicht in der Hosentasche. In dem Moment, als er im Innenfutter seines Jacketts den silbernen Anhänger ertastete, an dem der Schlüssel befestigt war, traf ihn ein Schlag auf den Hinterkopf. Es war ein heftiger, gut gezielter Schlag, und Johannes Imhofen ging augenblicklich zu Boden. Sein Blick fiel noch auf die verschlossene Tür vor ihm, und er bedauerte plötzlich, seine Frau nicht mehr gesprochen zu haben. Sie hatten sich nicht mehr viel zu sagen gehabt in den letzten Jahren, hatten mehr geschwiegen als miteinander geredet, aber in dem Augenblick, in dem ihm klar wurde, dass dieser Schlag tödlich war, erfasste ihn eine große Sehnsucht nach ihrer Stimme, wollte er noch einmal mit ihr sprechen. »Sybille«, flüsterte er, dann traf ihn ein zweiter Schlag, und nichts konnte mehr gesprochen werden zwischen ihnen. Nichts gab es mehr, was gehört oder gesehen oder wiedergutgemacht werden konnte. Er spürte es nicht mehr, als ein weiterer Schlag ihn traf. Und noch einer. Obwohl seine Augen weit aufgerissen waren, konnte er das Blut nicht mehr sehen, das aus seinem zertrümmerten Schädel auf den grauen Betonboden sickerte. Er fühlte nicht, wie das Leben ihn verließ. Spürte nicht, wie seine Organe ihre Arbeit einstellten, der Herzschlag verstummte und Kälte aus dem Boden in die Glieder kroch. Er war tot.
CADAQUÉS 1
Der Himmel war leer. Er hatte keine Farbe, kein Licht war darin, kein Anfang und kein Ende. Er starrte mit weit aufgerissenen Augen hinein, in der Hoffnung, aufgesogen zu werden von dieser unerbittlichen Leere. Irgendwann wurde ihm schwindlig, der Himmel begann, sich zu entfernen, löste sich in viele winzige Punkte auf, die zu flimmern begannen, und endlich schloss er die Augen. Blind ging er in die Knie und ließ sich zur Seite fallen. Der Sand war hart wie ein Brett. Kälte kroch ihm in die Glieder, er fühlte seinen Körper steif werden. Er fühlte, wie er schwerer wurde, wie ein Stein, den irgendwann einmal das Meer heraufgespült und dort liegen gelassen hatte. Das Päckchen an seiner Brust zog ihn hinunter in die sandige Kälte. Er wollte sterben.
Als er die Augen wieder öffnete, wusste er einen Augenblick lang weder, wo er sich befand, noch was für eine Tageszeit war. Alles um ihn herum war von einem hellen, klaren Grau, wie ein künstliches, lebloses Abbild der Wirklichkeit. Mühsam richtete er sich wieder auf. Sein erster Griff galt dem Päckchen in seinem Hemd. Es war noch da. Er zog es heraus und wog es unschlüssig in den Händen. Er sollte es ins Meer werfen, davontreiben lassen und zusehen, wie es sich voll Wasser sog und langsam unterging. Warum nur hatte diese Frau ihn aufgesucht? Warum hatte sie ihm diese Last aufgebürdet? Er schüttelte den Kopf und schob das Päckchen wieder zurück. Er wusste genau, warum.
Die Frau hatte in Miguels Bar im Hafen auf ihn gewartet, eine leere Tasse Kaffee vor sich. Ein großer Hund lag zu ihren Füßen, grau wie ein Schatten. »Ich heiße Clara«, hatte sie gesagt und ihm ohne ein Lächeln ihre Hand hingestreckt. Clara. Nichts weiter. Ein Name, der Helligkeit, Licht versprach. Doch der Name trog. Er hatte es in dem Moment gewusst, als er ihre Hand ergriffen hatte. Trotzdem hatte er sich zu ihr gesetzt. Miguel hatte ihnen eine Karaffe Wein gebracht und zwei Gläser. Sie waren allein in der Bar, es war noch zu früh für Gäste. Und Touristen gab es um diese Jahreszeit sowieso nicht. Nur ihn und diese rothaarige Frau. Clara.
Er begann zu trinken. Die Frau sagte nichts. Sie saß nur da, noch immer in ihrem grünen Wollmantel. Sie trank den Wein mit ihm. Rauchte Zigaretten. Irgendwann zog sie den Mantel aus und hängte ihn über den Stuhl. Langsam füllte sich die Bar mit Menschen. Arbeiter aus der Umgebung, junge Leute, Mädchen mit hohen Absätzen, ihre Freunde in pastellfarbenen Hemden und Collegepullovern. Sie standen an der Bar, tranken kleine Gläser mit Wein, Fino, oder ein Bier aus der Flasche. Dazu gab es Tapas. Fette Chorizo, gebratene Datteln mit Speck, rohen Schinken, weißes Brot. Miguel brachte auch ihnen einen kleinen Teller, obwohl er wusste, er würde ihn nicht bezahlen können. Irgendwann holte die Frau ein Päckchen aus ihrer Tasche und schob es ihm hin.
»Kommen Sie zurück«, sagte sie, und ihr Blick war eine Bitte. Dann ging sie, und der graue Schatten folgte ihr.
MÜNCHEN, ZWEIEINHALB WOCHEN FRÜHER
Rechtsanwältin Clara Niklas hielt den Hörer noch eine ganze Weile in der Hand, als der Anrufer längst aufgelegt hatte. Erst als das drängende Besetztzeichen ertönte, legte sie den Hörer langsam zurück. Dieser Anruf war entschieden seltsam gewesen. Ein gewisser Dr. Lerchenberg, von dem sie noch nie gehört hatte, Ralph Lerchenberg. Clara warf einen Blick auf die Notizen, die sie sich während des Telefonats gemacht hatte. Dr. Lerchenberg war Arzt in Schloss Hoheneck, wie er ihr mit gehetzter, fast flüsternder Stimme mitteilte, eine Privatklinik am Starnberger See. Es gehe um eine vorübergehende vormundschaftliche Betreuung für eine ehemalige Patientin, hatte er gemeint, und ob sie bereit wäre, diese zu übernehmen? Clara hatte gezögert. Sie machte nur sehr selten Betreuungen. Auf ihre Frage, weshalb er sich damit an sie wandte, hatte er nur ausweichend geantwortet, er wolle ihr dies lieber persönlich erklären. An diesem Punkt war Clara misstrauisch geworden.
»Hören Sie«, sagte sie ungeduldig. »Ich habe keine Zeit, zu Ihnen hinaus nach Starnberg zu kommen, wenn es also so dringend ist, wie Sie sagen, müssen Sie jemand anderes ...«
»Nein! Bitte, hören Sie mir zu!« Seine Stimme klang, obwohl er noch immer sehr leise sprach, fast flehentlich. »Ich komme zu Ihnen, heute Nachmittag. Können wir uns irgendwo in der Stadt treffen?«
»Warum kommen Sie nicht einfach in die Kanzlei?«, wollte Clara wissen.
»Das ... wäre nicht gut für Sie.« Er verstummte einen Moment. »Und für mich auch nicht.«
Clara schüttelte den Kopf. Was hatte sie hier für einen Spinner in der Leitung? »Ich glaube nicht, dass ich die Richtige für Sie bin«, versuchte sie, das Gespräch zu beenden, doch der Mann unterbrach sie erneut. »Bitte, Frau Niklas! Ich kenne Ihre Mutter sehr gut!«
»Hat meine Mutter Sie etwa zu mir geschickt?«, fragte Clara ungläubig. Was hatte, verdammt noch mal, ihre Mutter damit zu tun? Noch nie hatte ihre Mutter, Ärztin und Psychotherapeutin, Medizinerin mit Haut und Haaren, den Beruf ihrer jüngsten Tochter mehr als nur zur Kenntnis genommen.
»Nein! Sie hat damit gar nichts zu tun. Ich wollte damit nur sagen, bitte ... Sie können mir vertrauen.« Er verstummte.
Clara rieb sich die Stirn und kniff die Augen zusammen. Sie war gerade dabei, wieder einmal Zeit und Energie für irgendeinen Schwachsinn zu vergeuden, der einen Haufen Arbeit machen würde und kein Geld einbrachte. »Also gut«, sagte sie. »Wo sollen wir uns treffen?«
»Um 15.30 Uhr im Café am Botanischen Garten«, kam es wie aus der Pistole geschossen. Clara musste fast lächeln. Dr. Lerchenberg hatte bereits alles geplant. »In Ordnung«, sagte sie. »Bis dann.«
»Äh, da wäre noch was«, kam es zögernd aus der Leitung.
»Was noch?« Clara seufzte.
»Der Termin beim Vormundschaftsgericht, mit dem Ihnen die Betreuung übertragen wird, ist um 15.00 Uhr ...«
»Wie bitte? Sie haben den Antrag bereits gestellt, ohne mich zu fragen?« Clara konnte es nicht fassen. »Was fällt Ihnen denn ein?«
»Es gab keine andere Möglichkeit, Frau Rechtsanwältin. Bitte, glauben Sie mir.«
Etwas an seiner Stimme brachte Clara dazu, ihren Zorn über die Eigenmächtigkeit dieses merkwürdigen Arztes ein wenig zu dämpfen.
»Ich soll also da hingehen und eine Betreuung beantragen, ohne einen blassen Schimmer davon zu haben, um was oder wen es sich dabei handelt, so stellen Sie sich das vor, ja?«, fragte sie wütend.
»Ich schicke Ihnen ein Fax. Die Richterin war so freundlich, uns sofort einen Termin zu geben.«
»Warum eilt die Sache denn so? Hat Ihr Schützling etwas angestellt?«, wollte Clara wissen.
»Nein!« Die Antwort kam heftig. »Nichts hat sie angestellt, gar nichts! Da bin ich mir hundertprozentig sicher ...« Er brach ab und Clara bemerkte, dass er die Hand auf die Muschel legte. Dumpfe Stimmen waren zu hören. Jemand sprach schnell und laut. Lerchenberg antwortete zunächst zögernd, wie es klang, dann wurde seine Stimme immer erregter, und obwohl Clara kein Wort von dem verstand, was gesprochen wurde, war deutlich zu hören, dass es sich um einen heftigen Wortwechsel handeln musste. Dann war Lerchenberg plötzlich wieder zu hören, seine Stimme klang merkwürdig zittrig, doch gleichzeitig sehr entschlossen: »Entschuldigen Sie bitte die Unterbrechung, Frau Anwältin, wir sehen uns dann also heute Nachmittag?«
»Äh, Moment ...«, warf Clara vergeblich ein. Dr. Lerchenberg hatte schon aufgelegt.
Als wenige Minuten später unten bei Linda, der Sekretärin, das Fax zu rattern begann, sprang Clara auf und rannte neugierig die drei Stufen hinunter, die den Arbeitsbereich von ihr und Willi Allewelt, Claras Sozius und Freund, vom Sekretariat trennte. Ihre Kanzlei war in einer ehemaligen Buchhandlung untergebracht, die Clara damals, vor einigen Jahren, als sie sich Hals über Kopf in die Selbstständigkeit stürzte, vornehmlich aus Geldmangel weitgehend unverändert belassen hatte. Mittlerweile hatten sich alle daran gewöhnt und die Eigenheiten ihrer Kanzlei lieb gewonnen, und so war es bis heute bei dem großen Schaufenster und dem offenen Raum auf zwei Ebenen, der zwar wenig Privatsphäre, dafür aber viel Ablenkung bot, geblieben. Im oberen Stockwerk, das man über eine offene Holztreppe erreichte, war noch ein weiterer Raum untergebracht, der ein wenig mehr Diskretion bot: das Besprechungszimmer.
Das Fax kam tatsächlich von Schloss Hoheneck und war nichts weiter als die Kopie der Ladung zum heutigen Termin beim Vormundschaftsgericht. Kein Begleitschreiben, keine Erklärung. Nicht einmal der Antrag, mit dem die Notwendigkeit einer Betreuung begründet wurde. Aber wenigstens wusste Clara jetzt den Namen der Patientin und das Aktenzeichen. Ruth Imhofen stand dort, geboren am 2. April 1960 in München. Clara hob die Augenbrauen. Die Frau war erst 47 Jahre alt. Weshalb benötigte sie eine vormundschaftliche Betreuung? Wahrscheinlich war sie psychisch krank. Clara nahm das Papier mit zu ihrem Schreibtisch. Die Einzelheiten würde sie hoffentlich heute Nachmittag erfahren. »Ich kann es nicht fassen, dass ich mich habe breitschlagen lassen«, sagte sie, an Elise, ihre große graue Dogge gewandt, die neben ihrem Stuhl auf einer alten Matratze döste und bei Claras Worten den Kopf hob. Clara strich ihr über den faltigen, weichen Nacken: »Was hältst du von einem kleinen Spaziergang?«
Nicht viel, besagte Elises Miene, und ihr Kopf sank zurück auf ihre großen Pfoten. Demonstrativ schloss sie die Augen.
»Na, komm schon!« Clara zupfte sie am Ohr. »Es gibt nachher auch ein Croissant bei Rita.«
Elise horchte auf. Rita’s Café ein paar Häuser weiter war das Lieblingscafé aller Mitarbeiter der Kanzlei Niklas & Allewelt, Elise mit eingeschlossen. Ihr Augenmerk richtete sich dabei jedoch weniger auf Rita als auf die Schwingtür, die zur Küche führte, aus der so mancher Leckerbissen kam und für sie abfiel, und die täglich frischen Croissants, die eigentlich Cornetti hießen, weil Rita Italienerin war. Mit derartigen Aussichten geködert, erhob sich Elise gähnend von ihrer Ruhestatt, streckte ausgiebig ihre langen Glieder und trabte Clara hinterher.
Nach den letzten verregneten Tagen hatte sich die Sonne heute erbarmt. Mit aller Kraft schickte sie ihre schwächer werdenden Strahlen auf die Stadt hinunter und brachte die Luft noch einmal zum Leuchten. Clara mochte den Herbst. Sie hatte nichts gegen stürmisches Wetter und konnte sogar dem Nebel mitunter etwas abgewinnen. Am liebsten aber waren ihr Tage wie heute. Es störte sie nicht, dass es trotz des sonnigen Wetters schon empfindlich kühl war und überall das Laub in den Rinnsteinen lag. Sie hob eine glänzende Kastanie auf und schob sie sich in die Tasche. Früher, als ihr Sohn Sean noch klein gewesen war, hatte sie auf ihren Spaziergängen immer die schönsten Kastanien aufgehoben und ihm mitgebracht. Oder sie waren zusammen in den Englischen Garten geradelt und hatten eine ganze Einkaufstüte davon gesammelt. Manchmal hatten sie auch Drachen steigen lassen: Sean hatte einen ganz einfachen, kleinen Drachen in Form eines Raubvogels gehabt. Hochkonzentriert, die Schnur fest in den Fäusten, hatte er zugesehen, wie sich sein Adler immer höher schraubte und dann, als er fast nur als glänzender Punkt zu sehen war, hatte er seiner Mutter stolz zugelächelt. Clara zündete sich eine Zigarette an und marschierte mit Elise an ihrer Seite die Straße entlang. Sie gingen ein gutes Stück, bis sie zu der hohen Mauer gelangten, die den alten Südfriedhof umschloss. Mitten in der Stadt gelegen, bot der kleine, längst aufgelassene Friedhof eine Insel der Ruhe und war einer von Claras Lieblingsplätzen. Sie drückte das schmiedeeiserne Tor auf und ignorierte dabei, wie jedes Mal, wenn sie hierherkam, das ausdrückliche Hundeverbotsschild, das dort angebracht war. Solche Verbote ließ sie für Elise, die sich niemals einfallen lassen würde, Gräber aufzubuddeln oder gar mit ihren Hinterlassenschaften zu verzieren, nicht gelten. Zumindest so lange nicht, bis sie nicht irgendjemand dazu zwang, was bisher noch nicht geschehen war.
Die Stille, die diesen Ort umgab, umfing sie wie ein Freund. Alte, efeuüberwucherte Gräber von prominenten Münchner Bürgern, Privatiers und ihren Gattinnen, Künstlern, Amtsräten, Brauereibesitzern und Kohlelieferanten säumten beschützt von steinernen Engeln die sorgfältig geharkten Wege. Obwohl die meisten der Bäume längst ihr Laub verloren hatten, drang die Sonne kaum durch die dichten Zweige, und es war schattig und kühl. Clara verlangsamte ihren Schritt, wanderte ziellos hierhin und dorthin, während Elise ein paar halbherzige Versuche machte, die Amseln zu jagen, die geschäftig zwischen den Gräbern herumhüpften. Schrilles Hohngezwitscher quittierte ihre tollpatschigen Sprünge, doch sie trug es mit Fassung. Mit einem kurzen Blick auf Clara, die sich mit angezogenen Beinen auf eine Bank gesetzt hatte und ihr Gesicht in einen der wenigen Sonnenstrahlen hielt, die zwischen den Bäumen den Weg zum Boden gefunden hatten, entfernte sich Elise, die Nase schnuppernd am Boden, zwischen den Grabsteinen hindurch in den hinteren Bereich des Friedhofs, begleitet vom boshaften Gekecker der Vögel.
»Imhofen, Imhofen.« Clara murmelte den Namen gedankenverloren vor sich hin. Er kam ihr irgendwie bekannt vor. Aber sie kam nicht darauf, wo sie ihn schon einmal gehört hatte. Was war das nur für eine merkwürdige Sache. Weshalb diese Heimlichtuerei? Clara bemerkte einen Spatz, der sich ihr vorsichtig näherte, den Kopf misstrauisch geneigt. Er folgte einem der Sonnenstrahlen, die wie dünne Zeiger auf dem Weg lagen. Jetzt war er fast bei der Bank angelangt und blieb stehen, den Blick unverwandt auf Clara gerichtet. Sie erwiderte nachdenklich seinen Blick, bemüht, sich nicht zu bewegen. Wie mochte ein Vogel wohl die Welt sehen? Nahm er die Umwelt genauso wahr wie sie? Wohl kaum. Er sah etwas ganz anderes, etwas, das seiner Perspektive, seinen Notwendigkeiten entsprach. Der Gedanke machte sie plötzlich traurig. Zwei Lebewesen waren in diesem Moment an genau dem gleichen Ort, und doch befanden sie sich in verschiedenen Welten. Nicht eine Sekunde ihres Lebens würde sie je die Welt aus der Perspektive eines Vogels sehen können. Clara hob die Hand, und der Spatz flog in der gleichen Sekunde weg. Sie versuchte, ihm mit den Blicken zu folgen, aber er verschmolz mit den Schatten zwischen den Ästen.
Ihre Gedanken kehrten zu dem Anruf von heute Morgen zurück. Dieser Arzt hatte so aufgeregt geklungen. Völlig untypisch für einen Mediziner, wie Clara fand. Ärzte waren immer so abgeklärt und distanziert, vor allem, wenn es um ihre Patienten ging. Und selbst wenn sie es einmal nicht waren, so setzten sie alles daran, wenigstens so zu wirken. Dieser Dr. Lerchenberg dagegen war ein Nervenbündel gewesen. Wahrscheinlich hatte er irgendetwas verbockt. Und jetzt versuchte er, es wieder geradezubiegen, bevor seine Vorgesetzten etwas bemerkten. Clara nickte langsam und ließ ihren Blick über die verwitterten Gräber schweifen. Dann drückte sie ihre Zigarette an der Schuhsohle aus und ließ die Kippe zurück in die Schachtel fallen. Sie hatte keine Lust, in irgendwelche Klinikschweinereien hineingezogen zu werden, obwohl sie zugeben musste, dass sie die Sache auch ein wenig neugierig gemacht hatte. Doch sie wusste einen Weg, vielleicht etwas mehr über diesen Arzt herauszufinden. Dr. Lerchenberg selbst hatte sie darauf gebracht. Clara seufzte und versuchte vergeblich, das Gefühl der Unzulänglichkeit zu unterdrücken, das sie jedes Mal überkam, wenn sie an ihre Mutter dachte. Als die Kirchturmuhr elf schlug, stand Clara auf und pfiff nach ihrem Hund. Der Anruf bei ihrer Mutter konnte noch ein bisschen warten. Zuerst würde sie Elise das versprochene zweite Frühstück gönnen und sich selbst einen extragroßen Cappuccino.
Ihre Mutter klang überrascht, als Clara sie anrief. Was kein Wunder war, da ihre gegenseitigen Telefonanrufe äußerst selten waren. Obwohl Dr. Thea Niklas ihre Praxis schon vor einigen Jahren aufgegeben hatte, hatte sie nicht das Bedürfnis und auch keine Verpflichtung, sich jetzt, da sie im Ruhestand war, in das Leben ihrer drei Kinder einzumischen. Claras Verhältnis zu ihrer Mutter war geprägt von liebevoller, aber zugleich unüberbrückbarer – so wirkte es zumindest – gegenseitiger Distanz. Frau Niklas, von ihrem Naturell her ein kühler, verstandesmäßig geprägter Kopf, war ihrer jüngsten, impulsiven und rebellischen Tochter nie wirklich nahe gekommen. Es war nicht so, dass sie ihre Tochter nicht geliebt hätte. Im Gegenteil. Doch Clara hatte sich von Anfang an so sehr von ihren älteren Geschwistern unterschieden, dass man kaum glauben konnte, dass sie miteinander verwandt waren. Sie war aufsässig, frech, kaum zu bändigen gewesen. Ihre karrierebewussten und durch und durch intellektuellen Eltern, die an zwei reibungslos funktionierende Kinder, die sich weitgehend problemlos in ihren Tagesablauf einfügten, gewöhnt gewesen waren, erwiesen sich im Umgang mit der jüngsten Tochter als schlichtweg überfordert. Was sie jedoch nie zugegeben hätten. Claras Vater reagierte auf diese Herausforderung so, wie er gelernt hatte, auf alles zu reagieren, was er nicht verstand: mit Sarkasmus, Spott und Ablehnung all dessen, was Clara tat oder sagte. Dies hatte zermürbende Grabenkämpfe im Hause Niklas zur Folge, die regelmäßig damit endeten, dass Clara weinend vor Wut die Tür hinter sich zuschlug und sich entweder in ihr Zimmer einschloss oder das Haus verließ. Was wiederum zu Hausarrest, Moralpredigten und neuen Streitereien führte.
Claras Mutter versuchte, das Problem rationeller anzugehen. Sie las populäre Bücher über antiautoritäre Erziehung, über »das schwierige Kind« und als Psychotherapeutin natürlich alle einschlägig bekannten Fachautoren zu dem Thema. Der Erfolg war gleich null, Clara reagierte geradezu hysterisch auf die klugen und durchdachten Argumente ihrer Mutter, und je mehr diese versuchte, auf ihre Tochter einzugehen, sie zu überzeugen, desto mehr flippte Clara aus. Irgendwann gab Thea Niklas es auf, aus ihrer Tochter ein wohlgeratenes Exemplar der Familie Niklas machen zu wollen. Sie ließ sie sein, wie sie war, ignorierte Claras Versuche, sie zu provozieren, und meldete sie statt zum Ballettuntericht im örtlichen Fußballverein an.
Und was für Dr. Niklas anfangs eine Kapitulation bedeutet hatte, entpuppte sich erstaunlicherweise als Beginn eines Waffenstillstandes, der sich im Laufe der Jahre in so etwas wie ein gegenseitiges Akzeptieren verwandelte und fast etwas Liebevolles bekam. »Unsere Wunderblume«, pflegte Thea Niklas zu sagen, wenn sie über ihre jüngste Tochter sprach, und manchmal klang so etwas wie Stolz dabei mit. Leider hatte Claras Vater nie die Gelassenheit seiner Frau in Bezug auf seine jüngste Tochter übernommen, sodass sich ihre Beziehung bis heute höchstens ein paar Grad über dem Gefrierpunkt bewegte.
Die Überraschung über Claras unerwarteten Telefonanruf wandelte sich von anfänglicher Besorgnis in noch größeres Erstaunen, als Frau Niklas den Grund ihres Anrufs erfuhr.
»Dr. Lerchenberg, sagst du?«, fragte sie nachdenklich.
»Ja. Ralph Lerchenberg.« Clara wartete. Fast hoffte sie, ihre Mutter habe nie von dem Mann gehört, und sie könnte die Sache vergessen, doch nach einigen Sekunden Schweigens meinte ihre Mutter: »Ist das nicht der Junge von Dr. Lerchenberg, dem Augenarzt?«
»Keine Ahnung! Ich kenne ihn ja nicht. Er sagte, er würde dich kennen!«
Claras Mutter murmelte etwas vor sich hin, dann wandte sie sich offenbar an ihren Mann. Ihre Stimme wurde leiser, als sie sich vom Hörer abwandte.
»Sag mal, Ralph Lerchenberg, kennst du den? Ist das nicht der Sohn von den Lerchenbergs, die unten an der Hauptstraße die Praxis haben?«
Clara hörte die barsche Stimme ihres Vaters etwas antworten, was sie nicht verstehen konnte, dann erklang das Lachen ihrer Mutter. »Natürlich, wie konnte ich das nur vergessen!«
Sie wandte sich wieder Clara zu, die bereits ungeduldig mit den Fingern auf ihre Schreibtischplatte klopfte. »Hör mal, Liebes, dein Vater hat wirklich ein brillantes Gedächtnis.«
Clara schnaufte, verkniff sich jedoch einen Kommentar.
»Ralph Lerchenberg ist tatsächlich der Sohn der beiden Augenärzte hier bei uns. Wir kennen die Familie, und dein Vater hat mich daran erinnert, dass dieser Ralph unbedingt auch Arzt werden wollte, schon als er noch ein Dreikäsehoch war. Ein netter Junge. Ich glaube, er ist Nervenarzt geworden, in einer Privatklinik hier irgendwo in der Gegend. Seine Mutter hat mal so etwas erwähnt. Weshalb willst du das denn wissen, kennst du ihn näher? Er dürfte ein paar Jahre jünger als du sein.«
Clara konnte förmlich hören, wie ihre Mutter rechnete und überlegte, in welcher Beziehung ihre Tochter zu diesem netten Jungen stehen mochte.
»Das ist rein beruflich«, erstickte Clara alle möglichen Spekulationen ihrer Mutter im Keim, bedankte sich und wollte sich schnell verabschieden, doch ihre Mutter hatte noch etwas anderes auf dem Herzen. Sie bat Clara, einen Augenblick zu warten. Clara merkte, wie sie in ein anderes Zimmer ging, damit ihr Vater sie nicht hören konnte. Sie ahnte, was jetzt kommen würde. Und tatsächlich, der Ton ihrer Mutter war vorsichtig geworden, als sie wieder zu sprechen begann, so als würde sie sich mit einer Fackel in der Hand einem Sprengstofflager nähern.
»Ich wollte noch mit dir über Vaters Geburtstag sprechen.«
»Mm, ja.« Clara schloss für einen Moment die Augen. Ihr Vater hatte am 6. Dezember Geburtstag, und dies war in der Familie seit jeher der Anlass gewesen, ein großes Fest zu geben, mit Kammermusik und Gourmet-Büffet und ihrem Bruder Georg als Nikolaus, der alle geladenen Honoratioren aus Starnberg und Umgebung mit feinsinnigen Bosheiten und kleinen Aufmerksamkeiten bedachte. In diesem Jahr wurde ihr Vater fünfundsiebzig, was in Bezug auf die Größe der geplanten Festlichkeit nichts Gutes ahnen ließ.
»Deine Schwester kommt in der nächsten Woche für ein paar Tage zu uns zu Besuch, und wir wollen bei dieser Gelegenheit gleich über die Gästeliste und das Essen sprechen. Sie wird dieses Jahr wieder das Gestalten der Einladungen übernehmen. Möchtest du nicht auch einen Abend zu uns herauskommen?«
Clara schluckte. Diese wenigen Sätze genügten, um das vertraute schlechte Gewissen in ihr wieder hochzuspülen.
Gesine, ihre sechs Jahre ältere Schwester, Innenarchitektin und mit einem erfolgreichen Mann und drei wohlgeratenen Kindern gesegnet, kam extra aus Hamburg angereist, um ihrer Mutter bei den Vorbereitungen für das Fest zu helfen, während Clara, die nicht einmal 50 km entfernt wohnte, wahrscheinlich eher dazu geeignet war, die Feierlichkeiten zum Platzen zu bringen.
Clara ermahnte sich, nett zu sein: »Ich werde versuchen zu kommen!«, versprach sie und legte auf, bevor ihre Mutter noch auf die Idee kam, sie mit der Auswahl der Tischdekoration zu beauftragen.
Der Termin beim Vormundschaftsgericht verlief unspektakulär und für Clara wenig erhellend, da die Richterin selbstverständlich davon ausging, dass Clara über den Sachverhalt Bescheid wusste und sich deshalb nur auf die Aktenlage bezog. Clara ließ sie in dem Glauben und nahm am Ende mit gemischten Gefühlen den Betreuerausweis für Ruth Imhofen entgegen, den die Richterin ihr überreichte. Umso gespannter machte sie sich auf den Weg zum verabredeten Treffpunkt.
Das Café am Botanischen Garten war nur ein paar Schritte vom Gericht entfernt und hob sich wohltuend altmodisch vom durchgestylten Einheitsbrei moderner Café-Lounges ab. Samtbezogene Stühle und Kronleuchter an der hohen Stuckdecke erinnerten an Wiener Kaffeehäuser, die aktuellen Tageszeitungen hingen in Zeitungshaltern an der Wand, und klassische Klaviermusik erklang diskret aus dem Hintergrund. In der Vitrine am Eingang türmten sich Torten und Kuchen in verschwenderischer Fülle und ließen Clara den Grund für ihren Besuch einen Augenblick lang vergessen. Nach eingehender Betrachtung aller Köstlichkeiten bestellte sie bei der rundlichen Bedienung eine Trüffel-Schokoladentorte. Dann suchte sie sich einen Tisch, der sowohl Platz für ihren Hund bot als auch einen guten Rundumblick, um Dr. Lerchenberg nicht zu verpassen. Sie hatte keinen blassen Schimmer, wie der Arzt aussah, außer dass er laut ihrer Mutter um einiges jünger sein musste als sie selbst. In dem gut besetzten Café gab es jedoch keinen einzigen Mann, der alleine an einem Tisch saß, deshalb vermutete Clara, dass er sich verspätet hatte. Er würde jeden Moment kommen. Nach Genuss der Schokoladentorte und zwei Tassen Kaffee wurde Clara unruhig. Es war bereits kurz nach halb fünf, und niemand war gekommen. Das Café hatte sich merklich geleert, außer Claras Platz waren nur noch zwei andere Tische am Fenster besetzt. Sie stand auf und warf zum wiederholten Mal einen Blick in das Nebenzimmer. Bis auf eine alte Dame mit blaugrauer Dauerwelle und einem Pudel mit ähnlicher Haartracht war es völlig leer.
Langsam ging sie zurück an ihren Tisch, unter dem Elise zufrieden schnarchte. Dr. Lerchenberg hatte seine Verabredung nicht eingehalten. Was hatte das zu bedeuten? Hatte er sie womöglich auf den Arm genommen und nie die Absicht gehabt, ihr die Dinge zu erklären? Clara schüttelte den Kopf. Das war nicht logisch. Weshalb sollte er so etwas tun? Vielleicht war ihm einfach etwas dazwischengekommen, ein Notfall. Sie ging zur Theke und fragte die junge Frau, ob jemand angerufen und eine Nachricht für sie hinterlassen hatte. Kopfschütteln antwortete ihr. Niemand hatte angerufen. Das Mädchen schürzte bekümmert die Lippen, als bedauere sie dies persönlich. Vielleicht dachte sie, Clara sei von ihrem Liebhaber versetzt worden. Clara spürte, wie sie wütend wurde. Reine Zeitverschwendung war es gewesen, hierherzukommen. Fast hatte sie es geahnt. Sie würde die verdammte Betreuung für diese unbekannte Frau nicht übernehmen. Gleich morgen früh würde sie ein Schreiben an das Gericht faxen und den Betreuerausweis zurückgeben.
Clara zahlte und holte ihren Mantel aus der Garderobe. Es war kalt und dämmerte schon, als sie mit Elise hinausging. Trotzdem beschloss sie zu Fuß nach Hause zu gehen und auf dem Weg dahin noch einen Abstecher in die Kanzlei zu machen. Vielleicht hatte Dr. Lerchenberg ja dort eine Nachricht hinterlassen. Während sie mit Elise durch die Fußgängerzone ging, hellte sich ihre Stimmung wieder auf, wie so oft, wenn sie sich an der frischen Luft bewegte. Obwohl es erst Mitte Oktober war, herrschte zwischen Stachus und Marienplatz fast schon so etwas wie Vorweihnachtsstimmung. Die Menschen hasteten mit Tüten beladen von einem beleuchteten Kaufhaus ins nächste, und aus den U-Bahnschächten drang warme, stickige Luft in den kalten Abendhimmel. Clara kaufte sich an einem Stand eine Bratwurst mit scharfem Senf und verschlang sie gierig. Die Trüffeltorte war doch ein wenig zu süß gewesen. Mit dem Rest Semmel wischte sie den Senf vom Pappteller und zündete sich dann eine Zigarette an. Zufrieden ging sie weiter, vorbei an den geschlossenen Ständen des Viktualienmarktes und an der Schrannenhalle. Am Jakobsplatz blieb sie stehen und bewunderte, wie jedes Mal, wenn sie hierherkam, die neugebaute Synagoge, die wie ein gigantischer, sandfarbener Bauklotz mitten auf dem Platz stand, asymetrisch, modern und doch so selbstverständlich, als ob sie schon immer da gewesen wäre. Ebenfalls wie immer nahm sie sich vor, demnächst einmal an einer Führung teilzunehmen, wohl wissend, dass es vermutlich bei dem guten Vorsatz bleiben würde.
Die Kanzlei war längst dunkel. Lindas Arbeitszeit endete um fünf, und Willi war ebenfalls schon gegangen. Clara sperrte die Tür auf und ging zu ihrem Schreibtisch. Keine Nachricht lag dort, keiner der kleinen gelben Zettel, auf denen Linda, der die mangelnde Ordnungsliebe ihrer Chefin ein ständiger Dorn im Auge war, wichtige Nachrichten notierte und die sie mitten auf Claras Bildschirm klebte um sicherzustellen, dass sie nicht von der Papier- und Aktenflut auf dem Schreibtisch verschlungen wurden.
Unschlüssig ließ sich Clara auf den Stuhl sinken. Eigentlich sollte sie nach Hause gehen. Oder auf ein Glas Wein zu Rita. Morgen war auch noch ein Tag. Aber diese Sache ließ ihr keine Ruhe. Sie kramte in ihrer Tasche nach dem Schreiben, das ihr Dr. Lerchenberg gefaxt hatte. Nichts war daraus zu entnehmen, was sie nicht schon wusste. Und das war nicht mehr als der Name ihrer neuen Mandantin. Clara hob erstaunt die Augenbrauen, als sie zum ersten Mal Ruth Imhofens Adresse bewusst las: Haus Maximilian stand dort. Sie kannte diese Einrichtung, es handelte sich um ein kirchliches Wohnheim, in dem Menschen in sozialen oder psychischen Schwierigkeiten für eine gewisse Zeit unterkommen konnten, und es war nur wenige Straßen von der Kanzlei entfernt. Sie konnte morgen auf dem Weg zur Arbeit direkt dort vorbeigehen. Natürlich nur, wenn sie den Fall übernähme, fügte sie in Gedanken einschränkend dazu.
Clara schob das Schreiben zurück in ihre Tasche und ließ sich über die Telefonauskunft mit der Klinik verbinden, in der Ralph Lerchenberg arbeitete.
Eine freundliche Stimme meldete sich: »Privatklinik Schloss Hoheneck, was kann ich für Sie tun?«
Clara stellte sich vor und bat, mit Dr. Lerchenberg verbunden zu werden.
»Worum geht es bitte?« Die Frau an der Vermittlung hatte ihre professionelle Freundlichkeit schlagartig eingebüßt. Fast schien es, als wolle sie Clara sofort wieder abwimmeln.
»Eine Privatangelegenheit«, gab Clara kühl zurück. »Dr. Lerchenberg erwartet meinen Anruf.«
Nach kurzem Zögern und einem gepressten »Moment bitte« erklang Musik, und Clara war in die Warteschleife verbannt. Sie lauschte mit halbem Ohr dem seichten Geplätscher und überlegte, was für eine Entschuldigung Dr. Lerchenberg wohl anbringen würde. Dann stoppte die Musik abrupt.
»Hallo, wer spricht da?« Es war nicht Dr. Lerchenberg, sondern wiederum die Stimme einer Frau. Sie klang ängstlich.
Clara wiederholte ihren Namen und ihre Bitte, und erneut hatte sie den seltsamen Eindruck, als prallte die Person in der Leitung regelrecht zurück. Als habe sie um etwas Unghöriges gebeten.
»Es ist nicht möglich, mit Dr. Lerchenberg zu sprechen«, sagte die Frau zögernd.
»Warum nicht? Ist er schon weg?« Clara wurde ungeduldig. »Hören Sie, wären Sie bitte so freundlich, ihm etwas auszu ...«
»Er ist tot.«
»Wie?«, rief Clara erschüttert. »Das ist doch nicht möglich! Wir haben heute Morgen miteinander gesprochen. Wir waren verabredet ...« Sie verstummte einen Moment, dann fragte sie: »Was ist passiert?« Doch es antwortete ihr niemand. Die Frau hatte aufgelegt.
CADAQUÉS 2
Lange hatte er der Frau hinterhergesehen, noch als sie längst schon die Bar verlassen hatte. Die Stimmen um ihn herum wurden leiser, rückten in die Ferne wie in einem Film bei einem Schwenk, weg von der Totalen hin zu einem Detail. Er hörte einzelne Stimmen heraus, das helle Lachen einer jungen Frau. Montserrat hieß sie vielleicht, so ziemlich alle Frauen hier hießen nach dem heiligen Berg Kataloniens. Dann ein paar Wortfetzen in dieser schwer verständlichen Sprache, irgendwo zwischen Spanisch und Französisch. Gläser klirrten aneinander, ein Barhocker wurde weggerückt, schrammte über den Fliesenboden. Jemand sang ein paar Takte, wurde ausgebuht. Rufe, neues Gelächter in der Ferne.
Clara. Er flüsterte den Namen so vorsichtig, als enthielte er eine Verwünschung. Was im Grunde auch so war. Und doch hielt er sich an dem Namen fest. Clara. Sie war zu ihm gekommen. Hatte ihn gefunden. Er starrte auf seine Hände. Die Nägel waren abgebrochen, jede Falte um die Fingerknöchel herum schwarz von Sand und Schmutz, rau wie Schleifpapier. Sie fühlten sich fremd an, diese Hände. Alles an ihm fühlte sich fremd an. Er kannte sich nicht mehr. Doch wann war das passiert? Er wusste es nicht. Er hatte auch die Zeit verloren, sie war ihm durch die Finger geronnen wie der kalte Sand unten am Strand. Langsam schüttelte er den Kopf. Es war schon viel früher passiert. Vor ewiger Zeit. Er konnte den Blick nicht abwenden von seinen Händen. Er empfand plötzlich Mitleid mit ihnen. Er hatte sie zu sehr geschunden in all den Jahren. Keine Pause hatte er ihnen gegönnt. Nichts Weiches, Warmes, nichts Nachgiebiges hatten sie berühren dürfen, immer nur den harten, rauen Stein. Langsam strich er mit den Fingern der rechten Hand über seinen linken Daumen. Er war krumm, verbogen wie ein alter, knorriger Ast. Die Gelenke waren geschwollen, wie alle seine Fingergelenke. Verbrauchte, kranke Hände. Nutzlos.
Langsam löste sich eine Träne aus seinem Augenwinkel und suchte sich einen Weg hinunter durch das zerfurchte, unrasierte Gesicht. Er schmeckte das Salz auf seinen Lippen und dachte an das Meer. So leer und weit wie das Meer hatte er werden wollen. Sich auflösen in dieser Endlosigkeit, verschwinden, hinuntersinken auf den Grund wie ein Stein. Vielleicht hätte er es geschafft, vielleicht wäre es ihm gelungen, wenn nicht diese Frau heute gekommen wäre.
Clara. Eine weitere Träne löste sich. Tropfte auf die Tischplatte. Miguel kam und tauschte die leere Karaffe Rotwein gegen eine volle aus. Er tat ihm leid, dieser grauhaarige Deutsche mit dem roten Bart, den irgendetwas hier an die Küste gespült hatte. Seit vielen Jahren kam er schon hierher, blieb ein paar Wochen und saß bei ihm in der Bar, stumm und abweisend, ein einsamer Trinker. Doch dieses Mal war etwas anders gewesen. Er war spät im Jahr aufgetaucht, ganz plötzlich, ohne sich vorher anzukündigen. Und in dem Moment, als er hier zur Tür hereingekommen war, schwankend, strauchelnd, wie ein welkes Blatt, das der heftige Herbststurm, der draußen wütete, vor sich hergetrieben hatte, war Miguel sich sicher gewesen, dass dieser Mann, den hier alle Pablo nannten, obwohl er ganz anders hieß, nicht mehr nach Deutschland zurückkehren würde. Er wollte sterben. Hier in Cadaqués. Und so wie es aussah, würde es ihm auch gelingen.
Jeden Abend brachte Miguel ihm Rotwein. Eine Karaffe billigen Rioja nach der anderen. Meistens stellte er ihm ungefragt etwas zu essen dazu. Aufs Haus, wie so mancher Liter Wein auch. Es gab Dinge, die konnte man nicht ändern.
Jetzt schenkte er Pablo noch ein Glas ein. Die Hände des Deutschen lagen auf dem Tisch wie zwei unnütze Gegenstände. Wie aus Holz geschnitzt. Als Miguel sah, dass Pablos Augen voller Tränen waren, klopfte er ihm sachte auf die Schulter, sagte jedoch nichts. Er wusste aus Erfahrung, dass es nichts brachte, mit ihm reden zu wollen. Mit Pablo war nicht mehr zu reden.
Pablo, der eigentlich ganz anders hieß, hörte durch den Lärm, der von der Bar her klang, wie der schwere Rotwein gluckernd in das dicke Glas vor ihm floss. Er hörte, wie Miguel die Karaffe auf dem Tisch abstellte, und spürte seine Hand auf der Schulter. Er wollte danach greifen und sie festhalten, doch er konnte seine Arme nicht bewegen. Stumm blieb er sitzen und wartete, bis Miguel gegangen war. Er starrte auf das Glas vor sich, meinte, den Alkohol darin riechen zu können, die Gerbsäure, die die Zunge pelzig machte, und hatte einen metallischen Geschmack in der Kehle. Übelkeit stieg in ihm hoch und erinnerte ihn an die fette Chorizo, die er gerade eben gegessen hatte. Die erste Mahlzeit an diesem Tag. Mit einer raschen Bewegung, die man ihm gar nicht zugetraut hätte, griff er nach dem Glas und trank es in einem Zug aus. Dann langte er nach dem Päckchen, das die Frau ihm dagelassen hatte, und wickelte es vorsichtig auf. Es waren Briefe darin, ein ganzer Packen Briefe. Die meisten steckten in billigen, gebrauchten Umschlägen, und alle waren sie ohne Anschrift und ohne Absender. Doch er wusste auch so, dass sie an ihn gerichtet waren und wer sie geschrieben hatte. Sorgfältig öffnete er den ersten Brief und faltete ihn auseinander. Er wagte nicht, die Worte zu lesen, die auf dem einfachen, vergilbten Karopapier standen, kniff die Augen zu und presste dabei die Hände so fest auf das Papier, als müsste er sich daran festhalten. Es ging nicht. Er schaffte es nicht. Nach endlosen Minuten sinnloser Anspannung öffnete er wieder die Augen. Mit zitternden Händen goss er sich noch einmal von dem Rotwein ein. Schal rann der Wein seine Kehle hinunter. Er schenkte nach und trank auch dieses Glas hastig aus. Als sich endlich eine leichte Benommenheit in seinem Kopf bemerkbar machte, wandte er sich wieder dem Brief zu. Jetzt gelang es ihm, seine Augen auf die Worte zu richten, und langsam begann er zu lesen:
Mein Geliebter,
der Tag ist trotzdem schön. Er kümmert sich nicht um unsere Schuld. Kann dich das trösten? Mich schon. Manchmal. Ich glaube fest daran, dass alles gut werden wird. Es ist immer alles gut geworden, was er in die Hand genommen hat. Du kannst ihm vertrauen, Liebster, denn ich vertraue ihm auch. Es wird vorübergehen, und dann werden wir wieder zusammen sein und der Himmel wird so blau sein wie heute, und das Licht wird leuchten. Wenn du Angst hast, denke an den Apfelbaum. Denke an unser Haus am Meer. Siehst du es? Siehst du das gelbe Haus? Ich sehe es auch, und so können wir in Gedanken zusammen dort sein. Siehst du die Farben? Indischgelb, Krapplack, Chromoxidgrün. Du lachst wie immer, wenn ich über meine Farben spreche, ich kann dich hören ...
Er konnte nicht weiterlesen. Mit einer heftigen Handbewegung schob er das Papier weg und fegte dabei das Glas vom Tisch. Klirrend zerschellte es auf den Fliesen. Der Lärm in der Bar verstummte einen Augenblick. Köpfe wandten sich um, und alle sahen den Mann an, der seinen Kopf in beide Hände vergraben hatte und weinte.
MÜNCHEN 2
Clara saß wie vom Blitz getroffen auf ihrem Stuhl in der dunklen Kanzlei und starrte das Telefon an. Dr. Lerchenberg war tot, hatte die Frau gesagt. Wie konnte das möglich sein? Sie schüttelte verwirrt den Kopf und stand auf. »Lass uns heimgehen, Elise«, sagte sie und fühlte sich plötzlich erschöpft. »Morgen sehen wir weiter.« Und während sie langsam den dunklen Weg am Fluss entlang und über die Brücke weiter zu ihrer Wohnung ging, versuchte sie, ihre Gedanken zu ordnen und herauszufinden, was dieser unerwartete Tod des Arztes für sie bedeutete. Sollte sie den Fall trotzdem abgeben, wie sie es sich heute Nachmittag vorgenommen hatte? Sie war wütend gewesen, hatte sich über die vertane Zeit geärgert. Doch er hatte sie gar nicht versetzt. Er war gestorben. Die drängende, nervöse Stimme des Arztes kam ihr wieder ins Bewusstsein, die Erregung und Angst, die darin zu hören gewesen war. »Angst«, flüsterte sie, mehr erstaunt als schockiert. »Er hatte Angst.« Und in dem Moment wurde ihr klar, dass sie den Fall nicht mehr abgeben konnte. Nicht, bevor sie herausgefunden hatte, worum es eigentlich ging. Aber wie sollte sie jetzt an die Informationen gelangen, die er ihr hatte geben wollen?
Clara blieb auf der Brücke stehen und schaute hinunter auf das Wasser, das dunkel und still dahinfloss. Die Uferlinie der Isar war kaum zu unterscheiden von den weiten Flächen der Isarauen, die sich hier kilometerweit erstreckten und die Clara so liebte. Jeden Tag ging sie hier mit Elise spazieren, bei jedem Wetter und so lange ihre Zeit es zuließ. Manchmal auch länger. Jetzt wurde die Landschaft von der herbstlichen Dunkelheit verschluckt. Nur die Lichter der Häuser entlang des Flusses konnte man sehen, versteckt hinter den kahlen Ästen der Kastanien und Linden, die die Spazierwege säumten. Sie zündete sich eine Zigarette an. Morgen würde sie noch einmal in der Klinik anrufen, sich offiziell als die gerichtlich bestellte Betreuerin von Ruth Imhofen vorstellen und um Überlassung der Krankenakten bitten. Dann konnte sie immer noch entscheiden, was sie damit anfangen sollte.
In ihrer Wohnung war es kalt und ungemütlich. Sie drehte die Heizungen auf die höchste Stufe und schlüpfte in warme Socken. Dann zog sie die Vorhänge vor den großen Altbaufenstern im Wohnzimmer zu. Sie hatte sie erst vor ein paar Monaten gekauft. Dunkelrote Vorhänge aus weichem Stoff, die eine gemütliche Atmosphäre verbreiteten. Vorher hatte sie gar keine Vorhänge besessen. Sie hatte es schön gefunden, nachts am Fenster zu stehen und hinunterzusehen in die dunklen Straßen. Sie hatte diese Offenheit gemocht. Bis sie im vergangenen Frühjahr in diesen Fall verwickelt worden war. Diesen schrecklichen Fall, der sie dazu gebracht hatte, nachts in der Küche zu schlafen, aus Angst vor einem Überfall, Angst vor der Dunkelheit, vor ihrem eigenen Schatten. Noch nie zuvor hatte sie solche Angst gehabt. Danach, als alles vorbei war, hatte sie die Vorhänge gekauft. Sie wusste, dass sie nichts mehr zu befürchten hatte, aber manchmal beschlich sie immer noch das unheimliche Gefühl, beobachtet zu werden, belauert, verfolgt.
Heute dagegen wollte sie es nur warm haben. Sie schaltete den Fernseher ein und holte sich einen Rest Thunfischsalat aus der Küche. Dann wickelte sie sich in eine Wolldecke und ließ sich auf ihr altes, durchgesessenes Sofa plumpsen.
Elise zögerte nur den Bruchteil einer Sekunde, dann sprang sie neben Clara, drehte sich umständlich um ihre eigene Achse und ließ sich ächzend fallen. Es entstand ein kurzes Gerangel zwischen Clara und ihrem Hund, in dem Clara versuchte, wenigstens ein Drittel des Platzes für sich zu behaupten, dann hatte man sich geeinigt, und in einem einmütigen Durcheinander aus Hundeschnauze, rotbraunem Haarschopf, Pfoten und Menschenbeinen kehrte Ruhe auf der Couch ein.
Clara ließ sich eine Weile von einer Talkshow berieseln, dann schaltete sie den Fernseher aus und griff neben sich auf den Boden, wo eine Flasche ihres Lieblingswhiskeys bereitstand. Redbreast, eine Erinnerung an längst vergangene Zeiten, die sich hinübergerettet hatte in die Gegenwart und der Clara über all die Jahre hinweg treu geblieben war. Sie goss sich einen Zentimeter voll ein und nippte daran. Vertraute Wärme breitete sich in ihr aus, und sie schloss genussvoll die Augen. Noch immer vermochte der Geschmack in ihr die alten Bilder heraufzubeschwören, die Straßen Dublins, bunte Fassaden, die Schilder der Pubs, Musik, die aus den offenen Türen drang, verfallene Bruchsteinmauern, der graue Himmel. Alles längst vorbei. Sie nahm einen letzten, etwas wehmütigen Schluck und stellte das Glas sachte auf den Boden. In dem Moment klingelte das Telefon. Clara fuhr erschrocken zusammen. Es war halb elf. Wer rief so spät noch an? Hastig und sehr zum Unmut ihres Hundes schälte sie sich aus ihrer Decke.
»Ja?«
Es war ihre Mutter. »Du wirst es nicht glauben, was heute passiert ist«, begann sie ohne Begrüßung.
»Passiert?« Clara rieb sich die Stirn. Musste sie sich Sorgen machen? War etwas mit ihrem Vater? Doch ihre Mutter klang eigentlich nicht so. Eher aufgeregt als besorgt.
»Erinnerst du dich an unser Gespräch von heute Mittag?«
»Ja, natürlich.« Clara wurde klar, worauf ihre Mutter hinauswollte: Sie hatte von Ralph Lerchenbergs Tod gehört. Starnberg war eben doch ein Dorf, und ihre Mutter, Mitglied des Kirchenvorstandes und engagiert in zahlreichen anderen Institutionen, Vereinen und Gesprächskreisen, mittendrin.
»Du meinst, Dr. Lerchenberg? Ich habe gehört, dass er gestorben sein soll, ist das wahr?«
Ihre Mutter schnaubte. »Und ob! Er ist keinen Kilometer von unserem Haus entfernt mit dem Auto gegen einen Baum gefahren. Stell dir das vor! Gegen den einzigen Baum weit und breit! Er war sofort tot.« Sie holte Luft, dann fügte sie noch hinzu: »Der Baum muss gefällt werden. Dabei war er uralt.«
Clara musste trotz allem lächeln. Das war typisch für ihre Mutter, sich Gedanken um den Baum zu machen.
»Wann ist das denn passiert?«, fragte sie.
»Heute Nachmittag, so gegen zwei Uhr, glaube ich.«
Clara schüttelte langsam den Kopf. Konnte es solche Zufälle geben?
Ihre Mutter sprach schon weiter. »Gerade war Herr Solberg da, du kennst ihn doch, er ist mit mir im Kirchenvorstand.«
»Mm, ja.« Clara nickte mechanisch. Ihre Mutter ging davon aus, dass jeder wusste, wer mit ihr im Kirchenvorstand saß.
»Nun, Herr Solberg ist ein guter Freund von Herrn Wildenauer, und der ist bei der Polizei, und weißt du, was er gesagt hat über diesen Unfall?«
»Sag schon!«
»Man hat keine Bremsspuren gefunden und auch keine Anzeichen, dass er jemandem ausgewichen wäre.« Ihre Mutter machte eine Pause, um Clara die Schlussfolgerung aus dem Gesagten selbst ziehen zu lassen.
Clara meinte zögernd: »Das bedeutet also, sie glauben, er könnte mit Absicht ...«
»Genau!«, fiel ihre Mutter ihr ins Wort, zufrieden über die schnelle Auffassungsgabe ihrer Tochter. »Er sieht so aus, als ob er Selbstmord begangen hätte.«
Clara schluckte. Aber das kann nicht sein, dachte sie. Das kann nicht sein. Wir waren verabredet.
Ihre Mutter sprach weiter: »Ist das nicht merkwürdig, Liebes, dass wir am Vormittag noch über ihn geredet haben, und dann bringt er sich ein paar Stunden später um?«
Als Clara am nächsten Morgen in Schloss Hoheneck anrief, wurde sie im Gegensatz zum letzten Mal sofort weitergeleitet. »An die Klinikleitung«, wie die Dame am Empfang sie informierte.
Es meldete sich ein Mann, der sich als Dr. Selmany vorstellte. »Wie kann ich Ihnen helfen?,« erkundigte er sich höflich, als Clara ihren Namen nannte, doch an seinem wachsamen Ton konnte sie hören, dass er längst wusste, weshalb sie anrief. Trotzdem erklärte sie es ihm noch einmal geduldig und schloss mit der Bitte: »Ich benötige Einsicht in die Krankenakten von Frau Imhofen.«
Dr. Selmany räusperte sich umständlich, bevor er antwortete. »Ich fürchte, das ist nicht möglich, Frau Rechtsanwältin.«
»Wieso? Dr. Lerchenberg hat gesagt, Frau Imhofen wäre eine Patientin in Ihrer Klinik gewesen ...«
»Das ist schon richtig«, gab Dr. Selmany eilig zurück. »Aber sie wurde entlassen und das schon vor gut drei Wochen.«
»Vor drei Wochen?«, fragte Clara verwundert. »Warum hat man dann erst jetzt eine Betreuung veranlasst?«
»Nun«, Dr. Selmany zögerte. »Diese Entlassung ... wie soll ich sagen, es war eine Sache, die Herr Lerchenberg in eigener Verantwortung unternommen hat. Wir, also die Klinikleitung, haben Dr. Lerchenbergs Auffassung nicht geteilt ...«
»Ach!« Clara runzelte die Stirn. »Wie konnte denn Herr Lerchenberg gegen Ihren Willen eine Patientin entlassen?«
»Nun ...« Man konnte förmlich spüren, wie sich der Arzt wand. »Nachdem das Gericht aufgrund von Dr. Lerchenbergs eigenmächtigem Antrag so entschieden hatte, blieb uns trotz erheblicher Bedenken keine andere Wahl. Justitia hat immer das letzte Wort, nicht wahr?« Seine Stimme fand langsam ihren öligen Ton zurück.
Clara gab keine Antwort. Im Stillen fragte sie sich, weshalb Selmany dies überhaupt erwähnte. Interne Meinungsverschiedenheiten zwischen Ärzten wurden im Allgemeinen nicht in der Öffentlichkeit ausgebreitet. Sie hakte nicht weiter nach, sondern kritzelte stattdessen Selmanys Namen und ein dickes Fragezeichen in ihre Akte. Dann meinte sie: »Aber die Krankenakten müssten doch trotzdem da sein.«
»Eigentlich schon, ja, natürlich«, gab Dr. Selmany zu und ergänzte dann mit deutlichem Unbehagen in der Stimme, »aber sie sind es nicht. Um genau zu sein, sie sind verschwunden.«
»Verschwunden?«
»Hören Sie, Frau Anwältin«, beeilte sich der Arzt, sie zu beschwichtigen. »Es ist uns sehr unangenehm, das können Sie uns glauben. Wir hätten viel früher reagieren sollen, schon als die ersten Anzeichen bekannt wurden.«
»Was für Anzeichen?«
»Nun, eigentlich gehört es sich nicht, darüber zu sprechen, jetzt wo Dr. Lerchenberg auf so tragische Weise ...«
»Wovon sprechen Sie?« Clara fischte sich eine Zigarette aus der Schachtel in ihrer Tasche und tastete nach dem Feuerzeug.
»Also, Herr Dr. Lerchenberg war in letzter Zeit gesundheitlich nicht mehr so recht auf der Höhe, wie soll ich sagen, es gab ... ähem ... Unregelmäßigkeiten bei den Medikamenten, und er trank mehr als ihm guttat ...«
»Ja und weiter?«, hakte Clara ungeduldig nach, als Dr. Selmany wieder verstummte. Dieses Reden um den heißen Brei ging ihr langsam auf die Nerven.
Der Arzt zögerte, bevor er weitersprach. Dann gab er sich einen Ruck: »Nun, kurz gesagt, er hatte sich nicht mehr im Griff, und das hat auch seine Urteilsfähigkeit getrübt. Wir hatten ihm daher nahegelegt, seine Anstellung hier aufzugeben. Vermutlich hat ihm dies – nun ja – den Rest gegeben. Aber im Interesse unserer Patienten konnten wir nicht anders handeln.« Er hüstelte etwas gekünstelt und fügte hinzu: »Eine wirklich tragische Sache, die uns alle sehr belastet.«
Wer’s glaubt, wird selig, dachte Clara böse in Bezug auf den selbstgerechten Ton des Arztes und hakte nach: »Sie wollten Dr. Lerchenberg entlassen?«
»Nun, uns wäre eine einvernehmliche Lösung lieber gewesen ...«, wich der Arzt aus. »Aber dazu ist es jetzt bedauerlicherweise nicht mehr gekommen.«
»Bedauerlicherweise«, wiederholte Clara ironisch und bohrte nochmals nach: »Dr. Lerchenberg hat sich also bei seiner Diagnose im Fall Ruth Imhofen geirrt?«
»Aber das liegt doch auf der Hand!«, gab Selmany erregt zurück. »Frau Imhofen hätte nie entlassen werden dürfen. Sie ist schwer psychisch krank und aufgrund ihrer Krankheit unberechenbar. Alle Therapieversuche in der Vergangenheit sind fehlgeschlagen. Aber Dr. Lerchenberg wollte das nicht wahrhaben, er hat alle meine Warnungen in den Wind geschlagen.« Dr. Selmany seufzte tief. »Und als die Katastrophe dann passiert ist, hat er versucht, seine Haut zu retten. Er hat alle Unterlagen verschwinden lassen und Sie beauftragt. Aber es war natürlich viel zu spät.«
Clara schwirrte der Kopf. Sie hatte das Gefühl, nicht wirklich anwesend zu sein. Sie verstand nicht, wovon dieser Arzt sprach. »Katastrophe? Von welcher Katastrophe sprechen Sie?«, fragte sie unbehaglich. War ihr in dem Gespräch etwas entgangen?
»Wollen Sie mir etwa weismachen, Sie wüssten nichts davon?« Dr. Selmany klang plötzlich wütend. »Lesen Sie denn keine Zeitung?«
»Himmelherrgottnochmal!«, fluchte Clara. »Würden Sie endlich einmal Klartext mit mir reden?«
»Aber das tue ich doch!«, gab Dr. Selmany pikiert zurück. »Offenbar hat es Dr. Lerchenberg versäumt, Sie über die Tragweite dieses Falles aufzuklären.« Und wie zu sich selbst fügte er noch hinzu: »Das ist ja ein starkes Stück.«
»Er hatte es vor, aber die Sache mit dem Baum ist ihm dazwischengekommen«, gab Clara trocken zurück.
»Oh. Natürlich.« Dr. Selmany schwieg.
Clara wartete. Doch es kam kein weiterer Kommentar. Der Arzt schien nicht gewillt zu sein, mehr über die Sache zu sagen.
»Dr. Selmany?«
»Hören Sie, ich fürchte, ich muss das Gespräch hier beenden, ich habe noch Termine. Es tut uns sehr leid, dass Dr. Lerchenberg Sie mit dieser unseligen Sache belästigt hat.« Er hüstelte erneut, dann sprach er schnell weiter: »Wir werden sofort veranlassen, dass Ihre Beauftragung rückgängig gemacht wird, und für Ihre bisherigen Bemühungen kommen wir selbstverständlich in voller Höhe auf. Bitte schicken Sie uns Ihre Honorarrechnung, und scheuen Sie sich nicht, alle Posten anzusetzen, die Sie für angemessen betrachten. Es ist das Mindeste, das wir in Anbetracht des eklatanten Fehlverhaltens unseres Mitarbeiters tun können.« Es klang sehr salbungsvoll.
»Moment!« Clara runzelte die Stirn. »Wie kommen Sie darauf, dass ich diese Sache nicht übernehmen möchte?«
»Aber ich dachte ... nachdem Sie keinerlei Informationen haben und Frau Imhofen in Kürze sowieso wieder in unsere Obhut zurückkommen wird, wäre es das Einfachste für alle Beteiligten, ihr die Betreuerin zu geben, die sie in all den Jahren zuvor hatte.«
Clara konnte nun die Ungeduld in Dr. Selmanys glatter Stimme durchklingen hören, doch das ließ sie unbeeindruckt. Längst hatten in ihr alle Alarmglocken zu schrillen begonnen.
»Warum wurde diese Betreuung denn überhaupt aufgehoben?«, fragte sie.
Dr. Selmany gab ein bitteres Lachen von sich. »Das, Frau Anwältin, wüssten wir alle gerne. Aber leider können wir Herrn Lerchenberg nicht mehr fragen, nicht wahr?« Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: »Sie sollten diese Angelegenheit wirklich uns überlassen, Frau Niklas. Unsere hausinterne Betreuerin verfügt sowohl über die notwendige Erfahrung mit der Patientin als auch über die medizinische Kompetenz, und Sie können Ihre kostbare Zeit für sinnvollere Dinge verwenden.« Dann legte er auf, bevor Clara noch etwas erwidern konnte.
Sie stand nachdenklich auf und öffnete das Fenster neben ihrem Schreibtisch, um den Rauchgeruch zu vertreiben. Sie und Willi, der ein leidenschaftlicher Pfeifenraucher war, hatten sich mit Rücksicht auf Linda und ihre Mandanten auf ein generelles Rauchverbot in der Kanzlei geeinigt, und Übertretungen wurden scharf geahndet, beispielsweise mit einer Einladung zum Mittagessen bei Rita oder einem freigehaltenen Abend im Murphy’s, ihrer Stammkneipe.
Clara lehnte sich auf die Fensterbank und zündete sich eine weitere Zigarette an. Sorgfältig blies sie den Rauch in die kalte Herbstluft hinaus. Es war ungemütlich kalt, und die schweren Wolken kündigten Regen an. Das trockene, klare Oktoberwetter der letzten Tage schien sich endgültig verabschiedet zu haben. Clara bemerkte eine Katze, die im Haus gegenüber am Fenster einer Wohnung im ersten Stock saß und auf sie herunterblickte. Unbeweglich hockte sie dort, wie eine Figur aus Porzellan, ihre Augen unverwandt auf Clara gerichtet. Clara winkte hinauf und wünschte, die Katze würde eine Bewegung machen. Doch nichts geschah. Reglos blieb das Tier auf der Fensterbank sitzen.
Clara rauchte ihre Zigarette zu Ende und warf die Kippe auf den Gehsteig. Dann schloss sie das Fenster und setzte sich unschlüssig an ihren Schreibtisch zurück. Ihr Blick fiel auf die Notizen vor ihr, und sie zog die Nase kraus. Hatte dieser Arzt tatsächlich versucht, sie zu bestechen? Zweifellos wollte er nicht, dass sie sich weiter um Frau Imhofen kümmerte. Doch hier passte nichts zusammen. War Dr. Lerchenberg tatsächlich so ein Mensch gewesen, wie Dr. Selmany ihn dargestellt hatte? Er war nervös gewesen, aufgeregt, ja, das schon. Aber tablettensüchtig, ein Trinker? Clara konnte es nicht sagen. Sie hatte ihn nicht gekannt. Und immerhin schien er sich umgebracht zu haben. Sie schüttelte den Kopf, das konnte sie nicht glauben. Niemand verabredet sich, wenn er vorhat, Selbstmord zu begehen. Aber andererseits ... warum sollte Dr. Selmany solche Dinge über einen Mitarbeiter verbreiten, wenn sie keinen wahren Hintergrund hatten? Ärzte waren in der Regel nicht so freigebig mit Informationen, wenn es um Versäumnisse in ihren eigenen Reihen ging. Clara nickte nachdenklich. Genau das war es gewesen, das sie in dem Gespräch von Anfang an stutzig gemacht hatte. Dr. Selmany hatte sie glauben lassen wollen, er sei vollkommen aufrichtig zu ihr, doch in Wahrheit hatte er nichts preisgegeben. Diese ganze Geschichte um Dr. Lerchenberg konnte genauso gut dazu gedient haben, die wahren Hintergründe zu verschleiern.
»Da stinkt was ganz gewaltig, meine Liebe!«, sagte Clara zu Elise gewandt. Elise grunzte zustimmend und öffnete ein Auge.