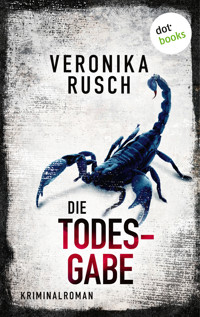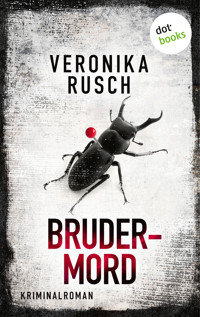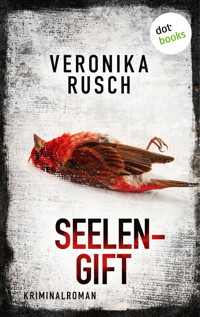11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Heldinnen des Alltags
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Berlin, 1945. In der Mission am Schlesischen Bahnhof suchen Flüchtlinge, Traumatisierte, Überlebende Zuflucht. Sie werden von Alice in Empfang genommen, der selbst der Krieg mit seinem Elend nichts von ihrem Idealismus hat nehmen können. Und auch Natalie taucht aus dem Exil wieder auf, zusammen mit ihrer Tochter. Als ein Arzt zu den Helfenden stößt, sind sie zunächst dankbar für sein Engagement. Doch nach und nach wird immer deutlicher, dass den angeblich so Selbstlosen ein dunkles Geheimnis umgibt. Natalies Tochter lässt nicht locker, und schließlich stehen die drei Frauen vor einer schweren Entscheidung ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 548
Ähnliche
INHALT
ÜBER DAS BUCH
Berlin, 1945. In der Mission am Schlesischen Bahnhof suchen Flüchtlinge, Traumatisierte, Überlebende Zuflucht. Sie werden von Alice in Empfang genommen, der selbst der Krieg mit seinem Elend nichts von ihrem Idealismus hat nehmen können. Und auch Natalie taucht aus dem Exil wieder auf, zusammen mit ihrer Tochter. Als ein Arzt zu den Helfenden stößt, sind sie zunächst dankbar für sein Engagement. Doch nach und nach wird immer deutlicher, dass den angeblich so Selbstlosen ein dunkles Geheimnis umgibt. Natalies Tochter lässt nicht locker, und schließlich stehen die drei Frauen vor einer schweren Entscheidung …
ÜBER DIE AUTORIN
Veronika Rusch ist Jahrgang 1968. Sie studierte Rechtswissenschaften und Italienisch in Passau und Rom und arbeitete als Anwältin in Verona, sowie in einer internationalen Anwaltskanzlei in München, bevor sie sich selbständig machte. Heute lebt sie als Schriftstellerin mit ihrer Familie in ihrem Heimatort in Oberbayern. Neben Romanen schreibt sie Theaterstücke für Erwachsene und Kinder sowie Dinner-Krimis. Für ihre Krimikurzgeschichte Hochwasser erhielt sie 2009 den zweiten Preis im Agatha-Christie-Krimiwettbewerb.
VERONIKA RUSCH
EINESMENSCHENLEBEN
DIEBAHNHOFSMISSION
ROMAN
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © Veronika Rusch
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München
Copyright © 2024 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anna Hahn, Trier
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de
Einband-/Umschlagmotive: © iStock | Getty Images Plus: Serjio74 | Daria Bayandina | LiuSol | BrAt_PiKaChU; © Richard Jenkins Photography
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-4818-6
luebbe.de
lesejury.de
TEIL 1
PROLOG
BERLIN, ENDE APRIL 1945
Die Welt draußen hatte aufgehört zu existieren. Es gab nur noch diese vier grob verputzten Wände, gestampfte Erde unter den Füßen, eine niedrige Decke aus Holzbalken. Darüber seit Tagen nur Kanonendonner, Artillerie, ein dumpfes Grollen, Schüsse, das Geknatter der Flaks. Volkssturm nannte man diese Farce, die vorgab zu retten, was längst verloren war. Tausendjähriges Reich, Endsieg, totaler Krieg. Begriffe, die keinen Sinn ergaben, so laut sie auch hinausgebrüllt wurden in diese schwarz-weiß-rote Welt, in der es nur noch dafür und dagegen gab. Ein Gemetzel ohne Ziel und Verstand. Der Untergang aller Dinge, die einmal schön gewesen waren. Liebe, Glück, Lachen, Freiheit … nur noch eine blasse Erinnerung an etwas, was einmal gewesen war, irgendwann, irgendwo …
»Pielst du mit mir?« Das kleine Mädchen mit den blonden Löckchen zupfte Alice am Ärmel. Sie lächelte das Kind dankbar an.
»Ja, lass uns was spielen!«
Elsie schaffte es immer wieder, sie auf andere Gedanken zu bringen. Sogar hier unten in diesem Loch, wo Alice zusammen mit den anderen Bewohnern des Mietshauses und Nachbarn seit Tagen ausharrte, während über ihnen die Apokalypse stattfand. Die Russen hatten die Sperrringe der Wehrmacht bis ins Innere der Stadt überrannt, die Deutschen hatten ihnen nichts mehr entgegenzusetzen gehabt, nachdem sie seit Monaten schon auf dem Rückzug gewesen waren, abgestumpft, entkräftet, tödlich verwundet, Kanonenfutter dieses einen kleinen brüllenden Mannes und seiner Schergen, die die Welt mit ihren geifernden Fieberträumen an den Rand des Abgrunds gebracht hatten.
Elsie hielt ihr einen schäbigen alten Teddy hin, der schwarz von Ruß war und nur noch ein Auge hatte. »Du pielst Fritz. Er ist krank.«
Alice bemerkte, dass Elsie dem Teddy ein Taschentuch um den Hals gebunden hatte. »Oje, was fehlt ihm denn?«
»Nupfen«, sagte die Vierjährige betrübt und wischte sich mit dem Handrücken über ihre eigene Rotznase, was den Rotz allerdings nur verschmierte. Ihr herziges Gesicht mit den blauen Kulleraugen war schmutzig, so wie die Gesichter aller anderen hier unten auch. Man konnte nicht tagelang im Kohlenkeller hausen, fünfzehn Menschen, und dabei sauber bleiben. Alice stellte sich vor, was sie für ein Bild abgeben würden, sollten sie irgendwann wieder ans Tageslicht kommen: Eine Gruppe hohlwangiger, schmutziger Gespenster mit rußigen Gesichtern und angstgeweiteten Augen. Doch im Gegensatz zu so vielen anderen waren sie am Leben. Noch.
»Und wen spielst du?« Alice wusste, dass es in Elsies Spielefundus, den sie in einer alten Kaffeebüchse immer mit sich herumtrug, noch ein Stoffpüppchen, drei Wehrmachtsoldaten aus Lineol und einen kleinen roten Ball gab, auf den Elsies große Schwester Hertha mit Kohle zwei Augen gemalt hatte und dessen Name Franz war. Die Soldaten gehörten ihrem älteren Bruder Alfred, ebenso wie ein Panzerspähwagen aus Blech, der mit einem kleinen Flakgeschütz ausgestattet war. Die Mutter hatte Alfred jedoch verboten, damit zu spielen, und seit von oben unablässig der Lärm der Geschütze ertönte, war Alfred auch die Lust dazu vergangen, Krieg zu spielen. Bei Elsie dagegen hatten die beiden Soldaten kein kriegerisches Leben zu befürchten. Sie spielte Vater, Mutter, Kind mit ihnen, verarztete sie oder setzte sie zusammen mit dem Teddy und dem Ball nebeneinander auf einen herumliegenden Ziegelstein, der sich in ihrer Fantasie in eine Schulbank verwandelte. Dann wurde das Püppchen zur Lehrerin und brachte den gehorsamen Schülern das Einmaleins und das ABC bei, zumindest das, was Elsie davon schon beherrschte oder glaubte, zu wissen. Eine Wand diente dabei als Tafel. Sie war vollgemalt mit Fantasiezeichen, die Zahlen und Buchstaben darstellen sollten, krakeligen Zeichnungen von Bäumen, Blumen, Sonnen und windschiefen Häuschen, die Elsie, die Zunge konzentriert zwischen die Lippen geklemmt, mit einem Stück Kohle malte. Wenn Alice besonders schwermütig zumute war, sah sie sich die Zeichnungen an und betete darum, dass es dem Mädchen vergönnt sein möge, Bäume, Blumen, heile Häuser und die Sonne wiederzusehen. Jetzt hob Elsie ihr Püppchen hoch und sagte zu dem Teddy: »Ich bin Krankenschwester Alice, ich mach dich wieder gesund.«
Elsie wusste, dass Alice als Hilfskrankenschwester im Lazarett gearbeitet hatte, bevor es in der allgemeinen Panik vor den heranrückenden Russen aufgelöst und die Verletzten hastig in vermeintlich sicherer gelegene Krankenhäuser verlegt worden waren. Sie fand das unglaublich spannend, daher imitierte sie sie häufig im Spiel. Wie immer ließ Alice sich auch jetzt gerne von dem kleinen Mädchen in ihre Fantasiewelt entführen. Schniefend und niesend wackelte sie mit dem Teddy hin und her. »Oh, das ist gut!«, erwiderte sie in ihrer schon oft geprobten Teddy-Fritz-Stimme. »Ich fühle mich ganz schwach. Und meine Nase ist zugesperrt. Kannst du sie bitte wieder aufsperren?«
Elsie kicherte. »Die ist doch nicht zugesperrt, Fritz. Das ist der Nupfen. Du musst dich ins Bett legen. Sonst kriegst du Fieber wie Irmchen.«
Alice legte den Teddy auf das Zeitungspapier, das Elsie zum Bett erkoren hatte. »Oh, wie schön!«, seufzte sie mit Fritz’ Stimme. »Das ist sooo gemütlich.«
Elsie deckte den Teddy mit einem weiteren schmutzigen Zeitungsblatt sorgfältig zu. Als Alice dabei unwillkürlich die Schlagzeile darauf las – Tagesbefehl des Führers an die Ostfront: Vor Berlin wird der Feind verbluten! –, vergaß sie für einen Moment das Spiel, und die hilflose Wut, die sie nun schon so lange Zeit mit sich herumtrug, packte sie erneut. Dieser größenwahnsinnige, jämmerliche Lügner und all seine Spießgesellen. In der Hölle zu schmoren war noch zu wenig Strafe für ihn. Ein weiterer kurzer Blick sagte ihr, dass das rußige Zeitungpapier erst vom 17.April stammte. Offenbar hatte jemand Kohlen darin eingewickelt, die er irgendwo ergattert – oder gestohlen – hatte. Ihr entfuhr ein bitteres Lachen. Hatte vor nicht mal zwei Wochen etwa noch irgendein Mensch in diesem zerstörten Land an solche Sprüche geglaubt?
»Du darfst nicht lachen, Alice!«, wies Elsie sie streng zurecht. »Fritz ist doch krank. Das ist nicht lustig.«
»Stimmt«, gab Alice ihr schuldbewusst recht und rief mit Fritz’ Stimme: »Oje, mir geht’s so schlecht. Kannst du mir nicht eine Medizin geben, Alice?«
»Du kriegst jetzt Tropfen, und dann ist der Nupfen gleich weg,« sagte Elsie in einem gewichtigen Tonfall und tat so, als verabreichte sie dem Teddy Nasentropfen, genau wie Alice es gestern Abend bei ihr und ihren Geschwistern gemacht hatte. Alle vier Kinder der Familie Ackermann waren erkältet, am schlimmsten Irma, das kleine Würmchen, das erst acht Monate alt war. Sie greinte und wimmerte die ganze Zeit und hatte fiebrig rote Bäckchen. Trude, ihre Mutter, stillte sie noch, aber weil die Nase so verstopft war, konnte die Kleine nicht richtig trinken und das Fieber schwächte sie und trocknete sie aus. Alice machte sich Sorgen, was passieren würde, wenn sie nicht bald hinauskamen. Die abgestandene, feuchte Luft des Kellers war Gift für Bronchien und Schleimhäute, und wenn Irmchen nicht bald ordentlich Nahrung aufnahm und noch schwächer wurde, konnte es schnell kritisch werden. Trude Ackermann, die Mutter, wusste das ebenso wie Alice und ließ das kleine Mädchen nicht aus den Augen. Tag und Nacht saß sie in der Ecke und hielt Irmchen im Arm, eng an ihre Brust gedrückt, um es zu wärmen, wiegte es und summte ihm leise etwas vor, so auch jetzt. Alice erkannte das Lied »Die Gedanken sind frei«, was von Böswilligen – und solche gab es genug – vermutlich als gefährliche Regimekritik gewertet werden könnte, sofern das jetzt und hier unten noch eine Rolle spielte.
Als hätte er Alice’ Gedanken gehört, meldete sich prompt Hermann Olsen, der einen Zeitschriftenladen im Erdgeschoss ihres Hauses betrieben hatte, zu Wort: »Hörste wohl mit die Gesumms von dem Lied uff? Wenn dit jemand hört!«
»Wer soll dit schon hören?«, antwortete eine Frau aus dem Dunkel einer anderen Ecke. »Höchstens die Ratten. Meenste, da is eene bei, die uns verhaftet?«
Gelächter ertönte. Alice erkannte die Stimme. Es war Wilma Tietze, die Frau des Metzgers in ihrer Straße.
»Lacht nur!«, wehrte sich Olsen. »Ick hab jesehen, wie die SS noch den Jungen von den Kurschattkes aufjehängt hat. Keene zehn Tage ist dit her. Da standen die Russn schon vor der Tür.«
»Ja, und jetzt sind sie da, die Bolschwiken, die wa doch besiegen wollten! Und haben nich mal anjeklopft«, entgegnete Wilma Tietze spöttisch. »Denen ist dit schnurzegal, wat die Trude da singt. Wenn die mit uns fertig sind, kannste uns vom Boden uffkratzen.«
»Die Wehrmacht wird sie zurücktreiben!«, rief eine Jungenstimme, die erkennbar im Stimmbruch war. Sie gehörte Hans, dem dreizehnjährigen Sohn von Alice’ Nachbarin aus dem dritten Stock, Heide Prittwitz. Er war nur mit Gewalt von seiner Mutter dazu zu bringen gewesen, mit in den Keller zu kommen, eigentlich hatte er als Luftwaffenhelfer dem Führer bis zuletzt dienen wollen, doch als Heide ihn im allgemeinen Chaos entdeckt hatte, hatte sie ihm eine Ohrfeige gegeben, die sich gewaschen hatte, und ihn buchstäblich am Kragen heruntergeschleift. Seitdem hockte er murrend auf seinem Platz und haderte damit, nicht als Held sterben zu dürfen.
»Berlin wird deutsch bleiben!«, rief er in einer Tonlage irgendwo zwischen Kieksen und Krächzen, und es klang, als sei er den Tränen nahe.
Wilma Tietze lachte meckernd auf. »Davon träumt er vielleicht, der olle Hitler.«
»So etwas dürfen Sie nicht sagen!« Die Stimme des Jungen war schrill geworden. »Den Führer darf man nicht beleidigen! Darauf steht der Tod!«
Die Frau stand auf und stemmte die Arme in die Seiten.
»Hör mir mal zu, du Grünschnabel. Ick lass mir von niemandem mehr den Mund verbieten. Ick hab nen juten Mann und zwee anständije, stattliche Söhne jehabt, die ihr Leben noch vor sich hatten. Alle drei hat er mir jenommen, dein ach so heilijer Scheißführer. Und du kannst och froh sein, dass deine Mutter dich herjebracht hat. Sonst wärste jetzt Matsche und kein Hahn würde mehr nach dir krähen.«
Das Schweigen, das sich nach dieser Ansage im Keller ausbreitete, war so dicht und schwer, dass nicht einmal Irmchens Weinen es durchdringen konnte. Elsie, die gerade noch geschäftig an ihrem Teddy herumgenestelt hatte, hielt mitten in der Bewegung inne und sah angstvoll auf, und auch Hans Prittwitz war verstummt. Alice’ Blick flog zu der Stelle ganz hinten im Keller, wo Ernst Krause und seine Frau Waltraud saßen, doch in dem bloß von Kerzen und zwei alten Petroleumlampen erhellten Raum konnte sie ihre Mienen nicht erkennen. Krause war der Blockleiter des Gebäudekomplexes gewesen, zu dem auch der Luftschutzkeller gehörte und von dem nur noch das Vorderhaus, in dem Alice wohnte, stand. Alice überlegte kurz, ob die Gegenwartsform, in der sie an ihre kleine Wohnung dachte, überhaupt noch angemessen war. Mit dem Einmarsch der Russen war nichts mehr sicher, noch nicht einmal das Wenige, das nach den unzähligen Luftangriffen geblieben war. Es hatte Diskussionen darüber gegeben, ob man Krause und seine Frau in den Keller lassen sollte, zu präsent waren all die Schikanen und Bespitzelungen des schmalbrüstigen kleinen Mannes Anfang sechzig und seiner missgünstigen Gattin noch gewesen. Alice war überzeugt, dass er Schuld daran trug, dass die Familie Winterfeld aus dem dritten Stock bei Nacht und Nebel von der Gestapo abgeholt worden war, ebenso wie einige Leute im Hinterhaus über der Wäscherei, die im Beisein einer der beiden Krauses etwas Falsches gesagt oder einer seiner Anordnungen nicht Folge geleistet hatten. Heide Prittwitz und Hermann Olsen waren strikt dagegen gewesen, die beiden aufzunehmen, andere hatten sichtlich gehadert, doch am Ende hatte der Großmut sich knapp durchgesetzt. Alice war unter denen gewesen, die sich dafür ausgesprochen hatten, die Krauses trotz allem in den Keller zu lassen. Sie weigerte sich, das Mitleidlose und Verrohte dieser Zeit mit Gleichem zu vergelten, und wenn auch nur aus reinem Selbstschutz. Denn was blieb noch übrig von einem, wenn man seine Menschlichkeit aufgab? Sie hatte es gesehen, erlebt, Tag für Tag, Jahr für Jahr. So wollte, nein, so durfte sie nicht werden.
Seit sie hier waren, schwiegen die Krauses, wohlwissend, dass die Gnade der Aufnahme in diese im Keller Schutz suchende Gemeinschaft eine unsichere Sache war. Ein falsches Wort, ein plötzlich aufflammender Streit – und all der aufgestaute Groll und Hass der Mieter auf den Blockwart würden sich folgenschwer entladen. Ernst Krause schien sich dessen sehr genau bewusst zu sein. Vermutlich aus diesem Grund erbot er sich auch jedes Mal in unterwürfiger Manier, den Eimer zu leeren, der – hinter einem behelfsmäßigen Vorhang – als Latrine diente, und zum Hydranten an der Straßenecke zu gehen, wenn die Wasservorräte zur Neige gingen, was im pausenlosen Kugelhagel dieser Tage eine lebensgefährliche Aufgabe darstellte. Anfangs hatte seine Frau dann immer geweint, aber nachdem Wilma Tietze sie unmissverständlich angewiesen hatte, die Klappe zu halten, sonst würde sie sie ihr höchstpersönlich stopfen, schwieg sie, die blassen Hände zu einem stummen Gebet verkrampft, und wartete in ihrer Ecke, bis ihr Mann von seinem Opfergang zurück war. Sie hatten beide keine Regung gezeigt, als Wilma jetzt Hitler beschimpft hatte, etwas, was noch vor wenigen Tagen mit ihrem eifrigen Zutun zu einer sofortigen Verhaftung geführt hätte. Doch jetzt war niemand mehr da, bei dem Ernst Krause Wilma Tietze hätte anzeigen können. Niemand, der ihm den Rücken stärkte und ihm bestätigte, dass er richtig handelte. Das tausendjährige Reich war dem Erdboden gleichgemacht, und all seine willfährigen Helfer – ihrer Anführer beraubt – waren wieder das, was sie vorher auch gewesen waren: armselige kleine Würstchen.
Plötzlich durchbrach ein lautes Geräusch das bleierne Schweigen. Etwas rumpelte und schlug gegen die von innen verriegelte Eisentür, die hinauf zum Hausflur führte. Heide Prittwitz schrie erstickt auf und verstummte dann sofort wieder.
»Was war das?«, hauchte Trude Ackermann mit vor Angst bebender Stimme, ihr endlich schlafendes Baby fester umklammernd.
»Sind das die Russen?«, fragte ihr Sohn Alfred und drängte sich ängstlich an Hertha, seine ältere Schwester, die neben der Mutter saß und die ganze Zeit über verbissen versucht hatte, im trüben Kerzenlicht in ihrem Buch zu lesen.
»Nein, Fredi, das war bestimmt nur ein Stein, der von oben runtergekollert ist«, antwortete Hertha, doch auch ihre Stimme zitterte, und sie sah ebenso ängstlich aus wie er. Langsam klappte sie das Buch zu und legte ihren Arm um den Bruder. Elsie ließ Püppchen und Teddy fallen und lief zu ihnen hinüber. Trude nahm sie zu Irmchen auf ihren Schoß, während sich die beiden anderen Kinder ebenfalls an sie schmiegten. Sie sah jetzt aus wie eine Glucke, die ihre Küken beschützt.
»Jemand sollte nachsehen«, sagte Otto Pasulke. Der Besitzer der Wäscherei war hier unten der einzige Mann im wehrfähigen Alter, allerdings besaß er nur noch ein Bein. Er hatte an der Ostfront gekämpft und war schwer verwundet worden. Kurz nach seiner Rückkehr nach Hause war die Familie ausgebombt worden. Das alte Fräulein Pachmayer, die Mutter des Hauseigentümers, die ganz allein in der großen Beletage wohnte, hatte der Familie Pasulke daraufhin Unterschlupf gewährt. Die alte Dame, klein und zerbrechlich wie ein Vögelchen, saß jetzt neben Astrid, der Tochter der Pasulkes, auf einem der provisorischen Holzbänke, mit denen der Kellerraum neben den Feldbetten ausgestattet war. Sie hatte einen altmodischen Hut mit kleinem Schleier und Strohblumen auf ihrem Kopf und saß so aufrecht da, als warte sie auf den Zug. In der ganzen Zeit, in der sie hier unten waren, hatte Alice sie noch nicht ohne Hut gesehen. Astrid Pasulke, eine stämmige Achtzehnjährige mit einem runden, freundlichen Gesicht, hatte Strickzeug dabei, und wie Hertha, die versuchte, durch ständiges Lesen die Angst und die Langeweile nicht an sich heranzulassen, beschäftigten sich Astrids Finger den ganzen Tag über mit einem aus komplizierten Mustern bestehenden, halb fertigen Pullover. Die zarte, flaumige Wolle war vermutlich einmal hellgelb gewesen, jetzt jedoch war sie schmutzig grau, und Alice zweifelte daran, dass aus diesem Werk einmal ein tragbarer Pullover würde.
»Nachsehen? Sind Sie verrückt?«, zischte Heide Prittwitz jetzt in Otto Pasulkes Richtung. »Was, wenn das einer von der SS ist? Der erschießt meinen Hans als Deserteur und uns alle gleich mit.«
»Ich will nicht erschossen werden!«, wimmerte Alfred, und Elsie begann zu weinen. Irmchen, wieder wach geworden, fiel mit ein.
»Haltet doch mal die Klappe, ihr dämlichen Gören!«, fuhr Hermann Olsen die Kinder an. »Ihr könnt ja gleich rausposaunen, dass wir hier unten sitzen. Es soll uns doch niemand finden.«
»Dann wäre ick an deiner Stelle och leise, Hermann«, meldete sich Wilma Tietze zu Wort, noch ehe Trude etwas erwidern konnte. »Ick bin dafür, nachzukieken. Vielleicht ist uns das Haus uffn Kopp jefallen oder es brennt irgendwo da oben und wir müssen kucken, wie wir rauskommen. Ick will hier nich jämmerlich verrecken wie ne Ratte in der Falle.«
»Und wenn sie genau darauf warten?«, fragte Hermann Olsen. »Wenn sie nur drauf warten, dass wir rauskommen?«
»Wen meinste denn mit sie?«
»Na, die tollwütigen Hunde von der SS!«, mischte sich Heide Prittwitz wieder ein und zog ihren nun ebenfalls blass gewordenen Sohn näher zu sich. »Wir dürfen auf gar keinen Fall aufmachen.«
»Quatsch, die SS ist doch längst über alle Berge! Das sind die Russen!«, sagte Olsen, und seine kleinen, wässrigen Augen huschten nervös umher, so als suchte er nach einem Fluchtweg. Er ähnelte tatsächlich ein wenig einer Ratte in der Falle.
»Die Russen wären schon längst hier drin. Und die SS auch. Oder glaubste etwa, die klopfen an?« Wilma ging in Richtung Tür.
»Warten Sie! Ich sehe nach.« Ernst Krause war aufgesprungen und trat Wilma Tietze in den Weg. »Sie sollten das nicht tun. Wenn es eine fehlgegangene Granate ist …« Er sprach nicht weiter, sondern schob sich wortlos an der breiten, großen Metzgersfrau vorbei zur Tür.
»Nein, Ernst! Bleib da!«, kreischte seine Frau auf, doch er achtete nicht auf sie. Langsam schob er den Riegel zurück und öffnete die Tür, die nach innen aufging, einen winzigen Spalt, gerade so viel, um einen Blick nach draußen werfen zu können. Im Keller war es mucksmäuschenstill, noch nicht einmal das Klappern von Astrids Stricknadeln war zu hören. Alice konnte fast spüren, wie jeder im Raum die Luft anhielt, sie miteingeschlossen. Nach ein paar Sekunden schloss sich die Tür mit einem leisen Quietschen wieder, und der ehemalige Blockwart drehte sich zu ihnen um. »Da liegt einer«, sagte er. »Ein Soldat.«
»Ist er tot?«, fragte Wilma.
Krause schüttelte den Kopf. »Ich glaube, er atmet noch. Sein Bein ist voller Blut.«
»Dann müssen wir ihn reinholen«, sagte Alice. »Ich habe meine Ausrüstung dabei. Vielleicht kann ich ihm helfen.« Sie stand auf und ging zu Krause an die Tür, doch der machte keine Anstalten, sie wieder zu öffnen.
»Was ist? Warum machen Sie nicht auf?«
»Es ist keiner von uns«, sagte er.
»Sie meinen, es ist ein Russe?«
Er nickte.
Ein kollektives Keuchen war zu hören, dann begann seine Frau zu wimmern. »Oh, mein Gott!«, stieß sie unter Schluchzern hervor. »Sie sind tatsächlich da! Wir sind verloren.«
Alice fragte sich irritiert, was die Frau gedacht hatte, warum sie seit Tagen hier unten hockten, und wandte sich wieder Ernst Krause zu. »Wir können den Mann nicht vor unserer Tür verbluten lassen.«
»Aber er ist der Feind!«
Alice lachte bitter auf. »Gibt es das noch, ja? Freunde und Feinde? Und wo sind sie, Ihre sogenannten Freunde?«
Krause hatte den Anstand, seinen Blick zu senken, und Alice griff nach dem Türknauf.
»Sind Sie völlig verrückt geworden?« Hermann Olsen war jetzt aufgesprungen und trat auf sie zu. »Gute Frau, Ihre weiblichen Anwandlungen von Mitgefühl in allen Ehren, aber die sind hier fehl am Platz. Wir sind im Krieg, ist Ihnen denn nicht klar, was das bedeutet?«
»Allerdings ist es das!«, fauchte Alice ihn so zornentbrannt an, dass Olsen erschrocken zurückwich. »Ich habe zwei Jahre im Lazarett in Treptow gearbeitet. Glauben Sie mir, ich weiß besser als Sie, was Krieg bedeutet.« Etwas leiser, aber nicht minder zornig fügte sie hinzu: »Und nennen Sie mich nie mehr ›gute Frau‹, sonst kann ich für nichts garantieren.«
Er starrte sie mit offenem Mund an. Auch die Übrigen schwiegen. Alice sah in viele verblüffte Gesichter. Kein Wunder. Außer mit Elsie und ihrer Mutter, mit der sie befreundet war, hatte sie in den Tagen hier unten nicht viel gesprochen und auch vorher eher zurückgezogen gelebt. Ein höfliches »Guten Tag«, ein paar unverfängliche Worte über das Wetter, die Frage nach dem Wohlergehen der Familie, weiter nichts.
Alice drehte sich um und öffnete die Tür, ohne dass noch einmal jemand widersprach. Staubiges Licht drang durch den Spalt in den Keller, und der beißende Geruch nach unzähligen abgefeuerten Geschützen, nach Rauch und Feuer und Blut. Der russische Soldat lag direkt vor der Tür, und als Alice sie weiter öffnete, rutschten sein Kopf und der Oberkörper auf die Schwelle. Er war nicht bei Bewusstsein, und wie Krause schon gesagt hatte, blutete er stark am Bein. Unter dem Oberschenkel hatte sich bereits eine Lache gebildet, und der Stoff der Uniformhose war blutgetränkt. Hoffentlich war die Arterie nicht verletzt, denn dann würde Alice nicht mehr viel für ihn tun können. Doch in diesem Fall würde das Blut in heftigen Stößen herausspritzen, mit jedem Herzschlag ein neuer Schwall, und davon war nichts zu sehen. Aber womöglich hatte er sich bei dem Sturz über die Kellertreppe noch weitere Verletzungen zugezogen. Alice warf einen Blick nach oben. Die Kellertreppe endete in einem hellen Rechteck, man konnte einen Zipfel des Himmels sehen, wolkenverhangen, grau und leblos. Eine Haustür gab es schon seit Längerem nicht mehr. Eines Morgens war sie plötzlich weg gewesen. Vielleicht hatte jemand Feuerholz gebraucht oder eine Trage für Verletzte daraus gebaut. Es hatte keinen im Haus interessiert, ja, es war nicht einmal erwähnt worden. Seit man wusste, dass die Russen auf Berlin zumarschierten, machte sich niemand mehr Gedanken über so belanglose Dinge wie verschwundene Türen. Das helle Viereck blieb leer, niemand war zu sehen, keine Schritte zu hören, nur das etwas entfernte Knattern von Maschinengewehren hallte von den zerborstenen Wänden der Hausruine auf der anderen Straßenseite wider. Darüber lag das allgegenwärtige Dröhnen der Tiefflieger, das man fast schon nicht mehr wahrnahm. Alice wandte sich an Krause. »Wir müssen ihn vorsichtig anfassen. Womöglich hat er eine Wirbelsäulenverletzung.«
Krause sah zweifelnd drein. »Ich weiß nicht recht, ob ich das kann …«, sagte er und bückte sich unsicher, um den Mann anzuheben.
»Geh’n Se mal zur Seite, Krause«, sagte da eine forsche Stimme von hinten. »Ick mach das.« Wilma Tietze trat neben Alice. »Wat muss ick tun?«
Alice gab ihr ein paar Anweisungen, dann beförderten sie den Bewusstlosen zusammen vorsichtig in den Kellerraum. Krause folgte ihnen betreten. Kaum, dass sie drinnen waren, trat Hermann Olsen vor, schlug die Tür wieder zu und verriegelte sie. »Gnade Ihnen Gott, wenn das uns alle gefährdet!«, murmelte er leise, ohne Alice anzusehen, doch sie beachtete ihn ohnehin nicht mehr. »Krause, breiten Sie eine Decke auf das Feldbett da«, wies sie den kleinen Mann an und deutete auf das erste Bett neben ihnen. Zusammen mit Wilma bettete sie den Soldaten darauf. Dann holte sie ihre Tasche mit dem Verbandszeug und Medikamenten, die sie mit in den Keller gebracht hatte, sowie eine der beiden rußenden Petroleumlampen. Sie leuchteten nur noch schwach und flackernd. Mehr als eine notdürftige Erstversorgung war bei diesen Lichtverhältnissen nicht möglich. Aber sie konnte wenigstens verhindern, dass der Mann vor ihrer Tür verblutete. Als sie wieder zu dem Soldaten trat, sagte eine leise Stimme zu ihr: »Vielleicht kann ich Sie unterstützen?« Überrascht drehte Alice sich um. Hinter ihr stand Astrid Pasulke und schenkte ihr ein schüchternes Lächeln. »Ich arbeite seit einem Jahr beim Roten Kreuz mit. Ich habe keine richtige Ausbildung, nur einen Kurs gemacht, aber …« Sie verstummte schüchtern.
»Gerne, danke.« Alice nickte dem jungen Mädchen zu, dann kniete sie sich neben dem Soldaten auf den Boden und nahm ihm zunächst behutsam den Stahlhelm ab. Der Mann war jung, höchstens Anfang zwanzig, unter all dem Staub und Schmutz schien er blondes Haar zu haben, das an den Seiten so kurz geschoren war, dass die weiße Kopfhaut durchschimmerte. Sein Gesicht war blutig zerschrammt und die geschlossenen Lider bläulich. Sie flatterten leicht. Er würde vermutlich bald aufwachen. Alice tastete ihn vorsichtshalber nach Waffen ab, fand jedoch nichts und fühlte dann seinen Puls. Einigermaßen stabil. Sie machte sich daran, die Wunde zu untersuchen. Zunächst schnitt sie die zerfetzten Ränder der Uniformhose großflächig weg und tupfte das Blut ab, um besser sehen zu können, worum es sich eigentlich handelte. Sein Bein zuckte bereits bei der ersten Berührung. Sie warf Astrid einen Blick zu. »Ich werde ihn jetzt genauer untersuchen. Halte ihn an den Schultern fest.«
Gehorsam kniete Astrid sich hinter den Soldaten. An ihren routinierten Bewegungen erkannte Alice, dass die junge Frau das nicht zum ersten Mal machte.
Der Mann hatte eine Schussverletzung, ein glatter Durchschuss durch ein Infanteriegeschoss, mit einer verhältnismäßig großen Austrittswunde, was sie durch vorsichtiges Anheben des Beines feststellen konnte. Alice atmete auf. Wenn kein Knochen getroffen war, war dies noch die komplikationsloseste Art der Verletzung. Gelang es, eine Entzündung zu verhindern, hatte der junge Mann gute Chancen, wieder vollständig gesund zu werden. Als sie ihm den Stiefel auszog, das Hosenbein abschnitt und schließlich damit begann, die Wunde gründlich zu reinigen, schlug der Soldat die Augen auf. Nach einem Moment der Verwirrung bemerkte er, dass er nicht alleine war, und wollte sich aufrichten. Astrid gelang es nur mit Mühe, ihn wieder zurück auf sein Lager zu drücken. Er warf seinen Kopf hin und her und hatte seine Augen weit aufgerissen. In dem spärlichen, flackernden Licht mit seinen zuckenden Schatten wirkte seine Miene wild, und Hermann Olsen, der hinter Alice stand und den Soldaten nicht aus den Augen ließ, flüsterte: »Dieser vermaledeite Russe sieht aus wie der Teufel.«
»Wie ein armer Teufel«, gab Alice trocken zurück und arbeitete schweigend weiter. Sie kannte diesen Gesichtsausdruck zur Genüge. Die Miene des jungen Mannes zeigte, was die Mienen aller Soldaten zeigten, wenn sie nach einer Verletzung an der Front plötzlich im Lazarett aufwachten: Pure, nackte Todesangst. Zwar mochten sie in relativer Sicherheit sein, doch der Moment, als sie verletzt worden waren, die Panik, unter Beschuss geraten zu sein, hatte sich in ihren Gehirnen eingebrannt, war gewissermaßen konserviert worden. Als er jetzt realisierte, dass er in die Hände von Deutschen gefallen war, weiteten sich seine Augen noch mehr.
»Es ist alles gut«, sagte Alice zu ihm. »Sie sind in Sicherheit. Es wird Ihnen nichts geschehen. Bewegen Sie sich nicht.« Er verstand vermutlich kein Wort, aber ihre Stimme schien ihn zu beruhigen. Er ließ sich zurückfallen, wehrte sich nicht mehr, sein Körper blieb jedoch angespannt.
Alice konzentrierte sich weiter auf die Wunde, so wie sie es in den letzten Wochen und Monaten gemacht hatte. Desinfektion, Tupfer, örtliche Betäubung, falls vorhanden, den erschöpften, abgestumpften Chirurgen assistieren, sauber machen, Boden aufwischen, verzweifelten Männern über die Stirn streichen, Hände halten, beruhigend lächeln und dabei alles andere ausblenden. Diese Routine hatte sie über die traurigen Geschichten hinweggerettet, die sie zu hören bekommen hatte, über die Schreie und Tränen der Sterbenden – und sie half ihr auch jetzt.
»Waren Sie an der Front?«, fragte Astrid, während sie sie beobachtete.
»Nein«, gab Alice zurück. »Ich bin auch gar keine richtige Krankenschwester.« Sie zögerte, dann fügte sie hinzu: »Ich habe genau wie du vor vielen Jahren einmal einen Kurs zur Hilfskrankenschwester gemacht. Das war neunzehnhundertacht, vor meinem Studium, da war ich so alt wie du jetzt.« Alice presste in Erinnerung daran kurz und heftig die Lippen aufeinander. Neunzehnhundertacht. Siebenunddreißig Jahre war das her, und es schien ihr, als sei es in einem anderen Leben gewesen.
»Oh. Dann haben Sie ja zwei Kriege miterlebt.« Astrid sah sie mit einer gewissen Ehrfurcht an, und Alice rief sich ins Gedächtnis, dass Astrid damals noch gar nicht geboren gewesen war.
»Ja, das habe ich.« Alice spürte, wie sich ein bitterer Zug um ihren Mund legte, und übertünchte ihn mit einem leicht wehmütigen Lächeln.
Der Soldat sagte etwas auf Deutsch, doch so leise, dass Alice ihn nicht verstand. Sie beugte ihren Kopf zu ihm.
»Ich? Sterben?«, flüsterte er.
Alice schüttelte den Kopf. »Nicht jetzt. Nicht hier«, sagte sie, und er nickte, als hätte er ihre Worte begriffen.
Dann war sie fertig, der Verband war angelegt und sie brachte dem Soldaten unter dem finsteren Blick Hermann Olsens ein Glas Wasser. Der junge Mann hatte sich auf dem Bett etwas aufgerichtet, lehnte an der Wand und starrte misstrauisch und angstvoll zugleich in die Runde, registrierte offensichtlich erst jetzt die vielen Augenpaare, die ebenso misstrauisch und angstvoll zurückstarrten.
»Spasíbo«, murmelte er kaum hörbar.
Alice nickte. Auch ohne Russisch zu beherrschen, verstand sie, was das bedeutete.
Zwei Tage und zwei Nächte verbrachten sie zusammen mit dem Soldaten der Roten Armee in ihrem Keller, während über ihnen die Kämpfe unvermindert weitergingen. Es gab Diskussionen um die Essensrationen, die inzwischen so knapp waren, dass für keinen mehr genug da war. Und niemand wusste, ob und wann es wieder irgendetwas geben würde. Die letzten Reste Graupen, in Brühe eingeweicht, bekamen die Kinder und Trude, die noch stillte, die anderen nur leere Brühe und Tee, doch auch dies wollte Hermann Olsen dem Soldaten nicht gönnen. »Warum sollten wir dem etwas von unseren Sachen geben?«, fragte er jedes Mal, wenn Alice oder Astrid ihm einen Becher mit heißer Flüssigkeit brachten. »Die nehmen sich doch sowieso gerade alles, was nicht niet- und nagelfest ist, einschließlich unserer Frauen.«
»Quatsch nich so dusslig daher! Als ob du Schwächling jemals ne Frau jehabt hättest, die du ›mein‹ nennen könntest«, fuhr ihm Wilma Tietze dann grob über den Mund. Mit solchen und ähnlichen Sprüchen konterte sie sein Lamento stetig und unerbittlich, und immer verstummte er irgendwann, allerdings mit zornrotem Gesicht. Dem Mundwerk von Wilma Tietze war er nicht gewachsen. Alice beteiligte sich nicht an diesen Streitereien, sie kümmerte sich um den Soldaten, der, wie sie mithilfe von Astrid herausgefunden hatte, Jewgeni hieß. Das Versorgen des Verletzten ließ Alice auch den Hunger leichter ertragen, der unablässig an ihr nagte. Sie alle litten darunter, hatten seit Tagen nichts Richtiges mehr gegessen, Alice konnte sich nicht mehr erinnern, wann sie zum letzten Mal Graupensuppe und Brot für alle gehabt hatten. Keiner wagte es im Moment, weiter als bis zum Hydranten zu gehen, zu unübersichtlich war die Lage. Gestern hatten sie von einer Frau aus der Nachbarschaft gehört, die beim Wasserholen in Gefechtsfeuer geraten und getötet worden war. Sie hatte drei kleine Kinder, die nun allein im Schutzkeller ihres Hauses zurückblieben und hoffen mussten, dass sich jemand ihrer annahm. Abgesehen von der allgegenwärtigen Gefahr gab es aber auch nichts mehr, wo man sich etwas zum Essen beschaffen konnte. Die Bäckerei gegenüber stand zwar noch, war aber ebenso leer und verlassen wie alle anderen Häuser in der Sternstraße. Alle waren geflohen, hockten wie sie in Kellern und Luftschutzbunkern oder waren tot. Würden sie hier unten verhungern müssen? Sie hatten sich darüber unterhalten, ob sie versuchen sollten, den früheren SS-Stützpunkt eine Straße weiter aufzusuchen und nachzusehen, ob dort Lebensmittel gebunkert waren, doch dann den Plan wieder verworfen. Wenn sich dort noch etwas befunden haben sollte, war es mit Sicherheit längst geplündert worden. Das Risiko auf sich zu nehmen, so weit zu laufen und dann vor leeren Räumen zu stehen, wollte niemand eingehen, auch Alice nicht, die sich allerdings zunehmend Sorgen um Trude und ihr Baby machte. Irmchen war so dünn geworden, ihr kleines Gesicht wirkte vom Fieber und der Krankheit ausgezehrt wie das einer alten Frau, und Trude, selbst erschreckend mager, hatte kaum noch Milch. Alice sprach es nicht laut aus, aber sie gab dem kleinen Mädchen nur noch ein paar Tage.
Als sie am dritten Tag seit der Rettung des Soldaten aufwachte, war etwas anders als sonst. Sie kam nicht gleich darauf, was es war, konnte das Gefühl nicht festmachen. Doch als sie sich aufgerichtet, die Decke zusammengelegt und ihr Kleid geordnet hatte, fiel es ihr auf: Es war still. Kein Geräusch war zu hören. Das Dröhnen des Krieges über ihnen, die Gefechtsfeuer, die sie seit Tagen begleiteten, alles war verstummt. Die plötzliche Stille war jedoch keineswegs beruhigend. Im Gegenteil. Alice empfand sie als unheilvoll. Sie spürte, wie sich ihre Härchen am Nacken und an den Armen aufstellten. »Was hat das zu bedeuten?«, flüsterte sie, mehr zu sich selbst als zu ihren Leidensgenossen, die um sie herum in Decken gewickelt dalagen und sich langsam zu regen begannen. Ihr Blick fiel auf Elsies Kohlezeichnungen neben ihr an der Wand: Häuser, Blumen, die Sonne … Sie sahen aus wie geheimnisvolle Zeichen eines früheren Lebens.
»Was ist passiert?« Ihre Stimme klang brüchig, sie wagte kaum, laut zu sprechen.
Auch die anderen bemerkten jetzt die Stille. Ängstlich hoben sie den Blick zur Decke und lauschten.
»Ist es vorbei?« Die bange Frage kam von Hertha.
»Wer hat gewonnen?«, fragte ihr Bruder.
Niemand antwortete.
Auf einmal kam Leben in Trude. Sie warf ihrer Tochter ein Bündel Kleider zu: »Schnell. Zieh das an.«
Hertha hob das Bündel hoch. »Das ist eine alte Kittelschürze von dir. Und ein Kopftuch. Was soll ich denn damit?«
»Mach dich so hässlich, wie es geht. Schmier dir Ruß ins Gesicht, und binde dir das Tuch um den Kopf. Und dann legst du dich auf die Pritsche, als ob du krank wärst. Huste!«
Als Hertha widersprechen wollte, herrschte ihre Mutter sie in ungewohnt barschem Ton an. »Mach jetzt! Sofort!«
Hertha gehorchte mit verschrecktem Gesichtsausdruck. Etwas in der Stimme ihrer Mutter schien sie überzeugt zu haben, dass sie besser nicht mehr widersprach, auch wenn sie ganz offensichtlich nicht verstand, was diese Anordnung sollte. Alice hoffte, sie würde es auch nicht herausfinden müssen. Die Kittelschürze war dem Mädchen zu groß, und Trude gab ihr noch eine Bluse sowie eine Decke zum Darunterstopfen und dicke, graue Wollstrümpfe. Das Mädchen zog alles an, band sich, wie geheißen, das Tuch um den Kopf, und ihre Mutter schmierte ihr Kohlestaub ins Gesicht. Als Hertha sich auf die Pritsche legte, war das hübsche, blonde Mädchen nicht mehr wiederzuerkennen. Im schwachen Licht der Kerze wirkte sie wie eine sehr viel ältere, sieche Frau. Jedenfalls, solange man nicht genauer hinsah. Alice’ und Trudes Blick trafen sich, und Alice nickte unmerklich. Anders als die vierzehnjährige Hertha verstand sie diese Vorkehrungen, so wie alle anderen Frauen im Raum, die jetzt ebenfalls unruhig wurden. Auch Käthe Pasulke band ihrer Tochter ein altes Tuch um den Kopf, das deren dicke, haselnussbraune Zöpfe verbarg, und sagte, sie solle den Blick nicht heben und weg von der Tür bleiben. Die Nachrichten von den Gräueltaten der heranrückenden Russen aus den eroberten Ostgebieten hatten sich schnell verbreitet. Frauen waren Kriegsbeute und Racheobjekte. Und so würden sie auch behandelt werden. Astrid schürzte ihre Lippen und hockte sich eng an die Wand neben den verwundeten Soldaten, die Knie an den Bauch gepresst, die Arme um die Unterschenkel geschlungen, und blickte mit starrem Blick zur Tür. Waltraud Krause begann leise zu weinen, und Heide Prittwitz fiel mit ein, während sie die Hand ihres Sohns umklammerte wie eine Ertrinkende. Wilma Tietze griff mit grimmiger Miene nach der Schöpfkelle aus dem Eimer und begann den letzten Rest Wasser in die Becher zu verteilen. Einzig Fräulein Pachmayer war wie immer. Aufrecht saß sie auf der Bank, ihr Köfferchen vor sich, den Hut auf dem Kopf, und sah mit ihrem zarten Vogelköpfchen schweigend umher, so als begreife sie nicht ganz, was hier vor sich ging. Käthe Pasulke streichelte ihr beruhigend über die knochigen Schultern. Otto stand auf und platzierte sich vor der Tür, seinen wuchtigen Körper schwer auf seinen Stock gestützt. Er hatte ein kleines weißes Taschentuch an den Stock gebunden, bereit, es wie eine weiße Fahne zu schwenken.
Hermann Olsen sagte kein Wort, und auch Ernst Krause schwieg. Es gab nichts zu sagen. Nur zu warten.
Ein paar Stunden passierte gar nichts. Die Stille über ihren Köpfen hielt an, was die Gewissheit, dass sich etwas Entscheidendes getan hatte, verstärkte, doch niemand kam. Krause und Pasulke hatten einmal die Tür geöffnet, und Krause hatte sogar Anstalten gemacht, die Treppe hinaufzugehen und nachzusehen, aber Krauses Frau und Hermann Olsen hatten ihn zurückgezerrt, bevor er einen Schritt auf die erste Stufe gemacht hatte. Abwarten, das war die einhellige Meinung aller gewesen, und auch Alice, die zwar innerlich vor Ungeduld brannte und hin- und hergerissen war zwischen der Hoffnung darauf, dass das Grauen des Krieges womöglich vorüber sein könnte, und der Angst, dass etwas noch Schlimmeres folgen würde, schloss sich dieser Meinung an. Selbst wenn die Kämpfe im Moment beendet schienen, mit Sicherheit herrschte dort oben Chaos. Die Stadt war seit Tagen rechtsfreier, anarchistischer Raum. Eine Wolfszone. Es gab keinen Strom, Wasser nur aus den Hydranten, keine Nahrungsmittel, keine Infrastruktur, niemanden, der für Ordnung sorgte. Nur hungernde, verängstigte Menschen, siegestrunkene russische Soldaten, und, womöglich noch immer, marodierende SSler, die versuchten, noch in letzter Minute so viele Menschen wie möglich mit sich in den Abgrund zu reißen.
Als es dann so weit war und sie kamen, war Alice gerade dabei, Jewgenis Verband zu wechseln. Zunächst waren laute Stimmen zu hören, dann ein Trampeln und Rütteln an der Tür, kurz darauf krachte die schwere Eisentür wie ein mürbes Blatt Papier mitten in den Kellerraum. Mehrere Soldaten stürmten herein, ihre Maschinengewehre und Pistolen im Anschlag, und brüllten russische Kommandos. Sie brachten den Geruch des Krieges mit sich, Staub, Rauch, Feuer, Tod. Einige richteten ihre Waffen auf die wie gelähmt verharrende kleine Kellergemeinde, andere leuchteten hektisch mit starken Taschenlampen umher. Hermann Olsen riss die Hände in die Höhe und rief: »Nicht schießen, nicht schießen!«, und Otto Pasulke, etwas unsicher auf einem Bein stehend, schwenkte seinen Stock mit dem Taschentuch. Einer der Soldaten trat vor, gab Pasulke einen groben Rempler, dass er auf sein Knie fiel und den Stock verlor, und hieb dann Olsen den Schaft seines Gewehrs gegen die Brust. Stöhnend ging dieser ebenfalls zu Boden.
»Uhr!«, brüllte der Soldat auf Deutsch und deutete auf Olsens Handgelenk. Rasch band er seine Armbanduhr ab, ebenso wie Pasulke. Der Soldat ließ beide Uhren in die Tasche seiner Uniformjacke gleiten, während die anderen Soldaten, es waren ein halbes Dutzend, umhergingen und den anderen ebenfalls die Uhren und den Schmuck abnahmen. Einer der Soldaten blieb vor Astrid stehen, die noch immer am Boden kauerte, und zog ihr das Kopftuch herunter. Grob packte er sie an den Zöpfen und zerrte sie auf die Beine. Sie schrie auf, als er ihre Bluse vorne aufriss und nach ihren Brüsten grapschte.
»Nein!«, rief Alice ohne nachzudenken, sprang auf und griff nach dem Arm des Soldaten. Der Soldat fuhr zu ihr herum. Er drückte ihr die Mündung seiner Pistole an die Schläfe und knurrte etwas Unverständliches. Mit der freien Hand packte er ihr Kinn und bog ihren Kopf nach oben, während ihr ein anderer mit seiner Lampe mitten ins Gesicht leuchtete und sie für einen Moment geblendet die Augen schloss. Sie spürte, wie ihr trotz der Kälte im Keller der Schweiß ausbrach, als ihr bewusst wurde, dass nur eine winzige Bewegung nötig war, um ihr ein tödliches Geschoss ins Gehirn zu jagen. Das Gesicht des Soldaten kam näher, so nah, dass sie seine Bartstoppeln und die rot geäderte Iris seiner Augen sehen konnte. Sein Blick war kalt, und er stank nach ranzigem Schweiß, Alkohol und Tabak. In dem Moment, da sich sein Mund auf den ihren presste, seine Zunge sich zwischen ihre Zähne drängte, widerlich nass, warm und fleischig, ertönten Schritte an der Treppe, und ein weiterer Mann trat ein, offenbar der vorgesetzte Offizier, denn der Soldat ließ Alice los und trat hastig einen Schritt zurück, um Haltung anzunehmen. Auch die anderen standen stramm. Alice schwankte und stützte sich mit der Hand an der rauen Wand ab. Ihre Knie sackten weg, und sie ging in die Hocke. Nur mit Mühe konnte sie einen Würgereiz unterdrücken.
Der Offizier, der die Treppe heruntergekommen war, war groß, schlank und um die fünfzig. Er hatte ein hart wirkendes Gesicht mit markanten Wangenknochen und kräftigem Kinn sowie dunkle Augen, die jetzt prüfend durch den Raum wanderten. Bei Jewgeni hielt er inne und sprach ihn an. Seine Stimme war tief und autoritätsgewohnt. Der verwundete Soldat antwortete hastig, verängstigt, wie es Alice schien, und instinktiv legte sie eine Hand schützend auf den gerade erneuerten Verband. Stalins Armee sprang auch mit den eigenen Leuten alles andere als sanft um. Von deutschen Soldaten im Lazarett hatte sie gehört, dass Angehörige der Roten Armee, bei denen es auch nur den leisesten Verdacht gab, sie stünden nicht voll und ganz hinter der Sache oder würden versuchen, sich mithilfe von selbst zugefügten Verletzungen zu drücken, umgehend erschossen wurden. Manchmal genügte dazu schon ein missinterpretierter Gesichtsausdruck, ein einziges falsches Wort oder die schlechte Laune des Vorgesetzten.
Doch der Offizier wandte sich ohne weiteren Kommentar von Jewgeni ab und sah Alice mit scharfem Blick an. Seine dunklen Augen schienen jeden Winkel ihres Bewusstseins abzutasten, jedes Geheimnis in ihr aufzuspüren. Sie schauderte. Nur mit Mühe gelang es ihr standzuhalten und nicht den Kopf zu senken. Dann wanderte sein Blick weiter durch den Raum, glitt über die beiden am Boden knienden Männer zu Trude Ackermann, die in der hintersten Ecke kauerte, dicht neben der Pritsche, auf der unter einer Decke ihre Tochter lag, zurechtgemacht wie eine sterbende Alte. Ihre drei anderen Kinder hielt sie eng umklammert. Auch Trude wandte den Kopf nicht ab, als die Augen des Offiziers sie erfassten, nur umklammerte sie ihre Kinder noch ein wenig fester. Die Kinder wirkten vor Angst wie gelähmt. Ihre weit aufgerissenen blauen Augen leuchteten im Licht der Taschenlampen unnatürlich hell in den rußverschmierten Kindergesichtern, und sogar Irmchen gab keinen Ton von sich. Sie war schon zu schwach, um zu weinen, hatte in der letzten Zeit nur noch leise gegreint, doch auch davon war nichts zu hören. Einen Moment lang schienen alle den Atem anzuhalten, gebannt von der Frage, was als Nächstes passieren würde. Trude Ackermann war eine schöne Frau, selbst jetzt noch, wo der Hunger und die Angst um ihre Kinder sie zermürbt und ausgelaugt hatten. Ihr madonnenhaftes Gesicht, die dichten dunklen Haare und die zarte Statur schienen offenbar auch dem Offizier nicht zu entgehen, der keinen Blick an Hertha auf ihrer Pritsche verschwendete, sondern weiter Trude fixierte. Er nickte ihr mit dem Kinn zu. »Mitkommen!«, sagte er auf Deutsch mit hartem Akzent, drehte sich zu Alice um und fügte hinzu: »Sie auch.«
Alice zuckte zusammen, widersprach jedoch nicht, sondern stand auf. Trude reichte Irmchen an Heide Prittwitz weiter, strich Elsie und Alfred über die Haare und sagte, so gefasst, als ginge sie nur kurz Milch holen: »Bleibt schön brav, Mama kommt gleich wieder.« Hertha auf ihrer Pritsche machte eine Bewegung, als wolle sie aufspringen, doch eine harsche Handbewegung ihrer Mutter ließ sie innehalten. Langsam kam Trude zu Alice herüber, und sie gingen zusammen hinaus. Der Offizier und ein Soldat folgten ihnen, die anderen Soldaten blieben im Keller zurück.
Langsam stiegen sie hintereinander die Treppe hinauf, und bei jedem Schritt spürte Alice, wie schwach sie in den letzten Tagen geworden war. Ihre Beine schienen ihr nicht recht gehorchen zu wollen, und sie musste sich mehrmals am Geländer festhalten. Trude vor ihr schwankte ebenfalls mehrere Male und drohte hinzufallen, sodass Alice neben sie trat, einen Arm um sie legte und sie sich gegenseitig stützten.
Oben angekommen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Die Bombenangriffe der letzten Wochen hatten bereits eine Vielzahl der Häuser ihrer Wohnstraße ganz oder zum Teil zerstört, aber die Kämpfe der letzten Tage hatten noch einmal ihr Übriges getan. Die Straße war übersät mit Trümmern, hie und da schwelten noch Feuer und Alice meinte, die leblosen Körper toter Menschen dazwischen liegen zu sehen, aschgrau und kaum zu unterscheiden von den Steinbrocken, der Asche und dem Schutt. Sie hatte erwartet, dass der Offizier und sein Adjutant sie in irgendein verlassenes Gebäude bringen würden, wo sie ihr Lager aufgeschlagen hatten, stattdessen bedeutete man ihnen, zu einem Lastwagen zu gehen, der vor der ehemaligen Bäckerei parkte. Das Haus stand noch, doch durch seine zerschlagenen Fensterscheiben und die zerschossene Fassade wirkte es fast noch trauriger als die Trümmer drumherum. Alice fragte sich, was mit der Bäckersfamilie geschehen sein mochte. Lebten sie noch? Harrten sie mit ihren Mitbewohnern ebenfalls in einem Keller aus? Oder waren sie geflohen?
Am Lastwagen trafen sie auf eine weitere Gruppe Soldaten in staubigen Uniformen, die Alice und Trude mit einer Mischung aus Verachtung und unverhohlener Gier musterten. Trudes Schritte wurden langsamer, und Alice, die noch immer einen Arm um die jüngere Frau gelegt hatte, spürte, wie diese sich versteifte. »Lass dir deine Angst nicht anmerken«, flüsterte sie, ohne die Lippen zu bewegen, und Trude nickte, obwohl man ihr ansah, dass sie starr vor Angst war. Alice erging es nicht anders. Sie zählte acht Soldaten und fragte sich beklommen, ob der Offizier tatsächlich vorhatte, sie diesen Männern als Trophäen zu überlassen.
Als sie bei ihnen angekommen waren, bellte er ihnen ein paar Befehle entgegen, und drei der Männer sprangen augenblicklich in den Wagen. Kurz darauf kamen zwei von ihnen mit einer Trage wieder heraus, mit der sie im Laufschritt in Richtung Keller verschwanden. Der dritte schob eine Kiste aus den Tiefen der Ladefläche nach vorne und nahm mehrere verschieden große Papierpakete heraus. Der Offizier bedeutete Alice und Trude, sie zu nehmen. »Für die Kinder«, sagte er mit seinem harten Akzent, und weder Alice noch Trude konnten die Hast, mit der sie danach griffen, zügeln. Die kyrillischen Buchstaben auf dem Papier waren nicht zu entziffern, aber es war offensichtlich, dass es Nahrung war. Der Soldat auf dem Lastwagen reichte ihnen auch noch ein paar flache Brotlaibe heraus, und plötzlich wirkte er nicht mehr roh, gemein und gefährlich. Er war ein junger Mann Anfang zwanzig, mit kurzen blonden Haaren, Jewgeni ähnlich.
Den Arm voller Pakete und Brot musste Alice sich kurz gegen den Lastwagen lehnen. Ihr war schwindlig vor Schwäche und ihren widerstreitenden Gefühlen. Soeben war sie aus Angst davor, vergewaltigt und womöglich getötet zu werden, wie gelähmt gewesen, und jetzt durchströmte sie eine so ungeheure Dankbarkeit, dass sie am ganzen Körper zu zittern begann. Eines der Päckchen, das sie in den Händen hielt, hatte ein kleines Loch, aus dem ein wenig weißes Pulver herausrieselte, und Alice tauchte einen Finger hinein und leckte ihn ab. Es schmeckte süß, nach Wärme und Geborgenheit, nach glücklichen Kindertagen, heißer Milch mit Honig, tröstlichen Momenten, in denen es einem an nichts mangelte. »Milchpulver«, murmelte sie, und ihr traten Tränen in die Augen. Sie sah, dass es Trude ebenso erging. Auch sie weinte. Alice lächelte ihr zu, und beide dachten in dem Moment das Gleiche: Irmchen bekam noch eine Chance.
Mit feuchten Augen wandte Alice sich dem Offizier zu. »Spasíbo!«, flüsterte sie etwas atemlos das Wort, das sie von Jewgeni aufgeschnappt hatte. Für mehr als ein Flüstern fehlte ihr die Stimme. Der Offizier deutete mit dem Kinn zu den zwei Männern, die sich gerade mit Jewgeni auf der Trage wieder dem Lastwagen näherten, und nickte: »Ich habe zu danken. In Zeiten wie diesen ist jedes Zeichen von Güte wertvoll.« Sein Deutsch war trotz des deutlichen Akzents fehlerfrei und seine Ausdrucksweise erstaunlich geschliffen. Alice hob erstaunt die Brauen und nickte. Als die beiden Frauen sich zum Gehen wandten, rief der Offizier ihnen noch hinterher: »Übrigens: Der Krieg ist vorbei!«
1
BERLIN, JULI 1945
Unter den Linden sollte es am Vormittag Kartoffeln geben. Der Bäcker hatte erzählt, dass die Russen ein paar Lastwagen voll vom Land in die Stadt bringen würden, das habe er von seinem Mehllieferanten gehört, der alle paar Tage mit einem alten Handkarren Mehl in die Stadt brachte. Die Nachricht verbreitete sich in der Sternstraße wie ein Lauffeuer, und Alice, Wilma und Trude beschlossen, hinzugehen. Auch wenn die Hoffnung darauf, frische Kartoffeln zu ergattern, eher gering war – schließlich würden sie nicht die Einzigen sein, die davon erfahren hatten –, so war die Aussicht auf einen gemeinsamen Spaziergang durch die Stadt bis zur britischen Zone gar nicht so schlecht. Nachdem die Alliierten Berlin in vier Teile geteilt hatten, gehörte der Bezirk Tiergarten nun zum Britischen Sektor, während Friedrichshain und damit auch die Sternstraße im russischen Sektor verblieben waren, gut bewacht von Väterchen Stalin, der auf zahlreichen Propagandaplakaten mit ehrfurchtsgebietender Strenge auf die Besiegten herabsah.
Wie ihre beiden Nachbarinnen hatte sich auch Alice für diesen Ausflug zurechtgemacht und die Kittelschürze, in der sie mit den anderen jeden Tag Schutt rund um ihr Haus entfernte, gegen eines ihrer »guten« Kleider eingetauscht. Es war aus mitternachtsblauer Baumwolle, hatte eine schmale Taille und einen weit schwingenden Rock. Da sie in den letzten Monaten ziemlich abgenommen hatte, war es etwas zu groß, deshalb hatte Alice es an der Taille mit Sicherheitsnadeln enger gemacht. Dazu trug sie ihre einzigen eleganten Schuhe, mit Spange und etwas höherem Absatz. Das honigbraune Kalbsleder war bereits abgewetzt, sie hatte mit Schuhcreme und einem braunen Farbstift an den kahlen Stellen am Absatz nachgeholfen, damit die Schuhe nicht allzu schäbig wirkten. Wilma hatte ein burgunderfarbenes Kostüm an, das ebenfalls ziemlich schlackerte, und Trude, die Irmchen im Kinderwagen vor sich herschob, sogar Lippenstift aufgelegt. Sie sah so herzzerreißend jung aus in ihrem hellgrün geblümten Kleid, der zierlichen Gestalt und den rosa glänzenden Lippen, kein Mensch würde auf den Gedanken kommen, dass sie schon vier Kinder hatte. Alice und Wilma hatten alte Wehrmachtsrucksäcke geschultert, die sie kurz nach Kriegsende im Schutt gefunden hatten, und Trude würde ihre mögliche Beute im Kinderwagen verstauen. Dort hatten sie auch etwas Silberbesteck, Kinderschuhe, aus denen Hertha und Alfred herausgewachsen waren, eine Tischuhr aus Messing und kalbslederne Handschuhe deponiert. Am Brandenburger Tor befand sich ein großer Schwarzmarkt, womöglich konnte man auch das eine oder andere eintauschen.
In Friedenszeiten war man mit der Straßenbahn von der Sternstraße zum Brandenburger Tor eine gute halbe Stunde unterwegs gewesen, doch jetzt, zu Fuß durch die Ruinen, würden sie sicher mehr als zwei Stunden benötigen. Sie beschlossen daher, sich schon im Morgengrauen auf den Weg zu machen, um die Kartoffellieferung auch ja nicht zu verpassen. Gerade als sie das Haus verließen – eine Haustür gab es immer noch nicht –, kam ihnen aus Fräulein Pachmayers Wohnung Astrid Pasulke nachgelaufen. »Darf ich mitkommen?«, fragte sie, während sie mit glänzenden Augen die Treppe hinuntersprang. Auch sie trug ein hübsches Sommerkleid, himmelblau mit Punkten, und hatte ihre Zöpfe aufgesteckt.
Keine der Frauen hatte etwas dagegen, dass das junge Mädchen sich ihnen anschloss, und so zogen sie zu viert samt Irmchen los.
Der einstige Prachtboulevard Unter den Linden war trotz der frühen Stunde bereits voll mit Menschen, überwiegend Frauen und Kinder, und alle schienen ein Ziel zu haben, seien es die Kartoffeln, die genau vor der Ruine des Hotels Adlon in einem großen Haufen einfach auf den Bürgersteig gekippt worden waren, sei es der Schwarzmarkt ein paar Meter weiter, wo mehr oder weniger zwielichtig aussehende junge Burschen mit den Händen in den Hosentaschen, die Hüte keck in den Nacken geschoben und Zigaretten in den Mundwinkeln, scheinbar ziellos umherschlenderten, tatsächlich aber auf Kundschaft warteten.
Alice und die anderen Frauen klaubten hastig erdige Kartoffeln von dem schnell schrumpfenden Haufen, stopften sich damit die Rucksäcke voll und gingen dann langsam weiter, sprachen einen der Männer an. Trude gelang es, die Tischuhr und ihre Kinderschuhe gegen ein halbwegs neues Paar Schuhe für Hertha, Milch und einen kleinen Sack Mehl einzutauschen, und Alice bekam für die dünnen Kalbslederhandschuhe ihrer Großmutter und drei Silberlöffel eine Flasche Speiseöl, Schweineschmalz, Graupen und eine Tafel Hershey-Schokolade.
Als sie auch ihre Schwarzmarktbeute verstaut hatten, warf Wilma einen Blick auf die Ruinen des Hotels Adlon. Von dem einstigen Luxushotel standen nur noch ein Seitenflügel und der vordere Teil der Fassade. Die Wände waren schwarz vor Ruß. Am Schriftzug über dem Eingangsportal fehlte das A.
»Is echt ne Schande«, sagte sie und schüttelte sichtlich wehmütig den Kopf. »Mein Mann und ick haben das Adlon beliefert, früher, in den Zwanzigern. Ick sag euch, mit Sicherheit haben Charlie Chaplin und Josephine Baker unsere Knackwurst gegessen!«
»Wer ist Josephine Baker?«, wollte Astrid wissen.
Wilma warf ihr einen ungläubigen Blick zu. »Dit weeste nich? Armes Küken. Josephine Baker ist die schönste Frau, die die Welt je jesehen hat, dit kann ick dir sagen. Und tanzen konnte die damals schon, als blutjunges Mädel, da hat mein Männe den Mund nich mehr zujekriegt.« Sie lachte kurz auf und verstummte dann abrupt. An ihrer Nasenwurzel erschien die tiefe Kerbe, die immer dann zu sehen war, wenn sie an ihren gefallenen Mann oder einen ihrer Söhne dachte.
»Und Sie haben Josephine Baker damals gesehen?«, wollte Trude wissen. »In echt?«
»Aber sicher doch! Neunzehnhundertsechsundzwanzig war dit. Im Nelson Theater am Kurfürstendamm. Jibt es och nich mehr. Hamse zu nem Kino umjebaut. Und ick wees gar nich, ob dit nich auch die Bomben erwischt haben.« Sie wandte sich an Astrid. »Die Nelson-Revuen waren ne Schau, dit kannst du junges Gänschen dir gar nich mehr vorstellen. Marlene Dietrich, die Waldoff, der Hans Albers, alle warn se da … Dit war ein Spaß! Und so viel schöne Musik …« Sie begann leise zu singen: »Mir ist heut so nach Tamerlan, nach Tamerlan zu Mut, ein kleines bisschen Tamerlan, ja Tamerlan wär gut …« Sie machte ein paar Tanzschritte quer über die staubige Straße.
Während Trude und Alice lächelten – beide konnten sich an den Schlager noch gut erinnern –, runzelte Astrid die Stirn. »Was ist denn bitteschön Tamerlan?«
»Ick hab keenen blassen Schimmer!« Wilma lachte.
»Können wir noch ein bisschen weitergehen? Die Charlottenburger Chaussee entlang?«, fragte Astrid, die ganz offensichtlich wenig mit Wilmas nostalgischen Erinnerungen anfangen konnte.
»Was willst du denn da?«, fragte Alice.
»Ach, nichts weiter«, erwiderte Astrid achselzuckend. »Nur Engländer ankucken.« Sie lächelte verschämt. »Hab noch nie welche gesehen. Vielleicht sind sie ja hübscher als die Deutschen?«
»Na, viele deutsche Männer, die es sich lohnt anzukieken, kriegste ja heutzutage och nich zu sehen bei die janzen armselijen Hungerhaken, die rumloofen.« Wilma verdrehte die Augen, und Trude lachte. Auch Alice musste schmunzeln. Gemeinsam gingen sie durch das Brandenburger Tor und passierten dabei ein Schild mit britischer Flagge, auf dem stand: YOU ARE NOW ENTERING THE BRITISH SECTOR.
»Wie aufregend«, murmelte Astrid beim Weitergehen und sah sich dann so neugierig um, als sei sie mit diesen wenigen Schritten tatsächlich in England gelandet und nicht nur auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor, der seit einigen Jahren Hindenburgplatz hieß, wie Alice sich erst wieder ins Gedächtnis rufen musste. Der Anblick auf die Charlottenburger Chaussee jedoch war trostlos. Die Kuppel des Reichstags war nur noch ein verkohltes Gerippe und der Tiergarten eine Einöde aus verbrannten Baumresten.
»Hier is och nüscht mehr übrig«, kommentierte Wilma trocken die Zerstörung und warf einen Blick in Richtung Siegessäule in der Ferne, die wie durch ein Wunder unversehrt geblieben war. Seltsam entrückt schien der Friedensengel über dem verwüsteten Park zu schweben. »Die Goldelse wird sich wat wundern, wenn se sich umkiekt«, brummte Wilma. »Mit Sieg is ja nu nüscht jewesen.«
»Aber immerhin ist jetzt Frieden«, sagte Astrid. »Das passt doch zum Friedensengel.«
»Frieden ja, schon!«, schnaubte Wilma. »Is ja jut und schön, der Frieden, wenn wa nicht verhungern, wir, die wa übrigjeblieben sind von dit verfluchte tausendjährige Reich des ollen Schreihalses.«
»Aber es ist schön, dass man so etwas jetzt wieder laut sagen kann, ohne dass uns der Krause gleich die Gestapo auf den Hals hetzt«, wandte Trude ein, und Wilma nickte, schien aber nur halb überzeugt. »Jetzt grade vielleicht. Aber die Krauses werden nich aussterben, nur weil der Krieg zu Ende ist, Trude, darauf kannste einen lassen.«
Es war ein sonniger Sommertag, und sie gingen noch ein paar Schritte die Chaussee entlang und warfen dabei einen Blick auf eine Gruppe von britischen Soldaten, die neben ihrem Jeep standen und rauchten. Sie trugen olivbraune Uniformen mit weiten Hosen und sahen jung und freundlich aus. Dennoch betrachtete Alice sie mit gemischten Gefühlen. Sie hatte genug von Soldaten und Uniformen, genug von Waffen, Helmen und glänzenden Knöpfen, ganz gleich, welcher Nation sie angehörten.
»Und? Findest du sie nun hübscher als die Deutschen?«, fragte Trude an Astrid gewandt, und das junge Mädchen errötete. »Na ja. Sie sehen schon nicht schlecht aus, oder?«
»Mmmh«, machte Trude und wiegte prüfend den Kopf hin und her, als könne sie sich nicht entscheiden, welches Päckchen Kaffee aus dem Regal sie nehmen sollte. »Der eine da, ganz links, der könnte mir gefallen.«
»Oh, nein, doch nicht der! Der hat ja rote Haare!« Astrid kicherte.
»Mal was anderes«, meinte Trude ungerührt. Die beiden jungen Frauen sahen sich an und prusteten los. Wieder fand Alice, dass Trude noch viel zu jung für vier Kinder zu sein schien. Sie war zwar schon vierunddreißig, wirkte aber kaum älter als Astrid, und dabei war sie schon seit sechzehn Jahren verheiratet. Kurt, ihr Mann, wurde seit letztem Jahr vermisst, und es bestand kaum Hoffnung, dass er noch lebte.
Langsam spazierten sie weiter, genossen trotz der öden Umgebung die warme Sonne und den leichten Wind, der die Straße entlangwehte und ihre Haare zauste. Es war still und friedlich auf der Chaussee. Keine Panzer dröhnten, keine Flugzeuge verdunkelten den Himmel, niemand marschierte, niemand bellte Befehle. Stattdessen fuhren Radfahrer über den breiten Boulevard, Frauen schoben ihre Kinderwagen entlang der verkohlten Baumstümpfe, und dazwischen konnte man immer wieder Grüppchen von Menschen ausmachen, die bis oben vollbepackte Leiterwagen mit sich zogen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Passanten waren sie nicht hübsch zurechtgemacht, ihre Kleider waren verschmutzt, die Gesichter verhärmt, die Augen stumpf vor Erschöpfung. Es waren Vertriebene und Flüchtlinge aus dem Osten.
»Dit elende Pack!«, sagte ein Mann, der vor ihnen ging, zu seiner Frau, allerdings laut genug, dass nicht nur Alice und ihre Freundinnen es hören konnten. Der Mann, der den Leiterwagen zog, senkte den Blick, seine Frau, die neben ihm herging, einen Säugling im Arm und einen kleinen Jungen am Rockzipfel hängend, wandte den Kopf ab.
»Kiek dir die nur an«, schrie der Mann weiter. »Nix als dreckiges Gesindel.«
Alice, die bei seinen Worten von heißem Zorn erfasst wurde, beschleunigte ihren Schritt, bis sie den Mann erreicht hatte. »Sie würden auch so aussehen, wenn sie seit Wochen zu Fuß unterwegs gewesen wären, bei Wind und Wetter und ständig in Todesangst«, sagte sie empört. »Sie wissen doch gar nicht, was diesen Leuten widerfahren ist!«
»Na, hör’n Se mal!« Der Mann fuhr zu ihr herum. »Ick seh, wenn einer ’n anständijer Mensch ist. Man muss diesen Saupolacken doch nur in die verschlagenen Visagen sehen, dann weiß man, dass die’s nicht sind!«
»Ach, ja? Weil sie schmutzig und am Ende ihrer Kräfte sind? Geben Sie den Leuten etwa die Schuld dafür?« Alice’ Stimme war laut geworden.
»Alice! Lass es gut sein.« Trudes Hand legte sich auf ihren Arm und hielt sie sanft zurück. Widerstrebend blieb Alice stehen, während der Mann von seiner Gattin energisch untergehakt und weitergezogen wurde. Alice sah ihnen wütend nach.
»Lasst uns in diese Richtung gehen«, schlug Trude vor und bog mit ihrem Kinderwagen in einen Seitenweg ein, der von der Chaussee weg mitten in den zerstörten Park hineinführte.
Wilma nickte. Astrid sagte nichts, doch Alice bemerkte, wie das junge Mädchen ihr einen scheuen Blick zuwarf. Sie wirkte überrascht.