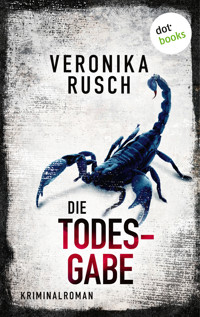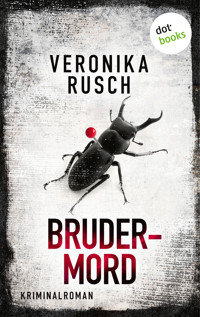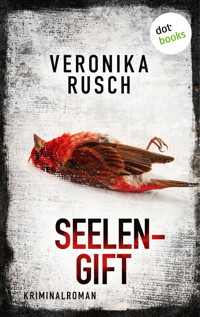9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Die Schwarze Venus«-Trilogie: Historische Spannung um eine legendäre Figur – Josephine Baker, Tänzerin, Vordenkerin, Kämpferin! Band 1 »Der Tod ist ein Tänzer« führt den Leser ins Berlin des Jahres 1926: An einem kalten Januartag treffen sie erstmals aufeinander: Tristan Nowak und Josephine Baker, die schillernde Tänzerin, die er vor einem Anschlag schützen soll. Zunächst glaubt Tristan nicht so recht an die Bedrohung. Er begleitet Josephine durch die Vergnügungswelt Berlins und verliebt sich gegen seinen Willen in die außergewöhnliche Frau. Doch die Gefahr ist real, und die Attentäter kommen immer näher … In ihren historischen Kriminalromanen (Bd. 1: »Der Tod ist ein Tänzer«, Bd. 2: »Die Spur der Grausamkeit«, Bd. 3: »Die Dunkelheit der Welt«) macht Veronika Rusch die faszinierende Tänzerin und Sängerin Josephine Baker, die man auch »Die schwarze Venus« nannte, zur zentralen Figur einer groß angelegten Verschwörung. Die drei Bände führen die Leser in drei glamouröse Hauptstädte – Berlin, Wien und Paris – und von den goldenen Zwanzigern bis ins Paris des Jahres 1942: Drei Schicksale treffen wieder und wieder aufeinander, ein Mann, gezeichnet durch den Krieg, eine Frau, entschlossen, die Welt zu erobern, ein Gegner, gefährlich und unberechenbar … »›Der Tod ist ein Tänzer‹ ist ein großartiger historischer Roman, eine gelungene Mischung aus Fakten und Fiktion, unheimlich atmosphärisch und spannend bis zum Schluss. Dieser Roman macht unbedingt Lust auf Teil zwei und drei.« WDR 4
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Kriminalroman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Der Tod ist ein Tänzer« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Redaktion: Martina Vogl
Covergestaltung: zero-media.net, München
Coverabbildung: FinePic®, München; akg-images
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Motto
Einleitung
ERSTER AKT
1
Paris, Dezember 1925
2
Paris, Januar 1926
3
Berlin, Januar 1926
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ZWEITER AKT
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
DRITTER AKT
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Vier Wochen später
44
Berlin, März 1926
Nachwort
Lebenslauf Josephine Baker von 1906 bis 1926
Saint Louis – New York – Paris – Berlin
Danksagung
Literaturverzeichnis
Quellenangaben
»Ich war nicht wirklich nackt.
Ich hatte nur keine Kleider an.«
Josephine Baker
Ich habe meinen Namen verloren. Er ist mir abhandengekommen, irgendwo in den Schützengräben von Flandern. Dort liegt er noch immer, im Schlamm begraben, vom Regen und dem Blut der Toten durchtränkt. Er hört auf ewig den Kanonendonner, die Schreie, das Wimmern und den Wind, der klagend über die Felder streicht.
Man sagt, der Name enthielte die Seele eines Menschen. Solange du namenlos bist, bist du ein Nichts, hast keine Vergangenheit und keine Zukunft. Erst mit deinem Namen kommst du wirklich auf diese Welt. Und wenn du ihn verlierst, verlierst du alles.
Ich bin Nowak. Und das ist meine Geschichte.
ERSTER AKT
Auf einem Häuserblocke sitzt er breit.
Die Winde lagern schwarz um seine Stirn.
Er schaut voll Wut, wo fern in Einsamkeit
Die letzten Häuser in das Land verirrn.
Georg Heym, »Der Gott der Stadt«, 1910
1
Paris, Dezember 1925
Der Mann, der in der Galerie des Théâtre des Champs-Elysées in der vordersten Reihe saß, war zutiefst angewidert von dem, was er sah. Seine rechte Hand, an der der kleine Finger und der Ringfinger fehlten, verkrampfte sich ruckartig zu einer Faust, und die sorgfältig manikürten Nägel der übrigen Finger gruben sich tief in die Handballen. Der Schmerz lenkte ihn kurzfristig ab, reichte jedoch nicht aus, um ihn zu beruhigen. Seit Beginn der Vorstellung unterdrückte er nur mit Mühe den Impuls, einfach aufzustehen und zu gehen. Doch er wollte seine Gastgeber nicht unnötig brüskieren. Das Ehepaar Amsinck, bei dem er logierte, hatte mehrmals betont, dass es nur aufgrund von guten Beziehungen überhaupt möglich gewesen sei, noch Karten für die Vorführung zu bekommen, und die beiden waren außerordentlich stolz darauf gewesen, ihn einladen zu dürfen.
Er hatte sich keine Vorstellung gemacht, was ihn erwarten würde, inzwischen jedoch war er entsetzt. Die Dekadenz dieser Stadt war weiter fortgeschritten als vermutet, und die Amsincks hatten sich, obwohl Deutsche, ganz offenbar von dem Virus der sittenlosen Vergnügungssucht anstecken lassen. Jetzt flüsterte ihm Fritz Amsinck zu, dass die nächste Szene den Höhepunkt der gesamten Vorstellung darstellte. Seine Frau Mathilda, gepudert und geschminkt wie ein halbseidenes Mädchen, obwohl sie bereits über vierzig war, nickte, und ihre Augen leuchteten, als sie sich nun ebenfalls zu ihm herüberbeugte und leise hinzufügte: »La Danse Sauvage.« Eine Wolke ihres schweren Parfüms nebelte ihn ein, und er wich unauffällig zurück. Dann rang er sich ein höfliches Lächeln ab und fragte sich gleichzeitig bestürzt, was als Steigerung zum Bisherigen wohl noch Unsägliches aufgeboten werden konnte.
Es wurde dunkel auf der großen, von goldenen Reliefs eingefassten Bühne, und die unmelodische, quäkende Negermusik, die ihn die ganze Zeit in den Ohren geschmerzt hatte, veränderte sich, Trommeln gewannen die Oberhand. Dann flammte ein einzelner Scheinwerfer auf, und ein kräftiger, tiefschwarzer Wilder erschien. Nackt bis auf einen Lendenschurz und mit zahlreichen Perlenketten um Bizeps, Knöchel und Brust geschmückt, ging er vornübergebückt und trug eine Frau mit sich. Sie lag quer auf seinem Rücken, rücklings ausgestreckt wie auf einer Sänfte, und trug nichts am Leib außer ein paar zitternden Federn an Fuß- und Armgelenken und ein winziges, von Federn bedecktes Höschen. Ihre braune Haut glänzte im goldenen Licht des Scheinwerfers. Der Wilde setzte sie behutsam ab, und sie begann zum Rhythmus der Trommeln zu tanzen.
Der Mund des Mannes auf der Galerie wurde staubtrocken. Noch nie hatte er Derartiges gesehen. Mit jedem dunklen Trommelschlag, mit jeder obszönen Bewegung der Frau sank er tiefer in seinen Sessel. Mit einem Mal fiel ihm das Atmen schwer, und fast panisch lockerte er mit den verbliebenen Fingern seiner Rechten die Krawatte. Es war viel zu warm in dem Saal mit der prächtigen Glasrosette an der Decke. Die Luft war erfüllt vom süßlichen Duft der parfümierten Damen und dem Schweißgeruch der angeblich so kultivierten Pariser Männer, die das abstoßende Treiben auf der Bühne in einen Zustand atemloser Verzückung versetzte. Obwohl er glaubte, vor Abscheu ohnmächtig werden zu müssen, hier, in diesem Sessel aus rotem Samt, vor den Augen all dieser dekadenten Froschfresser, konnte er den Blick nicht von der Bühne abwenden. Fast gegen seinen Willen saugten sich seine Augen an der biegsamen Gestalt der Tänzerin fest, und er spürte mit Entsetzen, wie ihn eine nie gekannte Erregung erfasste und ihm seine Hose zu eng wurde.
Hastig richtete er sich auf und versuchte, sich innerlich abzukühlen. Das durfte nicht sein. Diese Darbietung überstieg die Grenzen allen Anstandes. Und plötzlich wusste er mit absoluter Klarheit: Das war er. Der endgültige Verfall all dessen, was einmal seine Welt, was einmal gut und richtig gewesen war. Hier, in diesem Theater, in der Stadt des Erbfeindes wurde er eingeläutet, und es würde nicht lange dauern, und der endgültige Niedergang würde auch Berlin erreichen. Es war ohnehin nicht mehr viel vonnöten, um seiner Stadt den Todesstoß zu versetzen. Sie taumelte bereits. All das Gesindel – die Republikaner, die Kommunisten und die Juden – hatte das seinige dazu beigetragen. Die Stadt wankte ihrem Untergang entgegen. Und wenn es so weit war, würde sie das ganze Land mit in den Abgrund reißen. Es brauchte nur noch einen Stoß …
Die Darbietung war zu Ende, und er blinzelte, wie aus einem Albtraum erwacht. Langsam beruhigten sich seine Nerven, und sein Körper gehorchte ihm wieder. Die Tänzerin verbeugte sich vor dem frenetisch klatschenden Publikum und verteilte lachend Handküsschen, bevor sie hinter der Bühne verschwand, um gleich darauf in einen glitzernden Umhang gehüllt zurückzukommen und mit ihr der ganze Rest der Truppe von Wilden. Um ihn herum, auf den Galerien und im Parkett sprangen die Zuschauer auf und jubelten, warfen Rosen auf die Bühne und benahmen sich wie toll. Auch seine Gastgeber waren aufgestanden und klatschten wie entfesselt. Pikiert schürzte er die Lippen und wandte sich ab. Als Einziger im Saal blieb er sitzen, wie versteinert, die Hände im Schoß, die rechte Faust noch immer zuckend vor unterdrückter Wut. Mit keiner Bewegung, und sei sie noch so zufällig, würde er sich erniedrigen und dieser Darbietung so etwas wie Beifall zollen.
Während ihn der Jubel des Publikums umtoste, wuchs sein Hass ins Unermessliche. Er fixierte die schwarze Tänzerin aus zusammengekniffenen Augen. Sie erschien ihm wie die Ausgeburt der Hölle, wie sie in ihrem Glitzerfummel vorne auf der Bühne stand und lachte, mit diesem großen, breiten Negermund, und sich unverfroren feiern ließ. Im nächsten Monat würde sie nach Berlin kommen. Die Revue war bereits angekündigt, und die Vorstellung, dass sich die Berliner für diese schamlose Person ebenso zum Affen machen würden wie die Pariser, war ihm unerträglich. Diese Revue war eine Beleidigung der Welt, in der er groß geworden war, in der Recht und Ordnung, Sitte und Anstand etwas gegolten hatten.
Dieses grinsende schwarze Miststück trat mit jeder schamlosen Zurschaustellung ihres nackten Körpers diese Welt mit Füßen, bespuckte ihr Andenken und würde sie letztendlich in den Abgrund stürzen. Wenn niemand es verhinderte.
Bei diesem letzten Gedanken richtete er sich auf, bemüht, ihn festzuhalten. Er beugte sich nach vorne, den Kopf leicht schräg, wie in Lauerstellung, darauf konzentriert, den Gedanken weiterzuspinnen, während um ihn herum der Applaus noch einmal anschwoll und nach einer Zugabe verlangt wurde. Als die Kapelle ein letztes Lied zu spielen begann, achtete er nicht mehr darauf. In ihm reifte ein Plan, und während sich nahezu mühelos ein Detail zum anderen fügte, erfasste ihn eine dunkle Woge gehässiger, boshafter Genugtuung. Er lachte laut auf, so berauscht war er von seiner Idee, doch sein Lachen ging in dem Lärm unter.
Niemand hörte es, denn niemand beachtete den dunkelhaarigen Mann im Stresemann, der leicht vorgebeugt und so steif und bleich wie eine Wachsfigur in seinem Sessel saß. Hätte jemand den Blick von der Bühne abgewandt und sich die Mühe gemacht, ihn näher zu betrachten, wären ihm wohl als Erstes die fehlenden Finger an der rechten Hand aufgefallen und die Angewohnheit, die verstümmelte Hand neben seinem Körper immer wieder ruckartig zur Faust zu ballen, als versuche er, etwas für alle anderen Unsichtbares zu greifen, um es zwischen seinen drei verbliebenen Fingern unbarmherzig zu zermalmen. Hätte sich der Beobachter noch ein wenig mehr Zeit gelassen, wäre sein Blick über das hagere Gesicht mit den hohen Wangenknochen und der eigentümlich faltenlosen Stirn geschweift, hätte vermutlich die zu großen, abstehenden Ohren und den militärischen Haarschnitt registriert und wäre dann bei den Augen des Mannes hängen geblieben. Irritiert. Vielleicht ein wenig verunsichert.
Es waren sehr dunkle Augen, und sie lagen leblos wie schwarze Glasmurmeln tief in den Höhlen. Diese Augen sprachen keine Sprache, nichts war darin zu lesen. Alles, was jener Mann auf der Galerie zu fühlen imstande war, alles, wozu er fähig war, blieb hinter dieser lichtlosen Dunkelheit verborgen. Kein Hass, keine Wut und kein Schmerz schimmerten daraus hervor. Er hatte früh schon gelernt, diese Gefühle im Zaum zu halten, sie tief in sich zu verbergen und keine Schwäche zu zeigen. Niemals.
Doch niemand beachtete den reglos inmitten der applaudierenden Zuschauer sitzenden Mann, niemand sah ihm in die leblosen Augen, niemand bemerkte seine zuckende Faust, die scharfen Fingernägel, die jetzt, endlich, die Haut an seinem Handballen aufgerissen hatten. Niemand sah das Blut, das auf den Boden tropfte.
2
Paris, Januar 1926
Die junge Frau stand allein am Bahngleis. Es war früher Morgen, der Dampf der Lokomotiven stieg weiß und dicht wie Nebel in den klaren Winterhimmel, und die Morgensonne warf ihre Strahlen auf die Gleise. Wie verheißungsvolle Pfade in eine andere Welt verliefen sie zunächst nebeneinander, kreuzten sich dann scheinbar ohne erkennbare Ordnung und verloren sich schließlich in der Ferne, wo sich der Rauch der unzähligen Kamine der Stadt mit dem Dampf der Lokomotiven vereinte. Die Luft roch nach Kohle und Kälte, auf den Dächern glitzerte der Frost. Die junge Frau trug einen hellgrauen Wollmantel mit Pelzkragen sowie einen weichen Hut in der gleichen Farbe, der sich eng an ihren Kopf schmiegte und ihre Augen beschattete. Ihre Schuhe glänzten silbern, ebenso die Kette, die sie um den Hals trug. Ein Dienstmann mit einem Gepäckwagen voller Koffer und Hutschachteln stand ein wenig abseits und zündete sich eine Zigarette an. Dabei ließ er die junge Frau im hellgrauen Mantel nicht aus den Augen.
Sie jedoch beachtete ihn nicht. Ihr Blick war auf die Gleise gerichtet, und ein Lächeln umspielte ihre Lippen. Noch war der Zug nicht da, der sie nach Berlin bringen sollte, aber er würde jeden Moment kommen.
»Berlin …« Sie flüsterte den so fremd und doch irgendwie vertraut klingenden Namen und wiederholte ihn zur Sicherheit noch ein paarmal, um ihn flüssig und so korrekt wie möglich aussprechen zu können.
Ihr Ruf eilte der Stadt weit voraus. Seit einigen Jahren schon war Berlin in aller Munde. Während sich Paris auf ihrer Eleganz und ihrer Schönheit auszuruhen begann wie eine in die Jahre gekommene Diva, die sich ihrer Sache zu sicher war, war aus dem zu Boden gedrückten, besiegten Nachkriegsberlin nach allem, was man hörte, eine ernst zu nehmende Konkurrentin geworden. Hungrig griff sie nach der Krone der alternden Diva, hielt sie vermutlich schon in den Händen.
Berlin hatte den Ruf einer wilden, leidenschaftlichen Stadt, die das Leben feierte wie keine andere in Europa. Dort gebe es keine Schranken des guten Geschmacks, des comme il faut, hieß es in Paris mit einer Mischung aus Bewunderung und Abscheu, und genau das war es, was die junge Frau so in Vorfreude versetzte, während sie wartete, bis der Zug einfuhr, der sie dorthin bringen würde. Mitten ins Herz jenes verheißungsvollen Ortes. Sie hatte keine Furcht vor Leidenschaft, und mit der Sprengung althergebrachter Vorstellungen kannte sie sich bestens aus. Eine vibrierende, elektrisierende Vorfreude erfasste sie beim Gedanken daran, diese Stadt zu erobern.
Sie schloss die Augen und versuchte sich vorzustellen, was sie erwartete. Wie würden die Gebäude und Straßen dort aussehen, die Lichter, die Cafés und Geschäfte und natürlich die Bühne, auf der sie stehen würde? Versonnen strich sie über das silbrig schimmernde Band um ihren Hals und flüsterte: »Wir werden Spaß haben, Kiki, nicht wahr?«
Es war ihre Entscheidung gewesen, einen Tag früher zu fahren als der Rest der Truppe. Morgen würden sie nachkommen, Sidney und Louis, Maud, ihre Freundin May, die Garderobieren und alle anderen, und es würde wieder laut und fröhlich werden. Sie waren alle überrascht gewesen, als sie verkündet hatte, allein vorzufahren, doch sie war standhaft geblieben. Aus irgendeinem Grund, der ihr selbst nicht ganz klar war, wollte sie die ersten Schritte in dieser neuen, fremden Stadt allein machen. Sie hatte das unbestimmte Gefühl, als warte dort etwas auf sie. Und sie würde jede einzelne Meile der Fahrt dorthin genießen.
Nein. Kilometer, verbesserte sie sich schnell. Sie war in Europa. Weit, weit weg von dem Ort, den sie vor sechs Jahren mit nichts als einem Paar Schuhen und dem Kleid, das sie am Leib trug, verlassen hatte. Doch noch immer packte sie an manchen Tagen unversehens die Furcht, wieder dorthin zurückkehren zu müssen. Eine plötzliche Angst, dass alles, was sie seither erlebt hatte, nichts als ein Traum gewesen sein könnte und sie in Wirklichkeit noch immer »Tumpie« war, ein mageres Mädchen von elf Jahren, das mitansehen musste, wie der Rauch über den Hütten am Fluss aufstieg, und das hörte, wie die Menschen um sie herum in Panik und Todesangst schrien.
Sie vertrieb die Beklemmung mit einem geübten Lächeln, streifte ihre Furcht ab wie ein paar unerwartete Schneeflocken am Ärmel ihres Mantels und straffte die Schultern. Es war vorbei. Sie war in Paris, und jetzt würde sie Berlin erobern. Weiter, immer weiter. So weit weg wie möglich von dem Ort ihrer Kindheit. Es konnte nie weit genug sein.
* * *
Der Zug fuhr schnaufend ein, und der Dienstmann warf seine Zigarette weg. Jetzt. Jetzt war seine Chance gekommen. Er trat auf die Dame in dem silbergrauen Mantel zu und räusperte sich. »Mademoiselle«, sagte er, und seine Stimme war so heiser, dass er sich ein zweites Mal räuspern musste. »Mademoiselle Baker …«
Sie drehte sich um und musterte ihn mit einem Lächeln. »Ja, bitte?«
Der Dienstmann schluckte. Sie war es tatsächlich. Stand direkt vor ihm. Mit diesem schönen Gesicht, den großen Augen, den fein geschwungenen Brauen und … diesem unglaublichen Lächeln, das er bisher nur von Fotos kannte.
»Ich … ich wollte nur sagen …«, stotterte er und knetete seine Finger. »Ich … bewundere Sie, Mademoiselle Baker. Ja, das wollte ich sagen … Ich wünschte, Sie würden nicht weggehen.«
Ihr Lächeln wurde breiter. »Danke. Wie lieb von Ihnen«, sagte sie. »Aber keine Sorge, ich komme wieder.«
Der Mann nickte ernst. »Hoffentlich, Mademoiselle. Paris ist nicht mehr dasselbe ohne Sie.« Dann fiel sein Blick auf die breite silberne Kette, die sie um den Hals trug, und er erkannte, dass es keine Kette, sondern eine lebende Schlange war, die jetzt, von den kreischenden Bremsen des einfahrenden Zuges geweckt, den Kopf hob.
Er zuckte vor Schreck zurück, und Mademoiselle Baker lachte vergnügt. »Das ist Kiki, sie freut sich auch schon auf Berlin. Genau wie ich.« Sie strich der Schlange mit einem Finger zärtlich über den Kopf. Schon am Einsteigen, drehte sie sich noch einmal um und warf ihm übermütig eine Kusshand zu. »Au revoir, Monsieur! Vergessen Sie Kiki und mich nicht!«
Nachdem die Koffer verstaut, die Passagiere eingestiegen und der Zug abgefahren war, stand der Dienstmann noch immer am Bahnsteig und sah auf die leeren Gleise hinaus.
»Wie könnte ich das vergessen«, murmelte er kopfschüttelnd. »Eine Schlange. Und eine Kusshand. Das glaubt mir kein Mensch.«
* * *
Josephine Bakers Abreise nach Berlin war noch von jemand anderem bemerkt worden, der etwas entfernt im Schatten einer Säule stand und die Begegnung zwischen der jungen Frau und dem Dienstmann genau beobachtet hatte. Jetzt, nachdem der Zug abgefahren war, zog er sich zurück und verließ eilig den Bahnhof. Auf der nahe gelegenen Post gab er ein Telegramm auf, dessen Text aus drei deutschen Wörtern bestand: SIE IST UNTERWEGS.
3
Berlin, Januar 1926
Schutzpolizist Willy Ahl betrachte die Stulle in seiner Aluminiumbüchse mit einiger Kümmernis. Eine einzige Scheibe Käse lag zwischen zwei harten Scheiben Graubrot, die nur hauchdünn mit Butter bestrichen waren. Die Ecken des Käses waren bereits trocken und krümmten sich. Keine erfreuliche Aussicht für seine wohlverdiente Pause. Er hob die obere Scheibe Brot zur Sicherheit auf und warf einen Blick darunter. Wie schon befürchtet war auch nicht das kleinste Fitzelchen Wurst zu sehen. Noch nicht einmal eine eingelegte Gurke.
Da hätte sich Ilse schon ein wenig mehr Mühe geben können, dachte er verstimmt, und das nicht zum ersten Mal. Seine Schwester war nicht gerade eine Leuchte, was die Haushaltsführung anbelangte, vor allem aber hatte sie keine Lust, ihren Bruder auch noch zu »verwöhnen«, wie sie es nannte. Als ob eine ordentliche Butterstulle mit Schinken und Senfgurke etwas mit Verwöhnen zu tun hätte. Aber da war nichts zu machen. Ilse war stur wie ein Maulesel. Ahl bückte sich ächzend, nahm eine Flasche Bier aus seiner Tasche und stellte sie behutsam auf seinen Schreibtisch. Elf Uhr. Zeit für die Pause. Er wollte gerade in sein karges Käsebrot beißen, als die Tür der Polizeiwache aufging und ein Herr hereinkam. Ahl sah sofort, dass es ein Herr war, auch wenn er ihn nicht kannte. Ein feiner Wollmantel, Lederhandschuhe und ein Filzhut, der so schräg saß, dass er dem Mann ein etwas leichtsinniges Aussehen gab. Ein Hut gehörte gerade auf den Kopf, fand Ahl, und nicht so keck über einem Auge, als wolle er sein Gegenüber verhöhnen.
Schließlich war dieser Mann beileibe nicht einer dieser modischen jungen Fatzkes, die man in letzter Zeit überall sah. Er hatte mit Sicherheit die fünfzig bereits überschritten. Jetzt nahm er den Hut ab, und Ahl blickte in zwei graue Augen, die ihn kühl musterten.
»Ich hörte, es gab heute Nacht eine Festnahme bei Ihnen, Herr Wachtmeister«, sagte er ohne eine Begrüßung.
Ahl bekam augenblicklich ein schlechtes Gewissen, was ihn ärgerte. Was bildete sich dieser Mann eigentlich ein, ihn hier bei seiner wohlverdienten Pause mit irgendwelchen Anschuldigungen zu überfallen? Schließlich war er der Arm des Gesetzes. Er packte seine Stulle und das Bier weg und richtete sich etwas auf. »Was geht Sie das an?«, blaffte er. »Wer sind Sie überhaupt?«
Der Mann lächelte, jedoch auf eine Art, die ihn eher noch arroganter wirken ließ. Es kräuselten sich nur die Mundwinkel kaum sichtbar, und die Augenbrauen hoben sich ein paar Millimeter. Er hatte ein schmales Gesicht mit einem gepflegten, an den Enden spitz zulaufenden Schnurrbart und Augenbrauen, wie mit dem Federkiel gezogen. Seine Nase war scharf gebogen, eine typische Adlernase. Dem Schutzmann kam der Gedanke, dass sein Gegenüber womöglich ein ehemaliger Offizier sein könnte. Hatten von denen nicht viele solche Adlernasen in ihren herrischen Visagen?
»Verzeihung.« Der Mann zog seine Handschuhe aus, knöpfte seinen Mantel auf und zog ein silbernes Etui aus der Innentasche. Er klappte es auf und entnahm ihm ein Kärtchen, das er Ahl reichte.
Johann Henry Graf von Seidlitz, stand dort in geschwungener Schrift auf festem Karton. Und unter einem geprägten Wappen war noch die Berufsbezeichnung zu lesen: Diplomat.
»Es geht um den jungen Mann, der heute am frühen Morgen in eine Auseinandersetzung vor der Blauen Maus verwickelt war«, sagte der Mann dann und schob das Etui in die Manteltasche zurück.
Ahl spürte, wie er unter seiner Uniformjacke zu schwitzen begann. Hatte er einen Fehler gemacht, als er den Kerl mitgenommen hatte? Er hatte ihn für einen dieser kleinen Gauner gehalten, die sich hier in der Gegend herumtrieben. Jede Nacht kam es in der Blauen Maus und den umliegenden Kneipen zu Schlägereien und Randale, meist war zu viel Alkohol im Spiel, dazu Wut, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit.
Willy Ahl kannte das alles, er wusste um den Frust der jungen Männer, verstand ihn sogar und war doch hilflos. Aufgreifen, wegsperren, ausnüchtern, das war seine Aufgabe. Und wenn man sie dann am nächsten Morgen zurück auf die Straße ließ, hinaus in die graue, leblose Kälte, der sie nichts entgegenzusetzen hatten als ein schäbiges Jackett und abgewetzte Schuhe, sah man schon in ihren Augen, dass das Elend in der nächsten Nacht von Neuem beginnen würde. Doch mehr konnte er nicht tun. Und es war wichtig, ein Mindestmaß an Ordnung aufrechtzuerhalten, davon war Ahl überzeugt. Wenn einem das auch noch durch die Finger glitt, war gar nichts mehr übrig. Wenn nun aber ein Graf – und Diplomat noch dazu – sich für den Mann interessierte, konnte er wohl kaum einer dieser Nichtsnutze sein, für den er ihn gehalten hatte. Ihm fiel ein, dass er ihn noch nicht einmal nach seinem Namen gefragt hatte. Er war aber auch zu betrunken gewesen. Hatte kaum gerade stehen können. Und das Gesicht war voller Blut gewesen. Hatte ganz schön was abgekriegt. Rein ins Loch und Rausch ausschlafen, das hatte er sich gedacht und die Tür hinter ihm zufallen lassen.
»Es gab eine Prügelei«, sagte er nun, erheblich vorsichtiger als zuvor. »Ich musste eingreifen.«
Der Graf nickte gleichmütig. »Sie werden Ihre Gründe gehabt haben. Doch sicher haben Sie nichts dagegen, wenn ich den Mann jetzt mitnehme?«
Der Schutzpolizist hörte zwei Botschaften aus dieser Äußerung heraus: Erstens hatte er nichts falsch gemacht, und zweitens würde es kein Nachspiel haben, selbst wenn dieser junge Schläger nicht der war, für den er ihn gehalten hatte. Er war aus dem Schneider. Keine »diplomatischen Verwicklungen« – so hieß es doch immer, wenn Diplomaten im Spiel waren. Und was das bedeutete, wusste man ja: Es war immer was Politisches und immer ungemütlich. Ahl dachte an das Bier, das neben seinem Schreibtisch wartete, und an das Käsebrot, das ihm plötzlich erheblich verlockender erschien als noch vor zehn Minuten. Er strich sich über seinen stattlichen Walrossschnurrbart und nickte. Und weil er so erleichtert war, lächelte er dem Grafen sogar ein klein wenig vertraulich zu. »Klar können Se den mitnehmen, Herr Graf. War ja nur ’ne kleine Rangelei. Ist niemand ernstlich zu Schaden gekommen.«
Willy Ahl ging nach hinten, um die Zelle aufzuschließen, in die er alle gesperrt hatte, die es heute Nacht zu weit getrieben hatten. Als er bemerkte, dass sein Besucher ihm folgte, wurde er erneut nervös.
Die Polizeiwache an der Friedrichstraße mit ihren »Verwahrräumen«, wie es im Amtsdeutsch hieß, war wenig einladend, und je weiter sie den Flur entlanggingen, desto schäbiger wurde es. Gelblich schimmernde Flecken Salpeter hatten sich in den feuchten Ecken breitgemacht, und stellenweise blätterte der Putz von den Wänden. Das Linoleum auf dem Boden war abgewetzt; der ganze Flur roch nach Resignation und Verzweiflung. Bei der vorletzten Tür blieb Ahl stehen und warf seinem feinen Gast einen zögerlichen Blick zu.
Doch dessen Gesichtsausdruck verriet nichts, keinen Ärger, keine Ungeduld, man konnte nicht einmal sagen, ob er seine schmuddelige Umgebung überhaupt registrierte.
Nun nickte er, fast unmerklich. »Nur zu, Herr Wachtmeister. Es ist mehr vonnöten, mich zu schockieren, als ein paar verkaterte Männer in einer Arrestzelle.«
Ahl drehte den Schlüssel im Schloss und öffnete die schwere Tür. Drei Männer in unterschiedlichen Stadien der Aus- beziehungsweise Ernüchterung befanden sich in dem fensterlosen Raum, in dem es nach ungewaschenen Körpern, kaltem Rauch und den Hinterlassenschaften nächtlicher Exzesse roch. Eine kahle Glühbirne beleuchtete zwei Pritschen, die fest an den sich gegenüberliegenden Wänden befestigt waren. Ein Eimer stand in einer Ecke, ein Krug mit Wasser in der anderen.
Der fette Alfons Dieckmeier, seines Zeichens Apotheker, saß auf der linken Pritsche und sah noch am anständigsten aus. Ahl fing ihn regelmäßig alle paar Wochen ein, weil er einfach nie genug kriegen konnte, wenn er einmal auf Tour war. Dann randalierte er, um sich danach, wenn er alles kurz und klein geschlagen hatte, an der Schulter des Schupos auszuflennen. Dieckmeier warf dem Wachtmeister einen bangen Blick zu, erwartete er doch, seine nicht minder beleibte Frau zu sehen, die ihn nach seinen Sauftouren jedes Mal abholte, stumm, mit einem Todesblick, der selbst den abgebrühten Wachtmeister erschaudern ließ. Auf den Ernüchterungsstufen dem dicken Alfons diametral entgegengesetzt befand sich der Mann, der in einer Ecke am Boden kauerte und leise vor sich hin brabbelte. Seinem Zustand war mit Ausnüchterung nicht mehr beizukommen. Er war klapperdürr, und sein Gesicht glänzte von kaltem Schweiß. Es würde nicht mehr lange dauern, und sie würden ihn tot in irgendeiner dunklen Ecke finden. Erfroren oder totgesoffen mit billigem Fusel. Man brauchte viel Alkohol, um sich im Winter auf den Straßen Berlins warm zu halten.
Der dritte Mann, um den es dem Grafen offenbar ging und den Ahl heute in den frühen Morgenstunden vor dieser üblen Kaschemme aufgegriffen hatte, wirkte schon wieder einigermaßen nüchtern. Er hockte hemdsärmelig auf der zweiten Pritsche, hatte den Rücken an die Wand gelehnt und warf dem Wachtmeister einen misstrauischen Blick zu. Ahl machte eine Handbewegung in seine Richtung. »Rauskommen. Sie werden abgeholt.« In letzter Sekunde hatte er sich für das höfliche Sie entschieden. Man wusste ja nie.
Der Mann runzelte die Stirn. Er hatte sich das Blut aus dem Gesicht gewaschen und sah jetzt zwar einigermaßen sauber, aber blass und übernächtigt aus. An Kinn und Wangen sprossen rötliche Bartstoppeln. Ahl schätzte ihn auf etwa Ende zwanzig. Er hatte ein schmales, kantiges Gesicht und graublaue Augen. Seine Haare waren zerzaust, und oberhalb der rechten Augenbraue hatte er eine frische Platzwunde. Die Nase war ein wenig schief, offenbar war sie früher einmal gebrochen worden. Irgendwie kam dem Wachtmeister das Gesicht bekannt vor, doch er wusste nicht, woher.
Nach kurzem Zögern sprang der Mann von der Pritsche und griff nach seinem zerknitterten Jackett, das ihm als Kopfkissen gedient hatte. Mit einem kurzen Nicken verabschiedete er sich von seinen Zellengenossen und folgte Ahl nach draußen. Der Schupo ließ die Tür wieder ins Schloss fallen und drehte den Schlüssel um.
Der Graf hatte im Flur gewartet. Er musterte den jungen Mann einen Moment lang schweigend, dann sagte er: »Guten Morgen.«
Der junge Mann zuckte zurück, als hätte ihn eine Schlange gebissen. Seine Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. »Was willst du?«, sagte er dann leise, und in seinen Worten lag fast so etwas wie eine Drohung. Ahl dachte bei sich, dass mit diesem Kerl mit Sicherheit nicht gut Kirschen essen war. Er war nicht besonders groß, aber sehnig und hatte breite Schultern.
Jetzt wandte sich der junge Mann an ihn und deutete auf die Zellentür. »Sperren Sie wieder auf.«
»Wie?« Das war Ahl noch nie untergekommen. Einer, der freiwillig zurück in die Zelle wollte?
»Sei nicht albern, Junge.« Der Graf schüttelte ungeduldig den Kopf. »Lass uns wenigstens reden.«
»Kein Bedarf. Hau ab!«
Ahl wunderte sich immer mehr. Diese Geschichte mit dem Grafen wurde mit jeder Minute interessanter.
»Ich bitte dich.«
»Kannst du vergessen.« Der junge Mann warf dem Schutzmann einen ungeduldigen Blick zu. »Wenn Sie mich nicht mehr einsperren wollen, dann kann ich also gehen?« Ahls Blick wanderte unschlüssig zwischen dem Grafen und dessen unwilligem Schützling hin und her, dann nickte er. »Von mir aus.« Er wandte sich an den Grafen und fügte leise hinzu: »Vielleicht klären Sie das besser woanders.«
Der Graf gab keine Antwort. Er hastete dem jungen Mann hinterher, der in sein zerknittertes Jackett geschlüpft war, den Kragen nach oben geschlagen hatte und sich anschickte, die Wache zu verlassen, ohne sich noch einmal umzusehen.
Ahl ging achselzuckend zurück in die Amtsstube und setzte sich wieder an seinen Schreibtisch. Er stellte zum zweiten Mal an diesem Tag die Büchse mit dem Käsebrot und die Flasche Bier auf den Tisch und betrachtete beides unschlüssig. Nach einer Weile stand er wieder auf und ging zur Arrestzelle zurück. Er schickte Apotheker Dieckmeier mit einer knappen Kopfbewegung nach Hause, um ihm die demütigende Abholung durch seine Frau zu ersparen, und reichte seine Brotzeit dem klapperdürren Kerl, der noch in der Arrestzelle verblieben war. Der brabbelte ein zahnloses Dankeschön, bevor er sich als Erstes auf das Bier stürzte.
Nachdem Ahl ihm eine Weile beim Trinken zugesehen hatte, sagte er: »Wird langsam Zeit, ’ne Biege zu machen, mein Freund«, und deutete mit einem Daumen vielsagend zur Tür. Sein junger Kollege Gille würde gleich kommen, und er hatte keine Lust auf Diskussionen mit ihm.
Der Mann verstand, stopfte sich das Brot in die Jackentasche und rappelte sich auf. Als er Ahl noch einmal danken wollte, winkte dieser ab.
»Mach, dass de rauskommst. Will mal hoffen, dass ich dich nicht so bald hier wiederseh«, brummte er, doch es klang nicht unfreundlich.
Der Mann humpelte eilig davon, und Ahl sah ihm mitleidig nach. Diesen armen Teufeln war nicht mehr zu helfen. Da musste man ihnen das letzte Stück des Weges nicht noch bitterer machen, indem man nach ihnen trat, wo sie doch schon längst am Boden lagen. Das war seine feste Überzeugung, und die versuchte er auch immer seinem jungen Kollegen beizubringen. Doch Hermann Gille begriff es nicht. Er war pflichtbewusst, das schon, aber was Mitgefühl und Menschenkenntnis anbelangte, davon besaß er keinen Fingerhut voll.
Als er wenig später mit einem leichten Hungergefühl im Magen an seinem Schreibtisch saß, dachte Willy Ahl noch einmal über die seltsame Begegnung zwischen dem Grafen und dem jungen Mann nach. Wo hatte er Letzteren nur schon einmal gesehen? Er kannte dieses Gesicht. Ganz sicher. Und er hatte es in keiner guten Erinnerung.
4
Tristan mochte keine Bahnhöfe, und das hatte einen triftigen Grund. Vom Anhalter Bahnhof war er losgefahren, vor zwölf Jahren, ein sechzehnjähriger Schuljunge, aufgekratzt wie auf dem Weg ins Sommerlager. »Heil dir im Siegerkranz«, hatten sie gesungen, er und seine künftigen Kameraden, markige Sprüche geklopft, so wie »jeder Stoß ein Franzos, jeder Schuss ein Russ«, und ihren Proviant geteilt. Und hier war er zusammen mit den anderen, die mit ihm zurückkehrten, vier Jahre später wieder ausgestiegen. Krank und abgemagert war er auf den Bahnsteig getreten, zögerlich, das Grauen des Krieges noch vor Augen. Es hatte sich in diesen vier Jahren in seine Hornhaut eingebrannt, sich ins Innerste hineingefressen wie ein bösartiger Parasit, der sich nicht mehr vertreiben ließ.
Tristan erinnerte sich an seine Stiefel von damals, die die Bezeichnung kaum mehr verdient hatten, so zerfleddert waren sie gewesen. Mit den Riemen seines Tornisters hatte er die Sohlen notdürftig festgebunden. Socken hatte er schon lange keine mehr gehabt, hatte sie durchgelaufen oder zweckentfremdet, als notdürftiges Verbandszeug für verwundete Kameraden. Seine nackten Füße waren damals so wund gewesen, dass es ihm vorgekommen war, als seien sie mit dem harten Schuhleder verwachsen, und als er endlich die Stiefel ausziehen konnte, war die Haut in Fetzen am schrundigen Leder hängen geblieben.
Die Erinnerung an den Schmerz meldete sich zurück, klopfte an wie ein ungebetener Gast, während er langsam durch die belebte Bahnhofshalle ging. Graues Winterlicht drang von oben durch die Glasfenster. Tristans Blick fiel immer wieder auf die zahlreichen Bettler. Sie strichen herum wie halb verhungerte Streunerkatzen, mit demütig aufgehaltener Hand, schäbig und scheu, immer auf der Hut. Oder sie kauerten reglos in den dunklen Ecken, nicht mehr als Lumpenhaufen, die niemand beachtete.
Als er an einem Bettler in einem abgetragenen Offiziersmantel vorbeikam, blieb er stehen und drückte ihm ein paar Münzen in die ausgestreckte Hand. Der Mann bedankte sich mit einem stummen Nicken. Er hatte nur noch ein Bein und lehnte, auf eine Krücke gestützt, an einer der Säulen. Nur wenig älter als Tristan selbst, sah er aus, als würde er seit Kriegsende an diesem Platz stehen. Als sei er aus demselben Zug gestiegen, aus dem auch Tristan entkräftet gestolpert war, und einfach hiergeblieben, an diesem Bahnhof, auf ewig gefangen zwischen Abfahren und Ankommen.
Tristan war schon ein paar Schritte weitergegangen, als er innehielt und noch einmal umkehrte. Er zündete sich eine Zigarette an, nahm einen Zug und reichte die brennende Zigarette dann dem Bettler, der sie mit einem traurigen Lächeln entgegennahm. Die wenigen Zigaretten zu teilen, die man hatte, war damals in den Schützengräben ein heiliges Ritual gewesen, eine der wenigen menschlichen Gesten, die in der Hölle noch Bestand gehabt hatten. Obwohl er sich inzwischen ausreichend Zigaretten leisten konnte, brachte Tristan es noch immer nicht fertig, eine Zigarette wegzuwerfen, bevor er sie nicht ganz und gar zu Ende geraucht hatte.
Eine Durchsage kündigte die zehnminütige Verspätung des Expresszuges aus Paris an. Mit gemischten Gefühlen reihte Tristan sich am Kopf des Bahnsteigs in die Riege der Wartenden ein. Und zum wiederholten Mal seit heute Morgen fragte er sich, wieso er diesen Auftrag nur angenommen hatte.
Tristan hatte die Wache kaum verlassen, als der Graf ihn eingeholt und gemeint hatte, etwas Wichtiges mit ihm besprechen zu müssen.
»Aber ich nicht mit dir«, hatte Tristan ihn angeschnauzt und war einfach weitergegangen. Doch von Seidlitz hatte sich nicht abschütteln lassen, und so war Tristan mit ihm in eine unscheinbare Mokkadiele an der Friedrichstraße gegangen. Er hatte weder in das noble Auto steigen wollen, wie sein Onkel vorgeschlagen hatte, noch hatte er gewollt, dass ihn einer seiner Bekannten mit dem Grafen sah.
Sobald sie sich in eine der abgeteilten Nischen gesetzt hatten, bestellte von Seidlitz zwei Mokka – »Einen extrastark für den jungen Herrn« – und wandte sich dann an Tristan, der ihn ablehnend musterte. »Sagt dir der Name Josephine Baker etwas?«
Tristan runzelte die Stirn. »Das ist irgend so eine Varietétänzerin, oder?«
Seine Antwort schien von Seidlitz zu amüsieren. »Offenbar gehörst zu den wenigen Ahnungslosen in dieser Stadt, die nicht wissen, wer oder was sie tatsächlich ist.« Er schwieg, als ihre Getränke gebracht wurden. Nachdem sie beide einen Schluck von dem heißen, schwarzen Kaffee genommen hatten, fuhr er fort: »Josephine Baker ist nicht irgendeine Tänzerin, sondern ein Star. Sie ist erst neunzehn Jahre alt, und sie tanzt, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Seit sie mit ihrer Revue in Paris auftritt, liegt ihr die ganze Stadt zu Füßen«, schwärmte er und fügte dann hinzu: »Heute Abend kommt sie hier in Berlin an.«
Tristan zuckte mit den Schultern. »Na und? Was geht mich das an?«
»Viel, denn ich möchte, dass du auf sie aufpasst«, sagte von Seidlitz ernst.
Tristan starrte ihn ungläubig an. »Ich soll Kindermädchen für eine Tänzerin spielen?«, fragte er schließlich und wusste nicht, ob er lachen oder wütend werden sollte.
»Kindermädchen ist nicht das richtige Wort. Ich möchte, dass du die Verantwortung übernimmst für den Schutz und das Wohlergehen der jungen Dame während ihres Aufenthalts in der Stadt.«
Tristan verzog angesichts der umständlichen Ausdrucksweise verächtlich das Gesicht. Kindermädchen blieb Kindermädchen, egal wie geschraubt man es formulierte.
Der Graf hatte seine abschätzige Reaktion entweder nicht bemerkt oder bewusst ignoriert. Denn er sah sich erst um, dann beugte er sich vor und sagte leise: »Du weißt vermutlich, dass das heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist. Josephine Baker tanzt nicht nur mehr oder weniger nackt, sie ist noch dazu dunkelhäutig, und beides zusammen passt vielen in der Stadt nicht.«
Tristan nickte widerwillig. Er wusste, wovon von Seidlitz sprach. Von der zunehmend nationalistischen und rassistischen Stimmung in der Stadt. Hetzartikel in einschlägigen Zeitungen, Beleidigungen auf offener Straße, Schlägertruppen, die nachts durch die Vergnügungsviertel zogen, Veranstaltungen störten und wahllos Menschen verprügelten, die sie für nicht passend hielten. Eine dunkelhäutige, amerikanische Nackttänzerin fiel genau in diese Kategorie. Dennoch verstand er nicht, weshalb der Graf damit zu ihm kam. Sie hatten sich seit Jahren nicht gesehen, und wäre es nach Tristan gegangen, wäre es auch so geblieben.
»Gibt es dafür nicht die Polizei?«, wehrte er ab, doch von Seidlitz schüttelte den Kopf.
»Es handelt sich um einen inoffiziellen Auftrag der Regierung, und ich bin überzeugt davon, dass du dafür der beste Mann bist. Wir haben Informationen über einen geplanten Anschlag und sind überzeugt, dass die junge Frau in großer Gefahr schwebt.« Als Tristan ungläubig schnaubte, fügte er rasch hinzu: »Ich wäre nicht zu dir gekommen, wenn es eine andere Lösung gäbe.«
Nach diesem eher zweifelhaften Kompliment war Tristan versucht gewesen, einfach aufzustehen und zu gehen.
Er war seinem Onkel nichts schuldig, im Gegenteil. Eigentlich hatte der Graf es verdient, eine verpasst zu bekommen, allein dafür, dass er es gewagt hatte, ihn um etwas zu bitten.
Dennoch war Tristan nun hier am Bahnsteig und wartete auf diese sagenhafte Josephine Baker.
Am Ende war es das Geld gewesen, das ihn umgestimmt hatte. Für die Summe, die die Regierung ihm für diesen »inoffiziellen« Auftrag bezahlen würde, hätte sein Freund Freddy leichten Herzens seine Großmutter verscherbelt.
Einen Teil davon hatte von Seidlitz bereits dabeigehabt, ein dicker Umschlag voller Scheine. »Für Spesen«, wie er es genannt hatte, so als würde es sich nur um ein paar Groschen handeln, um sich Zigaretten zu kaufen. Der Rest würde folgen, sobald seine Arbeit getan sei.
* * *
Als der Zug mit zehnminütiger Verspätung um 18:24 Uhr in den Anhalter Bahnhof einfuhr, hatte Josephine Mühe, still zu sitzen. Während sie durch die Vorstädte gefahren waren, vorbei an rußgeschwärzten Mietshäusern und Fabriken mit rauchenden Schloten, war ihr klar geworden, wie groß diese Stadt tatsächlich war. Berlin hatte erheblich mehr Einwohner als Paris und erschien ihr plötzlich sehr viel fremder als die französische Hauptstadt, die sie im letzten Jahr mit offenen Armen willkommen geheißen hatte.
Ob ihre Entscheidung wirklich klug gewesen war, niemanden außer die Pensionswirtin über ihre frühere Ankunft informiert zu haben? Immerhin sprach sie kein Wort Deutsch. Würde sie sich überhaupt zurechtfinden? Sie hatte ja schon Mühe, Französisch zu lernen, auch wenn sie eifrig übte. Doch Deutsch erschien ihr noch um einiges schwieriger zu sein. Sie zog einen Zettel aus ihrer Handtasche, auf dem sie die Adresse der Pension notiert hatte, und versuchte, die fremd klingenden Wörter auszusprechen. Ihre Mutter kam ihr in den Sinn, wie sie verächtlich das Gesicht verzog und meinte: »Typisch Tumpie, immer erst nachdenken, wenn es zu spät ist.«
Unwirsch schüttelte sie den Kopf und schob alle negativen Gedanken beiseite. Was machte es schon, wenn sie kein Deutsch sprach? Sie war hier, um zu tanzen, und diese Sprache war zum Glück auf der ganzen Welt gleich.
Sie warf den Zettel in die Tasche zurück und holte ihren Taschenspiegel heraus. Als der Zug schnaufend und kreischend zum Stehen kam, legte sich Josephine Kiki, die die meiste Zeit zusammengerollt auf ihrem Schoß geschlafen hatte, wieder um den Hals. Dann warf sie einen letzten Blick in den Spiegel, zog den Lippenstift nach, atmete einmal tief durch und verließ das Abteil.
Der Bahnhof war beeindruckend groß und modern. Rundbögen aus rotem Backstein verliefen entlang der Bahnsteige, und darüber wölbte sich eine Kuppel aus Glas und Stahl. Überall waren Menschen. Ankommende, Abfahrende, verliebte Paare, die sich trennten oder gerade erst wiedersahen, müde Mütter mit Kinderwägen und noch ein paar Kindern am Rockzipfel, junge Burschen in geflickten Hosen, armselig aussehende Bettler neben gut gekleideten Damen und ihren Dienstmädchen, ernste Männer mit Schnauzbärten und Monokel, magere Mädchen mit bleichen Gesichtern, uniformierte Kofferträger, schreiende Zeitungsverkäufer und dazwischen immer wieder Polizisten mit seltsamen Helmen auf dem Kopf. Aus dem Gewimmel auf dem Bahnsteig und der Ankunftshalle drangen fremde Wortfetzen zu ihr empor, die ebenso rätselhaft waren wie die Hinweisschilder. Immer wieder erklangen schroff und abgehackt deutsche Durchsagen aus den Lautsprechern. Josephine setzte ihr Lächeln auf, dieses Lächeln, das sie schon über so vieles, weitaus Schlimmeres als eine fremde Stadt getragen hatte, rückte ihren Hut zurecht und stieg dann anmutig die Metallstufen hinunter auf den Bahnsteig, mitten hinein in ihr kleines, ganz privates Abenteuer.
Anfangs bemerkte sie es nicht, doch als sie sich einen Weg durch das Gedränge bahnte, fiel ihr auf, dass sie nur weiße Gesichter sah. Alle Menschen in dieser riesigen Bahnhofshalle waren weiß, auch die Kofferträger und Bediensteten. Natürlich erregte ihre schwarze, fünfundzwanzigköpfige Revuetruppe auch in Paris Aufsehen, wenn sie zusammen unterwegs waren. Aber dort gab es zahlreiche andere schwarze Musiker und Künstler, die Amerika den Rücken gekehrt hatten, weil sie die Repressalien und Demütigungen dort nicht mehr ertragen hatten. Josephine wusste nicht, ob es in Berlin ähnlich war. Immerhin hatte die Stadt den Ruf, ein Mekka für Künstler zu sein. Hier jedoch, auf dem Bahnhof, gab es nur Weiße. Sie spürte plötzlich, wie sie angestarrt wurde. Manche senkten den Blick, wenn sie sich ihnen zuwandte, andere aber glotzten einfach weiter, kümmerten sich nicht darum, ob sie ihre schamlose Neugier bemerkte.
Als Josephine feststellte, dass aus manchen Blicken unverhohlene Feindseligkeit sprach, gefror das erwartungsvolle Lächeln auf ihrem Gesicht. Und waren nicht auch abfällige Bemerkungen aus dem allumfassenden Lärm herauszuhören? Leise gemurmelte Wörter, die sie nicht verstand, deren Bedeutung sie aber wohl begriff. Sie umfasste ihre Handtasche mit beiden Händen, als könne ihr der Notizzettel mit der Adresse darin Halt bieten, und zwang sich, langsam und selbstsicher weiterzugehen.
Schritt für Schritt und mit unbeteiligtem Gesichtsausdruck schob sie sich an den Menschen vorbei, um zu den Gepäckwagen zu gelangen. Dort winkte sie nach einem der Dienstmänner, die herumstanden und auf Aufträge warteten. Als sie dem Träger ihren Koffer zeigte, der gerade ausgeladen wurde, drängelte sich ein Mann in ihre Richtung.
Er hatte ein kleines Oberlippenbärtchen, war recht beleibt und trug einen schäbigen Mantel.
Jetzt schnauzte er den Gepäckträger an, der gerade Josephines Koffer auf seinen Handkarren wuchten wollte, und bedeutete ihm mit einer herrischen Geste zu warten.
Josephine straffte die Schultern, und ihre Finger glitten flüchtig über den glatten Leib der Schlange um ihren Hals. Der Mann hatte einen Fotoapparat um den Hals hängen und Notizblock und Bleistift in der Hand, daher vermutete sie, dass es ein Journalist war. Offenbar war ihre frühere Ankunft nicht so geheim geblieben, wie sie gehofft hatte. Der Mann war ihr unsympathisch, und sie hatte keinerlei Bedürfnis, mit ihm zu sprechen. Sie sah sich um, überlegte, ob sie einfach im Gedränge verschwinden sollte, doch da sprach er sie bereits an.
»Josephine Baker!«, rief er laut, um dann in einem grauenhaften Englisch mit hartem deutschen Akzent zu fordern: »Ehlers, vom Völkischen Kurier. Unsere Leser hätten ein paar Fragen an Sie!«
Als die Umstehenden ihren Namen hörten, wurden sie aufmerksam und wandten sich ihnen zu. Noch immer war Josephine versucht, weiterzugehen und so zu tun, als ob sie nicht gemeint wäre, aber als einzige Schwarze weit und breit wäre dies wenig glaubwürdig. Daher fügte sie sich dem Unausweichlichen und wandte sich dem Mann zu.
»Ja, bitte?«, fragte sie und spürte, wie um sie herum immer mehr Menschen stehen blieben. Es wurde aufgeregt getuschelt, und schnell bildete sich ein Kreis aus Neugierigen um sie und den Journalisten.
»Sie beabsichtigen, hier bei uns in der Stadt aufzutreten?«, fragte der Mann und kniff seine eng stehenden blassblauen Augen zusammen.
Josephine nickte. »Ja. Wir wurden für das Nelson-Theater engagiert.«
»Engagiert, ja, mag sein!« Der Mann lachte verächtlich auf. »Aber glauben Sie wirklich, dass hier in Berlin jemand diesen Schmutz sehen will?«
»Schmutz?« Josephine runzelte die Stirn. »Ich verstehe nicht …«
»Ich hörte, Sie tanzen nackt! Wie ein Tier!«
Bevor Josephine antworten konnte, fuhr der Journalist mit vor Empörung bebender Stimme fort: »Eine Schande ist das! Wir sind doch hier nicht in einem Negergral in Afrika!«
Offenbar verstanden einige der zuhörenden Passanten Englisch, denn Josephine hörte, wie jemand laut klatschte, und einige nickten zustimmend. Die meisten jedoch starrten nur schweigend auf ihre Fußspitzen oder musterten sie verstohlen.
Josephine hob das Kinn, lächelte und sah dem Journalisten dabei direkt in die Augen.
»Wissen Sie, Mister, wie ich mir eine ideale Welt vorstelle? Es wäre eine Welt, in der alle Menschen nackt leben könnten, genau wie im Paradies.« Sie musterte den feisten Mann provozierend langsam von oben bis unten. Als ihr Blick an seinem ausladenden Bauch angekommen war, fügte sie mit einer komischen Grimasse des Bedauerns hinzu: »Aber leider können sich nur sehr wenige Menschen nackt zeigen.«
Der Journalist lief puterrot an, und als jemand in der Menschenmenge, die sie umgab, zu lachen begann, fielen andere mit ein.
Josephine lächelte.
5
In dem Moment, in dem er sie sah, beschlich Tristan eine Ahnung, dass dieser Auftrag womöglich komplizierter werden könnte, als er vermutet hatte. Nach der denkwürdigen Unterredung mit seinem Onkel waren ihm zum ersten Mal die vielen Plakate an den Litfaßsäulen aufgefallen, mit denen die »Negerrevue«, in der Josephine Baker auftreten würde, beworben wurde. Darauf war sie breit grinsend, mit lang gezogenen, gummiartigen Gliedern, großen Ohrringen und mit nichts als einem kleinen Baströckchen bekleidet dargestellt. Eine lustige schokoladenbraune Biegepuppe umgeben von grotesk überzeichneten schwarzen Musikern, die nur aus rollenden Augen und riesigen Mündern zu bestehen schienen.
Die echte Josephine Baker war jedoch vollkommen anders. Auf den ersten Blick erkannte Tristan, dass sie genau das war, was sein Onkel gesagt hatte: ein Star. Sie trug teure Kleidung, einen Mantel mit Pelzkragen, silberfarbene Schuhe, schimmernde Strümpfe und hielt ihren Kopf selbstbewusst erhoben, obwohl alle Leute sie anstarrten wie ein Tier im Zoo. Sie war elegant, und vor allem war sie schön. Nicht auf diese grelle, aufdringliche Art, die er erwartet hatte. Tristan konnte nicht sagen, was ihre Schönheit ausmachte, und er suchte vergeblich nach Begriffen, es zu beschreiben. Die junge Frau schien ein Leuchten zu umgeben, das sie von allen anderen Leuten um sie herum abhob. So als wäre sie die einzige scharf gezeichnete Figur in einem abstrakten Gemälde. Und keinesfalls sah sie wie eine Varietétänzerin aus.
Tristan schob sich unauffällig durch die Menge, bis er fast neben ihr stand. Als ein schmieriger Kerl, der sich als Journalist vorstellte, begann, sie zu beleidigen, wollte er einschreiten, doch dann zeigte sich, dass es nicht nötig war. Josephine Baker konnte sich offenbar ganz gut alleine wehren. Mit wenigen Sätzen parierte sie den Angriff und lächelte dabei auch noch. Während die Umstehenden, die das Gespräch verfolgt hatten, lachten, verstummte der Schreiberling, das Gesicht rot vor Zorn und Scham. Er zog sich etwas zurück, doch als Josephine Baker sich in Begleitung des Dienstmanns zum Ausgang aufmachte, ging er in einigem Abstand hinter ihr her. Er machte sich nicht die Mühe, sich umzusehen, sonst hätte er bemerkt, dass Tristan, der sich ebenfalls in Bewegung gesetzt hatte, ihn nicht aus den Augen ließ.
Während der Gepäckträger Mühe hatte, den Handkarren an den vielen Leuten vorbeizubugsieren, und er und seine Kundin deshalb nur langsam vorankamen, bog der Journalist plötzlich Richtung Ostflügel des Bahnhofs ab. Einen Augenblick hin- und hergerissen, wem er folgen sollte, entschied sich Tristan für den Schmierfinken und wandte sich ebenfalls nach rechts. Er fand, dass dieser Armleuchter eine kleine Abreibung verdient hatte. Sie würde ihn davon abhalten, Josephine Baker noch einmal zu nahe zu treten.
In diesem wenig genutzten Teil des Bahnhofs war das Licht spärlicher, und die hohen Rundbögen aus Backstein, die die Flanken der Halle begrenzten, schienen schwarz und leer wie tote Augenhöhlen. Allerdings war es hier keineswegs so verlassen, wie es auf den ersten Blick wirkte.
Während Tristan dem Mann mit sicherem Abstand folgte, nahm er hie und da eine verstohlene Bewegung wahr, sah das Aufflammen eines Streichholzes, hörte leises, lustvolles Stöhnen. Irgendwo hustete jemand und spuckte qualvoll aus, und es klang, als würde dessen Urheber nur noch auf der Erde weilen, weil der Teufel ihn vergessen hatte.
Dennoch war kein Mensch zu sehen. Die Schritte des Journalisten klangen laut und aufdringlich in dieser gedämpften, verborgenen Welt, und Tristan begann sich zu fragen, wo der Kerl überhaupt hinwollte. Ein paar Meter weiter erhielt er die Antwort. Der Journalist blieb stehen. Leise sprach er mit einer Gestalt im Schatten, und wenig später sah Tristan, wie er eine braune Papiertüte erhielt, die er sich hastig in die Innentasche seines Mantels schob.
Koks, vermutete er. Das passte zu diesem Typen. Tristan wartete, bis die beiden das Geschäft abgewickelt hatten, und als der Mann weiterging, schloss er lautlos auf. Am nächsten Rundbogen rempelte er den Journalisten an, und als der fette Kerl ins Straucheln kam, packte er ihn am Kragen und presste ihn grob gegen die Backsteinmauer. Mit dem Unterarm drückte er ihm auf die Kehle, und während der Mann würgend nach Luft schnappte, flüsterte Tristan ihm ins Ohr: »Ich will keinen solchen Auftritt mehr erleben, solange das Fräulein hier in der Stadt ist. Sie steht unter meinem persönlichen Schutz. Kannst du weitersagen.«
Dann verpasste er ihm einen Magenschwinger, der ihn ächzend in die Knie gehen ließ, und setzte, als er sich gerade wieder aufgerichtet hatte, einen satten Kinnhaken hinterher. Der Mann fiel um wie ein gefällter Baum und rührte sich nicht mehr.
Tristan sah sich kurz um, dann durchsuchte er flink die Taschen des Bewusstlosen und schob alles ein, was er fand, auch die braune Tüte. Das Ganze hatte weniger als eine Minute gedauert. Ebenso lautlos, wie er den Journalisten verfolgt hatte, lief er in Richtung Ausgang.
* * *
Josephine trat aus dem Bahnhofsgebäude hinaus. Der Wind pfiff ungemütlich nasskalt und wehte ein paar einzelne Schneeflocken vor sich her. Sie schloss mit der Hand den Kragen ihres Mantels, um Kiki vor der kalten Luft zu schützen, und sah sich um. Der Bahnhofsvorplatz entpuppte sich – mit Ausnahme einer kleinen Grünfläche mit ein paar kahlen Bäumen – als eine riesige Kreuzung, auf der lärmend der Verkehr toste. Straßenbahnen fuhren vorbei und spuckten an den Haltestellen Trauben von Leuten aus. Automobile schossen um die Kurven, hupten Pferdefuhrwerke und Radfahrer an, Fußgänger hasteten kreuz und quer über die Straßen. Auf der dem Bahnhof gegenüberliegenden Seite säumten herrschaftliche Häuser und noble Hotels den Platz. Excelsior, stand in Leuchtschrift an einer der Fassaden.
Der Gepäckträger, der mit seinem Handkarren neben ihr stand, deutete nach rechts, und als sie mit ihrem Blick seiner ausgestreckten Hand folgte, atmete sie erleichtert auf. Nur wenige Meter entfernt standen Taxis.
Sie gab dem Dienstmann seinen Lohn. Er lud ihren Koffer ab, verabschiedete sich mit einem knappen, aber nicht unfreundlichen Tippen an seine Uniformmütze und zog mit seinem Handkarren wieder ab.
Josephine begann, in ihrer Handtasche nach dem Notizzettel mit der Adresse der Pension zu suchen, doch sie fand ihn nicht. Der Zusammenstoß mit dem Journalisten hatte sie stärker beunruhigt, als sie vor sich selbst zugeben mochte. Er war so hasserfüllt gewesen. Was, wenn er recht hatte und sie in Berlin wirklich niemand sehen wollte? Wenn man sie bei ihren Auftritten ausbuhte und mit faulen Eiern bewarf? Ihr war so etwas gottlob noch nie passiert, doch sie kannte es aus Erzählungen der anderen und hatte dabei jedes Mal gedacht, sie würde mit Sicherheit auf der Stelle sterben, wenn ihr das einmal geschehen sollte. Josephine liebte das Publikum und wollte auch von ihm geliebt werden.
Endlich fand sie den Zettel, und sie umschloss ihn fest mit ihrer Hand. Dann kamen ihr erneut Bedenken. Hoffentlich nahmen die Taxis sie überhaupt mit. Vielleicht gab es hier Regeln für Schwarze, wie in Amerika, und sie durfte gar nicht erst einsteigen? Als sie letztes Jahr in Frankreich angekommen war, war sie vollkommen überrascht gewesen, wie selbstverständlich man sie dort akzeptierte. Schwarze durften in allen Hotels übernachten, wurden in jedem Café und jedem Restaurant bedient, durften dieselben Toiletten wie die Weißen benutzen, und auch im Zug gab es keine abgetrennten Abteile mit harten Holzbänken für Leute wie sie.
Eben am Bahnsteig hatte sie das Starren der Passanten und der Journalist mit seinen Beleidigungen für einen Moment in ihr altes Leben zurückversetzt. Ein Leben, dem sie entkommen zu sein glaubte. Nein. Dem sie entkommen war. Mit ihrer freien Hand nahm sie ihren Koffer und ging entschlossen auf die wartenden Taxis zu.
In diesem Moment kam ein Mann mit langen Schritten auf sie zugelaufen.
»Miss Baker?« Er war ein wenig außer Atem.
Sie blieb stehen und musterte ihn misstrauisch. Anders als der Journalist vom Bahnsteig sah er zumindest sympathisch aus mit seinen rötlichen Haaren, den graublauen Augen und dem schmalen Gesicht, das allerdings etwas zerschrammt war. Oberhalb der rechten Augenbraue klebte ein Pflaster.
»Ja?«
»Es tut mir leid, ich bin ein bisschen zu spät«, sagte er in einwandfreiem, unverkennbar britischem Englisch. »Ich wurde aufgehalten.«
»Wer sind Sie?«
Er lüpfte seine Schiebermütze und lächelte. »Mein Name ist Nowak. Ich bin für die Dauer Ihres Aufenthalts in der Stadt Ihr Fahrer.«
6
Graf von Seidlitz war mit Paul Ballin, seinem Sekretär und heimlichen Lebensgefährten, im Romanischen Café verabredet. Das im neoromanischen Stil gehaltene, etwas düster wirkende Lokal mit seinen hohen Räumen, holzvertäfelten Wänden und den reich verzierten Säulen war ein beliebter Treffpunkt unter Intellektuellen, Künstlern und vor allem auch solchen, die es werden wollten. Um die Etablierten vor den Belästigungen derjenigen zu verschonen, die versuchten, deren Aufmerksamkeit zu erregen, waren die Räumlichkeiten aufgeteilt, was spöttisch »Schwimmer-« und »Nichtschwimmerbassin« genannt wurde. Das Nichtschwimmerbassin, ein großer Raum mit Blick auf den Auguste-Viktoria-Platz, und die Gedächtniskirche, war offen für alle, sogar für Touristen.
Von Seidlitz ging selbstverständlich nach nebenan ins kleinere, intimere »Schwimmerbassin«, wo Paul ihn schon erwartete. Er saß an einem der Fenster, die zum Kurfürstendamm hinausgingen, rauchte Zigarillo und nippte an seinem obligatorischen Glas Absinth. Als von Seidlitz eintrat, sah er erwartungsvoll auf, wartete jedoch mit seinen Fragen, bis dieser Mantel und Hut abgegeben und sich gesetzt hatte.
Der Kellner brachte von Seidlitz einen Kognak, von dem er erst einen großen Schluck nahm und sich dann eine Players Navy Cut anzündete. Der Graf rauchte nur englische Zigaretten, die er sich direkt aus England schicken ließ, und dies nicht nur aus Geschmacksgründen. Während des Krieges war in Deutschland alles Ausländische verpönt gewesen, englische Namen von Bars und Restaurants wurden vaterländisch umbenannt und ausländische Zigarettenpackungen mit schwarz-weiß-roten Banderolen überklebt. Von Seidlitz, dessen Mutter aus England stammte und der in Frankreich aufgewachsen und in England zur Schule gegangen war, hatte dies unerträglich albern gefunden und auf diese Weise dagegen protestiert. Es hatte mitunter scheele Blicke unter seinen vaterländisch gesinnten Bekannten gegeben, auch die eine oder andere vorwurfsvolle Bemerkung. Im Allgemeinen hatte man es jedoch toleriert, wie so manch andere »liberale Absonderlichkeit« des Grafen: seine zahlreichen Bekanntschaften mit Künstlern und anderen zweifelhaften Subjekten oder, neuerdings, sein leidenschaftliches Engagement für die Sozialdemokraten und die Demokratie, was ihm den Spitznamen »Roter Graf« eingebracht hatte. Man tat es als typisch englischen Spleen ab und zog vor, es zu ignorieren. Der Graf war zu einflussreich und hatte zu viele Kontakte, um es sich mit ihm ohne Not zu verderben.
»Und?«, fragte Paul. »Wie ist es gelaufen?«
Von Seidlitz hob die Schultern. »Er macht es.«
»Aber das ist doch gut, oder?«, sagte Paul. »Das wolltest du doch?«
Von Seidlitz blies den Rauch aus und sah zu, wie er in einem dünnen Faden langsam zur hohen Decke aufstieg. »Ja.«
»Was ist los?«, wollte Paul wissen. »Gab es ein Problem?«
»Eines? Die ganze Sache ist ein einziges Problem«, murmelte von Seidlitz düster und nahm noch einen Schluck. Er musterte Paul eine Weile unschlüssig.
Paul Ballin war zweiunddreißig, also nicht viel älter als sein Neffe, aber die beiden hätten unterschiedlicher nicht sein können. Paul kümmerte sich um den kleinen Verlag, den von Seidlitz mehr als Hobby denn als Broterwerb betrieb und der teure, edel gestaltete Kunstbücher, ausgewählte Lyrik und Klassiker in kleiner Auflage herausbrachte, und war darin ganz in seinem Element. Er war kunstsinnig und ein Ästhet, hatte feine Gesichtszüge, dunkle Haare, die er immer etwas zu lang trug, und war stets nach der neuesten Mode gekleidet. Sein bissiger Humor und sein Scharfsinn waren bei ihren gemeinsamen Freunden gefürchtet, und das war es, was von Seidlitz an ihm besonders schätzte.
Paul hatte durchaus auch dunkle Seiten, doch er war ehrlich, sagte immer, was er dachte, und, was am wichtigsten war, er war unbedingt loyal.
»Ich habe ihn angelogen«, gestand von Seidlitz schließlich. »Ich habe behauptet, ich würde im Auftrag der Regierung handeln.«
»Nicht sehr klug, so eine Geschichte mit einer Lüge zu beginnen«, gab Paul trocken zurück.
»Es ist nicht ganz falsch«, beharrte von Seidlitz. »Immerhin habe ich mit Fritz Lemmau darüber gesprochen.« Das stimmte. Von Seidlitz hatte den Reichstagsabgeordneten gewarnt und dringend aufgefordert, entsprechende Schritte zu unternehmen, doch Lemmau hatte sich geweigert. Für ihn gab es keine ausreichenden Beweise, und ohne solche wollte er sich wegen dieser Tänzerin nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Er fürchtete, damit womöglich die konservativeren Mitglieder seiner eigenen Partei zu verärgern.
Auch wenn von Seidlitz wütend über diese feige Zurückhaltung gewesen war, die so typisch für den Zauderer Fritz Lemmau war – was er ihm auch unverblümt ins Gesicht gesagt hatte –, hatte er es ihm nicht einmal richtig verdenken können. Er hatte dem Abgeordneten nicht mehr als vage Gerüchte, ein paar angeblich mitgehörte Sätze und eine böse Ahnung präsentieren können und gehofft, dies und das Gewicht seiner Person würden reichen, um Lemmau zum Handeln zu bewegen.
Seine tatsächlichen Quellen preiszugeben, zu sagen, was er von wem erfahren und warum man es ausgerechnet ihm zugetragen hatte, hätte Fragen nach sich gezogen. Gefährliche Fragen, die er nicht beantworten konnte, ohne sich selbst und andere in Gefahr zu bringen. Von Seidlitz brauchte dies seinem Freund nicht erklären. Paul wusste Bescheid.
Aus besagten Quellen hatte der Graf schon vor einiger Zeit erfahren, dass von deutschnationaler Seite ein Anschlag geplant war, allerdings nicht, wann und wo, und vor allem nicht, wer die Zielperson sein würde. Am Ende war es Paul gewesen, der ihm gesagt hatte, dass es sich dabei um die amerikanische Tänzerin Josephine Baker handeln könnte.
Von Seidlitz hatte nicht weiter nachgefragt, wer jene Frau war, die Paul davon erzählt hatte, und wie die beiden zueinander standen. Er hatte es nicht so genau wissen wollen. Wie er von dem Leben, das Paul – mehr oder weniger diskret – neben ihrer langjährigen Beziehung noch führte, ohnehin so wenig wie möglich wissen wollte. Paul brauchte diese Abwechslung, das Abenteuer, und er machte keinen Hehl daraus. Von Seidlitz akzeptierte es, mal mehr, mal weniger gelassen. Weil er Paul liebte. So einfach war das. Und so kompliziert.
Pauls Worte rissen ihn zurück in die Gegenwart:
»Lemmau! Diese Memme. Es war völlig sinnlos, mit dem zu reden. Das habe ich dir von Anfang gesagt, Henry. Der bewegt sich erst, wenn ihn die Nationalen mit vorgehaltenem Karabiner aus dem Reichstag jagen.« Er trank seinen Absinth aus und winkte dem Kellner, ihm ein weiteres Glas zu bringen.
»Wie auch immer. Tristan hätte es nicht gemacht, wenn er gewusst hätte, dass es mein Geld ist, mit dem er bezahlt wird«, sagte von Seidlitz bedrückt. »Er hat schon meinen Wagen, den ich ihm für die Zeit überlassen habe, nur mit allergrößtem Widerwillen genommen. Er hasst mich.«
»Was hast du erwartet?«
Von Seidlitz drehte seine Zigarette sorgfältig am Rand des Aschenbechers und vermied es dabei, Paul anzusehen. Natürlich hatte er sich mehr erwartet. Oder wenigstens irgendetwas. Ein winziges Gefühl von Verbundenheit, einen kleinen Funken Hoffnung auf Vergebung. Aber da war nichts gewesen. Sein Neffe hatte sich so abweisend, so voll kalter Verachtung gezeigt, dass es von Seidlitz lieber gewesen wäre, er hätte ihn beschimpft oder wäre auf ihn losgegangen. Dabei sah der Junge seiner Mutter so ähnlich, dass es fast schon unheimlich war. Die gleichen Augen, die gleichen widerspenstigen rötlich braunen Haare, das schmale Gesicht mit dem energischen Kinn. Und die gleiche Haltung. Stur, eigensinnig und zu stolz, um sich helfen zu lassen.
»Versuch, ihn zu verstehen«, sagte Paul jetzt. »Es muss ein Schock gewesen sein, als du plötzlich nach so vielen Jahren auf der Wache aufgetaucht bist.«
Von Seidlitz nickte. »Das war nicht sehr geschickt von mir. Aber die Zeit drängte, und ich hatte keine Wahl.«
Das stimmte nicht ganz, und beide wussten es, doch Paul war taktvoll genug, nichts zu sagen. Es hätte in den vergangenen Jahren genug andere Möglichkeiten gegeben, mit seinem Neffen wieder in Kontakt zu treten. Doch von Seidlitz hatte es nicht gewagt. Er hatte erst einen Vorwand gebraucht, und diese Geschichte hatte ihn geliefert.