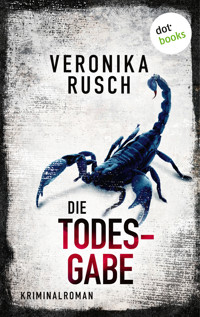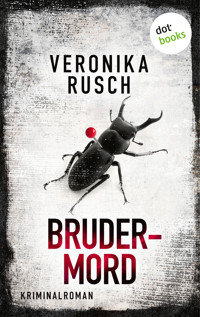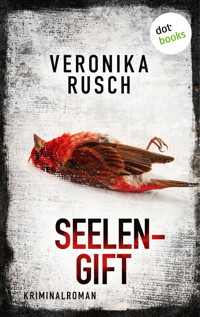9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Heldinnen des Alltags
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Berlin, 1908. In der Mission am Schlesischen Bahnhof finden die Verzweifelten, die mit der Hoffnung auf ein besseres Leben in die Großstadt strömen, Schutz. Hier führt das Schicksal auch zwei junge Frauen zusammen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: die mittellose Abenteuerin Natalie — und Alice, die aus gutem, großbürgerlichem Hause stammt, sich aber mit der Rolle der behüteten Haustochter nicht zufriedengibt. Gemeinsam helfen sie, wo sie nur können. Dabei ist Natalies zupackende Art Gold wert, denn die Menschen vertrauen ihr. Doch bald zeigt sich, dass nicht alle mit dem wohltätigen Tun einverstanden sind. Irgendjemand sieht seine Geschäfte mit den Schutzbedürftigen gestört ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 544
Ähnliche
INHALT
ÜBER DAS BUCH
Berlin, 1908. In der Mission am Schlesischen Bahnhof finden die Verzweifelten, die mit der Hoffnung auf ein besseres Leben in die Großstadt strömen, Schutz. Hier führt das Schicksal auch zwei junge Frauen zusammen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: die mittellose Abenteuerin Natalie – und Alice, die aus gutem, großbürgerlichem Hause stammt, sich aber mit der Rolle der behüteten Haustochter nicht zufriedengibt. Gemeinsam helfen sie, wo sie nur können. Dabei ist Natalies zupackende Art Gold wert, denn die Menschen vertrauen ihr. Doch bald zeigt sich, dass nicht alle mit dem wohltätigen Tun einverstanden sind. Irgendjemand sieht seine Geschäfte mit den Schutzbedürftigen gestört …
ÜBER DIE AUTORIN
Veronika Rusch ist Jahrgang 1968. Sie studierte Rechtswissenschaften und Italienisch in Passau und Rom und arbeitete als Anwältin in Verona, sowie in einer internationalen Anwaltskanzlei in München, bevor sie sich selbständig machte. Heute lebt sie als Schriftstellerin mit ihrer Familie in ihrem Heimatort in Oberbayern. Neben Romanen schreibt sie Theaterstücke für Erwachsene und Kinder sowie Dinner-Krimis. Für ihre Krimikurzgeschichte Hochwasser erhielt sie 2009 den zweiten Preis im Agatha-Christie-Krimiwettbewerb.
VERONIKA RUSCH
ALLER TAGE HOFFNUNG
DIEBAHNHOFSMISSION
ROMAN
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © Veronika Rusch
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München
Copyright © 2023 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Katharina Rottenbacher, Berlin
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de
Einband-/Umschlagmotive: © Adobestock: Victor zastol’skiy; / © iStock / Getty Images Plus: Daria Bayandina | LiuSol
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-2857-7
luebbe.de
lesejury.de
1
BERLIN, 4. SEPTEMBER 1908
Wie hässlich lachende Menschen sind, dachte das kleine Mädchen, während sie die Zuschauer betrachtete, die im Halbkreis um sie herumstanden. Ihre aufgerissenen Münder waren rote Höhlen, in denen fleischige Zungen lagen und schadhafte, schiefe Zähne standen davor wie kaputte Zäune. Sie ekelte sich vor ihnen. Dabei war es gut, dass die Menschen lachten, weil es bedeutete, dass sie heute Abend etwas zu essen bekommen würde.
Seit Tagen hatte es geregnet. Die alte Nuria mit ihrer Glaskugel hatte etwas von der Sintflut und den Heimsuchungen des jüngsten Tages gefaselt und sie damit zum Weinen gebracht, bis schließlich Claudine die Alte angefaucht hatte, sie solle gefälligst die Klappe halten, sonst würde sie ihr zeigen, was eine Heimsuchung sei. Das Mädchen schaute ängstlich in den Himmel. Die Regenwolken waren noch immer da, die Abendsonne streckte nur ganz vorsichtig ihre Finger dazwischen hindurch. Es war nur eine kurze Pause, doch Papa hatte beschlossen, sie zu nutzen und eine Vorstellung zu geben. Sie war eilig in ihr Harlekinkostüm geschlüpft, das schon so zerschlissen war, dass sie es nicht mehr zuknöpfen konnte, sondern es stattdessen mit einem Strick um den Bauch zubinden musste. Dann hatte sie ihr Tambourin mit den kleinen Glöckchen daran genommen und war hinausgelaufen, um die Menschen, die schon neugierig um den Lagerplatz herumschlichen, anzulocken, näher zu kommen. Der Wanderzirkus, mit dem sie unterwegs waren, seit sie denken konnte, lagerte auf einer Wiese vor einer kleinen Stadt und, Papa hatte gemeint, hier wären die Leute reich, hier wäre ein guter Platz für sie. Als sie angekommen waren, hatte auch alles hübsch ausgesehen, die Wiese mit den Bäumen drumherum, der Bach, der vorüberfloss, die hübschen grauen Steinhäuser und die große Kirche. Doch bereits in der Nacht ihrer Ankunft hatte es zu regnen begonnen und seitdem nicht wieder aufgehört. Niemand war gekommen, um ihren Aufführungen zuzusehen, und sie hatten kein Geld verdient, was Papa so wütend gemacht hatte, dass er seine leere Flasche Branntwein gegen die Wand ihres Wagens geworfen hatte, wo sie in tausend Stücke zerbrochen war. Das Mädchen hatte die Scherben schnell aufgesammelt, damit Papa sich nicht schnitt, denn das würde ihn noch wütender machen.
Es regnete nun seit sieben Tagen. Die Wiese hatte sich in einen Sumpf verwandelt, und auf ihrem Lagerplatz stand das Wasser knöcheltief. Es war dem Mädchen daher auch schwergefallen, zu hüpfen und zu springen, so wie sie es tun sollte, weil Harlekine das nun einmal taten. Ihre Schuhe waren zu groß und waren immer wieder im dunkelbraunen Matsch steckengeblieben. Dennoch blieben Leute stehen und sahen zu. Sie musste sich nicht zu der kleinen Bühne des Theaters hinter ihr umdrehen, um zu wissen, wie weit Papa mit der Geschichte war, sie kannte die ganze Geschichte auswendig und wusste auch, wann die Zuschauer wieder ihre Münder aufreißen und lachen würden. Das war ganz einfach. Bei den Erwachsenen genauso wie bei den Aufführungen für die Kinder. Nur dass sie bei den Aufführungen für die Erwachsenen nie so richtig verstand, weshalb die Leute lachten. Sie fand nichts von dem, was bei diesen Stücken passierte, richtig lustig, und Papa erklärte es ihr auch nicht. Sie hatte einmal danach gefragt, aber er hatte nur gelacht und gemeint, sie sei zu dumm, um das zu verstehen. Das war etwas verwirrend, denn Claudine sagte immer »Du bist die klügste kleine Kröte, die mir je untergekommen ist«, und kniff sie dabei grinsend in die Wange. So dumm konnte sie also nicht sein. Aber sie war eben noch klein, und vielleicht war man da auch noch dumm. Wenn man Papa glauben durfte, war sie ungefähr acht Jahre alt. Doch so sicher war das nicht, weil Papa nicht so gut war mit Zahlen und auch sonst viele Dinge vergaß oder durcheinanderbrachte.
Jetzt kam gleich der Moment, der am allerlustigsten war für die Erwachsenen. Sie lauschte Papas Stimme, die kaum wiederzuerkennen war, wenn er spielte. Er konnte sich in alle Figuren seines Stücks verwandeln und redete jedes Mal mit einer anderen Stimme, mal sanft und liebenswürdig, mal gemein und böse. Gerade als die Stelle kam, wo die Leute wieder lachen würden, traf sie ein dicker Regentropfen im Gesicht und sie erstarrte. Nein. Es durfte jetzt nicht regnen! Sie ließ ihr Tambourin fallen, mit dem sie besondere Stellen im Stück immer begleitete, zum Beispiel wenn zwei Figuren tanzten, oder wenn es spannend wurde, und drehte sich um, um die Blechbüchse zu holen, die neben der Bühne bereitstand. Damit ging sie am Ende immer herum und sammelte das Geld ein, das die Leute zu geben bereit waren. Wenn sie genug gelacht und sich womöglich sogar auf die Schenkel geklopft hatten, waren sie spendabler, als wenn sie nicht lachten. Heute hatten sie viel gelacht, aber nun kam der Regen und der würde alles kaputt machen. Das Geld einzusammeln war ihre allerwichtigste Aufgabe. Dafür war sie auf der Welt, sagte Papa immer. Das war ihre Arbeit, mit der sie sich etwas zu essen verdiente. Kein Geld, kein Essen, so einfach war das. Das verstand man, auch wenn man erst acht Jahre alt und dumm war.
Bis sie sich die Büchse geschnappt hatte, war der Regen stärker geworden. Sie wirbelte wieder herum und begann zu laufen, auf die Leute zu, die bereits anfingen, wegzugehen, die Krägen hochgeschlagen, die Köpfe unter dem beginnenden Regen geduckt. Ihre Schuhe blieben im Matsch stecken, zuerst der eine, dann der andere, sie schlüpfte heraus und lief barfuß weiter, auf die Leute zu. Dabei schüttelte sie die Büchse, in der ein paar Kieselsteine lagen, damit es so klang, als sei bereits Geld darin, doch es regnete bereits zu stark, die Menschen beachteten sie nicht mehr, egal wie auffordernd sie ihnen die Büchse vor die Nase hielt. Sie rempelten sie an, schoben sie zur Seite und flüchteten unter die schützenden Dächer der Häuser. Das Mädchen blieb zurück. Der Regen tropfte ihr ins Gesicht und in den Kragen ihres zerschlissenen Kostüms und machte leise Tropfgeräusche auf der leeren Blechbüchse. Auf dem Deckel war eine Tänzerin abgebildet, mit einem grünen Prinzessinnenkleid und schwarzen Haaren, die fast bis zum Boden reichten, und das Mädchen stellte sich oft vor, dass das ihre Mutter sei. Die Tänzerin lächelte aufmunternd, doch das tröstete das Mädchen nicht. Es würde heute Abend nichts zu essen geben. Und morgen früh auch nicht. Höchstens ein Glas Milch bei Claudine, wenn es ihr gelang, sich davonzuschleichen. Papa hatte ihr verboten, bei anderen Leuten etwas zu essen oder zu trinken. Wir sind Puppenspieler, keine Bettler, sagte er immer und wurde sehr wütend, wenn er erfuhr, dass sie nicht gehorchte und ein Stück Brot oder ein Glas Milch annahm.
Sie trottete zurück zur Theaterbühne, wo Papa aufgehört hatte zu spielen. Ihre nackten Füße waren kalt, und zwischen den Zehen drückte sich bei jedem Schritt der Schlamm nach oben. Es klang genauso wie das Geräusch, wenn die alte Nuria, die kaum noch Zähne hatte, ein Stück Weißbrot aß, irgendetwas zwischen Schmatzen und Saugen. Sie war gerade bei ihren Schuhen angelangt, als Papa hinter der Bühne hervorkam. Sie hörte seine schweren Schritte auf sie zukommen, sah jedoch nicht auf, sondern hielt den Blick fest auf ihre Lederschuhe gerichtet, die halb im Schlamm steckten. Als er bei ihr angelangt war, konnte sie seinen Atem riechen, der nach Branntwein roch, den Schweiß und den kalten Rauch der Zigaretten, der immer in seiner Kleidung hing. Er riss ihr die Blechbüchse aus der Hand und öffnete sie. Das Mädchen hörte die Steine darin herumkullern. Dann hörte sie ihn fluchen. Es klang wie das Knurren eines bösen schwarzen Hundes. »Du warst zu langsam. Wieder mal. Du kleines Stück Scheiße taugst einfach zu gar nichts«, knurrte der schwarze Hund, zu dem Papa geworden war und warf die Blechbüchse auf den Boden. Obwohl sie sich duckte, traf sein Schlag sie mit voller Wucht. Sie taumelte, fiel hin und landete mit dem Gesicht im Matsch. Kalter, nasser Schlamm drang ihr in Augen und Mund. Sie spürte ihn rau und kratzig zwischen ihren Zähnen, es schmeckte nach Erde und Moder und vermischte sich mit dem Geschmack von Eisen, als das Blut aus ihrer aufgeplatzten Lippe drang. Irgendwann kamen die Tränen dazu.
Natalie betrachtete prüfend ihre Zähne im Spiegel. Sie waren schwarz von dem Zahnpulver, das sie benutzte, eine Mischung aus zerstoßener Holzkohle, Schlämmkreide und ein paar Tropfen Nelkenöl. Dieses Pulver erinnerte sie jeden verfluchten Morgen an damals. An den Moment, als ihr Vater sie wegen der leeren Blechbüchse verprügelt und sie den Mund voller Schlamm gehabt hatte. Schon oft hatte sie sich vorgenommen, endlich eine dieser neuen, sündhaft teuren Zahncremes zu kaufen, die in den Zeitungen angepriesen wurden. Sie hießen Kalodont und Odors Zahncreme und versprachen »aromatisch erquickend« und zudem hilfreich gegen Zahnschmerzen und Zahnpilz zu sein. Natalie hatte weder Zahnschmerzen, noch konnte sie sich vorstellen, was ein Zahnpilz sein sollte, es ging ihr nur darum, weiße Zähne zu haben und sie so lange wie möglich zu behalten. Ihr selbstgemachtes Zahnpulver leistete ihr dabei seit Jahren gute Dienste. Wenn nur die Erinnerungen nicht wären. Aber vielleicht rief sie diese Erinnerungen auch absichtlich herbei, jeden Morgen aufs Neue, denn anders war es nicht zu erklären, dass sie noch nie zugegriffen hatte, wenn sie in der Drogerie die Zahncremes hatte liegen sehen, ordentlich aufgereiht, daneben ein Aufsteller aus Pappe, auf dem stand: »Anerkannt bestes, unentbehrliches Zahnputzmittel«. Am Geld lag es nicht, obwohl 70 Pfennige für eine Tube schon Wucher waren. Vermutlich war es einfach das Richtige, bei ihrem altbewährten Zahnpulver zu bleiben: Es war preiswert und erinnerte sie daran, wo sie hergekommen war und wo sie nie wieder hinwollte.
Natalie goss Wasser aus dem Krug in den Becher und spülte ihre Zähne so lange und sorgfältig, bis auch der letzte Rest Kohle verschwunden war. Dann fuhr sie mit der Zunge prüfend darüber, freute sich an dem glatten, sauberen Gefühl und zog sich an. Seit einiger Zeit verzichtete sie auf ein Korsett, zumindest tagsüber. Es war einfach zu unpraktisch bei der Arbeit. Meistens trug sie Rock und Bluse, aber heute war ihr mehr nach einem Kleid zumute. Ihre Freundin Juliette, die Schneiderin war, hatte ihr ein sommerliches Alltagskleid genäht, das sie momentan am liebsten mochte. Es war schlicht, der Stoff robust, aber von einem schönen Blau, das gut zu ihren Augen passte, hatte duftige Keulenärmel und einen Rock, der ausreichend Bewegungsfreiheit bot, um rasch laufen, sich hinknien und bücken zu können. Als Natalie es sich übergestreift hatte, zog sie Schnürstiefel an, legte sich ein leichtes Wollcape um und setzte sich ihren Sommerhut auf, der ebenfalls blau war. Nie wieder in ihrem Leben würde sie verschlissene, schmutzige, stinkende Kleidung tragen, das hatte sie sich vor vielen Jahren schon geschworen. Nie wieder würde sie nach etwas anderem riechen als nach duftender Seife und Honigwasser in den Haaren. Sie warf einen letzten Blick in den Spiegel, der neben der Kommode mit der Waschschüssel an der Wand hing, und der so groß war, dass sie sich fast vollständig darin sehen konnte. Sie war vierzehn gewesen, als sie sich zum ersten Mal in einem Spiegel betrachtet hatte, vorher hatte sie gar nicht genau gewusst, wie sie aussah. Das war, nachdem es ihr gelungen war, ihrem Vater endgültig zu entkommen. Sie hatte ihr altes Leben abgestreift wie das zerschlissene Harlekinkostüm. Obwohl sie für ihr Alter sehr klein und mager war, war es ihr viel zu klein gewesen, doch ein neues gab es nicht. Sie hatte das Kostüm ohne Bedauern in dem schäbigen Wagen zurückgelassen, hatte das alte Pferd zum Abschied gestreichelt und war gegangen, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Natalie lächelte ihrem Spiegelbild zu und drehte sich dann übermütig um die eigene Achse. Der Stoff ihres neuen Kleides raschelte leicht, sie spürte einen feinen Luftzug an ihren bestrumpften Beinen und die Erinnerungen an früher verblassten wie ein rätselhafter Traum, den man nach dem Erwachen bereits vergessen hat. Das Sonnenlicht drang durch das Dachfenster und ließ das Zimmer hell erstrahlen. Das hier war ihr kleines Reich. Ihr Leben, das sie liebte und für das sie jeden einzelnen Tag dankbar war, sobald sie die raue Kohle des Zahnputzpulvers nicht mehr schmeckte. Nichts davon würde sie je wieder hergeben. Sie nahm die weiße Armbinde mit dem aufgestickten Johanniterkreuz von der Kommode, streifte sie sich über und ging an die Arbeit.
2
Alice lehnte ihre Wange an die vom Fahrtwind kühle Scheibe und sah hinaus. Saftig grüne Wiesen, auf denen Pferde grasten, zogen vorbei, gelbe Weizenfelder, zartblauer Himmel. Ein Greifvogel saß auf einem Holzgatter und musterte den vorüberfahrenden Zug ohne erkennbaren Schrecken, bevor er sich mit elegantem Schwung in die Lüfte erhob. Es war ein Rotmilan, wie Alice an den rotbraunen, gegabelten Schwanzfedern erkannte. Sie kannte nicht nur alle Vögel dieser Gegend und konnte ihre Rufe nachahmen, sie kannte auch die meisten der Pflanzen und wusste zu sagen, wofür man sie verwendete oder ob sie giftig waren. Ihr Onkel hatte ihr all das beigebracht, früher, als Kind, während der gemeinsamen Spaziergänge an der Oder. Damals hatten sie und ihre Schwester noch jedes Jahr die Sommerferien auf dem Gut ihres Onkels und ihrer Tante in Küstrin verbracht. Endlose Wochen, in denen sie durch die Flussauen gestreift waren und sie gar nicht genug von all den Dingen hatte bekommen können, die der Onkel über die Pflanzen und Tiere zu erzählen wusste.
Unnützes Wissen, dachte Alice bitter. Taugt nicht für eine junge Dame von Stand. Hilft nicht weiter, wenn es darum geht, einen Haushalt zu führen, Gesellschaften zu geben, Dienstboten zu beaufsichtigten. Sie seufzte leise und schloss die Augen. Sie hatten Küstrin vor etwa einer Viertelstunde verlassen und würden in knapp zwei Stunden in Berlin ankommen. Ihr graute davor. In der sommerschweren Trägheit des verschlafenen Garnisonsstädtchens, wo sie zusammen mit ihrer Schwester fast wie früher als Kinder die letzten Wochen bei Onkel und Tante verbracht hatte, war es ihr gelungen, den hässlichen Streit zu verdrängen, der ihrer Abreise vor sechs Wochen vorausgegangen war. Doch jetzt, als sie sich Berlin wieder näherten, unaufhaltsam in diesem gleichgültigen, eintönigen Rhythmus der Eisenbahn, kam auch die Erinnerung daran wieder zurück. »Unpassend!« Mit einem einzigen Wort hatte ihre Mutter den Kompromissvorschlag, was ihre Zukunft anbelangte, zunichtegemacht. Alice konnte nicht sagen, worüber sie sich im Laufe dieses Streits mehr aufgeregt hatte: über dieses lapidare, nichtssagende Wort, mit dem ihr Wunsch, wenn schon nicht Ärztin, dann doch wenigstens Krankenschwester werden zu dürfen, niedergebügelt worden war oder die Erkenntnis, dass sie nie eine Wahl gehabt hatte. Ihr Weg war von Anfang an vorgezeichnet gewesen, und alles, was sie sich selbst für ihr Leben ersehnte, was sie hoffte, wünschte und liebte, spielte dabei nicht die geringste Rolle. Es war »vollkommen unmöglich«, Medizin zu studieren, als Frau, und noch dazu, wenn der eigene Vater ein angesehener Arzt in der Charité und außerdem Universitätsprofessor war. Und aus demselben Grund war es auch »unpassend«, Krankenschwester zu werden. »Du willst doch deinen Vater nicht kompromittieren«, hatte ihre Mutter zutiefst entrüstet ausgerufen, als Alice diesen Wunsch geäußert hatte. »Was sollen denn die Leute denken, wenn die Tochter von Professor Hardtleben das Nachtgeschirr der Patienten leert?«
Alice hatte versucht, sachlich zu argumentieren. Zunächst brachte sie wider besseren Wissens noch einmal ein Medizinstudium ins Spiel und verwies auf all die Frauen, die bereits erfolgreich studierten, in der Schweiz, in Frankreich, Italien und sogar anderswo in Deutschland, weil es nur in Preußen noch immer nicht erlaubt war, und als sie damit erwartungsgemäß bei ihrer Mutter auf taube Ohren stieß, ging sie dazu über, den Beruf der Krankenschwester mit zahlreichen Argumenten ins beste Licht zu rücken. Sie sprach vom Dienst an der Gesellschaft, von dem hohen Ansehen, das Frauen in einem solchen Beruf genossen (taten sie das wirklich? Sie hatte keine Ahnung, aber es klang gut), zählte die vielen praktischen Aspekte auf, die es mit sich brachte, wenn man sich in der Krankenpflege gut auskannte. Als alles an der unnachgiebigen Miene ihrer Mutter abzuprallen drohte, schleuderte sie ihr schlussendlich als letzte Waffe ein Zitat ihres Vaters entgegen: »Frauen, die stumm und einfältig wie angemalte Püppchen in den Salons herumstehen, brauchen sich nicht zu wundern, wenn man sie mit einer Stehlampe verwechselt.« Die Tatsache, dass ihr dabei Tränen hilfloser Wut in die Augen traten und ihre Stimme hörbar zitterte, nahm der Argumentation an diesem Punkt allerdings ein wenig das Sachliche.
»Verdrehe deinem Vater nicht das Wort im Mund«, hatte ihre Mutter sie scharf zurechtgewiesen. »Du weißt, dass er genau deswegen Wert auf eine solide Bildung seiner Töchter legt. Du hast nicht nur Französisch und Literatur, sondern auch Latein, Philosophie und sogar Physik gelernt! Er möchte, dass du und deine Schwester selbstbewusste Mitglieder der Gesellschaft werdet und euren Teil leistet. Auf dem privilegierten Platz, der für euch vorgesehen ist. Alles andere ist Firlefanz.« Damit hatte sie das Gespräch beendet, und Alice war, türenknallend und in Tränen aufgelöst, auf ihr Zimmer gelaufen. Später am Abend hatte sie noch ein Gespräch der Eltern im Salon belauscht, in dem ihre Mutter sich beklagte, dass Alice »so viel schwieriger« sei als ihre ältere Schwester Constanze und man ihr womöglich zu viele Freiheiten gelassen habe.
»Warte nur ab, wenn erst einmal Constanzes Kind auf der Welt ist«, hatte ihr Vater erwidert. »Sobald sie das Kind in den Armen hält, wird Alice keinen Gedanken mehr an ein Studium oder gar eine Krankenschwesterausbildung verschwenden. Auf den Mutterinstinkt war schon immer Verlass.«
Das hatte Alice den Rest gegeben. Leise war sie die Treppe wieder hinauf in ihr Zimmer geschlichen und hatte bei jeder Stufe mit der ganzen Inbrunst ihrer achtzehn Jahre geschworen, dem Mutterinstinkt, sofern sie über Derartiges überhaupt verfügte, niemals Vorrang gegenüber ihren beruflichen Zielen einzuräumen.
Sie wandte den Kopf von der Scheibe und betrachtete ihre Schwester Constanze, die ihr gegenübersaß und in einer Zeitschrift blätterte. Sie hatte vor einem knappen Jahr geheiratet und war im vierten Monat schwanger. Man konnte bisher nur eine kleine Wölbung sehen, was vermutlich auch daran lag, dass Constanze noch immer ein Korsett trug, das sie zwar locker band, das aber dazu dienen sollte, ihre üppige Figur, die seit der Schwangerschaft ein wenig ausgeufert war, zu bändigen. Es ging ihr nicht gut, sie übergab sich jeden Morgen und auch untertags, hatte Kreislaufprobleme und litt unter Stimmungsschwankungen. Deshalb hatten ihre Eltern und Gottfried, Constanzes Mann, der Arzt wie ihr Vater war, angeregt, sie möge den Sommer lieber außerhalb der Stadt verbringen, wo die Luft besser war. Wenn sie im Herbst zurückkehrten, würden diese anfänglichen Probleme überwunden sein. Alice hatte nichts dagegen gehabt, ihre Schwester zu begleiten. Seit sie im letzten Jahr die Schule beendet hatte, langweilte sie sich fast zu Tode. Sie verstand nicht, wozu sie sich viermal am Tag umziehen und neu frisieren sollte, am Vormittag, zum Tee, zur Promenade, zum Abendessen, wenn doch ohnehin nie etwas Aufregendes geschah. Die endlosen Gespräche ihrer Freundinnen aus Schulzeiten über die neueste Mode, die Stoffe der Saison und welche Frisuren in Paris getragen wurden, ermüdeten sie, und wenn sie sich jetzt hin und wieder noch zum Tee trafen, gelang es ihr oft nur mit Mühe, ein Gähnen zu unterdrücken. Genauso erging es ihr mit jenem Thema, das über allen Modefragen und sonstigen Albernheiten schwebte: der Mann fürs Leben. Die meisten ihrer ehemaligen Mitschülerinnen waren bereits verlobt oder kurz davor, nur ihre Freundin Käthe und sie waren noch »auf dem Markt«, wie Käthe einmal mit bitterem Spott bemerkt hatte. Dies hatte dazu geführt, dass Alice und ihre alte Schulfreundin sich kaum noch sahen. Käthe und ihre Mutter waren viel zu sehr damit beschäftigt, ständig zur Schneiderin, zur Hutmacherin oder auf irgendwelche Gesellschaften zu gehen. Alice hingegen war es vollkommen gleichgültig, dass sie noch nicht verlobt war. Es war nicht so, dass sie sich nichts aus Männern machte. Sie hatte bisher einfach noch keinen kennengelernt, der sie interessiert hätte und der vor allem auch ihre Ansichten, etwa was Berufstätigkeit von Frauen anbelangte, teilte. Die jungen Männer, denen sie bisher begegnet war, waren ihr alle albern und einfältig erschienen, und dabei so geblendet von ihrer eigenen Herrlichkeit, dass es fast lächerlich war.
»In diesem Herbst sind Chevronstoffe en vogue!«, unterbrach Constanze Alices trübe Gedanken. Sie tippte auf eine Seite in der Zeitschrift. »Bei Wertheim ist schon die Ware aus England und Frankreich eingetroffen. Es gibt schöne Wollstoffe, Plaids und Messaline …«
Alice runzelte die Stirn. »Was?«
»Chevron, das bedeutet Zickzackmuster, Alice! Und Messaline ist Atlasgewebe.« Constanze seufzte. »Ich fürchte, das ist dieses Jahr beides nichts für mich. Ich sehe jetzt schon aus wie ein aus der Form gegangener Hefeteig, da ist Zickzack wohl nicht vorteilhaft. Dabei hätte ich so gerne einen Rock mit diagonalem Muster.«
»Nächstes Jahr kannst du so einen Rock sicher wieder anziehen«, tröstete Alice sie.
»Nächstes Jahr?« Constanze hob empört die Brauen. »Daran sieht man mal wieder, dass du keine Ahnung von Mode hast, Schwesterherz. Wer weiß schon, was nächstes Jahr getragen werden wird? Ich kann mir doch nicht in diesem Herbst einen Chevronstoff kaufen, um ihn im nächsten Winter zu tragen!«
»Oh Gott, nein! Wie unsäglich dumm von mir«, erwiderte Alice scheinbar schockiert.
Constanze betrachtete sie misstrauisch, und als Alice grinsen musste, schlug ihre Schwester lachend mit der Zeitschrift nach ihr. »Nimm mich nicht immer auf den Arm. Ich meine es ernst! Wir sind jung und hübsch – also, ich werde es, so Gott will, wieder sein – und da können wir doch nicht in alten Lumpen der letzten Saison herumlaufen!«
Alice schüttelte, noch immer lächelnd, den Kopf. »Nein, das können wir natürlich nicht.« Auch wenn Constanze ihr mit ihrer Oberflächlichkeit bisweilen auf die Nerven ging, sie liebte ihre lustige, lebhafte, ältere Schwester, die sich stundenlang über Nichtigkeiten ereifern konnte, sich dann aber nicht zu schade dafür war, auch über sich selbst zu lachen, bis ihr die Tränen kamen. Constanze war, im Gegensatz zu Alice, die für ihren Geschmack viel zu groß, zu eckig und zu dünn geraten war, tatsächlich sehr hübsch. Alles an ihr war rund und weich, sie hatte große blaue Augen mit langen Wimpern, üppiges, schokoladenbraunes Haar und einen rosigen Teint, normalerweise jedenfalls. Im Augenblick war davon schwangerschaftsbedingt leider nicht viel zu sehen. Obwohl sie nun sechs Wochen außerhalb der Stadt verbracht hatten, auf einem Gutshof mit großem Garten direkt an der Oder, waren ihr Gesicht blass und ihre Haare strähnig und kraftlos. Jetzt zuckte sie die Schultern und schlug die Zeitschrift wieder auf. Sie blätterte zu einer Seite, wo verschiedene Modelle abgebildet waren. »Lassen wir meine Wenigkeit mal beiseite. Ich werde nämlich in diesem Jahr sehr wohl in alten Lumpen der letzten Saison herumlaufen, denn die kann man schadlos so ändern, dass mein Riesenbauch darin Platz findet. Aber du solltest dir unbedingt etwas Neues zulegen. Lass mich dich ausstaffieren. Du brauchst unbedingt ein Kostüm in dieser neuen schlanken Linie, du hast die Figur dazu. Rot ist dieses Jahr sehr gefragt. Ein schönes, sattes Rotbraun würde gut zu deinen blonden Haaren passen …«
Alice nickte gutmütig und ließ sie reden. Bei Rotbraun musste sie wieder an den Raubvogel denken, den sie gerade gesehen hatte und der jetzt vermutlich hoch oben am Morgenhimmel seine Kreise zog. Wenn sie doch auch fortfliegen könnte, frei und ungebunden am Himmel schweben, niemandem verantwortlich, nur sich selbst …
Constanzes Begeisterung über ein rotbraunes Kostüm für ihre kleine Schwester, die, obwohl vier Jahre jünger, fast einen Kopf größer als sie war, währte jedoch nicht lange. Mitten im Satz unterbrach sie sich, schlug die Hand vor den Mund und presste undeutlich darunter hervor: »Mir ist übel.«
»Jetzt? So plötzlich?«, wunderte sich Alice, kramte aber fast schon reflexartig eine Papiertüte aus ihrer Handtasche, die sie in letzter Zeit immer dabei hatte, wenn sie mit ihrer Schwester unterwegs war. Constanze war furchtbar schusslig und vergaß immer, selbst welche einzupacken. Constanze nahm ihr die Tüte ab, beugte sich darüber und würgte, dann lehnte sie sich stöhnend zurück. »Himmel, verflucht noch mal, wie ich das hasse!«, stieß sie hervor und wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. »Heißt es nicht immer, die Schwangerschaft lässt die Frauen aufblühen? Davon merke ich nichts.«
»Du solltest dein Korsett weglassen«, riet Alice ihr. »Es ist zu eng. Vor allem, wenn es warm ist.«
Constanze gab keine Antwort. Sie stöhnte nur und wedelte sich mit ihrem Taschentuch Luft zu.
»Ich werde mal nachsehen, ob ich die Teemamsell aufspüre. Eine Tasse Tee wird dir sicher guttun«, schlug Alice vor, und Constanze nickte dankbar.
Der Speisewagen des Zuges, der aus Königsberg kam, war in Küstrin abgekoppelt worden, wie der Schaffner ihnen bei der Abfahrt erklärt hatte. Stattdessen gab es für die restliche Fahrt bis Berlin eine Frau mit einem Wagen, die in der ersten Klasse Tee ausschenkte und Gebäck und kleine Knabbereien anbot. Sie war vor etwa einer halben Stunde bei ihnen vorbeigekommen. Alice stand auf und trat durch die offene Abteiltür auf den Gang hinaus, auf dem sich Reisende, die keinen Sitzplatz mehr ergattert hatten, drängten. Der Zug war jetzt, zu Ende der Ferienzeit, sogar in der Polsterklasse ziemlich überfüllt, und es war nur der Umsicht ihrer Tante zu verdanken, die dem Schaffner etwas Geld zugesteckt hatte, dass sie in ihrem Abteil bisher alleine geblieben waren. Constanze hatte vor ihrer Abreise angesichts der Aussicht, sich womöglich im Beisein fremder Mitreisender übergeben zu müssen, fast eine Nervenkrise bekommen. Direkt gegenüber ihrem Abteil lehnte ein junger Offizier am Fenster und las in einem Buch. Er war mit ihnen eingestiegen, wie sie glaubte, sich zu erinnern. Vermutlich war er in Küstrin stationiert und hatte Urlaub. Als sie sich wegen einer Kurve, die der Zug gerade in diesem Moment nahm, direkt neben ihm abstützte, sah er von seiner Lektüre auf.
»Verzeihung«, murmelte Alice und sah sich nach der Frau mit dem Teewagen um.
»Kann ich Ihnen behilflich sein, gnädiges Fräulein?«, fragte er, doch sie schüttelte den Kopf. »Nein, danke, das ist sehr freundlich. Ich suche nur die Teemamsell. Meiner Schwester ist nicht ganz wohl, sie ist … in Erwartung.« Alice spürte, wie sie rot wurde, angesichts dieses unbeholfenen Ausdrucks. Aber wie sonst sollte man gegenüber einem fremden Mann Constanzes Zustand beschreiben?
Der Mann überlegte. »Ich glaube, sie ist in dieser Richtung weitergegangen«, sagte er und deutete nach rechts. »Aber sicher bin ich mir nicht. Ich war zu sehr in die Lektüre vertieft.« Er lächelte entschuldigend und hob sein Buch hoch.
»Das Herz der Finsternis«, las Alice den Titel. »Sie lesen Joseph Conrad?«
Der Offizier nickte. »Mit Begeisterung. Wobei Begeisterung nicht das richtige Wort ist. Dazu ist es zu …«, er suchte nach einem passenden Begriff.
»Beängstigend?«, schlug Alice vor. »Schwer zu ertragen?«
»Sie haben es gelesen?« Der junge Mann hob überrascht die Brauen.
Alice nickte. »Es hat mir ein paar Albträume beschert, muss ich zugeben. Aber die Sprache ist sehr eindrucksvoll.«
»Da haben Sie recht. Dennoch ist es wohl kaum die richtige Lektüre für eine junge Frau, mit all den dort beschriebenen Grausamkeiten …«
»Niemand sollte die Augen vor den Dingen verschließen, die in der Welt passieren. Auch junge Frauen nicht«, gab Alice ein wenig forsch zurück.
Der junge Offizier lächelte. Er sah gut aus, blond und groß, mit einem kühn gezwirbelten Schnurrbart. Alice schätzte ihn auf Ende zwanzig. »Ich wette, Ihre Eltern sind da anderer Meinung?«, sagte er mit freundlichem Spott in der Stimme.
»Natürlich«, gab Alice im gleichen Ton zurück. »Deshalb habe ich einen anderen Einband um das Buch gelegt. Sie sollen sich schließlich nicht beunruhigen. Offiziell habe ich das Stundenbuch gelesen.«
Das Lächeln des Offiziers wurde noch ein wenig breiter. »Nun, gegen Rilke können natürlich nicht einmal die besorgtesten Eltern etwas einwenden.«
Alice verabschiedete sich von dem jungen Mann mit einem knappen Kopfnicken und ging vorsichtig weiter, sich immer wieder mit den Händen an den Wänden abstützend. Wenn der Zug weiter so schlingerte, würde sie den Tee niemals heil bis zu ihrer Schwester bringen. Vielleicht konnte sie die Teemamsell bitten, mit ihrem Wägelchen zu ihnen zu kommen, das wäre einfacher. Sie musste lächeln. Ein gutaussehender Offizier war das gewesen. Und sogar belesen. Allzu viele Männer, die Joseph Conrad und Rilke lasen, hatte sie bisher nicht getroffen. Keinen einzigen, um genau zu sein.
In den Waggons der Polsterklasse fand sie die Teemamsell nicht, auch nicht in denen der dritten Klasse, die so voll mit Leuten waren, dass kaum ein Durchkommen war. An der Verbindungstür zur vierten Klasse blieb Alice zögernd stehen. Hier nach der Teemamsell zu suchen, erschien ihr unsinnig. Vorsichtig linste sie durch die Scheibe in den Großraumwaggon, in dem nur längs einfache Holzbänke angebracht waren, die meisten Passagiere jedoch stehen mussten. Der Waggon hatte keine Fensterscheiben, so dass es ziemlich zugig sein musste, wie Alice an den Frauen sehen konnte, die teilweise ihre Hüte festhielten. Ein Mädchen fiel ihr ins Auge, etwa so alt wie sie selbst. Es kauerte direkt neben der Tür auf dem nackten, von Unrat übersäten Holzboden und wirkte völlig entkräftet. Ihr blondes Haar hing ihr in Strähnen ins Gesicht, und sie hatte die Augen geschlossen. Mit roten Händen, die von harter Hausarbeit zeugten, hielt sie eine schäbige Stofftasche umklammert. Ohne lange nachzudenken, öffnete Alice die Tür, zwängte sich in den Waggon und beugte sich zu dem Mädchen hinunter.
»Ist dir nicht gut? Brauchst du Hilfe?«, fragte sie, doch das Mädchen schüttelte nur matt den Kopf. Alice betrachtete das gerötete Gesicht, die glasigen Augen und legte ihr eine Hand auf die Stirn. Sie war glühend heiß. »Du hast Fieber«, sagte sie erschrocken. »Wie lange sitzt du schon hier?«
»Seit … seit Königsberg.« Das Mädchen hustete in den Ärmel ihrer fadenscheinigen Bluse.
»Hier kannst du nicht bleiben. Da holst du dir den Tod.« Alice schauderte, als sie sich vorstellte, wie das Mädchen die ganze Nacht hier auf dem Boden gekauert hatte. »Komm mit in mein Abteil, da ist es nicht so zugig«, sagte sie energisch und nahm das Mädchen am Arm. »Ich wollte mir und meiner Schwester gerade Tee holen, den kannst du auch gebrauchen.«
Zögernd stand das Mädchen auf. »Das ist sehr freundlich«, sagte sie mit belegter Stimme und wurde erneut von einem Hustenanfall geschüttelt.
»Wieso bist du überhaupt losgefahren, so krank, wie du bist?«, fragte Alice, während sie das Mädchen durch den Zug bugsierte.
»Ich war bis vorgestern in Stellung und kann es mir nicht leisten, lange ohne Arbeit zu bleiben«, keuchte das Mädchen. »In Berlin bekomme ich eine neue Anstellung. Bei feinen Leuten.« Auf ihrem fiebrigen Gesicht erschien ein Lächeln. »Bei feinen Leuten«, wiederholte sie, als könne sie es selbst nicht glauben. »Ich habe sonntags frei und an den Abenden auch. Ich kann tanzen gehen!«
Inzwischen hatten sie ihr Abteil erreicht. »Setz dich«, sagte Alice. »Das ist meine Schwester Constanze.«
Das Mädchen nickte Constanze, die erstaunt von Alice zu dem Mädchen und wieder zurück blickte, schüchtern zu, dann setzte sie sich auf die vorderste Kante der Polsterbank. Ihre Finger glitten so vorsichtig über den dunkelblauen Bezug, als fürchtete sie, ihn mit ihren Händen zu beschmutzen. Alice wollte ihr die Tasche abnehmen, um sie in die Gepäckablage zu legen, doch das Mädchen umklammerte die Griffe, als hinge ihr Leben davon ab.
»Was hast du uns denn da mitgebracht?«, fragte Constanze, die wieder ein wenig Farbe im Gesicht hatte. »Nach Tee sieht das nicht aus.«
Alice zuckte entschuldigend mit den Schultern. »Die Teemamsell habe ich nicht gefunden. Aber dieses Mädchen saß am Boden, in einem offenen Waggon. Sie hat Fieber, da …«
»… da hast du sie gleich adoptiert, so wie die halbverhungerte Katze, die du mal mit nach Hause gebracht hast, oder die flügellahme Taube, die du unbedingt aus dem Rinnstein fischen musstest …«
»Das ist doch etwas anderes!«, zischte Alice und warf dem Mädchen einen schuldbewussten Blick zu. Ihre Schwester konnte mitunter recht taktlos sein.
»Wie heißt du?«, wandte sich Constanze jetzt an das Mädchen direkt.
»G…Gerda«, stotterte sie. »Ahrens.«
Constanze musterte das Mädchen. »Du siehst wirklich nicht gesund aus. Bist du schwanger?«
»Nein!« Gerda errötete bis unter die Haarspitzen.
»Ich dachte nur. Ich bin es nämlich, und ich fühle mich so ähnlich, wie du aussiehst.« Constanze öffnete ihre Tasche, nahm einen Parfumflakon heraus und sprühte etwas davon in die Luft. Sie wedelte mit der Hand herum, schnupperte und setzte eine zufriedene Miene auf. »So ist es besser.«
Das Mädchen duckte sich in ihren Sitz, als wäre sie geschlagen worden. Ihr Blick wanderte zur offenen Abteiltür. Offenbar dachte sie über Flucht nach. Alice nahm ihre glühend heiße Hand. »Ich besorge uns jetzt Tee. Lass dich von meiner Schwester nicht einschüchtern. Sie meint es nicht so.« Sie warf Constanze einen mahnenden Blick zu. »Nicht wahr?«
Constanze riss ihre himmelblauen Augen auf. »Ich verstehe nicht, was du meinst?«
Alice stand auf, ohne zu antworten. Es lohnte nicht, ihre Schwester auf ihre unsensiblen Bemerkungen hinzuweisen. Wenn Constanze ein Gespür dafür gehabt hätte, was sich in einem solchen Fall gehörte, hätte sie ihren Mund gehalten. Ihr das zu erklären, war ungefähr so hilfreich wie zu versuchen, einem Kalb das Fliegen beizubringen. Gerade als sie das Abteil wieder verlassen wollte, hörte sie den Schaffner, der den Waggon betrat und in breitem ostpreußischem Dialekt »Jemand zugestiegen?« schnarrte. Alice erinnerte sich, dass der Zug vor Kurzem an irgendeiner kleinen Bahnstation mitten im Nirgendwo gehalten hatte und ließ sich erleichtert zurück auf ihren Platz sinken. Sie würde den Schaffner bitten, ihnen die Teemamsell vorbeizuschicken, dann musste sie sich nicht auch noch durch den restlichen Zug kämpfen. Als der Schaffner kam, fiel sein Blick sofort auf Gerda, die ihre Zugfahrkarte aus einer Tasche ihres Kleides nestelte und ihm hinhielt.
»Sie ist nicht zugestiegen …«, begann Alice, doch der Schaffner beachtete sie nicht, sondern nahm dem Mädchen die Karte aus der Hand. »Das ist ein Billet für die vierte Klasse«, sagte er streng.
»Ja, ich habe sie hergebracht, sie ist krank«, mischte sich Alice ein. »Sie hat Fieber …«
»Und mit Fieber darf man in die Polsterklasse? Das wäre mir neu.« Der Schaffner, ein kleiner Mann mit einem gewaltigen Schnauzbart, musterte Gerda mit zusammengekniffenen Augen. »Mach, dass du fortkommst, du kleines Luder. Und dass dir nicht nochmal einfällt, Herrschaften zu belästigen.«
Das Mädchen stand hastig auf, doch Alice hielt sie fest. »Nein!«, rief sie empört. »Ich habe sie gebeten, in unser Abteil zu kommen, und ich werde auch den Zuschlag für die Polsterklasse bezahlen. Was kostet das?«
Jetzt wandte sich der Schaffner zum ersten Mal Alice zu. »Junges Frollein«, sagte er, »ich glaube kaum, dass Ihre Eltern Ihnen erlauben würden, ihr Geld für so ein Lumpenmädel zum Fenster hinauszuwerfen.«
»Es geht Sie nichts an, wofür ich mein Geld ausgebe«, fauchte Alice und spürte, wie ihr Gesicht sich zornesrot färbte.
»Alice, lass es gut sein!« Der Einwand kam von Constanze, doch Alice zog es vor, ihn zu überhören. »Sie täten besser daran, sich darum zu kümmern, uns Tee bringen zu lassen. Oder sollen wir uns über Sie beschweren?«
Der Schaffner schnaubte vor Entrüstung. »Das ist eine Unverschämtheit …«, begann er, offensichtlich hin- und hergerissen zwischen Empörung und dem eigentlich gebotenen Respekt vor den Passagieren der ersten Klasse.
»Sie haben gehört, was die junge Dame gesagt hat«, ertönte eine scharfe Stimme vom Gang her. Der junge Offizier war hinter den Schaffner getreten. Als dieser sich zu ihm umwandte, steckte der junge Mann ihm einen Geldschein in die Brusttasche seiner Uniform. »Das dürfte für den Zuschlag genügen. Wenn Sie nun so freundlich wären, für den Tee zu sorgen?«
Der Schaffner öffnete den Mund, doch es kam kein Ton heraus. Er klappte ihn wieder zu und nickte. Dann murmelte er ehrerbietig: »Jawohl, Herr Offizier«, und verließ das Abteil, ohne Alice und die beiden anderen Frauen noch eines Blickes zu würdigen.
»Du liebe Güte!«, stieß Constanze hervor und ließ sich zurück in ihr Polster sinken. »Was für ein unsympathischer Zeitgenosse. Warum musstest du dich mit ihm anlegen?« Sie warf Alice einen vorwurfsvollen Blick zu und wandte sich dann an den jungen Offizier. »Vielen Dank! Sie haben uns gerettet!«, rief sie. »Sie bekommen das Geld natürlich zurück …«
»Auf gar keinen Fall. Es war mir eine Ehre, Ihnen behilflich sein zu können.« Er machte eine angedeutete Verbeugung und lächelte ihnen der Reihe nach zu. Auf Alice blieb sein Blick ein wenig länger ruhen. »Niemand sollte die Augen vor den Dingen verschließen, die in der Welt passieren«, sagte er, an sie gewandt, dann drehte er sich um und nahm seinen Platz am Fenster wieder ein.
»Was war das denn?«, fragte Constanze etwas später, als die Teemamsell gekommen und ihnen drei Tassen Tee gebracht hatte, leise. »Was hat dieser schneidige Offizier wohl mit dem letzten Satz gemeint? Das klang so beziehungsvoll.« Sie pustete in ihre Tasse und nahm einen kleinen Schluck. Gerda balancierte die Tasse Tee so vorsichtig auf ihren Knien, als handle es sich um eine Schale roher Eier. Seit sie ihnen ihren Namen verraten hatte, hatte sie kein Wort mehr gesprochen.
»Das war eine Bemerkung, die ich vorher ihm gegenüber gemacht habe«, sagte Alice und bemühte sich, nicht allzu auffällig hinaus auf den Gang zu sehen. Wider Willen hatte der junge Offizier sie beeindruckt.
»Du hast schon mit ihm geredet?«
»Ja, wir haben kurz über Bücher gesprochen. Er liest … Rilke.«
»Über Bücher? Ihr habt euch über Bücher unterhalten?« Constanzes große Augen wurden noch runder. Jetzt erinnerte sie Alice tatsächlich ein wenig an ein Kälbchen. Lesen gehörte nicht zu Constanzes Lieblingsbeschäftigungen. Und mit einem fremden Mann in einem Zug über Bücher zu sprechen, fand sie offensichtlich völlig abwegig. Als Alice nicht antwortete, hakte sie das Thema Bücher daher kommentarlos ab und meinte nur versonnen: »Was für ein gut aussehender, charmanter Mann. Wenn ich nicht schon verheiratet wäre …« Sie kicherte. »Hast du bemerkt, wie er dich angesehen hat, Schwesterherz?«
»Er hat uns alle angesehen.«
»Aber dich besonders.«
»Blödsinn. Und überhaupt, er hätte sich nicht einzumischen brauchen. Wir hätten uns durchaus auch allein gegen den Schaffner behaupten können.«
Constanze starrte sie an. »Was stimmt nicht mit dir, Alice?«
»Wieso?«
»Da kommt ein schöner Mann daher, jung, ohne Buckel und sonstige Gebrechen, ein Offizier noch dazu und sieht dich mit einem Blick an, dass einem heiß und kalt gleichzeitig wird, und du bist beleidigt, weil er uns geholfen hat?«
»Ich bin nicht beleidigt. Das war nett von ihm. Es ärgert mich, dass der Schaffner uns nicht ernst genommen hat. Und das nur, weil wir Frauen sind! Wir hätten …«
»Papperlapapp. So ist es nun mal«, fiel Constanze ihr ins Wort. »Gewöhn dich dran. Immerhin haben wir viele Vorteile dadurch, dass man uns für das schwache Geschlecht hält. Wir müssen unsere Koffer nicht selbst tragen, keine sinnlosen Kriege führen, und rasieren müssen wir uns auch nicht.« Sie strich sich mit dem Zeigefinger prüfend über ihre makellos glatte Oberlippenpartie. »Das hoffe ich jedenfalls. Oder hast du schon einmal davon gehört, dass einem während der Schwangerschaft ein Damenbart wächst? Das hätte mir gerade noch gefehlt.«
Die restliche Fahrt verlief ereignislos. Alice versuchte, Gerda in ein Gespräch zu verwickeln, doch offensichtlich schüchterte Constanzes Anwesenheit sie zu sehr ein. Sie blieb wortkarg, und das glückselige Lächeln, mit dem sie Alice zuvor von ihrer neuen Anstellung erzählt hatte, zeigte sich nicht mehr. Immerhin gelang es Alice, Gerda zu entlocken, dass eine Freundin in Berlin ihr diese neue Stelle besorgt hatte. Diese Freundin hatte in ihren Briefen offenbar so in den höchsten Tönen von der Stadt und ihren Möglichkeiten geschwärmt, dass Gerda ihre Anstellung gekündigt und sich auf den Weg von Königsberg nach Berlin gemacht hatte. »Caroline wird mich abholen«, verkündete sie, als sie in den Bahnhof einfuhren. »Ich kann bei ihr wohnen, bis ich bei den neuen Herrschaften anfange.«
Alice nahm das mit einer gewissen Erleichterung zur Kenntnis, wofür sie sich jedoch sofort schalt. Wenn das Mädchen keinen Ort zum Bleiben gehabt hätte, hätte sie sich verpflichtet gefühlt, sich weiter um sie zu kümmern, was vermutlich für Ärger mit Constanze und ihren Eltern gesorgt hätte. Als sie in den Schlesischen Bahnhof einfuhren und vor den Fenstern für einen Moment alles in Dampf und Rauch gehüllt war, stellte das Mädchen behutsam die Tasse ab, griff nach ihrer Tasche und stand auf. »Vielen Dank«, sagte sie leise zu Alice und machte einen kleinen Knicks. »Das werde ich Ihnen nie vergessen.«
Alice winkte gerührt ab. »Das war doch selbstverständlich.«
Gerda schüttelte den Kopf. »Nein, das war es nicht. Jetzt weiß ich, dass die Berliner großherzige und gute Menschen sind. Von nun an wird alles besser werden.« Und da war es wieder, das hoffnungsvolle Lächeln, das ihr zartes, vom Fieber und der Erschöpfung ausgezehrtes Gesicht verwandelte und erahnen ließ, dass sie eigentlich ein sehr hübsches Mädchen war.
Alice, die ebenfalls aufgestanden war und ihr Handgepäck und das ihrer Schwester aus der Gepäckablage genommen hatte, drückte ihre Hand. »Ich wünsche dir alles Gute. Mögen deine Hoffnungen in Erfüllung gehen!«
Dann war das Mädchen fort, hinausgeschlüpft aus dem Abteil wie eine Maus aus der Speisekammer und im Gedränge der aussteigenden Passagiere verschwunden. Alice hoffte inständig, dass es ihr in der Stadt gut ergehen und ihre gute Meinung über die Berliner nicht allzu rasch enttäuscht werden würde.
Als sie mit Constanze auf den Bahnsteig trat, war sie für einen Moment wie erschlagen von dem Trubel, der sie dort erwartete. Die Luft war erfüllt vom Geruch nach Kohle, Rauch und Bratwürsten, die an einem Stand angeboten wurden. Ankommende und Abreisende liefen durcheinander, Gepäckstücke standen herum, und die Dienstmänner mit ihren Karren bemühten sich um die begüterten Passagiere. Alice und Constanze standen einen Moment lang etwas unschlüssig da. Sie würden von Johann, dem Faktotum des Hauses, mit der Kutsche abgeholt werden, doch er war nirgends zu sehen. Als Constanze von einem vorbeihastenden Mann so rüde angerempelt wurde, dass sie fast gestürzt wäre, war sogar Alice trotz ihres Bemühens um Selbständigkeit erleichtert, als der junge Offizier auf sie zutrat und fragte, ob er ihnen mit dem Gepäck behilflich sein könne. Er besorgte ihnen einen Dienstmann und gab diesem nach ihrer Beschreibung genaue Anweisungen betreffend ihrer Koffer. Während sie warteten, stellte er sich als Heinrich von Kessel vor. Alice entging nicht, dass sich der Gesichtsausdruck ihrer Schwester bei diesem Namen veränderte. »Von Kessel? Etwa der Tuchwarenfabrikant?«, fragte sie unverblümt.
Der Offizier nickte, etwas verlegen, wie Alice schien. »Mein Vater.«
»Wie interessant! Ich musss gestehen, schöne Stoffe sind meine Leidenschaft!« Constanze strahlte. »Haben Sie schon eine Fahrgelegenheit? Ansonsten würde wir uns freuen, Sie mit unserer Kutsche mitnehmen zu dürfen.« Sie reichte ihm die Hand. »Constanze Nissen, geborene Hardtleben. Das ist meine Schwester, Alice Hardtleben.«
»Sehr erfreut.« Heinrich wandte sich Alice zu. »Wenn Sie nichts dagegen haben, Fräulein Hardtleben, nehme ich das Angebot Ihrer Schwester sehr gerne an. Ich habe überraschend Urlaub bekommen und mich zu Hause nicht angekündigt, daher holt mich niemand ab.«
Alice lächelte verwundert. »Natürlich können Sie mit uns fahren. Warum sollte ich denn etwas dagegen haben?«
Constanze stieß sie unauffällig an, und als Alice ihr einen überraschten Blick zuwarf, verdrehte ihre Schwester demonstrativ die Augen. Alice kannte die Botschaft dahinter: Du bist ein hoffnungsloser Fall! Sie hatte jedoch keinen blassen Schimmer, was sie falsch gemacht haben könnte, deshalb beschloss sie, Constanze einfach zu ignorieren. Gerade als sie sich abgewandt hatte, um weiter nach Johann Ausschau zu halten, bemerkte sie eine bekannte Gestalt. Es war Gerda, die, ihre Tasche fest umklammert, an einer der Säulen in der Bahnhofshalle stand und sehr verloren aussah. Die Freundin, die sie abholen kommen sollte, war offenbar noch nicht eingetroffen. Alice spürte, wie sie ungehalten wurde. Wenn man eine Freundin dazu brachte, alles zurückzulassen und in eine ihr vollkommen fremde Großstadt Hunderte Kilometer entfernt von ihrem Zuhause zu kommen, hatte man gefälligst pünktlich zu sein, fand sie. Sie wollte gerade auf das Mädchen zugehen und ihr erneut ihre Hilfe anbieten, als ein Mann auf Gerda zutrat und sie ansprach. Nicht unattraktiv, mit einem gewinnenden Lächeln auf den Lippen, wirkte er durchaus respektabel. Er trug ein ordentliches Jackett und Weste zum weißen Hemd und seine Schuhe glänzten ebenso wie die Brillantine in seinen akkurat gescheitelten, rabenschwarzen Haaren. Dennoch sagte Alice irgendetwas an seiner Haltung und der Art, wie er das Mädchen ansah, dass er nicht vertrauenswürdig war. Sie versteifte sich und fixierte die beiden, bereit einzugreifen, falls der Mann sich in irgendeiner Weise anstößig benehmen sollte. Bisher wirkte er sehr zurückhaltend, sprach freundlich und ruhig mit Gerda, die ihn zuerst etwas verschreckt, dann jedoch dankbar anlächelte. Womöglich ein Bekannter von Gerdas Freundin, versuchte Alice das Unbehagen zu vertreiben, das sie bei seinem Anblick erfasst hatte. Im Grunde ging sie dieses Mädchen ja nichts mehr an. Dennoch konnte sie den Blick nicht abwenden. Jetzt bückte sich Gerda und nahm etwas aus ihrer Tasche, das wie ein schmales Büchlein aussah. Gerade wollte sie es dem Mann reichen, als eine dritte Person zu den beiden trat und mit offensichtlich scharfen Worten dazwischenfuhr. Es war eine Frau mit üppigen dunklen Locken, die sich unter einem kecken blauen Hut hervorringelten. Auch das Kleid, das sie trug, war blau, und am Arm hatte sie eine weiße Armbinde mit einem Symbol darauf, das Alice aus der Entfernung jedoch nicht erkennen konnte. Sie war sehr klein und zierlich, der Mann, obwohl auch er nicht besonders groß, überragte sie um eine gute Kopflänge, doch offensichtlich war sie davon nicht im Geringsten beeindruckt. Obwohl Alice nicht hören konnte, was sie zu ihm sagte, war deutlich zu erkennen, dass es nicht freundlich war. Den Mann nicht aus den Augen lassend, legte die Frau jetzt einen Arm um Gerda und nahm mit der anderen Hand deren Tasche. Dann zog sie sie sanft, aber bestimmt von ihm weg, was das Mädchen, das das dünne Büchlein noch immer in der Hand hielt, ohne Widerspruch geschehen ließ. Offenbar war es ebenso verwirrt wie Alice über das unerwartete Eingreifen der Frau. Auch der Mann erhob keinen Einspruch. Reglos stand er da und sah den beiden nach, während sie in der Menge verschwanden. Dann gab er sich einen Ruck, spuckte einmal verächtlich auf den Boden, was nicht ganz zu seinem respektablen Eindruck von vorhin passte, und ging in die andere Richtung davon. Für einen kurzen Moment konnte Alice dabei seine Augen sehen, die auffallend hell waren. Ein Schauder lief ihr über den Rücken. Sie wusste nicht, worum es hier ging und was vorgefallen war, aber sie erkannte, dass sich diese energische kleine Frau mit den ungebärdigen Locken soeben einen Feind fürs Leben gemacht hatte.
»Kommst du?« Constanze zupfte sie am Ärmel. »Was träumst du denn hier mit offenen Augen? Johann ist da, und unser Gepäck steht auch schon bereit. Und ich freue mich aufs Mittagessen.« Sie hakte sich bei Alice unter und zog sie mit sich. Alice ließ sich von ihrer Schwester in Richtung Ausgang bugsieren, von wo Johann ihnen bereits entgegenkam. Heinrich von Kessel und ein Dienstmann, auf dessen Karre sich ihr Gepäck befand, folgten ihnen. Johann begrüßte sie mit dem Lüpfen seiner Melone.
»Schön, dass Sie wieder bei uns sind, meine Damen. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Fahrt«, sagte er in seiner wie immer sehr förmlichen Art, aber seine Augen zwinkerten freundlich. Er warf Heinrich von Kessel einen kurzen Blick zu, der nichts von seinen Gedanken verriet, doch Alice war sich sicher, dass Johann neugierig war, was es mit ihrer unerwarteten Begleitung auf sich hatte. Sie kannte Johann seit ihrer Kindheit und mochte ihn. Als sie noch klein gewesen war, hatte sie ihm immer mit den beiden Pferden geholfen, hatte sie gestriegelt und gefüttert, und er hatte sie darauf sitzen lassen und sie herumgeführt. Im Gegensatz zu den Dienst- und Küchenmädchen, die häufig wechselten, waren Johann und seine Frau Else schon bei ihnen, seit Alice denken konnte. Er kümmerte sich um die Pferde und die Kutsche, den weitläufigen Garten hinter dem Haus und alles, was sonst noch so anfiel, während Elses Reich die Küche war. Constanze stellte Heinrich von Kessel knapp vor und wies Johann dann an, ihn als Erstes nach Hause zu fahren. Dabei warf sie dem jungen Offizier einen vielsagenden Blick zu und fragte: »Unter den Linden, nicht wahr?«, woraufhin er überrascht nickte.
Alice, der im Gegensatz zu ihrer Schwester der Name von Kessel nichts sagte, wunderte sich ebenfalls, dass Constanze sogar wusste, wo die Familie wohnte. Sie selbst hatte keine Ahnung von Tuchwarenfabrikanten und kannte auf dem Boulevard Unter den Linden nur das Café Kranzler, weil sie dort schon ein paar Mal mit ihrer Großmutter Kuchen gegessen hatte.
Als sie in den Landauer stiegen, der vor dem Bahnhof wartete, fielen Alice zwei weitere Frauen auf, die wie die kleine, dunkelhaarige Frau von eben eine weiße Armbinde trugen. »Wissen Sie, was diese Armbinden zu bedeuten haben?«, wandte sie sich an Heinrich von Kessel, der ihr beim Einsteigen galant die Hand reichte, während Johann das Gepäck verstaute. Sie deutete auf die zwei Frauen, die gerade vorbeigingen. Jetzt konnte sie auch sehen, dass auf den Armbinden ein Kreuz abgebildet war. Er folgte ihrem Blick. »Ich glaube, das ist das Zeichen der Bahnhofsmission, die es seit einiger Zeit hier am Schlesischen Bahnhof gibt«, sagte er und wandte sich Constanze zu, um ihr ebenfalls beim Einsteigen zu helfen. »Die haben ein Büro oder so etwas Ähnliches am anderen Ende der Halle.«
Ihre Schwester kletterte so schwerfällig in die Kutsche, als stünde die Niederkunft unmittelbar bevor und ließ sich dann ächzend auf die Bank fallen. Alice betrachtete sie mit einer Mischung aus Mitleid und Ungeduld. Wenn das so weiterging, würde Constanze sich in den nächsten Monaten nicht mehr von der Stelle bewegen können.
»Was macht die Bahnhofsmission?«, wollte sie weiter wissen.
Er zuckte mit den Schultern. »So genau weiß ich das nicht. Ich glaube, sie helfen jungen Frauen vom Land, die hier ankommen und Arbeit suchen.«
»Wieso interessiert dich das?«, wollte Constanze wissen, während sie ihren Hut zurechtrückte, der ein wenig Schieflage bekommen hatte. »Das sind vermutlich scheinheilige alte Jungfern, denen langweilig ist, so wie unsere Tante Dotti, die ständig Kuchen für arme Waisenkinder bäckt und ihnen hässliche Handschuhe strickt. Sie geben vor, arme Seelen vor der Verdammnis zu retten, dabei wollen sie sich nur die Zeit vertreiben und dabei von ihren Freundinnen für Heilige gehalten werden.«
Alice hielt nach den beiden Frauen Ausschau, konnte sie jedoch nicht mehr entdecken. Ihre Schwester hatte bei der Charakterisierung ihrer Tante zwar den Nagel auf den Kopf getroffen, doch was die Bahnhofsmission anging, so täuschte sie sich gewaltig: Die Frau mit dem wilden Haarschopf und dem kecken Hut mochte alles Mögliche sein, aber sie war mit Sicherheit keine scheinheilige alte Jungfer.
3
Natalie führte das Mädchen durch die Bahnhofshalle, bis sie zu der unscheinbaren Tür gelangten, über der in schlichten weißen Lettern BAHNHOFSMISSION stand. Neben der Tür befand sich ein buntes Emailleschild, auf dem eine junge Frau abgebildet war, die weinend auf einem Koffer saß. »Du weißt nicht mehr weiter? Komm zur Bahnhofsmission, dort hilft man dir!«, stand darüber. Darunter prangte in Rot ihr Erkennungszeichen, das achtzackige Johanniterkreuz. Natalie hatte noch immer den Arm um das Mädchen gelegt und spürte die Hitze, die ihr Körper ausstrahlte. Die glasigen Augen und der rasselnde Husten ließen keinen Zweifel daran, dass das Mädchen krank war. Sie brauchte nicht nur moralische Unterstützung, sie brauchte auch medizinische Hilfe.
Der Raum, in dem die Bahnhofsmission seit ein paar Monaten untergebracht war, war ein langer, schmaler Schlauch. Er hatte bis vor Kurzem noch als Leichenkammer gedient, in der Verstorbene, die überführt werden mussten, auf ihren Weitertransport warteten. Es war ihr Glück gewesen, dass wegen Verbesserungen der Logistik eine Lagerung der Toten am Schlesischen Bahnhof überflüssig wurde und sie daher den Raum samt einem kleinen Keller zur Verfügung gestellt bekommen hatten. Ein paar zartbesaitete Frauen unter ihren Helferinnen hatten zwar Bedenken angemeldet und schaudernd gemeint, sie wollten nicht an einem Ort arbeiten, an dem Tote gelegen hätten, doch dieses Argument hatte Pfarrer Burckhardt mit einer harschen Handbewegung weggewischt. »Die Toten sind nicht zum Fürchten. Sie sind uns nur vorausgegangen.«
Der Pfarrer mochte recht haben, dennoch hatte Natalie dieses Argument nicht als besonders hilfreich empfunden. Die Aussicht, bald selbst in einem Sarg zu liegen, trug ihrer Meinung nach nicht dazu bei, sich in einer ehemaligen Leichenkammer wohler zu fühlen. Sie hatte daher auf praktische Argumente gesetzt und den noch zweifelnden Damen die Renovierung des Raums in den höchsten Tönen ausgemalt. Dabei hatten ihr Marthe, die Köchin und eine weitere Helferin, die alle nur »die Gräfin« nannten, beigestanden. Letztere war Natalie von allen Frauen, die sich in der Bahnhofsmission engagierten, die liebste. Die energische ältere Dame mit dem aristokratischen Auftreten unterstützte den Pfarrer schon seit vielen Jahren und hatte bei der Diskussion um die neue Örtlichkeit den Standpunkt vertreten, dass man einem geschenkten Gaul auch dann nicht ins Maul schauen solle, wenn es sich dabei um eine ehemalige Leichenkammer handelte und alle vorgebrachten Argumente dagegen mit einem forschen Papperlapapp beiseitegeschoben. Derart bekräftigt, war Natalie zur Tat geschritten, ohne zuerst noch auf die Spendenbitte des Pfarrers in den Kreisen der wohltätigen Damen der Stadt zu warten. Einen Eimer vanillegelbe Kalkfarbe und taubenblauen Lack für die Holzvertäfelung hatte sie einem Malermeister aus dem Viertel am Bahnhof für zwei Flaschen Weinbrand aus dem Kreuz geleiert und dann ein paar dort herumlungernde Jungs, die nichts Besseres zu tun hatten, überredet, ihnen für Zigaretten und eine warme Mahlzeit beim Streichen zu helfen. Von ihrer Tatkraft angesteckt, hatten die anderen Helferinnen zwei Pritschen, Stühle, einen Tisch, ein Pult, Geschirr und sogar einen Holzofen beigesteuert, auf dem man auch kochen konnte. Frisch gestrichen und mit den ausrangierten Möbeln aus den Häusern der feinen Damen ausgestattet, wirkte der vormals so düstere Raum fast wie eine behagliche Stube. Als Pfarrer Burckhardt ihre neue Wirkungsstätte am Ende auch noch gesegnet und ein Kruzifix aus dem Pfarrhaus aufgehängt hatte, waren selbst Hedwig und Margarethe, die ängstlichsten der Helferinnen, besänftigt und fürchteten nicht mehr, von den Geistern der Toten heimgesucht zu werden. Woher die zwei Flaschen Weinbrand und die Zigaretten beziehungsweise das Geld dafür stammten, fragte niemand, und Natalie hütete sich, etwas darüber verlauten zu lassen.
Natalie steuerte mit dem noch immer erschrocken wirkenden Mädchen die hinter einem Paravent stehenden Pritschen an, auf denen sich erschöpfte Reisende ausruhen und in Notfällen auch einmal eine Nacht verbringen konnten. Heute Vormittag waren sie noch leer, so dass sie dort ungestört sein würden. Aus Erfahrung wusste Natalie, dass die Mädchen offener sprachen, wenn sie sich nicht beobachtet fühlten, vor allem am Anfang, daher waren die vom übrigen Raum abgeteilten Pritschen besser, um sich zu unterhalten, als der Tisch, wo gerade mehrere Helferinnen saßen und die Flugblätter untereinander aufteilten, die sie heute auslegen wollten. Erschöpft setzte sich das Mädchen, das, wie Natalie inzwischen erfahren hatte, Gerda hieß, auf die mit einer dünnen Decke belegte Liege.
»Warum haben Sie mich von dem Mann weggebracht?«, fragte sie, nachdem sie ein wenig zu Atem gekommen war.
»Er wollte dir dein Dienstbuch wegnehmen.«
»Er hat mich drum gebeten und gesagt, er würde es den Herrschaften geben, bei denen ich die neue Anstellung bekommen würde. Die haben ihn geschickt, um mich abzuholen. Weil meine Freundin nicht kommen kann.«
»Und das hast du ihm geglaubt?«
Das Mädchen nickte schüchtern. »Er hat ja den Namen von meiner Freundin gewusst. Caroline heißt die. Und er war freundlich und hat ausgesehen wie’n Herr.«
»Dein Dienstbuch ist dein wertvollster Besitz, Gerda. Da steht alles drin, was dich ausmacht, Name, Herkunft, Arbeitgeber, Zeugnisse. Und du bist verpflichtet, es der Polizei vorzulegen, wenn du an einen neuen Ort ziehst. Was meinst du, was passiert, wenn du es nicht mehr hast?«
Als das Mädchen nicht antwortete, fuhr Natalie unerbittlich fort: »Du wirst unsichtbar. Niemand weiß, dass du hier bist, niemand wird dich suchen, wenn dir etwas passiert. Du kannst dich nicht mehr ausweisen, und keine anständige Herrschaft wird dir eine Stellung geben.«
»Aber …«
»Dieser Mann hatte keinen Grund, nach deinem Dienstbuch zu fragen. Du musst es nur den neuen Herrschaften zeigen, sonst niemandem und darfst es nie aus der Hand geben! Ich bin mir sicher, der Mann hat dich angelogen. Hat er dir seinen Namen genannt?«
»Pavel.«
»Wie noch?«
Das Mädchen hob die Schultern.
»Wie heißen denn die Leute, bei denen du deine neue Arbeit anfängst?«
»Ich weiß es nicht. Caroline wollte sich um alles kümmern.«
»Und wo wohnt deine Freundin?«
»Das weiß ich auch nicht.« Gerda sprach jetzt so leise, dass sie kaum noch zu verstehen war. »Ich hab ihr immer postlagernd geschrieben. Sie meinte, die Briefe kämen sonst nicht bei ihr an, weil so viele Parteien in ihrem Haus wohnten und der Postbote in ihrer Straße so schusslig wär.«
Natalie unterdrückte einen Seufzer. Es war immer das Gleiche. Diese Mädchen, die auf der Suche nach einem besseren Leben von irgendwoher in die Stadt strömten, waren einfach zu gutgläubig. »Wie gut kennst du diese Caroline denn?«
»Wir haben eine Weile zusammen gearbeitet. Sie war Dienstmädchen und ich Küchenmagd auf einem Gutshof bei Königsberg. Das war kein gutes Haus, deswegen ist sie auch weg von da. Die Herrschaften waren geizig und unfreundlich. Wenn wir einen Fehler machten oder nicht schnell genug waren, gab’s gleich Schläge. Wir haben auch immer nur Brühe mit Knochen zum Essen gekriegt, und ich musste im Hängeboden über dem Herd schlafen, da war’s im Sommer so heiß wie im Backofen.« Sie hob den Kopf, und in ihren fiebrigen Augen leuchtete etwas auf: »Deswegen hab ich mich auch so gefreut, als Caroline mir geschrieben hat. Ich hab ja geglaubt, sie hätt mich längst vergessen. Sie hat geschrieben, dass sie eine feine Anstellung bei netten Herrschaften gekriegt hat und 150 Mark im Jahr verdient! Außerdem hat sie jeden Sonntag frei und zu Mittag bekommen die Dienstboten sogar Fleisch und Kuchen, genau wie die Herrschaften, nicht nur Brühe.«
»Und da hast du gedacht, das willst du auch.«
Das Mädchen nickte, und das hoffnungsvolle Funkeln in ihren Augen erlosch. Offenbar dämmerte ihr langsam, dass sie getäuscht worden war. Natalie hatte Mitleid mit ihr. Sanft sagte sie: »Das kann ich gut verstehen. Wäre mir vermutlich genauso gegangen. Was haben deine Eltern dazu gesagt, dass du nach Berlin willst?«
»Ich hab keine Eltern. Komm aus’m Waisenhaus.« Gerda hustete.
Natalie warf einen Blick am Paravent vorbei in Richtung Küchenbereich. Marthe, die bei dem ledigen Pfarrer als Haushälterin arbeitete und jeden Tag in die Mission kam, rührte in einem großen Topf Suppe. Außerdem roch es nach frisch aufgebrühtem Kaffee und Kuchen.
»Du hast sicher Hunger?«, fragte Natalie, wartete die Antwort des Mädchens jedoch nicht ab, sondern stand auf. »Ich bringe dir etwas. Dann sehen wir weiter.«
Sie sah zu, wie Gerda in Windeseile den Teller Erbsensuppe verschlang und dann ehrfürchtig ein Stück von dem Sandkuchen abbrach, den eine der Helferinnen mitgebracht hatte.
»So weich«, hauchte sie und kaute andächtig, bevor sie an der Tasse Kaffee schnupperte. »Ist das echter Kaffee?«
Als Natalie nickte, nippte sie vorsichtig. »Hab ich noch nie getrunken.«
Als Gerda mit dem Essen fertig war und ihr schmales Gesicht ein wenig den erschöpften Ausdruck verloren hatte, nahm ihr Natalie das Tablett ab und stellte es auf den Boden.