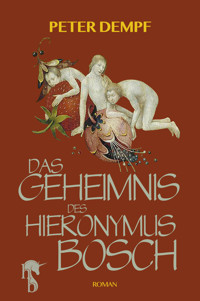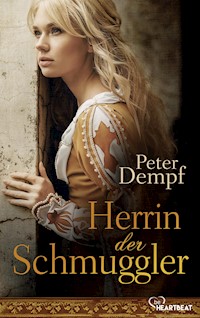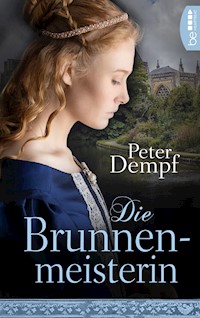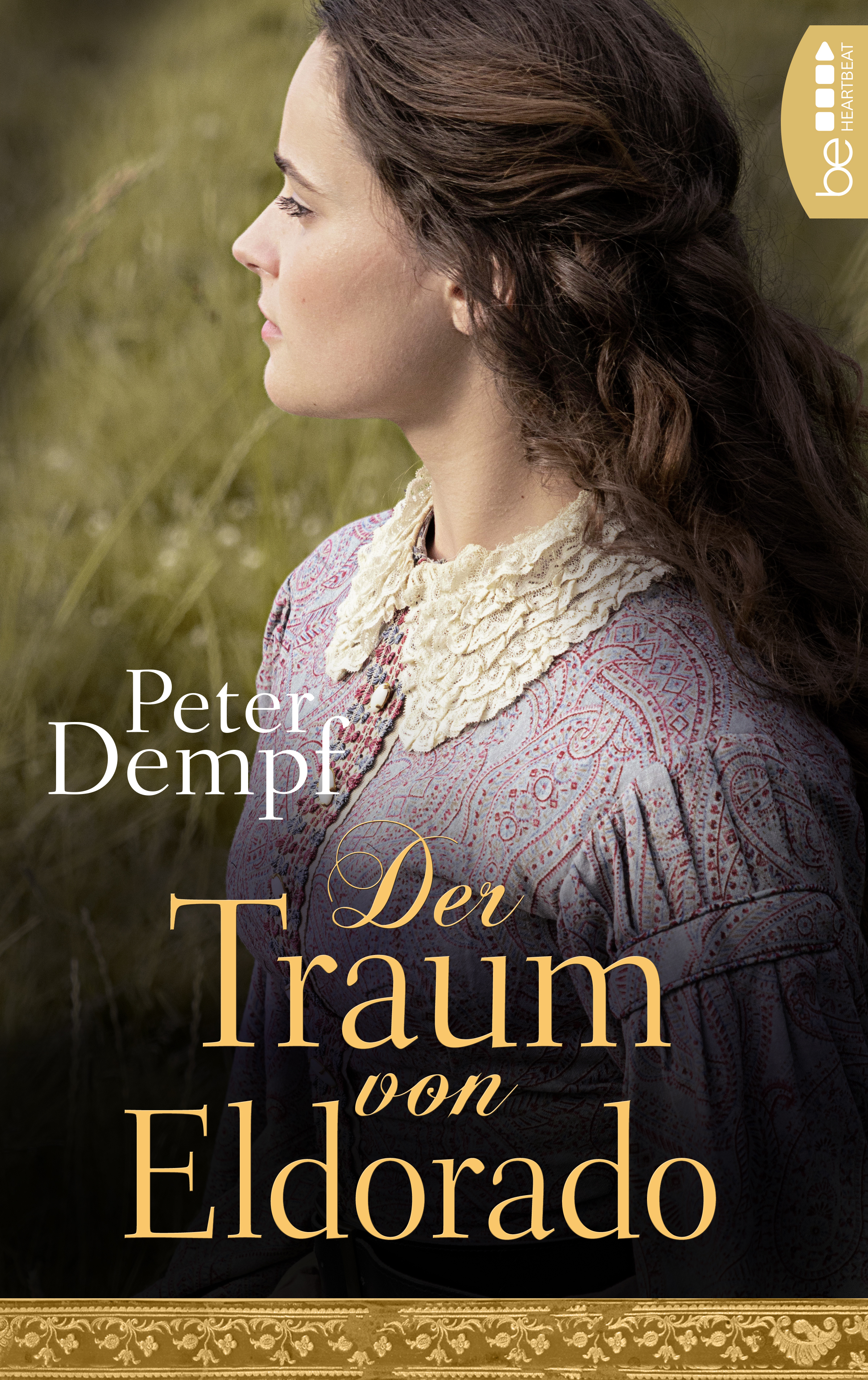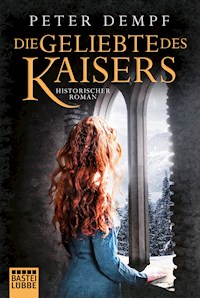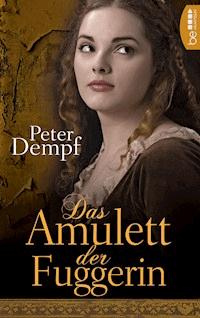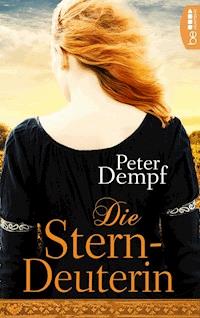
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Augsburg, 1509. Katrin Buschmann ist die Tochter des bekannten Instrumentenbauers und hegt eine Leidenschaft für Astrologie und Horoskope. Auch ihr Vater ist fasziniert von den Sternen und arbeitet an einer geheimnisvollen Maschine, mit der er die Zukunft aus den Sternen lesen will.
Eines Tages taucht der junge Instrumentenbauer Florint Deroubaix in der Werkstatt von Meister Buschmann auf. Er ist auf der Suche nach seinem Vater. Als Katrin ihm von der seltsamen Sphärenmaschine erzählt, glaubt Florint, dass auch sein Vater daran gearbeitet haben muss. Doch dann wird Florint des Mordes beschuldigt und mit einem Fuggertransport nach Venedig verschleppt.
Heimlich und unerkannt folgt Katrin ihm - denn sie will die Wahrheit herausfinden: Was hat das Verschwinden von Florints Vater mit der Sternenmaschine zu tun? Und welches Geheimnis verbirgt sich hinter dem alten Dokument in griechischer Sprache, für das sich die Heilige Inquisition so brennend interessiert?
Doch als Katrin in der Lagunenstadt angekommt, muss sie erkennen, dass sie und Florint zu Spielfiguren geworden sind in einem viel größeren und für alle äußerst gefährlichen Spiel.
In dieser Reihe haben wir die schönsten, spannendsten und fesselndsten Romane von Peter Dempf zusammengestellt. Die Romane erzählen vom Leben starker Frauen in vergangenen Zeiten: von ihrem Mut, ihrer Kraft und ihrer Leidenschaft, von ihrem Kampf gegen Intrigen, Hass, Verrat und für die eigene Freiheit. Jeder Roman kann einzeln für sich gelesen werden.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 653
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber das BuchÜber den AutorTitelImpressumZitatPrologErster TeilZitatKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Zweiter TeilZitatKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Dritter TeilZitatKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Nachwort des VerfassersDanksagungÜber das Buch
Augsburg, 1509. Die Leidenschaft der jungen Katrin, Tochter des Instrumentenbauers Buschmann, sind Horoskope. Auch ihr Vater will die Zukunft aus den Sternen lesen und arbeitet im Geheimen an einer Maschine dafür. Da tritt der junge Geselle Florint in ihr Leben. Er ist auf der Suche nach seinem verschollenen Vater, der in der Werkstatt des Instrumentenbauers gearbeitet hat. Gibt es eine Verbindung zwischen seinem Verschwinden, der geheimnisvollen Sphärenmaschine und jenem alten Dokument in griechischer Sprache, an dem nicht nur die Stadt Venedig, sondern auch die Heilige Inquisition ein Interesse hat?
Über den Autor
Peter Dempf, geboren 1959 in Augsburg, studierte Germanistik und Geschichte und unterrichtet heute an einem Gymnasium. Der mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnete Autor schreibt neben Romanen und Sachbüchern auch Theaterstücke, Drehbücher, Rundfunkbeiträge und Erzählungen. Bekannt wurde er aber vor allem durch seine historischen Romane. Peter Dempf lebt und arbeitet in Augsburg, wo auch seine beiden Mittelalter-Romane »Fürstin der Bettler« und »Herrin der Schmuggler« spielen.
Peter Dempf
Die Sterndeuterin
Historischer Roman
beHEARTBEAT
Digitale Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2007/2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Digitale Neuausgabe vermittelt durch die AVA International GmbH, München
www.ava-international.de
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-3367-1
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
»Die Welt
ist in geheimen Knoten verbunden.«
ATHANASIUS KIRCHER, 1631
Prolog
Die Sonne löschte den Tag in einem See blutroter Wolkenstreifen aus und sank hinter den Horizont. Meister Buschmann, der eben noch sein Astrolab aufgebaut und eine Sanduhr sowie den Jakobsstab neben sein Winkelmessinstrument auf die Brüstung des Turmes gelegt hatte, hielt inne und blickte in die warmen Farben, die im Gegensatz zur beißenden Kälte dieses Spätherbstes standen. Zeugte nicht gerade diese verschwenderische Pracht des Sonnenuntergangs davon, dass der Herr den Menschen dazu anhielt, sich mit den Geheimnissen des Himmels zu beschäftigen? Er suchte mit zusammengekniffenen Augen den Horizont über der Stadtmauer ab, während er in seine Hände blies. Jeden Moment musste sie erscheinen, die Herrin des Himmels, die Schönste unter den Gestirnen.
»Worauf wartet Ihr, Meister Buschmann?«
Die Stimme in seinem Rücken ließ ihn zusammenzucken. Er seufzte, ohne den Blick vom Himmel zu lassen.
»Ihr solltet nicht schleichen wie eine Katze, Pater Eginald. Mein Herz macht jedes Mal einen Sprung, wenn Ihr auftaucht, als wärt Ihr aus dem Boden gewachsen«, knurrte der Instrumentenbauer in seine Fäuste, und leise fügte er hinzu: »Und es ist kein Freudensprung!«
»Es wird Euer schlechtes Gewissen sein, weil Ihr wider die Gebote der heiligen Mutter Kirche verstoßt«, zischte Pater Eginald gehässig.
Der Dominikaner, den Meister Buschmann mit Pater Eginald angeredet hatte, löste sich aus der Öffnung des Turmaufgangs und trat neben den Handwerker.
Einen größeren Gegensatz hätte man sich kaum vorstellen können. Buschmann steckte in einem massigen Körper mit einem feisten, freundlichen Gesicht. Er schwitzte trotz der Kälte, und obwohl er sich nicht bewegte, wischte er sich beständig mit den Ärmeln seines Wamses Schweißperlen von der Stirn und atmete hörbar schwer, sodass ihm eine weiße Fahne vor dem Mund stand. Dabei glitten seine lebhaften Augen über die Stelle, an der sich Firmament und Erde berührten, während er seinen Nachbarn keines Blickes würdigte.
Pater Eginald dagegen war so mager, dass er sich gut und gern hinter dem Handwerker hätte verbergen können. Sein Gesicht wirkte asketisch schmal, was jedoch eher von einer Magenkrankheit herrührte, aufgrund derer sich zudem zwei tiefe Falten links und rechts des Mundes eingegraben hatten. Die Wangenknochen traten energisch hervor, seine schmalen, blutleeren Lippen umspielte ein fanatischer Zug, und seine Hände hatten etwas damenhaft Zartes. Ihn fror in dieser Spätnovemberkälte.
»Ihr wisst, worauf ich warte, Pater Eginald? Die Venus muss jeden Augenblick aufgehen. Die schönste Erscheinung an Gottes Firmament.«
Pater Eginald verzog verärgert den Mund, was seine Falten zu Schnitten vertiefte. Zwei humpelnde Schritte kam er langsam näher.
»Aberglaube, Ketzerei!«, zischte er. »Hätte ich in dieser Stadt etwas zu sagen, Meister Buschmann, würde ich dieses … dieses …«, er deutete auf das Astrolab und auf eine Scheibe, mit der man Aufgangswinkel und Endwinkel des Untergangs messen konnte, und deren Messingoberfläche im letzten Tageslicht wie pures Gold glänzte, »… Ding hier in eine Pflugschar umschmieden lassen …«
Meister Buschmann grinste, ohne den Blick vom Horizont zu lassen.
»Dann bete ich dafür, dass unserer Stadtregierung ein langes und segensreiches Leben vergönnt ist.« Buschmann senkte die Stimme: »Der Glaube, wie Ihr ihn betreibt, macht Angst, weil er einen Feind braucht: den Ungläubigen, den Ketzer. Blickt in den Sternenhimmel, Pater Eginald, und lernt angesichts der Gewaltigkeit der Erscheinung dort oben etwas Demut!« Er hielt inne, kniff die Augen zusammen, dann deutete er in den Himmel hinein. »Dort, dort ist sie«, flüsterte er und zeigte auf den Horizont.
Ohne weiter auf seinen Zaungast zu achten, richtete er das Astrolab auf den hellen Flecken am Horizont, fixierte es mit einem Auge und fingerte an seiner Winkelscheibe herum, bis er deren Plejadenmuster gefunden hatte. Anhand dieser Markierung konnte er das Messinstrument, ohne hinzusehen, auf den Aufgangspunkt einstellen. Dabei vermied er es, durch den Mund zu atmen, damit der weiße Atemdampf ihm nicht die Sicht nahm. Dann legte er den Jakobsstab auf die Steinbrüstung und justierte die linke Hälfte des Kreuzes auf den Venusstern. Das Metall war eiskalt unter seinen Händen.
»Wundervoll!«, machte sich in ihm die Begeisterung über den Planeten Luft. »Weiß und rein wie die Jungfrau Maria!«
»Versündigt Euch nicht, Meister Buschmann! Solche Vergleiche führen geradewegs auf den Scheiterhaufen …«, entfuhr es dem Dominikaner hinter ihm.
Der Handwerker ließ sich nicht von der galligen Art des Mönchs stören, sondern vergaß für kurze Zeit alles um sich her. Eine halbe Stunde würde ihm zur Verfügung stehen, eine halbe Stunde, in der er den reinsten aller Planeten studieren konnte. Weil ihm die Kälte ins Gesicht stach und die Beine hinaufkroch, dachte er an die Tabelle, die er für den heutigen Venusstand errechnet hatte. Venus mit Mars in Opposition und Saturn im selben Haus. Das bedeutete nichts Gutes. Die Königin des Himmels würde ihre Kraft nicht ausleben können, und Unheil schwebte in der Luft. Ob damit der unselige Dominikaner gemeint war?
Unablässig redete der auf ihn ein und versuchte, ihn von seinem Untersuchungsgegenstand abzulenken. Doch Meister Buschmann vernahm das Geplapper nur wie das Rauschen des Blutes in seinen Ohren.
Nur einmal, als ihm die Stimme des Mönchs zu nahe am Ohr giftete, richtete er sich kurz auf, wischte sich mit dem Ärmel über das schweißnasse Gesicht und ließ eine Bemerkung fallen:
»Solltet Ihr nicht beim Abendgebet sein, Pater Eginald? Oder habt Ihr Euch von Eurem Prior Dispens erbeten?«
Sofort verstummte das Keifen, und Pater Eginald trat mehrere Schritte zurück, senkte das Haupt und betete leise für sich. Zufrieden wandte sich der Handwerker wieder seinen Beobachtungen zu. Er schlüpfte mit den Händen in die Ärmel und erspürte eine kalte glatte Oberfläche. Eine wohlige Wärme durchströmte ihn. Die Kristalllinse hätte er beinahe vergessen. Er hatte sich eine Tasche in die Innenseite der Ärmel genäht – und dort steckte seit einigen Tagen ein linsenförmig geschliffenes Stück Bergkristall. Zweimal hatte er sich die Linse bereits vors Auge gehalten und so den Mond betrachtet, der dadurch wie vergrößert wirkte. Wenn Pater Eginald das gesehen hätte …
»Vater! Vater!«
Die Stimme riss den Instrumentenbauer erneut aus seinen Betrachtungen. Gleichzeitig mit Pater Eginald drehte er sich zur Turmöffnung um. Dort stand seine Tochter, das Gesicht rot vor Anstrengung, ihr Atem ging stoßweise.
»Vater. Schnell. Ein Bote …«, keuchte das Mädchen, das die Stufen zum Perlachturm heraufgerannt sein musste, »… aus Venedig. Es sei dringend, sagt er.«
Verstohlen ging Meister Buschmanns Blick hinüber zu dem Dominikaner. Der hob gerade die Augenbrauen. Pater Eginald zitterte vor Kälte, wie der Handwerker mit klammheimlicher Freude feststellte. Sein Besuch hier oben sollte ihm wenigstens nicht zum Vergnügen ausarten und ihm neben den Kosten für die Bestechung des Türmers auch noch eine Erkältung eintragen.
»Wollt Ihr nicht ein Auge auf dieses Wunderwerk Gottes werfen?«, fragte Meister Buschmann spöttisch. »Man sieht die Welt anders, wenn man die Gestirne beobachtet! Aber ich sehe, Euch steht nicht der Sinn danach. Nun denn, der Herr gibt uns die Möglichkeiten, und er nimmt sie uns, Pater Eginald.«
Dann drückte er der Tochter die Winkelscheibe in die Hand und wollte die Leiter ins Turmzimmer hinabsteigen.
Der Dominikaner folgte ihm mit versteinerter Miene.
»Wer besucht Euch zu so später Stunde, Meister Buschmann?«
Die Frage war wie beiläufig gestellt und enthielt doch eine ganze Reihe von Fußangeln, in die Buschmann jetzt nicht geraten wollte. Der Bote aus Venedig verhieß ein neues Manuskript – und das durfte er nicht verpassen. Dafür verlor er lieber einige Beobachtungsdaten.
»Ich will Eure Frage nachher gern beantworten, doch jetzt … jetzt müsst Ihr mich entschuldigen!«
Er stieg hinter der Tochter her die Leiter hinunter und eilte mit ihr zusammen die Treppe hinab.
»Hat er dir einen Namen gesagt, Katrin? Hatte er etwas bei sich? Wie sah er aus? War es Gaßner?«
Ein Feuerwerk aus Fragen prasselte auf die Tochter ein und prallte von ihr ab.
»Ihr werdet es sehen, Vater, hat er mir zu sagen aufgetragen. Mehr weiß ich nicht«, war alles, was er aus Katrin herausholen konnte. Sie hatte etwas vom Dickkopf ihres Vaters geerbt, stellte Buschmann fest.
Der Handwerker war außer Atem, als sie am Ende der Treppe anlangten. Mit seinem massigen Körper drängte er sich an der Tochter vorbei und warf sich gegen die Tür. Sie klemmte seit Jahren von innen, ohne dass es den Türmer störte. Als die Pforte hinter ihnen wieder zufiel, ließ er sich zusätzlich mit dem Rücken dagegen fallen. So klemmte sie stärker. Pater Eginald würde sich mit dem Öffnen schwertun – wenigstens eine kleine Rache für die verpasste Gelegenheit, die vergrößernde Wirkung des Kristalls am Venusaufgang zu versuchen.
Meister Buschmann hastete am Rathaus entlang bis zur Wintergasse und dort zu seiner Werkstatt. Er öffnete das Tor und wartete einige Augenblicke, bis er zu Atem gekommen war. Dann wischte er sich die Augen mit den Ärmeln seines Wamses frei, überquerte den Innenhof und betrat die Stube.
»Katrin, lass uns bitte allein!« Ohne weiter auf das enttäuschte Gesicht seiner Tochter zu achten, schloss er hinter sich die Tür.
Erleuchtet wurde der zu dieser Abendstunde beinahe nachtdunkle Raum nur durch zwei einsame Kerzen, die auf dem Fenstersims standen, und durch ein Kaminfeuer, das vor sich hin glühte. Zwei Truhen und ein Tisch füllten den Raum, dazu ein Lesepult und zwei Stühle. Meister Buschmann genoss die Hitze, die ihn wie eine warme Decke umhüllte. Dann sah er den Mann, der lässig gegen das Stehpult lehnte und ihm entgegensah.
»Gaßner!«, entfuhr es dem Handwerker. Er konnte seine Aufregung nicht verhehlen.
»Ich dachte, Ihr würdet gar nicht mehr kommen«, wurde Meister Buschmann in Deutsch mit venezianischem Singsang begrüßt. »Oder musstet Ihr Euch aus dem Abendgebet stehlen?«
»Weder das Eine noch das Andere, Gaßner«, erwiderte der Handwerker und eilte, die ausgestreckte Hand reichend, auf den Patrizier zu. Dessen Gestalt verschmolz beinahe mit der mühsam durch Kerzen und Kaminglut zurückgedrängten Dunkelheit. Nur das Gesicht leuchtete aus der ebenfalls schwarzen Kleidung hervor. »Ein wenig habt Ihr von einem Teufel«, fasste Buschmann seinen Eindruck zusammen. Der dunkle Teint, die schwarze Kleidung, das finstere Gemach, Grund genug, an die Gestalt des Gottseibeiuns zu denken.
»Sind wir nicht über diesen Aberglauben hinaus und können uns unterhalten wie gesittete Menschen?« Gaßner, dessen Kinn- und Mundpartie unter einem lockigen Bart verschwand, verzog keine Miene. Kräftig schüttelte er die dargebotene Hand.
»Was habt Ihr mir mitgebracht, Gaßner?« In Buschmanns Stimme zitterte nicht nur die Anstrengung, sondern auch die Gier nach Neuem.
Der Ratsherr hüstelte. »Fein. Ihr kommt ohne Umschweife zur Sache. Dafür liebe ich Euch. Ihr hättet selbst Kaufmann werden sollen, Buschmann!«
»Heraus mit der Sprache. Was habt Ihr dabei? Einen neuen Plato? Eine Schrift des Aristoteles? Gedichtzeilen des Epikur? Was?«
Stumm zog Gaßner ein Blatt aus dem Revers des Ärmels und wedelte damit vor der Nase des Handwerkers herum. Dieser konnte seine Enttäuschung kaum verbergen.
»Ein einziges Blatt nur?«
»Ein ganz besonderes diesmal. Ihr wisst, dass ich kein Griechisch beherrsche.« Gaßner machte eine Pause, in der Buschmann das Knarren des Gebälks zu hören glaubte. »Eine Zeichnung mit Erklärungen.«
Mit einer hitzigen Bewegung riss der Instrumentenbauer dem Kaufmann das Pergament aus der Hand und legte es auf eines der Lesepulte im Raum. Dann ergriff er die ihm zunächst stehende Kerze und stellte sie ans Kopfende. Erst danach faltete er das Blatt auf und strich es glatt. Es widersetzte sich seinen Bemühungen, wollte immerfort in die alte Form zurückspringen.
»Echtes Pergament«, konstatierte er. Seine Augen leuchteten, als er die Zeichnung überflog. Er ließ die Finger über das Blatt gleiten. »Eine Arbeit aus den Werkstätten Pergamons. Die Schrift«, er zog seine Linse aus dem Ärmel und spähte hindurch, »die Schrift eindeutig ein Griechisch aus der Blütezeit des Ptolemäus. Sogar ein Name am unteren Ende: Aristarchos von Samos. Ich habe noch niemals von ihm gehört. Ein Unikat demnach. Ein wundervolles Blatt, Gaßner. Die Abbildung …«
Begeistert sah er von der Handschrift auf und Gaßner ins Gesicht.
Die Augen des Händlers funkelten. »Ein Fund, Meister Buschmann! Umso mehr, wenn Ihr zu hören bekommt, wer sich dafür interessiert.«
Wieder beugte sich der Handwerker über das Blatt. Er roch an der Tinte, leckte die Tierhaut an einer unbeschrifteten Stelle ab, dann griff er erneut nach seinem Kristall und fuhr damit die Schriftzeichen ab.
»Ein wundervoller Text. Schwierig zu übertragen, weil das Griechische ungewohnt klingt, als hätte sein Schreiber es nicht beherrscht«, keuchte er. »Die Zeichnung?« Meister Buschmann machte eine Pause, weil er nicht recht wusste, wie er sie deuten sollte. »Ich weiß nicht, was sie darstellt.«
»Die Regierung Venedigs, die Signoria, interessiert sich für dieses Manuskript, Buschmann. Sie sind ganz verrückt danach, zu wissen, was darauf dargestellt wird. Ich habe das Blatt nur bekommen, weil ich versprechen konnte, dass in meiner Heimatstadt Instrumentenbauer leben, die in der Lage sind, solche Geräte herzustellen. Es ist das beste Geschäft seit langer Zeit.«
Buschmann runzelte die Stirn. »Ich fürchte, Ihr habt Euch von Eurer Begeisterung blenden lassen. Ich selbst kann Euch da wenig weiterhelfen.«
Das Gesicht des Kaufmanns war fahl unter der gebräunten Haut, als Meister Buschmann aufsah.
»Ihr habt keine Ahnung, was Ihr da sagt, Buschmann. Das ist kein x-beliebiges Manuskript, das wir an Peutinger oder andere Humanisten weitergeben können. Venedig will ein Ergebnis sehen. Ich stehe in der Pflicht Messer Matteos.«
Buschmann drohte spielerisch mit dem Zeigefinger. »Ihr wisst, dass der Schmuggel mit Manuskripten verboten ist!«
Gaßner überhörte den Einwand.
»Nennt einen Preis, die Signoria wird zahlen, glaubt mir. Ich habe mich an Euch gewandt, weil die Zeichnung nämlich in ein Gebiet fällt, das Euch besonders am Herzen liegt.«
Eines war Buschmann klar: Gaßner hatte sicherlich viel Geld für das Manuskript bezahlt. Erneut beugte er sich über das Pergament.
Neben einer Beschreibung enthielt das Blatt eine Zeichnung, ein Durcheinander von Rädchen und Stangen, von Zifferblättern und Zahnkränzen und Schrauben. Er konnte die Stifte und Räder, die er zu sehen glaubte, nicht recht zuordnen. Ein Wirrwarr aus zarten Linien und Kreisen, aus Zacken und Spiralen, aus Zeigern und Ziffern füllte die Blattmitte. Die Begriffe der Beschreibung nahmen ihn jedoch sofort gefangen: Sonne, Mond, Sterne stand dort in griechischen Lettern. Himmelslinie, Tagundnachtgleiche und Sonnenwende, hora für Stunde, sphaira für das Himmelsgewölbe. Wie diese Begriffe allerdings zueinander in Beziehung standen, das konnte er auf die Schnelle aus der Zeichnung nicht herauslesen.
Der letzte Satz des Manuskripts ließ ihn schlucken. Dort stand, als gehöre der Satz nicht zum restlichen Bild und dennoch in derselben Schrift, in denselben Lettern etwas von einer »Kenntnis der Unsterblichkeit …«
Und brach unvermittelt ab. Wie versteinert blickte der Handwerker für einen flackernden Augenblick darauf, dann stieß er den angehaltenen Atem aus und wandte sich an den Kaufmann.
»Gaßner, Gaßner. Ich denke, der Inhalt ist bedeutend. So etwas denkt sich niemand aus. Lasst es mich studieren. Lasst mir Zeit.« Buschmanns Stimme zitterte leicht, und er wusste, dass diese Erregung seinem Gegenüber nicht verborgen blieb. Es war kein gewöhnliches Blatt, das er hier in Händen hielt, so viel war sicher. Er durfte es Gaßner nur nicht zu deutlich spüren lassen. Diesem letzten Satz musste eine Bedeutung innewohnen. »Ich werde mich bemühen – wie immer.«
»Ihr werdet mehr als das, Meister Buschmann. Holt Euch einen Übersetzer, der des Griechischen mächtiger ist als Ihr, holt Euch einen Meister der Feinmechanik. Baut das Gerät. Ihr werdet ein Vermögen verdienen. Ein halbes Jahr, dann stehe ich wieder vor Eurer Tür!«
Erster Teil
»Wahr, wahr, ohne Zweifel und gewiss:
Das Untere gleicht dem Oberen, und das Obere dem Unteren, zur Vollendung der Wunder des Einen.«
HERMES TRISMEGISTOS, 1415
Kapitel 1
Katrin hatte den jungen Burschen längst bemerkt, der sich in der Märzsonne vor dem Haus ihres Vaters herumdrückte. Sie strich ihr Horoskopblatt glatt, das sie für diese Woche errechnet hatte: Mars und Jupiter standen im Quadranten und verhießen größere Spannungen.
Durch die Lamellen der Fensteröffnung spitzelte sie nach draußen und beobachtete, wie sich der Blondschopf mit den leuchtend blauen Augen dem Haus näherte, am Klingelzug vorbeistrich. Dann fuhr er mit der Hand über dessen Kugelgriff, betrachtete ihn verstohlen und zog doch nicht daran. Als wollte er dessen Temperatur spüren, strich er abermals mit den Fingerspitzen darüber, nachdem er sich vergewissert hatte, dass niemand ihn beobachtete, und richtete sich schließlich auf.
Katrin lächelte. Mit dieser Spannung wäre sie zufrieden. Sie warf einen flüchtigen Blick auf ihre Zeichnung. Venus störte in diesem Bild und brachte eine unbestimmte Unruhe hinein.
Rasch wechselte der Junge die Straßenseite, ging zwei Häuser weiter, blieb stehen, machte kehrt und kam auf der gegenüber liegenden Seite zurück. Er schielte erneut zu ihnen hinüber. Katrin hätte am liebsten laut losgelacht und den Burschen gehänselt, wenn nicht etwas an ihm gewesen wäre, das sie gleichzeitig beunruhigte. Er war kein Augsburger, das war unschwer an der Kleidung zu erkennen. Ein Geselle auf Walz vermutlich, ein Zünftling, der bei ihrem Vater Brot und Übernachtung erbitten wollte. Die Unsicherheit des Jungen war dennoch nicht die der üblichen Gesellen, wenn sie vor der Türschwelle standen. Etwas Lauerndes schwang in der Art mit, mit der er wohl zehnmal auf und ab lief und das Haus in Augenschein nahm, als suche er darin etwas.
Katrin beschloss, dem Spiel ein Ende zu bereiten. Dies war kein Haus, das man ausspionierte, sondern die Werkstatt eines ehrbaren Instrumentenbauers. Außerdem konnte Mars im aufsteigenden neunten Haus ja auch bedeuten, dass sie die Dinge in die Hand nehmen musste.
Sie legte die Wäsche, die sie falten musste, aus der Hand und band sich ein Tuch um den Kopf, während sie die Treppe hinabeilte und vor die Tür trat. In der engen Häuserschlucht war es heller als im Haus, sodass sie kurz die Augen schließen musste. Als sie sich an das Licht gewöhnt hatte, das aus Süden direkt in die Zeile einfiel, war der Junge verschwunden.
Sie sah die Straße hinauf und hinunter, konnte den blonden Lockenkopf jedoch nirgends mehr entdecken. Missgestimmt zog Katrin die Stirn kraus. Wo hatte sich der Kerl versteckt? Katrin ging die beiden Stufen zur Straße hinab und wandte sich nach rechts. Sie hätte gern gesehen, ob die Ebenmäßigkeit seiner Gesichtszüge der Wirklichkeit entsprach oder ob die Entfernung täuschte. Wie oft war sie schon vom garstigen Aussehen der Gesellen enttäuscht gewesen.
»Sucht Ihr mich, Jungfer?«
Wie aus dem Boden gewachsen stand der Geselle plötzlich vor ihr. Katrin machte einen Sprung zurück, weil sie sonst unweigerlich mit ihm zusammengestoßen wäre. Dabei knickte sie um und strauchelte. Eine kräftige Hand packte zu und verhinderte, dass sie in die Gosse fiel.
»Äh ja. Nein. Ich meine … Danke. Entschuldigt.«
Katrin stotterte vor sich hin, während der Jüngling weiter ihren Arm gefasst hielt, bis sie wieder ihr Gleichgewicht gefunden hatte. Jetzt erst wurde ihr bewusst, was geschehen war.
»Was fällt Euch ein, so vor mir aufzutauchen, dass ich mich beinahe zu Tode erschrecke?«, fauchte sie. »Lasst endlich los!«
Sie befreite sich mit einer ungestümen Handbewegung von ihm, was ihr sofort leidtat. Schließlich hatte er ihr geholfen. Der Geselle ignorierte ihren Wutausbruch.
»Ihr beobachtet mich schon eine ganze Weile, Jungfer. Und ich frage mich, warum. Weil ich ein Fremder bin?«
Unwillkürlich nickte Katrin. Ihr gefiel die Art, wie der Junge sprach. Es klang weich und melodisch. Allerdings hörte man deutlich, dass er nicht aus der Gegend stammte. Trotzdem verstand sie beinahe alles, was er sagte.
»Fremde sind Feinde. Man kann nicht vorsichtig genug sein, wenn man ihnen begegnet.«
Jetzt lachte der Junge kehlig und wirkte dadurch reifer, als sie gedacht hatte, beinahe erwachsen. In seinem Lachen lagen Erfahrung und Weltklugheit.
»Dann müssen wir die Fremdheit überwinden. Am besten beginne ich damit, denn ich bin hier der Eindringling. Ich bin Florint.« Er streckte ihr seine Hand entgegen, die fein geschnitten und doch kräftig war. »Aus Straßburg. Geselle auf Wanderschaft und Instrumentenbauer.«
»Wie Papa!«, sagte Katrin und hielt sich sofort die Hand vor den Mund. Sie war zu rasch mit ihrem Mundwerk. Vorsichtig, als berührte sie eine Ofenplatte und wollte testen, ob sie heiß sei, schlug sie in die dargebotene Hand ein.
»Jetzt müsst Ihr mir nur noch sagen, wir Ihr heißt. Das gehört sich so«, grinste Florint sie an.
»Ka-Katrin«, stotterte Katrin, die völlig überrascht war und sich für einen Augenblick ganz vom Zauber seiner weichen Stimme einhüllen ließ.
»Gut«, antwortete er. »Damit wäre das geklärt. Jetzt seid ehrlich zu mir: Ist dies die Werkstatt Meister Buschmanns?«
Katrin, der plötzlich bewusst wurde, dass sich der Geselle nicht für sie, sondern für ihren Vater interessierte, öffnete bereits den Mund für eine spöttische Erwiderung, doch der Ausdruck auf dem Gesicht des Jungen verhinderte dies. Es war ein gespieltes oberflächliches Interesse, doch dahinter lauerte eine gewisse Spannung.
»Was wollt Ihr von Meister Buschmann?«
Die Frage stellte sie, ohne darüber nachgedacht zu haben. Ihre Gedanken gingen in eine ganz andere Richtung. Sie wollte ihn einen Spionierer heißen, einen Herumschleicher, doch sie brachte die Worte nicht auf die Zunge. Diese war wie gelähmt für ihren Spott.
»Ich will … ich will mich bei ihm verdingen. Als Geselle«, antwortete der Junge. »Wenn er einen braucht.«
Dabei sah er sie auf so eine durchdringende Art an, dass ihr unheimlich zumute wurde. Sein helles Gesicht leuchtete geradezu, und Falschheit und Verschlagenheit konnte sie in seinen Augen auch nicht finden, eher eine Art Schleier, der sich während ihrer Musterung über seinen Blick legte, als verberge er etwas darunter.
»Könnt Ihr für mich ein gutes Wort bei ihm einlegen?«
Katrin zuckte unter dem Satz zusammen. Etwas stimmte nicht mit diesem Gesellen. Er meinte es nicht ehrlich, so viel spürte sie – und doch log er wieder nicht. Er schwindelte oder versuchte zumindest, die Wahrheit hinter seinen Worten zu verbergen, das spürte sie mit aller Macht ihrer weiblichen Intuition. Dabei lehnte er sich betont lässig gegen die Hauswand und spielte mit der Holzkugel des Klingelzugs, ließ seine Hand darübergleiten, als prüfe er sie.
Dennoch nickte sie und sagte: »Das müsst Ihr meinen Vater schon selbst fragen.«
»Dann frage ich ihn«, sagte der Fremde kurz entschlossen, fasste sie bei den Schultern und drehte sie in Richtung Hauseingang. »Weist Ihr mir den Weg, Jungfer Katrin!«
Katrin wollte so nicht behandelt werden, doch das schöne Gesicht und der angenehme fremde Ton in der Stimme des Gesellen ließen eine Widerrede nicht zu. Sie griff nach seiner Hand und zog ihn hinter sich her ins Haus.
Katrin ging in den dunklen Flur voraus, der nach hinten zur Werkstatt führte. Die Arbeitsstätte des Vaters lag über dem Hof auf der anderen Seite. So trat Katrin links in den Tordurchgang hinaus, weil sie ihn nicht durch die Wohnstube führen wollte, und sie gelangten in den Innenhof, der von drei Wänden umstanden war und nach hinten in einen Garten hinauslief, an dessen Ende eine mannshohe Mauer das Grundstück zum Nachbarn hin abschloss.
Während sie noch im Halbdunkel der Durchfahrt standen, trat Meister Buschmann mit einem Mann auf den Hof hinaus. Katrin blieb unwillkürlich stehen. Sie wollte nicht, dass der Geselle die Kunden seines Meisters bereits jetzt kennen lernte. Was sie nicht verhindern konnte, war, dass er das Gespräch mithörte.
»Ich sagte es Euch doch, Gaßner, ich habe das Dokument nicht. Der Kerl hat es mitgenommen!«
Der Mann in einem Mantel mit dichtem Pelzbesatz um den Hals und auf der Brust rieb sich mit dem abgewinkelten Zeigefinger die Nase und zuckte schließlich mit den Schultern.
»Wenn ich wüsste, wie weit Ihr seid, Meister Buschmann, wäre mir wohler. Mit dieser Maschine, meine ich … diesem … ach, ich weiß nicht was.«
»Oh«, nickte Buschmann und legte den Arm um die Schulter des Mannes. »Ein Ich-weiß-nicht-was ist eine gute Umschreibung dessen, was sich darin an Zahnrädern und Scheiben tummelt, Gaßner.«
Gaßner holte tief Atem und gab sich einen Ruck.
»Ich dachte mir … nun, Ihr seid ein vorzüglicher Handwerker …« Er räusperte sich.
»… kurz und gut«, ergänzte Meister Buschmann unbeeindruckt, »Ihr zahlt mir eine erkleckliche Summe dafür, dass ich Euch dieses Gerät baue. Aber ich kann keine Wunder vollbringen.« Der Handwerker senkte die Stimme. »Vor allem seit dieser Kerl auf und davon ist.«
»Wunder verlange ich nicht. Aber die Signoria wird ungeduldig.«
»Die oder Ihr, Gaßner?«, spottete Meister Buschmann. »Ihr Kaufleute habt keine Ahnung.«
Auf der Stirn des Mannes, den Buschmann Gaßner genannt hatte, hatten sich Schweißperlen gebildet. Mit der flachen Hand wischte er sie fort.
Der Instrumentenbauer hatte den Mann nach hinten in den Garten geführt. Zur Hofgrenze hin tummelten sich drei Ziegen in einem Gatter. Kurz davor lehnte eine Leiter. Jetzt nahm er die Leiter von der Wand und ließ den Kaufmann über sie weg in den Nachbarhof hinüberklettern. Katrin wunderte sich über dieses ungewöhnliche Verhalten nicht, wusste sie doch, dass sich so mancher Kunde allein aus Angst vor der Inquisition nicht gern hier blicken ließ. Bevor der Kopf des Kaufherrn hinter der Mauer verschwunden war, ergriff dieser noch einmal das Wort.
»Noch mehr Geld? Ihr habt doch schon …«
»Handelt nicht!«, polterte Buschmann. »Es ist schwierig genug, die Dominikanerbrut aus allem herauszuhalten.«
Gaßner räusperte sich, lächelte, wurde wieder ernst und sagte dann: »Das leidige Geld. Nun ja … Ihr bekommt es.«
Jetzt lachte Meister Buschmann spöttisch. »Ich kenne euch Krämer! Um jeden Pfennig muss man feilschen.«
Mittlerweile war der Kaufmann hinter der Mauer verschwunden. Buschmann wurde ernst und stieg drei Stufen der Leiter empor. »Kein Geld, keine Maschine«, rief er dem Mann nach, der bereits im Nachbarhof verschwunden war.
Meister Buschmann lachte, als er von der Leiter herabstieg und sie wieder zurückstellte.
Jetzt erst trat Katrin, Florint hinter sich her führend, aus der Toreinfahrt heraus.
»Vater«, rief sie. »Ein Geselle aus … aus …«, sie wusste nicht mehr, woher er stammte, und schalt sich eine Närrin.
Mit raschem Schritt trat der Junge hinter ihr hervor und ging auf ihren Vater zu.
»Aus Straßburg, Meister Buschmann! Euer Ruf dringt bis an die Grenzen des Heiligen Römischen Reiches«, sagte er und schmeichelte damit dem Instrumentenbauer. Katrin bemerkte jedoch, wie ihr Vater blass wurde. Rasch blickte er zum Werkstattgebäude hinüber, als wollte er nicht, dass der Junge es betrat.
»Aus Straßburg. So, so.« Ein Schatten legte sich über das Gesicht des Meisters. »Und wie heißt du?«
»Florint«, sagte der Geselle und zögerte.
Der Name schien ihren Vater zu erleichtern. Er nickte nur.
Der Junge ließ ihn nicht aus den Augen. »Ich habe bei Meister Deroubaix gelernt!«, ergänzte er bestimmt.
Die Erwähnung dieses Namens übte auf ihren Vater eine eigenartige Wirkung aus. Zuerst wurde er blass, dann hochrot im Gesicht. Er suchte nach einer Leitersprosse, um sich daran einzuhalten.
»Auf Wanderschaft bin ich, Meister Buschmann«, fuhr Florint fort. »Heute bin ich angekommen und vom Zunftoberen der Stadt an Euch verwiesen worden. Ich möchte bei Euch gern in die Lehre gehen.«
»Ihr seid flott bei der Sache und geradeheraus. In die Lehre also«, wiederholte der Instrumentenbauer leise. Er schüttelte mehrere Male den Kopf und schien in sich hineinzublicken. Dann ließ er den Jungen stehen, eilte zur Werkstatt hinüber, trat ein und machte die Tür hinter sich zu. Katrin hörte den Schlüssel sperren.
Florint drehte sich verwirrt zu Katrin um, die das Verhalten des Vaters ebenfalls verwunderte. Sie zuckte mit den Schultern.
»Er ist manchmal etwas – seltsam. Macht Euch nichts draus.«
Doch da erschien Meister Buschmann bereits wieder in der Tür. Er hielt sich am Rahmen ein und musterte Florint von oben bis unten.
»Geselle also. Nun denn. Und bei Meister Deroubaix in die Lehre gegangen. Wenn Ihr mit dem Arbeiten nur annähernd so schnell seid wie mit dem Reden, soll’s mir recht sein. Zeig ihm die Kammer, Katrin. Dann essen wir.«
Mit diesen Worten schloss er erneut die Tür.
Katrin warf Florint einen Blick zu, den dieser mit einem Achselzucken erwiderte. »Wenn’s dem Meister recht ist …«
»Dann kommt!«
Sie wandte sich um, ging vor Florint her ins Haus und geleitete ihn bis unters Dach.
»Klein, aber fein!«, sagte sie und warf ihm einen koketten Blick zu, den er gern erwiderte. »In einer Viertelstunde in der Küche unten.«
Florint nickte. Dann schloss Katrin die Tür, und er stand allein im Raum.
Das Zimmer war gerade so hoch, dass er sich nicht bücken musste. Lange starrte er auf die Tür. Schließlich zog Florint sein Wams aus, drehte es um und fingerte aus dem Saum am Rücken ein Stück Papier. Vorsichtig faltete er den Zettel auf und strich ihn glatt. Dreieckig war er und an einer Seite ausgefranst, als hätte man ihn von einem Büttenblatt abgerissen. Nur wenige Worte standen darauf, geschrieben in einer bräunlichen Tinte, die ihn an getrocknetes Blut erinnerte: »Augusta Vindelicum. Pax tibi Marce. Der Himmel bewegt sich nicht. Hilf mir«, las er, und auf der Rückseite hatte eine zittrige Hand »Florint Deroubaix, Straßburg« notiert, und darunter stand das Plejadenzeichen, eingestochen mit einem spitzen Gegenstand: das Zeichen seines Vaters.
Lange starrte Florint darauf, bis Wörter und Zeichen vor seinen Augen verschwammen. »Augusta Vindelicum« verstand er, deshalb war er hier. Augsburg. Sein Vater war hier in der Stadt gewesen. Doch alle anderen Sätze hüllten sich in ein geheimnisvolles Dunkel.
Vierzehn Tage hatte der Brief bis nach Straßburg gebraucht, so jedenfalls hatte es ihm der Fugger’sche Fuhrmann versichert, der ihm die Nachricht ausgehändigt hatte. Durch wie viele Hände der Wisch noch gegangen war, konnte Florint nicht einmal vermuten, schätzte jedoch, dass weitere zwei Wochen darüber vergangen waren, bis er bei dem Fuhrwerker gelandet war. Zwei Wochen hatte er selbst von Straßburg hierher gebraucht. Alles in allem mochten zwei Monate vergangen sein, seit die Sätze aufs Papier gefunden hatten, geschrieben mit dem Blut seines Vaters. Florint hielt das Papier in der offenen Hand. Er hatte nicht einmal die Hoffnung, dass er noch rechtzeitig kommen würde, um ihm helfen zu können.
Jetzt schloss er die Augen und atmete tief ein und aus. Endlich war er auf eine Spur gestoßen.
Er steckte das Papier zurück in sein Wams und machte sich auf zum Essen. Er würde herausfinden, was mit seinem Vater geschehen war.
Kapitel 2
Der nächste Tag sah Katrin früh auf den Beinen. Sie legte Holz im Herd nach, damit das Wasser für den Hirsebrei warm war, bis sie vom Brunnen zurückkam. Dann nahm sie die beiden Kübel auf und trat in den Hof hinaus. Die kühle Morgenluft strömte erfrischend in ihre Lungen. Katrin mochte diese Stimmung, wenn die Nacht ihr samtenes Tuch sanft von den Wangen des Morgens zog. Außer ihr stand niemand mit der Sonne auf, Vater schon gar nicht, wenn er bis spät nachts in seiner Werkstatt gearbeitet hatte. Er war ein Mensch der Dunkelheit, sie einer des Tagesanbruchs.
Sie schlüpfte in das Holzhäuschen, um ihre Notdurft zu verrichten. Danach schleppte sie die beiden Zinkeimer zum Hoftor.
Überrascht bemerkte sie, dass das Tor einen Spalt breit offen stand. Hatte Vater gestern vergessen, den Riegel vorzulegen? Er war sicher nicht vor ihr aus dem Haus gegangen. Sie musste nämlich durch das Elternschlafzimmer hindurch, wenn sie aus ihrem Zimmer wollte. Und sie hatte ihn im Bett liegen sehen und schnarchen hören.
Wer hatte das Tor geöffnet? Jetzt ließ die frische Morgenluft sie frösteln, und ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Es war nicht das erste Mal, dass man bei ihnen eingebrochen hatte. Rasch blickte sie um sich, ob in der Dunkelheit des Tordurchgangs jemand lauerte. Ebenso aufmerksam ließ sie ihren Blick über den Innenhof schweifen, soweit sie ihn übersehen konnte, doch sie entdeckte nichts und niemanden. Sie packte die Eimergriffe fester und drückte mit der Schulter das Tor ganz auf. Auch auf der Gasse befand sich niemand. Alles schien ruhig. Hin und wieder hörte sie Kindergeschrei aus einem der oberen Fenster. Es war Zeit, die Wickelkinder zu stillen und zu säubern. Katrin lief rasch die Gasse entlang und zum Herkulesbrunnen hinüber. Ein eigenartiges Gefühl kitzelte ihr im Nacken, als werde sie beobachtet.
Außer ihr stand noch Sarah Beitel am Brunnen, eine der Mägde aus dem Fuggerhaus. Sie trafen sich beinahe jeden Morgen. Auch die Sarah war solch eine Frühaufsteherin wie sie.
»Einen schönen Morgen, Sarah!«, begrüßte Katrin die dunkeläugige Magd, die mit ihrem vollen Zuber bereits auf sie wartete.
»Wen schleppst du denn mit dir herum?«, grüßte diese zurück und zog die Augenbrauen hoch. »Oder hast du von deinem Verehrer noch nichts bemerkt?«
Katrin runzelte die Stirn.
»Ich habe keinen Verehrer«, protestierte sie.
»Dann solltest du dich umsehen, Jungfer Katrin«, spottete Sarah. »Er ist etwa so groß wie du, hat blonde Haare und ein schmal geschnittenes Gesicht!«
»Florint!«, entfuhr es Katrin unwillkürlich.
»Ach, dann kennt man den jungen Mann doch? Du wirst mir eine beste Freundin sein, wenn du mich in deine Liebeleien nicht einweihst.«
Im Augenblick konnte Katrin nicht an Sarah denken. Warum schlich der neue Geselle um diese Zeit hinter ihr her? Hatte er womöglich das Tor geöffnet?
»Du verstehst gar nichts!«, wischte sie ihrer Freundin über den Mund. Dann füllte sie stumm ihre beiden Eimer bis an den Rand. Nur unter großen Mühen gelang es ihr, die überschwappenden Gefäße über den Brunnenrand zu wuchten.
»Nimmst du dir nicht etwas zu viel vor, Katrin?«, versuchte Sarah die Stimmung aufzulockern.
Katrin lachte sie schelmisch an. Ihr momentaner Ärger war wie weggeblasen. »Die sind nicht für mich, die sind für meinen Verehrer. Wer mir heimlich hinterhergeht, der kann mir auch tragen helfen. Dann muss ich nachmittags kein zweites Mal kommen.«
Jetzt lachte auch Sarah aus vollem Hals.
Katrins Plan ging auf. Kaum hatte sie die beiden übervollen Eimer über den Weinstadel geschleppt und war in die Gasse, die zur Werkstatt führte, eingebogen, vertrat ihr Florint den Weg.
»Kann ich Euch helfen?«
Seine hellen Haare hatte er glatt nach hinten gebürstet. Im fahlen Morgenlicht sah man, dass er noch keine Zeit gefunden hatte, sich zu rasieren. Die Stoppeln ließen seine vollen Lippen deutlich hervortreten. Mit Augen wie ein Sommerhimmel so blau sah er sie an, und Katrin fühlte ein Prickeln auf Hals und Wangen. Männern wie diesem begegnete man in Augsburg nicht alle Tage.
Sie stützte die Fäuste in die Hüfte.
»Eure Spezialität ist es wohl, unverhofft vor mir aufzutauchen und mich zu Tode zu erschrecken.« Ihre wütende Attacke zeigte Wirkung. Florint blickte sie betroffen an. »Helft mir wenigstens mit den Eimern, damit Ihr zu etwas nütze seid!«
Sofort bückte sich der neue Geselle, und Katrin glitt ein Lächeln über das Gesicht. Florints Eifer tröstete sie ein wenig. Er packte beide Eimer gleichzeitig und schleppte sie die Gasse entlang bis zur Toreinfahrt. Auf dem gesamten Weg sprachen sie kein Wort miteinander.
»Habt Ihr das Tor aufstehen lassen, Florint?«, fragte sie beiläufig, als sie das Tor erreichten.
»Nein. Ihr habt es doch geöffnet. Ich bin Euch nur nachgegangen.«
Jetzt war Katrin ein wenig verblüfft.
»Man geht also einfach den Mädchen nach«, sagte sie spöttisch. »Und das Tor habt Ihr wirklich nicht aufgemacht?«
»Nein«, erklärte Florint energisch.
Katrin glaubte ihm kein Wort. Dennoch ließ sie den Blick nachdenklich über den Innenhof gleiten. Wer war in der Lage, den Riegel wegzuziehen? Nur jemand, der wusste, dass man den Innenhof durch das Haus gegenüber betreten konnte. Doch Vater hatte die Leiter entfernt, nachdem Gaßner über die Mauer gestiegen war, und sie lehnte noch immer dort, wo er sie hingestellt hatte, an der Werkstatt nämlich. Wenn Florint jedoch die Wahrheit sagte … Sie mochte gar nicht daran denken, was das bedeutete. Der Dieb war womöglich noch hier.
»Lasst die Eimer stehen und kommt!«, herrschte sie Florint an, packte ihn am Ärmel und zog ihn hinter sich her zur Werkstatt. Als sie auf die Tür zuging, schien ihre schlimmste Befürchtung sich zu bestätigen. Die Tür war nur angelehnt. Ein schwarzer Spalt klaffte zwischen Türblatt und Zarge. Derjenige, der sie geöffnet hatte, hatte sie nicht mehr ganz zugezogen. Weil es zu viel Lärm verursacht hätte?
»Es war jemand im Hof«, sagte Katrin nur und schob den verblüfften Florint vor sich her bis zur Werkstatttür.
»Ihr voran, Geselle«, betonte sie und deutete mit dem Kinn auf die Öffnung. »Wenn noch jemand im Raum ist, ist es besser, ich verstecke mich hinter Euch.«
»Aber …«, wollte Florint einwenden, doch Katrin unterbrach ihn.
»Los jetzt! Bis wir Vater wecken, kann der Dieb über alle Berge sein.«
Sie hörte Florint schlucken. Dann jedoch fasste er sich ein Herz, drückte die Tür auf und spähte ins Innere. Durch die Fenster auf allen drei Seiten strömte Licht in den Raum. Tatsächlich stand, mit dem Rücken zu ihnen, eine Gestalt an einem der Tische, beugte sich über irgendwelche Papiere und blätterte rasch darin hin und her, als suche sie etwas. Die Tür glitt lautlos ganz auf. Katrin deutete auf einen Prügel neben der Tür, auf dem ihr Vater sonst Kupfer dengelte. Florint griff danach und betrat den Raum, die Waffe zum Schlag erhoben.
»Was sucht Ihr da?«, rief Katrin hinter ihm in die Werkstatt hinein.
Die Gestalt drehte sich zu ihnen um. Das Gesicht lag im Dunkeln, sodass Katrin einige Augenblicke brauchte, bis sie erkennen konnte, wer dort stand.
»Katrin, Florint!«, rief Meister Buschmann ihnen entgegen. »Was tut ihr beiden hier in der Werkstatt? Und was soll der Knüppel in deiner Hand, Kerl?«
Kapitel 3
»Herein mit euch!«, sagte Meister Buschmann. »Und schließt die Tür hinter euch.«
Florint betrat den Raum und ließ seinen Blick wandern. Es war eindeutig das Herzstück der Werkstatt, ausgestattet mit drei Arbeitstischen, deren Arbeitsfläche bis auf Schulterhöhe reichte, wenn man davorsaß. Jeder Tisch war nierenförmig ausgeschnitten, sodass man beinahe in ihm saß und nicht vor ihm. Auf einer zweiten Ebene darunter lagen die Werkzeuge. Die Wände waren bedeckt mit Schränken und Halterungen, die grobe, große Hämmer und Feilen und Bohrer ebenso enthielten wie sauber aufgereihte Werkzeuge in kleinsten Größen, oft so winzig, dass man mit bloßem Auge Schwierigkeiten hatte, ihre Funktion zu erkennen. Feilen so dünn wie ein Haar, Drähte so fein wie ein Faden, Bohrer schlank wie Nähnadeln. An den freien Stellen der Wände hingen Zeichnungen und Aufrisse. Auf einem der Tische stand ein Messinggehäuse, dessen Innereien frei lagen und an dem ein zweiter Mann arbeitete.
»Das ist mein Altgeselle, Wolfhart. Er ist seit einem halben Jahr in meinem Dienst. Ein wenig wortkarg und verschlossen zwar, doch zuverlässig. Zuverlässigkeit schätze ich bei meinen Untergebenen am meisten.«
Florint nickte dem Gesellen zu, der kaum den Kopf bewegte und ihn von unten her misstrauisch musterte. Das Knurren, das er ausstieß, konnte ebenso »Willkommen« heißen wie »Mach, dass du weiterkommst!«.
Florint beschloss, diesen Rotschopf vorerst zu ignorieren. Im Schuppen roch es nach Metall und Schweiß, nach Öl und Kerzenwachs. Auf einem Messtisch vor dem Fenster lag eine Messingscheibe, deren Winkelgravur gerade neu geschnitten wurde. Er suchte die Wände ab, suchte nach einem Zeichen.
»Ich hoffe, der Knüppel hat nichts Schlimmes zu bedeuten«, knurrte Buschmann.
Florint wollte etwas erwidern, legte den Holzstock dann jedoch kommentarlos beiseite. Katrin nahm ihm die Entschuldigung ab.
»Er kann nichts dafür, Vater. Das Tor stand auf. Ich dachte, weil Ihr noch geschlafen habt, als ich aufgestanden bin, und das Tor offen stand, es … es wäre ein Fremder im Hof und in der Werkstatt.«
Die Wörter sprudelten nur so über ihre Lippen und fielen in hellen Kaskaden in den stillen Raum.
»Es war jemand hier«, sagte Meister Buschmann, seiner Tochter den Rücken zugekehrt. »Ich bin eben dabei, zu schauen, was fehlen könnte. Die neue astronomische Uhr jedenfalls hat den Eindringling nicht interessiert.«
Stattdessen fehlt eine der Zeichnungen, hätte Florint beinahe dazwischengeworfen. Ihm war der helle Flecken an der Wand sofort aufgefallen. Bei den Zeichnungen neben einem der Fenster klaffte eine Lücke. Da sie dem Meister nicht auffiel, konnte der das Blatt auch selbst abgenommen haben.
Dann aber wurde Florint auf etwas anderes aufmerksam. In der sonst so peinlich sauberen Hütte war über einer der Werkbänke ein Papier an die Wand geheftet, dem eine Ecke fehlte.
Sein Blick blieb an der Risskante hängen. Der Zettel seines Vaters besaß dieselbe dreieckige Form. An zwei Seiten glatt beschnitten, doch an der dritten so zerfasert, als wäre es in höchster Eile von dem vor ihm hängenden Bogen abgetrennt worden.
Für einen Augenblick rief sich Florint den Papierfetzen in seinem Wams vor Augen: An einigen Stellen war er mit etwas Feuchtem in Berührung gekommen und hatte sich aufgelöst – mit Wasser oder mit Speichel. Florint drehte den Fetzen in Gedanken so, dass er zu dem Büttenblatt an der Wand passte. Plötzlich zitterten ihm die Hände. Er sah deutlich eine Szene vor sich, wie sein Vater sich in aller Hast umsah, weil er etwas zu schreiben brauchte, den Bogen erblickte, eine Ecke davon abriss und sie sich in den Mund stopfte. Dort würde sicherlich niemand das Papier entdecken.
Florint öffnete die Augen wieder. Auch wenn er sich nicht sicher war, ob alles sich so zugetragen hatte, wusste er, dass er auf dem richtigen Weg war.
»Bislang vermisse ich nichts.«
Die Stimme Meister Buschmanns holte Florint in die Werkstatt zurück.
Er lügt, dachte Florint sofort, und war froh, dass der Herrgott es den Menschen verwehrt hatte, sich gegenseitig ins Herz zu schauen.
»Wer sollte ein Interesse haben, die Werkstatt eines Instrumentenbauers zu durchstöbern. Oder arbeitet Ihr auch in Gold und Silber?«, wagte Florint einzuwerfen.
Unwillig schüttelte Buschmann den Kopf, als wolle er nicht darüber reden.
»Neue Gesellen sollten nicht fragen, sondern arbeiten. Ihr wollt heute Abend etwas zu essen? Dann verdient es Euch!«
Buschmann verschwand in einen Raum, den man im Schuppen gar nicht vermutet hätte und der nach hinten hinausführte. Es konnte nur ein schmaler Anbau sein, denn von außen sah man dem Gebäude diese Erweiterung nicht an.
Er brachte einen Filzkorb herein und stellte ihn auf den Gesellentisch, der nächst der Tür lag. Florint spähte hinein. Eine ganze Anzahl von Uhrwerken lag dort.
»Putzt und säubert mir die Werke, macht sie gangbar und ölt und fettet, wo es notwendig erscheint. Nächste Woche fahre ich aufs Land. Mal sehen, wie die Bauern dort auf Eure Arbeit anspringen werden.«
Erst als sich Florint an den Gesellentisch setzte, sah er, dass die Tür zur Werkstatt aufgebrochen worden war. Der Beschlag selbst war zwar heil geblieben, doch die Fassung des Zargen war aufgesplittert. Ein zweites Mal blickte Florint aufmerksam durch den Raum. Was verbarg der neue Meister hier, das für einen Dieb interessant sein könnte? Dann sah er es, das Zeichen, nach dem er gesucht hatte. Über dem gesplitterten Holz der Tür hatte eine sichere Hand das Trapez der Plejaden eingeritzt, mit den drei kaum sichtbaren Nebensternen. Das Siebengestirn. Florint schluckte. Sein Vater war demnach hier gewesen. Florint versuchte sich wieder auf das zu konzentrieren, was im Raum geschah.
»Ihr scheint es gelassen zu nehmen«, sagte er wie beiläufig, als er das erste Werk aus dem Korb nahm, konnte jedoch seine Erregung nur schwer beherrschen. »Habt Ihr Wasser zum Händewaschen?«, setzte er hinzu. »Solche Feinarbeiten fordern fettfreie Finger.«
Wolfhart, der Altgeselle, stand auf, reichte ihm Wasser und Seife und ein kleines Fläschchen mit Branntwein. Sorgfältig säuberte sich Florint die Hände, während er die Umgebung einer genauen Prüfung unterzog, ob er weitere Hinweise fand. Dann beugte er sich über die Arbeit, ohne Katrin weiter zu beachten.
Die stand, seit sie die Werkstatt betreten hatten, direkt hinter ihm. Bis auf die Rechtfertigung hatte sie nichts gesagt. Jetzt trat sie zu ihrem Vater und flüsterte ihm etwas zu. Sosehr Florint auch die Ohren spitzte, um zu verstehen, was die beiden miteinander tuschelten, so wenig gelang es ihm, auch nur Wortfetzen zu erhaschen.
»Soll ich dir Ohrmuscheln dengeln?«, fuhr der Altgeselle dazwischen, mit einem Blick, der Florint durchbohrt hätte, wenn dies möglich gewesen wäre.
Florint bemerkte, wie Meister Buschmann aufschaute, das Gespräch mit Katrin beendete und sie zur Tür hinausschob. Misstrauisch sah er zu Florint herüber.
Als die Tür zuschlug, versank die Werkstatt in Stille.
Florints Augen wanderten durch den Raum. Jedes Werkzeug prüfte er mit seinem Blick, jedes Papier suchte er nach der ihm bekannten Handschrift oder dem vereinbarten Zeichen ab, doch er fand es nirgends mehr.
»Bist du der einzige Geselle?«, begann er endlich ein Gespräch.
Der Altgeselle brummte Unverständliches. Ohne aufzusehen, feilte er an einem Zahnrädchen, das er in einen Fixieramboss eingespannt hatte.
»Ich … ich heiße Florint, Wolfhart«, setzte Florint erneut an. »Aus Straßburg!«
Die Reaktion erfolgte sofort. Der Altgeselle hörte auf zu feilen und ließ die Hände sinken. Unverwandt starrte er Florint an. Dabei verschwamm ihm der Blick und richtete sich nach innen. Florint hätte wetten können, dass er ihn nicht mehr sah.
»Straßburg?« Wolfhart räusperte sich mehrere Male ausführlich, als müsse er die Stimme erst wieder gängig machen. »Aus Straßburg?«
»Ja«, setzte Florint ein. Jetzt durfte er nicht lockerlassen. Die Erwähnung seiner Heimatstadt hatte unverkennbar eine Reaktion ausgelöst. »Ist das ungewöhnlich?«
Wolfhart schien wie aus einem Traum aufzuwachen. Plötzlich sahen seine Augen klar, der mürrische Zug um seinen Mund kehrte zurück, nur mit dem Feilen hielt er immer noch inne.
»Deroubaix!«, sagte er unvermittelt. »Deroubaix.«
Florint musste mehrmals durchatmen, musste seine Aufregung vergessen. Der Geselle kannte seinen Namen, obwohl er dem Meister nur verraten hatte, er habe bei einem Mann dieses Namens gelernt.
»War auf Wanderschaft in Straßburg. Schöne Stadt. Bin bei einem Deroubaix untergekommen. Guter Handwerker, guter Mathematiker und Konstrukteur. Danach ging’s weiter, nach Frankreich hinein, nach Paris – und später ins Welschland hinüber, nach Verona, Venedig. Schöne Zeit.«
Als hätte er für den Rest der Woche schon zu viel gesagt, brach Wolfhart einfach ab und konzentrierte sich wieder auf seine Arbeit.
»Deroubaix und Frankreich«, glaubte Florint den Altgesellen mehrmals murmeln hören. Er selbst konnte die Enttäuschung nicht ganz verbergen, dass Wolfhart nur in Straßburg gearbeitet hatte, einen Monat, womöglich zwei, und dann wieder fortgezogen war.
Andererseits fühlte er sich gespannt wie eine Feder. Wolfhart war in Straßburg bei seinem Vater gewesen, hatte ihn gekannt. Womöglich wusste er mehr. Ausfragen musste er ihn, löchern, was ihm bei der Wortkargheit des Mannes schwerfallen dürfte. Er zwang sich vorerst wieder über seine Arbeit, die mehr einem Geduldsspiel glich als einem vernünftigen Auftrag und ihm viel Zeit zum Denken ließ.
Er legte sich einen Plan zurecht, mit dem er aus dem Gesellen herauszukitzeln gedachte, was er wissen wollte. Von sich musste er erzählen, warum er hier war, was ihn dazu trieb, sich nach Augsburg zu begeben. Vielleicht sollte er auch sein Geheimnis lüften, die Tatsache …
Noch bevor er das Tuch von seiner Vergangenheit ziehen und den Gesellen weiter ausfragen konnte, betrat Katrin den Raum. Sie blieb auf der Schwelle stehen und winkte ihm nur. Florint wischte sich die Hände an einem Flicken sauber. Als er ihn auf den zweiten Gesellentisch legte, stach ihm erneut das Siebengestirn ins Auge. Mitten auf dem Tisch waren für Halterungen sieben Löcher gebohrt worden. Sieben Löcher in Form eines Trapezes mit drei Ausbuchtungen. Florint schrak auf, als Katrin ihn ansprach.
»Vater will dich sprechen!«, verkündete sie in einem Ton, als habe sie ihm die Entlassung mitzuteilen. »Und das schnell.«
Kapitel 4
Florint lag mit hinter dem Kopf verschränkten Armen in seiner Kammer und starrte in die Dunkelheit. Ein langer Tag hatte ihn angestrengt, hatte ihn müde gemacht, und zugleich fühlte er sich erregt. In seinem Innern brodelte es. Es war richtig gewesen, dass er seine wahren Beweggründe verschwiegen hatte, die ihn nach Augsburg gelockt hatten. Noch war es nicht an der Zeit, dieses kleine Geheimnis zu lüften. Obwohl seine Augen offen waren, sah er nichts außer dem schmalen Rechteck der Fensterluke, die auf Oberschenkelhöhe direkt unter der Traufe freigelassen worden war und bis zum Boden hinabreichte. Der Rest war Schräge. Doch er wollte sich über die Kammer nicht beklagen. Wenn er den Kopf durch die schmale Öffnung hinausstreckte, konnte er den Hof überblicken. Bis zur Werkstatt sah er hinüber.
Er fühlte, wie der Ärger über das Gespräch mit Meister Buschmann erneut sein Gemüt erhitzte.
Der Meister hatte ihm vorgeworfen, er sei der Einzige, der für diesen Schaden in Frage komme. Als einziger Fremder im Haus hätte er das Tor von innen öffnen können, denn von innen sei es geöffnet worden. Von außen sei das nicht möglich. Auch wenn er vielleicht nicht die Tür zur Werkstatt aufgebrochen habe – so viel Frechheit halte er für unmöglich –, so habe er doch durch seine Unvorsichtigkeit und seinen Übermut, so früh das Haus und den Hof zu verlassen, dem Diebstahl Vorschub geleistet und dem Unheil sozusagen Tür und Tor geöffnet. Meister Buschmann hatte getobt. Er wünsche nicht, dass seine Gesellen die Riegel selbstständig öffneten. Das sei seine Aufgabe – und mit einem Blick zu seiner Tochter hinüber betonte er, auch deren natürlich. Würde er, Florint, sich dieser Gepflogenheit widersetzen, kündigte der Meister an, müsse er ihn außerhalb des Anwesens in einem Zunfthaus unterbringen.
Mit gesenktem Kopf hatte Florint das Donnerwetter über sich ergehen lassen, hatte sich nicht gewehrt, obwohl ihm Unrecht geschehen und jedes Wort eine Beleidigung gewesen war.
Ganz in die Gedanken über seinen Ärger versunken, hätte er das Geräusch beinahe überhört. Ein Schaben und Scharren drang vom Hof herauf. Florint war sofort hellwach und richtete sich auf. Für einen langen Moment lauschte er in die Finsternis, die ihm alle möglichen Geräusche zutrug: das Huschen der Mäuse unter den Dielenbrettern, das Knacken der Balken, das Rascheln schlafender Vögel in den Ecken und Winkeln des Daches. Wieder drang ein Quietschen vom Hof herauf, das er sich nicht erklären konnte. Sein Gehör schien in die Nacht hineinzuwachsen. Er verdrängte seine Gedanken. Dafür war später noch Zeit. Jetzt musste er wissen, was dort unten geschah, umso mehr, als er sich geschworen hatte, die Demütigung Meister Buschmanns nicht auf sich beruhen zu lassen.
Langsam, um selbst keinen Laut von sich zu geben, erhob er sich und glitt zur Fensteröffnung. Auf dem Bauch liegend konnte er hinabschauen.
Schwarz lag der Hof unter ihm. Nicht einmal der Mond beschien die Fläche. Nur die Sterne warfen einen blassen Schimmer über Ziegel und Dächer, doch bis auf den Boden reichte ihre Kraft nicht.
Florint lauschte. Wenn er sich nicht täuschte, drang das Geräusch von der Werkstatt herüber. Ein verhaltenes Kreischen, als würden die Angeln des Holzschuppens aufgedrückt, bestätigte seinen Verdacht.
War es der Dieb, der sich erneut eingeschlichen hatte, um sein Werk zu vollenden? Aus den Läden, die Meister Buschmann am Abend sorgfältig geschlossen hatte, stahl sich Licht in feinen Strahlen auf den Hof. Wie Nadeln durchstachen sie die Schwärze der Nacht. Tatsächlich war jemand in die Werkstatt eingedrungen und hatte eine Kerze entzündet.
Dieser Umstand trieb Florint hoch. Sollte er hinuntergehen und Meister Buschmann wecken? Florint verwarf den Gedanken sofort. Er wusste nicht einmal, wo genau der Meister schlief. Und Wolfhart? Wolfhart war direkt nach dem Abendessen verschwunden, ohne dass Florint gewusst hätte, wohin.
Rasch schlüpfte er in Hose und Wams und öffnete die Tür. Wie ein Höllenschlund gähnte ihm die Stiege entgegen, schwarz und abgrundtief. Kein Kienspan glomm im Halter, keine Kerze bot einen noch so dürftigen Schimmer. Meister Buschmann war ein vorsichtiger Mann. Florint überlegte, ob er sich zu Tode stürzen oder wieder in sein Bett zurückkriechen sollte. Was gingen ihn die Diebstähle im Hause Buschmann an? Dann jedoch siegte seine Eitelkeit. Er war unschuldig und wollte das beweisen. Das konnte er nur, wenn er dem frechen Räuber das Handwerk legte. Jetzt hatte er Gelegenheit dazu.
Mit kleinen Schritten und den Händen an der Wand tastete er sich langsam die Treppe hinab. Jeder Schritt knarzte, jede Stufe krachte, und Florint wunderte sich, dass bislang niemand aus der Tür getreten war und ihn aufzuhalten versuchte. Als er sich im ersten Stock noch den großen Zeh an einer vorstehenden Scheuerleiste aufschlug, verfluchte er sich und seine Idee der Diebeshatz. Humpelnd stieg er weiter abwärts.
Erst an der Tür wurde ihm bewusst, dass er barfuß war. Seine Schuhe hätte er mitnehmen sollen! Florint wischte seinen Ärger beiseite und drückte den Eingang auf, der nur angelehnt war. Er trat auf die Steintreppe hinaus, und das Frühjahr biss mit frostigen Zähnen in seine Zehen.
Beinahe lautlos huschte er über den Hof, vermied die wenigen Stellen, an denen das Sternenlicht bis auf den Grund schien. Über ihm prangten die Plejaden. Kurz sah er zu ihnen empor. Mit dem Sommer würden sie unter den Horizont verschwinden und erst im Herbst wiederkehren. Doch für solche Überlegungen blieb keine Zeit. Er erreichte den Schuppen der Werkstatt von der Mauer her. Dort stahl sich Kerzenschein durch eine größere Ritze. Zuerst musste er sich vergewissern, wer sich in dem Raum aufhielt. Lautlos, um den Eindringling nicht zu warnen, glitt er näher und legte den Kopf an die Öffnung.
Florint überblickte nur einen schmalen Streifen des Innenraums. Niemand war zu sehen. Kein Geräusch drang von innen heraus. Allein das Flackern der Kerze ließ die Werkstatt lebendig erscheinen, als würden sich die Werkzeuge selbstständig bewegen. Florint presste ein Auge so dicht an den Spalt, dass ihm die scharfen Fugenkanten in die Haut stachen. Ein Scheppern ließ ihn zusammenzucken. Der metallische Klang kam bestimmt aus dem Rückraum, aus dem Anbau hinter der Werkstatt. Florint war versucht, seinen Platz zu verlassen und die Tür aufzureißen, um den Dieb zu überraschen, als eine Gestalt in sein Sichtfeld trat. Sie hielt einen Kasten in der Hand, dessen Innereien aus unzähligen Zahnrädern und Scheiben und Federwellen bestanden. Ein mechanischer Apparat, das sah Florint sofort, doch seine Funktion blieb ihm verborgen, denn der Dieb stellte sich so vor das Werk, dass er Florint die Sicht nahm. Nur seine rechte Hand hatte er kurz gesehen und eine schwärzliche Narbe, die sich am Gelenk zum Unterarm abzeichnete. Und dann geschah für Florint das Unfassbare: Der Eindringling setzte sich auf einen der Hocker, holte sich eine Schusterkugel, mit der man das Licht bündeln konnte, stellte sie vor die Kerze, griff sich Werkzeug aus dem Untertisch, eine Feile und einen feinen Schraubendreher, und begann an dem Werk zu arbeiten.
Ein Dieb, der ein mechanisches Instrument bearbeitete? Das war doch unmöglich.
Florint trat einen halben Schritt zurück. So wie der Mann saß, verdunkelte er beinahe den gesamten Raum. Nur die Hände des Eindringlings und die Mechanik selbst waren erleuchtet.
Er konnte die Gestalt nur schwer ausmachen. Ob er von der anderen Seite das Gesicht sehen konnte? Florint schlich um die Werkstatt herum. Er musste sich dort langsam durch eine tintene Schwärze vorantasten, um nicht über einen Gegenstand zu stolpern.
Vor der Eingangstür blieb er stehen und zögerte. Sollte er nicht einfach das Moment der Überraschung ausnützen, die Tür aufreißen, hineinstürmen und den Mann überwältigen? Ein ungutes Gefühl im Magen hielt ihn zurück. Der Kerl dort drinnen sah kräftig aus und war größer als er. Allein würde er verlieren. Er musste jemanden holen, mit dem zusammen er ihn überwältigen konnte.
Mit weit aufgerissenen Augen suchte er die gegenüberliegende Seite der Werkstatt nach einem Spalt ab, durch den Licht fiel, konnte jedoch keinen entdecken. Hatte der Kerl drinnen die Kerze gelöscht? Florint schalt sich einen Dummkopf, weil er nicht darauf geachtet hatte, was um ihn her geschah. Eine innere Glocke warnte ihn davor, auch nur einen Schritt weiter in die Finsternis auf dieser Seite der Werkstatt vorzudringen. Was hatte er sich nur dabei gedacht, hier allein auf Verbrecherjagd zu gehen? Barfuß obendrein, denn er fror erbärmlich an den Zehen. Mit Ohren so groß wie die Frachtschiffsegel der Rheinschiffer lauschte er in die Schwärze. Atmete dort nicht jemand? Hörte er nicht weiche Sohlen auf dem Kieselboden des Innenhofes umherhuschen? Florint getraute sich nicht, auch nur den Arm zu heben, aus Angst davor, er könne sich verraten.
So stand er eine ganze Weile regungslos, bis er sich wieder einen Verrückten und Närrischen schalt. Er bildete sich das alles nur ein. Wenn der Fremde aus der Werkstatt geschlüpft wäre, dann hätte er die Tür hören müssen. Er hatte sie jedoch nicht gehört. Es war nur die Stille und die Finsternis, die ihm Geräusche vorgaukelte, seinen Kopf mit Schreckbildern und Gruseligkeiten füllte.
Nur langsam gelang es ihm, wieder normal zu denken, normal zu hören. Der Mensch ist doch ein Tagwesen, dachte sich Florint und setzte wieder einen Fuß vor den anderen und versuchte, mit ausgestreckten Händen die Bretterwand zu erreichen.
Plötzlich griff er in Stoff. Ein erschrecktes Einatmen vernahm er, dann das Tappen von Füßen in weichen Ledersohlen. Im nachtschwarzen Dunkel hinter der Werkstatt war er auf den Eindringling gestoßen. Er hatte sich eben doch nicht geirrt.
Bevor Florint einen Laut ausstoßen konnte, fuhr ein Gegenstand auf seinen Schädel nieder. Er hörte es krachen, hörte sich aufstöhnen und fallen. Ein wenig christlicher Fluch folgte. Er vernahm, wie der Knüppel auf den Boden geworfen wurde und klang, wie trockenes Holz klang, das auf einen Steinboden fiel. Sein Gehör schien wegzuschwimmen, sein Kopf schmerzte beim Denken, der Verstand blockierte sich selbst. Einerseits wollte er schreien, andererseits ruhig daliegen und sterben. Dann umfing ihn eine tiefe Schwärze.
Kapitel 5
Es muss die Hölle sein, sonst würde mein Kopf nicht derart schmerzen, waren Florints erste Gedanken. Sanfte Hände fuhren ihm übers Gesicht und befeuchteten Wangen und Stirn. Er konnte sich auch irren, und dieser pochende Schädel war eine Strafe der Engel für seine Neugier. Im Grunde wollte er es gar nicht wissen, ob er in den Himmel auf- oder in die Hölle abgestiegen war. Vielmehr interessierte er sich dafür, was geschehen war, doch er konnte sich beim besten Willen an nichts erinnern.
Er musste eingeschlafen sein, denn als er wieder dem Schmerz hinter seiner Stirn nachspürte, fühlte er, dass er allein war. Jedenfalls rührte sich nichts um ihn herum. Florint wollte die Augen öffnen, doch allein diese Bewegung mochte ihm nicht gelingen. Für einen Augenblick schwappte eine Welle der Furcht über ihn hinweg, er könnte erblindet sein. Keuchend setzte er sich auf, spürte ein Stechen im Kopf, das ihn schwindeln ließ, und wäre beinahe zur Seite gekippt.
»Florint!«, hörte er eine Stimme sagen, die er zu kennen glaubte. »Florint, Ihr seid ein Tollpatsch ohnegleichen!«
»Katrin?«, fragte er voller Angst und Erwartung.
»Wer sonst?«, kam gedankenschnell die spöttische Antwort.
Florint ließ sich erleichtert in das Kissen zurücksinken. Keine Hölle, kein Himmel. Die Erde hatte ihn wieder. Es war tatsächlich die Stimme der Haustochter.
»Was ist … ich habe solche Schmerzen … was ist passiert?«